“ Erlebnisbericht von Gustav Rattay.”
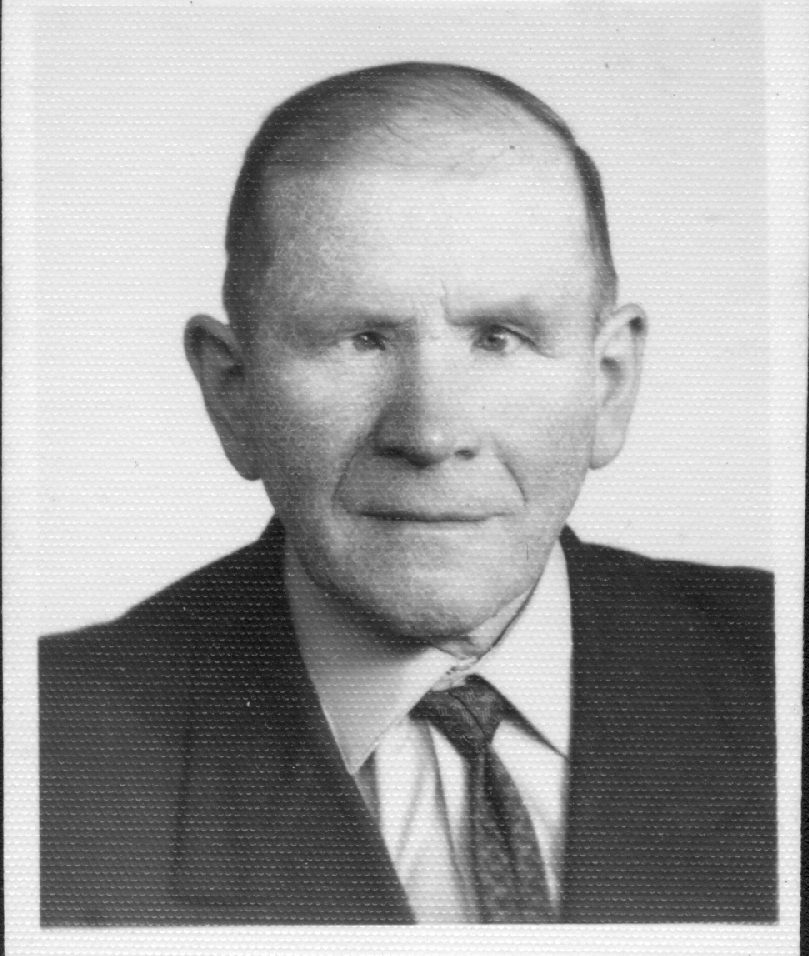
“Kurzfassung”
Zum besseren Verständniss möchte ich hier ein par erklärende Worte einfügen. Mein Vater Gustav
Rattay, ist gegen Ende des 19. Jahrhunderts in Rohmanen, Kreis Ortelsburg, in Ostpreußen, geboren. Seine Kindheit und
Jugend waren geprägt, durch Arbeit und Ehrfurcht gegenüber seinem Elternhaus. In seinem Verständnis waren
Erziehungsberechtigte; Eltern, Lehrer und andere Personen des öffentlichen Lebens Vorbilder, deren Anweisungen man zu
befolgen hatte. Seine Jugendzeit wurde durch den Ausbruch des Ersten
Weltkrieges jäh beendet.
Mit 16 Jahren wurde er zum Militär einberufen und nach seiner Ausbildungszeit an verschiedenen Frontabschnitten,
in Russland und Frankreich eingesetzt. Seine Begeisterung für König, Kaiser, Volk und Vaterland war im angeboren.
Noch in späteren Jahren schwärmte er oft von dieser Zeit, die ihn in Gedanken immer noch begeistern konnte.
Das Ende des 1. Weltkrieges erlebte er an der Westfront. Den Rückzug aus Frankreich bis Köln und dann weiter mit der
Bahn bis Ostpreußen, empfanden er und seine Kameraden als eine bittere Niederlage. Der Wiederaufbau nach dem 1.
Weltkrieg und die Umgestaltung des gesellschaftlichen Lebens, im nun vom Reich abgetrennten Ostpreußen, nahm seine
Aufmerksamkeit voll in Anspruch. Die Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum, lag ihm sehr am Herzen, was
in seiner Werbung für verschiedene Organisationen ihren Ausdruck fand.
Von der politischen Umgestaltung, in den 30ger Jahren, war er wenig begeistert, weil er als Teilnehmer des 1.
Weltkrieges, die Schrecken einer militärischen Auseinandersetzung am eigenen Leib erfahren hat. Dennoch hielt er es
für seine Pflicht, als erfahrener Frontsoldat, an den militärischen Übungen teilzunehmen.
Schon vor Anfang des 2. Weltkrieges war er einer der ersten, die eingezogen wurden. Seinen Fronteinsatz in Polen,
als Sanitätsunteroffizier, sowie andere Tätigkeiten im sanitären Bereich hat er unverletzt überstanden und ist nach
dem Rückzug aus dem polnischen Raum, über Schlesien, den Spreewald und den Raum südlich von Berlin, mit seiner Einheit,
bis zu Elbe zurückgewichen. In Grimma an der Mulde geriet er in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Nach seiner
Auslieferung an die Franzosen und einer, ein Jahr dauernden Gefangenschaft, wurde er in die sowjetische Besatzungszone
entlassen.
Aus dem Raum Magdeburg versuchte er seine Familie wieder zu finden und fand sie auch bei Rostock, an der Ostsee.
Sein Bestreben war es wieder eine Tätigkeit in der Landwirtschaft zu finden. 1947 ist er mit seiner Familie, auf
seinen Hof, nach Ostpreußen zurückgekehrt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, die seinen ganzen Einsatz erforderten,
ist es ihm im Laufe der Jahre gelungen, den, durch Kriegseinwirkungen und Plünderungen in der Nachkriegszeit,
verwahrlosten Hof wieder dem Vorkriegsniveau, anzunähern.
Als in den 60ger Jahren, die nach dem Krieg noch im südlichen Ostpreußen verblieben Deutschen, die Ausreise in die
Bundesrepublik Deutschland anstrebten, hielt es auch mein Vater, für angebracht, diesem Trend zu folgen. Er, der viele
Jahrzehnte, vom deutschen Geistesleben geprägt wurde, und seinem Vaterland, in guten wie in schlechten Zeiten, immer
die Treue hielt, war davon überzeugt das sein weiteres Leben, nur in der Bundesrepublik Deutschland einen Sinn haben
konnte.
1969 sind auch wir, für immer, in die Bundesrepublik Deutschland ausgereist. Über Friedland, Unna-Massen, kamen wir
am 11.12.1969 nach Velbert im Rheinland. Hier verbrachten wir die ersten fünf Jahre im Westen. Mein Vater der ein
ausgeprägtes Gedächtnis hatte, begann damit, seine Erlebnisse aufzuschreiben. Bis zu seinem Tod, am 21.12.1983, hatte
er sein Wissen auf vielen Seiten niedergeschrieben. Ich habe seine Aufzeichnungen geordnet und elektronisch erfasst,
damit diese wertvollen Erinnerungen an Rohmanen und an unsere ostpreußische Heimat, nicht verloren gehen.
Kurt Rattay
“ Geboren und aufgewachsen in Ostpreußen.”
Meine ersten Schritte

Ich bin am 7.2.1898 in Rohmanen Kreis Ortelsburg geboren. Meine Eltern hatten eine Landwirtschaft von 14,34
Hektar(Erbhof). Mein Vater ist in Jellinowen(Gellen) Kreis Ortelsburg geboren. Seit dem 18. Lebensjahr arbeitete er
als Bergmann in Westfalen. Auf der Zeche „Unser Fritz” verdiente er sein Geld unter Tage. Mit 24 Jahren kehrte er nach
Ostpreußen zurück. Seine Eltern wollten im den Hof in Jellinowen übergeben. Da er jedoch Schwierigkeiten hatte, im
Umgang mit seiner Stiefmutter, verzichtete er auf dieses Angebot. Da mein Vater durch seine Arbeit im Kohlenbergwerk
etwas Geld gespart hatte, versuchte er wo anders Fuß zu fassen. Seine Wahl fiel auf Rohmanen im Kreis Ortelsburg. Hier
heiratete er die Tochter des Landwirts Adam Slopianka.
Mein Großvater mütterlicherseits hatte nur Schulland gepachtet, dass er mit zwei Ochsen bearbeitet hat. Mit dem Geld,
das mein Vater im Kohlenbergbau, in Westfahlen verdient hat, konnte er Land dazukaufen und dadurch auch den Hof
vergrößern. Bis zu meiner Einschulung wurde ich im Elternhaus erzogen. Vom 6. bis zum 14. Lebensjahr habe ich die, in
drei Klassen eingeteilte Volksschule in Rohmanen besucht. Wir wurden in der Schule streng erzogen und man versuchte
uns alles beizubringen damit wir so gut wie möglich durchs Leben kommen würden.
Die Hauptschullehrer Reinhard, Puzicha, und Schürmann waren unsere Klassenlehrer. Wir bekamen dann den Hauptlehrer
Müller und die Klassenlehrer Willimzik und Maleyka. Hauptlehrer Müller war von Osterode nach Rohmanen gekommen. Zur
Rohmaner Schule gehörten 110 Morgen Land. Hauptlehrer Müller hatte alles bearbeitet. Auf seinem Hof arbeiteten 2
Knechte und 2 Mägde. Er hatte 4 Pferde, Rinder und eine Schweinezucht. Auch eine neue Scheune wurde in seiner Amtszeit
auf dem Schulhof errichtet. Lehrer Müller demonstrierte den Rohmaner Bauern wie man unter Verwendung von Kunstdünger
und fachgerechter Bodenbearbeitung die Erträge aus der Landwirtschaft erheblich steigern kann. Im August 1914 wurde
Lehrer Müller zusammen mit seinem Sohn Alfred und Karl Deptolla von den Russen erschossen.
Rohmanen vor dem Ersten Weltkrieg
Rohmanen ist von der Kreisstadt Ortelsburg 3 Kilometer entfernt und liegt an der Landstraße von Ortelsburg über
Kobulten nach Bischofsburg. Wegen der Nähe zur Kreisstadt wurde schon darauf geachtet, dass alles ordentlich und
sauber war. Die Zäune, an der Straßenseite, wurden, bei Bedarf immer ausgebessert und jeden Sonnabend musste die
Straße gefegt werden. Der Landjägermeister kam am Sonntag zu Pferde geritten und hat nachgesehen ob jeder seine
Pflicht getan hat. Hatte jemand vergessen die Straße zu fegen, kostete ihn das 5 Reichsmark Strafe, was zu jener Zeit
viel Geld war. Wenn er dann vor dem Gasthof anhielt, kam Frl. Trzaska mit einem Tablett heraus, auf dem sich eine
Zigarre, ein Gläschen Kognak und auch 2 Stück Würfelzucker fürs Pferd, befanden. Er nahm alles entgegen ohne vom Pferd
zu steigen und ritt dann ins nächste Dorf weiter.
Die Rohmaner Feldmark erstreckte sich etwa über 1500 Hektar. Das Dorf bestand aus etwa 80 Höfen; die Abbauten und
nicht landwirtschaftlichen Gebäude mitgerechnet. Sechs Abbauten sind nach dem zweiten Weltkrieg, teils durch
Fronteinwirkungen, teils durch Vandalismus, unwiederbringlich verloren gegangen. Auf einen Teil der Rohmaner Felder
erstreckt sich auch der Dammerauer Höhenzug. Die höchste Erhebung von 210 Meter über dem Meeresspiegel, befindet sich
auf dem Feld von Friedrich Glinka. Da ist auch ein vierkantiger Granitstein eingegraben, der als Navigtionspunkt, zur
Erstellung von Kartenmaterial, genutzt wurde. Diese Stelle war mit einer Holzpyramide gekennzeichnet und diente auch
bei Truppenmanövern als Orientierungspunkt.
Im Bereich der Rohmaner Gemarkung befinden sich so gut wie keine Wiesen. Die Rohmaner Wiesen liegen etwa 10 Kilometer
entfernt; bei der Försterei Wickno, in Schodmak, in Seedanzig und in Neu Schiemanen. Kurz vor dem zweiten Weltkrieg,
haben Herr Biella und Friedrich Trzaska sich schon mit der staatlichen Forstverwaltung, darauf geeinigt, die Wiesen in
Neu Schiemanen gegen näher gelegene zu tauschen. Die neuen Wiesen liegen vor dem Waldpuschsee und befinden sich im
Besitz der staatlichen Forste. Obwohl die eingetauschte Fläche schon neu vermessen wurde und genutzt werden konnte,
wurde sie leider vom Katasteramt, noch nicht ins Grundbuch eingetragen. Auf Grund dieser Tatsache, wurde dieser
Tausch, nach dem Krieg, von den polnischen Behörden, nicht anerkannt.

In der Mitte des Dorfes befindet sich ein, 5 Morgen großer Teich, der den Bauern als Viehtränke diente und Enten sowie
Gänse zum verweilen einlud. Es wurde dort auch Löschwasser entnommen, wenn es im Dorf brannte. Im Teich waren auch
verschiedene Fische, die der Fischer Adam Glitza, in jedem Frühjahr neu eingesetzt hat. Die Fische sind wegen des
vielen Schlammes, der den Boden bedeckte, oft erstickt sind. Aus Richtung Ortelsburg kommend, liegt 50 Meter vor dem
Dorfeingang, zur rechten Hand, ein Soldatenfriedhof. Auf ihm haben die Gefallenen des 1.Weltkrieges, Deutsche und
Russen, ihre letzte Ruhe gefunden. Von der Landstraße kommend muss man einige Stufen hinaufsteigen, die von beiden
Seiten mit Birken bepflanzt sind.
Auf einer kleinen Anhöhe befindet sich die aus zwei Klassenräumen bestehende Dorfschule, mit einer Wohnung für den
Lehrer. Die Schule wurde 1906, mit tatkräftiger Unterstützung aller Dorfbewohner, aus gebrannten Lehmziegeln, gebaut.
Auf der Anhöhe, vor der Schule sind später Kastanienbäume gepflanzt worden, die den Schulkindern, an heißen Tagen
Schatten spendeten.
Die älteste Familie in Rohmanen war die Familie Friedrich Biella. Wie ich mich noch erinnern kann war sein Vater
Gemeindevorsteher. Nach seinem Tode hat das Amt sein Sohn Friedrich übernommen bis er 1914 als Unteroffizier in den
ersten Weltkrieg einrücken musste. Friedrich Biella hat aktiv bei der Garde in Berlin gedient. Bei den Wahlen und bei
der Abstimmung 1920 hat er sich sehr für den Erhalt des Deutschtums eingesetzt. Er hat auch im Jahr 1896, die
Freiwillige Feuerwehr in Rohmanen ins Leben gerufen und war zugleich ihr erster Brandmeister. Bei der Genossenschaft
und bei der Darlehenskasse war er im Vorstand. Dadurch war es ihm möglich die Rohmaner Bauern mit Krediten und
Kunstdüngern zu versorgen. Die Söhne Fritz und Wilhelm hat er aufs Gymnasium nach Ortelsburg geschickt und studieren
lassen. Bei Bauernversammlungen hat uns Fritz Biella Vorträge gehalten.
Eine weitere Familie war die des Gasthofbesitzers Friedrich Trzaska. Der Hof von Friedrich Trzaska war der älteste in
Rohmanen. Wenn die Bauern aus weiter gelegenen Dörfern, vom Wochenmarkt nach Hause fuhren, hielten sie oft an der
Gaswirtschaft an. Die Pferde, sowie die auf dem Markt eingekauften Rinder wurden dann, an einem vor dem Haus
angebrachten Querbalken festgebunden und die Besitzer machten es sich in der Gaststube gemütlich. Zwei große
Kastanienbäume standen zu beiden Seiten der Eingangstreppe und weiter rechts war ein großes Fenster, in dem, die im
Geschäft vorrätigen Artikel, ausgestellt waren; besonders zur Weihnachtszeit. Die Kinder drückten sich an der Scheibe
die Nase platt, um die vielen schönen Sachen, die sich die meisten Dorfbewohner nicht leisten konnten, wenigstens aus
der Nähe zu bestaunen.
In der Gaststube wurde Korn, sowie auch guter Bärenfang ausgeschenkt, und wenn es den Gästen gut geschmeckt hat, haben
sie es lange ausgehalten, so das für eine weitere Rast, in einem der nächsten Dörfer keine Zeit mehr übrig blieb. Die
alten Bauern erzählten auch; das es in ganz Ortelsburg, keinen so guten Schnupftabak gab, wie im Gasthof Trzaska. Zu
diesem Grundstück gehörte einst auch der Rohmaner See. Weil dafür keine Steuern gezahlt wurden hat sich der Besitzer
von Gut Frenzken den See angeeignet.
Als Königsberg zur Festung ausgebaut wurde, haben viele Männer dort Arbeit gefunden. Zu dieser Zeit war an eine
Beschäftigung im Kohlenbergbau, in Westfalen, noch nicht zu denken. Weil auch noch keine Eisenbahnlinie vorhanden war,
mussten sie den weiten Weg zu Fuß zurücklegen. Nachdem sie den ganzen Tag marschiert sind, haben sie in der Nacht ein
Feuer angezündet, eine Malzeit zubereitet und in der Nähe des Feuers, das sie vor wilden Tieren schützen sollte,
übernachtet. Die Reise nach Königsberg hat eine ganze Woche gedauert. Sie wurden dort zum Aufschütten der
Festungswälle eingesetzt.
Das Jahr 1914 wurde zum Schicksalsjahr, für Ostpreußen und seine Bevölkerung. Nach Abschluß der Volksschule im Jahr
1912, habe ich in den Wintermonaten einen Fortbildungslehrgang für die Landwirtschaft besucht, den Hauptlehrer Aaron,
der aus Olschienen nach Rohmanen versetzt wurde, für uns organisiert hatte. Da im Dorf 2 Trompeten vorhanden waren,
hatte er uns nahe gelegt eine Kapelle zu gründen, dann könnten wir ja die Soldaten, die aus dem Krieg heimkehren
würden mit Musik empfangen. Zum Abschluss konnte man sich ein Buch oder ein Obstbäumchen wünschen. Eine Woche vor dem
Einmarsch der Russen, haben wir noch mit einem Breitdrescher, der durch ein Rosswerk dass von 6 Pferden angetrieben
wurde 110 Zentner Roggen gedroschen. Der Lehrer Malayka hat sich 1914 freiwillig zum Militär gemeldet. 1915 hat er uns
als Offiziersanwärter besucht. Im Frühjahr 1916 wurde mein Jahrgang gemustert und im Herbst 1916 wurden wir eingezogen.
Ausbruch des Ersten Weltkrieges
Am 2. August 1914 wurde die Allgemeine Mobilmachung ausgerufen. Alle wehrfähigen Männer folgten
dem Ruf des Kaisers und eilten zu den zuständigen Wehrmeldeämtern um die Grenzen des Vaterlandes zu schützen. Wir als
Grenzbewohner bekamen das Meiste zu spüren. Alle Häuser, Scheunen und Ställe waren mit Soldaten und ihrem Tross belegt.
Die Einen gingen, die Anderen kamen. Die Kosaken hatten bei Muschaken und Radzinen die Grenze überschritten. Der
Flüchtlingsstrom hatte sich von der Grenze her angestaut. Die Russen haben überall geplündert. Die Trosse mussten sich
zurückziehen und haben dazu vorwiegend die Feldwege benutzt. Die Pferde waren erschöpft. In einer Nacht kam der
Gemeindevorsteher mit einem deutschen Offizier auf unseren Hof. Mein Vater und der Nachbar Wilhelm Dorka mussten mit
ihren Pferden aushelfen. Sie waren 2 Tage unterwegs, bis zu einem Gut in Kleeberg bei Allenstein. Als sie dann wieder
nach Hause kamen waren die Russen schon am Rohmaner Friedhof. In der Zwischenzeit hatten wir schon den Leiterwagen mit
Mehl, Rauchfleisch und Betten beladen.
Der überwiegende Teil der Rohmaner war schon losgefahren. Der Hauptlehrer Müller kam noch mit dem Fahrrad vorbei und
sagte es wäre höchste Zeit das wir wegkämen weil die Russen schon Ortelsburg besetzt hätten und im Anmarsch auf
Rohmanen wären. Wir sind auf eine Anhöhe gestiegen und haben die Staubwolken beobachtet, aber wir dachten es wäre
deutsches Militär.
Auf der Flucht vor den Russen
Kurz vor Sonnenuntergang haben wir die Pferde vor den fertig gepackten Wagen gespannt und sind
sofort losgefahren. Mein Bruder und ich nahmen 4 Milchkühe und die beste Sterke mit und gingen hinterher. Schweine,
Kälber und Geflügel haben wir aus den Ställen getrieben. Wir waren die ganze Nacht unterwegs und sind bis Rheinswein
gekommen. Da hatten wir einen Onkel wohnen, bei dem haben wir den ganzen Tag verbracht.
Unterwegs haben wir einen Mann getroffen, der erzählte uns dass die Russen bei Groß Jerutten einen Personenzug
überrumpelt haben. Sie hatten aus Eisenbahnschwellen eine Sperre auf den Schienen errichtet und somit den Zug zum
Anhalten gezwungen. Die Russen haben den Zug mit Artillerie beschossen. Als die Soldaten und Zivilisten den Zug
verlassen wollten kamen die Kosaken zu Pferde und haben ein Massaker angerichtet. Nur wer sich am Boden davon
schleichen konnte hat überlebt. Die Russen wurden durch einen Verräter darüber informiert das auf diesem Gleis ein
Zug unterwegs war und waren darauf vorbereitet. Unserem Informanten ist es auch gelungen dem Massaker zu entkommen.
Ein Kosake hatte ihm im beim vorbeireiten mit dem Säbel ein Ohr abgehauen und ihn dadurch zu Boden geschlagen. Es ist
ihm danach gelungen ins Gebüsch zu schleichen. Sein Kopf war schon verbunden als wir ihn trafen. Später wurde an der
Stelle des Überfalls ein Gedächtnisstein errichtet.
Im Morgengrauen sah man viele Kosaken über die Felder reiten. Wir sind dann später wieder weiter in Richtung
Jellinowen gefahren. Unser Vater ist mit dem Pferdewagen die Landstraße entlang gefahren. Wir mit dem Vieh sind
entlang einer tiefen Schlucht durch den Wald bis zum Babanter See gegangen. Wir hatten schon vorher versucht die
Schlucht zu verlassen aber wegen der steilen Hänge ist es uns leider nicht gelungen. Am See angekommen fanden wir drei
große Schober mit Getreide vor. Von einem dieser Schober haben uns zwei Kosaken mit einem Fernglas beobachtet. Sie
schwangen sich auf ihre Pferde und kamen uns entgegen geritten, dann hielten sie uns ihre Lanzen vor die Brust und
versuchten uns auszufragen. Wir haben leider nichts verstanden und fingen an zu weinen. Plötzlich pfiff der
Patrollienführer auf einer Trillerpfeife und die Kosaken kehrten zu ihrem Ausgangspunkt zurück.
Als wir dann weiter am See entlang gingen sahen wir von weitem drei Gehöfte. In der Nähe einer dieser Höfe hatte unser
Vater den Pferdewagen im Gestrüpp abgestellt. Die vorrückenden Schützenlinien der russischen Infanterie hatten ihn
jedoch entdeckt. Sie haben den Wagen durchwühlt und den Sack mit Rauchfleisch mitgenommen. Andere Flüchtlingswagen die
in diesem Gebüsch Schutz gesucht haben sind nicht besser davon gekommen. Wir haben das Vieh auf einen der Höfe
getrieben und am Zaun festgebunden. Dann haben wir mit Hilfe einer Leiter den Heuboden erklommen und uns dort versteckt.
Als die Kosaken auf dem Hof erschienen verlangten sie Brot und Milch. Die Frauen mussten zuerst essen und trinken,
danach haben es die Russen auch getan, sie fürchteten sich davor, dass man sie vergiften könnte. Später kam dann die
russische Infanterie und hat Haus, Scheune und Schuppen durchsucht. Die Falltüre zum Heuboden ließ sich nur nach oben
hin öffnen. Wir hatten die Türe von oben mit schweren Gegenständen beschwert, aber die Russen versuchten mit aller
Gewalt auf den Heuboden zukommen. Als die Frauen das sahen, sagten sie zu den Russen, da oben würden sich ihre Kinder
versteckt halten. Die Russen forderten nun, die Kinder sollten sofort den Heuboden verlassen. Die Mütter riefen nun
nach ihren Kindern die dann auch tatsächlich den Heuboden verließen. Als wir das sahen, haben wir uns am Giebel tief
im Heu vergraben. Drei Russen kamen nun rauf und stocherten mit ihren Bajonetten im Heu herum. Glücklicherweise kamen
sie nicht in unsere Nähe. Als die Russen den Heuboden verließen haben wir befürchtet sie würden ihn in Brand setzen.
Wahrscheinlich taten sie deshalb nicht weil so viele russische Soldaten auf dem Hof waren. Einige Zeit später
erschienen russische Offiziere auf dem Hof, mit einem Auto. Sie sagten, sie hätten das Land erobert und wir hätten ab
sofort dem russischen Zaren zu gehorchen. Wir wurden angewiwsen nach Hause fahren und unbesorgt unsere Ernte
einzubringen. Sie haben uns auch eine Bescheinigung ausgestellt, damit uns auf dem Heimweg niemand die Pferde und
das Vieh wegnehmen würde.
Erst am nächsten Morgen, als die Front weiter vorgerückt war, beschlossen wir die Heimreise anzutreten. Die Straßen
waren mit vorrückenden russischen Truppen blockiert. Manchmal mussten wir stundenlang am Wegesrand warten bis die
Soldaten mit ihrem Tross vorbeigezogen waren. Unterwegs wollten sie unser Vieh zum Schlachten wegnehmen, aber die
Bescheinigung hat uns davor bewahrt. Die Eisenbahnbrücke vor Neu-Keykuth wurde von Kavallerie bewacht. Die wollten uns
nicht drüber lassen und hielten uns bis zum frühen Morgen fest. Zurück in Rohmanen angekommen, konnten wir unser Haus
nicht betreten weil der Hof und alles rundherum ein großes Militärlager war.
Wir sind dann in Richtung Seelonken gefahren, bis Abbau Brosch. Auf dem Hof angekommen haben wir zuerst Grünfutter für
die Pferde vom Feld geholt und anschließend Mittag für uns selbst gekocht. Die Nacht haben wir erstmal auf dem Hof
verbracht. Am nächsten Morgen wagten wir es ins Dorf zu gehen um die Lage zu erkunden. Die Russen waren schon wieder
weiter gezogen, aber Haus und Hof waren in einem schrecklichen Zustand. Wir sind dann gegen Abend wieder nach Hause
zurückgekehrt.
Am 23. August 1914 waren die Russen bei uns eingebrochen, bis sie am 28. August von den Deutschen zurückgeschlagen
wurden. Dann fuhren sie wieder zurück, drei Wagen nebeneinander. Ortelsburg brannte lichterloh. Ein Wagen mit Mehl war
uns gegenüber in den Straßengraben gekippt, aber wir haben nichts davon genommen, weil man ja nicht wusste ob man die
Nacht überleben würde. Wir saßen die ganze Zeit im Keller. Am nächsten Morgen zog dann russische Kavallerie und
Infanterie durch unser Dorf. Die Kavallerie ritt orientierungslos hin und her. Die Infanterie hat den ganzen
Vormittag 1,5 Meter tiefe Schützengräben ausgehoben. Um 11 Uhr kamen aus Richtung Eichtal 3 deutsche Spähwagen nicht
ahnend dass die nördliche Hälfte des Dorfes noch von Russen besetzt war. Wir haben zu diesem Zeitpunkt auf dem
Dachboden Weizen eingesackt und hatten aus diesem Grunde einen weiten Rundblick.
Um 11 Uhr kamen aus Richtung Eichtal drei deutsche Spähwagen angefahren. Als wir die deutschen Soldaten erkannt hatten,
haben wir sie durch Handzeichen gewarnt weiter nach Norden vorzustoßen. Die Kosaken hatten sich auf den Häuserdächern
positioniert und in Richtung Norden nach deutschen Truppen Ausschau gehalten. Die Deutschen sprangen von den Spähwagen
und fingen an die nichts ahnenden Russen zu beschießen. Als die sich ihrer gefährlichen Lage bewusst wurden verließen
sie ihre Aussichtsposten und bestiegen ihre Pferde. Mit Peitschenhieben versuchten sie, die sich in panikartiger Flucht
befindliche Infanterie dazu zu Bewegen, die Deutschen anzugreifen. Zwei Spähwagen wendeten sofort, der Dritte konnte
nicht mehr umkehren. Es gelang allen, bis auf den Fahrer des dritten Wagens die Flucht. Die Russen nahmen ihn sofort
unter Beschuss, doch es gelang ihm über unseren Hof zu entkommen. Auf der rückwärtigen Seite schlug er sich quer durch
die Gärten bis zum Gehöft von Friedrich Sakowski durch. Der versteckte ihn im Keller und versorgte ihn anschließend
mit Zivilkleidung.
Als die Russen den Soldaten auf unseren Hof laufen sahen nahmen sie sofort die Verfolgung auf. Sie durchstöberten auch
die Nachbarhäuser und trieben die Bewohner auf der Straße zusammen. An der Spritzenwagenremise richteten sie einen
Sammelpunkt ein. Unter dem Vorwand es würde hier eine Schlacht stattfinden, versuchten die Russen die Zivilbevölkerung
aus dem Dorf zu drängen. Alle die dem Aufruf gefolgt sind und an unserer Sammelstelle vorbeikamen wurden unserem Haufen
hinzugefügt. Unter ihnen befand sich auch der deutsche Soldat in Zivilkleidung. Er hatte einen Sack über die Schulter
geschlagen in dem sich ein Brot befand, an der anderen Hand führte er eine Kuh am Strick. Als unser Haufen schon aus
etwa 50 Leuten bestand setzten uns die Russen mit Marschrichtung Seelonken in Bewegung. Wir Jungen versuchten in einem
unbeaufsichtigten Moment wegzulaufen, doch die Begleitmanschaft prügelte uns mit Gewehrkolben wieder in Reihe und Glied.
Unterwegs gelang es dem Soldaten mit der Kuh unbemerkt zu entkommen. Er kehrte unbehelligt ins Dorf zurück und lieferte
die Kuh wieder dort ab wo er sie entführt hatte.
Uns haben die Russen an Seelonken vorbei zum Sylvensee getrieben. Wenn sie von vorbeiziehenden russischen Offizieren
gefragt wurden weshalb wir unterwegs wären, sagten sie denen wir hätten deutsche Soldaten versteckt und wollten das
Versteck nicht verraten. Als wir am See vorbei waren begann die deutsche Artillerie aus Richtung Ortelsburg zu
schießen. Unweit von uns explodierten Granaten und richten ein großes Chaos unter Freund und Feind an. Es hieß dann
rette sich wer kann. Die Russen verließen uns in Richtung Waldpuschsee und wir kehrten orientierungslos nach Seelonken
zurück. Nach Rohmanen konnten wir nicht zurück weil die deutsche Artillerie aus Richtung Eichtal anfing unser Dorf zu
beschießen. Schließlich sind wir auf dem Abbau Brosch untergekommen. Ein durch Granatsplitter schwer verletzter Russe
suchte dort auch Zuflucht. er versucht sich mit einem Messer das Leben zu nehmen. es gelang den Frauen ihn davon
abzubringen, weil sonst bei einem etwaigen erscheinen von russischen Soldaten der Verdacht auf uns gefallen wäre.
Später erschienen tatsächlich Kosaken die ihn dann mitgenommen haben. Ihnen folgten in 50 Meter Entfernung Deutsche
Ulanen, die hinter den Russen in einem in der Nähe liegenden Wäldchen verschwanden.
Nachdem die Russen Rohmanen besetzt hatten, versteckten sie sich vorwiegend in mit Stroh gedeckten Gebäuden. Durch
Schießscharten, die sie im Strohdach anlegten, schossen sie auf die deutschen Kampfverbände, die sie wieder vertreiben
wollten. Um die Angreifer zu entlasten, wunde das Dorf von deutscher Seite unter Beschuss genommen. Durch die
Geschosse der deutschen Artillerie entstanden in Rohmanen viele Brände. Die mit Stroh gedeckten Gebäude fielen zuerst
in Schutt und Asche. Unser Vater hatte uns ins Dorf geschickt, damit wir das Vieh im Stall von der Kette losbinden
sollten. Am Dorfrand kamen uns schon deutsche Ulanen und Husaren entgegen. Rohmanen brannte an mehreren Stellen. Unser
Hof war noch unversehrt, nur die Zäune standen schon in Flammen. Wir haben das Vieh los gebunden und anschließend
versucht die Brandherde rund herum zu löschen. Es gelang uns die Flammen von unserem Hof fernzuhalten und auch bei
unserem Nachbarn einzugreifen. In vielen Scheunen und Ställen hatten sich noch viele versprengte Russen versteckt. Die
wurden anschließend von deutschen Soldaten eingesammelt und in Gefangenenlager abgeführt. Am nächste Tag haben wir dann
zerbrochene Gewehre und Munition in Körbe gesammelt und im Dorfteich versenkt.
Am 29. August haben die Russen Rohmanen verlassen, doch schon am 30. August sind sie wieder zurückgekehrt. Hauptlehrer
Müller wurde mit seinem Sohn und Karl Deptolla auf Fahrrädern fahrend von einer russischen Patrouille aufgegriffen.
Sie wurden von den Russen der Spionage verdächtigt weil der Lehrer Müller ein Fernglas bei sich trug. Der Sohn hatte
eine Gymnasiastenmütze und eine Landkarte bei sich. Sie wurden in Richtung Lehmanen abgeführt. Auf einer Anhöhe des
Grundstücks von Ernst Chittka befand sich eine nicht mehr betriebstaugliche Windmühle. Dort soll ein russisches
Kriegsgericht sie zum Tode verurteilt haben. Nach der Hinrichtung wurden sie in der Nähe der Windmühle verscharrt.
Später wurden sie wieder ausgegraben, in Särge gelegt und auf dem Rohmaner Friedhof beigesetzt. Die Ehefrau von Lehrer
Müller hat die Gräber nach dem 1. Weltkrieg mit einem schmiedeeisernen Zaun umrandet.
Die Kämpfe um Rohmanen haben viele Menschenopfer gekostet. Bei uns hinter der Scheune lagen 2 tote Russen und ein
Verwundeter. Die Toten haben wir in einer Kartoffelmiete vergraben. Alle anderen Gefallenen wurden auch gleich an der
Stelle an der sie zu Tode kamen verscharrt und mit einem Kreuz gekennzeichnet. Für die im Raum Rohmanen gefallenen
Russen wurde nach dem Krieg hinterm Dorf, in Richtung Ortelsburg, auf einer Anhöhe ein Heldenfriedhof angelegt. Dort
liegen 20 Soldaten und 1 Offizier. In der Mitte befindet sich ein Trauerbaum und Birken säumen den Zugang von der
Landstraße her. Der Lehrer Dorka hat nach dem Kriege, mit seinen Schülern immer die Gräber gepflegt.
Meine Einberufung zum Militär

Bis zu meinem 17. Lebensjahr habe ich meinem Vater in der Landwirtschaft geholfen. Im Frühjahr
1916 wurde unser Jahrgang gemustert. Im Herbst 1916 erhielten Gustav Spektor, Johann Resonek und ich einen
Einberufungsbescheid. Wir mussten uns in Allenstein im Kaisergarten melden. Dort wurden Rekruten aus mehreren
Landkreisen zusammen gezogen und danach verschiedenen Ausbildungszentren zugeteilt. Wir Rohmaner kamen zum 18.
Infanterie-Regiment nach Osterode. Ein Unteroffizier mit einer Gruppe Musketiere haben uns von Allenstein abgeholt.
Als wir in der Kaserne ankamen haben wir sofort Mittagessen in Blechnäpfen bekommen. Untergebracht wurden wir im
Dachgeschoß der Kaserne. Es waren keine Betten vorhanden, nur Strohsäcke lagen auf dem Boden.
Als dann einige Tage später ausgebildete Kompanien an die Front ausrückten durften wir in einen anderen Block umziehen.
Wir wurden der Größe nach aufgestellt, in Korporalschaften eingeteilt und dann von Kopf bis Fuß eingekleidet. Die
Ausgehuniformen hatten blanke Knöpfe dazu einen Schako mit blanker Spitze. Im neuen Block hatten wir 2stöckige Betten.
Unsere Zivilbekleidung mussten wir in einen Karton verpacken und nach Hause schicken. Dann erst begann das eigentliche
Kasernenleben. Die Kaserne durfte niemand ohne Erlaubnis verlassen, nur in Begleitung eines Unteroffiziers. In der
Kaserne war eine Kantine in der man alles kaufen konnte was in der Kaserne gebraucht wurde.
Am nächsten Tag kam unser Kompanieführer, im Range eines Hauptmanns, zu Pferde angeritten. Er begrüßte uns mit;
Guten Morgen Kameraden, wir antworteten ihm mit; Guten Morgen Herr Hauptmann. Er hat dann die Front abgeschritten und
jeder musste sich mit seinem Namen vorstellen. Um 5 Uhr wurde geweckt, 6 Uhr Kaffee holen, 7-8 Uhr Unterricht, 8-11
Uhr exerzieren auf dem Kasernenhof. Um 11.30 blies der Trompeter zur Mittagspause. Die erste Zeit war noch alles
ziemlich gemütlich aber dann wurde es von Tag zu Tag strenger. Um 10 Uhr abends war Zapfenstreich, dann ging der
Unteroffizier vom Dienst von Stube zu Stube, der Stubenälteste musste die Anwesenheit aller Rekruten melden; zum
Beispiel: Stube 56 belegt mit 14 Mann, alle zu Haus. Wir mussten in 2 Reihen antreten, mit Drillichanzug bekleidet
und in Pantoffeln, ein tadelloses Aussehen präsentieren. Der Diensthabende Unteroffizier prüfte ob alle
vorschriftsmäßig angezogen, gewaschen, gekämmt und ob alle Knöpfe an der Jacke geschlossen waren. Als er bei einem
Rekruten einen offenen Knopf erspähte, hat er uns gefragt, ob jemand ein Taschenmesser bei sich hat.
Wir ahnten nicht Gutes, darum haben wir uns ganz still verhalten und nichts gesagt. Da sagte der U.v.D. plötzlich:
”Wenn niemand von euch ein Messer bei sich hat, dann habe ich ein”. Er zog sein Messer aus der Tasche und fing an, bei
dem Rekruten die Knöpfe abzuschneiden. Als die Knöpfe zu Boden purzelten, brachen wir in lautes Gelächter aus. Das hat
ihn so in Rage gebracht, das unser unwürdiges Benehmen, zuerst mit einem „Donnerwetter” bestraft wurde. Dann schrie
er: ”In den Korridor marsch, marsch, die Treppen runter bis auf den Hof”. Als wir unten angekommen waren hieß es
wieder; "Zurück auf die Stube in der 3. Etage”. Jemand hat mir bei dem Durcheinander, von hinten in den Pantoffel
getreten, so das er auseinander gerissen wurde. Ich bin dann nur mit einem Pantoffel und einem Socken die Treppen rauf
und runter gelaufen. So wurden wir 3-mal hinunter und wieder hinauf gejagt.
Danach ließ er uns wieder antreten und hat mit einer Taschenlampe unter den Betten geleuchtet. Plötzlich schrie er
wieder los: "Das nennt ihr Fegen? wenn ihr mit dem Besen nicht fegen könnt, dann mühst ihr das mit eueren Bäuchen tun.
Marsch, marsch unter die Betten” . Als wir schon alle am Schlafen waren, kam der U.v.D. wieder und hat nachgesehen ob
alle Schränke abgeschlossen waren. Ein Kamerad hatte seinen Schlüssel verloren, deshalb hat er das Schoß nur so
eingehängt. Als der U.v.D. das bemerkte hat er die Türe aufgerissen, die ganzen Sachen aus dem Schrank, quer durch die
Stube verteilt und war dann endlich gegangen.
Die Anziehsachen mussten, fein sauber gefaltet, auf dem Stuhl liegen; da drauf die Socken und die Pantoffeln unter dem
Stuhl. Die Stühle mussten in einer Reihe ausgerichtet sein; die Hosenträger im Schrank einschlossen und der Brustbeutel
mit Geld auf dem Hals tragen werden. Morgens wurden wir geweckt und kamen zuerst in den Waschraum. Jeder musste seinen
entblößten Oberkörper mit kaltem Wasser abreiben. Da draußen strenger Frost herrschte war es im Waschraum auch sehr
kalt, so das manche ihr Hemd anbehielten. Der UvD hat dann bei seinem Kontrollgang alle Verweigerer aufgeschrieben
und ihnen befohlen in 30 Minuten mit einem Besen in der Hand auf der Schreibstube zu erscheinen. Einige mussten den
Kasernenhof fegen, andere die zugefrorenen Latrinen enteisen und reinigen. Während unserer Ausbildungszeit durften wir
die Kaserne nicht verlassen. Wenn man Stuben- oder Frühdienst hatte, blieb keine Zeit zum Frühstücken.
Nach 6 Wochen wurden wir in der Grollmann Kaserne vereidigt. Die Regimentskapelle spielte "Heil dir im Siegerkranz",
danach folgten 3 Strophen des Deutschlandliedes. Vor der Vereidigung wurden die Rekruten gefragt wer keine deutsche
Staatsangehörigkeit besitzt. Es sind dann Luxemburger und auch noch welche aus anderen Ländern hervorgetreten. Sie
wurden gefragt ob sie die deutsche Staatsangehörigkeit annehmen wollen. Die das abgelehnt haben wurden auf die
Schreibstube gerufen und sofort aus dem Militärdienst entlassen. Nach der Vereidigung erfolgte ein Kirchgang, danach
konnte man einen Stadturlaub beantragen. Nach dem Mittagessen mussten alle, die einen Urlaubschein beantragt hatten
vor der Kaserne antreten. Der Hauptfeldwebel prüfte dann ob an der Uniform alle Knöpfe blank geputzt waren, die Stiefel
glänzten und der Rekrut auch vorschriftsmäßig grüßen konnte. Wer diese Anforderungen nicht erfüllen konnte musste
seinen Urlaubschein wieder abgeben und zurück auf sein Zimmer gehen.
Wenn man die Kaserne für eine gewisse Zeit verlassen wollte, mussten zuerst der Korporal, dann der Hauptfeldwebel und
letzt endlich der Hauptmann, seine Zustimmung erteilen. Es wurde geprüft; ob die Ausgeh-Uniform sitzt, alle Knöpfe
blank geputzt sind und der Helm so blank ist das man sich darin spiegeln kann. Unser Hauptmann war in Zivil,
Bürgermeister von Osterode. Er war sehr stolz wenn er seine Kompanie, in Parade Uniform und mit einem fröhlichen Lied
auf den Lippen, durch seine Stadt führen durfte.
Als wir eines Tages zum etwa 6 Kilometer entfernten Schießstand marschieren sollten, war es sehr kalt und glatt. Der
Hauptmann ritt durch das große Tor, wir aber sind durch das kleine Tor gegangen und haben eine steil bergab führende
Abkürzung gewählt. Die Zug- und Gruppenführer gingen voraus und wir im Gänsemarsch hinterher. Ein Kamerad hat sich auf
den Gewehrkolben gesetzt und ist darauf den Berg hinunter gerutscht. Als die Anderen das sahen haben sie es ihm
nachgemacht und hatten einen Riesenspaß. Da kam der Hauptmann plötzlich im Galopp angeritten; ließ alles anhalten und
hat zuerst die Zugführer ausgeschimpft, dann anschließend die ganze Kompanie. Er sagte: „Wie könnt ihr es wagen, so
mit eueren Gewehren umgehen. Ein Gewehr soll man wie seine Braut behandeln und nicht wie einen Straßenbesen”. Zur
Strafe mussten wir, links und rechts der Straße, in zwei Reihen antreten und durch den verschneiten Straßengraben
robben. Die Herrn Zug- und Gruppenführer durften die Straße benutzen und erteilten uns nur Befehle, wie: hinlegen,
nach rechts schwenken, nach links schwenken, einzeln vorarbeiten und sammeln. Als wir dann abgekämpft, in Linien zu
2 Glieder angetreten waren, ging es mit Gesang zum Schießstand.
Auf dem Schießstand angekommen, erhielten wir zuerst eine praktische Unterweisung, für den Gebrauch von Schusswaffen.
Wir mussten solange mit einem nicht geladenen Gewehr üben, bis wir unserem Vorgesetzten beweisen konnten, dass wir
alles im Griff haben. Daraufhin wurden jedem 10 Patronen zugeteilt, so das er unter der Aufsicht eines Unteroffiziers
mit den Schießübungen beginnen konnte. Der Unteroffizier hat die Position der Einschüsse, auf der Scheibe, in einem
Buch eingetragen und nach Beendigung der Übung dem Hauptmann Bericht erstattet, ob der Schütze seine Aufgabe erfüllt
hat oder nicht. Nach dem Schießen wurden die Gewehre zu Pyramiden zusammengestellt. Diejenigen die ihre Aufgabe nicht
erfüllt haben, mussten rund um die Zielscheibe, die Bleikugeln aufsammeln.
Seit unserer Einberufung hatten wir noch keinen Heimaturlaub. Urlaub bekamen nur die, die ihren Heimatort zu Fuß
erreichen konnten. Wegen der vielen Truppentransporte die täglich von Ost nach West unterwegs waren durften wir die
Eisenbahn nicht benutzen. Einmal wurde uns gesagt; wenn jemand gut schießen kann der bekommt Heimaturlaub, aber auch
das war nur ein leeres Versprechen.
Kaisers Wilhelms Geburtstag
Der beste Tag war des Kaisers Geburtstag. Am 27. Januar mussten alle in der Grollmann Kaserne
antreten, der Battalions-Kommandeur beendete seine Laudatio mit den Worten: Seine Majestät, unser Kaiser und König
Wilhelm II, erlebe hoch, hoch, hoch. Dann spielte die Regimentskapelle: Heil dir im Siegerkranz, Herrscher des
Vaterlands, Heil Kaiser dir. Danach folgten 3 Strophen des Deutschlandliedes und anschließend fand ein Gottesdienst
statt. Anschließend gab es ein vorzügliches Mittagessen, Schweinebraten, ein Stück Wurst auf die Faust und Biermarken,
die man in der Kantine gegen gutes Bier einlösen konnte, danach Urlaub bis zum Wecken, ohne Urlaubschein. Mein Vater
und die Mutter eines Kameraden waren schon morgens angekommen, konnten uns aber nicht finden, wurden von einer Kaserne
in die andere geschickt. Erst als wir mit Musik, von der Kirche zurück zur Kaserne marschiert sind habe ich sie
zufällig entdeckt. Als sie mich auch erkannt haben, sind sie nachgekommen. Da war die Freude groß: Der Vater hatte
einen großen Koffer auf einem Krückstock über die Schulter getragen. Ich ging gleich zur Wache und habe sie angemeldet,
sie sind dann bis zum Abend geblieben. Es war einer der schönsten Tage in der Grollmann-Kaserne in Osterode.
Alle 10 Tage bekamen wir Sold. Vor der Auszahlung mussten wir antreten, jeder wurde gefragt ob noch Restgeld vom
letzten Sold vorhanden war. Dann bekam jeder 3,30 Mark, davon musste man noch Sidol für das Koppelschloss und
Schuhkreme für die Stiefel kaufen. Wer geraucht hat und nichts von zu Hause bekam war schlimm dran. Beim Militär bekam
man nicht nur die Ausbildung an der Waffe beigebracht, man lernte auch putzen, nähen, Strümpfe stopfen und vieles
Andere. Man bekam einen beschädigten Strumpf, der musste aufgeribbelt werden, mit der Wolle konnte man dann andere
Strümpfe stopfen oder Kleidungsstücke mit Namen kennzeichnen. wer das nicht konnte, der musste seinen Kameraden
Zigaretten oder Geld geben die das dann für ihn erledigten.
Verschiedene Kameraden gingen nach dem Dienst noch in die Stadt. Um 21:45 Uhr wurde zum Zapfenstreich geblasen, dann
musste man schnell zurück in die Kaserne, weil um 22:00 Uhr der Wachhabende von Bett zu Bett ging und prüfte ob auch
alle anwesend waren. Zwei mal pro Woche fanden Gewaltmärsche statt, mit vollem Gepäck im Tornister. Am Ende der
Marschkolonne fuhr dann ein Pferdewagen, wenn der Feldarzt bei jemandem einen Erschöpfungszustand feststellte, der
durfte dann aufsitzen. Am Sonnabend wurden auf dem großen Exerzierplatz Felddienstübungen durchgeführt, es befand sich
dort ein großer Hügel, den wir immer wieder erstürmen mussten. Am Nachmittag war Revierreinigen angesagt, wir mussten
dann die Tische schrubben, auf einen Tisch wurde Sand mit etwas Wasser gestreut, der nächste Tisch wurde mit der den
Beinen nach oben drauf gelegt und solange hin und her geschoben bis beide sauber waren. Mit den Stühlen geschah das
Gleiche. Dann wurde der Fußboden in der Stube geschrubbt, die Schränke abgewaschen, Staub geputzt, zuletzt kamen Flur
und Treppe dran.
Für die Arbeit war eine Stunde angesetzt, wenn jemand zu früh fertig war erregte er den Argwohn des Diensthabenden
Korporals, der prüfte dann alles genau, fand natürlich immer etwas das nicht seinen Erwartungen entsprach. Der
Übereifrige musste dann Nacharbeiten bis die Stunde um war. Eine Stunde war für Gewehr reinigen und Unterricht an der
Waffe vorgesehen.
Im Februar wurden wir neu eingekleidet; Schnürschuhe, Koppel, alles gelbes Leder mussten wir mit Lederschwärze
behandeln. 2 Wolldecken, Uniform und Helm in feldgrau, da brauchten wir die Knöpfe nicht mehr zu putzen. Die neuen
Gewehre mussten zuerst eingeschossen werden. Es wurden 90 scharfe Patronen und Marschverpflegung ausgegeben, danach
mussten wir mit vollem Gepäck zum Appell antreten. Man konnte kaum gerade stehen, weil der Tornister einen in die Knie
zwang. Der Major, der die Aufstellung besichtigte rief >Brust raus<, dann informierte er uns dass wir ins
Feldrekrutendepot und in Feindesland kommen. Urlaub bekam niemand. Ich habe ein Telegramm nach Hause geschickt, mit
der Nachricht dass wir bald abrücken werden. Einen Tag vor dem ausrücken hat mich meine Mutter noch besucht, sie hat
mir vieles mitgebracht. Alles konnte ich nicht mitnehmen, weil es nicht gestattet war anderes Gepäck bei sich zu haben
als dem Soldaten zustand.
Abmarsch zum Fronteinsatz
Am nächsten Tag hat uns die Regimentskapelle mit Musik zum Bahnhof gebracht. Von Osterode ging
es über Thorn, Posen,
Annaberg, Warschau, Brestlitowsk ins Pruschana-Lager. Das war eine russische Artillerie-Kaserne, in der 2 deutsche,
3 österreichische Bataillone und eine Offiziersschule untergebracht waren. Ein Bataillon das waren wir 18 und 19
jährige, die Anderen waren Männer bis 45 Jahre. Als wir in Osterode abfuhren lag Schnee, in Annaberg/Schlesien waren
die Kühe auf der Weide und im Pruschana-Lager lag der Schnee wieder einen Meter hoch. Drei Kilometer vor unserem vor
unserem Lager war die Bahnfahrt zu Ende. Mit den schweren Tornistern waren viele überfordert, wir mussten immer wieder
warten bis alle nachkamen. Unsere Unterkünfte das waren Baracken die den Russen als Pferdeställe gedient hatten. In
jeder Baracke wurde eine Kompanie mit Schreibstube untergebracht, die nur durch ein Zelt abgegrenzt war.
Wir haben aus Brettern Doppelbetten hergestellt, in jeder Baracke war ein Ziegelofen. Unsere neuen Uniformen und die
scharfe Munition mussten wir abgeben und bekamen dafür alte Bekleidung, sowie Ecksezierpatronen. Hier ging es wieder
Kasernenmäßig zu, das jüngere Bataillon bekam besseres Essen, doppelte Portionen und nach dem Essen 2 Stunden Bettruhe.
Wenn jemand die Bettruhe nicht einhielt und dabei erwischt wurde wusste zur Strafe Holz hacken oder Schnee schaufeln.
Zwei Wochen war Frost bis minus 40 Grad, da hatten wir keinen Unterricht im Freien, alle Aktivitäten fanden in der
Baracke statt, die nur mit nassem Holz beheizt wurde und dem entsprechend war auch die Temperatur im Inneren. Um
Brennmaterial für die Küche zu besorgen mussten wir ins nächste Dorf gehen und von zerfallenen Häusern Holz holen.
Als endlich das Tauwetter einsetzte verwandelte sich die Gegend um Baranowitschi in ein unüberwindbares Sumpfgelände.
Wir wurden mit anderen Einheiten die aus Frankreich zu uns verlegt wurden, zusammengelegt. Wenn jemand nachweisen
konnte dass er Landwirt ist und mehr als 100 Morgen Ackerland besitzt, konnte er einen Urlaub zur Frühjahrsbestellung
beantragen. Ein Gottlieb Piotrowski aus Plohsen hat seinen Urlaub bewilligt bekommen und durfte für 14 Tage nach Hause.
Wenn von der unweit entfernten Front Kanonendonner zuhören war und Alarm ausgerufen wurde, dachten wir es geht los.
Obwohl wir als Reserve aufgestellt waren mussten wir allzeit einsatzbereit sein. Wir haben auch Bunker und Stollen
gebaut, Schützengräben ausgeworfen und mit scharfen Handgranaten exerziert.
Als Gottlieb Piotrowski nach 2 Wochen zurückkam waren wir schon in Alarmbereitschaft und sind dann auch 2 Tage später
ausgerückt. Kamerad Piotrowski hatte mir noch ein großes Paket von zu Hause mitgebracht.
Italien hat Deutschland und Österreich den Krieg erklärt.
Zuerst sind drei Bataillone Österreicher ausgerückt, dann die Deutschen hinterher. Bis zum
Bahnhof Linowa wurden wir von einer Musikkapelle begleitet, dann ging es per Eisenbahn ab nach Baranowitsche. Dort
wurden wir der, an der Westfront aufgeriebenen, 15ten Reserve Division zugeteilt. Es wurde uns gesagt das Kameraden
aus der Heimat gleichen Gruppen zugeordnet werden können. Ich hatte einen Freund aus meinem Dorf, Gustav Spektor,
einen aus Groß Schöndamrau, Wilhelm Lukas und einen aus Ortelsburg, Karl Schlensack, wir kamen zu zusammen in eine
Kompanie. Zuerst waren wir in einem Kinosaal einquartiert, haben jeden Tag Schützengräben ausgehoben und Feldübungen
gemacht. Es war ein sumpfiges Gelände, so dass die Soldaten wegen den vielen Mücken, Netze auf den Köpfen tragen
mussten. Nach einem Gewitter wurde es plötzlich unerträglich. Die Mücken hatten meinen Freund so zerstochen dass sein
Gesicht dermaßen angeschwollen war und ich ihn gar nicht wieder erkannt habe.
Von Baranowitsche wurden wir wieder auf die Eisenbahn verladen, die uns mit unbekanntem Ziel Richtung Osten fuhr.
Nachdem wir unterwegs einmal zum Essenfassen gehalten haben, kamen wir in der Nacht in Krakau an. In der nächsten
Nacht befanden wir uns schon in den Karpaten, wo wir die Hügelketten zu Fuß überqueren mussten, die Fahrzeuge fuhren
um die Berge herum und wir mussten manchmal 2 Stunden warten bis sie uns wieder eingeholt hatten. So ging es immer
weiter bis wir auf einen Berg kamen wo wir Zelte aufgebaut und Biwak bezogen haben. Dort stießen wir auf türkische
Einheiten die auf Mauleseln Munition und Verpflegung über die Berge transportiert haben. Die Esel hatten ein Gestell
auf dem Rücken, auf jeder Seite eine Fass mit Wasser oder Kisten mit Proviant. Ihre Artillerie wurde von 6 Mauleseln
gezogen, während die Offiziere, ohne Sattel, ohne Zaumzeug, nur mit einem Hanfseil ausgerüstet, daher kamen.
Die Mannschaften marschierten wie es jeder für richtig hielt, mit aufgekrempelten Ärmeln, das Gewehr über den Tornister
gelegt, wie die Wilddiebe. Im Gegensatz dazu herrschte bei uns strenge Disziplin, wen jemand aus der Reihe ging kam
sofort der Kompanieführer angeritten, hat uns angeschrieen, uns klar gemacht dass wir keine Türken seien und nur auf
höheren Befehl etwas an der Marschordnung ändern dürften, wer dagegen verstoße, müsste mit einem 3tägigen Arrest
rechnen. Wir haben hinter der der Front Gewaltmärsche durchgeführt die dem Feind große Truppenaufmärsche vortäuschen
sollten.
Wir lagen in einem Buchenwald in Bereitschaft. Überläufer berichteten dass auf russischer Seite eine Großoffensive
vorbereitet wird. In einer Nacht wurde plötzlich Alarm geschlagen, der Russe war zu einem Angriff mit Gasgranaten
übergegangen. Wir lagen unter Zelten und hatten die Gasmasken gar nicht bei uns, sondern nur etwas abseits liegen. In
der Dunkelheit hat mach einer keine Gasmaske mehr gefunden. Es war ein fürchterliches Durcheinander. Dabei war es
unsere Pflicht die Maske immer an dem Tragriemen über dem Hals zu tragen, mit halb geöffnetem Deckel. Uns hat es zum
Glück nicht so stark betroffen weil wir auf einer Anhöhe lagen und die Gaswolken sich im Tal verteilten. Wir wurden in
höchste Alarmbereitschaft versetzt weil der Russe die österreichische Front durchbrochen hatte.
Eigentlich sollten wir noch an einer Gulaschkanone Essen fassen, aber es blieb uns dazu keine Zeit mehr. Der
Kompanieführer befahl uns die Zelte abzubrechen, auf den Tornister aufzurollen und in fünf Minuten marschbereit zu
sein. Die Kanoniere befanden sich schon in der Batteriestellung, luden die Granaten, die sofort abgefeuert wurden. Der
Battalions-Kommandeur versammelte die Kompanieführer und erteilte ihnen die Angriffsbefehle. Derweil sollten wir in
einem Eichenwal der schon mit Granattrichter übersät war, Deckung suchen. Bald hatten wir die Verbindung zu unserem
Batteriestab verloren. Wir warfen unsere Tornister auf einen Haufen, schwärmten unverzüglich, nur mit Sturmgepäck
ausgerüstet, 4 Handgranaten im Brotbeutel, zum Angriff aus. Wir robbten uns einzeln voran. Weil der Russe unsere
Stellungen schon überrannt hatte war jeder auf sich selbst angewiesen. Mann hörte kein Kommando mehr weil der Russe
inzwischen den Rückzug angetreten hatte, um sich auf einer Bergspitze zu verschanzen, von der er uns mit
Flachbahngeschützen beschoss. Irgendwann befanden wir uns in einem Schützengraben, wo ein Leutnant und 17 Mann aus
unserer Division die Stellung hielten. Unter Androhung von Gewalt befahl er uns den Graben sofort zu verlassen und am
Gegenangriff teilzunehmen. Wir sprangen über den Stacheldraht, duckten uns aber sofort im nächsten Graben damit das
mörderische Maschinengewehrfeuer uns nicht hinwegfegte.
Dort blieben wir bis zum Eintritt der Dunkelheit liegen. Wir konnten unsere Waffen nicht mehr einsetzen weil der Sand
die Gewehrschlösser blockiert hatte. Als es Nacht wurde herrschte ein gespenstische Stille. Wir krochen aus dem
Schützengraben und lauschten nach irgendeinem Lebenszeichen von anderen Kameraden. Dann hörten wir irgendwelche Laute
die wir nicht genau zuordnen konnten. Sie kamen aus einem Holzbunker ganz in der Nähe. Wir näherten uns ganz
vorsichtig, als plötzlich eine Schar österreichischer Soldaten herausstürmte. An unseren Stahlhelmen erkannten sie
dass wir Deutsche sind. Bald danach trafen wir auch auf 69 deutsche Soldaten die zu unserer Division gehörten. Dann
kam ein Hauptmann der uns mit Vorwürfen überschüttete, wir seien Feiglinge, wir hätten uns von unserer Einheit entfernt.
Wir haben ihm den Vorgang geschildert, aber ließ nicht mit sich reden und sagte nur dass wir bestraft werden und nichts
zu essen bekommen. Wir wurden einer Maschinengewehr Einheit zugeteilt welche die vorderste Stellung verteidigen
musste. Wir hatten einen Stollen mit 2 Ausgängen.
Die Russen haben bemerkt das sich etwas bewegte und haben uns unverzüglich mit Artilleriefeuer belegt. Schon die
dritte Granate war ein Volltreffer. Vier Kameraden waren sofort tot, ich bekam mit einem Stollenbrett in den Rücken
der sofort blau und grün angelaufen war. Ich schaute nach oben, alles war verschüttet. Ich wusste nicht das da noch
ein Ausgang war, doch die Kameraden die hier in Stellung waren haben mir geholfen das Freie zu erreichen. Ich habe
mich am nächsten Tag krank gemeldet, dachte 2 Tage Schonung zu bekommen, aber der Sanitäter hat mir nur den Rücken mit
Spiritus eingerieben und mich wieder, zurück zu unserer Kompanie geschickt. Sie bestand nur noch aus 3 Gruppen, die in
einem Stollen, der in einen Berg gehauen war, Stellung bezogen hatten. Wir konnten uns hier wenigstens waschen, an
einer Quelle die aus dem Felsen sprudelte. Wir waren nicht mehr einsatzfähig und mussten durch andere Truppenteile
verstärkt werden.
Beim Essen holen musste man auch das Gewehr bei sich haben, es wurde erzählt dass hier der braune Bär herumwandert.
Ich habe keinen gesehen, nur das die Toten ausgescharrt wurden und verstümmelt herumlagen. Nach einigen Wochen haben
die Deutschen eine Gegenoffensive gestartet, von den Bergen herunter, über den Fluss Zlota Lipa, bis zu einer Stadt
die Brzezany hieß. 2 Tage später wurden wir auch eingesetzt, bei großer Hitze ging es in Dauermärschen vorwärts, man
durfte aus den Flüssen kein Wasser trinken, weil es mit Petroleum verseucht war. Nur wenn es dunkel wurde machten wir
halt, dann mussten wir Gräben ausheben um vor Überraschungen sicher zu sein.
Links von uns war Tarnopol und rechts Rumänien. Wenn es nach einer Ruhepause wieder losging dann war es am schlimmsten,
man ging wie auf Nägel, weil die Füße die Strapazen nicht so ohne weiteres wegsteckten. Im Dorf wurde niemals Rast
gemacht, denn da waren immer Brunnen, zu denen alle hinstürmten. Später wurden Melder vorausgeschickt, die von den
Dorfbewohnern Wasser in Eimern am Weg raussetzen ließen, damit die Soldaten Ihren Durst löschen konnten. Ein Soldat hat
gleich den ganzen Eimer mitgenommen und ihn dann als er leer war, irgendwo am Wegrand stehen lassen. Der Kompanieführer
kam angeritten, hat ihn ausgeschimpft und gedroht, ihn mit 3 Tagen Arrest zu bestrafen. Wir gehörten zur Südarmee
welche von Graf Bothmer befehligt wurde.
Die Stellungen waren schlecht ausgebaut, abends mussten wir, von der 2 Kilometer hinter der Front liegenden Feldküche,
Essen und andren Proviant holen. Ich war der Jüngste der Gruppe, musste immer 9 Kochgeschirre tragen, Brot und Post
habe ich in 2 Sandsäcke, die ich über der Schulter hängen hatte, verstaut. Wenn wir unterwegs waren wurde der
Laufgraben immer beschossen. Einmal schlug eine Granate am Schützengrabenrand ein und hat mich halb verschütte, die
Kochgeschirre aus den Händen gerissen, so dass ich ohne Verpflegung im vorderen Graben ankam. Nach drei Wochen sollten
wir abgelöst werden Es hat jeden Tag geregnet, wir haben unsere Mäntel angezogen und uns mit Zelten bedeckt. Nach dem
wir abgelöst wurden kamen wir in ein Dorf dass von Juden bewohnt war. Die Bewohner waren froh dass wir keine Kosaken
waren, mit denen hatten sie vor ein par Tagen schon schlechte Erfahrung gemacht, die hatten ihnen beim Abzug Vieh und
Pferde weggenommen.
Der Boden war sehr fruchtbar, es wurden Hanf, Weizen, Hafer, Mais, Bohnen, Roggen und Kartoffeln angebaut. Die
Bewohner waren gerade mit der Ernte beschäftigt. Die Häuser waren nur aus Holz und Stroh erbaut. Die Leute lebten in
sehr ärmlichen Verhältnissen. Ich hatte mir in unserer Kantine für 20 Pfennig ein Taschenmesser gekauft, das hat mir
ein Bauer für 6 Eier und 2 Pfund Brot abgekauft, daraus hat er sich dann ein Rasiermesser geschliffen. Wenn unser
Versorgungstross auf denn holperigen Wegen nicht nachkam, haben im Dorf auch Verpflegung eingekauft. Die Leute hatten
Angst dass wir nicht bezahlen werden, doch wir bekamen meistens pünktlich unseren Wehrsold ausgezahlt und konnten uns
so manches genehmigen. Um unser Marschgepäck zu erleichtern haben wir so manches aus dem Tornister weg geworfen.
Unweit eines Dorfes wurde halt gemacht, wir sollten Zelte aufschlagen, doch niemand hatte mehr Zeltstöcke im Tornister,
alles war unterwegs liegen geblieben. Der Zugführer befahl uns ins Dorf zugehen und Stöcke zu besorgen. In einer
Scheune stießen wir auf eine Hühnerschar, mit den Stöcken haben wir einige Hühner erlegt, in einem Hanffeld gerupft
und dann im Eiltempo zurück zu unserer Truppe. Als wir ankamen war die Kompanie schon marschbereit, es gleich weiter,
mit dem Huhn im Tornister. Bei der nächsten Rast haben wir die Hühner ausgenommen und Holz besorgt um sie zu kochen,
doch wir mussten schnell wieder weiter marschieren und erst nach 2 Tagen konnten wir uns mit den Hühnern befassen,
leider waren die so alt das sie nicht gar wurden. Das Fleisch mussten wir wegwerfen, nur die Suppe konnten wir noch
gebrauchen.
Meine Verwundung am Pruth.
Wir befanden uns 8 km vor der russischen Grenze. Der Kompanieführer hatte uns informiert das
wir hier zum Einsatz kommen. Wir bekamen noch ein Mittagessen aus der Gulaschkanone, konnten unsere Feldflaschen mit
Tee, der mit Rum angereichert war, auffüllen, Munition und Handgranaten in Empfang nehmen und dann ging es zum Einsatz.
Um 3 Uhr begann das ganze Bataillon auszuschwärmen, sofort hat uns der Russen entdeckt und begann uns mit Artillerie
zu beschießen, je weiter wir vorrückten desto heftiger.
Bis zu einem Eisenbahndamm hatten wir gute Deckung, doch wir sollten den dahinter fließenden Fluss überqueren. Doch
plötzlich explodierte über meinem Kopf eine Schrapnellkugel, der Stahlhelm wurde mir vom Kopf gerissen, Tornister und
Koppel flogen auch weg, ich lag auf der Erde und wusste gar nicht was passiert war. Plötzlich fing Blut aus der
Kreuzbeingegend zu rieseln, aus dem rechten Oberschenkel auch. Gleich nebenan war ein Granattrichter, dort habe ich
Schutz gesucht. In der rechten Rockecke hatte man immer ein großes Verbandspäckchen, das habe ich herausgenommen und
auf die Wunde gedrückt, doch das Blut floss mir bis in den Stiefel. Links und rechts von mir schlugen Granaten ein,
dicke Erdbrocken und Schlamm fielen auf mich herab, doch in meinem Erdloch war ich vor Maschinengewehrsalven geschützt.
Der ganze Rücken war angeschwollen und ich konnte mich überhaupt nicht bewegen.
Die Deutschen mussten die Stellung den Russen überlassen, einer hatte mich entdeckt, da ich aber so blutverschmiert da
lag, hat er bestimmt gemeint ich wäre nicht mehr am leben und ist weitergegangen. Nach zwei Stunden habe ich gehört
das die Russen sich wieder zurückzogen, danach herrschte eine gespenstische Stille. Als es dunkel wurde kamen deutsche
Sanitäter mit Spürhunden und haben die Verwundeten aufgesammelt. Ich wurde auf eine Trage gelegt, lag gebeugt und
konnte mich nicht rühren weil der blutverschmierte Rücken völlig verkrustet war. Ein Pferdegespann konnte nur vier
Tragen befördern, die Fahrt über Ackerfurchen war eine Tortur, ich habe nicht geglaubt das ich es überleben werde. In
einer Dorfkirche wurden wir dann ausgeladen und zu den etwa 50 Verwundeten gelegt die da schon lagen.
Mich haben sie zu den Bauchschüssen gelegt, weil ich einen Nervenschock hatte und am ganzen Körper gezittert habe. Zu
trinken bekam ich nichts, nur einen feuchten Lappen in den Mund. Ich sollte gleich operiert werden, aber es kamen
immer mehr Verwundete, so bekam ich nur eine Tetanusspritze, wurde verbunden und für den Weitertransport ins Hinterland
vorbereitet. Im Morgengrauen wurden wir auf Lastautos verladen, die aus auf ein Landgut brachten, wo wir in einem
Pferdestall untergebracht wurden. Die Fahrer fuhren so schnell über die Granatlöcher, das wir vor Schmerzen geschrieen
haben. Wir baten sie langsamer zu fahren, aber die bekamen es in ihrem Führerhaus nicht mit, erst alt ein Verwundeter,
der einen Krückstock bei sich hatte von hinten die Scheibe einschlug wurde die Fahrt erträglich. Lastautos, die
Munition und Verpflegung an die Front transportiert hatten, brachten in den nächsten Tagen immer wieder Verwundete
ins Hinterland. Die Deutschen hatten an diesem Fronabschnitt hohe Verluste zu beklagen. Wir können von Glück reden
dass wir dem Höllenfeuer überhaupt entkommen sind.
Wir wurden mit Lastautos, die ein Feldlazarett uns geschickt hatte, bis nach Lemberg befördert. da wurden wir gewaschen,
rasiert und frisch verbunden. Auf einem Nebengleis stand ein Lazarettzug, in dem wurden wir anschließend in frisch
bezogenen Betten untergebracht. Der Zug brachte uns über Annaberg nach Freiburg in Sachsen, eine Stunde hinter Dresden.
Hier wurden wir auf Tragen gebettet und mit einem Möbelwagen in ein Reservelazarett transportiert.
Im Heimatlazarett.
Als ich am nächsten Tag aufwachte und das schöne Bett sah in dem ich lag, dachte ich dass ich
im Himmel bin. Ich dankte meinem Herrgott das er mich bis zu diesem Ort begleitet hat. Am Nachmittag kamen Schulkinder
mit Geschenken und haben uns schöne Lieder vorgesungen. Anhand von Röntgenaufnahmen wurde in den nächsten Tagen
festgestellt dass bei mir ein Schrapnellsplitter an der Wirbelsäule in die Kreuzbeingegend eingedrungen war. Ich wurde
jeden Tag in Salzwasser gebadet und bekam wieder volle Verpflegung, da mein Magen zum Glück nicht verletzt war. Auf
dem Transport bekam ich nur Suppe und bei Bedarf einen feuchten Lappen auf die Lippen. Ich bin von 62 auf 43 Kilogramm
abgemagert, gehen konnte ich wegen dem Nervenschock den ich bei der Verwundung erlitten hatte auch noch nicht. Die
Wunde am rechten Oberschenkel war nur ein Streifschuss und wurde mit einem Schutzverband versorgt.
In den nächsten Tagen habe ich einen Brief nach Hause geschrieben und mitgeteilt wo ich mich zurzeit befinde. Meine
Eltern schickten mir ein Paket mit Lebensmitteln, jetzt konnte ich essen was ich wollte. Das Essen im Lazarett war
nicht besonders, jeden Tag nur Kohlblätter. Der weg zu den Toiletten führte durch einen Gemüsegarten. Die gehfähigen
Kameraden haben den ganzen Kohlrabi aufgegessen, so dass schließlich Wachposten aufgestellt werden mussten. Sechs
Wochen lang konnte ich mich nur auf allen Vieren fortbewegen, denn sobald ich mich aufrichtete wurde es mir
schwindelig und ich musste zurück ins Bett.
Als ich wieder bei Kräften war habe ich meinen Eltern mitgeteilt das ich mich in ein Lazarett in ihrer Nähe verlegen
lassen will. Der Chefarzt hatte mir zugesichert, wenn die Möglichkeit besteht in Ortelsburg unterzukommen, wird er dem
zustimmen. Meine Mutter hat daraufhin, in Ortelsburg, beim Lazarettinspektor Zantopf nachgefragt und er hat angedeutet
das sie mich aufnehmen können. Daraufhin bekam ich die Krankenpapiere und einen Fahrschein nach Ortelsburg. Da ich als
Soldat nie Heimaturlaub hatte, beschloss ich zuerst meine Eltern zu besuchen. Ich fühlte mich noch sehr schwach, habe
nach jedem Kilometer Rast gemacht, aber letztendlich war ich wieder daheim bei meinen Eltern. Die Wiedersehensfreude
war sehr groß. Ich bin am 30 Juli verwundet worden und am gleichen Tag wurde mein ältester Bruder beerdigt. Er bekam
den Splitter einer Gasgranate ins rechte Bein und ist an einer Blutvergiftung verstorben.
Am nächsten Tag brachte mich mein Vater ins Garnisonslazarett nach Ortelsburg. Ich wurde jeden Tag gebadet und massiert,
weil die Rückenhaut am Knochen angewachsen war konnte ich mich nicht schmerzfrei bücken. In Ortelsburg verbrachte ich
noch sechs Wochen, bis Ende Oktober, da wurde es schon ziemlich kalt und in unserer Barackenunterkunft ziemlich
ungemütlich. Kohlen und anderes Brennmaterial lagen im Hof auf Halde, aber es war verboten zu heizen. Kameraden die in
der Nähe zu Hause waren konnten Sonntagsurlaub beantragen.
Einer von ihnen brachte von zuhause Brennholz mit und entzündete damit im Ofen ein wärmendes Feuer, andere holten vom
Hof Kohlen, so dass der Ofen in kurzer Zeit glühend heiß wurde und die Gefahr bestand das die Betten Feuer fangen
würden. Wir hatten die Betten schon weg gerückt, da kam der Feldwebel herein und fragte wer das Feuer im Ofen
angezündet hat, doch niemand fühlte sich angesprochen. Der Feldwebel hatte den Vorfall dem Stabsarzt gemeldet, als der
am nächsten Morgen zur Visite kam, war seine erste Frage: ”Wer hat gestern Abend das Feuer im Ofen angezündet”. Als
sich niemand meldete, schrie er uns an: ”Morgen wird alles entlassen, zum Ersatzbatallion, in Diez an der Lahn! Wer
gehen kann, sofort zur Schreibstube, Krankenpapiere und Fahrscheine abholen”. Er erinnerte uns noch daran am nächsten
Tag pünktlich am Bahnhof zu sein, weil eine Verspätung unangenehme Folgen für uns haben würde. Das war das Ende der
schönen Erholungsphase. Ich blieb noch eine Nacht zu Hause und bin dann am nächsten Tag von dort zum Bahnhof gegangen.
Wieder Kriegsverwendungsfähig.
Als wir am nächsten Tag in Diez angekommen waren, wurde ich gefragt ob ich aus dem Heimaturlaub
käme, als ich das verneinte wurden mir 2 Tage genehmigt und 14 Tage Genesungsurlaub dazu. Wieder zurück im
Ersatzbatallion bestand unsere Tätigkeit aus Wache schieben und Kartoffel schälen. Nach einem Monat wurden wir von
einem Generalarzt untersucht, er hat mich für nicht einsatzfähig befunden weil ich noch den Steckschuss im Rücken
hatte und das linke Bein 10 Zentimeter dünner war. Jetzt fing das Kasernenleben wieder von vorne an. Wachdienst,
Gewehr laden, sichern, Ehrenbezeugung, Einzelmarsch und Appell. Wer nicht weit nach Hause hatte bekam zu Weihnachten
Urlaub. Ich hatte zu Heiligabend und Silvester Torwache, denn nach Ostpreußen wurde niemand beurlaubt.
Nach Neujahr 1918 wurden wir neu eingekleidet und kamen nach Köln zur Baukompanie. Mit Musik wurden wir zum Bahnhof
gebracht. In Köln wurden wir noch mit Soldaten die von andern Truppenteilen dorthin verlegt wurden in einem großen
Kinosaal, im Stadtteil Edengarten untergebracht. Wir brauchten keinen Dienst zu machen und konnten zu Heilige Drei
Könige den Gottesdienst im Dom besuchen. Kameraden die aus irgendwelchen Gründen im Arrest saßen wurden gefragt ob sie
auch am Gottesdienst teilnehmen möchten, dann würde ihnen die Strafe erlassen. Fast alle haben dem zugestimmt. Einige
Tage später wurden wir wieder auf einen Transportzug verladen, der uns über Herbestal, Antwerpen nach Brügge in Belgien
brachte. Hier mussten wir den Zug kurzfristig verlassen und einen Luftschutzkeller aufsuchen, weil Fliegeralarm
gemeldet wurde. Danach ging es wieder weiter nach Turut, Kortemark, Hauseme, Kautremollen, Zaren, Zarenlinde. Dort
wurden wir in verschiedene Gruppen aufgeteilt und einer Pionierkompanie auf dem Pionierpark Struwendorf zugewiesen.
Wir haben hinter Klerken Bunker für schwere Maschinengewehre gebaut. Unsere Arbeit konnten wir nur bei Nebel verrichten,
denn bei Sonnenschein waren wir sofort dem Beschuss der feindlichen Artillerie ausgesetzt. eine Kleinbahn die Munition
und Stacheldraht an die Front brachte war dem Beschuss besonders ausgesetzt. Die Gleise, von schweren Geschossen
zerfetzt, mussten immer wieder hergerichtet werden, damit der Nachschub aufrechterhalten werden konnte. Später haben
wir am Kemelberg bei Armentier, eine Brücke über die Lys gebaut. Um in dem Sumpfgelände einen Untergrund dafür zu
schaffen, mussten wir 10 bis 12 Meter lange Pfähle in den Boden rammen. Ein Feldwebel gab immer den Befehl: „Hoch den
Bär, noch viel mehr, dass man sieht, wie er zieht, denn dieser Pfahl, glatt wie ein Aal, durch Fels und Stein, durch
Wasser und Sand, fürs Vaterland”. Jedes mal mussten wir den Bär an Schnüren hochziehen und dann wieder herunterlassen.
Wenn es manchmal, trotz vieler Mühe nicht mehr weiter ging wurde der Pfahl auf eine bestimmte Länge abgeschnitten.
Nach Fertigstellung der Brücke kamen wir in die Siegfriedstellung bei Kambrei, zum Bau eines Bataillons-Gefechtstandes.
Da der Boden kreidehaltig war, mussten wir die großen Stücke von Hand zu Hand reichen, den Schutt haben wir dann mit
Sandsäcken aus der Baugrube gehoben und mit Ästen getarnt, damit der Stand nicht von feindlichen Fliegern entdeckt
werden konnte. Alle acht Stunden wechselte die Arbeitsgruppe. Wir mussten von der Baustelle durch das Gelände robben,
denn aufrecht gehend war man dem Beschuss der feindlichen Scharfschützen ausgesetzt, die von einem Fesselballon aus
informiert wurden der über den feindlichen Linien stand.
Der Wechsel war mit einem großen Risiko verbunden, und wurde wenn Möglich bei Dunkelheit vollzogen. Um vor
Überraschungen sicher zu sein haben wir spanische Reiter (Stacheldrahtverhaue) gebaut und vor die ersten Gräben
gestellt, die dann oft in der Nacht von den Franzosen geklaut, und dann vor ihren eigenen Linien wieder aufbaut wurden.
Wir hatten aus Bohlen eine Brücke auf Rädern gebaut, die dann in den Graben geschoben wurde, damit die Artillerie und
andere Fahrzeuge über die Schützengräben kamen. Weil um vier Uhr morgens der Beschuss mit Gasgranaten begann, mussten
wir Gasmasken aufsetzen, danach haben feindliche Flieger unsere Munitionskolonne bombardiert und total aufgerieben.
Es wurde auch eine Marinedivision eingesetzt, die bis dahin dem Küstenschutz gedient hatte und jetzt ihren ersten
Einsatz hatte.
Wir sind zuerst ein ganzes Stück in Richtung Amiens vorangekommen, doch dann blieb unser Angriff in den zuvor von
Engländern besetzten Stellungen, stecken. Da die Engländer ihre Stellungen fluchtartig verlassen hatten, fiel ihr
ganzer Proviant in unsere Hände; Schokolade, Weißbrot, Flaschenwein. Die erste Nacht haben wir in einem runden Zelt
verbracht, weil ich mir durch den starken Wind, der da herrschte eine Angina zugezogen hatte, die mit hohem Fieber
verbunden war, konnte ich die vielen Köstlichkeiten überhaupt nicht genießen.
An eine ärztliche Versorgung war überhaupt nicht zu denken, denn es mussten zuerst die vielen Granatlöcher eingeebnet
werden damit die vielen Fahrzeuge und Geschütze wieder weiter fahren konnten. Auch eine Bahnlinie musste repariert
werden, damit die großen Geschütze in Stellung gebracht werden konnten, dabei wurden auch die vielen Kriegsgefangenen,
die bei dieser Offensive gemacht wurden, eingesetzt. Als die Offensive dann schließlich scheiterte, wurden wir an die
Somme verlegt. Da habe ich die Ortelsburger Jäger, die aus Italien an die Westfront verlegt wurden, zum ersten Mal im
Einsatz gesehen.
Unser nächster Einsatzort waren dann Stellungen hinter Laon. Hier wurden die Vorbereitungen zu einer neuen Offensive
getroffen. Feindliche Flieger versuchten uns Tag und Nacht daran zu hindern die Aufmarschwege instand zu halten. Als
die Offensive dann endlich losging, hatten wir die Order eine Brücke über die Oise mit Bohlen und Balken zu verstärken.
Gleich am Anfang der Offensive mussten wir Gasmasken anlegen, um für alle Fälle gewappnet zu sein. Nur die Artillerie
und Kraftfahrzeuge durften die Landstraße benutzen, die Infanterie ging immer im Straßengraben und wurde von einer
Seite von Kopf bis Fuß mit Dreck bespritzt. Die Franzosen und Engländer haben hier schon Panzer eingesetzt, die von
Truppen aus den Kolonien gefahren wurden. Die Australier gingen mit umgekrempelten Ärmeln hinter den Panzern her.
Die letzte Offensive des Ersten Weltkrieges.
Zum Jahresende 1917 hatten noch 153 deutsche 175 alliierten Divisionen gegenübergestanden.
Zur Vorbereitung der Offensive ließ Ludendorff 39 Divisionen aus dem Osten und aus Italien heranziehen. Er ließ
spezielle Angriffsdivisionen formieren, die durch intensive Ausbildung auf den beabsichtigten, schnellen Vormarsch
vorbereitet wurden. 6608 Geschütze, 3500 Minenwerfer und 1070 Flugzeuge wurden hinter dem vorgesehenen
Angriffsabschnitt konzentriert. Den Ausbildungsbefehlen Ludendorffs, die bis zu den Kompanieführern herab verteilt
wurden, konnte man entnehmen, dass der Versuch, den Krieg mit einem mächtigen Schlag zu entscheiden schon in der
nächsten Zeit gewagt werden sollte. Wir übten die fast vergessenen Formen des Schützengefechts und des
Bewegungskrieges, auch wurde eifrig mit Gewehr und Maschinengewehr geschossen. Wir hegten keinen Zweifel daran, dass
der große Plan gelingen würde.
Den ganzen Winter 1917/18 über plante der Generalquartiermeister Ludendorff die deutsche Offensive. Zwar hatten die
Vereinigten Staaten von Amerika dem Deutschen Reich am 6. April 1917 den Krieg erklärt, aber vor dem Sommer des
Jahres 1918 war mit dem Auftreten von US-Truppen in relevanter Größenordnung nicht zu rechnen. Der deutschen Führung
blieb nur ein schmales Zeitfenster, um die Niederlage und den zu erwartenden Diktatfrieden abzuwenden. Ypern,
Armentieres, Arras, Cambrai oder Verdun wurden ernsthaft als Schauplätze erwogen. Ludendorf entschied sich für einen
Angriff zwischen Cambrai und La Fere – genau an der Nahtstelle zwischen der Französischen Armee und dem britischen
Expeditionscorps.
Der Fluss Somme bildete die Grenze zwischen Franzosen und Briten. Die Briten – nicht die Franzosen – sollten das Ziel
des Vorstoßes werden. Ihre Stellungen waren nur 130 Kilometer von der Kanalküste entfernt. Beim erreichen der
Sommemündung wäre die gesamte britische Armee eingeschlossen gewesen, denn hinter ihnen lag die Straße von Dover.
Am 21. März 1918 begann die letzte entscheidende Offensive des deutschen Westheeres im Ersten Weltkrieg. Der
Angriffsstreifen war 75 Kilometer breit. Dort hatte Ludendorff 43 Angriffsdivisionen konzentriert, dahinter 30
weitere Reservedivisionen, ihnen standen lediglich 26 britische Divisionen gegenüber. „Michael“ – so der Deckname der
„Kaiserschlacht“ – lief dank Ludendorffs akribischer Vorbereitung gut an. Der britische Oberbefehlshaber General
Douglas Haig erkannte die Chance, welche die Deutschen in dieser Situation hatten. Wollten die Deutschen diese Chance
nutzen, mussten sie darauf verzichten die Somme zu überschreiten, wo sie auf die französischen Reserven treffen und
sich von der Küste entfernen würden. Genau diesen Fehler begingen jedoch die Deutschen.
Am dritten Tag überschritt der linke Flügel mit der 18. Armee die Somme. Ludendorf stellte die Taktik über die
Strategie, wie er das bei Tannenberg und der Schlacht an den Masurischen Seen auch schon getan hatte. Ludendorffs
Befehl an die 18. Armee vom Abend des 22. März 1918 lautete: „Jetzt gilt es den Sieg auszunutzen, den Feind nicht zum
Stehen kommen zu lassen, Somme und Crozat-Kanal zu überschreiten, bevor feindliche Verstärkungen wirksam werden“.
Was Haig befürchtet hatte, trat nicht ein. Die deutsche Offensive Lief weiter Richtung Süden und lief sich schließlich
tot. Am 31 März war Ludendorff zu der Erkenntnis gekommen, dass „Michael“ gescheitert war. Am 5. April wurde die
Einstellung der Offensive befohlen. Im Hochsommer waren die US-Truppen in Frankreich angekommen und gingen mit den
Franzosen zum Angriff vor. Nur mühsam konnten Hindenburg und Ludendorf den Zusammenhalt der Front waren. Am 24. Oktober
1918 forderte US-Präsident Woodrow Wilson die bedingungslose Kapitulation, am 11.Nuvember Wurde der Waffenstillstand
von Compiegne unterzeichnet.
Zusammenbruch der Westfront und Waffenstillstand .
Als die Offensive dann letztendlich gescheitert war, wurden wir auf Eisenbahnwaggon verladen, in
eine Stellung vor Verdun gebracht und der siebenten bayerischen Division zugeteilt. Als wir ausgeladen wurden nahm der
Franzose den Bahnhof unter Beschuss. Eine Granate traf einen Waggon der mit Seifenpulver beladen war, so dass der ganze
Bahnhof aussah als wäre gerade Neuschnee gefallen. Wir gingen auf die Suche nach Kartoffeln. Als ich mit einem Sack,
vollbeladen die Böschung runter ging um zur Feldküche zu gelangen, schlug unweit von mir eine Granate ein und riss mir
den Sack vom Rücken. Ich bin mit dem Schrecken davon gekommen, mir war nichts passiert.
Der Bahnhof war menschenleer, nur ein par Kaninchen liefen verschreckt durch die Gegend und einigen Kameraden gelang
es welche einzufangen. Am nächsten Tag gelang es uns endlich die Feldküche zu erreichen. Als wir gerade beim Essen
fassen waren, schlug unweit eine Granate ein so dass Pflastersteine das Dach durchschlugen und wir das Weite suchen
mussten. und wir wieder nichts zu Essen bekamen. Ein Friseur aus unserer Kompanie fuhr immer ins Hinterland um uns
mit Proviant zu versorgen. Als er 14 Tage vor dem Zusammenbruch wieder mal zurückkam erzählte er uns schon das der
Krieg nicht mehr lange dauern würde, weil Kaiser Wilhelm mit Frack und Zylinder bekleidet, Deutschland verlassen und
ins Ausland gehen würde. In unserer Einheit hatten wir auch einen Juden der glaubte dass er sich alles erlauben darf.
Eines Morgens ging er in die Küche, als er keinen Koch vorfand stieg er auf die Gulaschkanone und hob den Deckel vom
Kessel in dem der Kaffee kochte an. Der kochende Kaffee verbrühte seine Füße so sehr das er sofort ins Lazarett musste,
für ihn war der Krieg somit zuende. Es kam noch ein Erlass, das Kameraden die 2 Jahre aktiv gedient hatten und
Gefreiter waren sofort zum Sergeanten befördert wurden. Für den 11. November 1918 war ein Waffenstillstand vereinbart
und ab 11 Uhr sollte nicht mehr geschossen werden. Wir hatten unsere Kopfkissen aufgetrennt und eine Kissenschlacht
veranstaltet, um auf diese Art und Weise unserer Freude Ausdruck zu verleihen. Als die Federn durch die Luft flogen
brachen wir in Tränen aus.
In jeder Kompanie wurde ein Soldatenrat gewählt, der aus drei Mann bestand. Wenn der Kompanieführer jemanden bestrafen
wollte, musste er erst den Soldatenrat fragen, der die Strafe befürworten, aber auch ablehnen konnte. Die Offiziere
durften keine Achselstücke mehr tragen, was für sie einer Degradierung gleich kam. Wir waren in einem Dorf
einquartiert und morgens zum Appell angetreten, als einer vom Soldatenrat sich stockbesoffen vor den auf dem Pferd
sitzenden Kompanieführer stellte und schrie: „Alles hört auf mein Kommando”. Der Kompaniechef war wie vom Blitz
getroffen, ihm versagte die Stimme. Wir sahen ein das dies nicht so weiter gehen kann und wählten einen neuen
Soldatenrat. Unser Rückzug begann bei Konflanz, einer Vorfestung von Metz und führte uns zunächst über die
luxemburgische Grenze, wo wir in einem Ort einquartiert wurden. Als wir für die Küche Holz aus dem Wald holen gingen,
entschieden wir uns eine Eiche abzusägen, ohne uns dessen bewusst zu sein, in welchem Forst wir uns befanden. Als wir
beim fällen waren fielen plötzlich Schüsse, die wir auch sofort erwiderten, bis uns ein Elsässer der sich in unserer
Kompanie befand aufklärte: „Kameraden, wir befinden uns hier auf Luxemburgischem Hoheitsgebiet”.
Wir sind dann weiter durch das Fürstentum Birkenfeld marschiert, wo das Städtchen Merzig für uns geflaggt hatte. Das
Elsass haben wir auch noch kurz gestreift. Wo wir bei einem Bauern, der uns kein Stroh für das Nachtlager geben wollte,
einquartiert wurden. Daraufhin gingen wir in die Scheune und haben uns selbst was besorgt. Wir haben dann noch erfahren,
sie hätten ein Schwein geschlachtet und warteten auf den Einzug der Franzosen. Als wir uns 1917, an der Ostfront, in
den in Karpaten, im Einsatz befanden, waren unter uns auch viele Elsässer. Sie durften ihre Heimatpost nicht in
französischer Sprache schreiben, mussten ihre Briefe offen auf der Schreibstube abgeben, wo sie zuerst kontrolliert
und dann abgeschickt wurden. Als ich in einer Nacht, mit einem Elsässer auf einem Vorposten Wache schieben musste,
wollte er mich überreden zum Russen überzulaufen. Als ich darauf nicht eingehen wollte verschwand er plötzlich in der
Dunkelheit und ich habe ihn nie wieder gesehen.
Wir sind dann weiter Richtung Worms und Ludwighafen gezogen, dort wurden wir bei einem Mühlenbesitzer einquartiert,
ein Unteroffizier und vier Mann. Obwohl wir verlaust und verdreckt waren bestand die Müllerin darauf das wir in ihren
Betten übernachteten. „Wenn alles durch ist”, sagte sie, „werde ich alles gründlich reinigen”. Der Müller brachte uns
eine Gießkanne voll Wein und sagte wir sollen es uns Schmecken lassen. Wir haben reichlich davon Gebrauch gemacht, so
dass ich gar nicht weiß wie ich ins Bett kam. Das war meine Erinnerung an die Pfalz. Manchmal waren wir auch 2 Tage im
Quartier.
Vor dem Weitemarsch wurde uns immer gesagt welche Truppe die Vorhut und welche Truppe die Nachhut übernehmen sollte.
Die Nachhut hielt immer Verbindung zu den nachrückenden Franzosen und man muss staunen wie alles reibungslos, ohne
Zwischenfälle von statten ging, was wir in erster Linie dem General-Feldmarschall Paul von Hindenburg zu verdanken
haben, der den Rückzug an der Westfront koordiniert hat.
In Köln angekommen, erhielten wir im Volkshaus unsere Entlassungspapiere, Eisenbahnfahrscheine, Reisepässe,
unterschrieben von Oberstleutnant Mann. Wir mussten Köln umgehend verlassen, weil schon am nächsten Tag die
französischen Besatzungstruppen in einmarschieren sollten. Wir fuhren mit einem Zug der bis Allenstein fuhr, dort
wurden unsere Papiere vom Soldatenrat kontrolliert. Die jüngren Jahrgänge wurden festgehalten, zu neuen Einheiten
zusammengestellt und zur Sicherung der Ostgrenze gegen die Bolschewisten abkommandiert. Ich hatte gesagt das ich noch
einen Schrapnellsplitter in der Kreuzbeingegend habe und durfte daraufhin nach Hause fahren.
Kaum in Ortelsburg angekommen fiel ich wieder dem Soldatenrat in die Hände. Sie haben alles durchsucht, haben mir mein
Seitengewehr und eine Decke abgenommen, aber ich durfte weiter und bin dann kurz vor Weihnachten 1918 auf dem
elterlichen Hof angekommen. Schon auf dem Hof habe ich meine Kleider vom Leib gerissen, weil vor Läusen und anderem
Ungeziefer nicht mehr aushalten konnte und mich erst gründlich gewaschen bevor ich das elterliche Haus betreten habe.
Die Freude über das Wiedersehen war sehr groß.
“ Unser Leben zwischen den beiden Weltkriegen.”
Endlich wieder zurück in der Heimat
Rohmanen war durch die Kampfhandlungen 1914/15 zu einem drittel zerstört worden, aber schon
wieder im Aufbau. Die Firma Grzella aus Ortelsburg hatte die Bauarbeiten übernommen. Unter der Aufsicht von Polier
Karl Kontor wurden die Dachstühle errichtet. Ich habe mich, nach kurzer Erholungspause, auch als Zimmermanngehilfe am
Wiederaufbau beteiligt. Die Firma Grzella hat das Material geliefert und auch unsere Löhne gezahlt. Wegen meinem
Steckschuss bin ich dem VDK beigetreten und habe mit dessen Hilfe eine Rente beantragt die mir auch bewilligt wurde.
Nach vier Jahren wurde ich nach Allenstein zur Nachuntersuchung vorgeladen. Die ärztliche Untersuchung hatte ergeben,
das Geschoß sei verkapselt, und nur das linke Bein etwas in Mitleidenschaft gezogen. Daraufhin wurde die Rentenzahlung
eingestellt.
Der Stellmacher Adam Ornowski war im Krieg als Sanitäter eingesetzt und hatte auf Grund seiner Erfahrungen,
 Beziehungen zum medizinischen Dienst in Ortelsburg aufgebaut. Es wurden dort Lehrgänge in Erster Hilfe angeboten,
die von Prof. Dr. Kutz geleitet wurden. Adam Ornowski hat dafür gesorgt das einige junge Männer aus Rohmanen daran
teilnehmen konnten. Adam Ornowski, August Linka, Emil Rosowski, Johann Dembek, Emil Baschek und ich sind dann dem
Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes beigetreten und mussten jeden Sonntag am Lehrgang teilnehmen. Unser
Gruppenführer war Kreisobersekretär Albrecht, Landrat von Poser, als unser Ehrenvorsitzender, hat viel zu unserer
finanziellen Unterstützung beigetragen und hat dafür gesorgt dass die Bereitschaft eingekleidet wurde.
Beziehungen zum medizinischen Dienst in Ortelsburg aufgebaut. Es wurden dort Lehrgänge in Erster Hilfe angeboten,
die von Prof. Dr. Kutz geleitet wurden. Adam Ornowski hat dafür gesorgt das einige junge Männer aus Rohmanen daran
teilnehmen konnten. Adam Ornowski, August Linka, Emil Rosowski, Johann Dembek, Emil Baschek und ich sind dann dem
Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes beigetreten und mussten jeden Sonntag am Lehrgang teilnehmen. Unser
Gruppenführer war Kreisobersekretär Albrecht, Landrat von Poser, als unser Ehrenvorsitzender, hat viel zu unserer
finanziellen Unterstützung beigetragen und hat dafür gesorgt dass die Bereitschaft eingekleidet wurde.
In jedem Dorf wurde eine Unfallstelle eingerichtet, mit einem Verbandskasten und mit Verbandsmaterial für die erste
Hilfe ausgerüstet. Die Unfallstelle in Rohmanen, die am Haus von der Straßenseite, durch eine Tafel mit einem roten
Kreuz gekennzeichnet war, hatte ich zu verantworten. An Sonntagen wurden wir an Badestellen und bei Fußballspielen
eingesetzt, haben viele Übungen bei Waldbränden durchgeführt und auch Ausflüge nach Rudzany am Niedersee gemacht. Bei
der Einweihung des Tannenbergdenkmals in der Nähe von Hohenstein kamen wir an Straßenkreuzungen zum Einsatz.
Rohmanen hatte auch eine freiwillige Feuerwehr. Bis zum ersten Weltkrieg hat Friedrich Biella als Brandmeister das
Kommando gehabt. Er war aktiver Unteroffizier, hatte gute Führungsqualitäten und die Männer, die allesamt aus dem
aktiven Militärdienst stammten hatten zu ihm ein großes Vertrauen. Nach dem Krieg wollten diese Männer,
(Friedrich Nickel, Friedrich Willam, Julius Wittkowski, Jakob Janowski, Johann Gloddek, Gustav Bednarz), nicht mehr
weitermachen. Friedrich Biella, der inzwischen zum Gemeindevorsteher gewählt wurde, hat sich dann auf einer
Gemeinderatsitzung vorgeschlagen, für die Freiwillige Feuerwehr jüngere Kräfte anzuwerben.
Zum Brandmeister hat er Herrn Wilhelm Pilath vorgeschlagen. Der wurde dann nach Königsberg zur Fortbildung geschickt.
Der Feuerwehr gehörten nun folgende Personen an: Wilhelm Pilath(Brandmeister), August Linka(Stellvertreter), Gustav
Deptolla, Julius Matzey, Johann Dembek, Willy Willam, Gustav Rattay. Der Kreisbrandmeister war Heinrich Thalmann aus
Ortelsburg, sein Stellvertreter war Kreisobersekretär Salzmann. Der Bezirks-Kommissar bei der Ostpreußischen
Feuersozität War Herr Ernst Trzaska. Er hat dafür gesorgt das die Wehr uniformiert und mit Löschgeräten ausgerüstet
wurde. Da die alten Schläuche schon sehr marode waren, wurden sie durch moderne ersetzt, deren Kupplungen auch mit der
Motorspritze übereinstimmten.
Ernst Trzaska hat bei der Feuersozität und beim Landratsamt Finanzmittel beantragt und auch genehmigt bekommen. Der
Schneidermeister Wilhelm Baran wurde beauftragt Tuch und Drillichanzüge nach Maas zu schneidern. Er hat uns
Stoffmuster vorgelegt aus denen wir wählen sollten. Feuerwehrhelme haben wir auch bekommen. Die Gemeinde musste
Finanzmittel bereitstellen, einen Prozentsatz vom Gemeindebudget. Im Brandfall mussten für den Spritzenwagen Pferde
zur Verfügung stehen, von Willy Willam, Gustav Rattay, Julius Matzey und Gustav Dorka, weil sie in der Nähe des
Spritzenhauses wohnten. Am Spritzenhaus wurde ein großer Baum mit Querleisten aufgestellt, wo nach jedem Brand oder
einer größeren Übung die Schläuche zum trocknen aufgehängt wurden.
Der Kreisbrandmeister hat mindestens 2-3-mal im Jahr die Wehren besichtigt. Das ganze Dorf war dann auf den Beinen,
die Bauern mit Pferden, und andere Dorfbewohner mit Eimern und Spaten, wurden dann in verschiedene Gruppen eingeteilt.
Erst hat die Wehr sämtliche Aufstellungen am Gerät geübt; Grundstellung Fahrstellung und Marschstellung. Dann wurde
ein Brand angekündigt, die Feuerwehr mit der Spritze an den Brunnen, die Gruppen dort wohin sie beordert wurden, die
Bauern brachten mit den Wasserkiwen Wasser aus dem Brunnen zum Brandort. Wenn das Wasser im Brunnen alle wurde hat
man den Saugkorb in die Kiewen gelegt und dort Wasser entnommen. Die Wassergruppe ging mit Eimern zum Dorfteich, holte
Wasser und füllte damit die leeren Kiewen.
Der Löschtrupp ging mit Feuerhaken und Löschpatschen auf die umliegenden Gehöfte und versuchte das vermeintliche Feuer
von ihnen fernzuhalten. Nach dem Alarm wurde wieder am Spritzenhaus angetreten. Die Gruppenführer mussten angeben ob
ihre Gruppe auch vollständig erschienen war, denn Übungen wurden nur vor, oder nach der Feldarbeit durchgeführt, so
dass niemand eine Entschuldigung vorbringen konnte. Wer ohne begründete Entschuldigung nicht anwesend war erhielt eine
Verwarnung. Der Kreisbrandmeister erklärte dann welche Handgriffe den Vorschriften entsprachen und welche nicht. Die
Schläuche wurden noch schnell zum Trocknen aufgehängt. Anschließend gingen wir alle in den Gasthof Trzaska, haben über
vorhandene Mängel diskutiert, Verbesserungsvorschläge unterbreitet und zwischendurch den Durst gelöscht. Der
Kreisbrandmeister ist dann, nach einer kurzen Verabschiedung, ins nächste Dorf gefahren, weil er an einem Tag mehrere
Feuerwehren betreuen musste.
Der Rohmaner Dorffriedhof

Einen Kilometer vom Ende des Dorfes entfernt, auf der rechten Seite der Landstraße in Richtung
Ortelsburg, befand sich der Rohmaner Dorffriedhof. Wann dieser Friedhof angelegt wurde entzieht sich meiner Kenntnis.
Nach Aussagen älterer Dorfbewohner soll davor auch schon eine Ruhestätte vorhanden gewesen sein, und
zwar auf der linken Straßenseite gegenüber dem jetzigen Friedhof. An dieser Stelle befand sich bis in die
Nachkriegszeit ein kleiner Brunnen, aus dem die Dorfbewohner, das Wasser zum begießen der Grabbepflanzung auf den
Gräbern ihrer verstorbenen Angehörigen holten. Der Friedhof war in einer Hanglage angelegt, wahrscheinlich weil diese
Parzelle für eine landwirtschaftliche Nutzung nicht geeignet war. Um das Gräberfeld vor herumstreunenden Tieren oder
von der Weide entlaufenen Kühen zu schützen, hat man das ganze Gelände mit einem Holzzaun umgeben. Der Zugang befand
sich von der Straßenseite. Unter einem Torbogen hindurch wurden die Verstorbenen zu Grabe getragen. Die Gräber der
einzelnen Familien waren nebeneinander angelegt, mache, wie zum Beispiel die der Familie Trzaska, sogar mit einem
schmiedeeisernen Zaun eingefasst.
Nach dem 2. Weltkrieg verfiel der Friedhof immer mehr. Die nötigen Finanzmittel für die Pflege der Einfriedung konnten
von den restlichen noch verbliebenen Deutschen nicht mehr aufgebracht werden. An den gepflegten Gräbern konnte man noch
erkennen dass es Verwandte von noch in Rohmanen wohnenden Deutschen waren, oder von bereits im Westen Deutschlands
lebenden, die ihre noch in Rohmanen wohnenden Nachbarn damit beauftragt hatten. Die übrigen Gräber wurden von Jahr zu
Jahr immer mehr von Wildkräutern überwuchert und schließlich auch von Sträuchern und schnell wachsenden Bäumen.
In den späteren Jahren konnte man nicht mehr erkennen dass dort vor Jahren Tote zur letzten Ruhe gebettet wurden. Die
Natur holte sich das ganze Gelände zurück und nur unter großen Schwierigkeiten konnten Besucher aus dem Westen das
Friedhofsgelände noch betreten.
Das Gasthaus Trzaska

Nach dem ersten Weltkrieg hat der Gastwirt Friedrich Trzaska neben dem Gasthof einen großen Saal
für Festlichkeiten und Vereinsfeiern gebaut, in dem schon mal Feuerwehrfeste veranstaltet wurden. Ernst Trzaska war
Feuerkommissar bei der Ostpreußischen Feuersozität. Erich Trzaska war Vollziehungsbeamter beim Amtsgericht in
Ortelsburg. Unser Feuerkommissar war uns beim organisieren der Veranstaltungen sehr behilflich, hat uns den Saal, die
Musik und die Theaterstücke besorgt und die Feuerwehren aus den Nachbardörfern eingeladen.
Zu Manöverzeiten, vor dem 2. Weltkrieg und dann auch während des Krieges, waren im Gasthof Soldaten, meist im Range
eines Offiziers, einquartiert. Fräulein Mariechen Trzaska hat die Poststelle im Dorf betreut. Nachdem ich 1939 zum
Militär eingezogen wurde, hat sie, nach einer Schulung im Ortelsburger Krankenhaus, auch die Unfallmeldestelle
übernommen. Nach dem Krieg, pflegte sie mit vielen Bekannten, die bereits in der Bundesrepublik wohnten, einen regen
Briefwechsel. Auf dem Rohmaner Friedhof hat sie viele Gräber, im Auftrag von Angehörigen, die auf Grund ihrer
Abwesenheit, dazu nicht mehr in der Lage waren, gepflegt. Der Bauunternehmer Kurnitzki aus Ortelsburg, äußerte die
Bitte, sie möchte ihm doch ein Blatt vom Rosenstrauch, der auf dem Grab seiner Eltern steht, in den Brief legen. Als
sie uns den Brief vorgelesen hat, waren wir zu Tränen Gerührt. Sie hat als Letzte aus ihrer Familie, bis zu ihrem Tod
im Jahre 1960, in Rohmanen, im Gebäude der Gastwirtschaft gewohnt und ist auf dem Rohmaner Friedhof beerdigt worden.
Fleisch und Wurstwaren Karl Pelkowski
Im Jahr 1931 hat der Fleischermeister Karl Pelkowski, aus Grammen, direkt neben unserem Hof ein
Anwesen gekauft und dort eine Fleischerei eingerichtet. Er war mit meiner Schwester Frieda, verheiratet. Am Anfang hat
er die Schweine noch auf seinem Hof geschlachtet, später dann im Ortelsburger Schlachthof. Jede Woche fuhr er 2-mal,
mit dem Pferdewagen(Einspänner), nach Ortelsburg zum Wochenmarkt, wo er seine Fleisch und Wurstwaren zu Verkauf anbot.
Am Tag davor, wenn er die Wurst gekocht hat, kamen viele Rohmaner mit Kannen oder anderen Gefäßen, wegen der guten
Wurstsuppe, die er umsonst unter die Leute verteilte. Als Karl Pelkowski, Ende August 1939 zum Militär eingezogen
wurde, hat seine Frau das Pferd verkauft und den Beitrieb stillgelegt. Am Haus hing, immer noch die Tafel mit der
Aufschrift: Karl Pelkowski, Fleisch und Wurstwaren. Ein Witzbold hat irgendwann darunter geschrieben; „Fleisch und
Wurst waren einmal”, drauf hin hat Frau Pelkowski die Tafel entfernen lassen. Karl Pelkowski ist im Mai 1946 in
französischer Gefangenschaft verstorben. Seine Ehefrau Frieda, verstarb an ihrem 85. Geburtstag in Mettmann bei
Düsseldorf.
Die steinreichen Rohmaner Felder
Die letzte Eiszeit hat bei der Schmelze, auf der Rohmaner Feldgemarkung viele Steine und
Granitblöcke zurück gelassen. Überirdisch, aber besonders unter der Erde, gab es viele kleine, aber auch große Steine,
die, den Bauern, beim Pflügen und anderen Feldarbeiten sehr viel Schweiß, abverlangten. In einer Kiesgrube, auf dem
Feld des Bauern August Radek, lag ein Granitblock, von schätzungsweise 100 cbm. Vor etwa 80 Jahren, als man für diese
Steine noch keine Verwendung hatte, griffen die Bauern zu einer „List”. Weil er sonst nicht pflügen konnte, hat mancher
seinem Nachbarn, die Steine in der Nacht auf dessen Feld abgeladen. Als diese Tätigkeit unter Strafe gestellt wurde,
hat man die Steine in Schluchten gekippt und mit Mutterboden zugeschüttet. In späteren Jahren kam diese jedoch beim
pflügen wieder an die Oberfläche. Dann hat man aber schon Steine für den Straßenbau gebraucht und konnte sie so zu Geld
machen. Besonders im Raum südlich von Ortelsburg, bis zur polnischen Grenze, wo Steine eine Rarität waren, kamen sie
jetzt zum Einsatz. Auch beim Bau von Häusern, besonders für die Fundamente, wurden sie eingesetzt, weil auf diese
Weise viel Ziegeln eingespart wurden. Die Firma Gribienski aus Ortelsburg hat die großen Steine mit Dynamit gesprengt
und auf diese Weise die weitere Verarbeitung erleichtert.
Die Steine welche beim Pflügen aus dem Boden geholt wurden, hat man am Feldrand auf große Haufen zusammen getragen.
Wenn die Feldarbeit beendet war, sowie auch in den Wintermonaten, waren wir jeden Tag mit Steinen unterwegs. Wir sind
vorwiegend am Abend los gefahren, weil unter der schweren Last die Wagenachsen so heiß wurden und die Gefahr bestand,
das durch die Dehnung, die Räder blockiert würden. Bei einer Fahrt konnte man bis zu 24 Reichsmark verdienen, wogegen
1 Zentner Roggen für 8 bis 9 Reichsmark zu haben war. Ich bin selbst, mit dem Pferdewagen bis Fürstenwalde, Radostowen,
Luka, Altkirchen, Höhenwerder, ja sogar bis Friedrichshof gefahren.
In Rohmanen wurden auch rote Ziegeln gebrannt. Viele Häuser wurden, mit Ziegeln erbaut, die nur wenige 100 Meter von
der Baustelle entfernt hergestellt wurden. Der Lehn wurde auf den Feldern in der näheren Umgebung entnommen, dann von
Ochsen solange getreten, bis er so geschmeidig war, das er sich in Formen einstreichen ließ. Wenn die Ziegel in der
Form trocken war, wurde sie entnommen und in einem Brennofen gestapelt. Um einen Ofen richtig anzufeuern, brauchte man
12 Raummeter Holz, das im Zeitraum von ein par Tagen verheizt wurde. Der Fischer Karl Glitza hatte schon eine
Knetmaschine, die von einem Pferd angetrieben wurde, das mit verbundenen Augen, den ganzen Tag in die Runde ging.
Im Dorf waren auch vier Kalköfen, in denen so genannte Kalksteine, die sich an gewissen Stellen, im Erdboden befanden,
gebrannt wurden. Nach dem Brennen wurden die Steine mit Wasser abgelöscht und die daraus entstandne Masse diente, nach
dem Beimischen einer gewissen Menge Sand, dann als Bindemittel beim Häuserbau. Das Gerichtsgebäude und das
Lehrerseminar in Ortelsburg wurden mit Kalk, aus dem Rohmaner Brennöfen erbaut. Auch zum Bau einer Eisenbahnbrücke, auf
der, der Zug, den Sawitzfluß, von Ortelsburg nach Allenstein überquerte, hat mein Großvater, mit einem Ochsengespann,
Kalk gefahren.
Hinter der Scheune, beim Bauern Johann Dembek hat man Tonerde gefördert, aus der man mit Hilfe einer Formerscheibe,
die von einem Arbeiter mit Muskelkraft(Fußbetrieb) angetrieben wurde, schöne Krüge, Schalen und Vasen geformt hat.
Die Töpferware wurde, nachdem sie trocken genug war, auch in einem Ofen gebrannt, anschließend mit einer Lasur
überzogen und wieder gebrannt. Es wurden auch Kacheln zum Bau von Kachelöfen hergestellt, die mit verschiedenen
Ornamenten versehen, die Wohnstuben unserer Vorfahren schmückten. So haben unsere Großväter ihr Leben gemeistert und
nach und nach, unsere Dörfer aus der Rückständigkeit in die Neuzeit geführt.
Das gesellschaftliche Leben nach dem 1. Weltkrieg

Als der Lehrer Alfred Dorka, ein Frontkämpfer des Ersten Weltkrieges und ein Sportsmann, als
zweite Lehrkraft an der Rohmaner Schule angestellt wurde, hat er die Sitten und Gebräuche aus früherer Zeit wieder zum
Leben erweckt. Zuerst hat er die Jugend zusammen gerufen, einen Jugendverein und einen Fußballclub, gegründet. Zum
Vorsitzenden des Fußballclubs wurde Johann Gloddek berufen, der ihn auch geleitet hat. Bauer Wilhelm Spittka, der am
Rohmaner See wohnte, stellte Land für einen Sportplatz unentgeltlich zur Verfügung. Lehrer Alfred Dorka hat am
Rohmaner See eine Badestelle ausgesucht und ein Sprungbrett bauen lassen. An jedem Sonnabend im Sommer, bevor die
Sonne unterging, versammelte sich die gestammte Jugend des Dorfes an der Badestelle am See. Es wurde gebadet,
Heimatlieder gesungen, gespielt, im Fackelschein eines großen Biwakfeuers, bis in die späte Nacht hinein. Der Fischer
Karl Glitza hat uns Kähne zur Verfügung gestellt, mit denen wir auf den See hinausgepaddelt sind, dabei hatten wir viel
Spaß, was wiederum den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft gefördert hat. Ich habe mit meiner Mandoline den Gesang von
Volks- und Heimatliedern begleitet.
Der Rohmaner See liegt in einem Tal, dessen Hänge zu beiden Seiten mit Kiefern und Tannen bewaldet sind. Wenn man
gesungen oder Musiziert hat, hallte es von den Hängen zurück. Die Ufer waren mit Kalmus und Schilf bewachsen, was für
die Fischaufzucht von Vorteil war. Wenn man an einem sonnigen, windstillen Tag, am Seeufer spazieren ging, traf man
oft auf Flachstellen, an denen sich die Fischbrut im Sonnenlicht wärmte, wie ein Mückenschwarm. Im See befanden sich
folgende Fische: Karpfen, Hechte, Schleie, Barsche Plötze, Rotaugen, Aale und Krebse. Am Sonntagmorgen brachten viele
Rohmaner ihre Pferde zum See um sie zu baden.
Es wurden dort, unter der Aufsicht von Lehrer Dorka, auch viele Jugendfeste mit Theatervorführungen veranstaltet, zu
denen er selbst die Vorlagen organisiert hat. Der am See wohnende Bauer Johann Nadrowski, hat uns ein Scheunentor, als
Tanzboden zur Verfügung gestellt. Der Zimmermann Wilhelm Wittek hat uns eine Windmühle gebaut, die am auf dem Boden
liegenden Scheunentor aufgestellt wurde, dazu kamen Noch Tannen und Fichten, die das Ganze wie ein Bühnenbild
erscheinen ließen. Es wunden viele Bühnenstücke aufgeführt, unter anderen >Alte Weiber werden jung gemahlen<. Dazu bot
die Windmühle die entsprechende Kulisse.
Nach der Vorführung wurde der Boden aufgeräumt, um dann als Tanzdiele zur Verfügung zu stehen. Der Gastwirt Trzaska
hatte Tische und Bänke aufgestellt, Speisen und Getränke angeboten, so dass sich die die Veranstaltung bis in die
späte Nacht hinein zog. Es waren auch Leute aus Ortelsburg und anderen Nachbardörfern dabei. Im Winter hat Lehrer
Dorka eine Kreisrodelbahn eingerichtet, die von Zeit zu Zeit mit Wasser besprengt wurde, um die Gleitfähigkeit zu
verbessern. Von einer Anhöhe ging hinunter bis auf den halben See, was für alle ein großes Vergnügen war. Es kamen
Lehrer mit Schulklassen aus der näheren Umgebung um hier zu Rodeln.
Als Herr Lehrer Jobski als Hauptlehrer nach Rohmanen kam hat er mit dem Bürgermeister und der Gemeindeverwaltung
beschlossen, in der Nähe des Dorfes, auf einem zur Schule gehörenden Grundstück, einen Sportplatz anzulegen. Dafür
wurde gleich hinter den Gärten, 6 Morgen Ackerland abgetrennt, und nach Feierabend hat Lehrer Dorka mit den
Jugendlichen eingeebnet und gleich nebenan einen Graben für Schützenstand und Kugelfang ausgehoben. Am Sonntagvormittag
wurde Fußball gespielt und um 15:00 Uhr war Kleinkalieberschießen angesagt. Es musste auch ein kleiner Beitrag erhoben
werden, um Munition kaufen zu können. Eine Büchse konnten wir aus beim Kleinkalieberverein in Ortelsburg ausleihen.
Nach Hitlers Machtergreifung
Als Adolf Hitler an die Macht kam wurde die SA gegründet. Der Bürgermeister Michael Kownatzki
wurde zum Gruppenführer ernannt und folgende Männer haben sich freiwillig gemeldet: Wilhelm Matzey, Johann Gloddek,
Gustav Nadrowski, August Buttler, Karl Baran, Emil Nickel, Wilhelm Jaschinski, Emil Bork, Ernst Rattay und Gustav Bach.
Bei Versammlungen war die SA in Uniform angetreten um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Wer versucht hat Unruhe zu
stiften, egal aus welchem Grunde, wurde aufgefordert den Saal zu verlassen, andernfalls wurde er mit Gewalt entfernt.
Herr Lehrer Jobski wurde zum politischen Leiter ernannt, seine Frau hat die NS-Frauenschaft gegründet, Lehrer Dorka
die HJ, und so bekam die Dorfgemeinschaft, nach und nach ein anderes Gesicht. Der Sportplatz und der Schützenstand
wurden jetzt mehr als früher in den Mittelpunkt gestellt. Nach der Feldarbeit hat der Bürgermeister Fuhrwerke bestellt
und den Sportplatz noch besser herrichten lassen.
Der Bauer Wilhelm Both wurde zum Ortsbauernführer ernannt, mit der Aufgabe alles Land für den Anbau von Getreide und
Futtermittel bereitzustellen, oder wenn das nicht möglich war mit Wald aufzuforsten. Durch den Einsatz von Kunstdüngern
sollten größere Erträge aus dem Boden geholt werden, um den Viehbestand zu vergrößern und mehr Milch und Butter zu
produzieren. Deutschland sollte im Stande sein sich selbst zu selbst zu ernähren, ohne auf Importe angewiesen zu sein.
Frau Jobski hat, innerhalb der der NS-Frauenschaft, mit Hilfe von Fachkräften aus Ortelsburg, Lehrgänge veranstaltet,
auf denen man Backen und Nähen lernte. Auf den Bauernhöfen befand sich auch immer mehr Rassegeflügel, das eine erhöhte
Produktion von Eiern und Geflügelfleisch sicherstellen sollte.
Die Rohmaner Bauern hatten, außer in der Landwirtschaft, noch andere Verdienstmöglichkeiten in der Kreisstadt. In
Ortelsburg wurden vier Sägewerke betrieben, die mit Langholz aus dem Walde versorgt werden mussten. Wir haben eine
Kiefer von über 8 Festmeter angefahren, der wir zuerst 6 Meter Spitze abschneiden mussten, um diese Last überhaupt
auf den Wagen zu bekommen. Sechs Pferde musste angespannt werden um den Wagen zur befestigten Straße zu bringen.
Fichten und Tannen wuchsen bis zu einer Länge von 30 Metern. Auch beim Transport von Ziegel, von der Ziegelei zum
Bahnhof, konnte man gutes Geld verdienen.
Im Jahr 1934 wurde Rohmanen an das überregionale Stromnetz angeschlossen und schaffte auf diese Weise den Sprung von
der Petroleumlampe zur Glühbirne. Neben dem Grundstück von Karl Pietzonka wurde ein Transformatorhäuschen errichtet,
in dem der ankommende Strom von einer Hochspannung auf eine Verbrauchsspannung transformiert wurde. Es gab schon eine
Überlandleitung, die aus Richtung Ortelsburg kommend, quer über die Felder, in Richtung Neu Keykuth weiter ging.
Durch eine Zwischenspanne wurde der Transformator, mit der Hauptleitung auf Kownatzkis Feld verbunden.
Ein Stromanschluss konnte die Arbeit im Haus und Hof auf vielfältige Weise erleichtern, doch nur die besser gestellten
Bauern, sowie noch manche Pensionäre, die ein festes Einkommen hatten, konnten sich dass leisten. Weil nur wenige an
der Elektrifizierung teilnahmen, war ein Stromanschluss mit hohen Kosten verbunden. Nur Gustav Pietzonka, Gasthof
Trzaska, Friedrich Nickel, die Schule und Wilhelm Both, wurden in der ersten Phase erfasst.
Im Jahr 1952 wurde von den polnischen Behörden die zweite Stufe der Elektrifizierung eingeleitet, in der alle im Dorf
stehen Gebäude erfasst wurden. Am Anfang wurden nur Leitungen für Lichtstrom gelegt und auch nur 3 Lichtstellen pro
Haushalt bewilligt. Doch im nachfolgenden Zeitraum wurden dann, wenn Material vorhanden war, weitere Lichtpunkte
angelegt. 1952, am zweiten Wochenende im Advent, wurden dann die Leitungen geschaltet und alle waren von der
plötzlichen Helligkeit sehr begeistert. Wenn man Glühbirnen auswechseln wollte musste man am Anfang weite Wege
zurücklegen, um welche zu bekommen. In den 60ger Jahren wurden dann immer mehr Starkstromleitungen gelegt, weil die
Bauern elektrische Geräte kaufen konnten. Ende der 60ger wurden auch die Abbauten an das Stromnetz angeschlossen.
Das Urnengrab auf unserem Feld
Auf unserem Feld, in Richtung Seelonken, bin ich oft beim pflügen gegen Steine gestoßen, manchmal
rissen sogar die Stränge am Pferdegeschirr. Eines Tages nahm ich einen Spaten, Brechstange und einen langen Baum, um
der Sache auf den Grund zu gehen. Als ich eine Menge Sand ausgehoben hatte stieß ich auf eine steile, aus Steinen
errichtete Wand, die ich auch mit dem Baum nicht aus der Fassung bringen konnte. Ich habe den ganzen Vormittag gegraben,
konnte jedoch nicht unter die Steine kommen. Einige Tage später hatten wir in der Schule eine Bauernversammlung, da
habe ich Herrn Biella und Herrn Lehrer Dorka von meinem Fund berichtet. Am nächsten Morgen kam der Lehrer Dorka mit der
ganzen Schulklasse, mit Spaten und Sieben ausgerüstet auf unser Feld und fingen an die ausgehobene Erde zu sieben.
Lehrer Dorka benachrichtigte daraufhin den Leiter des Ortelsburger Heimatmuseums, der am nächsten Morgen vorbei kam um
sich die Fundstelle genau anzusehen. Er beauftragte ihn 4 Mann zu besorgen, um die Steine ringsum frei zu schaufeln.
Zwischen den Steinen durften wir die Erde nur mit Esslöffeln ausheben. Als es plötzlich zu regnen anfing hat Lehrer
Dorka die Brauerei Daum, in Ortelsburg angerufen, die uns über der Fundstelle ein Zelt errichtet haben, damit wir
ungestört weiterarbeiten konnten. Wir fanden 8 flache und 8 hohe Urnen zu beiden Seiten am Körper. Die Urnen wurden in
Gipsbinden eingewickelt und ins Heimatmuseum nach Ortelsburg gebracht, wo sie durch einen Fachmann, der extra aus einem
Königsberger Museum angereist war. Nach Reinigung der Urnen hat er festgestellt, das die Grabstätte etwa 2000 Jahre vor
Christi Geburt angelegt wurde und ein Doppelgrab war, in dem ein Toter liegend und einer in Hochstellung beigesetzt
wurde.
Die Nachricht von der Fundstelle verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Es erschienen viele Schaulustige, ganze
Schulklassen aus der Umgebung, mit Autos und zu Fuß. Durch die vielen Menschen wurden die bestellten Ackerflächen auf
unserem Feld sehr in Mitleidenschaft gezogen, eine Entschädigung haben wir nicht erhalten. Das Grab wurde vor dem
Heimatmuseum in Ortelsburg wieder so aufgebaut wie man es auf unserem Feld vorgefunden hat. Für den Transport der
Steine wurde ich entlohnt. Die Urnen hat das Königsberger Museum an sich genommen und wollte sie nicht wieder hergeben,
weil die solch einen Fund noch nicht in ihrer Sammlung hatten.
Sonnenwendfeuer
Am 24 Juni fand eine Sonnenwendfeier statt. Ein Brauch der an die alten Germanen erinnern sollte.
Der Lehrer Dorka hat den Bürgermeister beauftragt 2 Fuhrwerke in den Wald zu schicken, die Holz und alten Reisig holen
und auf dem großen Schulberg abladen sollten. Das Straßenbauamt hat uns Teertonnen zur Verfügung gestellt. Die ganze
Dorfgemeinschaft wurde eingeladen, am Abend, nach der Feldarbeit, an der Sonnenwendfeier teilzunehmen. Lehrer Dorka
hielt zuerst eine Ansprache, in der er anschaulich erklärte wie unsere Vorfahren in grauer Vorzeit gefeiert haben.
Nach dem offiziellen Teil wurden das Holz und die Teertonnen angezündet, es wurden Heimatlieder gesungen, wie: Wild
flutet der See, drauf schaukelt der Schiffer den schwankenden Kahn, Schaum wälzt er wie Schnee, von grausiger Mitte
zum Ufer heran, wild fluten die Wellen auf Vaterlands See, wie schön, oh trag mich auf Spiegel zu Hügel, Masovias See.
Masovia Land, mein Heimatland, Masovia es lebe mein Vaterland.
Lehrer Alfred Dorka und sein Wirken für Rohmanen.

Friedrich Biella hatte auf seinem Feld einen Granitstein mit einer geraden Seite, den haben wir
mit viel Schweiß an den Dorfteich transportiert und auf einer Erhöhung abgelegt. Der Stein sollte zum Denkmahl für die
Gefallenen des Ersten Weltkrieges umgestaltet werden. Da zu Wenige daran ein Interesse zeigten, wurde diese Idee fallen
gelassen und der Stein irgendwann ins Wasser gerollt. Der Lehrer Dorka war viele Jahre in Rohmanen tätig, dort hat er
später seine ehemalige Schülerin, Lotte Biella geheiratet. Er hat sich sehr für die Entwicklung des Dorfes interessiert,
war bei jeder Gemeindeversammlung anwesend und hat auf Schwachstellen hingewiesen die den Fortschritt behinderten.
Gemeinsam mit den Schülern hat er den Ehrenfriedhof für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges gepflegt, an der
Wegegablung nach Eichtal und zu Ehren des Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg eine Eiche gepflanzt.
Zum Advent hat Lehrer Dorka mit der Jugend einen Adventstern, in verschiedenen Farben gebastelt.
Der Stern wurde auf einer 2 Meter langen Stange befestigt, in der Mitte wurde ein Wachslicht angezündet, am Stern
wurde eine Schnur angebracht, wenn man daran zog rollte der Stern hin und her. Am ersten Wochenende im Advent
versammelten sich jung und alt, um den Stern durch das Dorf zu tragen. Alle schlossen sich dem vorausgehenden
Sternträger an, der den Stern durch die Hauptstraße und die angrenzenden Wege trug. Dieser Sternmarsch wurde an den
folgenden Adventwochenenden wiederholt.
Am ersten Weihnachtfeiertag wurde um 4:00 Uhr morgens ein Frühgottesdienst gehalten. Zuerst hat der Pfarrer eine
Andacht gehalten, dann haben die Kinder ein Krippenspiel aufgeführt und die Gemeinde hat schöne Weihnachtslieder
gesungen. Der Gastwirt Trzaska hat uns den Saal zur Verfügung gestellt. Wir hatten eine Posaunen- u. eine
Gitarrengruppe. Unter der Leitung von Herrn Willi Doormann spielten: Gottlieb Brosch, Fritz Ollech,
Gustav Rattay(Sopran), Wilhelm Pilath, Gustav Brosch(Alt), Fritz Both(Tenor) und Fritz Brosch(Bass).
In der Gitarrengruppe wirkten mit: Martha Ollech, Hedwig Ollech, Martha Lekzik, Martha Michalick und Auguste Lekzick.
Willy Doormann hat sie auf der Geige begleitet.
Kurz vor Ausbruch des 2. Weltkrieges
Bei der Aufstellung des Grenzschutzes(Regiment Buchholz), hat er als Hauptfeldwebel die
Gruppenführerkurse überwacht und selbst die fähigsten Männer dafür vorgeschlagen. Das Ausbildungspersonal hat das
Jäger-Battalion gestellt. Wir kamen zuerst ins Stadion(Waldheim), wurden da eingekleidet und dann ging es gleich
kasernenmäßig zu, theoretisch und praktisch. Jeder musste vor die Front treten und nachweisen ob er im Stande ist,
Befehle zu erteilen. Abends wurden Filme vorgeführt die uns zeigen sollten wie eine Gruppe sich im Gelände entfalten
muss. Die Exerziervorschriften hatten sich, im Verhältnis zu Kaiser Wilhelms Zeiten, etwas geändert. Damals bestand
eine Gruppe aus 8 Mann und einem Unteroffizier, jetzt aus 10 Schützen, 3 für das leichte Maschinengewehr und einem
Unteroffizier(13 Mann). Nach der Schulung folgte eine Abschlussprüfung, danach ein gemütliches Beisammensein. Aus
Rohmanen haben folgende Männer die Prüfung bestanden: Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy, Gustav Rattay und
Gustav Deptolla. Unsere Uniformen waren alle zu klein und es gab viel zu lachen bei der Anprobe.
Die erste Übung habe ich mit Emil Rosowski, in Lenzinen gemacht. Der Gutsbesitzer Marzinzick hat seine Scheune als
Unterkunft zur Verfügung gestellt. Er war im Range eines Hauptfeldwebels. In seinem haus war die Schreibstube
untergebracht, die er selbst verwaltete. Ein Lastauto hatte Uniformen aus der Kaserne in Ortelsburg geholt, jeder
musste eine Uniform anlegen und dann wurde solange getauscht bis alle eine passende gefunden hatten. An den Namen des
Kompanieführers kann ich mich nicht mehr erinnern. 1935 wurden wir zu einer Übung in die Dragonerkaserne nach Lyk
einberufen. Die Gruppenführer, Zugführer, und Kompanieführer die schon Frontberührung im dem Ersten Weltkrieg hatten,
mussten eine Woche früher anreisen. Die Übungen waren auf 6 Wochen angelegt. Die meisten der einberufenen waren noch
nie mit dem Wehrdienst in Berührung gekommen. Jeder Gruppenführer bekam 13 Mann zugeteilt.
Unser Zugführer war Leutnant Neumann, Kompanieführer Oberleutnant Rutschko, Battalions-Kommandeur Major Gröning
(Regiment Buchholz). Hier ging es wieder Kasernenmäßig voran. Das Bataillon wurde hier vereidigt. Jeden zweiten
Sonntag durften unsere Frauen uns besuchen. Ein Jahr später wurden wir wieder zu einer Übung einberufen, auf den
Truppenübungsplatz nach Arys. Jeder Gruppenführer hatte den Auftrag die Gruppe zu entfalten, und auf bewegliche
Figuren zu schießen. Diese Übung musste später mit scharfer Munition wiederholt werden. Jedes Maschinengewehr bekam
50 Schuss, jeder Schütze 20 Schuss zugeteilt. Nach dem Abschießen wurden die Treffer gezählt und dem Kommandierenden
Bericht erstattet. In einiger Entfernung spaziert ein Storch umher, der gar nicht bemerkt hatte dass geschossen wurde,
was bei den Kameraden ein großes Gelächter hervorrief.
Nach der Übung wurde uns gesagt das jeder Gruppenführer eine arische Abstammung nachweisen sollte. Ich konnte in den
Rheinsweiner Kirchenbüchern meine Vorfahren aus Gellen, bis zum Jahr 1732 zurück, nachweisen und wurde zum
Unteroffizier befördert. Aus unserem Dorf wurden auch, Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy und Gustav Deptolla
befördert. Zwischendurch mussten wir schon mal in die Radfahrer-Kaserne nach Ortelsburg, Gewehre empfangen und im
Gelände üben. Am 31 Juli 1939 wurde mir von einem Soldaten ein Schreiben übereicht, das mich aufforderte, am 1. August
um 6:00 Uhr, bei der 3. Kompanie, des 2. Infanterieregiments zu erscheinen.
Um 5:30 hat mich meine Schwester in die Kaserne gebracht. Auf der Schreibstube erklärte mir der Hauptfeldwebel,
dass mir ab sofort der Dienstgrad eines Sanitäters zugewiesen wird, ich mich in der Kammer einzukleiden hätte und mir
in der Handwerkerstube die entsprechenden Schulterklappen annähen lassen sollte. Die aktiven Sanitäter wurden den
Feldlazaretten zugewiesen und wir kamen an ihre Stelle. Unser Bataillon wurde nach Schodmak zum Bunker bauen und
Stacheldraht verlegen eingeteilt. Wir zogen in Begleitung einer Musikkapelle bis zur Kreuzung am Krankenhaus, dann
weiter zu unserem Bestimmungsort, gefolgt von einer Gulaschkanone die in den nächsten Tagen für unsere Verpflegung
sorgen sollte.
Am 14 August haben wir die Jägerkaserne, begleitet von einer Musikkapelle endgültig verlassen und zogen zuerst durch
Ortelsburg, dann über Lehmanen ins Feldmanöver, hinter Rohmanen. Dort entfaltete sich das Bataillon im Gelände, die
Verwundetensammelstelle wurde auf dem Hof des Bauern Friedrich Neumann eingerichtet. Gegen Abend wurde zu Sammeln
geblasen und Biwak bezogen, wobei unsere 3.Kompanie, in einem kleinen Wallt, in der Nähe von Otto Nickels Gehöft
Stellung bezogen hatte. Die 2. und 4. Kompanie hatte sich in der Nähe vom Abbau Pallasch niedergelassen. Die Frau
Nickel hat am Abend ein Mädel in Dorf geschickt um meiner Frau Bescheid zu sagen, wo wir uns zurzeit befinden. Meine
Frau ist dann noch gekommen um sich von mir zu verabschieden, weil wir am nächsten Morgen um 3:00 Uhr Zelte abbrechen
und um 4:00 Uhr in Richtung Kaspersguth marschieren sollten.
Wir sind dann über Achodden, Seelonken, Lehmanen, Ortelsburg, bis nach Grammen und Schützendorf marschiert, wo wir an
einem See Biwak bezogen haben. Es wurde immer gesagt, wir kommen zum Tannenberg-Denkmal bei Hohenstein, wo ein Reichs
Kriegervereinsfest stattfinden sollte. Es wurden auch schon Vorkommandos aufgestellt, doch dann kamen wir nach Orlau
und Lahna-Mühle, da wo die Alle entspringt haben wir 2 Tage biwakiert. Unser Kompanieführer hat uns nach Waplitz auf
den Soldatenfriedhof des Ersten Weltkrieges geführt und uns erklärt wie das Jägerbataillon sich 1914 hier entfaltet
hat und aufgerieben wurde. Dann mussten wir in der Nähe von Gut Koslau über einen Fluss und bezogen in einem Waldstück,
vorbereitete Stellungen in der Nähe der polnischen Grenze. Herr und Frau Thalmann haben uns jeden Tag, bis zur Grenze,
mit Brötchen und Getränken versorgt. Es wurde scharfe Munition ausgegeben, weil wir am nächsten Morgen um 4:00 Uhr die
polnische Grenze überschreiten sollten.
Am nächsten Morgen um 10 Minuten vor 4:00 Uhr kam der Befehl; scharfe Munition abgeben, alles zurück in ein 6 Kilometer
entferntes Dorf, wo wir auch einquartiert wurden. Das alles geschah’ eine Woche vor dem 1. September 1939. Es wurde
gesagt dass der Führer dem polnischen Präsidenten Rid-Szmigly, ein Ultimatum gestellt hat und es wahrscheinlich nicht
zum Krieg mit Polen kommt. Genau nach 5 Tagen kehrten wir wieder in die gleichen Stellungen zurück, es wurde wieder
scharfe Munition ausgegeben und am nächsten Morgen um 4:00 Uhr überschritten wir die polnische Grenze.
“Der 2. Weltkrieg.”
Der erste Einsatz in Polen
Wir kamen zuerst in ein Dorf in dem sich nur alte Menschen befanden. Auf unsere Frage wo denn die Bewohner wären sagte
man uns dass alle geflohen sind, weil erzählt wurde, die Deutschen würden alle Polen misshandeln und verstümmeln. Ich
habe ihnen daraufhin gesagt dass uns, unter Androhung von Strafe verboten wurde, einem Zivilisten etwas anzutun. Das
Vieh, die Schweine und Hunde des Dorfes liefen frei herum und die Soldaten fingen an auf die Hunde zu schießen, bis
gesagt wurde es seien Meldehunde im Dienste der Deutschen Wehrmacht und dieser Unfug der eigenen Truppe schaden würde,
weil etwaige Querschläger eigene Kameraden verletzen könnten. Wir gingen weiter auf polnischer Seite entlang der Grenze,
bis wir am Nachmittag die ersten Vorposten der Festung Mlawa erreichten, da befanden wir uns plötzlich im Feuerhagel
polnischer Festungsflack.
Am nächsten Morgen hatte ich schon 3 Verwundete und wusste nicht wo sich eine Verwundeten Sammelstelle befindet. Ich
suchte den Bataillonsgefechtstand auf der sich auf einer Anhöhe befand. Ich habe unseren Oberstabsarzt gefragt wo denn
die Verwundetensammelstelle wäre. Er rief beim Tross an, wo er die Auskunft erhielt, das sich vor dem Dorf ein Bunker
befindet in dem man die Verwundeten sammeln sollte, die dann von Sanitätsautos abgeholt würden, weil das Dorf unter
Artilleriebeschuss stand. Am Sonnabend haben unsere Flieger die Bunkerstellungen bombardiert, konnten aber, trotz guter
Treffer nicht viel ausrichten, die Bunker wurden nur etwas angekratzt.
Der Beschuss unserer vordersten Linien ging mit unverminderter Heftigkeit weiter. Am Sonntag verkündete eine große
Staubwolke die Ankunft unserer Panzer, doch sie kamen nur bis zur Panzersperre und mussten wieder abdrehen ohne den
Polen einen schaden zuzufügen. Ein Panzer bekam einen Volltreffer, der Fahrer konnte noch umkehren. Er blutete am Kopf
und der Schütze war so eingeklemmt, das wir ihn nur mit einem Seil unter den Armen, durch die Luke nach oben ziehen
konnten. Ob er seine Verwundung überlebt hat ist mir nicht bekannt, denn in der Nacht wurden Panzergeschütze nach
vorne in Stellung gebracht, die direkt in die Schießscharten der Bunker geschossen und so die Verteidiger vertrieben
haben. Daraufhin sind wir weiter vorgerückt. Auf einer Wiese war ein tiefer Graben ausgehoben und mit Ästen getarnt,
da war ein Panzer hinein gefahren, so dass nur das Hinterteil herausragte und er sich nicht aus eigner Kraft befreien
konnte. In der Luft waren Flieger die Brandbomben abwarfen, ich habe mich auf den Boden geworfen weil ich dachte die
würden explodieren, aber sie zischten nur, so das Stoppeln und Graß rings herum in Brand gerieten.
Bei den Kampfhandlungen gab es mehrere Verwundete, denen ich gerade Verbände anlegen wollte, als unser Hauptmann zur
Trillerpfeife griff um mir klar zu machen, dass ich ihm folgen sollte. Die Polen fingen an zu schreien, ich sollte
sie ins Lazarett bringen denn hier im Wald würde sie niemand finden. Ich setzte mich aufs Fahrrad und folgte unserem
Kompanieführer, der mir sagte ich soll immer bei der kämpfenden Truppe bleiben, denn hinter der Front sind die
Sanitätsabteilungen, die werden die Verwundeten schon versorgen. Der Vormarsch dauerte bis in die späte Nacht. Auf
einem Gehöft, das nach allen Seiten durch Feldwachen abgesichert wurde, machten wir endlich Rast. Wir haben
Getreidegarben auf dem Hof ausgebreitet und uns zur Ruhe gelegt, als plötzlich um Mitternacht Leuchtraketen den Himmel
erhellten und Maschinengewehrfeuer uns aus dem Schlaf schreckte. Ein par polnische Soldaten hatten das Feuer eröffnet,
aber sich kurz darauf ergeben.
Die Narew-Überquerung
Als es hell wurde ging der Vormarsch weiter. Es wurde uns untersagt Tagebuch zu führen, darum
weiß ich nicht wie die Orte hießen, durch die wir marschiert sind. Als wir durch ein sumpfiges Gelände vor drangen
stand auf einer Anhöhe am Horizont, die polnische Artillerie, die uns sofort unter Beschuss nahm. Unser Hauptmann war
der Meinung dass wir schon in der Nähe des Flusses Narew sein müssten, als aus den Sträuchern ein mit Schlauchboten
beladenes Lastauto auftauchte. Wir wurden aufgefordert mit je 6 Mann ein Schlauchboot zu nehmen, an einem Aggregat
der daneben stand mit Luft zu füllen und zu Wasser zu lassen. In einer Stunde war das ganze Bataillon über die Narew,
wo der Vormarsch fortgesetzt wurde. In einem Dorf überraschte uns die polnische Kavallerie und fing sofort mit
Maschinengewehren zu schießen an. Da kam der Befehl: Alles wieder zurück. Es ging noch schneller als auf der Hinfahrt.
Wir sind erst einige Kilometer am Fluss entlang gegangen und haben dann zum zweiten Mal rüber gesetzt.
Die Gehöfte im Dorf standen alle in Brand. Auf einem waren viele Bienestöcke. 2 Kameraden wollten den Stöcken Waben
entnehmen, doch die Bienen durch das Feuer aufgeschreckt, überfielen sie sofort und stachen derart zu das sie nicht
mehr wieder zu erkennen waren. Ich habe die Einstichstellen mit Salmiak betupft, mehr konnte ich nicht tun. Wir mussten
auf unserem Vormarsch durch einen Wald der in Flammen stand, so dass man kaum atmen konnte. Es ging weiter in Richtung
Minsk und Warschau, wo schon die Sowjetische Armee durchgegangen war, die Pferde und Vieh von einem Gut mitgenommen
hatten. In einem Wald stießen wir unverhofft auf ein Kloster, in dem wir einige Gefangene machten. Dann trafen wir auf
eine gute Straße die nach Grochow ging.
Als wir dort einmarschierten wurden wir aus den oberen Stockwerken beschossen, so dass wir, um uns zu schützen, nur an
den Hauswänden entlang gehen konnten. Wir haben jedes Haus nach Feinden durchsucht. Vor einem Haus stand ein Hund der
niemanden reinlassen wollte, solange bis ihn eine Kugel traf. Die polnische Artillerie feuerte von Warschau aus, um
unseren Vormarsch zu stoppen. Wir hatten uns gerade eingegraben als plötzlich deutsche Flieger am Himmel erschienen,
die unsere Stellungen mit Bomben bewarfen und dabei viel Unheil anrichteten. Wir haben sofort Fliegertücher
ausgebreitet und Leuchtraketen abgeschossen. Da ich in dem Graben, den ich kurz zuvor ausgehoben hatte, sofort in
Deckung gegangen bin ist mir zum Glück nichts passiert. Unter den anderen Kameraden gab es viele Verwundete, so dass
ich nicht wusste wem ich zuerst helfen sollte.
Der Oberstabsarzt hat mich sofort tatkräftig unterstützt, so das bald alle Verwundeten versorgt waren, außer einem,
dem ein Bombensplitter den Arm abgerissen hat. Ich habe im 3 große Verbandspäckchen auf die Wunde gelegt, doch die
Blutung ließ sich trotzdem nicht stoppen, so dass er eine Stunde später auf der Krankensammelstelle verstarb. Wir
haben danach in einem Tomatenfeld einen Graben ausgehoben und eine neue Abwehrstellung bezogen. Die Gruppe Schwarz
bekam den Auftrag nach etwaigen versprengten polnischen Verbänden Ausschau zu halten, als sie unerwartet aus einer
Häuserreihe mit Maschinengewehrsalven überschüttet wurden. Der Gruppenführer und noch ein Soldat wurden dabei tödlich
verwundet. Danach wurde noch ein weiter Stoßtrupp, unter der Führung von Leutnant Briskorn, der sich dazu freiwillig
gemeldet hatte, hinaus geschickt um den Gruppenführer und den anderen Toten zu bergen.
Bei diesem Unternehmen, das erfolglos ausging, weil die Toten schon verscharrt waren, durchschlug eine Kugel den
Stahlhelm von Leutnant Briskorn, der auch sofort tot war. Alle Toten wurden später, an der Kirchenmauer in Grochow, in
Särgen beigesetzt: Hauptmann Schönwald sagte, das sie nach dem Kriege auf den Heldenfriedhof nach Ortelsburg überführt
werden. Drei Tage lagen wir bei Grochow in Stellungen, waren dem polnischen Maschinengewehrfeuer sowie den Bomben
deutscher Flugzeuge ausgesetzt. In der Nacht musste ich zu einem Verwundeten in die vorderste Linie und habe den
Rückweg nicht mehr finden können, als plötzlich Gewehrfeuer aufflammte habe ich in den Ruinen Schutz gesucht. Erst im
Morgengrauen konnte ich mich wieder orientieren und zu meinem Unterstand zurückfinden.
Warschau wurde tagelang bombardiert und stand auch unter Artilleriebeschuss. Aus dunklen Rauchwolken kamen oft ganze
Bündel von Papier angeflogen. Die Verwundeten kamen oft auf Krücken zu unserem Unterstand, ich habe sie dann zur
Krankensammelstelle hingeführt. Wir haben auch polnische Zivilpersonen betreut, die während der Kampfhandlungen
verwundet wurden. Als einmal 2 Jungen vorbeiliefen hat einer ihnen nachgerufen sie sollten seiner Frau Bescheid sagen,
er wäre auf der Krankensammelstelle an der Kirche. Als wir dort ankamen war seine Frau, mit einem Kind auf dem Arm,
schon da.
Nach der Kapitulation von Warschau, gingen wir über Sokolow zum Bug und haben dort Quartier bezogen. Der Russe hatte
sich bereits hinter den Fluss zurückgezogen, hatte alles Vieh und Pferde mitgenommen. Dort erreichte mich ein Telegramm
von zu Hause, dass meine Tochter gestorben ist. Es sprach sich auch herum dass verschiedene Heimaturlaub bekommen haben,
ich durfte auch für 14 Tage heim. Wir fuhren mit Lastautos nach Allenstein in die neue Reiterkaserne, zum
Ersatzbatallion, da haben wir unsere Gewehre und Munition abgeben, dann durften wir, jeder in seinen Heimatort
weiterfahren.
Als wir unsere Quartiere am Bug verlassen haben war sehr viel Schnee gefallen. Hier in Ortelsburg fanden wir die
gleiche Wetterlage vor, aber nach 3 Tagen war alles wieder weggetaut und wir konnten die Kartoffelernte, die durch den
frühen Wintereinbruch gestoppt wurde, zu Ende bringen. Ein Tag bevor ich zu Hause angekommen bin wurde die Tochter
beerdigt. Nach 14 Tagen mussten wir uns in Allenstein melden, Gewehre empfangen und wieder zurück zur Division an den
Bug 150 Kilometer hinter Warschau. Die elfte Division, zu der wir auch gehörten sollte in den Westen Deutschlands
verlegt werden und war schon unterwegs zur Verladestation Skiernewice 50 Kilometer vor Warschau.
Mein Dienst als Sanitätsunteroffizier
Unser Bataillon kam in das Städtchen Burscheid, im Kreis Opladen, wo wir in Privatquartieren
untergebracht wurden. Nach 3 Monaten, im Januar 1940, wurden wir nach Solingen verlegt, wo wir bis zum
Frankreichfeldzug stationiert waren. Wir mussten an Feldübungen teilnehmen, wie andere die in Kasernen untergebracht
waren. Während dieser Zeit musste jeder seine Zähne in Ordnung bringen lassen. Jeden Tag fuhren 20 Mann in die
Cäzilienstraße nach Köln, zur Zahnklinik. Im Rheinland wurde unsere Division neu aufgestellt. Ausfälle durch den
Polenfeldzug wurden durch neue Soldaten ergänzt. Ich kam nun zum Ersatzbatallion, war der Älteste in der ganzen
Kompanie. Als der Frankreichfeldzug losging wurde unser Ersatzbatallion mit den noch vorhandenen Verwundeten, in die
neue Reiterkaserne, nach Allenstein verlegt.
Meine Frau hat, mit Unterstützung der Bauernschaft, einen Antrag gestellt, daraufhin wurde ich zur Frühjahrsbestellung,
beurlaubt und später bis auf weiteres vom Militärdienst freigestellt. Als der Russlandfeldzug losging wurde ich von der
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg, für 14 Tage einberufen. Ich war seit 1922, Mitglied der freiwilligen
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg und habe jedes Jahr an Übungen teilgenommen. Jede Bereitschaft musste etliche Leute
stellen. Von Rohmanen wurden Emil Rosowski, Johann Dembek, und ich, zur Krankensammelstelle Wirballen, in Litauen,
abkommandiert. Dorthin kamen Lazarettzüge aus Russland mit der Breitspurbahn. Die Verwundeten wurden frisch verbunden
und auf Waggon mit Normalspur verladen und nach Deutschland gebracht.
Als die 14 Tage vergangen waren wollten wir wieder nach Haus zurück, doch man wollte uns nicht entlassen. Stattdessen
wurden wir dem Wehrkreisamt Königsberg zugeteilt, neu eingekleidet und zur Aushilfe ins Lazarett nach Gumbinnen
abkommandiert. Mehr als ein Jahr war ich in den Urlauber-Baracken, habe dort Krankenstube betreut. Später, bis zum
Dezember 1944, war ich im Reserve-Lazarett 4, in Königsberg tätig. Dort habe ich auch die Luftangriffe der Engländer,
vom 25 bis 26. August 1944 miterlebt.
Wir sollten gerade einen Lazarettzug in Rotenstein entladen, als plötzlich die Sirenen ertönten - Fliegeralarm. Im
gleichen Moment waren die ersten Flugzeuge auch schon da, zuerst warfen sie „Tannenbäume” und danach Foßforkanister ab.
Die Omnibusse standen schon zur Abfahrt bereit als es losging. Wir haben die Verwundeten schnell in den
Luftschutzkeller getragen, haben die Betten von den Fenstern weggerückt damit die Verwundeten nicht von den
Glasssplittern verletzt wurden. Im Kasernenhof brannten die Fosforkanister lichterloh. Unsere Unterkunft, die sich in
einer Baracke befand ist völlig abgebrannt, mit dem Wenigen was wir unser Eigen nannten. Am nächsten Tag wurden wir neu
eingekleidet und am 29. bis 30. kamen die englischen Bomber wieder, sie setzten genau da ihr Zerstörungswerk fort wo
sie vor 3 Tagen aufgehört hatten.
Anfang Dezember 1944 musste ich mich nach Stablack melden und musste dann zur Sanitätsabteilung 1, nach Gernau, das
liegt zwischen Lodz und Warschau. Vormittags hatten wir Felddienstübungen und nachmittags theoretischen Unterricht.
Jeden Tag wurden Gruppen zusammengestellt und zu anderen Einheiten abkommandiert. Ich kam zu einer Panzerabteilung, wo
wir an einem Morgen plötzlich auf dem Kasernenhof antreten mussten und zu unserer Überraschung mit der Nachricht
konfrontiert wurden, dass der Russe an mehreren Frontabschnitten durchgebrochen war. Wir bekamen sofort einen
Marschbefehl in Richtung Lodz, wo das Stadtbild noch intakt war, selbst die Straßenbahnen fuhren noch. In der Nacht
haben russische Flugzeuge die Stadt bombardiert. Die Kaserne in der wir untergebracht waren hatte keine
Luftschutzkeller, aber zum Glück blieben wir von Bombentreffern verschont. Am nächsten morgen bot sich uns ein Bild der
Verwüstung. Die entgleisten Straßenbahnwagen, sowie andere Fahrzeuge blockierten die Straßen. Die Älteren unter uns
bekamen Fahrscheine für einen Transportzug, der bereit hinter Lodz abfahrbereit, unter Dampf stehen sollte. Als
russische Panzer in den Straßen auftauchten, verbrannte die Schreibstube unsere Wehrpässe und andere wichtige
Dokumente. Wir liefen zu der Station auf der unser Transportzug bereitstehen sollte, aber da war kein Zug mehr zu sehen
und wir setzten unseren Rückzug zu Fuß fort.
Der Rückzug und Zusammenbruch der Ostfront
In Dobroschin, einer Stadt in Polen, wurde gerade ein Lazarettzug verladen, doch wir kamen nicht
mehr zum Einsatz, weil die russische Infanterie uns schon auf den Fersen war. Es ging weiter über den Fluss Bober,
Sagan, bis nach Glogau an der Oder. Dort wurden wir der 29. motorisierten Sanitätskompanie zugeteilt. Im
Garnisonslazarett wurden noch Operationen durchgeführt. Unsere Division hatte ihr eigenes Feldlazarett, so dass wir den
Befehl zu Weiterfahrt erhielten und noch unbeschadet die Oderbrücke passieren konnten, denn Glogau wurde zur Festung
erklärt. Wir haben 2 Pferdewagen organisiert und mit Verbänden, sowie medizinischen Instrumenten beladen. So kamen wir
bis nach Lübbenau im Spreewald, wo wir in einem Schloss, in zuvor ein Museum war, unser Lazarett untergebracht haben.
Weil die Amerikaner Cottbus bombardiert hatten, wurden die Verwundeten zu uns nach Lübbenau gebracht. Hier haben wir
Tag und Nacht gearbeitet, um die vielen Verwundeten, aus den schweren Kämpfen bei Grünberg und Sagan zu versorgen. Die
Soldaten von der Abwehrfront kamen schon mit abgestorbenen Armen oder Beinen bei uns an, weil in vorderster Linie keine
Frontlazarette mehr vorhanden waren; es mussten viele Amputationen durchgeführt werden. Als für unsere Pferde kein Heu
mehr vorhanden war, schickte mich unser Hauptfeldwebel, zu einem Bauern in den Spreewald, mit dem Auftrag, Futter zu
besorgen. Mit noch zwei Mann fuhren mit zwei Kähnen, zuerst den Hauptstrom entlang und dann in einen Nebenarm; da haben
wir die Boote beladen und brachten das Heu nach Lübbenau.
Als wir uns bei unser Einheit zurück melden wollten, war alles schon marschbereit. Ich bin schnell in einen Bus
eingestiegen der sofort losfuhr, weil russische Verbände schon in sichtweite waren. Russische Flugzeuge kreisten über
den Dächern und nahmen, mit ihren Bordwaffen jeden unter Beschuss, der sich irgendwo blicken ließ. Wir konnten nur
durch den Wald, oder in der Nacht vorwärts kommen, denn wenn ein Auto auf der Landstraße fuhr, war alsbald ein Flugzeug
hinter ihm her und schoss es in Brand. Als wir nach Tagen am Ufer der Elbe ankamen, war bereits eine Ponton-Brücke
erstellt worden, welche die zerstörte Brücke ersetzen sollte.
Durch die vielen Fahrzeuge waren in den Sand tiefe Spuren gefahren, so dass andere Fahrzeuge unsere Busse ins
Schlepptau nehmen mussten, weil wir mit eigener Kraft nicht mehr weiterkamen. Beiderseits der Trasse standen
Flüchtlingswagen, in der der Hoffnung die Brücke passieren zu können, doch SS-Polizei verhinderte das die Gespanne den
militärischen Rückzug zum Stillstand brachten. Es gelang uns die Elbe zu überqueren, um in einem Waldstück Schutz vor
feindlichen Fliegern zu suchen.
Als wir unsere Busse und Autos gut getarnt hatten, hat unser Bataillonschef die anwesenden Parteigrößen zu sich
gerufen und ihnen erklärt das wir eine Einheit des Roten Kreuzes sind und nach internationalem Recht keine Waffen
besitzen dürfen. Nach langer, erregter Diskussion wurde beschlossen einen Graben auszuheben und alles im Sand zu
verscharren. Als wir dann weiter, durch die Dörfer fuhren, sahen wir schon viele weiße Bettlaken, als Zeichen der
Kapitulation, aus den Fenstern hängen. Es wurde uns erzählt dass der Bürgermeister von der SS erschossen wurde, weil
er die Bevölkerung zu diesem Schritt ermutigt hatte. Jetzt waren hinter uns die Russen und vor uns schon die Amerikaner.
Amerikanische Panzer fuhren umher und schossen wild durch die Gegend, ohne ein Ziel anzuvisieren. Niemand wollte sich
dem Russen ergeben, doch der Weg der zu den Amerikanern führte, war durch abgesägte Bäume blockiert. Wir sind schnell
in das nächste Dorf gegangen, haben uns Sägen und Äxte besorgt, die Bäume durchgesägt und in den Straßengraben
geworfen.
“ Nach dem Ende des 2. Weltkrieges.”
In amerikanische Kriegsgefangenschaft
Dann fuhren wir unter internationaler Flagge an eine Mulde Brücke, vor der zwei amerikanische Soldaten, mit Zigarren,
zur Hälfte im Mund, standen. Sie rauchten und kauten gleichzeitig. Wir mussten auf einen freien Platz fahren, alle
aussteigen und rechts wieder antreten. Wäschebeutel und Tornister mussten wir abstellen; danach wurden wir nach Waffen
durchsucht, Wertsachen, Uhren und Messer wurden uns gleich abgenommen. Als wir anschließend an unserem Gepäck
vorbeigingen durfte niemand was mitnehmen. Als ich gebückt, nach meinem Wäschebeutel greifen wollte, in dem sich noch
3 Konservendosen und ein Brot befanden, bekam ich einen Fußtritt ins Gesicht, so dass mir ein Zahn ausgeschlagen wurde.
Wir wurden dann in einem Garten zusammen getrieben und gefragt ob jemand bei der SS gedient hat. Nachdem wir in Reihe
und Glied angetreten waren, mussten wir den Oberkörper freimachen und die Arme anheben. Es wurde nach SS-Zeichen
gesucht, die gewöhnlich unter dem Oberarm eintätowiert waren. Nachdem wir Grimma bei Leipzig, wo wir in amerikanische
Gefangenschaft geraten waren, verlassen hatten, mussten wir durch ganz Thüringen bis Hersfeld, an der Grenze zu Hessen,
marschieren. In Hersfeld wurden wir auf große Lastautos verladen, die von farbigen Soldaten gefahren wurden. Man hat
uns mit Stöcken hinauf getrieben, solange bis das Auto so voll war das man kaum stehen konnte. Die Soldaten fuhren, für
diese Straßenverhältnisse, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Wenn die Straße eine scharfe Kurve hatte, flogen
wir alle übereinander und mussten erst mit viel Kraftanstrengung auf die Beine kommen um diese Fahrt zu überstehen.
Da die Straßenränder in dieser Gegend mit Obstbäumen bepflanzt sind und deren Äste sehr niedrig hängen, hätten die
uns die Köpfe abgerissen, wenn wir uns nicht ständig geduckt hätten. Unsere Fahrt endete in Bad Kreuznach, in der Pfalz,
wo wir in ein Lager, in dem sich später 130.000 Mann und 6 Generäle befanden, eingepfercht wurden. Die Unterkunft der
Generäle befand sich unter einem Zelt, alle anderen mussten die Zeit unter freiem Himmel zubringen. Die Offiziere, die
Unteroffiziere, die Mannschaften; wurden in getrennten Camps untergebracht. Die Mannschaften wurden auch zur Arbeit
abkommandiert und konnten bei dieser Gelegenheit, Brot, Brötchen oder Zigarettenstummel organisieren, wogegen die
Offiziere und Unteroffiziere ihr Camp überhaupt nicht verlassen durften.
Die ersten Tage gab es kein Wasser und kein Brot, so dass die Kameraden vor Erschöpfung umfielen. Später standen wir
manchmal den ganzen Tag nach Wasser an, das von den, uns bewachenden Negern mit großen Wassertanks angefahren wurde. Am
dritten Tag bekamen wir mittags und abends etwas zu Essen; Brot bekamen wir erst nach zwei Wochen, nach dem aus der
Umgebung herbeigeholte Handwerker, Backöfen gebaut hatten. In den verschiedenen Gemeinden, die in den uns umgebenden
Weinbergen lagen, mussten sich alle Männer beim Bürgermeister melden. Als sie dann erschienen waren, wurden sie auf
bereitstehende Lastautos getrieben und zu uns ins Lager gebracht. Sie waren ohne Kopfbedeckung und ohne wärmere
Bekleidung angekommen, weil ihnen gesagt wurde, dass ihr Aufenthalt im Lager nur von kurzer Dauer sein würde. Man hat
uns, falls noch vorhanden, Decken und Mäntel abgenommen, mit der Begründung, sie würden für Kranke und Verwundete
gebraucht. Jeden Tag starben mehr als 200 Mann, die wir sofort in ein Zelt tragen mussten. In der Nacht wurden die
Toten dann mit unbekanntem Ziel, weggefahren.
Viele haben ihren Verstand verloren uns irrten im ganzen Camp ziellos umher. Als Latrinen wurden Gräben ausgehoben, in
die verschiedene Kameraden, bei der Verrichtung ihrer Notdurft, vor Schwäche hineingefallen sind und nicht mehr wieder
heraus kamen. Aus den Pfählen die, die jungen Obstbäume stützten, haben wir Krankentragen gebaut um unsere Kameraden,
bei Bedarf, zur Krankensammelstelle zu tragen. Es war in diesem Frühjahr auch sehr kalt, doch unsere Erdlöcher, die wir
zum Schutz vor Kälte und Wind, nur mit leeren Konservendosen ausgehoben hatten, durften nicht tiefer als 20 Zentimeter
sein. Nach jedem Regenguss mussten wir das Wasser ausschöpfen. Nach einem Gewitter, standen wir wiedermal, total
durchnässt in unserem Camp, als unerwartet am Horizont die Sonne hervortrat. Einer unserer Kameraden hatte noch eine
Trompete gerettet und fing, von dem Anblick völlig überwältigt, zu spielen an: "Es geht alles vorüber, es geht alles
vorbei, nach jedem Dezember, folgt wieder ein Mai". Daraufhin hob sich die Stimmung der tiefbetrübten Kriegsgefangenen,
so das Heimatlieder durch das ganze Camp erklangen, obwohl wir in den nassen Kleider herumgehen mussten, bis sie am
Körper trocken wurden.
In französischer Kriegsgefangenschaft
Nach etwa einem Monat, haben uns die Amerikaner, den Franzosen, zum Arbeitseinsatz, ausgeliefert.
Etwa 4 Kilometer von Bad Kreuznach entfernt, stand auf freier Strecke, ein Zug mit offenen Kohlenloren, auf den wir
verladen wurden. In jeden Waggon, wurde pro Person eine Tafel Schokolade und ein Päcken Zwieback rein geworfen, doch
viele Kameraden fanden nur leere Päckchen vor, weil die schon zuvor von der französischen Wachmannschaft geplündert
wurden. Wir haben uns darüber beschwert, doch die haben uns nur ausgelacht. Nachdem wir zunächst bei Mainz über den
Rhein fuhren, endete unsere Fahrt bei Paris in einem großen Zeltlager. Dort wurden wir auf andere Züge verladen, die uns
nach Südfrankreich, in ein Barackenlager, bei Mazarei, brachten.
Auf einer Zwischenstation hat man uns unter einer Pumpe, die Lokomotiven mit Wasser versorgt, abgestellt, den Kran
aufgedreht und uns anschließend ausgelacht, die Kinder Haben uns mit Steinen beworfen. Ein Wachmann kam in unseren
Waggon gekommen, hat unser Gepäck durchsucht, wenn er Tabak oder Zigaretten gefunden hat, nahm er sie mit. Die Kameraden
waren darüber so empört, dass sie vorhatten, ihn nachts unter den Waggon zu werfen. Wir haben sie gebeten dass zu
unterlassen, weil man uns in diesem Falle, alle erschießen würde.
Als wir ins Lager kamen wurden wir zuerst gezählt, dann mussten wir unser Gepäck stehen lassen und beiseite treten.
Wenn man bei der Nachkontrolle noch was in den Taschen fand, wurde das auch entwendet, selbst Esslöffel. Wir wurden
dann in drei Baracken, ohne Toiletten, eingeschlossen. Die Kameraden haben ihre Bedürfnisse in Kochgeschirre erledigt
und durch ein kleines Fenster, das sich fast unter der Decke befand, hinausgeworfen. Andere Fenster ließen sich nicht
öffnen, weil sie mit Stacheldraht zu geflochten waren. Als die Kameraden die Kochgeschirre auskippten, haben die
Wachposten geschossen und die Fenster zertrümmert. Sie waren der Meinung dass wir ausbrechen wollten. Es herrschte eine
große Hitze, in den überfüllten Baracken sind wir fast erstickt. Am nächsten Tag haben wir uns über fehlende Toilettem
beschwert, da haben sie Heringsfässer durch die Hälfte geschnitten und an der Ausgangstür hingestellt. Um bei den
überfüllten Räumen dort hinzukommen, musste man über die Köpfe der Anderen steigen. Viele hatten Fieber und Durchfall
und mussten in die Krankenstube eingeliefert werden, wo sie kurz darauf verstarben.
Besonders Raucher litten sehr an der Unterernährung, bekamen Wasser in den Beinen und waren die Ersten die verstarben.
Nach der Registrierung wurden wir auf andere Baracken verteilt. Die Zivilbevölkerung kam in die Räume und begann uns
auszuplündern. Wer noch gute Schuhe besaß musste sie ausziehen und bekam dafür die kaputten des Plünderers. Eine Woche
lang mussten wir diesen Zustand ertragen, erst als die Kameraden sich beschwerten, wurde am Eingang eine Tafel am
Eingang angebracht, dass die Zivilbevölkerung das Lager nicht betreten darf. Bis auf einige, wenige Ausnahmen wurde
diese Anweisung befolgt.
Als wir im Lager ankamen, war der französische Lagerkommandant, ein ehemaliger Kriegsgefangener, der bei einem Bauern
in Deutschland gearbeitet hatte. Dieser Bauer war jetzt als Kriegsgefangener in seinem Lager. Als er ihn erkannte, hat
er ihn gleich zum Küchendienst eingeteilt und mit dem nächsten Krankentransport nach Hause fahren lassen. Zu Mittag
bekamen wir nur gekochte Haferkörner, da schwamm alles oben, später war man dann auf Gerste umgestiegen. Als viele
daran gestorben waren, weil sie diese „Rohkost”, die nur ein Kuhmagen verträgt, nicht gegessen haben, hat man die
Körner durch eine Schrotmühle laufen lassen. Dann hat man uns Steckrüben gekocht; wir bekamen 250 Gramm Weißbrot,
etwas Quark und ein viertel Liter Magermilch. Später, als wir schon arbeiten mussten, hat man in unserem Essen einen
Kuhkopf mitgekocht, das hat dann bedeutend besser geschmeckt.
Bevor wir morgens zur Arbeit gingen, mussten wir zu Flaggenparade und abends, nach der Rückkehr, haben wir die Flagge
wieder eingeholt. Wir haben einen Kanal gereinigt, dessen Sohle 2 Meter dick mit Schlamm bedeckt war. Zuerst wurde das
Wasser abgelassen, dann haben wir, einer dem andern, den Schlamm mit der Schippe hoch gereicht. Der Letzte hat den
Schlamm, der so zäh war, dass er nicht von der Schippe wollte, oben am Rande abgelegt. Manchmal waren 10 Mann nötig um
den Höhenunterschied zu überwinden. Das Wachpersonal schoss über unsere Köpfe hinweg und rief: „schnell arbeiten”. Bei
der großen Hitze war das ein Ding der Unmöglichkeit, zumal es nichts zu Trinken gab. Auf dem Heimweg haben wir im Walde
Heilkräuter gesammelt, die man in der Küche getrocknet und als Tee zubereitet hat, den wir am nächsten tag zur Arbeit
mitnahmen, um unseren Durst zu stillen.
Unser Aufseher hatte einen Stock, an dem sich noch kurz abgeschnittene Äste befanden. Wer seiner Meinung nach, nicht
ordentlich gearbeitet hat, bekam gleich Schläge auf den Rücken. Die weißen Aufseher wurden irgendwann durch Neger
ersetzt, die uns bedeutend besser behandelt haben. Wenn irgendetwas schief ging, haben sie nichts gesagt, nur gelacht.
In den übrig gebliebenen Wassertümpeln hatten sich noch einige Aale versteckt, die wir zu fangen versuchten, was uns
auch manchmal gelang. Wir mussten ihnen das Genick brechen, damit sie uns nicht entwischen konnten. Wenn die Franzosen
bemerkten das wir Aale hatten, wurden sie uns abgenommen. Gelang es uns aber, sie ins Lager zu bringen, dann haben wir
uns eine köstliche Malzeit zubereitet.
Um sicherzustellen dass niemand geflüchtet ist, wurden wir, wenn wir abends ins Lager zurückkamen, zuerst gezählt.
Diese Zählung wurde mehrmals wiederholt, weil die Wachmannschaften sich immer wieder verzählt haben. Als einer von uns
hin ging, ihnen sagte dass alle da sind, wollten sie es nicht glauben und haben uns vor dem stehen lassen, bis es ihnen
irgendwann einfiel. uns doch das Tor zuöffnen. Einmal, als wir von der Arbeit zurückgekehrt waren, standen wir bis 23
Uhr neben der Flagge, weil uns niemand das Tor geöffnet hat. Als wir dann doch irgendwie ins Lager kamen haben wir
festgestellt, dass das ganze Wachpersonal betrunken war und niemand im Stande uns das Tor zu öffnen.
Eines Tages waren wir wieder abends zur Parole angetreten, als ein älterer Herr mit seinem Hund, am Stacheldraht
entlang, spazieren ging. Weil der Hund, unterm Stacheldraht hindurch, zu uns kam, hat ihn einer geschnappt, ihm das
Genick gebrochen und unter seiner Jacke versteckt. Der Franzose hat nach seinem Hund gerufen und gepfiffen, aber alles
vergebens, der Hund war nicht aufzufinden. Die Kameraden haben ihm gleich das Fell über die Ohren gezogen, das Fleisch
gekocht und das Fell in die Latrine geworfen. Das Fleisch wurde umgehend verspeist.
Als wir am nächsten Tag von der Arbeit zurückkehrten, war im Lager der Teufel los. Wir mussten sofort antreten und
wurden gefragt, wo der Hund geblieben ist, der Gestern Abend, mit seinem Herrchen, am Zaun entlang spazieren ging. Als
sich niemand dazu bekannte, mussten wir weiterhin stehen bleiben, während die Wachmannschaften von Baracke zu Baracke
gingen und alles durchsuchten. In einer Latrine hat man dann das Fell gefunden, was uns ein furchtbares „Donnerwetter”
einbrachte und in den nächsten Tagen, nach der Arbeit, unter dem Kommando eines Oberfeldwebels, eine Stunde
nachexerzieren.
In Südfrankreich regnet es den ganzen Sommer nicht; die Bauern haben da keine Scheunen und das Getreide wir nur in
Schobern aufgestellt und dann umgehend gedroschen. Vom Oktober bis Dezember regnete es fasst jeden Tag in Strömen.
Gesät wird nur im Frühjahr und im Herbst, weil im Sommer alles vertrocknet. Es wird viel Wein angebaut und die
Steckrübe wächst den ganzen Winter. Neben den Weinreben wurde aus Schieferplatten ein Zaun aufgestellt, um dem Wein
einen optimalen Standort zu sichern. Die Bauernwagen hatten nur zwei Räder und waren nur mit einem Pferd bespannt, das
die ganze Balance des Wagens zu halten hatte. Trotzdem haben sie soviel aufgeladen wie wir auf einen Leiterwagen. Viele
Kameraden wurden den Bauern zur Arbeit ausgeliehen. Wenn ein Bauer einen Arbeiter gebraucht hat und es wurde gefragt,
wer sich in der Landwirtschaft auskennt, da haben sich alle gemeldet. Der Bauer konnte sich dann aussuchen, wen er
mitnehmen wollte.
Wenn wir durch die Stadt zur Arbeit gingen, haben verschiedene Leute Fallobst in die Abfalleimer gelegt. Wenn das von
den Kameraden bemerkt wurde, schwenkten viele aus der Reihe, um sich etwas mit zunehmen, was von den Wachmannschaften
nicht gern gesehen wurde. Viele Kriegsgefangene hatten keine Schuhe mehr, sie haben die Füße nur mit Lumpen bewickelt.
Eines Tages kamen Kameraden aus Norwegen, die nach Deutschland entlassen werden sollten. Mann hat sie jedoch ins Lager
gesteckt und zur Arbeit eingeteilt. In Norwegen hatten sie Kleider und Stoffe eingekauft, hatten volle Seesäcke und
sogar Karren auf 2 Rädern, weil sie ja in die Heimat entlassen werden sollten. Als wir morgens zur Arbeit rausgeführt
wurden standen sie schon vor dem Lager. Wir haben ihnen zugerufen, dass sie uns etwas abgeben sollen, weil ihnen ja
sowieso alles abgenommen wird, aber sie haben uns nur ausgelacht. Als sie ins Lager Kamen mussten sie ihr Gepäck
ablegen, wurden dann wo anders hingeführt und haben es danach nie wieder gesehen.
Durch die vielen Läuse, Flöhe und Wanzen die wie im Lager hatten, kam es bei verschieden Kameraden, an den
Einstichstellen, zu eiternden Entzündungen. Um dem vorzubeugen hat man uns mit einem Pulver, das in Frankreich
hergestellt wurde, aber bei den Parasiten keine Wirkung zeigte, eingesprüht. Erst bei der Anwendung eines Mittels
amerikanischer Herkunft, war alles über Nacht verschwunden.
Der Sonntag war arbeitsfrei. Dann kam ein katholischer, französischer Pfarrer, eskortiert von 3 Mann, mit
aufgepflanztem Seitengewehr ins Lager und hat Gottesdienst gehalten. Einen evangelischen Pfarrer gab es nicht, nur
einen Baptisten Prediger. Der wurde würdevoll eingekleidet, bekam ein großes Kreuz und hat jeden Sonntag in einer
extra dafür hergerichteten Baracke Gottesdienst gehalten. Wer Theologie studiert hatte und sich meldete, wurde zu
einem Seminar geschickt und konnte sein Studium fortsetzen. Glasbläser durften das Lager auch verlassen und ihrem
erlernten Beruf wieder arbeiten.
Wer sich freiwillig, für 5 Jahre, zum Dienst in der Fremdenlegion verpflichtet hat, das waren etliche unter uns, wurde
neu eingekleidet, bekam gutes Essen und Rauchwaren soviel er wollte. Nach einem Jahr wurden, nach und nach, die
Kranken und Körperbehinderten in die Sowjetische Besatzungszone entlassen. Eine Entlassung von Kriegsgefangenen, die
in den Westzonen oder jenseits von Oder und Neise zu Hause waren, war nicht vorgesehen. Die Österreicher wurden alle,
unabhängig von ihrem Gesundheitszustand entlassen.
Ich habe Briefe nach Hause geschrieben, aber die kamen nur bis Allenstein und wurden wieder zurück geschickt. Als eine
Kommission des Roten Kreuzes aus der Schweiz unser Lager besichtigt hat, haben wir uns beschwert, das wir als
Sanitätsdienstgrade, zur Arbeit gehen müssen. Daraufhin erging ein Befehl: Wer einen vom Roten Kreuz, ausgestellten
Ausweis besitzt, gehört einem internationalen Verband an und braucht nicht zu Arbeit gehen. Aus unserem Lager hatten
sich 20 Mann gemeldet, die daraufhin Freigang, in Begleitung von zwei französischen Wachsoldaten erhielten. Als wir
gefragt wurden wo wir hin wollen, entschlossen wir uns, einen Soldatenfriedhof, auf dem unsere verstorbenen Kameraden
beerdigt waren, zu besuchen.
Da der Untergrund in dieser Gegend aus Felsen bestand, wurden die Gräben, in denen die Toten in selbst gezimmerten
Kisten nebeneinander gestellt wurden, mit Hilfe von Dynamit ausgehoben. Ein Leichenwagen, mit einem Pferd bespannt,
das mit einer schwarzen Decke abgedeckt war, wurde von einem Kutscher in angemessener Kleidung, gefahren. Der Wagen
konnte gleichzeitig 4 Kisten transportieren. Wenn wir von der Arbeit kommend, dem Leichenwagen begegneten, wurde
gehalten und mit einer Schweigeminute der Toten gedacht, bis der Wagen vorbei war. Die Zivilbevölkerung verharrte auch
im Schweigen, mit abgenommener Kopfbedeckung.
Ein Kamerad, der in Krottorf, Kreis Oschersleben, bei Magdeburg, zuhause war, sagte bei seiner Entlassung zu mir:
Sollte ich das Glück haben, meine Entlassungspapiere zu erhalten ohne eine Bleibe vorzuweisen, dann soll ich Krottorf
als Heimatadresse angeben. Auf der Krankenstube habe ich angegeben, dass sich noch ein Schrapnellsplitter, aus dem
Ersten Weltkrieg, in meiner Kreuzbeingegend befindet, er zwar verkapselt ist, aber immer noch Beschwerden verursacht.
Daraufhin wurde ich zur Entlassung vornotiert. Als bekannt wurde das ein Rückkehrertransport in die sowjetische
Besatzungszone zusammengestellt wird, habe ich mich sofort gemeldet und wurde für ein Entlassungslager in Angoleme
vorgesehen. War das eine Freude, als uns mitgeteilt wurde, wann der Rücktransport stattfindet.
In unserem Lager waren noch 2 Kameraden aus dem Kreis Ortelsburg: Ein Gustav Lumma aus Leynau und ein Alfred Moritz
aus Groß Schöndamerau. Sie mussten noch zurückbleiben und haben mir den Auftrag erteil, die Angehörigen in der Heimat
zu grüßen und ihnen die Anschrift mitzuteilen. Als wir im Entlassungslager ankamen, fragte man uns nach unserer
Heimatanschrift. Dann wurden die Entlassungspapiere angefertigt. Es wurde uns auch ein Barscheck, für die in Frankreich
geleistete Arbeit ausgehändigt, den wir bei jeder Kasse in Deutschland einlösen könnten. Ich habe ihn bis zum heutigen
Tage nicht einlösen können, obwohl ich irgendwann in der Zeitung gelesen habe, das Verrechnungschecks die den aus
französischer Kriegsgefangenschaft Entlassenen, ausgehändigt wurden, einzulösen sind.
Wir kamen zuerst nach Saar Elbe, dann in die Nähe der Zonengrenze zu Thüringen. Hier mussten wir 2 Tage warten, weil
aus der sowjetischen Besatzungszone keine Eisenbahnwagen bereitgestellt wurden. Angesichts dessen, das der Russe beim
letzten Transport die aus Frankreich kommenden Wagen kassiert und nicht mehr herausgeben wollte, bestand der Franzose
jetzt darauf, seine Wagen sofort wieder mitzunehmen. Als der sehnsüchtig erwartete Zug endlich eintraf, durften wir
umsteigen und kamen, immer noch hinter Stacheldraht, nach Erfurt. Von dort weiter ins Quarantänelager nach Prätsch an
der Elbe.
Unter Androhung von Strafe war es verboten das Lager zu verlassen, doch der Hunger zwang uns dazu, in den umliegenden
Dörfern um Lebensmittel zu betteln. Man drohte uns damit, dass Zuwiderhandlungen, mit einer 14-tägigen Verlängerung der
Quarantäne geahndet werden. Der Roggen war schon reif und wir haben, auf den umliegenden Feldern, die Ähren abgerissen,
das Korn, zwischen 2 Steinen zu Mehl zerrieben, um daraus eine Suppe zu kochen, denn von dem was unsere Lagerküche uns
bieten konnte, war es nicht möglich zu überleben. Als der Eigentümer bemerkte wer seine Roggenähren entwendet hat, kam
er ins Lager, gerade zu dem Zeitpunkt als wir mit dem Mahlen beschäftigt waren. Der Lagerkommandant, bei dem er sich
beschwerte, drohte uns zu bestrafen, wenn wir unsere „Rauzüge” nicht unmittelbar einstellen würden. Wir sagten ihm er
solle uns heimfahren lassen, da wir doch lange genug hinter Stacheldraht gesessen hätten.
Endlich wieder in Freiheit
14 Tage nach unserer Ankunft wurden uns Entlassungspapiere ausgehändigt, sowie auch Fahrscheine
zum den, von uns angegeben Heimatorten. So kam ich nach Krottof, Kreis Oschersleben, zu meinem ehemaligen
Kriegskameraden, bei dem ich einen Tag geblieben bin. Er hatte mir schon eine Stelle bei einem Bauern besorgt, der 70
Jahre alt und kinderlos war. Zum Hof, den er mit seiner Ehefrau bewirtschaftet hat, gehörten 36 Morgen Land, 2 Ochsen
und 3 Kühe. Das Ackerland bestand aus 17 Parzellen und sicherte mir einen Arbeitsplatz.
Jetzt, da ich ein Dach überm Kopf und genug zu essen hatte, fing ich an nach dem Verbleib meiner Familie zu forschen.
Bei meinem letzten Heimaturlaub hatte ich mit meiner Frau verabredet; falls wir uns in den Kriegswirren verlieren
sollten, unsere Kontaktadresse, die meiner Quartiersleute in Burscheid, Kreis Opladen, sein sollte. Ich habe zuerst
nach Rohmanen geschrieben, aber leider keine Antwort erhalten. Dann habe ich nach Burscheid geschrieben, und siehe, -
bei denen lag schon eine Anfrage meiner Frau vor, die nach mir gefragt, und ihre jetzige Anschrift hinterlassen hatte.
Ich habe dem Bauern erzählt dass meine Frau sich zurzeit, auf einem Gut, in Alt Steinhorst, im Kreis Rostock, befindet.
Er war sofort bereit uns ein Zimmer zur Verfügung zu stellen, wenn ich meine Frau nach Krottorf rüberholen wollte. Das
habe ich Ihr mitgeteilt und sie war sofort bereit ihren Wohnsitz nach Krottorf zu verlegen, denn sie wohnte dort in
einem kleinen Stübchen unterm Dach.
Im Herbst, als die Feldarbeit so ziemlich erledigt war, bin ich nach Alt Steinhorst gefahren, um meine Frau und meinen
Sohn Kurt, sowie meinen Sohn Manfred, den ich noch nicht kannte, weil er erst nach der Flucht, am 31. Januar, in Groß
Lüssewitz, geboren wurde, nach Krottorf zu holen. Meine Frau hatte schon Holz für den Winter besorgt und vom Gut, auf
dem sie im Sommer gearbeitet hatte, Mehl und Kartoffeln bekommen. Wir haben das Mehl und andere Habseligkeiten in
Kisten verpackt. Das Holz haben wir einem Bauern gegeben, der uns und unser Gepäck, mit seinem Pferdewagen, zum 14
Kilometer entfernten Bahnhof, nach Ribnitz gebracht hat. Wir sind auch gut in Krottorf angekommen, aber als wir am
nächsten Tag, unsere Kisten vom Bahnhof abholen wollten, haben wir zwar die Kisten vorgefunden, doch der gesamte Inhalt
wurde während der Bahnfahrt entwendet. Die Bahnstation in Krottorf hat die Vorkommnisse zur Kenntnis genommen und
protokolliert, aber unsere Sachen haben wir nie wieder gesehen und mussten wieder bei Null anfangen.
Im Winter musste ich auf der Genossenschaft, unentgeltlich, für die Russen Weizen einsacken. Ich hatte versucht eine
Arbeit als Zimmermann zu bekommen, doch auf dem Arbeitsamt wurde mir gesagt, ich bin Ladwirt und muss auf der
Landwirtschaft arbeiten. Da in den ersten Nachkriegsjahren, auch in der sowjetisch besetzten Zone Arbeitsplätze knapp
waren, mussten auch solche, die einen anderen Beruf erlernt hatten, jede zumutbare Arbeit annehmen. Aus der Heimat
erhielt ich einen Brief, von meiner dort noch lebenden Mutter. Sie schrieb das sie mich noch einmal sehen wollte und
ich sollte doch wieder zurück kommen; Unser Hof wäre nicht von Polen besetzt und sie wäre ganz alleine, weil der Vater
nach dem Durchzug der Front von den Russen erschlagen wurde. Daraufhin habe ich dem polnischen Konsulat in Magdeburg
mitgeteilt, dass ich in Rohmanen eine Landwirtschaft besitze, und um eine Einreisegenehmigung gebeten.
Nach 2 Monaten erhielt ich eine Postkarte, mit der Mitteilung, ich sollte mich persönlich beim Konsulat vorstellen.
Nach Aufnahme meiner Personalien, wurde mir gesagt, das ich benachrichtigt werde wenn mein Antrag genehmigt wird. Ende
Juli 1947 erhielten wir die Einreisegenehmigung nach Ostpreußen, das jetzt unter polnischer Verwaltung stand. Wir
mussten zuerst zum polnischen Konsulat in Berlin-Lichterfelde, wo wir umgeben von einer Trümmerlandschaft, gewartet
haben, bis alle Untersuchungen und Formalitäten erledigt waren.
“ Wieder zurück in Ostpreußen.”
Der schwere Wiederaufbau nach dem Kriege
Dann fuhren wir über Frankfurt/Oder, Posen, Thorn, Allenstein, nach Ortelsburg, wo wir am 2. August 1947 ankamen. Mit
einem zweirädrigen Karren, den ich mir von einem noch in Ortelsburg lebenden Bekanten ausgeliehen hatte und meinem
Sohn Manfred im Kinderwagen fuhren wir nach Rohmanen. Meine Mutter war inzwischen verstorben und auf dem Hof war nur
meine, inzwischen aus Russischer Gefangenschaft wiedergekehrte Schwester, Frieda Pelkowski.

Es war alles ausgeplündert; kein Vieh, keine Maschinen und der ganze Hof mit kniehohem Graß überwachsen. Nur schmale
Trampelpfade, vom Haus zum Holzschuppen und zum Klo, durchkreuzten das satte Grün. Ich habe das Gras auf dem Hof mit
einer Sense, die ich noch gefunden habe, abgemäht, damit der Hof nicht so verwahrlost aussah. Am nächsten Tag habe ich
mich bei der Polizei in Ortelsburg angemeldet, wo ich auch ein Startgeld von 100 Zloty erhielt und Gepäckstücke, die
ich in Krottorf aufgegeben, am Bahnhof abgeholt. Es hat mich sehr gewundert das, das Gepäck überhaupt angekommen ist.
Da man von der Landwirtschaft nicht Leben konnte, habe ich mich in den nächsten Tagen, bei der jetzt polnischen Bahn,
um Arbeit beworben und wurde auch angenommen. Wenn wir unseren Monatslohn bekamen, saß immer einer am Tisch, der von
uns 100 Zloty für den Wiederaufbau von Warschau verlangte. Wenn ich dran war, riefen die Anderen, ich hätte Warschau
zerstört und müsste deshalb 200 Zloty abgeben. Nach 3 Jahren kam eine Verfügung, die besagte, dass wer länger als 1
Jahr bei der Bahn beschäftigt ist, angestellt werden muss. Um diese Bestimmung zu umgehen hat man mich entlassen und
eine Woche später wieder eingestellt.
Als ich vor Ablauf des nächsten Jahres, aus dem gleichen Grunde wieder entlassen wurde, habe ich mich bei der
Stadtverwaltung in Ortelsburg(jetzt Szczytno)beworben, wo ich zuerst im Gaswerk als Heizer und später auf Baustellen
als Zimmermann gearbeitet habe. Wir haben durch den Krieg beschädigte Häuser repariert, in den ehemals touristischen
Zentren einige Ausbesserungen an den Einrichtungen durchgeführt, eine Ziegelei wieder in Betrieb gesetzt und andere
anfallende Arbeiten verrichtet. Im Dach des Rathausturmes war während der Kämpfe eine Granate eingeschlagen, die, die
Dachlatten und die Verschalung zerstört hatte. Da wir, unter schwersten Bedingungen, den Schaden repariert haben,
wurde uns eine Höhenzulage versprochen, die wir aber nicht bekommen haben.
Aus Verärgerung darüber habe ich bei der Stadtverwaltung gekündigt und bei einer Wiederaufbaufirma unter der Leitung
von Bauingenieur Laskowski wieder angefangen, wo ich bis 1954, als Zimmermann beschäftigt war. Ab da habe ich mich
nur um meinen Hof gekümmert, der wegen meiner Arbeitsstellen, gezwungenermaßen, sehr vernachlässigt wurde. Als wir
1947 zurückkamen, brachten wir unseren Sohn Manfred noch im Kinderwagen. Den hat meine Frau zum Markt gebracht,
verkauft, und dafür eine Ziege erworben, die dank guter Pflege, uns täglich mit 4 Liter Milch versorgte. Das war der
erste Baustein zum Wiederaufbau, unserer durch den Krieg zerstörten, und danach ausgeplünderten Landwirtschaft.
Während meiner Arbeit bei der Bahn haben wir uns eine Kuh gekauft, die nach einem halben Jahr, wegen nicht bezahlter
Grundsteuer, vom Gerichtsvollzieher gepfändet wurde. Man hat uns die Kuh weggenommen und bei einem Arbeiter, der in
der Ernst-Mey-Straße in Ortelsburg wohnte und sie wegen nicht vorhandener Futtermittel, nur mit Kartoffelkraut
gefüttert hat, untergestellt. Als ich bei der Bahn meinen Monatslohn bekommen habe, bin ich zur Gmina gegangen, habe
eine Rate angezahlt und durfte dann die Kuh wieder mit nach Hause nehmen. Durch die schlechte Ernährung war die Kuh
stark abgemagert und lieferte nur die Hälfte der ursprünglichen Milchleistung.
Später habe ich ein Pferd auf Abzahlung bekommen, das 140.000 alte Zloty gekostet hat. Die Stute war schwach und unser
Feld sehr hügelig, so dass man nur bergab pflügen konnte, was sehr beschwerlich war, bergauf ging es immer im Leerlauf.
Später habe ich die schweren Böden mit dem Traktor umpflügen, und in den letzten Jahren auch mit dem Binder mähen
lassen. Von der Stute habe ich 2 schöne Fohlen gezogen; ein davon habe ich bei der Ausreise in die Bundesrepublik
mitgebracht und bei der Viehverwertungs-Genossenschaft in Göttingen verkauft. In den ersten Nachkriegsjahren als noch
wenig Land bestellt wurde, breiteten sich auf den nicht beackerten Flächen, Wildkräuter aus. Disteln und andere
Schnellwachsende, erreichten manchmal eine Höhe von 2 Meter, besonders auf den schweren Böden.
Es hat viel Schweiß gekostet ehe man den Acker soweit hatte, das er auch befriedigende Erträge abwarf. Die
Währungsreform von 1950, hat unser weiniges Geld das wir schon gespart hatten, wieder vernichtet. Ich hatte 2 Pferde,
1 Fohlen, 2 Kühe und Schweine, als ich wieder aufgefordert wurde nicht bezahlte Grundsteuern nachzuzahlen. Als ich
nicht bezahlen konnte, hat der Vollziehungsbeamte, ein Fohlen, eine Kuh und ein Schwein gepfändet. Es gelang mir jedoch
nach längeren Verhandlungen, ohne größere Verluste, alles zu regeln. Später kam eine Verfügung, die besagte; wenn
jemand auf seinem Hof nur eine Kuh und ein Pferd hatte, durften sie nicht gepfändet werden. Einige haben ihr Inventar
dieser Verfügung angepasst und dadurch die Zahlung von Grundsteuer umgangen.

Wer seine Steuern pünktlich bezahlt und sein Kontingent an landwirtschaftlichen Produkten fristgerecht abgeliefert hat,
der konnte seine, darüber hinaus erwirtschafteten Produkte zu marktgerechten Preisen verkaufen. Für eine hochtragende
Sterke, mindestens 400 kg schwer, die auf ein staatliches Gut verkauft wurde, konnte man bis zu 12000 Zloty bekommen.
Unsere Böden waren kalkarm, doch durch den Einsatz von Kalk und Kunstdünger konnte man den Ertrag erheblich steigern.
Kalk und Kunstdünger konnte man bei der Genossenschaft(GS) bestellen, der dann auch direkt auf den Hof geliefert wurde.
Kalk wurde geliefert und gleich auf dem Feld ausgestreut. In den 1960ger Jahren waren alle Ackerflächen der Rohmaner
Felder bestellt.
Die nach dem Krieg zurückgebliebenen deutschen Bauernfamilien, aber auch die Polen, die während des Krieges beim Bauern
in Deutschland gearbeitet haben, versuchten mit teils bescheidenen, oder auch zusammen gesuchten, landwirtschaftlichen
Geräten, die bäuerlichen Betriebe aufrecht zu erhalten. Nach den schweren Anfängen in den ersten Nachkriegsjahren
erzielten sie schließlich einen beachtlichen Erfolg, der sich in wogenden Kornfeldern, sowie in grünen Wiesen auf
denen gut genährtes Vieh weidete, widerspiegelte.
Ein schwerer Einschnitt in meinem Leben.
Am 11. Mai 1956 verstarb nach langer schwerer Krankheit, meine liebe Ehefrau Marta Rattay,
geborene Brosch. Ein Jahr zuvor war schon mein Schwiegervater Gottlib Brosch verstorben. Die schweren Bedingungen
unter denen wir nach Kriegende leben mussten, haben ihrer bereits angegriffenen Gesundheit sehr zugesetzt. Sie
verstarb mit 44 Jahren und hinterließ in unserer Familie eine große Lücke, die nicht mehr zu Überbrücken war. Wir
haben sie unter großer Anteilnahme der noch verbliebenen deutschen Bevölkerung zu Grabe getragen und auf dem Rohmaner
Friedhof beigesetzt. Die Arbeit die sie sonst verrichtet hatte fiel jetzt auf mich und meine Söhne zurück. Meine
Schwester Frieda Pelkowski half auch wo sie nur konnte. Wir waren auf die Unterstützung durch Nachbarn und Freunde
angewiesen, die uns immer wenn es nötig war, tatkräftig unterstützt haben. Im laufe der Zeit haben wir wieder zum
Alltag zurück gefunden, haben sie noch etliche Jahre auf dem Friedhof besuchen können, bis wir, bedingt durch unsere
Ausreise uns endgültig von ihr trennen mussten.
Der endgültige Abschied von Ostpreußen
Ab 1956 begannen, durch die Vermittlung des Deutschen Roten Kreuzes, die ersten Ausreisen in die
Bundesrepublik Deutschland. Zuerst waren es Kinder die zu ihren Eltern ausreisen durften, Familien deren Väter aus der
Kriegsgefangenschaft in den Westen Deutschlands entlassen wurden und andere durch den Krieg getrennte
Familienangehörige. Ab 1960 erhöhte sich die Zahl der Ausreisewilligen aus dem polnisch besetzten Ostpreußen. Es setzte
sich die Überzeugung durch, dass unsere Angestammte Heimat, uns für die Zukunft keine Perspektive mehr bieten konnte.
Meistens wurden die Anträge, die wir an die Passabteilung in Allenstein stellen mussten, um einen Ausreisepass zu
bekommen, negativ beschieden. Nach mehrmaligen Versuchen gelang es dann doch, diese begehrte Ausreiseberechtigung in
Empfang zu nehmen. Die Enttäuschung der Zurückgebliebenen war groß, wenn wieder mal Verwandte oder Nachbarn, den Weg
in Richtung Bahnhof einschlugen.
Um einen Reisepass zu beantragen, musste man zuerst eine Einladung von Verwandten aus der Bundesrepublik vorlegen, in
der, diese sich verpflichten mussten, für Unterkunft und Verpflegung der Eingeladenen zu sorgen. Diese Einladung
musste durch ein Amt in der Bundesrepublik beglaubigt werden. Außerdem mussten die Kosten für die Bahnfahrt, ab
polnischer Grenze, bis zum Zielort, beim polnischen Reisebüro ORBIS, in Warschau, in DM eingezahlt werden.
Unseren ersten Ausreiseantrag haben wir 1964, bei der Kommandantur der polnischen Miliz in Allenstein eingereicht, der
nach einer gewissen Zeitspanne, ohne eine uns verständliche Begründung zu nennen, abgelehnt wurde. Gegen diese
Ablehnung wurde ein Widerspruch zugelassen, den wir sofort einreichten. Nach einer weiteren Zeitspanne erhielten wir
wieder eine Ablehnung, gegen die kein Widerspruch mehr zulässig war. Wer seine Ausreiseabsicht nicht aufgeben wollte,
musste einen neuen Antrag stellen. Es gab Familien die schon 10 Mal einen Ausreiseantrag gestellt hatten und immer
wieder abgewiesen wurden. Da meine Söhne, nicht die Absicht hatten in Rohmanen zu bleiben und ich nach 2 Weltkriegen,
an denen ich teilgenommen, die schwere Arbeit auf der Landwirtschaft, nicht aus eigener Kraft schaffen würde, haben wir
1966 wieder einen Antrag gestellt, der prompt abgelehnt wurde. Der Widerspruch auf diese Ablehnung wurde auch negativ
beantwortet, so dass wir 1968 wieder einen Antrag eingereicht haben.
Weil das Passamt in Allenstein lange nichts von sich hören ließ, hegten wir schon die Hoffnung das es jetzt klappen
würde und waren sehr enttäuscht als wieder eine Absage kam. In der Zwischenzeit sind viele Nachbarn und Bekannte aus
Rohmanen, sowie aus der näheren Umgebung, ausgereist und das Häuflein der noch verbliebenen Deutschen, wurde immer
kleiner. Die Motivation, die uns in früheren Jahren, über so manche schwierige Lage hinweg geholfen hat, ist einer
hoffnungslosen Resignation gewichen. Man war davon überzeugt, dass unser Leben, in unser Angestammten Heimat, keine
Zukunftsperspektive mehr haben konnte und wenn wir keine Ausreisegenehmigung bekommen, wir eines Tages die letzten
Deutschen in der ganzen Umgebung sein werden.
Die Ausreise-Heimat ade
Wir hatten die Hoffnung schon aufgegeben, als am 30. April 1969, der Briefträger unseren Hof
betrat und mir einen Brief überreichte, in dem uns das Passamt in Allenstein mitteilte, dass unsere Ausreise in die
Bundesrepublik Deutschland, genehmigt worden ist. Wir müssten, nach Aushändigung der Reisepapiere, den Geltungsbereich
der Volksrepublik Polen, innerhalb von 3 Monaten verlassen. Wir waren zuerst geschockt, über den Hinweis, das wir
unsere Heimat in 3 Monaten verlassen müssen, aber dann stellte sich die Zukunftsperspektive wieder ein und wir gingen,
wie von einem schweren Ballast befreit und gut gelaunt unser weiteren Tätigkeit nach.
Als der Briefträger unseren Hof betrat, waren ich und mein Sohn Kurt gerade dabei eine Fuhre Mist zu laden. Wir hatten
den Wagen gerade halb geladen und haben nach der frohen Kunde nicht mehr weiter gemacht, sondern die Pferde vorgespannt
und den Mist aufs Feld gefahren, damit wir den Wagen für alle Fälle frei hatten. Das war die letzte Tätigkeit für
unsere Landwirtschaft in Ostpreußen.
Die Nachricht von unserer Ausreise verbreitete sich, ohne dass wir darüber gesprochen haben, wie ein Lauffeuer.
Alsbald kamen Leute aus dem Dorf, die sich für das Vieh und für diverse Landwirtschaftliche Geräte interessierten.
Etliche wollten bestimmte Sachen sofort kaufen, andere haben nur zurücklegen lassen und wollten später kommen und
bezahlen, haben es aber dann doch nicht genommen.

Wenn man eine Landwirtschaft hatte, konnte man 2 Pferde, 2 Rinder, 3 Schweine, 5 Schafe und 10 Hühner, in einem
geschlossenen Viehwaggon, in die Bundesrepublik mitnehmen. Jeden Tag war man unterwegs, von einer Behörde zur Andern.
Die Aushändigung der Reisepapiere erfolgte nur nach Vorlage bestimmter Bescheinigungen: Es mussten alle Steuern bezahlt
sein, das Kontingent landwirtschaftlicher Erzeugnisse musste abgeliefert sein, je eine Bescheinigung vom Katasteramt
und vom Notar musste vorgelegt werden, das man dem polnischen Staat das Grundstück abgetreten hat. Die Gebühren für
die notarielle Beglaubigung mussten wir selbst bezahlen. Wenn man alle Bescheinigungen beisammen hatte, bekam man bei
der Kreisverwaltung eine Gesamtbescheinigung. Mit dieser Bescheinigung konnte man nach Allenstein, zur
Polizeikommandantur fahren, wo man nach dem schriftlichen Verzicht auf die polnische Staatsangehörigkeit, einen
Reisepass ausgehändigt bekam, der den Inhaber zum Grenzübertritt berechtigte, aber nicht zur Wiedereinreise.
Wir haben 2 Pferde, eine Sterke, einen Ochsen, 5 Schafe, 2 Schweine und 10 Hühner mitgenommen. Über die Schutzimpfung
der Rinder musste man eine, vom Kreistierarzt beglaubigte Bescheinigung vorweisen. Ich habe 5 Schafsböcke gekauft, die
ich in der Zwischenzeit, hinter der Scheune, zum Weiden angekettet hatte. Einer von denen hat sich losgerissen und
seinen Nachbarn getötet. Das Fleisch konnten wir noch verkaufen, mussten aber dafür einen anderen Schafsbock kaufen.
Innerhalb von 3 Monaten mussten wir alles regeln und zwei Tage vor der Abfahrt einen Eisenbahnwagen, bei der
Eisenbahndirektion in Allenstein bestellen. Reservierungen bei den polnischen Behörden waren meist immer mit
Schmiergeld verbunden, weil man sonst nie sicher sein konnte dass diese Vereinbarungen auch eingehalten werden. Schon
2 Wochen vor unserer Abfahrt, gab es in Ortelsburg keine alkoholischen Getränke zu kaufen. Meine Söhne mussten mit dem
Motorrad die umliegenden Dörfer abfahren, damit wir für die Reise einen Vorrat anlegen konnten; denn Wodka war zu der
Zeit, in Polen, wie eine zweite Währung.
Am 25. Juli haben wir zusammen, mit meinem Neffen Siegfried Brosch, unseren sonstigen Hausrat, der in Kisten verpackt
war, in einen Eisenbahnwagen, auf dem Allensteiner Bahnhof verladen. Alles musste zuerst durch den Zoll, wo die
Federbetten gewogen wurden und über das erlaubte hinausgehende Kissen, verzollt werden mussten. Dasselbe galt auch für
Fleisch und Räucherwaren.
Am 26. Juli, unserem Verladetag, kam der Eisenbahnwagen aus Allenstein, erst um 11 Uhr auf dem Ortelsburger Bahnhof an.
Die Rinder hatten wir zu Fuß, zum Bahnhof gebracht; Schweine, Schafe und Hühner auf dem Pferdewagen. Im Eisenbahnwagen
mussten, mit Hilfe von Brettern und Bohlen, Boxen für die verschiedenen Tiere erstellt werden. Jedes Pferd und jedes
Rind in eine Bucht. Die Schafe zwischen die Pferde, die Schweine zwischen die Rinder und die Hühner in einem Käfig,
unter der Decke über den Rindern. Die Hühner hatten unterwegs Eier gelegt, somit hatten wir jeden Tag frische
Verpflegung. Bei der Fahrt im Viehwagen, begleitete mich mein Sohn Manfred. Als die Lokomotive nahte, um den Wagen
abzuholen, wurden noch schnell die restlichen Sachen hinein geworfen und so mache Abschiedsträne rollte dann die Wange
hinab.
Unsere Nachbarn, Deutsche und Polen, halfen uns beim Verladen des lebendigen Inventars. Jetzt erinnerte ich mich
plötzlich, an die oft auch schönen, Ereignisse der letzten 22 Jahre. Einer Zeit, in der das Zusammenleben von
Deutschen und Polen, von Jahr zu Jahr, besser wurde. Man half sich beim einbringen der Getreideernte, beim Dreschen
des Getreides, bei der Kartoffelernte und bei anderen Arbeiten, wo viele Menschen zupacken mussten. Es war eine
Dorfgemeinschaft, in schweren Zeiten geboren; jeder half jedem wenn Hilfe nötig war. Es wurde mir plötzlich bewusst,
das jetzt ein Lebensabschnitt zu Ende ging, zu dem ich nicht mehr zurückkehren konnte. Unsere Existenzgrundlage war
jetzt ein Eisenbahnwagen auf einem Schienenstrang, dessen Ende irgendwo in weiter Ferne lag. Obwohl, von langer Hand
vorbereitet, war dieser Moment voller Wehmut.
Doch als der Zug sich plötzlich, in Bewegung setzte, war ich sofort wieder in der Gegenwart. Menschen, mit denen man
Jahrzehnte lang, in gutem Einvernehmen zusammen gelebt hat, blieben plötzlich am Bahnsteig zurück und die Entfernung
zwischen ihnen und mir vergrößerte sich mit jeder Sekunde, bis sie letztendlich aus meinem Blickfeld verschwanden.
Es war ein heißer Julitag, als wir unsere Reise gen Westen antraten. Für die Schweine, die besonders unter der Hitze
zu leiden hatten, haben wir 10 Flaschen Essig mitgenommen und sie von Zeit zu Zeit besprenkelt, damit sie besser atmen
konnten. Für die anderen Tiere war reichlich Heu und Hafer vorhanden. Eine großes Fas und zwei Milchkannen waren mit
Wasser gefüllt, die wir auf den an der Strecke liegenden Bahnstationen, bei Bedarf wieder nachgefüllt haben.
Da der Kreistierarzt nicht in seinem Büro war, konnten wir die Impfbescheinigung für das Vieh, nicht rechtzeitig
herbeischaffen. Der Zug setzte sich in Bewegung und die Bescheinigung war immer noch nicht da. Als die Bescheinigung
dann eingetroffen, wir aber schon unterwegs waren, ist mein Sohn Kurt mit dem Motorrad hinterher gefahren und hat uns
in Passenheim, wo der Zug noch andere Wagen angehängt bekam, die Impfbescheinigung übergeben. Wir waren sehr froh das
er es noch geschafft hat, denn in solch einer Situation fühlt man sich sicherer wenn man alle Bescheinigungen bei sich
hat. Auf der Rückfahrt, mit dem Motorrad hatte er noch eine Panne, musste das Motorrad stehen lassen und per Anhalter
nach Hause fahren. Am nächsten Tag kam er mit Siegfried Deptolla, der das Motorrad wieder flott machte und brachte es
wieder nach Rohmanen zurück.
Die Fahrt mit dem Viehwagen, gen Westen
Von Ortelsburg bis Allenstein(45 km) hat unser Zug 4 Stunden gebraucht, weil auf jedem Bahnhof
gehalten wurde, um neue Wagen anzuhängen. Nachdem wir in Allenstein angekommen waren, kam ein Rangierer und fragte
nach unserem Ziel. Als wir ihm mitteilten, das wir in die Bundesrepublik Deutschland wollen, sagte er nur: „In 10
Minuten fährt ein Zug los. Wenn ich von euch 500 Zloty und einen Liter Wodka bekomme, werde euch sofort anhängen,
andernfalls kommt ihr auf ein Nebengleis und müsst dann auf den nächsten Zug warten. Es blieb uns nichts anderes übrig
als seiner Forderung nachzukommen, denn über derartige Erpressungen hat man bereits von Anderen, die vor uns ausgereist
sind, gehört. Wir wurden auch sofort angehängt und fuhren dann die ganze Nacht, an Osterode, und Thorn vorbei bis
Gnesen. Dort wurde wieder rangiert.
Von einer Anhöhe wurden die einzelnen Wagen auf verschiedene Gleise verteilt und zu neuen Zügen zusammengestellt. Der
Aufprall der ungebremsten Wagen erzeugte eine derartige Erschütterung, dass manche Bretter an den Boxen geborsten waren.
Von Gnesen ging es dann in einem Zuge durch bis zur Grenzstation Reppen(Rzepin). Dort mussten wir zum Zollamt, wo
unsere Ausfuhrpapiere durch die Zollbeamten, und durch einen Tierarzt geprüft wurden. Bis Reppen(Rzepin) haben wir für
den Eisenbahnwagen 900 Zloty bezahlt; hier mussten wir noch einmal 650 Zloty bezahlen. Bei der Wagenkontrolle erklärte
uns ein Bahnbeamter das unser Wagen, sich nicht für den internationalen Transport eignet und wir deshalb den Inhalt in
einen Anderen umladen müssen, der irgendwann, auf dem Nebengleis bereitgestellt wird. Nach langer Verhandlung, sowie
einer Zulage von 500 Zloty und einem Liter Wodka haben wir ihn davon überzeugt, das der Wagen sich doch für die
Weiterfahrt eignet.
In der Nacht war Schichtwechsel, der unseren Wagen wieder abgehängt hat, weil er angeblich von der Reichsbahn der DDR,
wegen technischer Mängel nicht weiterbefördert würde. Wir mussten unsere Verhandlung vom Vorabend wiederholen, die mit
der Zusage endete, dass wir am frühen Morgen, über die Grenze auf DDR Gebiet, gebracht werden. Um 5 Uhr morgens kam
eine Lokomotive, die uns den letzten Abschnitt bis über die Grenze bringen sollte. Als der Zug hat noch einmal anhielt,
kamen polnische Grenzbeamte und Soldaten in den Wagen. Sie durchsuchten ihn und fragten, ob wir noch polnisches Geld
oder einen Grundbuchauszug bei uns hätten. Wir zeigten ihnen 800 Zloty, die sie uns, nach Ausstellung einer Quittung
über 500 Zloty, abnahmen. Die Grundbuchauszüge habe ich, im Stroh versteckt, dem Ochsen vor die Füße gelegt. Falls
jemand da suchen sollte, hätte ich gesagt, das das Tier bösartig veranlagt ist, und ich für seine Sicherheit nicht
garantieren könnte, deshalb sollte er vorsichtig sein.
Als die Grenzkontrolle den Zug verlassen hatte, setzte sich die Lokomotive wieder in Bewegung und überquerte nach
kurzer Zeit die Oderbrücke. Auf einer eingezäunten Fläche, jenseits der Grenze, hat man uns abgestellt hat und die
Lokomotive fuhr zurück auf polnisches Gebiet. Vor und hinter uns waren die Tore verschlossen. Auf den Wachtürmen,
links und Rechts von uns, standen Posten mit einem Gewehr im Anschlag. Vier Grenzbeamte der DDR, jeder mit einer
Leiter in der Hand, sowie ein Schäferhund, kamen zu unserem Wagen. Sie öffneten die Schiebetüre, stellten die Leiter
davor und ließen den Hund in den Wagen springen, der nur etwas herum schnupperte und wieder heraussprang. 2 Beamte
haben dann anschließend, die Papiere kontrolliert und das Inventar gezählt.
Nach einiger Zeit wurden wir an einen Güterzug der Reichsbahn angehängt und fuhren von Frankfurt an der Oder, vorbei
an Berlin, Ellingen und Nordhausen, über die Grenze zur Bundesrepublik bis Herzberg. Hier hat ein Zollbeamter der
Bundesrepublik, die Formalitäten erledigt und ein Tierarzt die Pferde, Rinder und Schweine gründlich untersucht. Ich
musste ihnen die Mäuler aufhalten und die Füße hochheben. Danach hat uns die Lokomotive zu einer Wasserzapfstelle
gebracht, wo wir die Tiere tränken und unsere Behälter mit Wasser auffüllen konnten. Anschließen fuhren wir über
Northeim nach Göttingen, zur Viehverwertungsgenossenschaft, die zuvor von unserer Ankunft in Kenntnis gesetzt wurde.
Der Ochse, die Sterke und die Schweine wurden, in Göttingen zum Schlachthof gebracht; die Pferde kamen nach Hannover
und die Schafsböcke nach Kassel. Wir waren mit dem Viehtransport 5 Tage unterwegs; hatten so manche Klippe umschifft
und Schwierigkeiten gemeistert, die im normalen Leben nicht vorkommen.
Wir wurden mit einem PKW, ins Durchgangslager Friedland bei Göttingen gefahren, wo mein Sohn Kurt, meine Schwester
Frieda Pelkowski und Siegfried Brosch mit Familie, die am 30 Juli, um 14 Uhr, von Warschau mit dem Zug abgefahren, und
hier am 31. Juli in den Morgenstunden eingetroffen sind, schon auf uns gewartet haben. In Friedland hat man uns mit
Familie Siegfried Brosch in einem Raum untergebracht, wir wurden registriert und erhielten 20 DM Überbrückungsgeld,
pro Person. Da wir erst am Freitag in Friedland eingetroffen sind, mussten wir hier über das Wochenende bleiben,
obwohl die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der Regel nur 3 bis 4 Tage beträgt.
Um einen Antrag für die Ausreise stellen zu können, brauchten wir eine Einladung von in der Bundesrepublik lebenden
Verwandten. Diese Einladung hat uns mein Bruder, Ernst Rattay, aus Ingelheim am Rhein zugeschickt. Ingelheim liegt im
Bundesland Rheinland-Pfalz. Das Geld für die Bahnfahrt, hat uns, Frieda Schellin, geb. Nickel, aus Duisburg, die
Tochter unseres Nachbarn, überwiesen. In Friedland wurden wir registriert. Im Registrierschein, war als unser
nächster Aufenthaltsort in der Bundesrepublik, das Durchgangslager Osthofen bei Worms, das alle Aussiedler für
Rheinland-Pfalz aufnehmen musste, eingetragen. Die Eintragung erfolgte deshalb, weil der Ort aus dem uns unsere
Einladung zugeschickt wurde, sich auch in Rheinland-Pfalz befand.
Da ich nach dem Polenfeldzug, als Soldat, ein Jahr im Kreis Opladen, im Rheinland gewesen bin, wäre ich sehr gerne in
diese Gegend gezogen, denn die Erinnerung an die schönen Tage die ich dort verlebt habe war in mir immer noch wach.
Ich versuchte die Eintragung in unseren Regiestierscheinen ändern zu lassen, was nach einigen, vielleicht auch
berechtigten Einwänden, am 4. August, vom Beauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen, genehmigt wurde. Anstelle von
Rheinlad-Pfalz stand da jetzt Nordrhein-Westfalen und am 7. August, fuhren wir, noch mit anderen Aussiedlern, ins
Durchgangslager Unna-Massen, am östlichen Rande des Ruhrgebietes gelegen. Hier wurden wir in einem Zimmer untergebracht
und konnten unser Essen in einer Gemeinschaftsküche zubereiten.
Am 8. August wurden wir in Unna-Massen, als Bürger der Bundesrepublik Deutschland registriert, erhielten
Einhundert DM Begrüßungsgeld, den Vertriebenen Ausweis -A -und 4 Wochen später den Bundespersonalausweis. In
Unna-Massen haben wir mehr als 4 Monate verbracht, weil mein Sohn Kurt, wegen fehlender Berufsausbildung, in Unna, an
einem Grundlehrgang für Metallarbeiter teilgenommen hat, der vom Arbeitsamt finanziert wurde. Am 11 Dezember 1969 sind
wir endlich an unserem vorläufigen Wohnsitz, im Durchgangswohnheim, an der Elisabethstraße 13, in Velbert angekommen.
Ab dem 5. Januar 1970 konnten meine Söhne, in der Zahnradfabrik Reining, in Velbert ihrer geregelten Arbeit nachgehen.
Von Bau- und Sparverein in Velbert wurde uns am 20. Juni 1970, unsere erste Wohnung zugewiesen.
Velbert im Februar 1972
gezeichnet: Gustav Rattay
Das Ende des 1. Weltkrieges erlebte er an der Westfront. Den Rückzug aus Frankreich bis Köln und dann weiter mit der
Bahn bis Ostpreußen, empfanden er und seine Kameraden als eine bittere Niederlage. Der Wiederaufbau nach dem 1.
Weltkrieg und die Umgestaltung des gesellschaftlichen Lebens, im nun vom Reich abgetrennten Ostpreußen, nahm seine
Aufmerksamkeit voll in Anspruch. Die Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum, lag ihm sehr am Herzen, was
in seiner Werbung für verschiedene Organisationen ihren Ausdruck fand.
Von der politischen Umgestaltung, in den 30ger Jahren, war er wenig begeistert, weil er als Teilnehmer des 1.
Weltkrieges, die Schrecken einer militärischen Auseinandersetzung am eigenen Leib erfahren hat. Dennoch hielt er es
für seine Pflicht, als erfahrener Frontsoldat, an den militärischen Übungen teilzunehmen.
Schon vor Anfang des 2. Weltkrieges war er einer der ersten, die eingezogen wurden. Seinen Fronteinsatz in Polen,
als Sanitätsunteroffizier, sowie andere Tätigkeiten im sanitären Bereich hat er unverletzt überstanden und ist nach
dem Rückzug aus dem polnischen Raum, über Schlesien, den Spreewald und den Raum südlich von Berlin, mit seiner Einheit,
bis zu Elbe zurückgewichen. In Grimma an der Mulde geriet er in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Nach seiner
Auslieferung an die Franzosen und einer, ein Jahr dauernden Gefangenschaft, wurde er in die sowjetische Besatzungszone
entlassen.
Aus dem Raum Magdeburg versuchte er seine Familie wieder zu finden und fand sie auch bei Rostock, an der Ostsee.
Sein Bestreben war es wieder eine Tätigkeit in der Landwirtschaft zu finden. 1947 ist er mit seiner Familie, auf
seinen Hof, nach Ostpreußen zurückgekehrt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, die seinen ganzen Einsatz erforderten,
ist es ihm im Laufe der Jahre gelungen, den, durch Kriegseinwirkungen und Plünderungen in der Nachkriegszeit,
verwahrlosten Hof wieder dem Vorkriegsniveau, anzunähern.
Als in den 60ger Jahren, die nach dem Krieg noch im südlichen Ostpreußen verblieben Deutschen, die Ausreise in die
Bundesrepublik Deutschland anstrebten, hielt es auch mein Vater, für angebracht, diesem Trend zu folgen. Er, der viele
Jahrzehnte, vom deutschen Geistesleben geprägt wurde, und seinem Vaterland, in guten wie in schlechten Zeiten, immer
die Treue hielt, war davon überzeugt das sein weiteres Leben, nur in der Bundesrepublik Deutschland einen Sinn haben
konnte.
1969 sind auch wir, für immer, in die Bundesrepublik Deutschland ausgereist. Über Friedland, Unna-Massen, kamen wir
am 11.12.1969 nach Velbert im Rheinland. Hier verbrachten wir die ersten fünf Jahre im Westen. Mein Vater der ein
ausgeprägtes Gedächtnis hatte, begann damit, seine Erlebnisse aufzuschreiben. Bis zu seinem Tod, am 21.12.1983, hatte
er sein Wissen auf vielen Seiten niedergeschrieben. Ich habe seine Aufzeichnungen geordnet und elektronisch erfasst,
damit diese wertvollen Erinnerungen an Rohmanen und an unsere ostpreußische Heimat, nicht verloren gehen.
Schon vor Anfang des 2. Weltkrieges war er einer der ersten, die eingezogen wurden. Seinen Fronteinsatz in Polen,
als Sanitätsunteroffizier, sowie andere Tätigkeiten im sanitären Bereich hat er unverletzt überstanden und ist nach
dem Rückzug aus dem polnischen Raum, über Schlesien, den Spreewald und den Raum südlich von Berlin, mit seiner Einheit,
bis zu Elbe zurückgewichen. In Grimma an der Mulde geriet er in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Nach seiner
Auslieferung an die Franzosen und einer, ein Jahr dauernden Gefangenschaft, wurde er in die sowjetische Besatzungszone
entlassen.
Aus dem Raum Magdeburg versuchte er seine Familie wieder zu finden und fand sie auch bei Rostock, an der Ostsee.
Sein Bestreben war es wieder eine Tätigkeit in der Landwirtschaft zu finden. 1947 ist er mit seiner Familie, auf
seinen Hof, nach Ostpreußen zurückgekehrt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, die seinen ganzen Einsatz erforderten,
ist es ihm im Laufe der Jahre gelungen, den, durch Kriegseinwirkungen und Plünderungen in der Nachkriegszeit,
verwahrlosten Hof wieder dem Vorkriegsniveau, anzunähern.
Als in den 60ger Jahren, die nach dem Krieg noch im südlichen Ostpreußen verblieben Deutschen, die Ausreise in die
Bundesrepublik Deutschland anstrebten, hielt es auch mein Vater, für angebracht, diesem Trend zu folgen. Er, der viele
Jahrzehnte, vom deutschen Geistesleben geprägt wurde, und seinem Vaterland, in guten wie in schlechten Zeiten, immer
die Treue hielt, war davon überzeugt das sein weiteres Leben, nur in der Bundesrepublik Deutschland einen Sinn haben
konnte.
1969 sind auch wir, für immer, in die Bundesrepublik Deutschland ausgereist. Über Friedland, Unna-Massen, kamen wir
am 11.12.1969 nach Velbert im Rheinland. Hier verbrachten wir die ersten fünf Jahre im Westen. Mein Vater der ein
ausgeprägtes Gedächtnis hatte, begann damit, seine Erlebnisse aufzuschreiben. Bis zu seinem Tod, am 21.12.1983, hatte
er sein Wissen auf vielen Seiten niedergeschrieben. Ich habe seine Aufzeichnungen geordnet und elektronisch erfasst,
damit diese wertvollen Erinnerungen an Rohmanen und an unsere ostpreußische Heimat, nicht verloren gehen.
Als in den 60ger Jahren, die nach dem Krieg noch im südlichen Ostpreußen verblieben Deutschen, die Ausreise in die
Bundesrepublik Deutschland anstrebten, hielt es auch mein Vater, für angebracht, diesem Trend zu folgen. Er, der viele
Jahrzehnte, vom deutschen Geistesleben geprägt wurde, und seinem Vaterland, in guten wie in schlechten Zeiten, immer
die Treue hielt, war davon überzeugt das sein weiteres Leben, nur in der Bundesrepublik Deutschland einen Sinn haben
konnte.
1969 sind auch wir, für immer, in die Bundesrepublik Deutschland ausgereist. Über Friedland, Unna-Massen, kamen wir
am 11.12.1969 nach Velbert im Rheinland. Hier verbrachten wir die ersten fünf Jahre im Westen. Mein Vater der ein
ausgeprägtes Gedächtnis hatte, begann damit, seine Erlebnisse aufzuschreiben. Bis zu seinem Tod, am 21.12.1983, hatte
er sein Wissen auf vielen Seiten niedergeschrieben. Ich habe seine Aufzeichnungen geordnet und elektronisch erfasst,
damit diese wertvollen Erinnerungen an Rohmanen und an unsere ostpreußische Heimat, nicht verloren gehen.
Meine ersten Schritte

Ich bin am 7.2.1898 in Rohmanen Kreis Ortelsburg geboren. Meine Eltern hatten eine Landwirtschaft von 14,34
Hektar(Erbhof). Mein Vater ist in Jellinowen(Gellen) Kreis Ortelsburg geboren. Seit dem 18. Lebensjahr arbeitete er
als Bergmann in Westfalen. Auf der Zeche „Unser Fritz” verdiente er sein Geld unter Tage. Mit 24 Jahren kehrte er nach
Ostpreußen zurück. Seine Eltern wollten im den Hof in Jellinowen übergeben. Da er jedoch Schwierigkeiten hatte, im
Umgang mit seiner Stiefmutter, verzichtete er auf dieses Angebot. Da mein Vater durch seine Arbeit im Kohlenbergwerk
etwas Geld gespart hatte, versuchte er wo anders Fuß zu fassen. Seine Wahl fiel auf Rohmanen im Kreis Ortelsburg. Hier
heiratete er die Tochter des Landwirts Adam Slopianka.
Mein Großvater mütterlicherseits hatte nur Schulland gepachtet, dass er mit zwei Ochsen bearbeitet hat. Mit dem Geld,
das mein Vater im Kohlenbergbau, in Westfahlen verdient hat, konnte er Land dazukaufen und dadurch auch den Hof
vergrößern. Bis zu meiner Einschulung wurde ich im Elternhaus erzogen. Vom 6. bis zum 14. Lebensjahr habe ich die, in
drei Klassen eingeteilte Volksschule in Rohmanen besucht. Wir wurden in der Schule streng erzogen und man versuchte
uns alles beizubringen damit wir so gut wie möglich durchs Leben kommen würden.
Die Hauptschullehrer Reinhard, Puzicha, und Schürmann waren unsere Klassenlehrer. Wir bekamen dann den Hauptlehrer
Müller und die Klassenlehrer Willimzik und Maleyka. Hauptlehrer Müller war von Osterode nach Rohmanen gekommen. Zur
Rohmaner Schule gehörten 110 Morgen Land. Hauptlehrer Müller hatte alles bearbeitet. Auf seinem Hof arbeiteten 2
Knechte und 2 Mägde. Er hatte 4 Pferde, Rinder und eine Schweinezucht. Auch eine neue Scheune wurde in seiner Amtszeit
auf dem Schulhof errichtet. Lehrer Müller demonstrierte den Rohmaner Bauern wie man unter Verwendung von Kunstdünger
und fachgerechter Bodenbearbeitung die Erträge aus der Landwirtschaft erheblich steigern kann. Im August 1914 wurde
Lehrer Müller zusammen mit seinem Sohn Alfred und Karl Deptolla von den Russen erschossen.
Rohmanen vor dem Ersten Weltkrieg
Rohmanen ist von der Kreisstadt Ortelsburg 3 Kilometer entfernt und liegt an der Landstraße von Ortelsburg über
Kobulten nach Bischofsburg. Wegen der Nähe zur Kreisstadt wurde schon darauf geachtet, dass alles ordentlich und
sauber war. Die Zäune, an der Straßenseite, wurden, bei Bedarf immer ausgebessert und jeden Sonnabend musste die
Straße gefegt werden. Der Landjägermeister kam am Sonntag zu Pferde geritten und hat nachgesehen ob jeder seine
Pflicht getan hat. Hatte jemand vergessen die Straße zu fegen, kostete ihn das 5 Reichsmark Strafe, was zu jener Zeit
viel Geld war. Wenn er dann vor dem Gasthof anhielt, kam Frl. Trzaska mit einem Tablett heraus, auf dem sich eine
Zigarre, ein Gläschen Kognak und auch 2 Stück Würfelzucker fürs Pferd, befanden. Er nahm alles entgegen ohne vom Pferd
zu steigen und ritt dann ins nächste Dorf weiter.
Die Rohmaner Feldmark erstreckte sich etwa über 1500 Hektar. Das Dorf bestand aus etwa 80 Höfen; die Abbauten und
nicht landwirtschaftlichen Gebäude mitgerechnet. Sechs Abbauten sind nach dem zweiten Weltkrieg, teils durch
Fronteinwirkungen, teils durch Vandalismus, unwiederbringlich verloren gegangen. Auf einen Teil der Rohmaner Felder
erstreckt sich auch der Dammerauer Höhenzug. Die höchste Erhebung von 210 Meter über dem Meeresspiegel, befindet sich
auf dem Feld von Friedrich Glinka. Da ist auch ein vierkantiger Granitstein eingegraben, der als Navigtionspunkt, zur
Erstellung von Kartenmaterial, genutzt wurde. Diese Stelle war mit einer Holzpyramide gekennzeichnet und diente auch
bei Truppenmanövern als Orientierungspunkt.
Im Bereich der Rohmaner Gemarkung befinden sich so gut wie keine Wiesen. Die Rohmaner Wiesen liegen etwa 10 Kilometer
entfernt; bei der Försterei Wickno, in Schodmak, in Seedanzig und in Neu Schiemanen. Kurz vor dem zweiten Weltkrieg,
haben Herr Biella und Friedrich Trzaska sich schon mit der staatlichen Forstverwaltung, darauf geeinigt, die Wiesen in
Neu Schiemanen gegen näher gelegene zu tauschen. Die neuen Wiesen liegen vor dem Waldpuschsee und befinden sich im
Besitz der staatlichen Forste. Obwohl die eingetauschte Fläche schon neu vermessen wurde und genutzt werden konnte,
wurde sie leider vom Katasteramt, noch nicht ins Grundbuch eingetragen. Auf Grund dieser Tatsache, wurde dieser
Tausch, nach dem Krieg, von den polnischen Behörden, nicht anerkannt.

In der Mitte des Dorfes befindet sich ein, 5 Morgen großer Teich, der den Bauern als Viehtränke diente und Enten sowie
Gänse zum verweilen einlud. Es wurde dort auch Löschwasser entnommen, wenn es im Dorf brannte. Im Teich waren auch
verschiedene Fische, die der Fischer Adam Glitza, in jedem Frühjahr neu eingesetzt hat. Die Fische sind wegen des
vielen Schlammes, der den Boden bedeckte, oft erstickt sind. Aus Richtung Ortelsburg kommend, liegt 50 Meter vor dem
Dorfeingang, zur rechten Hand, ein Soldatenfriedhof. Auf ihm haben die Gefallenen des 1.Weltkrieges, Deutsche und
Russen, ihre letzte Ruhe gefunden. Von der Landstraße kommend muss man einige Stufen hinaufsteigen, die von beiden
Seiten mit Birken bepflanzt sind.
Auf einer kleinen Anhöhe befindet sich die aus zwei Klassenräumen bestehende Dorfschule, mit einer Wohnung für den
Lehrer. Die Schule wurde 1906, mit tatkräftiger Unterstützung aller Dorfbewohner, aus gebrannten Lehmziegeln, gebaut.
Auf der Anhöhe, vor der Schule sind später Kastanienbäume gepflanzt worden, die den Schulkindern, an heißen Tagen
Schatten spendeten.
Die älteste Familie in Rohmanen war die Familie Friedrich Biella. Wie ich mich noch erinnern kann war sein Vater
Gemeindevorsteher. Nach seinem Tode hat das Amt sein Sohn Friedrich übernommen bis er 1914 als Unteroffizier in den
ersten Weltkrieg einrücken musste. Friedrich Biella hat aktiv bei der Garde in Berlin gedient. Bei den Wahlen und bei
der Abstimmung 1920 hat er sich sehr für den Erhalt des Deutschtums eingesetzt. Er hat auch im Jahr 1896, die
Freiwillige Feuerwehr in Rohmanen ins Leben gerufen und war zugleich ihr erster Brandmeister. Bei der Genossenschaft
und bei der Darlehenskasse war er im Vorstand. Dadurch war es ihm möglich die Rohmaner Bauern mit Krediten und
Kunstdüngern zu versorgen. Die Söhne Fritz und Wilhelm hat er aufs Gymnasium nach Ortelsburg geschickt und studieren
lassen. Bei Bauernversammlungen hat uns Fritz Biella Vorträge gehalten.
Eine weitere Familie war die des Gasthofbesitzers Friedrich Trzaska. Der Hof von Friedrich Trzaska war der älteste in
Rohmanen. Wenn die Bauern aus weiter gelegenen Dörfern, vom Wochenmarkt nach Hause fuhren, hielten sie oft an der
Gaswirtschaft an. Die Pferde, sowie die auf dem Markt eingekauften Rinder wurden dann, an einem vor dem Haus
angebrachten Querbalken festgebunden und die Besitzer machten es sich in der Gaststube gemütlich. Zwei große
Kastanienbäume standen zu beiden Seiten der Eingangstreppe und weiter rechts war ein großes Fenster, in dem, die im
Geschäft vorrätigen Artikel, ausgestellt waren; besonders zur Weihnachtszeit. Die Kinder drückten sich an der Scheibe
die Nase platt, um die vielen schönen Sachen, die sich die meisten Dorfbewohner nicht leisten konnten, wenigstens aus
der Nähe zu bestaunen.
In der Gaststube wurde Korn, sowie auch guter Bärenfang ausgeschenkt, und wenn es den Gästen gut geschmeckt hat, haben
sie es lange ausgehalten, so das für eine weitere Rast, in einem der nächsten Dörfer keine Zeit mehr übrig blieb. Die
alten Bauern erzählten auch; das es in ganz Ortelsburg, keinen so guten Schnupftabak gab, wie im Gasthof Trzaska. Zu
diesem Grundstück gehörte einst auch der Rohmaner See. Weil dafür keine Steuern gezahlt wurden hat sich der Besitzer
von Gut Frenzken den See angeeignet.
Als Königsberg zur Festung ausgebaut wurde, haben viele Männer dort Arbeit gefunden. Zu dieser Zeit war an eine
Beschäftigung im Kohlenbergbau, in Westfalen, noch nicht zu denken. Weil auch noch keine Eisenbahnlinie vorhanden war,
mussten sie den weiten Weg zu Fuß zurücklegen. Nachdem sie den ganzen Tag marschiert sind, haben sie in der Nacht ein
Feuer angezündet, eine Malzeit zubereitet und in der Nähe des Feuers, das sie vor wilden Tieren schützen sollte,
übernachtet. Die Reise nach Königsberg hat eine ganze Woche gedauert. Sie wurden dort zum Aufschütten der
Festungswälle eingesetzt.
Das Jahr 1914 wurde zum Schicksalsjahr, für Ostpreußen und seine Bevölkerung. Nach Abschluß der Volksschule im Jahr
1912, habe ich in den Wintermonaten einen Fortbildungslehrgang für die Landwirtschaft besucht, den Hauptlehrer Aaron,
der aus Olschienen nach Rohmanen versetzt wurde, für uns organisiert hatte. Da im Dorf 2 Trompeten vorhanden waren,
hatte er uns nahe gelegt eine Kapelle zu gründen, dann könnten wir ja die Soldaten, die aus dem Krieg heimkehren
würden mit Musik empfangen. Zum Abschluss konnte man sich ein Buch oder ein Obstbäumchen wünschen. Eine Woche vor dem
Einmarsch der Russen, haben wir noch mit einem Breitdrescher, der durch ein Rosswerk dass von 6 Pferden angetrieben
wurde 110 Zentner Roggen gedroschen. Der Lehrer Malayka hat sich 1914 freiwillig zum Militär gemeldet. 1915 hat er uns
als Offiziersanwärter besucht. Im Frühjahr 1916 wurde mein Jahrgang gemustert und im Herbst 1916 wurden wir eingezogen.
Ausbruch des Ersten Weltkrieges
Am 2. August 1914 wurde die Allgemeine Mobilmachung ausgerufen. Alle wehrfähigen Männer folgten
dem Ruf des Kaisers und eilten zu den zuständigen Wehrmeldeämtern um die Grenzen des Vaterlandes zu schützen. Wir als
Grenzbewohner bekamen das Meiste zu spüren. Alle Häuser, Scheunen und Ställe waren mit Soldaten und ihrem Tross belegt.
Die Einen gingen, die Anderen kamen. Die Kosaken hatten bei Muschaken und Radzinen die Grenze überschritten. Der
Flüchtlingsstrom hatte sich von der Grenze her angestaut. Die Russen haben überall geplündert. Die Trosse mussten sich
zurückziehen und haben dazu vorwiegend die Feldwege benutzt. Die Pferde waren erschöpft. In einer Nacht kam der
Gemeindevorsteher mit einem deutschen Offizier auf unseren Hof. Mein Vater und der Nachbar Wilhelm Dorka mussten mit
ihren Pferden aushelfen. Sie waren 2 Tage unterwegs, bis zu einem Gut in Kleeberg bei Allenstein. Als sie dann wieder
nach Hause kamen waren die Russen schon am Rohmaner Friedhof. In der Zwischenzeit hatten wir schon den Leiterwagen mit
Mehl, Rauchfleisch und Betten beladen.
Der überwiegende Teil der Rohmaner war schon losgefahren. Der Hauptlehrer Müller kam noch mit dem Fahrrad vorbei und
sagte es wäre höchste Zeit das wir wegkämen weil die Russen schon Ortelsburg besetzt hätten und im Anmarsch auf
Rohmanen wären. Wir sind auf eine Anhöhe gestiegen und haben die Staubwolken beobachtet, aber wir dachten es wäre
deutsches Militär.
Auf der Flucht vor den Russen
Kurz vor Sonnenuntergang haben wir die Pferde vor den fertig gepackten Wagen gespannt und sind
sofort losgefahren. Mein Bruder und ich nahmen 4 Milchkühe und die beste Sterke mit und gingen hinterher. Schweine,
Kälber und Geflügel haben wir aus den Ställen getrieben. Wir waren die ganze Nacht unterwegs und sind bis Rheinswein
gekommen. Da hatten wir einen Onkel wohnen, bei dem haben wir den ganzen Tag verbracht.
Unterwegs haben wir einen Mann getroffen, der erzählte uns dass die Russen bei Groß Jerutten einen Personenzug
überrumpelt haben. Sie hatten aus Eisenbahnschwellen eine Sperre auf den Schienen errichtet und somit den Zug zum
Anhalten gezwungen. Die Russen haben den Zug mit Artillerie beschossen. Als die Soldaten und Zivilisten den Zug
verlassen wollten kamen die Kosaken zu Pferde und haben ein Massaker angerichtet. Nur wer sich am Boden davon
schleichen konnte hat überlebt. Die Russen wurden durch einen Verräter darüber informiert das auf diesem Gleis ein
Zug unterwegs war und waren darauf vorbereitet. Unserem Informanten ist es auch gelungen dem Massaker zu entkommen.
Ein Kosake hatte ihm im beim vorbeireiten mit dem Säbel ein Ohr abgehauen und ihn dadurch zu Boden geschlagen. Es ist
ihm danach gelungen ins Gebüsch zu schleichen. Sein Kopf war schon verbunden als wir ihn trafen. Später wurde an der
Stelle des Überfalls ein Gedächtnisstein errichtet.
Im Morgengrauen sah man viele Kosaken über die Felder reiten. Wir sind dann später wieder weiter in Richtung
Jellinowen gefahren. Unser Vater ist mit dem Pferdewagen die Landstraße entlang gefahren. Wir mit dem Vieh sind
entlang einer tiefen Schlucht durch den Wald bis zum Babanter See gegangen. Wir hatten schon vorher versucht die
Schlucht zu verlassen aber wegen der steilen Hänge ist es uns leider nicht gelungen. Am See angekommen fanden wir drei
große Schober mit Getreide vor. Von einem dieser Schober haben uns zwei Kosaken mit einem Fernglas beobachtet. Sie
schwangen sich auf ihre Pferde und kamen uns entgegen geritten, dann hielten sie uns ihre Lanzen vor die Brust und
versuchten uns auszufragen. Wir haben leider nichts verstanden und fingen an zu weinen. Plötzlich pfiff der
Patrollienführer auf einer Trillerpfeife und die Kosaken kehrten zu ihrem Ausgangspunkt zurück.
Als wir dann weiter am See entlang gingen sahen wir von weitem drei Gehöfte. In der Nähe einer dieser Höfe hatte unser
Vater den Pferdewagen im Gestrüpp abgestellt. Die vorrückenden Schützenlinien der russischen Infanterie hatten ihn
jedoch entdeckt. Sie haben den Wagen durchwühlt und den Sack mit Rauchfleisch mitgenommen. Andere Flüchtlingswagen die
in diesem Gebüsch Schutz gesucht haben sind nicht besser davon gekommen. Wir haben das Vieh auf einen der Höfe
getrieben und am Zaun festgebunden. Dann haben wir mit Hilfe einer Leiter den Heuboden erklommen und uns dort versteckt.
Als die Kosaken auf dem Hof erschienen verlangten sie Brot und Milch. Die Frauen mussten zuerst essen und trinken,
danach haben es die Russen auch getan, sie fürchteten sich davor, dass man sie vergiften könnte. Später kam dann die
russische Infanterie und hat Haus, Scheune und Schuppen durchsucht. Die Falltüre zum Heuboden ließ sich nur nach oben
hin öffnen. Wir hatten die Türe von oben mit schweren Gegenständen beschwert, aber die Russen versuchten mit aller
Gewalt auf den Heuboden zukommen. Als die Frauen das sahen, sagten sie zu den Russen, da oben würden sich ihre Kinder
versteckt halten. Die Russen forderten nun, die Kinder sollten sofort den Heuboden verlassen. Die Mütter riefen nun
nach ihren Kindern die dann auch tatsächlich den Heuboden verließen. Als wir das sahen, haben wir uns am Giebel tief
im Heu vergraben. Drei Russen kamen nun rauf und stocherten mit ihren Bajonetten im Heu herum. Glücklicherweise kamen
sie nicht in unsere Nähe. Als die Russen den Heuboden verließen haben wir befürchtet sie würden ihn in Brand setzen.
Wahrscheinlich taten sie deshalb nicht weil so viele russische Soldaten auf dem Hof waren. Einige Zeit später
erschienen russische Offiziere auf dem Hof, mit einem Auto. Sie sagten, sie hätten das Land erobert und wir hätten ab
sofort dem russischen Zaren zu gehorchen. Wir wurden angewiwsen nach Hause fahren und unbesorgt unsere Ernte
einzubringen. Sie haben uns auch eine Bescheinigung ausgestellt, damit uns auf dem Heimweg niemand die Pferde und
das Vieh wegnehmen würde.
Erst am nächsten Morgen, als die Front weiter vorgerückt war, beschlossen wir die Heimreise anzutreten. Die Straßen
waren mit vorrückenden russischen Truppen blockiert. Manchmal mussten wir stundenlang am Wegesrand warten bis die
Soldaten mit ihrem Tross vorbeigezogen waren. Unterwegs wollten sie unser Vieh zum Schlachten wegnehmen, aber die
Bescheinigung hat uns davor bewahrt. Die Eisenbahnbrücke vor Neu-Keykuth wurde von Kavallerie bewacht. Die wollten uns
nicht drüber lassen und hielten uns bis zum frühen Morgen fest. Zurück in Rohmanen angekommen, konnten wir unser Haus
nicht betreten weil der Hof und alles rundherum ein großes Militärlager war.
Wir sind dann in Richtung Seelonken gefahren, bis Abbau Brosch. Auf dem Hof angekommen haben wir zuerst Grünfutter für
die Pferde vom Feld geholt und anschließend Mittag für uns selbst gekocht. Die Nacht haben wir erstmal auf dem Hof
verbracht. Am nächsten Morgen wagten wir es ins Dorf zu gehen um die Lage zu erkunden. Die Russen waren schon wieder
weiter gezogen, aber Haus und Hof waren in einem schrecklichen Zustand. Wir sind dann gegen Abend wieder nach Hause
zurückgekehrt.
Am 23. August 1914 waren die Russen bei uns eingebrochen, bis sie am 28. August von den Deutschen zurückgeschlagen
wurden. Dann fuhren sie wieder zurück, drei Wagen nebeneinander. Ortelsburg brannte lichterloh. Ein Wagen mit Mehl war
uns gegenüber in den Straßengraben gekippt, aber wir haben nichts davon genommen, weil man ja nicht wusste ob man die
Nacht überleben würde. Wir saßen die ganze Zeit im Keller. Am nächsten Morgen zog dann russische Kavallerie und
Infanterie durch unser Dorf. Die Kavallerie ritt orientierungslos hin und her. Die Infanterie hat den ganzen
Vormittag 1,5 Meter tiefe Schützengräben ausgehoben. Um 11 Uhr kamen aus Richtung Eichtal 3 deutsche Spähwagen nicht
ahnend dass die nördliche Hälfte des Dorfes noch von Russen besetzt war. Wir haben zu diesem Zeitpunkt auf dem
Dachboden Weizen eingesackt und hatten aus diesem Grunde einen weiten Rundblick.
Um 11 Uhr kamen aus Richtung Eichtal drei deutsche Spähwagen angefahren. Als wir die deutschen Soldaten erkannt hatten,
haben wir sie durch Handzeichen gewarnt weiter nach Norden vorzustoßen. Die Kosaken hatten sich auf den Häuserdächern
positioniert und in Richtung Norden nach deutschen Truppen Ausschau gehalten. Die Deutschen sprangen von den Spähwagen
und fingen an die nichts ahnenden Russen zu beschießen. Als die sich ihrer gefährlichen Lage bewusst wurden verließen
sie ihre Aussichtsposten und bestiegen ihre Pferde. Mit Peitschenhieben versuchten sie, die sich in panikartiger Flucht
befindliche Infanterie dazu zu Bewegen, die Deutschen anzugreifen. Zwei Spähwagen wendeten sofort, der Dritte konnte
nicht mehr umkehren. Es gelang allen, bis auf den Fahrer des dritten Wagens die Flucht. Die Russen nahmen ihn sofort
unter Beschuss, doch es gelang ihm über unseren Hof zu entkommen. Auf der rückwärtigen Seite schlug er sich quer durch
die Gärten bis zum Gehöft von Friedrich Sakowski durch. Der versteckte ihn im Keller und versorgte ihn anschließend
mit Zivilkleidung.
Als die Russen den Soldaten auf unseren Hof laufen sahen nahmen sie sofort die Verfolgung auf. Sie durchstöberten auch
die Nachbarhäuser und trieben die Bewohner auf der Straße zusammen. An der Spritzenwagenremise richteten sie einen
Sammelpunkt ein. Unter dem Vorwand es würde hier eine Schlacht stattfinden, versuchten die Russen die Zivilbevölkerung
aus dem Dorf zu drängen. Alle die dem Aufruf gefolgt sind und an unserer Sammelstelle vorbeikamen wurden unserem Haufen
hinzugefügt. Unter ihnen befand sich auch der deutsche Soldat in Zivilkleidung. Er hatte einen Sack über die Schulter
geschlagen in dem sich ein Brot befand, an der anderen Hand führte er eine Kuh am Strick. Als unser Haufen schon aus
etwa 50 Leuten bestand setzten uns die Russen mit Marschrichtung Seelonken in Bewegung. Wir Jungen versuchten in einem
unbeaufsichtigten Moment wegzulaufen, doch die Begleitmanschaft prügelte uns mit Gewehrkolben wieder in Reihe und Glied.
Unterwegs gelang es dem Soldaten mit der Kuh unbemerkt zu entkommen. Er kehrte unbehelligt ins Dorf zurück und lieferte
die Kuh wieder dort ab wo er sie entführt hatte.
Uns haben die Russen an Seelonken vorbei zum Sylvensee getrieben. Wenn sie von vorbeiziehenden russischen Offizieren
gefragt wurden weshalb wir unterwegs wären, sagten sie denen wir hätten deutsche Soldaten versteckt und wollten das
Versteck nicht verraten. Als wir am See vorbei waren begann die deutsche Artillerie aus Richtung Ortelsburg zu
schießen. Unweit von uns explodierten Granaten und richten ein großes Chaos unter Freund und Feind an. Es hieß dann
rette sich wer kann. Die Russen verließen uns in Richtung Waldpuschsee und wir kehrten orientierungslos nach Seelonken
zurück. Nach Rohmanen konnten wir nicht zurück weil die deutsche Artillerie aus Richtung Eichtal anfing unser Dorf zu
beschießen. Schließlich sind wir auf dem Abbau Brosch untergekommen. Ein durch Granatsplitter schwer verletzter Russe
suchte dort auch Zuflucht. er versucht sich mit einem Messer das Leben zu nehmen. es gelang den Frauen ihn davon
abzubringen, weil sonst bei einem etwaigen erscheinen von russischen Soldaten der Verdacht auf uns gefallen wäre.
Später erschienen tatsächlich Kosaken die ihn dann mitgenommen haben. Ihnen folgten in 50 Meter Entfernung Deutsche
Ulanen, die hinter den Russen in einem in der Nähe liegenden Wäldchen verschwanden.
Nachdem die Russen Rohmanen besetzt hatten, versteckten sie sich vorwiegend in mit Stroh gedeckten Gebäuden. Durch
Schießscharten, die sie im Strohdach anlegten, schossen sie auf die deutschen Kampfverbände, die sie wieder vertreiben
wollten. Um die Angreifer zu entlasten, wunde das Dorf von deutscher Seite unter Beschuss genommen. Durch die
Geschosse der deutschen Artillerie entstanden in Rohmanen viele Brände. Die mit Stroh gedeckten Gebäude fielen zuerst
in Schutt und Asche. Unser Vater hatte uns ins Dorf geschickt, damit wir das Vieh im Stall von der Kette losbinden
sollten. Am Dorfrand kamen uns schon deutsche Ulanen und Husaren entgegen. Rohmanen brannte an mehreren Stellen. Unser
Hof war noch unversehrt, nur die Zäune standen schon in Flammen. Wir haben das Vieh los gebunden und anschließend
versucht die Brandherde rund herum zu löschen. Es gelang uns die Flammen von unserem Hof fernzuhalten und auch bei
unserem Nachbarn einzugreifen. In vielen Scheunen und Ställen hatten sich noch viele versprengte Russen versteckt. Die
wurden anschließend von deutschen Soldaten eingesammelt und in Gefangenenlager abgeführt. Am nächste Tag haben wir dann
zerbrochene Gewehre und Munition in Körbe gesammelt und im Dorfteich versenkt.
Am 29. August haben die Russen Rohmanen verlassen, doch schon am 30. August sind sie wieder zurückgekehrt. Hauptlehrer
Müller wurde mit seinem Sohn und Karl Deptolla auf Fahrrädern fahrend von einer russischen Patrouille aufgegriffen.
Sie wurden von den Russen der Spionage verdächtigt weil der Lehrer Müller ein Fernglas bei sich trug. Der Sohn hatte
eine Gymnasiastenmütze und eine Landkarte bei sich. Sie wurden in Richtung Lehmanen abgeführt. Auf einer Anhöhe des
Grundstücks von Ernst Chittka befand sich eine nicht mehr betriebstaugliche Windmühle. Dort soll ein russisches
Kriegsgericht sie zum Tode verurteilt haben. Nach der Hinrichtung wurden sie in der Nähe der Windmühle verscharrt.
Später wurden sie wieder ausgegraben, in Särge gelegt und auf dem Rohmaner Friedhof beigesetzt. Die Ehefrau von Lehrer
Müller hat die Gräber nach dem 1. Weltkrieg mit einem schmiedeeisernen Zaun umrandet.
Die Kämpfe um Rohmanen haben viele Menschenopfer gekostet. Bei uns hinter der Scheune lagen 2 tote Russen und ein
Verwundeter. Die Toten haben wir in einer Kartoffelmiete vergraben. Alle anderen Gefallenen wurden auch gleich an der
Stelle an der sie zu Tode kamen verscharrt und mit einem Kreuz gekennzeichnet. Für die im Raum Rohmanen gefallenen
Russen wurde nach dem Krieg hinterm Dorf, in Richtung Ortelsburg, auf einer Anhöhe ein Heldenfriedhof angelegt. Dort
liegen 20 Soldaten und 1 Offizier. In der Mitte befindet sich ein Trauerbaum und Birken säumen den Zugang von der
Landstraße her. Der Lehrer Dorka hat nach dem Kriege, mit seinen Schülern immer die Gräber gepflegt.
Meine Einberufung zum Militär

Bis zu meinem 17. Lebensjahr habe ich meinem Vater in der Landwirtschaft geholfen. Im Frühjahr
1916 wurde unser Jahrgang gemustert. Im Herbst 1916 erhielten Gustav Spektor, Johann Resonek und ich einen
Einberufungsbescheid. Wir mussten uns in Allenstein im Kaisergarten melden. Dort wurden Rekruten aus mehreren
Landkreisen zusammen gezogen und danach verschiedenen Ausbildungszentren zugeteilt. Wir Rohmaner kamen zum 18.
Infanterie-Regiment nach Osterode. Ein Unteroffizier mit einer Gruppe Musketiere haben uns von Allenstein abgeholt.
Als wir in der Kaserne ankamen haben wir sofort Mittagessen in Blechnäpfen bekommen. Untergebracht wurden wir im
Dachgeschoß der Kaserne. Es waren keine Betten vorhanden, nur Strohsäcke lagen auf dem Boden.
Als dann einige Tage später ausgebildete Kompanien an die Front ausrückten durften wir in einen anderen Block umziehen.
Wir wurden der Größe nach aufgestellt, in Korporalschaften eingeteilt und dann von Kopf bis Fuß eingekleidet. Die
Ausgehuniformen hatten blanke Knöpfe dazu einen Schako mit blanker Spitze. Im neuen Block hatten wir 2stöckige Betten.
Unsere Zivilbekleidung mussten wir in einen Karton verpacken und nach Hause schicken. Dann erst begann das eigentliche
Kasernenleben. Die Kaserne durfte niemand ohne Erlaubnis verlassen, nur in Begleitung eines Unteroffiziers. In der
Kaserne war eine Kantine in der man alles kaufen konnte was in der Kaserne gebraucht wurde.
Am nächsten Tag kam unser Kompanieführer, im Range eines Hauptmanns, zu Pferde angeritten. Er begrüßte uns mit;
Guten Morgen Kameraden, wir antworteten ihm mit; Guten Morgen Herr Hauptmann. Er hat dann die Front abgeschritten und
jeder musste sich mit seinem Namen vorstellen. Um 5 Uhr wurde geweckt, 6 Uhr Kaffee holen, 7-8 Uhr Unterricht, 8-11
Uhr exerzieren auf dem Kasernenhof. Um 11.30 blies der Trompeter zur Mittagspause. Die erste Zeit war noch alles
ziemlich gemütlich aber dann wurde es von Tag zu Tag strenger. Um 10 Uhr abends war Zapfenstreich, dann ging der
Unteroffizier vom Dienst von Stube zu Stube, der Stubenälteste musste die Anwesenheit aller Rekruten melden; zum
Beispiel: Stube 56 belegt mit 14 Mann, alle zu Haus. Wir mussten in 2 Reihen antreten, mit Drillichanzug bekleidet
und in Pantoffeln, ein tadelloses Aussehen präsentieren. Der Diensthabende Unteroffizier prüfte ob alle
vorschriftsmäßig angezogen, gewaschen, gekämmt und ob alle Knöpfe an der Jacke geschlossen waren. Als er bei einem
Rekruten einen offenen Knopf erspähte, hat er uns gefragt, ob jemand ein Taschenmesser bei sich hat.
Wir ahnten nicht Gutes, darum haben wir uns ganz still verhalten und nichts gesagt. Da sagte der U.v.D. plötzlich:
”Wenn niemand von euch ein Messer bei sich hat, dann habe ich ein”. Er zog sein Messer aus der Tasche und fing an, bei
dem Rekruten die Knöpfe abzuschneiden. Als die Knöpfe zu Boden purzelten, brachen wir in lautes Gelächter aus. Das hat
ihn so in Rage gebracht, das unser unwürdiges Benehmen, zuerst mit einem „Donnerwetter” bestraft wurde. Dann schrie
er: ”In den Korridor marsch, marsch, die Treppen runter bis auf den Hof”. Als wir unten angekommen waren hieß es
wieder; "Zurück auf die Stube in der 3. Etage”. Jemand hat mir bei dem Durcheinander, von hinten in den Pantoffel
getreten, so das er auseinander gerissen wurde. Ich bin dann nur mit einem Pantoffel und einem Socken die Treppen rauf
und runter gelaufen. So wurden wir 3-mal hinunter und wieder hinauf gejagt.
Danach ließ er uns wieder antreten und hat mit einer Taschenlampe unter den Betten geleuchtet. Plötzlich schrie er
wieder los: "Das nennt ihr Fegen? wenn ihr mit dem Besen nicht fegen könnt, dann mühst ihr das mit eueren Bäuchen tun.
Marsch, marsch unter die Betten” . Als wir schon alle am Schlafen waren, kam der U.v.D. wieder und hat nachgesehen ob
alle Schränke abgeschlossen waren. Ein Kamerad hatte seinen Schlüssel verloren, deshalb hat er das Schoß nur so
eingehängt. Als der U.v.D. das bemerkte hat er die Türe aufgerissen, die ganzen Sachen aus dem Schrank, quer durch die
Stube verteilt und war dann endlich gegangen.
Die Anziehsachen mussten, fein sauber gefaltet, auf dem Stuhl liegen; da drauf die Socken und die Pantoffeln unter dem
Stuhl. Die Stühle mussten in einer Reihe ausgerichtet sein; die Hosenträger im Schrank einschlossen und der Brustbeutel
mit Geld auf dem Hals tragen werden. Morgens wurden wir geweckt und kamen zuerst in den Waschraum. Jeder musste seinen
entblößten Oberkörper mit kaltem Wasser abreiben. Da draußen strenger Frost herrschte war es im Waschraum auch sehr
kalt, so das manche ihr Hemd anbehielten. Der UvD hat dann bei seinem Kontrollgang alle Verweigerer aufgeschrieben
und ihnen befohlen in 30 Minuten mit einem Besen in der Hand auf der Schreibstube zu erscheinen. Einige mussten den
Kasernenhof fegen, andere die zugefrorenen Latrinen enteisen und reinigen. Während unserer Ausbildungszeit durften wir
die Kaserne nicht verlassen. Wenn man Stuben- oder Frühdienst hatte, blieb keine Zeit zum Frühstücken.
Nach 6 Wochen wurden wir in der Grollmann Kaserne vereidigt. Die Regimentskapelle spielte "Heil dir im Siegerkranz",
danach folgten 3 Strophen des Deutschlandliedes. Vor der Vereidigung wurden die Rekruten gefragt wer keine deutsche
Staatsangehörigkeit besitzt. Es sind dann Luxemburger und auch noch welche aus anderen Ländern hervorgetreten. Sie
wurden gefragt ob sie die deutsche Staatsangehörigkeit annehmen wollen. Die das abgelehnt haben wurden auf die
Schreibstube gerufen und sofort aus dem Militärdienst entlassen. Nach der Vereidigung erfolgte ein Kirchgang, danach
konnte man einen Stadturlaub beantragen. Nach dem Mittagessen mussten alle, die einen Urlaubschein beantragt hatten
vor der Kaserne antreten. Der Hauptfeldwebel prüfte dann ob an der Uniform alle Knöpfe blank geputzt waren, die Stiefel
glänzten und der Rekrut auch vorschriftsmäßig grüßen konnte. Wer diese Anforderungen nicht erfüllen konnte musste
seinen Urlaubschein wieder abgeben und zurück auf sein Zimmer gehen.
Wenn man die Kaserne für eine gewisse Zeit verlassen wollte, mussten zuerst der Korporal, dann der Hauptfeldwebel und
letzt endlich der Hauptmann, seine Zustimmung erteilen. Es wurde geprüft; ob die Ausgeh-Uniform sitzt, alle Knöpfe
blank geputzt sind und der Helm so blank ist das man sich darin spiegeln kann. Unser Hauptmann war in Zivil,
Bürgermeister von Osterode. Er war sehr stolz wenn er seine Kompanie, in Parade Uniform und mit einem fröhlichen Lied
auf den Lippen, durch seine Stadt führen durfte.
Als wir eines Tages zum etwa 6 Kilometer entfernten Schießstand marschieren sollten, war es sehr kalt und glatt. Der
Hauptmann ritt durch das große Tor, wir aber sind durch das kleine Tor gegangen und haben eine steil bergab führende
Abkürzung gewählt. Die Zug- und Gruppenführer gingen voraus und wir im Gänsemarsch hinterher. Ein Kamerad hat sich auf
den Gewehrkolben gesetzt und ist darauf den Berg hinunter gerutscht. Als die Anderen das sahen haben sie es ihm
nachgemacht und hatten einen Riesenspaß. Da kam der Hauptmann plötzlich im Galopp angeritten; ließ alles anhalten und
hat zuerst die Zugführer ausgeschimpft, dann anschließend die ganze Kompanie. Er sagte: „Wie könnt ihr es wagen, so
mit eueren Gewehren umgehen. Ein Gewehr soll man wie seine Braut behandeln und nicht wie einen Straßenbesen”. Zur
Strafe mussten wir, links und rechts der Straße, in zwei Reihen antreten und durch den verschneiten Straßengraben
robben. Die Herrn Zug- und Gruppenführer durften die Straße benutzen und erteilten uns nur Befehle, wie: hinlegen,
nach rechts schwenken, nach links schwenken, einzeln vorarbeiten und sammeln. Als wir dann abgekämpft, in Linien zu
2 Glieder angetreten waren, ging es mit Gesang zum Schießstand.
Auf dem Schießstand angekommen, erhielten wir zuerst eine praktische Unterweisung, für den Gebrauch von Schusswaffen.
Wir mussten solange mit einem nicht geladenen Gewehr üben, bis wir unserem Vorgesetzten beweisen konnten, dass wir
alles im Griff haben. Daraufhin wurden jedem 10 Patronen zugeteilt, so das er unter der Aufsicht eines Unteroffiziers
mit den Schießübungen beginnen konnte. Der Unteroffizier hat die Position der Einschüsse, auf der Scheibe, in einem
Buch eingetragen und nach Beendigung der Übung dem Hauptmann Bericht erstattet, ob der Schütze seine Aufgabe erfüllt
hat oder nicht. Nach dem Schießen wurden die Gewehre zu Pyramiden zusammengestellt. Diejenigen die ihre Aufgabe nicht
erfüllt haben, mussten rund um die Zielscheibe, die Bleikugeln aufsammeln.
Seit unserer Einberufung hatten wir noch keinen Heimaturlaub. Urlaub bekamen nur die, die ihren Heimatort zu Fuß
erreichen konnten. Wegen der vielen Truppentransporte die täglich von Ost nach West unterwegs waren durften wir die
Eisenbahn nicht benutzen. Einmal wurde uns gesagt; wenn jemand gut schießen kann der bekommt Heimaturlaub, aber auch
das war nur ein leeres Versprechen.
Kaisers Wilhelms Geburtstag
Der beste Tag war des Kaisers Geburtstag. Am 27. Januar mussten alle in der Grollmann Kaserne
antreten, der Battalions-Kommandeur beendete seine Laudatio mit den Worten: Seine Majestät, unser Kaiser und König
Wilhelm II, erlebe hoch, hoch, hoch. Dann spielte die Regimentskapelle: Heil dir im Siegerkranz, Herrscher des
Vaterlands, Heil Kaiser dir. Danach folgten 3 Strophen des Deutschlandliedes und anschließend fand ein Gottesdienst
statt. Anschließend gab es ein vorzügliches Mittagessen, Schweinebraten, ein Stück Wurst auf die Faust und Biermarken,
die man in der Kantine gegen gutes Bier einlösen konnte, danach Urlaub bis zum Wecken, ohne Urlaubschein. Mein Vater
und die Mutter eines Kameraden waren schon morgens angekommen, konnten uns aber nicht finden, wurden von einer Kaserne
in die andere geschickt. Erst als wir mit Musik, von der Kirche zurück zur Kaserne marschiert sind habe ich sie
zufällig entdeckt. Als sie mich auch erkannt haben, sind sie nachgekommen. Da war die Freude groß: Der Vater hatte
einen großen Koffer auf einem Krückstock über die Schulter getragen. Ich ging gleich zur Wache und habe sie angemeldet,
sie sind dann bis zum Abend geblieben. Es war einer der schönsten Tage in der Grollmann-Kaserne in Osterode.
Alle 10 Tage bekamen wir Sold. Vor der Auszahlung mussten wir antreten, jeder wurde gefragt ob noch Restgeld vom
letzten Sold vorhanden war. Dann bekam jeder 3,30 Mark, davon musste man noch Sidol für das Koppelschloss und
Schuhkreme für die Stiefel kaufen. Wer geraucht hat und nichts von zu Hause bekam war schlimm dran. Beim Militär bekam
man nicht nur die Ausbildung an der Waffe beigebracht, man lernte auch putzen, nähen, Strümpfe stopfen und vieles
Andere. Man bekam einen beschädigten Strumpf, der musste aufgeribbelt werden, mit der Wolle konnte man dann andere
Strümpfe stopfen oder Kleidungsstücke mit Namen kennzeichnen. wer das nicht konnte, der musste seinen Kameraden
Zigaretten oder Geld geben die das dann für ihn erledigten.
Verschiedene Kameraden gingen nach dem Dienst noch in die Stadt. Um 21:45 Uhr wurde zum Zapfenstreich geblasen, dann
musste man schnell zurück in die Kaserne, weil um 22:00 Uhr der Wachhabende von Bett zu Bett ging und prüfte ob auch
alle anwesend waren. Zwei mal pro Woche fanden Gewaltmärsche statt, mit vollem Gepäck im Tornister. Am Ende der
Marschkolonne fuhr dann ein Pferdewagen, wenn der Feldarzt bei jemandem einen Erschöpfungszustand feststellte, der
durfte dann aufsitzen. Am Sonnabend wurden auf dem großen Exerzierplatz Felddienstübungen durchgeführt, es befand sich
dort ein großer Hügel, den wir immer wieder erstürmen mussten. Am Nachmittag war Revierreinigen angesagt, wir mussten
dann die Tische schrubben, auf einen Tisch wurde Sand mit etwas Wasser gestreut, der nächste Tisch wurde mit der den
Beinen nach oben drauf gelegt und solange hin und her geschoben bis beide sauber waren. Mit den Stühlen geschah das
Gleiche. Dann wurde der Fußboden in der Stube geschrubbt, die Schränke abgewaschen, Staub geputzt, zuletzt kamen Flur
und Treppe dran.
Für die Arbeit war eine Stunde angesetzt, wenn jemand zu früh fertig war erregte er den Argwohn des Diensthabenden
Korporals, der prüfte dann alles genau, fand natürlich immer etwas das nicht seinen Erwartungen entsprach. Der
Übereifrige musste dann Nacharbeiten bis die Stunde um war. Eine Stunde war für Gewehr reinigen und Unterricht an der
Waffe vorgesehen.
Im Februar wurden wir neu eingekleidet; Schnürschuhe, Koppel, alles gelbes Leder mussten wir mit Lederschwärze
behandeln. 2 Wolldecken, Uniform und Helm in feldgrau, da brauchten wir die Knöpfe nicht mehr zu putzen. Die neuen
Gewehre mussten zuerst eingeschossen werden. Es wurden 90 scharfe Patronen und Marschverpflegung ausgegeben, danach
mussten wir mit vollem Gepäck zum Appell antreten. Man konnte kaum gerade stehen, weil der Tornister einen in die Knie
zwang. Der Major, der die Aufstellung besichtigte rief >Brust raus<, dann informierte er uns dass wir ins
Feldrekrutendepot und in Feindesland kommen. Urlaub bekam niemand. Ich habe ein Telegramm nach Hause geschickt, mit
der Nachricht dass wir bald abrücken werden. Einen Tag vor dem ausrücken hat mich meine Mutter noch besucht, sie hat
mir vieles mitgebracht. Alles konnte ich nicht mitnehmen, weil es nicht gestattet war anderes Gepäck bei sich zu haben
als dem Soldaten zustand.
Abmarsch zum Fronteinsatz
Am nächsten Tag hat uns die Regimentskapelle mit Musik zum Bahnhof gebracht. Von Osterode ging
es über Thorn, Posen,
Annaberg, Warschau, Brestlitowsk ins Pruschana-Lager. Das war eine russische Artillerie-Kaserne, in der 2 deutsche,
3 österreichische Bataillone und eine Offiziersschule untergebracht waren. Ein Bataillon das waren wir 18 und 19
jährige, die Anderen waren Männer bis 45 Jahre. Als wir in Osterode abfuhren lag Schnee, in Annaberg/Schlesien waren
die Kühe auf der Weide und im Pruschana-Lager lag der Schnee wieder einen Meter hoch. Drei Kilometer vor unserem vor
unserem Lager war die Bahnfahrt zu Ende. Mit den schweren Tornistern waren viele überfordert, wir mussten immer wieder
warten bis alle nachkamen. Unsere Unterkünfte das waren Baracken die den Russen als Pferdeställe gedient hatten. In
jeder Baracke wurde eine Kompanie mit Schreibstube untergebracht, die nur durch ein Zelt abgegrenzt war.
Wir haben aus Brettern Doppelbetten hergestellt, in jeder Baracke war ein Ziegelofen. Unsere neuen Uniformen und die
scharfe Munition mussten wir abgeben und bekamen dafür alte Bekleidung, sowie Ecksezierpatronen. Hier ging es wieder
Kasernenmäßig zu, das jüngere Bataillon bekam besseres Essen, doppelte Portionen und nach dem Essen 2 Stunden Bettruhe.
Wenn jemand die Bettruhe nicht einhielt und dabei erwischt wurde wusste zur Strafe Holz hacken oder Schnee schaufeln.
Zwei Wochen war Frost bis minus 40 Grad, da hatten wir keinen Unterricht im Freien, alle Aktivitäten fanden in der
Baracke statt, die nur mit nassem Holz beheizt wurde und dem entsprechend war auch die Temperatur im Inneren. Um
Brennmaterial für die Küche zu besorgen mussten wir ins nächste Dorf gehen und von zerfallenen Häusern Holz holen.
Als endlich das Tauwetter einsetzte verwandelte sich die Gegend um Baranowitschi in ein unüberwindbares Sumpfgelände.
Wir wurden mit anderen Einheiten die aus Frankreich zu uns verlegt wurden, zusammengelegt. Wenn jemand nachweisen
konnte dass er Landwirt ist und mehr als 100 Morgen Ackerland besitzt, konnte er einen Urlaub zur Frühjahrsbestellung
beantragen. Ein Gottlieb Piotrowski aus Plohsen hat seinen Urlaub bewilligt bekommen und durfte für 14 Tage nach Hause.
Wenn von der unweit entfernten Front Kanonendonner zuhören war und Alarm ausgerufen wurde, dachten wir es geht los.
Obwohl wir als Reserve aufgestellt waren mussten wir allzeit einsatzbereit sein. Wir haben auch Bunker und Stollen
gebaut, Schützengräben ausgeworfen und mit scharfen Handgranaten exerziert.
Als Gottlieb Piotrowski nach 2 Wochen zurückkam waren wir schon in Alarmbereitschaft und sind dann auch 2 Tage später
ausgerückt. Kamerad Piotrowski hatte mir noch ein großes Paket von zu Hause mitgebracht.
Italien hat Deutschland und Österreich den Krieg erklärt.
Zuerst sind drei Bataillone Österreicher ausgerückt, dann die Deutschen hinterher. Bis zum
Bahnhof Linowa wurden wir von einer Musikkapelle begleitet, dann ging es per Eisenbahn ab nach Baranowitsche. Dort
wurden wir der, an der Westfront aufgeriebenen, 15ten Reserve Division zugeteilt. Es wurde uns gesagt das Kameraden
aus der Heimat gleichen Gruppen zugeordnet werden können. Ich hatte einen Freund aus meinem Dorf, Gustav Spektor,
einen aus Groß Schöndamrau, Wilhelm Lukas und einen aus Ortelsburg, Karl Schlensack, wir kamen zu zusammen in eine
Kompanie. Zuerst waren wir in einem Kinosaal einquartiert, haben jeden Tag Schützengräben ausgehoben und Feldübungen
gemacht. Es war ein sumpfiges Gelände, so dass die Soldaten wegen den vielen Mücken, Netze auf den Köpfen tragen
mussten. Nach einem Gewitter wurde es plötzlich unerträglich. Die Mücken hatten meinen Freund so zerstochen dass sein
Gesicht dermaßen angeschwollen war und ich ihn gar nicht wieder erkannt habe.
Von Baranowitsche wurden wir wieder auf die Eisenbahn verladen, die uns mit unbekanntem Ziel Richtung Osten fuhr.
Nachdem wir unterwegs einmal zum Essenfassen gehalten haben, kamen wir in der Nacht in Krakau an. In der nächsten
Nacht befanden wir uns schon in den Karpaten, wo wir die Hügelketten zu Fuß überqueren mussten, die Fahrzeuge fuhren
um die Berge herum und wir mussten manchmal 2 Stunden warten bis sie uns wieder eingeholt hatten. So ging es immer
weiter bis wir auf einen Berg kamen wo wir Zelte aufgebaut und Biwak bezogen haben. Dort stießen wir auf türkische
Einheiten die auf Mauleseln Munition und Verpflegung über die Berge transportiert haben. Die Esel hatten ein Gestell
auf dem Rücken, auf jeder Seite eine Fass mit Wasser oder Kisten mit Proviant. Ihre Artillerie wurde von 6 Mauleseln
gezogen, während die Offiziere, ohne Sattel, ohne Zaumzeug, nur mit einem Hanfseil ausgerüstet, daher kamen.
Die Mannschaften marschierten wie es jeder für richtig hielt, mit aufgekrempelten Ärmeln, das Gewehr über den Tornister
gelegt, wie die Wilddiebe. Im Gegensatz dazu herrschte bei uns strenge Disziplin, wen jemand aus der Reihe ging kam
sofort der Kompanieführer angeritten, hat uns angeschrieen, uns klar gemacht dass wir keine Türken seien und nur auf
höheren Befehl etwas an der Marschordnung ändern dürften, wer dagegen verstoße, müsste mit einem 3tägigen Arrest
rechnen. Wir haben hinter der der Front Gewaltmärsche durchgeführt die dem Feind große Truppenaufmärsche vortäuschen
sollten.
Wir lagen in einem Buchenwald in Bereitschaft. Überläufer berichteten dass auf russischer Seite eine Großoffensive
vorbereitet wird. In einer Nacht wurde plötzlich Alarm geschlagen, der Russe war zu einem Angriff mit Gasgranaten
übergegangen. Wir lagen unter Zelten und hatten die Gasmasken gar nicht bei uns, sondern nur etwas abseits liegen. In
der Dunkelheit hat mach einer keine Gasmaske mehr gefunden. Es war ein fürchterliches Durcheinander. Dabei war es
unsere Pflicht die Maske immer an dem Tragriemen über dem Hals zu tragen, mit halb geöffnetem Deckel. Uns hat es zum
Glück nicht so stark betroffen weil wir auf einer Anhöhe lagen und die Gaswolken sich im Tal verteilten. Wir wurden in
höchste Alarmbereitschaft versetzt weil der Russe die österreichische Front durchbrochen hatte.
Eigentlich sollten wir noch an einer Gulaschkanone Essen fassen, aber es blieb uns dazu keine Zeit mehr. Der
Kompanieführer befahl uns die Zelte abzubrechen, auf den Tornister aufzurollen und in fünf Minuten marschbereit zu
sein. Die Kanoniere befanden sich schon in der Batteriestellung, luden die Granaten, die sofort abgefeuert wurden. Der
Battalions-Kommandeur versammelte die Kompanieführer und erteilte ihnen die Angriffsbefehle. Derweil sollten wir in
einem Eichenwal der schon mit Granattrichter übersät war, Deckung suchen. Bald hatten wir die Verbindung zu unserem
Batteriestab verloren. Wir warfen unsere Tornister auf einen Haufen, schwärmten unverzüglich, nur mit Sturmgepäck
ausgerüstet, 4 Handgranaten im Brotbeutel, zum Angriff aus. Wir robbten uns einzeln voran. Weil der Russe unsere
Stellungen schon überrannt hatte war jeder auf sich selbst angewiesen. Mann hörte kein Kommando mehr weil der Russe
inzwischen den Rückzug angetreten hatte, um sich auf einer Bergspitze zu verschanzen, von der er uns mit
Flachbahngeschützen beschoss. Irgendwann befanden wir uns in einem Schützengraben, wo ein Leutnant und 17 Mann aus
unserer Division die Stellung hielten. Unter Androhung von Gewalt befahl er uns den Graben sofort zu verlassen und am
Gegenangriff teilzunehmen. Wir sprangen über den Stacheldraht, duckten uns aber sofort im nächsten Graben damit das
mörderische Maschinengewehrfeuer uns nicht hinwegfegte.
Dort blieben wir bis zum Eintritt der Dunkelheit liegen. Wir konnten unsere Waffen nicht mehr einsetzen weil der Sand
die Gewehrschlösser blockiert hatte. Als es Nacht wurde herrschte ein gespenstische Stille. Wir krochen aus dem
Schützengraben und lauschten nach irgendeinem Lebenszeichen von anderen Kameraden. Dann hörten wir irgendwelche Laute
die wir nicht genau zuordnen konnten. Sie kamen aus einem Holzbunker ganz in der Nähe. Wir näherten uns ganz
vorsichtig, als plötzlich eine Schar österreichischer Soldaten herausstürmte. An unseren Stahlhelmen erkannten sie
dass wir Deutsche sind. Bald danach trafen wir auch auf 69 deutsche Soldaten die zu unserer Division gehörten. Dann
kam ein Hauptmann der uns mit Vorwürfen überschüttete, wir seien Feiglinge, wir hätten uns von unserer Einheit entfernt.
Wir haben ihm den Vorgang geschildert, aber ließ nicht mit sich reden und sagte nur dass wir bestraft werden und nichts
zu essen bekommen. Wir wurden einer Maschinengewehr Einheit zugeteilt welche die vorderste Stellung verteidigen
musste. Wir hatten einen Stollen mit 2 Ausgängen.
Die Russen haben bemerkt das sich etwas bewegte und haben uns unverzüglich mit Artilleriefeuer belegt. Schon die
dritte Granate war ein Volltreffer. Vier Kameraden waren sofort tot, ich bekam mit einem Stollenbrett in den Rücken
der sofort blau und grün angelaufen war. Ich schaute nach oben, alles war verschüttet. Ich wusste nicht das da noch
ein Ausgang war, doch die Kameraden die hier in Stellung waren haben mir geholfen das Freie zu erreichen. Ich habe
mich am nächsten Tag krank gemeldet, dachte 2 Tage Schonung zu bekommen, aber der Sanitäter hat mir nur den Rücken mit
Spiritus eingerieben und mich wieder, zurück zu unserer Kompanie geschickt. Sie bestand nur noch aus 3 Gruppen, die in
einem Stollen, der in einen Berg gehauen war, Stellung bezogen hatten. Wir konnten uns hier wenigstens waschen, an
einer Quelle die aus dem Felsen sprudelte. Wir waren nicht mehr einsatzfähig und mussten durch andere Truppenteile
verstärkt werden.
Beim Essen holen musste man auch das Gewehr bei sich haben, es wurde erzählt dass hier der braune Bär herumwandert.
Ich habe keinen gesehen, nur das die Toten ausgescharrt wurden und verstümmelt herumlagen. Nach einigen Wochen haben
die Deutschen eine Gegenoffensive gestartet, von den Bergen herunter, über den Fluss Zlota Lipa, bis zu einer Stadt
die Brzezany hieß. 2 Tage später wurden wir auch eingesetzt, bei großer Hitze ging es in Dauermärschen vorwärts, man
durfte aus den Flüssen kein Wasser trinken, weil es mit Petroleum verseucht war. Nur wenn es dunkel wurde machten wir
halt, dann mussten wir Gräben ausheben um vor Überraschungen sicher zu sein.
Links von uns war Tarnopol und rechts Rumänien. Wenn es nach einer Ruhepause wieder losging dann war es am schlimmsten,
man ging wie auf Nägel, weil die Füße die Strapazen nicht so ohne weiteres wegsteckten. Im Dorf wurde niemals Rast
gemacht, denn da waren immer Brunnen, zu denen alle hinstürmten. Später wurden Melder vorausgeschickt, die von den
Dorfbewohnern Wasser in Eimern am Weg raussetzen ließen, damit die Soldaten Ihren Durst löschen konnten. Ein Soldat hat
gleich den ganzen Eimer mitgenommen und ihn dann als er leer war, irgendwo am Wegrand stehen lassen. Der Kompanieführer
kam angeritten, hat ihn ausgeschimpft und gedroht, ihn mit 3 Tagen Arrest zu bestrafen. Wir gehörten zur Südarmee
welche von Graf Bothmer befehligt wurde.
Die Stellungen waren schlecht ausgebaut, abends mussten wir, von der 2 Kilometer hinter der Front liegenden Feldküche,
Essen und andren Proviant holen. Ich war der Jüngste der Gruppe, musste immer 9 Kochgeschirre tragen, Brot und Post
habe ich in 2 Sandsäcke, die ich über der Schulter hängen hatte, verstaut. Wenn wir unterwegs waren wurde der
Laufgraben immer beschossen. Einmal schlug eine Granate am Schützengrabenrand ein und hat mich halb verschütte, die
Kochgeschirre aus den Händen gerissen, so dass ich ohne Verpflegung im vorderen Graben ankam. Nach drei Wochen sollten
wir abgelöst werden Es hat jeden Tag geregnet, wir haben unsere Mäntel angezogen und uns mit Zelten bedeckt. Nach dem
wir abgelöst wurden kamen wir in ein Dorf dass von Juden bewohnt war. Die Bewohner waren froh dass wir keine Kosaken
waren, mit denen hatten sie vor ein par Tagen schon schlechte Erfahrung gemacht, die hatten ihnen beim Abzug Vieh und
Pferde weggenommen.
Der Boden war sehr fruchtbar, es wurden Hanf, Weizen, Hafer, Mais, Bohnen, Roggen und Kartoffeln angebaut. Die
Bewohner waren gerade mit der Ernte beschäftigt. Die Häuser waren nur aus Holz und Stroh erbaut. Die Leute lebten in
sehr ärmlichen Verhältnissen. Ich hatte mir in unserer Kantine für 20 Pfennig ein Taschenmesser gekauft, das hat mir
ein Bauer für 6 Eier und 2 Pfund Brot abgekauft, daraus hat er sich dann ein Rasiermesser geschliffen. Wenn unser
Versorgungstross auf denn holperigen Wegen nicht nachkam, haben im Dorf auch Verpflegung eingekauft. Die Leute hatten
Angst dass wir nicht bezahlen werden, doch wir bekamen meistens pünktlich unseren Wehrsold ausgezahlt und konnten uns
so manches genehmigen. Um unser Marschgepäck zu erleichtern haben wir so manches aus dem Tornister weg geworfen.
Unweit eines Dorfes wurde halt gemacht, wir sollten Zelte aufschlagen, doch niemand hatte mehr Zeltstöcke im Tornister,
alles war unterwegs liegen geblieben. Der Zugführer befahl uns ins Dorf zugehen und Stöcke zu besorgen. In einer
Scheune stießen wir auf eine Hühnerschar, mit den Stöcken haben wir einige Hühner erlegt, in einem Hanffeld gerupft
und dann im Eiltempo zurück zu unserer Truppe. Als wir ankamen war die Kompanie schon marschbereit, es gleich weiter,
mit dem Huhn im Tornister. Bei der nächsten Rast haben wir die Hühner ausgenommen und Holz besorgt um sie zu kochen,
doch wir mussten schnell wieder weiter marschieren und erst nach 2 Tagen konnten wir uns mit den Hühnern befassen,
leider waren die so alt das sie nicht gar wurden. Das Fleisch mussten wir wegwerfen, nur die Suppe konnten wir noch
gebrauchen.
Meine Verwundung am Pruth.
Wir befanden uns 8 km vor der russischen Grenze. Der Kompanieführer hatte uns informiert das
wir hier zum Einsatz kommen. Wir bekamen noch ein Mittagessen aus der Gulaschkanone, konnten unsere Feldflaschen mit
Tee, der mit Rum angereichert war, auffüllen, Munition und Handgranaten in Empfang nehmen und dann ging es zum Einsatz.
Um 3 Uhr begann das ganze Bataillon auszuschwärmen, sofort hat uns der Russen entdeckt und begann uns mit Artillerie
zu beschießen, je weiter wir vorrückten desto heftiger.
Bis zu einem Eisenbahndamm hatten wir gute Deckung, doch wir sollten den dahinter fließenden Fluss überqueren. Doch
plötzlich explodierte über meinem Kopf eine Schrapnellkugel, der Stahlhelm wurde mir vom Kopf gerissen, Tornister und
Koppel flogen auch weg, ich lag auf der Erde und wusste gar nicht was passiert war. Plötzlich fing Blut aus der
Kreuzbeingegend zu rieseln, aus dem rechten Oberschenkel auch. Gleich nebenan war ein Granattrichter, dort habe ich
Schutz gesucht. In der rechten Rockecke hatte man immer ein großes Verbandspäckchen, das habe ich herausgenommen und
auf die Wunde gedrückt, doch das Blut floss mir bis in den Stiefel. Links und rechts von mir schlugen Granaten ein,
dicke Erdbrocken und Schlamm fielen auf mich herab, doch in meinem Erdloch war ich vor Maschinengewehrsalven geschützt.
Der ganze Rücken war angeschwollen und ich konnte mich überhaupt nicht bewegen.
Die Deutschen mussten die Stellung den Russen überlassen, einer hatte mich entdeckt, da ich aber so blutverschmiert da
lag, hat er bestimmt gemeint ich wäre nicht mehr am leben und ist weitergegangen. Nach zwei Stunden habe ich gehört
das die Russen sich wieder zurückzogen, danach herrschte eine gespenstische Stille. Als es dunkel wurde kamen deutsche
Sanitäter mit Spürhunden und haben die Verwundeten aufgesammelt. Ich wurde auf eine Trage gelegt, lag gebeugt und
konnte mich nicht rühren weil der blutverschmierte Rücken völlig verkrustet war. Ein Pferdegespann konnte nur vier
Tragen befördern, die Fahrt über Ackerfurchen war eine Tortur, ich habe nicht geglaubt das ich es überleben werde. In
einer Dorfkirche wurden wir dann ausgeladen und zu den etwa 50 Verwundeten gelegt die da schon lagen.
Mich haben sie zu den Bauchschüssen gelegt, weil ich einen Nervenschock hatte und am ganzen Körper gezittert habe. Zu
trinken bekam ich nichts, nur einen feuchten Lappen in den Mund. Ich sollte gleich operiert werden, aber es kamen
immer mehr Verwundete, so bekam ich nur eine Tetanusspritze, wurde verbunden und für den Weitertransport ins Hinterland
vorbereitet. Im Morgengrauen wurden wir auf Lastautos verladen, die aus auf ein Landgut brachten, wo wir in einem
Pferdestall untergebracht wurden. Die Fahrer fuhren so schnell über die Granatlöcher, das wir vor Schmerzen geschrieen
haben. Wir baten sie langsamer zu fahren, aber die bekamen es in ihrem Führerhaus nicht mit, erst alt ein Verwundeter,
der einen Krückstock bei sich hatte von hinten die Scheibe einschlug wurde die Fahrt erträglich. Lastautos, die
Munition und Verpflegung an die Front transportiert hatten, brachten in den nächsten Tagen immer wieder Verwundete
ins Hinterland. Die Deutschen hatten an diesem Fronabschnitt hohe Verluste zu beklagen. Wir können von Glück reden
dass wir dem Höllenfeuer überhaupt entkommen sind.
Wir wurden mit Lastautos, die ein Feldlazarett uns geschickt hatte, bis nach Lemberg befördert. da wurden wir gewaschen,
rasiert und frisch verbunden. Auf einem Nebengleis stand ein Lazarettzug, in dem wurden wir anschließend in frisch
bezogenen Betten untergebracht. Der Zug brachte uns über Annaberg nach Freiburg in Sachsen, eine Stunde hinter Dresden.
Hier wurden wir auf Tragen gebettet und mit einem Möbelwagen in ein Reservelazarett transportiert.
Im Heimatlazarett.
Als ich am nächsten Tag aufwachte und das schöne Bett sah in dem ich lag, dachte ich dass ich
im Himmel bin. Ich dankte meinem Herrgott das er mich bis zu diesem Ort begleitet hat. Am Nachmittag kamen Schulkinder
mit Geschenken und haben uns schöne Lieder vorgesungen. Anhand von Röntgenaufnahmen wurde in den nächsten Tagen
festgestellt dass bei mir ein Schrapnellsplitter an der Wirbelsäule in die Kreuzbeingegend eingedrungen war. Ich wurde
jeden Tag in Salzwasser gebadet und bekam wieder volle Verpflegung, da mein Magen zum Glück nicht verletzt war. Auf
dem Transport bekam ich nur Suppe und bei Bedarf einen feuchten Lappen auf die Lippen. Ich bin von 62 auf 43 Kilogramm
abgemagert, gehen konnte ich wegen dem Nervenschock den ich bei der Verwundung erlitten hatte auch noch nicht. Die
Wunde am rechten Oberschenkel war nur ein Streifschuss und wurde mit einem Schutzverband versorgt.
In den nächsten Tagen habe ich einen Brief nach Hause geschrieben und mitgeteilt wo ich mich zurzeit befinde. Meine
Eltern schickten mir ein Paket mit Lebensmitteln, jetzt konnte ich essen was ich wollte. Das Essen im Lazarett war
nicht besonders, jeden Tag nur Kohlblätter. Der weg zu den Toiletten führte durch einen Gemüsegarten. Die gehfähigen
Kameraden haben den ganzen Kohlrabi aufgegessen, so dass schließlich Wachposten aufgestellt werden mussten. Sechs
Wochen lang konnte ich mich nur auf allen Vieren fortbewegen, denn sobald ich mich aufrichtete wurde es mir
schwindelig und ich musste zurück ins Bett.
Als ich wieder bei Kräften war habe ich meinen Eltern mitgeteilt das ich mich in ein Lazarett in ihrer Nähe verlegen
lassen will. Der Chefarzt hatte mir zugesichert, wenn die Möglichkeit besteht in Ortelsburg unterzukommen, wird er dem
zustimmen. Meine Mutter hat daraufhin, in Ortelsburg, beim Lazarettinspektor Zantopf nachgefragt und er hat angedeutet
das sie mich aufnehmen können. Daraufhin bekam ich die Krankenpapiere und einen Fahrschein nach Ortelsburg. Da ich als
Soldat nie Heimaturlaub hatte, beschloss ich zuerst meine Eltern zu besuchen. Ich fühlte mich noch sehr schwach, habe
nach jedem Kilometer Rast gemacht, aber letztendlich war ich wieder daheim bei meinen Eltern. Die Wiedersehensfreude
war sehr groß. Ich bin am 30 Juli verwundet worden und am gleichen Tag wurde mein ältester Bruder beerdigt. Er bekam
den Splitter einer Gasgranate ins rechte Bein und ist an einer Blutvergiftung verstorben.
Am nächsten Tag brachte mich mein Vater ins Garnisonslazarett nach Ortelsburg. Ich wurde jeden Tag gebadet und massiert,
weil die Rückenhaut am Knochen angewachsen war konnte ich mich nicht schmerzfrei bücken. In Ortelsburg verbrachte ich
noch sechs Wochen, bis Ende Oktober, da wurde es schon ziemlich kalt und in unserer Barackenunterkunft ziemlich
ungemütlich. Kohlen und anderes Brennmaterial lagen im Hof auf Halde, aber es war verboten zu heizen. Kameraden die in
der Nähe zu Hause waren konnten Sonntagsurlaub beantragen.
Einer von ihnen brachte von zuhause Brennholz mit und entzündete damit im Ofen ein wärmendes Feuer, andere holten vom
Hof Kohlen, so dass der Ofen in kurzer Zeit glühend heiß wurde und die Gefahr bestand das die Betten Feuer fangen
würden. Wir hatten die Betten schon weg gerückt, da kam der Feldwebel herein und fragte wer das Feuer im Ofen
angezündet hat, doch niemand fühlte sich angesprochen. Der Feldwebel hatte den Vorfall dem Stabsarzt gemeldet, als der
am nächsten Morgen zur Visite kam, war seine erste Frage: ”Wer hat gestern Abend das Feuer im Ofen angezündet”. Als
sich niemand meldete, schrie er uns an: ”Morgen wird alles entlassen, zum Ersatzbatallion, in Diez an der Lahn! Wer
gehen kann, sofort zur Schreibstube, Krankenpapiere und Fahrscheine abholen”. Er erinnerte uns noch daran am nächsten
Tag pünktlich am Bahnhof zu sein, weil eine Verspätung unangenehme Folgen für uns haben würde. Das war das Ende der
schönen Erholungsphase. Ich blieb noch eine Nacht zu Hause und bin dann am nächsten Tag von dort zum Bahnhof gegangen.
Wieder Kriegsverwendungsfähig.
Als wir am nächsten Tag in Diez angekommen waren, wurde ich gefragt ob ich aus dem Heimaturlaub
käme, als ich das verneinte wurden mir 2 Tage genehmigt und 14 Tage Genesungsurlaub dazu. Wieder zurück im
Ersatzbatallion bestand unsere Tätigkeit aus Wache schieben und Kartoffel schälen. Nach einem Monat wurden wir von
einem Generalarzt untersucht, er hat mich für nicht einsatzfähig befunden weil ich noch den Steckschuss im Rücken
hatte und das linke Bein 10 Zentimeter dünner war. Jetzt fing das Kasernenleben wieder von vorne an. Wachdienst,
Gewehr laden, sichern, Ehrenbezeugung, Einzelmarsch und Appell. Wer nicht weit nach Hause hatte bekam zu Weihnachten
Urlaub. Ich hatte zu Heiligabend und Silvester Torwache, denn nach Ostpreußen wurde niemand beurlaubt.
Nach Neujahr 1918 wurden wir neu eingekleidet und kamen nach Köln zur Baukompanie. Mit Musik wurden wir zum Bahnhof
gebracht. In Köln wurden wir noch mit Soldaten die von andern Truppenteilen dorthin verlegt wurden in einem großen
Kinosaal, im Stadtteil Edengarten untergebracht. Wir brauchten keinen Dienst zu machen und konnten zu Heilige Drei
Könige den Gottesdienst im Dom besuchen. Kameraden die aus irgendwelchen Gründen im Arrest saßen wurden gefragt ob sie
auch am Gottesdienst teilnehmen möchten, dann würde ihnen die Strafe erlassen. Fast alle haben dem zugestimmt. Einige
Tage später wurden wir wieder auf einen Transportzug verladen, der uns über Herbestal, Antwerpen nach Brügge in Belgien
brachte. Hier mussten wir den Zug kurzfristig verlassen und einen Luftschutzkeller aufsuchen, weil Fliegeralarm
gemeldet wurde. Danach ging es wieder weiter nach Turut, Kortemark, Hauseme, Kautremollen, Zaren, Zarenlinde. Dort
wurden wir in verschiedene Gruppen aufgeteilt und einer Pionierkompanie auf dem Pionierpark Struwendorf zugewiesen.
Wir haben hinter Klerken Bunker für schwere Maschinengewehre gebaut. Unsere Arbeit konnten wir nur bei Nebel verrichten,
denn bei Sonnenschein waren wir sofort dem Beschuss der feindlichen Artillerie ausgesetzt. eine Kleinbahn die Munition
und Stacheldraht an die Front brachte war dem Beschuss besonders ausgesetzt. Die Gleise, von schweren Geschossen
zerfetzt, mussten immer wieder hergerichtet werden, damit der Nachschub aufrechterhalten werden konnte. Später haben
wir am Kemelberg bei Armentier, eine Brücke über die Lys gebaut. Um in dem Sumpfgelände einen Untergrund dafür zu
schaffen, mussten wir 10 bis 12 Meter lange Pfähle in den Boden rammen. Ein Feldwebel gab immer den Befehl: „Hoch den
Bär, noch viel mehr, dass man sieht, wie er zieht, denn dieser Pfahl, glatt wie ein Aal, durch Fels und Stein, durch
Wasser und Sand, fürs Vaterland”. Jedes mal mussten wir den Bär an Schnüren hochziehen und dann wieder herunterlassen.
Wenn es manchmal, trotz vieler Mühe nicht mehr weiter ging wurde der Pfahl auf eine bestimmte Länge abgeschnitten.
Nach Fertigstellung der Brücke kamen wir in die Siegfriedstellung bei Kambrei, zum Bau eines Bataillons-Gefechtstandes.
Da der Boden kreidehaltig war, mussten wir die großen Stücke von Hand zu Hand reichen, den Schutt haben wir dann mit
Sandsäcken aus der Baugrube gehoben und mit Ästen getarnt, damit der Stand nicht von feindlichen Fliegern entdeckt
werden konnte. Alle acht Stunden wechselte die Arbeitsgruppe. Wir mussten von der Baustelle durch das Gelände robben,
denn aufrecht gehend war man dem Beschuss der feindlichen Scharfschützen ausgesetzt, die von einem Fesselballon aus
informiert wurden der über den feindlichen Linien stand.
Der Wechsel war mit einem großen Risiko verbunden, und wurde wenn Möglich bei Dunkelheit vollzogen. Um vor
Überraschungen sicher zu sein haben wir spanische Reiter (Stacheldrahtverhaue) gebaut und vor die ersten Gräben
gestellt, die dann oft in der Nacht von den Franzosen geklaut, und dann vor ihren eigenen Linien wieder aufbaut wurden.
Wir hatten aus Bohlen eine Brücke auf Rädern gebaut, die dann in den Graben geschoben wurde, damit die Artillerie und
andere Fahrzeuge über die Schützengräben kamen. Weil um vier Uhr morgens der Beschuss mit Gasgranaten begann, mussten
wir Gasmasken aufsetzen, danach haben feindliche Flieger unsere Munitionskolonne bombardiert und total aufgerieben.
Es wurde auch eine Marinedivision eingesetzt, die bis dahin dem Küstenschutz gedient hatte und jetzt ihren ersten
Einsatz hatte.
Wir sind zuerst ein ganzes Stück in Richtung Amiens vorangekommen, doch dann blieb unser Angriff in den zuvor von
Engländern besetzten Stellungen, stecken. Da die Engländer ihre Stellungen fluchtartig verlassen hatten, fiel ihr
ganzer Proviant in unsere Hände; Schokolade, Weißbrot, Flaschenwein. Die erste Nacht haben wir in einem runden Zelt
verbracht, weil ich mir durch den starken Wind, der da herrschte eine Angina zugezogen hatte, die mit hohem Fieber
verbunden war, konnte ich die vielen Köstlichkeiten überhaupt nicht genießen.
An eine ärztliche Versorgung war überhaupt nicht zu denken, denn es mussten zuerst die vielen Granatlöcher eingeebnet
werden damit die vielen Fahrzeuge und Geschütze wieder weiter fahren konnten. Auch eine Bahnlinie musste repariert
werden, damit die großen Geschütze in Stellung gebracht werden konnten, dabei wurden auch die vielen Kriegsgefangenen,
die bei dieser Offensive gemacht wurden, eingesetzt. Als die Offensive dann schließlich scheiterte, wurden wir an die
Somme verlegt. Da habe ich die Ortelsburger Jäger, die aus Italien an die Westfront verlegt wurden, zum ersten Mal im
Einsatz gesehen.
Unser nächster Einsatzort waren dann Stellungen hinter Laon. Hier wurden die Vorbereitungen zu einer neuen Offensive
getroffen. Feindliche Flieger versuchten uns Tag und Nacht daran zu hindern die Aufmarschwege instand zu halten. Als
die Offensive dann endlich losging, hatten wir die Order eine Brücke über die Oise mit Bohlen und Balken zu verstärken.
Gleich am Anfang der Offensive mussten wir Gasmasken anlegen, um für alle Fälle gewappnet zu sein. Nur die Artillerie
und Kraftfahrzeuge durften die Landstraße benutzen, die Infanterie ging immer im Straßengraben und wurde von einer
Seite von Kopf bis Fuß mit Dreck bespritzt. Die Franzosen und Engländer haben hier schon Panzer eingesetzt, die von
Truppen aus den Kolonien gefahren wurden. Die Australier gingen mit umgekrempelten Ärmeln hinter den Panzern her.
Die letzte Offensive des Ersten Weltkrieges.
Zum Jahresende 1917 hatten noch 153 deutsche 175 alliierten Divisionen gegenübergestanden.
Zur Vorbereitung der Offensive ließ Ludendorff 39 Divisionen aus dem Osten und aus Italien heranziehen. Er ließ
spezielle Angriffsdivisionen formieren, die durch intensive Ausbildung auf den beabsichtigten, schnellen Vormarsch
vorbereitet wurden. 6608 Geschütze, 3500 Minenwerfer und 1070 Flugzeuge wurden hinter dem vorgesehenen
Angriffsabschnitt konzentriert. Den Ausbildungsbefehlen Ludendorffs, die bis zu den Kompanieführern herab verteilt
wurden, konnte man entnehmen, dass der Versuch, den Krieg mit einem mächtigen Schlag zu entscheiden schon in der
nächsten Zeit gewagt werden sollte. Wir übten die fast vergessenen Formen des Schützengefechts und des
Bewegungskrieges, auch wurde eifrig mit Gewehr und Maschinengewehr geschossen. Wir hegten keinen Zweifel daran, dass
der große Plan gelingen würde.
Den ganzen Winter 1917/18 über plante der Generalquartiermeister Ludendorff die deutsche Offensive. Zwar hatten die
Vereinigten Staaten von Amerika dem Deutschen Reich am 6. April 1917 den Krieg erklärt, aber vor dem Sommer des
Jahres 1918 war mit dem Auftreten von US-Truppen in relevanter Größenordnung nicht zu rechnen. Der deutschen Führung
blieb nur ein schmales Zeitfenster, um die Niederlage und den zu erwartenden Diktatfrieden abzuwenden. Ypern,
Armentieres, Arras, Cambrai oder Verdun wurden ernsthaft als Schauplätze erwogen. Ludendorf entschied sich für einen
Angriff zwischen Cambrai und La Fere – genau an der Nahtstelle zwischen der Französischen Armee und dem britischen
Expeditionscorps.
Der Fluss Somme bildete die Grenze zwischen Franzosen und Briten. Die Briten – nicht die Franzosen – sollten das Ziel
des Vorstoßes werden. Ihre Stellungen waren nur 130 Kilometer von der Kanalküste entfernt. Beim erreichen der
Sommemündung wäre die gesamte britische Armee eingeschlossen gewesen, denn hinter ihnen lag die Straße von Dover.
Am 21. März 1918 begann die letzte entscheidende Offensive des deutschen Westheeres im Ersten Weltkrieg. Der
Angriffsstreifen war 75 Kilometer breit. Dort hatte Ludendorff 43 Angriffsdivisionen konzentriert, dahinter 30
weitere Reservedivisionen, ihnen standen lediglich 26 britische Divisionen gegenüber. „Michael“ – so der Deckname der
„Kaiserschlacht“ – lief dank Ludendorffs akribischer Vorbereitung gut an. Der britische Oberbefehlshaber General
Douglas Haig erkannte die Chance, welche die Deutschen in dieser Situation hatten. Wollten die Deutschen diese Chance
nutzen, mussten sie darauf verzichten die Somme zu überschreiten, wo sie auf die französischen Reserven treffen und
sich von der Küste entfernen würden. Genau diesen Fehler begingen jedoch die Deutschen.
Am dritten Tag überschritt der linke Flügel mit der 18. Armee die Somme. Ludendorf stellte die Taktik über die
Strategie, wie er das bei Tannenberg und der Schlacht an den Masurischen Seen auch schon getan hatte. Ludendorffs
Befehl an die 18. Armee vom Abend des 22. März 1918 lautete: „Jetzt gilt es den Sieg auszunutzen, den Feind nicht zum
Stehen kommen zu lassen, Somme und Crozat-Kanal zu überschreiten, bevor feindliche Verstärkungen wirksam werden“.
Was Haig befürchtet hatte, trat nicht ein. Die deutsche Offensive Lief weiter Richtung Süden und lief sich schließlich
tot. Am 31 März war Ludendorff zu der Erkenntnis gekommen, dass „Michael“ gescheitert war. Am 5. April wurde die
Einstellung der Offensive befohlen. Im Hochsommer waren die US-Truppen in Frankreich angekommen und gingen mit den
Franzosen zum Angriff vor. Nur mühsam konnten Hindenburg und Ludendorf den Zusammenhalt der Front waren. Am 24. Oktober
1918 forderte US-Präsident Woodrow Wilson die bedingungslose Kapitulation, am 11.Nuvember Wurde der Waffenstillstand
von Compiegne unterzeichnet.
Zusammenbruch der Westfront und Waffenstillstand .
Als die Offensive dann letztendlich gescheitert war, wurden wir auf Eisenbahnwaggon verladen, in
eine Stellung vor Verdun gebracht und der siebenten bayerischen Division zugeteilt. Als wir ausgeladen wurden nahm der
Franzose den Bahnhof unter Beschuss. Eine Granate traf einen Waggon der mit Seifenpulver beladen war, so dass der ganze
Bahnhof aussah als wäre gerade Neuschnee gefallen. Wir gingen auf die Suche nach Kartoffeln. Als ich mit einem Sack,
vollbeladen die Böschung runter ging um zur Feldküche zu gelangen, schlug unweit von mir eine Granate ein und riss mir
den Sack vom Rücken. Ich bin mit dem Schrecken davon gekommen, mir war nichts passiert.
Der Bahnhof war menschenleer, nur ein par Kaninchen liefen verschreckt durch die Gegend und einigen Kameraden gelang
es welche einzufangen. Am nächsten Tag gelang es uns endlich die Feldküche zu erreichen. Als wir gerade beim Essen
fassen waren, schlug unweit eine Granate ein so dass Pflastersteine das Dach durchschlugen und wir das Weite suchen
mussten. und wir wieder nichts zu Essen bekamen. Ein Friseur aus unserer Kompanie fuhr immer ins Hinterland um uns
mit Proviant zu versorgen. Als er 14 Tage vor dem Zusammenbruch wieder mal zurückkam erzählte er uns schon das der
Krieg nicht mehr lange dauern würde, weil Kaiser Wilhelm mit Frack und Zylinder bekleidet, Deutschland verlassen und
ins Ausland gehen würde. In unserer Einheit hatten wir auch einen Juden der glaubte dass er sich alles erlauben darf.
Eines Morgens ging er in die Küche, als er keinen Koch vorfand stieg er auf die Gulaschkanone und hob den Deckel vom
Kessel in dem der Kaffee kochte an. Der kochende Kaffee verbrühte seine Füße so sehr das er sofort ins Lazarett musste,
für ihn war der Krieg somit zuende. Es kam noch ein Erlass, das Kameraden die 2 Jahre aktiv gedient hatten und
Gefreiter waren sofort zum Sergeanten befördert wurden. Für den 11. November 1918 war ein Waffenstillstand vereinbart
und ab 11 Uhr sollte nicht mehr geschossen werden. Wir hatten unsere Kopfkissen aufgetrennt und eine Kissenschlacht
veranstaltet, um auf diese Art und Weise unserer Freude Ausdruck zu verleihen. Als die Federn durch die Luft flogen
brachen wir in Tränen aus.
In jeder Kompanie wurde ein Soldatenrat gewählt, der aus drei Mann bestand. Wenn der Kompanieführer jemanden bestrafen
wollte, musste er erst den Soldatenrat fragen, der die Strafe befürworten, aber auch ablehnen konnte. Die Offiziere
durften keine Achselstücke mehr tragen, was für sie einer Degradierung gleich kam. Wir waren in einem Dorf
einquartiert und morgens zum Appell angetreten, als einer vom Soldatenrat sich stockbesoffen vor den auf dem Pferd
sitzenden Kompanieführer stellte und schrie: „Alles hört auf mein Kommando”. Der Kompaniechef war wie vom Blitz
getroffen, ihm versagte die Stimme. Wir sahen ein das dies nicht so weiter gehen kann und wählten einen neuen
Soldatenrat. Unser Rückzug begann bei Konflanz, einer Vorfestung von Metz und führte uns zunächst über die
luxemburgische Grenze, wo wir in einem Ort einquartiert wurden. Als wir für die Küche Holz aus dem Wald holen gingen,
entschieden wir uns eine Eiche abzusägen, ohne uns dessen bewusst zu sein, in welchem Forst wir uns befanden. Als wir
beim fällen waren fielen plötzlich Schüsse, die wir auch sofort erwiderten, bis uns ein Elsässer der sich in unserer
Kompanie befand aufklärte: „Kameraden, wir befinden uns hier auf Luxemburgischem Hoheitsgebiet”.
Wir sind dann weiter durch das Fürstentum Birkenfeld marschiert, wo das Städtchen Merzig für uns geflaggt hatte. Das
Elsass haben wir auch noch kurz gestreift. Wo wir bei einem Bauern, der uns kein Stroh für das Nachtlager geben wollte,
einquartiert wurden. Daraufhin gingen wir in die Scheune und haben uns selbst was besorgt. Wir haben dann noch erfahren,
sie hätten ein Schwein geschlachtet und warteten auf den Einzug der Franzosen. Als wir uns 1917, an der Ostfront, in
den in Karpaten, im Einsatz befanden, waren unter uns auch viele Elsässer. Sie durften ihre Heimatpost nicht in
französischer Sprache schreiben, mussten ihre Briefe offen auf der Schreibstube abgeben, wo sie zuerst kontrolliert
und dann abgeschickt wurden. Als ich in einer Nacht, mit einem Elsässer auf einem Vorposten Wache schieben musste,
wollte er mich überreden zum Russen überzulaufen. Als ich darauf nicht eingehen wollte verschwand er plötzlich in der
Dunkelheit und ich habe ihn nie wieder gesehen.
Wir sind dann weiter Richtung Worms und Ludwighafen gezogen, dort wurden wir bei einem Mühlenbesitzer einquartiert,
ein Unteroffizier und vier Mann. Obwohl wir verlaust und verdreckt waren bestand die Müllerin darauf das wir in ihren
Betten übernachteten. „Wenn alles durch ist”, sagte sie, „werde ich alles gründlich reinigen”. Der Müller brachte uns
eine Gießkanne voll Wein und sagte wir sollen es uns Schmecken lassen. Wir haben reichlich davon Gebrauch gemacht, so
dass ich gar nicht weiß wie ich ins Bett kam. Das war meine Erinnerung an die Pfalz. Manchmal waren wir auch 2 Tage im
Quartier.
Vor dem Weitemarsch wurde uns immer gesagt welche Truppe die Vorhut und welche Truppe die Nachhut übernehmen sollte.
Die Nachhut hielt immer Verbindung zu den nachrückenden Franzosen und man muss staunen wie alles reibungslos, ohne
Zwischenfälle von statten ging, was wir in erster Linie dem General-Feldmarschall Paul von Hindenburg zu verdanken
haben, der den Rückzug an der Westfront koordiniert hat.
In Köln angekommen, erhielten wir im Volkshaus unsere Entlassungspapiere, Eisenbahnfahrscheine, Reisepässe,
unterschrieben von Oberstleutnant Mann. Wir mussten Köln umgehend verlassen, weil schon am nächsten Tag die
französischen Besatzungstruppen in einmarschieren sollten. Wir fuhren mit einem Zug der bis Allenstein fuhr, dort
wurden unsere Papiere vom Soldatenrat kontrolliert. Die jüngren Jahrgänge wurden festgehalten, zu neuen Einheiten
zusammengestellt und zur Sicherung der Ostgrenze gegen die Bolschewisten abkommandiert. Ich hatte gesagt das ich noch
einen Schrapnellsplitter in der Kreuzbeingegend habe und durfte daraufhin nach Hause fahren.
Kaum in Ortelsburg angekommen fiel ich wieder dem Soldatenrat in die Hände. Sie haben alles durchsucht, haben mir mein
Seitengewehr und eine Decke abgenommen, aber ich durfte weiter und bin dann kurz vor Weihnachten 1918 auf dem
elterlichen Hof angekommen. Schon auf dem Hof habe ich meine Kleider vom Leib gerissen, weil vor Läusen und anderem
Ungeziefer nicht mehr aushalten konnte und mich erst gründlich gewaschen bevor ich das elterliche Haus betreten habe.
Die Freude über das Wiedersehen war sehr groß.
“ Unser Leben zwischen den beiden Weltkriegen.”
Endlich wieder zurück in der Heimat
Rohmanen war durch die Kampfhandlungen 1914/15 zu einem drittel zerstört worden, aber schon
wieder im Aufbau. Die Firma Grzella aus Ortelsburg hatte die Bauarbeiten übernommen. Unter der Aufsicht von Polier
Karl Kontor wurden die Dachstühle errichtet. Ich habe mich, nach kurzer Erholungspause, auch als Zimmermanngehilfe am
Wiederaufbau beteiligt. Die Firma Grzella hat das Material geliefert und auch unsere Löhne gezahlt. Wegen meinem
Steckschuss bin ich dem VDK beigetreten und habe mit dessen Hilfe eine Rente beantragt die mir auch bewilligt wurde.
Nach vier Jahren wurde ich nach Allenstein zur Nachuntersuchung vorgeladen. Die ärztliche Untersuchung hatte ergeben,
das Geschoß sei verkapselt, und nur das linke Bein etwas in Mitleidenschaft gezogen. Daraufhin wurde die Rentenzahlung
eingestellt.
Der Stellmacher Adam Ornowski war im Krieg als Sanitäter eingesetzt und hatte auf Grund seiner Erfahrungen,
 Beziehungen zum medizinischen Dienst in Ortelsburg aufgebaut. Es wurden dort Lehrgänge in Erster Hilfe angeboten,
die von Prof. Dr. Kutz geleitet wurden. Adam Ornowski hat dafür gesorgt das einige junge Männer aus Rohmanen daran
teilnehmen konnten. Adam Ornowski, August Linka, Emil Rosowski, Johann Dembek, Emil Baschek und ich sind dann dem
Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes beigetreten und mussten jeden Sonntag am Lehrgang teilnehmen. Unser
Gruppenführer war Kreisobersekretär Albrecht, Landrat von Poser, als unser Ehrenvorsitzender, hat viel zu unserer
finanziellen Unterstützung beigetragen und hat dafür gesorgt dass die Bereitschaft eingekleidet wurde.
Beziehungen zum medizinischen Dienst in Ortelsburg aufgebaut. Es wurden dort Lehrgänge in Erster Hilfe angeboten,
die von Prof. Dr. Kutz geleitet wurden. Adam Ornowski hat dafür gesorgt das einige junge Männer aus Rohmanen daran
teilnehmen konnten. Adam Ornowski, August Linka, Emil Rosowski, Johann Dembek, Emil Baschek und ich sind dann dem
Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes beigetreten und mussten jeden Sonntag am Lehrgang teilnehmen. Unser
Gruppenführer war Kreisobersekretär Albrecht, Landrat von Poser, als unser Ehrenvorsitzender, hat viel zu unserer
finanziellen Unterstützung beigetragen und hat dafür gesorgt dass die Bereitschaft eingekleidet wurde.
In jedem Dorf wurde eine Unfallstelle eingerichtet, mit einem Verbandskasten und mit Verbandsmaterial für die erste
Hilfe ausgerüstet. Die Unfallstelle in Rohmanen, die am Haus von der Straßenseite, durch eine Tafel mit einem roten
Kreuz gekennzeichnet war, hatte ich zu verantworten. An Sonntagen wurden wir an Badestellen und bei Fußballspielen
eingesetzt, haben viele Übungen bei Waldbränden durchgeführt und auch Ausflüge nach Rudzany am Niedersee gemacht. Bei
der Einweihung des Tannenbergdenkmals in der Nähe von Hohenstein kamen wir an Straßenkreuzungen zum Einsatz.
Rohmanen hatte auch eine freiwillige Feuerwehr. Bis zum ersten Weltkrieg hat Friedrich Biella als Brandmeister das
Kommando gehabt. Er war aktiver Unteroffizier, hatte gute Führungsqualitäten und die Männer, die allesamt aus dem
aktiven Militärdienst stammten hatten zu ihm ein großes Vertrauen. Nach dem Krieg wollten diese Männer,
(Friedrich Nickel, Friedrich Willam, Julius Wittkowski, Jakob Janowski, Johann Gloddek, Gustav Bednarz), nicht mehr
weitermachen. Friedrich Biella, der inzwischen zum Gemeindevorsteher gewählt wurde, hat sich dann auf einer
Gemeinderatsitzung vorgeschlagen, für die Freiwillige Feuerwehr jüngere Kräfte anzuwerben.
Zum Brandmeister hat er Herrn Wilhelm Pilath vorgeschlagen. Der wurde dann nach Königsberg zur Fortbildung geschickt.
Der Feuerwehr gehörten nun folgende Personen an: Wilhelm Pilath(Brandmeister), August Linka(Stellvertreter), Gustav
Deptolla, Julius Matzey, Johann Dembek, Willy Willam, Gustav Rattay. Der Kreisbrandmeister war Heinrich Thalmann aus
Ortelsburg, sein Stellvertreter war Kreisobersekretär Salzmann. Der Bezirks-Kommissar bei der Ostpreußischen
Feuersozität War Herr Ernst Trzaska. Er hat dafür gesorgt das die Wehr uniformiert und mit Löschgeräten ausgerüstet
wurde. Da die alten Schläuche schon sehr marode waren, wurden sie durch moderne ersetzt, deren Kupplungen auch mit der
Motorspritze übereinstimmten.
Ernst Trzaska hat bei der Feuersozität und beim Landratsamt Finanzmittel beantragt und auch genehmigt bekommen. Der
Schneidermeister Wilhelm Baran wurde beauftragt Tuch und Drillichanzüge nach Maas zu schneidern. Er hat uns
Stoffmuster vorgelegt aus denen wir wählen sollten. Feuerwehrhelme haben wir auch bekommen. Die Gemeinde musste
Finanzmittel bereitstellen, einen Prozentsatz vom Gemeindebudget. Im Brandfall mussten für den Spritzenwagen Pferde
zur Verfügung stehen, von Willy Willam, Gustav Rattay, Julius Matzey und Gustav Dorka, weil sie in der Nähe des
Spritzenhauses wohnten. Am Spritzenhaus wurde ein großer Baum mit Querleisten aufgestellt, wo nach jedem Brand oder
einer größeren Übung die Schläuche zum trocknen aufgehängt wurden.
Der Kreisbrandmeister hat mindestens 2-3-mal im Jahr die Wehren besichtigt. Das ganze Dorf war dann auf den Beinen,
die Bauern mit Pferden, und andere Dorfbewohner mit Eimern und Spaten, wurden dann in verschiedene Gruppen eingeteilt.
Erst hat die Wehr sämtliche Aufstellungen am Gerät geübt; Grundstellung Fahrstellung und Marschstellung. Dann wurde
ein Brand angekündigt, die Feuerwehr mit der Spritze an den Brunnen, die Gruppen dort wohin sie beordert wurden, die
Bauern brachten mit den Wasserkiwen Wasser aus dem Brunnen zum Brandort. Wenn das Wasser im Brunnen alle wurde hat
man den Saugkorb in die Kiewen gelegt und dort Wasser entnommen. Die Wassergruppe ging mit Eimern zum Dorfteich, holte
Wasser und füllte damit die leeren Kiewen.
Der Löschtrupp ging mit Feuerhaken und Löschpatschen auf die umliegenden Gehöfte und versuchte das vermeintliche Feuer
von ihnen fernzuhalten. Nach dem Alarm wurde wieder am Spritzenhaus angetreten. Die Gruppenführer mussten angeben ob
ihre Gruppe auch vollständig erschienen war, denn Übungen wurden nur vor, oder nach der Feldarbeit durchgeführt, so
dass niemand eine Entschuldigung vorbringen konnte. Wer ohne begründete Entschuldigung nicht anwesend war erhielt eine
Verwarnung. Der Kreisbrandmeister erklärte dann welche Handgriffe den Vorschriften entsprachen und welche nicht. Die
Schläuche wurden noch schnell zum Trocknen aufgehängt. Anschließend gingen wir alle in den Gasthof Trzaska, haben über
vorhandene Mängel diskutiert, Verbesserungsvorschläge unterbreitet und zwischendurch den Durst gelöscht. Der
Kreisbrandmeister ist dann, nach einer kurzen Verabschiedung, ins nächste Dorf gefahren, weil er an einem Tag mehrere
Feuerwehren betreuen musste.
Der Rohmaner Dorffriedhof

Einen Kilometer vom Ende des Dorfes entfernt, auf der rechten Seite der Landstraße in Richtung
Ortelsburg, befand sich der Rohmaner Dorffriedhof. Wann dieser Friedhof angelegt wurde entzieht sich meiner Kenntnis.
Nach Aussagen älterer Dorfbewohner soll davor auch schon eine Ruhestätte vorhanden gewesen sein, und
zwar auf der linken Straßenseite gegenüber dem jetzigen Friedhof. An dieser Stelle befand sich bis in die
Nachkriegszeit ein kleiner Brunnen, aus dem die Dorfbewohner, das Wasser zum begießen der Grabbepflanzung auf den
Gräbern ihrer verstorbenen Angehörigen holten. Der Friedhof war in einer Hanglage angelegt, wahrscheinlich weil diese
Parzelle für eine landwirtschaftliche Nutzung nicht geeignet war. Um das Gräberfeld vor herumstreunenden Tieren oder
von der Weide entlaufenen Kühen zu schützen, hat man das ganze Gelände mit einem Holzzaun umgeben. Der Zugang befand
sich von der Straßenseite. Unter einem Torbogen hindurch wurden die Verstorbenen zu Grabe getragen. Die Gräber der
einzelnen Familien waren nebeneinander angelegt, mache, wie zum Beispiel die der Familie Trzaska, sogar mit einem
schmiedeeisernen Zaun eingefasst.
Nach dem 2. Weltkrieg verfiel der Friedhof immer mehr. Die nötigen Finanzmittel für die Pflege der Einfriedung konnten
von den restlichen noch verbliebenen Deutschen nicht mehr aufgebracht werden. An den gepflegten Gräbern konnte man noch
erkennen dass es Verwandte von noch in Rohmanen wohnenden Deutschen waren, oder von bereits im Westen Deutschlands
lebenden, die ihre noch in Rohmanen wohnenden Nachbarn damit beauftragt hatten. Die übrigen Gräber wurden von Jahr zu
Jahr immer mehr von Wildkräutern überwuchert und schließlich auch von Sträuchern und schnell wachsenden Bäumen.
In den späteren Jahren konnte man nicht mehr erkennen dass dort vor Jahren Tote zur letzten Ruhe gebettet wurden. Die
Natur holte sich das ganze Gelände zurück und nur unter großen Schwierigkeiten konnten Besucher aus dem Westen das
Friedhofsgelände noch betreten.
Das Gasthaus Trzaska

Nach dem ersten Weltkrieg hat der Gastwirt Friedrich Trzaska neben dem Gasthof einen großen Saal
für Festlichkeiten und Vereinsfeiern gebaut, in dem schon mal Feuerwehrfeste veranstaltet wurden. Ernst Trzaska war
Feuerkommissar bei der Ostpreußischen Feuersozität. Erich Trzaska war Vollziehungsbeamter beim Amtsgericht in
Ortelsburg. Unser Feuerkommissar war uns beim organisieren der Veranstaltungen sehr behilflich, hat uns den Saal, die
Musik und die Theaterstücke besorgt und die Feuerwehren aus den Nachbardörfern eingeladen.
Zu Manöverzeiten, vor dem 2. Weltkrieg und dann auch während des Krieges, waren im Gasthof Soldaten, meist im Range
eines Offiziers, einquartiert. Fräulein Mariechen Trzaska hat die Poststelle im Dorf betreut. Nachdem ich 1939 zum
Militär eingezogen wurde, hat sie, nach einer Schulung im Ortelsburger Krankenhaus, auch die Unfallmeldestelle
übernommen. Nach dem Krieg, pflegte sie mit vielen Bekannten, die bereits in der Bundesrepublik wohnten, einen regen
Briefwechsel. Auf dem Rohmaner Friedhof hat sie viele Gräber, im Auftrag von Angehörigen, die auf Grund ihrer
Abwesenheit, dazu nicht mehr in der Lage waren, gepflegt. Der Bauunternehmer Kurnitzki aus Ortelsburg, äußerte die
Bitte, sie möchte ihm doch ein Blatt vom Rosenstrauch, der auf dem Grab seiner Eltern steht, in den Brief legen. Als
sie uns den Brief vorgelesen hat, waren wir zu Tränen Gerührt. Sie hat als Letzte aus ihrer Familie, bis zu ihrem Tod
im Jahre 1960, in Rohmanen, im Gebäude der Gastwirtschaft gewohnt und ist auf dem Rohmaner Friedhof beerdigt worden.
Fleisch und Wurstwaren Karl Pelkowski
Im Jahr 1931 hat der Fleischermeister Karl Pelkowski, aus Grammen, direkt neben unserem Hof ein
Anwesen gekauft und dort eine Fleischerei eingerichtet. Er war mit meiner Schwester Frieda, verheiratet. Am Anfang hat
er die Schweine noch auf seinem Hof geschlachtet, später dann im Ortelsburger Schlachthof. Jede Woche fuhr er 2-mal,
mit dem Pferdewagen(Einspänner), nach Ortelsburg zum Wochenmarkt, wo er seine Fleisch und Wurstwaren zu Verkauf anbot.
Am Tag davor, wenn er die Wurst gekocht hat, kamen viele Rohmaner mit Kannen oder anderen Gefäßen, wegen der guten
Wurstsuppe, die er umsonst unter die Leute verteilte. Als Karl Pelkowski, Ende August 1939 zum Militär eingezogen
wurde, hat seine Frau das Pferd verkauft und den Beitrieb stillgelegt. Am Haus hing, immer noch die Tafel mit der
Aufschrift: Karl Pelkowski, Fleisch und Wurstwaren. Ein Witzbold hat irgendwann darunter geschrieben; „Fleisch und
Wurst waren einmal”, drauf hin hat Frau Pelkowski die Tafel entfernen lassen. Karl Pelkowski ist im Mai 1946 in
französischer Gefangenschaft verstorben. Seine Ehefrau Frieda, verstarb an ihrem 85. Geburtstag in Mettmann bei
Düsseldorf.
Die steinreichen Rohmaner Felder
Die letzte Eiszeit hat bei der Schmelze, auf der Rohmaner Feldgemarkung viele Steine und
Granitblöcke zurück gelassen. Überirdisch, aber besonders unter der Erde, gab es viele kleine, aber auch große Steine,
die, den Bauern, beim Pflügen und anderen Feldarbeiten sehr viel Schweiß, abverlangten. In einer Kiesgrube, auf dem
Feld des Bauern August Radek, lag ein Granitblock, von schätzungsweise 100 cbm. Vor etwa 80 Jahren, als man für diese
Steine noch keine Verwendung hatte, griffen die Bauern zu einer „List”. Weil er sonst nicht pflügen konnte, hat mancher
seinem Nachbarn, die Steine in der Nacht auf dessen Feld abgeladen. Als diese Tätigkeit unter Strafe gestellt wurde,
hat man die Steine in Schluchten gekippt und mit Mutterboden zugeschüttet. In späteren Jahren kam diese jedoch beim
pflügen wieder an die Oberfläche. Dann hat man aber schon Steine für den Straßenbau gebraucht und konnte sie so zu Geld
machen. Besonders im Raum südlich von Ortelsburg, bis zur polnischen Grenze, wo Steine eine Rarität waren, kamen sie
jetzt zum Einsatz. Auch beim Bau von Häusern, besonders für die Fundamente, wurden sie eingesetzt, weil auf diese
Weise viel Ziegeln eingespart wurden. Die Firma Gribienski aus Ortelsburg hat die großen Steine mit Dynamit gesprengt
und auf diese Weise die weitere Verarbeitung erleichtert.
Die Steine welche beim Pflügen aus dem Boden geholt wurden, hat man am Feldrand auf große Haufen zusammen getragen.
Wenn die Feldarbeit beendet war, sowie auch in den Wintermonaten, waren wir jeden Tag mit Steinen unterwegs. Wir sind
vorwiegend am Abend los gefahren, weil unter der schweren Last die Wagenachsen so heiß wurden und die Gefahr bestand,
das durch die Dehnung, die Räder blockiert würden. Bei einer Fahrt konnte man bis zu 24 Reichsmark verdienen, wogegen
1 Zentner Roggen für 8 bis 9 Reichsmark zu haben war. Ich bin selbst, mit dem Pferdewagen bis Fürstenwalde, Radostowen,
Luka, Altkirchen, Höhenwerder, ja sogar bis Friedrichshof gefahren.
In Rohmanen wurden auch rote Ziegeln gebrannt. Viele Häuser wurden, mit Ziegeln erbaut, die nur wenige 100 Meter von
der Baustelle entfernt hergestellt wurden. Der Lehn wurde auf den Feldern in der näheren Umgebung entnommen, dann von
Ochsen solange getreten, bis er so geschmeidig war, das er sich in Formen einstreichen ließ. Wenn die Ziegel in der
Form trocken war, wurde sie entnommen und in einem Brennofen gestapelt. Um einen Ofen richtig anzufeuern, brauchte man
12 Raummeter Holz, das im Zeitraum von ein par Tagen verheizt wurde. Der Fischer Karl Glitza hatte schon eine
Knetmaschine, die von einem Pferd angetrieben wurde, das mit verbundenen Augen, den ganzen Tag in die Runde ging.
Im Dorf waren auch vier Kalköfen, in denen so genannte Kalksteine, die sich an gewissen Stellen, im Erdboden befanden,
gebrannt wurden. Nach dem Brennen wurden die Steine mit Wasser abgelöscht und die daraus entstandne Masse diente, nach
dem Beimischen einer gewissen Menge Sand, dann als Bindemittel beim Häuserbau. Das Gerichtsgebäude und das
Lehrerseminar in Ortelsburg wurden mit Kalk, aus dem Rohmaner Brennöfen erbaut. Auch zum Bau einer Eisenbahnbrücke, auf
der, der Zug, den Sawitzfluß, von Ortelsburg nach Allenstein überquerte, hat mein Großvater, mit einem Ochsengespann,
Kalk gefahren.
Hinter der Scheune, beim Bauern Johann Dembek hat man Tonerde gefördert, aus der man mit Hilfe einer Formerscheibe,
die von einem Arbeiter mit Muskelkraft(Fußbetrieb) angetrieben wurde, schöne Krüge, Schalen und Vasen geformt hat.
Die Töpferware wurde, nachdem sie trocken genug war, auch in einem Ofen gebrannt, anschließend mit einer Lasur
überzogen und wieder gebrannt. Es wurden auch Kacheln zum Bau von Kachelöfen hergestellt, die mit verschiedenen
Ornamenten versehen, die Wohnstuben unserer Vorfahren schmückten. So haben unsere Großväter ihr Leben gemeistert und
nach und nach, unsere Dörfer aus der Rückständigkeit in die Neuzeit geführt.
Das gesellschaftliche Leben nach dem 1. Weltkrieg

Als der Lehrer Alfred Dorka, ein Frontkämpfer des Ersten Weltkrieges und ein Sportsmann, als
zweite Lehrkraft an der Rohmaner Schule angestellt wurde, hat er die Sitten und Gebräuche aus früherer Zeit wieder zum
Leben erweckt. Zuerst hat er die Jugend zusammen gerufen, einen Jugendverein und einen Fußballclub, gegründet. Zum
Vorsitzenden des Fußballclubs wurde Johann Gloddek berufen, der ihn auch geleitet hat. Bauer Wilhelm Spittka, der am
Rohmaner See wohnte, stellte Land für einen Sportplatz unentgeltlich zur Verfügung. Lehrer Alfred Dorka hat am
Rohmaner See eine Badestelle ausgesucht und ein Sprungbrett bauen lassen. An jedem Sonnabend im Sommer, bevor die
Sonne unterging, versammelte sich die gestammte Jugend des Dorfes an der Badestelle am See. Es wurde gebadet,
Heimatlieder gesungen, gespielt, im Fackelschein eines großen Biwakfeuers, bis in die späte Nacht hinein. Der Fischer
Karl Glitza hat uns Kähne zur Verfügung gestellt, mit denen wir auf den See hinausgepaddelt sind, dabei hatten wir viel
Spaß, was wiederum den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft gefördert hat. Ich habe mit meiner Mandoline den Gesang von
Volks- und Heimatliedern begleitet.
Der Rohmaner See liegt in einem Tal, dessen Hänge zu beiden Seiten mit Kiefern und Tannen bewaldet sind. Wenn man
gesungen oder Musiziert hat, hallte es von den Hängen zurück. Die Ufer waren mit Kalmus und Schilf bewachsen, was für
die Fischaufzucht von Vorteil war. Wenn man an einem sonnigen, windstillen Tag, am Seeufer spazieren ging, traf man
oft auf Flachstellen, an denen sich die Fischbrut im Sonnenlicht wärmte, wie ein Mückenschwarm. Im See befanden sich
folgende Fische: Karpfen, Hechte, Schleie, Barsche Plötze, Rotaugen, Aale und Krebse. Am Sonntagmorgen brachten viele
Rohmaner ihre Pferde zum See um sie zu baden.
Es wurden dort, unter der Aufsicht von Lehrer Dorka, auch viele Jugendfeste mit Theatervorführungen veranstaltet, zu
denen er selbst die Vorlagen organisiert hat. Der am See wohnende Bauer Johann Nadrowski, hat uns ein Scheunentor, als
Tanzboden zur Verfügung gestellt. Der Zimmermann Wilhelm Wittek hat uns eine Windmühle gebaut, die am auf dem Boden
liegenden Scheunentor aufgestellt wurde, dazu kamen Noch Tannen und Fichten, die das Ganze wie ein Bühnenbild
erscheinen ließen. Es wunden viele Bühnenstücke aufgeführt, unter anderen >Alte Weiber werden jung gemahlen<. Dazu bot
die Windmühle die entsprechende Kulisse.
Nach der Vorführung wurde der Boden aufgeräumt, um dann als Tanzdiele zur Verfügung zu stehen. Der Gastwirt Trzaska
hatte Tische und Bänke aufgestellt, Speisen und Getränke angeboten, so dass sich die die Veranstaltung bis in die
späte Nacht hinein zog. Es waren auch Leute aus Ortelsburg und anderen Nachbardörfern dabei. Im Winter hat Lehrer
Dorka eine Kreisrodelbahn eingerichtet, die von Zeit zu Zeit mit Wasser besprengt wurde, um die Gleitfähigkeit zu
verbessern. Von einer Anhöhe ging hinunter bis auf den halben See, was für alle ein großes Vergnügen war. Es kamen
Lehrer mit Schulklassen aus der näheren Umgebung um hier zu Rodeln.
Als Herr Lehrer Jobski als Hauptlehrer nach Rohmanen kam hat er mit dem Bürgermeister und der Gemeindeverwaltung
beschlossen, in der Nähe des Dorfes, auf einem zur Schule gehörenden Grundstück, einen Sportplatz anzulegen. Dafür
wurde gleich hinter den Gärten, 6 Morgen Ackerland abgetrennt, und nach Feierabend hat Lehrer Dorka mit den
Jugendlichen eingeebnet und gleich nebenan einen Graben für Schützenstand und Kugelfang ausgehoben. Am Sonntagvormittag
wurde Fußball gespielt und um 15:00 Uhr war Kleinkalieberschießen angesagt. Es musste auch ein kleiner Beitrag erhoben
werden, um Munition kaufen zu können. Eine Büchse konnten wir aus beim Kleinkalieberverein in Ortelsburg ausleihen.
Nach Hitlers Machtergreifung
Als Adolf Hitler an die Macht kam wurde die SA gegründet. Der Bürgermeister Michael Kownatzki
wurde zum Gruppenführer ernannt und folgende Männer haben sich freiwillig gemeldet: Wilhelm Matzey, Johann Gloddek,
Gustav Nadrowski, August Buttler, Karl Baran, Emil Nickel, Wilhelm Jaschinski, Emil Bork, Ernst Rattay und Gustav Bach.
Bei Versammlungen war die SA in Uniform angetreten um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Wer versucht hat Unruhe zu
stiften, egal aus welchem Grunde, wurde aufgefordert den Saal zu verlassen, andernfalls wurde er mit Gewalt entfernt.
Herr Lehrer Jobski wurde zum politischen Leiter ernannt, seine Frau hat die NS-Frauenschaft gegründet, Lehrer Dorka
die HJ, und so bekam die Dorfgemeinschaft, nach und nach ein anderes Gesicht. Der Sportplatz und der Schützenstand
wurden jetzt mehr als früher in den Mittelpunkt gestellt. Nach der Feldarbeit hat der Bürgermeister Fuhrwerke bestellt
und den Sportplatz noch besser herrichten lassen.
Der Bauer Wilhelm Both wurde zum Ortsbauernführer ernannt, mit der Aufgabe alles Land für den Anbau von Getreide und
Futtermittel bereitzustellen, oder wenn das nicht möglich war mit Wald aufzuforsten. Durch den Einsatz von Kunstdüngern
sollten größere Erträge aus dem Boden geholt werden, um den Viehbestand zu vergrößern und mehr Milch und Butter zu
produzieren. Deutschland sollte im Stande sein sich selbst zu selbst zu ernähren, ohne auf Importe angewiesen zu sein.
Frau Jobski hat, innerhalb der der NS-Frauenschaft, mit Hilfe von Fachkräften aus Ortelsburg, Lehrgänge veranstaltet,
auf denen man Backen und Nähen lernte. Auf den Bauernhöfen befand sich auch immer mehr Rassegeflügel, das eine erhöhte
Produktion von Eiern und Geflügelfleisch sicherstellen sollte.
Die Rohmaner Bauern hatten, außer in der Landwirtschaft, noch andere Verdienstmöglichkeiten in der Kreisstadt. In
Ortelsburg wurden vier Sägewerke betrieben, die mit Langholz aus dem Walde versorgt werden mussten. Wir haben eine
Kiefer von über 8 Festmeter angefahren, der wir zuerst 6 Meter Spitze abschneiden mussten, um diese Last überhaupt
auf den Wagen zu bekommen. Sechs Pferde musste angespannt werden um den Wagen zur befestigten Straße zu bringen.
Fichten und Tannen wuchsen bis zu einer Länge von 30 Metern. Auch beim Transport von Ziegel, von der Ziegelei zum
Bahnhof, konnte man gutes Geld verdienen.
Im Jahr 1934 wurde Rohmanen an das überregionale Stromnetz angeschlossen und schaffte auf diese Weise den Sprung von
der Petroleumlampe zur Glühbirne. Neben dem Grundstück von Karl Pietzonka wurde ein Transformatorhäuschen errichtet,
in dem der ankommende Strom von einer Hochspannung auf eine Verbrauchsspannung transformiert wurde. Es gab schon eine
Überlandleitung, die aus Richtung Ortelsburg kommend, quer über die Felder, in Richtung Neu Keykuth weiter ging.
Durch eine Zwischenspanne wurde der Transformator, mit der Hauptleitung auf Kownatzkis Feld verbunden.
Ein Stromanschluss konnte die Arbeit im Haus und Hof auf vielfältige Weise erleichtern, doch nur die besser gestellten
Bauern, sowie noch manche Pensionäre, die ein festes Einkommen hatten, konnten sich dass leisten. Weil nur wenige an
der Elektrifizierung teilnahmen, war ein Stromanschluss mit hohen Kosten verbunden. Nur Gustav Pietzonka, Gasthof
Trzaska, Friedrich Nickel, die Schule und Wilhelm Both, wurden in der ersten Phase erfasst.
Im Jahr 1952 wurde von den polnischen Behörden die zweite Stufe der Elektrifizierung eingeleitet, in der alle im Dorf
stehen Gebäude erfasst wurden. Am Anfang wurden nur Leitungen für Lichtstrom gelegt und auch nur 3 Lichtstellen pro
Haushalt bewilligt. Doch im nachfolgenden Zeitraum wurden dann, wenn Material vorhanden war, weitere Lichtpunkte
angelegt. 1952, am zweiten Wochenende im Advent, wurden dann die Leitungen geschaltet und alle waren von der
plötzlichen Helligkeit sehr begeistert. Wenn man Glühbirnen auswechseln wollte musste man am Anfang weite Wege
zurücklegen, um welche zu bekommen. In den 60ger Jahren wurden dann immer mehr Starkstromleitungen gelegt, weil die
Bauern elektrische Geräte kaufen konnten. Ende der 60ger wurden auch die Abbauten an das Stromnetz angeschlossen.
Das Urnengrab auf unserem Feld
Auf unserem Feld, in Richtung Seelonken, bin ich oft beim pflügen gegen Steine gestoßen, manchmal
rissen sogar die Stränge am Pferdegeschirr. Eines Tages nahm ich einen Spaten, Brechstange und einen langen Baum, um
der Sache auf den Grund zu gehen. Als ich eine Menge Sand ausgehoben hatte stieß ich auf eine steile, aus Steinen
errichtete Wand, die ich auch mit dem Baum nicht aus der Fassung bringen konnte. Ich habe den ganzen Vormittag gegraben,
konnte jedoch nicht unter die Steine kommen. Einige Tage später hatten wir in der Schule eine Bauernversammlung, da
habe ich Herrn Biella und Herrn Lehrer Dorka von meinem Fund berichtet. Am nächsten Morgen kam der Lehrer Dorka mit der
ganzen Schulklasse, mit Spaten und Sieben ausgerüstet auf unser Feld und fingen an die ausgehobene Erde zu sieben.
Lehrer Dorka benachrichtigte daraufhin den Leiter des Ortelsburger Heimatmuseums, der am nächsten Morgen vorbei kam um
sich die Fundstelle genau anzusehen. Er beauftragte ihn 4 Mann zu besorgen, um die Steine ringsum frei zu schaufeln.
Zwischen den Steinen durften wir die Erde nur mit Esslöffeln ausheben. Als es plötzlich zu regnen anfing hat Lehrer
Dorka die Brauerei Daum, in Ortelsburg angerufen, die uns über der Fundstelle ein Zelt errichtet haben, damit wir
ungestört weiterarbeiten konnten. Wir fanden 8 flache und 8 hohe Urnen zu beiden Seiten am Körper. Die Urnen wurden in
Gipsbinden eingewickelt und ins Heimatmuseum nach Ortelsburg gebracht, wo sie durch einen Fachmann, der extra aus einem
Königsberger Museum angereist war. Nach Reinigung der Urnen hat er festgestellt, das die Grabstätte etwa 2000 Jahre vor
Christi Geburt angelegt wurde und ein Doppelgrab war, in dem ein Toter liegend und einer in Hochstellung beigesetzt
wurde.
Die Nachricht von der Fundstelle verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Es erschienen viele Schaulustige, ganze
Schulklassen aus der Umgebung, mit Autos und zu Fuß. Durch die vielen Menschen wurden die bestellten Ackerflächen auf
unserem Feld sehr in Mitleidenschaft gezogen, eine Entschädigung haben wir nicht erhalten. Das Grab wurde vor dem
Heimatmuseum in Ortelsburg wieder so aufgebaut wie man es auf unserem Feld vorgefunden hat. Für den Transport der
Steine wurde ich entlohnt. Die Urnen hat das Königsberger Museum an sich genommen und wollte sie nicht wieder hergeben,
weil die solch einen Fund noch nicht in ihrer Sammlung hatten.
Sonnenwendfeuer
Am 24 Juni fand eine Sonnenwendfeier statt. Ein Brauch der an die alten Germanen erinnern sollte.
Der Lehrer Dorka hat den Bürgermeister beauftragt 2 Fuhrwerke in den Wald zu schicken, die Holz und alten Reisig holen
und auf dem großen Schulberg abladen sollten. Das Straßenbauamt hat uns Teertonnen zur Verfügung gestellt. Die ganze
Dorfgemeinschaft wurde eingeladen, am Abend, nach der Feldarbeit, an der Sonnenwendfeier teilzunehmen. Lehrer Dorka
hielt zuerst eine Ansprache, in der er anschaulich erklärte wie unsere Vorfahren in grauer Vorzeit gefeiert haben.
Nach dem offiziellen Teil wurden das Holz und die Teertonnen angezündet, es wurden Heimatlieder gesungen, wie: Wild
flutet der See, drauf schaukelt der Schiffer den schwankenden Kahn, Schaum wälzt er wie Schnee, von grausiger Mitte
zum Ufer heran, wild fluten die Wellen auf Vaterlands See, wie schön, oh trag mich auf Spiegel zu Hügel, Masovias See.
Masovia Land, mein Heimatland, Masovia es lebe mein Vaterland.
Lehrer Alfred Dorka und sein Wirken für Rohmanen.

Friedrich Biella hatte auf seinem Feld einen Granitstein mit einer geraden Seite, den haben wir
mit viel Schweiß an den Dorfteich transportiert und auf einer Erhöhung abgelegt. Der Stein sollte zum Denkmahl für die
Gefallenen des Ersten Weltkrieges umgestaltet werden. Da zu Wenige daran ein Interesse zeigten, wurde diese Idee fallen
gelassen und der Stein irgendwann ins Wasser gerollt. Der Lehrer Dorka war viele Jahre in Rohmanen tätig, dort hat er
später seine ehemalige Schülerin, Lotte Biella geheiratet. Er hat sich sehr für die Entwicklung des Dorfes interessiert,
war bei jeder Gemeindeversammlung anwesend und hat auf Schwachstellen hingewiesen die den Fortschritt behinderten.
Gemeinsam mit den Schülern hat er den Ehrenfriedhof für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges gepflegt, an der
Wegegablung nach Eichtal und zu Ehren des Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg eine Eiche gepflanzt.
Zum Advent hat Lehrer Dorka mit der Jugend einen Adventstern, in verschiedenen Farben gebastelt.
Der Stern wurde auf einer 2 Meter langen Stange befestigt, in der Mitte wurde ein Wachslicht angezündet, am Stern
wurde eine Schnur angebracht, wenn man daran zog rollte der Stern hin und her. Am ersten Wochenende im Advent
versammelten sich jung und alt, um den Stern durch das Dorf zu tragen. Alle schlossen sich dem vorausgehenden
Sternträger an, der den Stern durch die Hauptstraße und die angrenzenden Wege trug. Dieser Sternmarsch wurde an den
folgenden Adventwochenenden wiederholt.
Am ersten Weihnachtfeiertag wurde um 4:00 Uhr morgens ein Frühgottesdienst gehalten. Zuerst hat der Pfarrer eine
Andacht gehalten, dann haben die Kinder ein Krippenspiel aufgeführt und die Gemeinde hat schöne Weihnachtslieder
gesungen. Der Gastwirt Trzaska hat uns den Saal zur Verfügung gestellt. Wir hatten eine Posaunen- u. eine
Gitarrengruppe. Unter der Leitung von Herrn Willi Doormann spielten: Gottlieb Brosch, Fritz Ollech,
Gustav Rattay(Sopran), Wilhelm Pilath, Gustav Brosch(Alt), Fritz Both(Tenor) und Fritz Brosch(Bass).
In der Gitarrengruppe wirkten mit: Martha Ollech, Hedwig Ollech, Martha Lekzik, Martha Michalick und Auguste Lekzick.
Willy Doormann hat sie auf der Geige begleitet.
Kurz vor Ausbruch des 2. Weltkrieges
Bei der Aufstellung des Grenzschutzes(Regiment Buchholz), hat er als Hauptfeldwebel die
Gruppenführerkurse überwacht und selbst die fähigsten Männer dafür vorgeschlagen. Das Ausbildungspersonal hat das
Jäger-Battalion gestellt. Wir kamen zuerst ins Stadion(Waldheim), wurden da eingekleidet und dann ging es gleich
kasernenmäßig zu, theoretisch und praktisch. Jeder musste vor die Front treten und nachweisen ob er im Stande ist,
Befehle zu erteilen. Abends wurden Filme vorgeführt die uns zeigen sollten wie eine Gruppe sich im Gelände entfalten
muss. Die Exerziervorschriften hatten sich, im Verhältnis zu Kaiser Wilhelms Zeiten, etwas geändert. Damals bestand
eine Gruppe aus 8 Mann und einem Unteroffizier, jetzt aus 10 Schützen, 3 für das leichte Maschinengewehr und einem
Unteroffizier(13 Mann). Nach der Schulung folgte eine Abschlussprüfung, danach ein gemütliches Beisammensein. Aus
Rohmanen haben folgende Männer die Prüfung bestanden: Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy, Gustav Rattay und
Gustav Deptolla. Unsere Uniformen waren alle zu klein und es gab viel zu lachen bei der Anprobe.
Die erste Übung habe ich mit Emil Rosowski, in Lenzinen gemacht. Der Gutsbesitzer Marzinzick hat seine Scheune als
Unterkunft zur Verfügung gestellt. Er war im Range eines Hauptfeldwebels. In seinem haus war die Schreibstube
untergebracht, die er selbst verwaltete. Ein Lastauto hatte Uniformen aus der Kaserne in Ortelsburg geholt, jeder
musste eine Uniform anlegen und dann wurde solange getauscht bis alle eine passende gefunden hatten. An den Namen des
Kompanieführers kann ich mich nicht mehr erinnern. 1935 wurden wir zu einer Übung in die Dragonerkaserne nach Lyk
einberufen. Die Gruppenführer, Zugführer, und Kompanieführer die schon Frontberührung im dem Ersten Weltkrieg hatten,
mussten eine Woche früher anreisen. Die Übungen waren auf 6 Wochen angelegt. Die meisten der einberufenen waren noch
nie mit dem Wehrdienst in Berührung gekommen. Jeder Gruppenführer bekam 13 Mann zugeteilt.
Unser Zugführer war Leutnant Neumann, Kompanieführer Oberleutnant Rutschko, Battalions-Kommandeur Major Gröning
(Regiment Buchholz). Hier ging es wieder Kasernenmäßig voran. Das Bataillon wurde hier vereidigt. Jeden zweiten
Sonntag durften unsere Frauen uns besuchen. Ein Jahr später wurden wir wieder zu einer Übung einberufen, auf den
Truppenübungsplatz nach Arys. Jeder Gruppenführer hatte den Auftrag die Gruppe zu entfalten, und auf bewegliche
Figuren zu schießen. Diese Übung musste später mit scharfer Munition wiederholt werden. Jedes Maschinengewehr bekam
50 Schuss, jeder Schütze 20 Schuss zugeteilt. Nach dem Abschießen wurden die Treffer gezählt und dem Kommandierenden
Bericht erstattet. In einiger Entfernung spaziert ein Storch umher, der gar nicht bemerkt hatte dass geschossen wurde,
was bei den Kameraden ein großes Gelächter hervorrief.
Nach der Übung wurde uns gesagt das jeder Gruppenführer eine arische Abstammung nachweisen sollte. Ich konnte in den
Rheinsweiner Kirchenbüchern meine Vorfahren aus Gellen, bis zum Jahr 1732 zurück, nachweisen und wurde zum
Unteroffizier befördert. Aus unserem Dorf wurden auch, Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy und Gustav Deptolla
befördert. Zwischendurch mussten wir schon mal in die Radfahrer-Kaserne nach Ortelsburg, Gewehre empfangen und im
Gelände üben. Am 31 Juli 1939 wurde mir von einem Soldaten ein Schreiben übereicht, das mich aufforderte, am 1. August
um 6:00 Uhr, bei der 3. Kompanie, des 2. Infanterieregiments zu erscheinen.
Um 5:30 hat mich meine Schwester in die Kaserne gebracht. Auf der Schreibstube erklärte mir der Hauptfeldwebel,
dass mir ab sofort der Dienstgrad eines Sanitäters zugewiesen wird, ich mich in der Kammer einzukleiden hätte und mir
in der Handwerkerstube die entsprechenden Schulterklappen annähen lassen sollte. Die aktiven Sanitäter wurden den
Feldlazaretten zugewiesen und wir kamen an ihre Stelle. Unser Bataillon wurde nach Schodmak zum Bunker bauen und
Stacheldraht verlegen eingeteilt. Wir zogen in Begleitung einer Musikkapelle bis zur Kreuzung am Krankenhaus, dann
weiter zu unserem Bestimmungsort, gefolgt von einer Gulaschkanone die in den nächsten Tagen für unsere Verpflegung
sorgen sollte.
Am 14 August haben wir die Jägerkaserne, begleitet von einer Musikkapelle endgültig verlassen und zogen zuerst durch
Ortelsburg, dann über Lehmanen ins Feldmanöver, hinter Rohmanen. Dort entfaltete sich das Bataillon im Gelände, die
Verwundetensammelstelle wurde auf dem Hof des Bauern Friedrich Neumann eingerichtet. Gegen Abend wurde zu Sammeln
geblasen und Biwak bezogen, wobei unsere 3.Kompanie, in einem kleinen Wallt, in der Nähe von Otto Nickels Gehöft
Stellung bezogen hatte. Die 2. und 4. Kompanie hatte sich in der Nähe vom Abbau Pallasch niedergelassen. Die Frau
Nickel hat am Abend ein Mädel in Dorf geschickt um meiner Frau Bescheid zu sagen, wo wir uns zurzeit befinden. Meine
Frau ist dann noch gekommen um sich von mir zu verabschieden, weil wir am nächsten Morgen um 3:00 Uhr Zelte abbrechen
und um 4:00 Uhr in Richtung Kaspersguth marschieren sollten.
Wir sind dann über Achodden, Seelonken, Lehmanen, Ortelsburg, bis nach Grammen und Schützendorf marschiert, wo wir an
einem See Biwak bezogen haben. Es wurde immer gesagt, wir kommen zum Tannenberg-Denkmal bei Hohenstein, wo ein Reichs
Kriegervereinsfest stattfinden sollte. Es wurden auch schon Vorkommandos aufgestellt, doch dann kamen wir nach Orlau
und Lahna-Mühle, da wo die Alle entspringt haben wir 2 Tage biwakiert. Unser Kompanieführer hat uns nach Waplitz auf
den Soldatenfriedhof des Ersten Weltkrieges geführt und uns erklärt wie das Jägerbataillon sich 1914 hier entfaltet
hat und aufgerieben wurde. Dann mussten wir in der Nähe von Gut Koslau über einen Fluss und bezogen in einem Waldstück,
vorbereitete Stellungen in der Nähe der polnischen Grenze. Herr und Frau Thalmann haben uns jeden Tag, bis zur Grenze,
mit Brötchen und Getränken versorgt. Es wurde scharfe Munition ausgegeben, weil wir am nächsten Morgen um 4:00 Uhr die
polnische Grenze überschreiten sollten.
Am nächsten Morgen um 10 Minuten vor 4:00 Uhr kam der Befehl; scharfe Munition abgeben, alles zurück in ein 6 Kilometer
entferntes Dorf, wo wir auch einquartiert wurden. Das alles geschah’ eine Woche vor dem 1. September 1939. Es wurde
gesagt dass der Führer dem polnischen Präsidenten Rid-Szmigly, ein Ultimatum gestellt hat und es wahrscheinlich nicht
zum Krieg mit Polen kommt. Genau nach 5 Tagen kehrten wir wieder in die gleichen Stellungen zurück, es wurde wieder
scharfe Munition ausgegeben und am nächsten Morgen um 4:00 Uhr überschritten wir die polnische Grenze.
“Der 2. Weltkrieg.”
Der erste Einsatz in Polen
Wir kamen zuerst in ein Dorf in dem sich nur alte Menschen befanden. Auf unsere Frage wo denn die Bewohner wären sagte
man uns dass alle geflohen sind, weil erzählt wurde, die Deutschen würden alle Polen misshandeln und verstümmeln. Ich
habe ihnen daraufhin gesagt dass uns, unter Androhung von Strafe verboten wurde, einem Zivilisten etwas anzutun. Das
Vieh, die Schweine und Hunde des Dorfes liefen frei herum und die Soldaten fingen an auf die Hunde zu schießen, bis
gesagt wurde es seien Meldehunde im Dienste der Deutschen Wehrmacht und dieser Unfug der eigenen Truppe schaden würde,
weil etwaige Querschläger eigene Kameraden verletzen könnten. Wir gingen weiter auf polnischer Seite entlang der Grenze,
bis wir am Nachmittag die ersten Vorposten der Festung Mlawa erreichten, da befanden wir uns plötzlich im Feuerhagel
polnischer Festungsflack.
Am nächsten Morgen hatte ich schon 3 Verwundete und wusste nicht wo sich eine Verwundeten Sammelstelle befindet. Ich
suchte den Bataillonsgefechtstand auf der sich auf einer Anhöhe befand. Ich habe unseren Oberstabsarzt gefragt wo denn
die Verwundetensammelstelle wäre. Er rief beim Tross an, wo er die Auskunft erhielt, das sich vor dem Dorf ein Bunker
befindet in dem man die Verwundeten sammeln sollte, die dann von Sanitätsautos abgeholt würden, weil das Dorf unter
Artilleriebeschuss stand. Am Sonnabend haben unsere Flieger die Bunkerstellungen bombardiert, konnten aber, trotz guter
Treffer nicht viel ausrichten, die Bunker wurden nur etwas angekratzt.
Der Beschuss unserer vordersten Linien ging mit unverminderter Heftigkeit weiter. Am Sonntag verkündete eine große
Staubwolke die Ankunft unserer Panzer, doch sie kamen nur bis zur Panzersperre und mussten wieder abdrehen ohne den
Polen einen schaden zuzufügen. Ein Panzer bekam einen Volltreffer, der Fahrer konnte noch umkehren. Er blutete am Kopf
und der Schütze war so eingeklemmt, das wir ihn nur mit einem Seil unter den Armen, durch die Luke nach oben ziehen
konnten. Ob er seine Verwundung überlebt hat ist mir nicht bekannt, denn in der Nacht wurden Panzergeschütze nach
vorne in Stellung gebracht, die direkt in die Schießscharten der Bunker geschossen und so die Verteidiger vertrieben
haben. Daraufhin sind wir weiter vorgerückt. Auf einer Wiese war ein tiefer Graben ausgehoben und mit Ästen getarnt,
da war ein Panzer hinein gefahren, so dass nur das Hinterteil herausragte und er sich nicht aus eigner Kraft befreien
konnte. In der Luft waren Flieger die Brandbomben abwarfen, ich habe mich auf den Boden geworfen weil ich dachte die
würden explodieren, aber sie zischten nur, so das Stoppeln und Graß rings herum in Brand gerieten.
Bei den Kampfhandlungen gab es mehrere Verwundete, denen ich gerade Verbände anlegen wollte, als unser Hauptmann zur
Trillerpfeife griff um mir klar zu machen, dass ich ihm folgen sollte. Die Polen fingen an zu schreien, ich sollte
sie ins Lazarett bringen denn hier im Wald würde sie niemand finden. Ich setzte mich aufs Fahrrad und folgte unserem
Kompanieführer, der mir sagte ich soll immer bei der kämpfenden Truppe bleiben, denn hinter der Front sind die
Sanitätsabteilungen, die werden die Verwundeten schon versorgen. Der Vormarsch dauerte bis in die späte Nacht. Auf
einem Gehöft, das nach allen Seiten durch Feldwachen abgesichert wurde, machten wir endlich Rast. Wir haben
Getreidegarben auf dem Hof ausgebreitet und uns zur Ruhe gelegt, als plötzlich um Mitternacht Leuchtraketen den Himmel
erhellten und Maschinengewehrfeuer uns aus dem Schlaf schreckte. Ein par polnische Soldaten hatten das Feuer eröffnet,
aber sich kurz darauf ergeben.
Die Narew-Überquerung
Als es hell wurde ging der Vormarsch weiter. Es wurde uns untersagt Tagebuch zu führen, darum
weiß ich nicht wie die Orte hießen, durch die wir marschiert sind. Als wir durch ein sumpfiges Gelände vor drangen
stand auf einer Anhöhe am Horizont, die polnische Artillerie, die uns sofort unter Beschuss nahm. Unser Hauptmann war
der Meinung dass wir schon in der Nähe des Flusses Narew sein müssten, als aus den Sträuchern ein mit Schlauchboten
beladenes Lastauto auftauchte. Wir wurden aufgefordert mit je 6 Mann ein Schlauchboot zu nehmen, an einem Aggregat
der daneben stand mit Luft zu füllen und zu Wasser zu lassen. In einer Stunde war das ganze Bataillon über die Narew,
wo der Vormarsch fortgesetzt wurde. In einem Dorf überraschte uns die polnische Kavallerie und fing sofort mit
Maschinengewehren zu schießen an. Da kam der Befehl: Alles wieder zurück. Es ging noch schneller als auf der Hinfahrt.
Wir sind erst einige Kilometer am Fluss entlang gegangen und haben dann zum zweiten Mal rüber gesetzt.
Die Gehöfte im Dorf standen alle in Brand. Auf einem waren viele Bienestöcke. 2 Kameraden wollten den Stöcken Waben
entnehmen, doch die Bienen durch das Feuer aufgeschreckt, überfielen sie sofort und stachen derart zu das sie nicht
mehr wieder zu erkennen waren. Ich habe die Einstichstellen mit Salmiak betupft, mehr konnte ich nicht tun. Wir mussten
auf unserem Vormarsch durch einen Wald der in Flammen stand, so dass man kaum atmen konnte. Es ging weiter in Richtung
Minsk und Warschau, wo schon die Sowjetische Armee durchgegangen war, die Pferde und Vieh von einem Gut mitgenommen
hatten. In einem Wald stießen wir unverhofft auf ein Kloster, in dem wir einige Gefangene machten. Dann trafen wir auf
eine gute Straße die nach Grochow ging.
Als wir dort einmarschierten wurden wir aus den oberen Stockwerken beschossen, so dass wir, um uns zu schützen, nur an
den Hauswänden entlang gehen konnten. Wir haben jedes Haus nach Feinden durchsucht. Vor einem Haus stand ein Hund der
niemanden reinlassen wollte, solange bis ihn eine Kugel traf. Die polnische Artillerie feuerte von Warschau aus, um
unseren Vormarsch zu stoppen. Wir hatten uns gerade eingegraben als plötzlich deutsche Flieger am Himmel erschienen,
die unsere Stellungen mit Bomben bewarfen und dabei viel Unheil anrichteten. Wir haben sofort Fliegertücher
ausgebreitet und Leuchtraketen abgeschossen. Da ich in dem Graben, den ich kurz zuvor ausgehoben hatte, sofort in
Deckung gegangen bin ist mir zum Glück nichts passiert. Unter den anderen Kameraden gab es viele Verwundete, so dass
ich nicht wusste wem ich zuerst helfen sollte.
Der Oberstabsarzt hat mich sofort tatkräftig unterstützt, so das bald alle Verwundeten versorgt waren, außer einem,
dem ein Bombensplitter den Arm abgerissen hat. Ich habe im 3 große Verbandspäckchen auf die Wunde gelegt, doch die
Blutung ließ sich trotzdem nicht stoppen, so dass er eine Stunde später auf der Krankensammelstelle verstarb. Wir
haben danach in einem Tomatenfeld einen Graben ausgehoben und eine neue Abwehrstellung bezogen. Die Gruppe Schwarz
bekam den Auftrag nach etwaigen versprengten polnischen Verbänden Ausschau zu halten, als sie unerwartet aus einer
Häuserreihe mit Maschinengewehrsalven überschüttet wurden. Der Gruppenführer und noch ein Soldat wurden dabei tödlich
verwundet. Danach wurde noch ein weiter Stoßtrupp, unter der Führung von Leutnant Briskorn, der sich dazu freiwillig
gemeldet hatte, hinaus geschickt um den Gruppenführer und den anderen Toten zu bergen.
Bei diesem Unternehmen, das erfolglos ausging, weil die Toten schon verscharrt waren, durchschlug eine Kugel den
Stahlhelm von Leutnant Briskorn, der auch sofort tot war. Alle Toten wurden später, an der Kirchenmauer in Grochow, in
Särgen beigesetzt: Hauptmann Schönwald sagte, das sie nach dem Kriege auf den Heldenfriedhof nach Ortelsburg überführt
werden. Drei Tage lagen wir bei Grochow in Stellungen, waren dem polnischen Maschinengewehrfeuer sowie den Bomben
deutscher Flugzeuge ausgesetzt. In der Nacht musste ich zu einem Verwundeten in die vorderste Linie und habe den
Rückweg nicht mehr finden können, als plötzlich Gewehrfeuer aufflammte habe ich in den Ruinen Schutz gesucht. Erst im
Morgengrauen konnte ich mich wieder orientieren und zu meinem Unterstand zurückfinden.
Warschau wurde tagelang bombardiert und stand auch unter Artilleriebeschuss. Aus dunklen Rauchwolken kamen oft ganze
Bündel von Papier angeflogen. Die Verwundeten kamen oft auf Krücken zu unserem Unterstand, ich habe sie dann zur
Krankensammelstelle hingeführt. Wir haben auch polnische Zivilpersonen betreut, die während der Kampfhandlungen
verwundet wurden. Als einmal 2 Jungen vorbeiliefen hat einer ihnen nachgerufen sie sollten seiner Frau Bescheid sagen,
er wäre auf der Krankensammelstelle an der Kirche. Als wir dort ankamen war seine Frau, mit einem Kind auf dem Arm,
schon da.
Nach der Kapitulation von Warschau, gingen wir über Sokolow zum Bug und haben dort Quartier bezogen. Der Russe hatte
sich bereits hinter den Fluss zurückgezogen, hatte alles Vieh und Pferde mitgenommen. Dort erreichte mich ein Telegramm
von zu Hause, dass meine Tochter gestorben ist. Es sprach sich auch herum dass verschiedene Heimaturlaub bekommen haben,
ich durfte auch für 14 Tage heim. Wir fuhren mit Lastautos nach Allenstein in die neue Reiterkaserne, zum
Ersatzbatallion, da haben wir unsere Gewehre und Munition abgeben, dann durften wir, jeder in seinen Heimatort
weiterfahren.
Als wir unsere Quartiere am Bug verlassen haben war sehr viel Schnee gefallen. Hier in Ortelsburg fanden wir die
gleiche Wetterlage vor, aber nach 3 Tagen war alles wieder weggetaut und wir konnten die Kartoffelernte, die durch den
frühen Wintereinbruch gestoppt wurde, zu Ende bringen. Ein Tag bevor ich zu Hause angekommen bin wurde die Tochter
beerdigt. Nach 14 Tagen mussten wir uns in Allenstein melden, Gewehre empfangen und wieder zurück zur Division an den
Bug 150 Kilometer hinter Warschau. Die elfte Division, zu der wir auch gehörten sollte in den Westen Deutschlands
verlegt werden und war schon unterwegs zur Verladestation Skiernewice 50 Kilometer vor Warschau.
Mein Dienst als Sanitätsunteroffizier
Unser Bataillon kam in das Städtchen Burscheid, im Kreis Opladen, wo wir in Privatquartieren
untergebracht wurden. Nach 3 Monaten, im Januar 1940, wurden wir nach Solingen verlegt, wo wir bis zum
Frankreichfeldzug stationiert waren. Wir mussten an Feldübungen teilnehmen, wie andere die in Kasernen untergebracht
waren. Während dieser Zeit musste jeder seine Zähne in Ordnung bringen lassen. Jeden Tag fuhren 20 Mann in die
Cäzilienstraße nach Köln, zur Zahnklinik. Im Rheinland wurde unsere Division neu aufgestellt. Ausfälle durch den
Polenfeldzug wurden durch neue Soldaten ergänzt. Ich kam nun zum Ersatzbatallion, war der Älteste in der ganzen
Kompanie. Als der Frankreichfeldzug losging wurde unser Ersatzbatallion mit den noch vorhandenen Verwundeten, in die
neue Reiterkaserne, nach Allenstein verlegt.
Meine Frau hat, mit Unterstützung der Bauernschaft, einen Antrag gestellt, daraufhin wurde ich zur Frühjahrsbestellung,
beurlaubt und später bis auf weiteres vom Militärdienst freigestellt. Als der Russlandfeldzug losging wurde ich von der
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg, für 14 Tage einberufen. Ich war seit 1922, Mitglied der freiwilligen
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg und habe jedes Jahr an Übungen teilgenommen. Jede Bereitschaft musste etliche Leute
stellen. Von Rohmanen wurden Emil Rosowski, Johann Dembek, und ich, zur Krankensammelstelle Wirballen, in Litauen,
abkommandiert. Dorthin kamen Lazarettzüge aus Russland mit der Breitspurbahn. Die Verwundeten wurden frisch verbunden
und auf Waggon mit Normalspur verladen und nach Deutschland gebracht.
Als die 14 Tage vergangen waren wollten wir wieder nach Haus zurück, doch man wollte uns nicht entlassen. Stattdessen
wurden wir dem Wehrkreisamt Königsberg zugeteilt, neu eingekleidet und zur Aushilfe ins Lazarett nach Gumbinnen
abkommandiert. Mehr als ein Jahr war ich in den Urlauber-Baracken, habe dort Krankenstube betreut. Später, bis zum
Dezember 1944, war ich im Reserve-Lazarett 4, in Königsberg tätig. Dort habe ich auch die Luftangriffe der Engländer,
vom 25 bis 26. August 1944 miterlebt.
Wir sollten gerade einen Lazarettzug in Rotenstein entladen, als plötzlich die Sirenen ertönten - Fliegeralarm. Im
gleichen Moment waren die ersten Flugzeuge auch schon da, zuerst warfen sie „Tannenbäume” und danach Foßforkanister ab.
Die Omnibusse standen schon zur Abfahrt bereit als es losging. Wir haben die Verwundeten schnell in den
Luftschutzkeller getragen, haben die Betten von den Fenstern weggerückt damit die Verwundeten nicht von den
Glasssplittern verletzt wurden. Im Kasernenhof brannten die Fosforkanister lichterloh. Unsere Unterkunft, die sich in
einer Baracke befand ist völlig abgebrannt, mit dem Wenigen was wir unser Eigen nannten. Am nächsten Tag wurden wir neu
eingekleidet und am 29. bis 30. kamen die englischen Bomber wieder, sie setzten genau da ihr Zerstörungswerk fort wo
sie vor 3 Tagen aufgehört hatten.
Anfang Dezember 1944 musste ich mich nach Stablack melden und musste dann zur Sanitätsabteilung 1, nach Gernau, das
liegt zwischen Lodz und Warschau. Vormittags hatten wir Felddienstübungen und nachmittags theoretischen Unterricht.
Jeden Tag wurden Gruppen zusammengestellt und zu anderen Einheiten abkommandiert. Ich kam zu einer Panzerabteilung, wo
wir an einem Morgen plötzlich auf dem Kasernenhof antreten mussten und zu unserer Überraschung mit der Nachricht
konfrontiert wurden, dass der Russe an mehreren Frontabschnitten durchgebrochen war. Wir bekamen sofort einen
Marschbefehl in Richtung Lodz, wo das Stadtbild noch intakt war, selbst die Straßenbahnen fuhren noch. In der Nacht
haben russische Flugzeuge die Stadt bombardiert. Die Kaserne in der wir untergebracht waren hatte keine
Luftschutzkeller, aber zum Glück blieben wir von Bombentreffern verschont. Am nächsten morgen bot sich uns ein Bild der
Verwüstung. Die entgleisten Straßenbahnwagen, sowie andere Fahrzeuge blockierten die Straßen. Die Älteren unter uns
bekamen Fahrscheine für einen Transportzug, der bereit hinter Lodz abfahrbereit, unter Dampf stehen sollte. Als
russische Panzer in den Straßen auftauchten, verbrannte die Schreibstube unsere Wehrpässe und andere wichtige
Dokumente. Wir liefen zu der Station auf der unser Transportzug bereitstehen sollte, aber da war kein Zug mehr zu sehen
und wir setzten unseren Rückzug zu Fuß fort.
Der Rückzug und Zusammenbruch der Ostfront
In Dobroschin, einer Stadt in Polen, wurde gerade ein Lazarettzug verladen, doch wir kamen nicht
mehr zum Einsatz, weil die russische Infanterie uns schon auf den Fersen war. Es ging weiter über den Fluss Bober,
Sagan, bis nach Glogau an der Oder. Dort wurden wir der 29. motorisierten Sanitätskompanie zugeteilt. Im
Garnisonslazarett wurden noch Operationen durchgeführt. Unsere Division hatte ihr eigenes Feldlazarett, so dass wir den
Befehl zu Weiterfahrt erhielten und noch unbeschadet die Oderbrücke passieren konnten, denn Glogau wurde zur Festung
erklärt. Wir haben 2 Pferdewagen organisiert und mit Verbänden, sowie medizinischen Instrumenten beladen. So kamen wir
bis nach Lübbenau im Spreewald, wo wir in einem Schloss, in zuvor ein Museum war, unser Lazarett untergebracht haben.
Weil die Amerikaner Cottbus bombardiert hatten, wurden die Verwundeten zu uns nach Lübbenau gebracht. Hier haben wir
Tag und Nacht gearbeitet, um die vielen Verwundeten, aus den schweren Kämpfen bei Grünberg und Sagan zu versorgen. Die
Soldaten von der Abwehrfront kamen schon mit abgestorbenen Armen oder Beinen bei uns an, weil in vorderster Linie keine
Frontlazarette mehr vorhanden waren; es mussten viele Amputationen durchgeführt werden. Als für unsere Pferde kein Heu
mehr vorhanden war, schickte mich unser Hauptfeldwebel, zu einem Bauern in den Spreewald, mit dem Auftrag, Futter zu
besorgen. Mit noch zwei Mann fuhren mit zwei Kähnen, zuerst den Hauptstrom entlang und dann in einen Nebenarm; da haben
wir die Boote beladen und brachten das Heu nach Lübbenau.
Als wir uns bei unser Einheit zurück melden wollten, war alles schon marschbereit. Ich bin schnell in einen Bus
eingestiegen der sofort losfuhr, weil russische Verbände schon in sichtweite waren. Russische Flugzeuge kreisten über
den Dächern und nahmen, mit ihren Bordwaffen jeden unter Beschuss, der sich irgendwo blicken ließ. Wir konnten nur
durch den Wald, oder in der Nacht vorwärts kommen, denn wenn ein Auto auf der Landstraße fuhr, war alsbald ein Flugzeug
hinter ihm her und schoss es in Brand. Als wir nach Tagen am Ufer der Elbe ankamen, war bereits eine Ponton-Brücke
erstellt worden, welche die zerstörte Brücke ersetzen sollte.
Durch die vielen Fahrzeuge waren in den Sand tiefe Spuren gefahren, so dass andere Fahrzeuge unsere Busse ins
Schlepptau nehmen mussten, weil wir mit eigener Kraft nicht mehr weiterkamen. Beiderseits der Trasse standen
Flüchtlingswagen, in der der Hoffnung die Brücke passieren zu können, doch SS-Polizei verhinderte das die Gespanne den
militärischen Rückzug zum Stillstand brachten. Es gelang uns die Elbe zu überqueren, um in einem Waldstück Schutz vor
feindlichen Fliegern zu suchen.
Als wir unsere Busse und Autos gut getarnt hatten, hat unser Bataillonschef die anwesenden Parteigrößen zu sich
gerufen und ihnen erklärt das wir eine Einheit des Roten Kreuzes sind und nach internationalem Recht keine Waffen
besitzen dürfen. Nach langer, erregter Diskussion wurde beschlossen einen Graben auszuheben und alles im Sand zu
verscharren. Als wir dann weiter, durch die Dörfer fuhren, sahen wir schon viele weiße Bettlaken, als Zeichen der
Kapitulation, aus den Fenstern hängen. Es wurde uns erzählt dass der Bürgermeister von der SS erschossen wurde, weil
er die Bevölkerung zu diesem Schritt ermutigt hatte. Jetzt waren hinter uns die Russen und vor uns schon die Amerikaner.
Amerikanische Panzer fuhren umher und schossen wild durch die Gegend, ohne ein Ziel anzuvisieren. Niemand wollte sich
dem Russen ergeben, doch der Weg der zu den Amerikanern führte, war durch abgesägte Bäume blockiert. Wir sind schnell
in das nächste Dorf gegangen, haben uns Sägen und Äxte besorgt, die Bäume durchgesägt und in den Straßengraben
geworfen.
“ Nach dem Ende des 2. Weltkrieges.”
In amerikanische Kriegsgefangenschaft
Dann fuhren wir unter internationaler Flagge an eine Mulde Brücke, vor der zwei amerikanische Soldaten, mit Zigarren,
zur Hälfte im Mund, standen. Sie rauchten und kauten gleichzeitig. Wir mussten auf einen freien Platz fahren, alle
aussteigen und rechts wieder antreten. Wäschebeutel und Tornister mussten wir abstellen; danach wurden wir nach Waffen
durchsucht, Wertsachen, Uhren und Messer wurden uns gleich abgenommen. Als wir anschließend an unserem Gepäck
vorbeigingen durfte niemand was mitnehmen. Als ich gebückt, nach meinem Wäschebeutel greifen wollte, in dem sich noch
3 Konservendosen und ein Brot befanden, bekam ich einen Fußtritt ins Gesicht, so dass mir ein Zahn ausgeschlagen wurde.
Wir wurden dann in einem Garten zusammen getrieben und gefragt ob jemand bei der SS gedient hat. Nachdem wir in Reihe
und Glied angetreten waren, mussten wir den Oberkörper freimachen und die Arme anheben. Es wurde nach SS-Zeichen
gesucht, die gewöhnlich unter dem Oberarm eintätowiert waren. Nachdem wir Grimma bei Leipzig, wo wir in amerikanische
Gefangenschaft geraten waren, verlassen hatten, mussten wir durch ganz Thüringen bis Hersfeld, an der Grenze zu Hessen,
marschieren. In Hersfeld wurden wir auf große Lastautos verladen, die von farbigen Soldaten gefahren wurden. Man hat
uns mit Stöcken hinauf getrieben, solange bis das Auto so voll war das man kaum stehen konnte. Die Soldaten fuhren, für
diese Straßenverhältnisse, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Wenn die Straße eine scharfe Kurve hatte, flogen
wir alle übereinander und mussten erst mit viel Kraftanstrengung auf die Beine kommen um diese Fahrt zu überstehen.
Da die Straßenränder in dieser Gegend mit Obstbäumen bepflanzt sind und deren Äste sehr niedrig hängen, hätten die
uns die Köpfe abgerissen, wenn wir uns nicht ständig geduckt hätten. Unsere Fahrt endete in Bad Kreuznach, in der Pfalz,
wo wir in ein Lager, in dem sich später 130.000 Mann und 6 Generäle befanden, eingepfercht wurden. Die Unterkunft der
Generäle befand sich unter einem Zelt, alle anderen mussten die Zeit unter freiem Himmel zubringen. Die Offiziere, die
Unteroffiziere, die Mannschaften; wurden in getrennten Camps untergebracht. Die Mannschaften wurden auch zur Arbeit
abkommandiert und konnten bei dieser Gelegenheit, Brot, Brötchen oder Zigarettenstummel organisieren, wogegen die
Offiziere und Unteroffiziere ihr Camp überhaupt nicht verlassen durften.
Die ersten Tage gab es kein Wasser und kein Brot, so dass die Kameraden vor Erschöpfung umfielen. Später standen wir
manchmal den ganzen Tag nach Wasser an, das von den, uns bewachenden Negern mit großen Wassertanks angefahren wurde. Am
dritten Tag bekamen wir mittags und abends etwas zu Essen; Brot bekamen wir erst nach zwei Wochen, nach dem aus der
Umgebung herbeigeholte Handwerker, Backöfen gebaut hatten. In den verschiedenen Gemeinden, die in den uns umgebenden
Weinbergen lagen, mussten sich alle Männer beim Bürgermeister melden. Als sie dann erschienen waren, wurden sie auf
bereitstehende Lastautos getrieben und zu uns ins Lager gebracht. Sie waren ohne Kopfbedeckung und ohne wärmere
Bekleidung angekommen, weil ihnen gesagt wurde, dass ihr Aufenthalt im Lager nur von kurzer Dauer sein würde. Man hat
uns, falls noch vorhanden, Decken und Mäntel abgenommen, mit der Begründung, sie würden für Kranke und Verwundete
gebraucht. Jeden Tag starben mehr als 200 Mann, die wir sofort in ein Zelt tragen mussten. In der Nacht wurden die
Toten dann mit unbekanntem Ziel, weggefahren.
Viele haben ihren Verstand verloren uns irrten im ganzen Camp ziellos umher. Als Latrinen wurden Gräben ausgehoben, in
die verschiedene Kameraden, bei der Verrichtung ihrer Notdurft, vor Schwäche hineingefallen sind und nicht mehr wieder
heraus kamen. Aus den Pfählen die, die jungen Obstbäume stützten, haben wir Krankentragen gebaut um unsere Kameraden,
bei Bedarf, zur Krankensammelstelle zu tragen. Es war in diesem Frühjahr auch sehr kalt, doch unsere Erdlöcher, die wir
zum Schutz vor Kälte und Wind, nur mit leeren Konservendosen ausgehoben hatten, durften nicht tiefer als 20 Zentimeter
sein. Nach jedem Regenguss mussten wir das Wasser ausschöpfen. Nach einem Gewitter, standen wir wiedermal, total
durchnässt in unserem Camp, als unerwartet am Horizont die Sonne hervortrat. Einer unserer Kameraden hatte noch eine
Trompete gerettet und fing, von dem Anblick völlig überwältigt, zu spielen an: "Es geht alles vorüber, es geht alles
vorbei, nach jedem Dezember, folgt wieder ein Mai". Daraufhin hob sich die Stimmung der tiefbetrübten Kriegsgefangenen,
so das Heimatlieder durch das ganze Camp erklangen, obwohl wir in den nassen Kleider herumgehen mussten, bis sie am
Körper trocken wurden.
In französischer Kriegsgefangenschaft
Nach etwa einem Monat, haben uns die Amerikaner, den Franzosen, zum Arbeitseinsatz, ausgeliefert.
Etwa 4 Kilometer von Bad Kreuznach entfernt, stand auf freier Strecke, ein Zug mit offenen Kohlenloren, auf den wir
verladen wurden. In jeden Waggon, wurde pro Person eine Tafel Schokolade und ein Päcken Zwieback rein geworfen, doch
viele Kameraden fanden nur leere Päckchen vor, weil die schon zuvor von der französischen Wachmannschaft geplündert
wurden. Wir haben uns darüber beschwert, doch die haben uns nur ausgelacht. Nachdem wir zunächst bei Mainz über den
Rhein fuhren, endete unsere Fahrt bei Paris in einem großen Zeltlager. Dort wurden wir auf andere Züge verladen, die uns
nach Südfrankreich, in ein Barackenlager, bei Mazarei, brachten.
Auf einer Zwischenstation hat man uns unter einer Pumpe, die Lokomotiven mit Wasser versorgt, abgestellt, den Kran
aufgedreht und uns anschließend ausgelacht, die Kinder Haben uns mit Steinen beworfen. Ein Wachmann kam in unseren
Waggon gekommen, hat unser Gepäck durchsucht, wenn er Tabak oder Zigaretten gefunden hat, nahm er sie mit. Die Kameraden
waren darüber so empört, dass sie vorhatten, ihn nachts unter den Waggon zu werfen. Wir haben sie gebeten dass zu
unterlassen, weil man uns in diesem Falle, alle erschießen würde.
Als wir ins Lager kamen wurden wir zuerst gezählt, dann mussten wir unser Gepäck stehen lassen und beiseite treten.
Wenn man bei der Nachkontrolle noch was in den Taschen fand, wurde das auch entwendet, selbst Esslöffel. Wir wurden
dann in drei Baracken, ohne Toiletten, eingeschlossen. Die Kameraden haben ihre Bedürfnisse in Kochgeschirre erledigt
und durch ein kleines Fenster, das sich fast unter der Decke befand, hinausgeworfen. Andere Fenster ließen sich nicht
öffnen, weil sie mit Stacheldraht zu geflochten waren. Als die Kameraden die Kochgeschirre auskippten, haben die
Wachposten geschossen und die Fenster zertrümmert. Sie waren der Meinung dass wir ausbrechen wollten. Es herrschte eine
große Hitze, in den überfüllten Baracken sind wir fast erstickt. Am nächsten Tag haben wir uns über fehlende Toilettem
beschwert, da haben sie Heringsfässer durch die Hälfte geschnitten und an der Ausgangstür hingestellt. Um bei den
überfüllten Räumen dort hinzukommen, musste man über die Köpfe der Anderen steigen. Viele hatten Fieber und Durchfall
und mussten in die Krankenstube eingeliefert werden, wo sie kurz darauf verstarben.
Besonders Raucher litten sehr an der Unterernährung, bekamen Wasser in den Beinen und waren die Ersten die verstarben.
Nach der Registrierung wurden wir auf andere Baracken verteilt. Die Zivilbevölkerung kam in die Räume und begann uns
auszuplündern. Wer noch gute Schuhe besaß musste sie ausziehen und bekam dafür die kaputten des Plünderers. Eine Woche
lang mussten wir diesen Zustand ertragen, erst als die Kameraden sich beschwerten, wurde am Eingang eine Tafel am
Eingang angebracht, dass die Zivilbevölkerung das Lager nicht betreten darf. Bis auf einige, wenige Ausnahmen wurde
diese Anweisung befolgt.
Als wir im Lager ankamen, war der französische Lagerkommandant, ein ehemaliger Kriegsgefangener, der bei einem Bauern
in Deutschland gearbeitet hatte. Dieser Bauer war jetzt als Kriegsgefangener in seinem Lager. Als er ihn erkannte, hat
er ihn gleich zum Küchendienst eingeteilt und mit dem nächsten Krankentransport nach Hause fahren lassen. Zu Mittag
bekamen wir nur gekochte Haferkörner, da schwamm alles oben, später war man dann auf Gerste umgestiegen. Als viele
daran gestorben waren, weil sie diese „Rohkost”, die nur ein Kuhmagen verträgt, nicht gegessen haben, hat man die
Körner durch eine Schrotmühle laufen lassen. Dann hat man uns Steckrüben gekocht; wir bekamen 250 Gramm Weißbrot,
etwas Quark und ein viertel Liter Magermilch. Später, als wir schon arbeiten mussten, hat man in unserem Essen einen
Kuhkopf mitgekocht, das hat dann bedeutend besser geschmeckt.
Bevor wir morgens zur Arbeit gingen, mussten wir zu Flaggenparade und abends, nach der Rückkehr, haben wir die Flagge
wieder eingeholt. Wir haben einen Kanal gereinigt, dessen Sohle 2 Meter dick mit Schlamm bedeckt war. Zuerst wurde das
Wasser abgelassen, dann haben wir, einer dem andern, den Schlamm mit der Schippe hoch gereicht. Der Letzte hat den
Schlamm, der so zäh war, dass er nicht von der Schippe wollte, oben am Rande abgelegt. Manchmal waren 10 Mann nötig um
den Höhenunterschied zu überwinden. Das Wachpersonal schoss über unsere Köpfe hinweg und rief: „schnell arbeiten”. Bei
der großen Hitze war das ein Ding der Unmöglichkeit, zumal es nichts zu Trinken gab. Auf dem Heimweg haben wir im Walde
Heilkräuter gesammelt, die man in der Küche getrocknet und als Tee zubereitet hat, den wir am nächsten tag zur Arbeit
mitnahmen, um unseren Durst zu stillen.
Unser Aufseher hatte einen Stock, an dem sich noch kurz abgeschnittene Äste befanden. Wer seiner Meinung nach, nicht
ordentlich gearbeitet hat, bekam gleich Schläge auf den Rücken. Die weißen Aufseher wurden irgendwann durch Neger
ersetzt, die uns bedeutend besser behandelt haben. Wenn irgendetwas schief ging, haben sie nichts gesagt, nur gelacht.
In den übrig gebliebenen Wassertümpeln hatten sich noch einige Aale versteckt, die wir zu fangen versuchten, was uns
auch manchmal gelang. Wir mussten ihnen das Genick brechen, damit sie uns nicht entwischen konnten. Wenn die Franzosen
bemerkten das wir Aale hatten, wurden sie uns abgenommen. Gelang es uns aber, sie ins Lager zu bringen, dann haben wir
uns eine köstliche Malzeit zubereitet.
Um sicherzustellen dass niemand geflüchtet ist, wurden wir, wenn wir abends ins Lager zurückkamen, zuerst gezählt.
Diese Zählung wurde mehrmals wiederholt, weil die Wachmannschaften sich immer wieder verzählt haben. Als einer von uns
hin ging, ihnen sagte dass alle da sind, wollten sie es nicht glauben und haben uns vor dem stehen lassen, bis es ihnen
irgendwann einfiel. uns doch das Tor zuöffnen. Einmal, als wir von der Arbeit zurückgekehrt waren, standen wir bis 23
Uhr neben der Flagge, weil uns niemand das Tor geöffnet hat. Als wir dann doch irgendwie ins Lager kamen haben wir
festgestellt, dass das ganze Wachpersonal betrunken war und niemand im Stande uns das Tor zu öffnen.
Eines Tages waren wir wieder abends zur Parole angetreten, als ein älterer Herr mit seinem Hund, am Stacheldraht
entlang, spazieren ging. Weil der Hund, unterm Stacheldraht hindurch, zu uns kam, hat ihn einer geschnappt, ihm das
Genick gebrochen und unter seiner Jacke versteckt. Der Franzose hat nach seinem Hund gerufen und gepfiffen, aber alles
vergebens, der Hund war nicht aufzufinden. Die Kameraden haben ihm gleich das Fell über die Ohren gezogen, das Fleisch
gekocht und das Fell in die Latrine geworfen. Das Fleisch wurde umgehend verspeist.
Als wir am nächsten Tag von der Arbeit zurückkehrten, war im Lager der Teufel los. Wir mussten sofort antreten und
wurden gefragt, wo der Hund geblieben ist, der Gestern Abend, mit seinem Herrchen, am Zaun entlang spazieren ging. Als
sich niemand dazu bekannte, mussten wir weiterhin stehen bleiben, während die Wachmannschaften von Baracke zu Baracke
gingen und alles durchsuchten. In einer Latrine hat man dann das Fell gefunden, was uns ein furchtbares „Donnerwetter”
einbrachte und in den nächsten Tagen, nach der Arbeit, unter dem Kommando eines Oberfeldwebels, eine Stunde
nachexerzieren.
In Südfrankreich regnet es den ganzen Sommer nicht; die Bauern haben da keine Scheunen und das Getreide wir nur in
Schobern aufgestellt und dann umgehend gedroschen. Vom Oktober bis Dezember regnete es fasst jeden Tag in Strömen.
Gesät wird nur im Frühjahr und im Herbst, weil im Sommer alles vertrocknet. Es wird viel Wein angebaut und die
Steckrübe wächst den ganzen Winter. Neben den Weinreben wurde aus Schieferplatten ein Zaun aufgestellt, um dem Wein
einen optimalen Standort zu sichern. Die Bauernwagen hatten nur zwei Räder und waren nur mit einem Pferd bespannt, das
die ganze Balance des Wagens zu halten hatte. Trotzdem haben sie soviel aufgeladen wie wir auf einen Leiterwagen. Viele
Kameraden wurden den Bauern zur Arbeit ausgeliehen. Wenn ein Bauer einen Arbeiter gebraucht hat und es wurde gefragt,
wer sich in der Landwirtschaft auskennt, da haben sich alle gemeldet. Der Bauer konnte sich dann aussuchen, wen er
mitnehmen wollte.
Wenn wir durch die Stadt zur Arbeit gingen, haben verschiedene Leute Fallobst in die Abfalleimer gelegt. Wenn das von
den Kameraden bemerkt wurde, schwenkten viele aus der Reihe, um sich etwas mit zunehmen, was von den Wachmannschaften
nicht gern gesehen wurde. Viele Kriegsgefangene hatten keine Schuhe mehr, sie haben die Füße nur mit Lumpen bewickelt.
Eines Tages kamen Kameraden aus Norwegen, die nach Deutschland entlassen werden sollten. Mann hat sie jedoch ins Lager
gesteckt und zur Arbeit eingeteilt. In Norwegen hatten sie Kleider und Stoffe eingekauft, hatten volle Seesäcke und
sogar Karren auf 2 Rädern, weil sie ja in die Heimat entlassen werden sollten. Als wir morgens zur Arbeit rausgeführt
wurden standen sie schon vor dem Lager. Wir haben ihnen zugerufen, dass sie uns etwas abgeben sollen, weil ihnen ja
sowieso alles abgenommen wird, aber sie haben uns nur ausgelacht. Als sie ins Lager Kamen mussten sie ihr Gepäck
ablegen, wurden dann wo anders hingeführt und haben es danach nie wieder gesehen.
Durch die vielen Läuse, Flöhe und Wanzen die wie im Lager hatten, kam es bei verschieden Kameraden, an den
Einstichstellen, zu eiternden Entzündungen. Um dem vorzubeugen hat man uns mit einem Pulver, das in Frankreich
hergestellt wurde, aber bei den Parasiten keine Wirkung zeigte, eingesprüht. Erst bei der Anwendung eines Mittels
amerikanischer Herkunft, war alles über Nacht verschwunden.
Der Sonntag war arbeitsfrei. Dann kam ein katholischer, französischer Pfarrer, eskortiert von 3 Mann, mit
aufgepflanztem Seitengewehr ins Lager und hat Gottesdienst gehalten. Einen evangelischen Pfarrer gab es nicht, nur
einen Baptisten Prediger. Der wurde würdevoll eingekleidet, bekam ein großes Kreuz und hat jeden Sonntag in einer
extra dafür hergerichteten Baracke Gottesdienst gehalten. Wer Theologie studiert hatte und sich meldete, wurde zu
einem Seminar geschickt und konnte sein Studium fortsetzen. Glasbläser durften das Lager auch verlassen und ihrem
erlernten Beruf wieder arbeiten.
Wer sich freiwillig, für 5 Jahre, zum Dienst in der Fremdenlegion verpflichtet hat, das waren etliche unter uns, wurde
neu eingekleidet, bekam gutes Essen und Rauchwaren soviel er wollte. Nach einem Jahr wurden, nach und nach, die
Kranken und Körperbehinderten in die Sowjetische Besatzungszone entlassen. Eine Entlassung von Kriegsgefangenen, die
in den Westzonen oder jenseits von Oder und Neise zu Hause waren, war nicht vorgesehen. Die Österreicher wurden alle,
unabhängig von ihrem Gesundheitszustand entlassen.
Ich habe Briefe nach Hause geschrieben, aber die kamen nur bis Allenstein und wurden wieder zurück geschickt. Als eine
Kommission des Roten Kreuzes aus der Schweiz unser Lager besichtigt hat, haben wir uns beschwert, das wir als
Sanitätsdienstgrade, zur Arbeit gehen müssen. Daraufhin erging ein Befehl: Wer einen vom Roten Kreuz, ausgestellten
Ausweis besitzt, gehört einem internationalen Verband an und braucht nicht zu Arbeit gehen. Aus unserem Lager hatten
sich 20 Mann gemeldet, die daraufhin Freigang, in Begleitung von zwei französischen Wachsoldaten erhielten. Als wir
gefragt wurden wo wir hin wollen, entschlossen wir uns, einen Soldatenfriedhof, auf dem unsere verstorbenen Kameraden
beerdigt waren, zu besuchen.
Da der Untergrund in dieser Gegend aus Felsen bestand, wurden die Gräben, in denen die Toten in selbst gezimmerten
Kisten nebeneinander gestellt wurden, mit Hilfe von Dynamit ausgehoben. Ein Leichenwagen, mit einem Pferd bespannt,
das mit einer schwarzen Decke abgedeckt war, wurde von einem Kutscher in angemessener Kleidung, gefahren. Der Wagen
konnte gleichzeitig 4 Kisten transportieren. Wenn wir von der Arbeit kommend, dem Leichenwagen begegneten, wurde
gehalten und mit einer Schweigeminute der Toten gedacht, bis der Wagen vorbei war. Die Zivilbevölkerung verharrte auch
im Schweigen, mit abgenommener Kopfbedeckung.
Ein Kamerad, der in Krottorf, Kreis Oschersleben, bei Magdeburg, zuhause war, sagte bei seiner Entlassung zu mir:
Sollte ich das Glück haben, meine Entlassungspapiere zu erhalten ohne eine Bleibe vorzuweisen, dann soll ich Krottorf
als Heimatadresse angeben. Auf der Krankenstube habe ich angegeben, dass sich noch ein Schrapnellsplitter, aus dem
Ersten Weltkrieg, in meiner Kreuzbeingegend befindet, er zwar verkapselt ist, aber immer noch Beschwerden verursacht.
Daraufhin wurde ich zur Entlassung vornotiert. Als bekannt wurde das ein Rückkehrertransport in die sowjetische
Besatzungszone zusammengestellt wird, habe ich mich sofort gemeldet und wurde für ein Entlassungslager in Angoleme
vorgesehen. War das eine Freude, als uns mitgeteilt wurde, wann der Rücktransport stattfindet.
In unserem Lager waren noch 2 Kameraden aus dem Kreis Ortelsburg: Ein Gustav Lumma aus Leynau und ein Alfred Moritz
aus Groß Schöndamerau. Sie mussten noch zurückbleiben und haben mir den Auftrag erteil, die Angehörigen in der Heimat
zu grüßen und ihnen die Anschrift mitzuteilen. Als wir im Entlassungslager ankamen, fragte man uns nach unserer
Heimatanschrift. Dann wurden die Entlassungspapiere angefertigt. Es wurde uns auch ein Barscheck, für die in Frankreich
geleistete Arbeit ausgehändigt, den wir bei jeder Kasse in Deutschland einlösen könnten. Ich habe ihn bis zum heutigen
Tage nicht einlösen können, obwohl ich irgendwann in der Zeitung gelesen habe, das Verrechnungschecks die den aus
französischer Kriegsgefangenschaft Entlassenen, ausgehändigt wurden, einzulösen sind.
Wir kamen zuerst nach Saar Elbe, dann in die Nähe der Zonengrenze zu Thüringen. Hier mussten wir 2 Tage warten, weil
aus der sowjetischen Besatzungszone keine Eisenbahnwagen bereitgestellt wurden. Angesichts dessen, das der Russe beim
letzten Transport die aus Frankreich kommenden Wagen kassiert und nicht mehr herausgeben wollte, bestand der Franzose
jetzt darauf, seine Wagen sofort wieder mitzunehmen. Als der sehnsüchtig erwartete Zug endlich eintraf, durften wir
umsteigen und kamen, immer noch hinter Stacheldraht, nach Erfurt. Von dort weiter ins Quarantänelager nach Prätsch an
der Elbe.
Unter Androhung von Strafe war es verboten das Lager zu verlassen, doch der Hunger zwang uns dazu, in den umliegenden
Dörfern um Lebensmittel zu betteln. Man drohte uns damit, dass Zuwiderhandlungen, mit einer 14-tägigen Verlängerung der
Quarantäne geahndet werden. Der Roggen war schon reif und wir haben, auf den umliegenden Feldern, die Ähren abgerissen,
das Korn, zwischen 2 Steinen zu Mehl zerrieben, um daraus eine Suppe zu kochen, denn von dem was unsere Lagerküche uns
bieten konnte, war es nicht möglich zu überleben. Als der Eigentümer bemerkte wer seine Roggenähren entwendet hat, kam
er ins Lager, gerade zu dem Zeitpunkt als wir mit dem Mahlen beschäftigt waren. Der Lagerkommandant, bei dem er sich
beschwerte, drohte uns zu bestrafen, wenn wir unsere „Rauzüge” nicht unmittelbar einstellen würden. Wir sagten ihm er
solle uns heimfahren lassen, da wir doch lange genug hinter Stacheldraht gesessen hätten.
Endlich wieder in Freiheit
14 Tage nach unserer Ankunft wurden uns Entlassungspapiere ausgehändigt, sowie auch Fahrscheine
zum den, von uns angegeben Heimatorten. So kam ich nach Krottof, Kreis Oschersleben, zu meinem ehemaligen
Kriegskameraden, bei dem ich einen Tag geblieben bin. Er hatte mir schon eine Stelle bei einem Bauern besorgt, der 70
Jahre alt und kinderlos war. Zum Hof, den er mit seiner Ehefrau bewirtschaftet hat, gehörten 36 Morgen Land, 2 Ochsen
und 3 Kühe. Das Ackerland bestand aus 17 Parzellen und sicherte mir einen Arbeitsplatz.
Jetzt, da ich ein Dach überm Kopf und genug zu essen hatte, fing ich an nach dem Verbleib meiner Familie zu forschen.
Bei meinem letzten Heimaturlaub hatte ich mit meiner Frau verabredet; falls wir uns in den Kriegswirren verlieren
sollten, unsere Kontaktadresse, die meiner Quartiersleute in Burscheid, Kreis Opladen, sein sollte. Ich habe zuerst
nach Rohmanen geschrieben, aber leider keine Antwort erhalten. Dann habe ich nach Burscheid geschrieben, und siehe, -
bei denen lag schon eine Anfrage meiner Frau vor, die nach mir gefragt, und ihre jetzige Anschrift hinterlassen hatte.
Ich habe dem Bauern erzählt dass meine Frau sich zurzeit, auf einem Gut, in Alt Steinhorst, im Kreis Rostock, befindet.
Er war sofort bereit uns ein Zimmer zur Verfügung zu stellen, wenn ich meine Frau nach Krottorf rüberholen wollte. Das
habe ich Ihr mitgeteilt und sie war sofort bereit ihren Wohnsitz nach Krottorf zu verlegen, denn sie wohnte dort in
einem kleinen Stübchen unterm Dach.
Im Herbst, als die Feldarbeit so ziemlich erledigt war, bin ich nach Alt Steinhorst gefahren, um meine Frau und meinen
Sohn Kurt, sowie meinen Sohn Manfred, den ich noch nicht kannte, weil er erst nach der Flucht, am 31. Januar, in Groß
Lüssewitz, geboren wurde, nach Krottorf zu holen. Meine Frau hatte schon Holz für den Winter besorgt und vom Gut, auf
dem sie im Sommer gearbeitet hatte, Mehl und Kartoffeln bekommen. Wir haben das Mehl und andere Habseligkeiten in
Kisten verpackt. Das Holz haben wir einem Bauern gegeben, der uns und unser Gepäck, mit seinem Pferdewagen, zum 14
Kilometer entfernten Bahnhof, nach Ribnitz gebracht hat. Wir sind auch gut in Krottorf angekommen, aber als wir am
nächsten Tag, unsere Kisten vom Bahnhof abholen wollten, haben wir zwar die Kisten vorgefunden, doch der gesamte Inhalt
wurde während der Bahnfahrt entwendet. Die Bahnstation in Krottorf hat die Vorkommnisse zur Kenntnis genommen und
protokolliert, aber unsere Sachen haben wir nie wieder gesehen und mussten wieder bei Null anfangen.
Im Winter musste ich auf der Genossenschaft, unentgeltlich, für die Russen Weizen einsacken. Ich hatte versucht eine
Arbeit als Zimmermann zu bekommen, doch auf dem Arbeitsamt wurde mir gesagt, ich bin Ladwirt und muss auf der
Landwirtschaft arbeiten. Da in den ersten Nachkriegsjahren, auch in der sowjetisch besetzten Zone Arbeitsplätze knapp
waren, mussten auch solche, die einen anderen Beruf erlernt hatten, jede zumutbare Arbeit annehmen. Aus der Heimat
erhielt ich einen Brief, von meiner dort noch lebenden Mutter. Sie schrieb das sie mich noch einmal sehen wollte und
ich sollte doch wieder zurück kommen; Unser Hof wäre nicht von Polen besetzt und sie wäre ganz alleine, weil der Vater
nach dem Durchzug der Front von den Russen erschlagen wurde. Daraufhin habe ich dem polnischen Konsulat in Magdeburg
mitgeteilt, dass ich in Rohmanen eine Landwirtschaft besitze, und um eine Einreisegenehmigung gebeten.
Nach 2 Monaten erhielt ich eine Postkarte, mit der Mitteilung, ich sollte mich persönlich beim Konsulat vorstellen.
Nach Aufnahme meiner Personalien, wurde mir gesagt, das ich benachrichtigt werde wenn mein Antrag genehmigt wird. Ende
Juli 1947 erhielten wir die Einreisegenehmigung nach Ostpreußen, das jetzt unter polnischer Verwaltung stand. Wir
mussten zuerst zum polnischen Konsulat in Berlin-Lichterfelde, wo wir umgeben von einer Trümmerlandschaft, gewartet
haben, bis alle Untersuchungen und Formalitäten erledigt waren.
“ Wieder zurück in Ostpreußen.”
Der schwere Wiederaufbau nach dem Kriege
Dann fuhren wir über Frankfurt/Oder, Posen, Thorn, Allenstein, nach Ortelsburg, wo wir am 2. August 1947 ankamen. Mit
einem zweirädrigen Karren, den ich mir von einem noch in Ortelsburg lebenden Bekanten ausgeliehen hatte und meinem
Sohn Manfred im Kinderwagen fuhren wir nach Rohmanen. Meine Mutter war inzwischen verstorben und auf dem Hof war nur
meine, inzwischen aus Russischer Gefangenschaft wiedergekehrte Schwester, Frieda Pelkowski.

Es war alles ausgeplündert; kein Vieh, keine Maschinen und der ganze Hof mit kniehohem Graß überwachsen. Nur schmale
Trampelpfade, vom Haus zum Holzschuppen und zum Klo, durchkreuzten das satte Grün. Ich habe das Gras auf dem Hof mit
einer Sense, die ich noch gefunden habe, abgemäht, damit der Hof nicht so verwahrlost aussah. Am nächsten Tag habe ich
mich bei der Polizei in Ortelsburg angemeldet, wo ich auch ein Startgeld von 100 Zloty erhielt und Gepäckstücke, die
ich in Krottorf aufgegeben, am Bahnhof abgeholt. Es hat mich sehr gewundert das, das Gepäck überhaupt angekommen ist.
Da man von der Landwirtschaft nicht Leben konnte, habe ich mich in den nächsten Tagen, bei der jetzt polnischen Bahn,
um Arbeit beworben und wurde auch angenommen. Wenn wir unseren Monatslohn bekamen, saß immer einer am Tisch, der von
uns 100 Zloty für den Wiederaufbau von Warschau verlangte. Wenn ich dran war, riefen die Anderen, ich hätte Warschau
zerstört und müsste deshalb 200 Zloty abgeben. Nach 3 Jahren kam eine Verfügung, die besagte, dass wer länger als 1
Jahr bei der Bahn beschäftigt ist, angestellt werden muss. Um diese Bestimmung zu umgehen hat man mich entlassen und
eine Woche später wieder eingestellt.
Als ich vor Ablauf des nächsten Jahres, aus dem gleichen Grunde wieder entlassen wurde, habe ich mich bei der
Stadtverwaltung in Ortelsburg(jetzt Szczytno)beworben, wo ich zuerst im Gaswerk als Heizer und später auf Baustellen
als Zimmermann gearbeitet habe. Wir haben durch den Krieg beschädigte Häuser repariert, in den ehemals touristischen
Zentren einige Ausbesserungen an den Einrichtungen durchgeführt, eine Ziegelei wieder in Betrieb gesetzt und andere
anfallende Arbeiten verrichtet. Im Dach des Rathausturmes war während der Kämpfe eine Granate eingeschlagen, die, die
Dachlatten und die Verschalung zerstört hatte. Da wir, unter schwersten Bedingungen, den Schaden repariert haben,
wurde uns eine Höhenzulage versprochen, die wir aber nicht bekommen haben.
Aus Verärgerung darüber habe ich bei der Stadtverwaltung gekündigt und bei einer Wiederaufbaufirma unter der Leitung
von Bauingenieur Laskowski wieder angefangen, wo ich bis 1954, als Zimmermann beschäftigt war. Ab da habe ich mich
nur um meinen Hof gekümmert, der wegen meiner Arbeitsstellen, gezwungenermaßen, sehr vernachlässigt wurde. Als wir
1947 zurückkamen, brachten wir unseren Sohn Manfred noch im Kinderwagen. Den hat meine Frau zum Markt gebracht,
verkauft, und dafür eine Ziege erworben, die dank guter Pflege, uns täglich mit 4 Liter Milch versorgte. Das war der
erste Baustein zum Wiederaufbau, unserer durch den Krieg zerstörten, und danach ausgeplünderten Landwirtschaft.
Während meiner Arbeit bei der Bahn haben wir uns eine Kuh gekauft, die nach einem halben Jahr, wegen nicht bezahlter
Grundsteuer, vom Gerichtsvollzieher gepfändet wurde. Man hat uns die Kuh weggenommen und bei einem Arbeiter, der in
der Ernst-Mey-Straße in Ortelsburg wohnte und sie wegen nicht vorhandener Futtermittel, nur mit Kartoffelkraut
gefüttert hat, untergestellt. Als ich bei der Bahn meinen Monatslohn bekommen habe, bin ich zur Gmina gegangen, habe
eine Rate angezahlt und durfte dann die Kuh wieder mit nach Hause nehmen. Durch die schlechte Ernährung war die Kuh
stark abgemagert und lieferte nur die Hälfte der ursprünglichen Milchleistung.
Später habe ich ein Pferd auf Abzahlung bekommen, das 140.000 alte Zloty gekostet hat. Die Stute war schwach und unser
Feld sehr hügelig, so dass man nur bergab pflügen konnte, was sehr beschwerlich war, bergauf ging es immer im Leerlauf.
Später habe ich die schweren Böden mit dem Traktor umpflügen, und in den letzten Jahren auch mit dem Binder mähen
lassen. Von der Stute habe ich 2 schöne Fohlen gezogen; ein davon habe ich bei der Ausreise in die Bundesrepublik
mitgebracht und bei der Viehverwertungs-Genossenschaft in Göttingen verkauft. In den ersten Nachkriegsjahren als noch
wenig Land bestellt wurde, breiteten sich auf den nicht beackerten Flächen, Wildkräuter aus. Disteln und andere
Schnellwachsende, erreichten manchmal eine Höhe von 2 Meter, besonders auf den schweren Böden.
Es hat viel Schweiß gekostet ehe man den Acker soweit hatte, das er auch befriedigende Erträge abwarf. Die
Währungsreform von 1950, hat unser weiniges Geld das wir schon gespart hatten, wieder vernichtet. Ich hatte 2 Pferde,
1 Fohlen, 2 Kühe und Schweine, als ich wieder aufgefordert wurde nicht bezahlte Grundsteuern nachzuzahlen. Als ich
nicht bezahlen konnte, hat der Vollziehungsbeamte, ein Fohlen, eine Kuh und ein Schwein gepfändet. Es gelang mir jedoch
nach längeren Verhandlungen, ohne größere Verluste, alles zu regeln. Später kam eine Verfügung, die besagte; wenn
jemand auf seinem Hof nur eine Kuh und ein Pferd hatte, durften sie nicht gepfändet werden. Einige haben ihr Inventar
dieser Verfügung angepasst und dadurch die Zahlung von Grundsteuer umgangen.

Wer seine Steuern pünktlich bezahlt und sein Kontingent an landwirtschaftlichen Produkten fristgerecht abgeliefert hat,
der konnte seine, darüber hinaus erwirtschafteten Produkte zu marktgerechten Preisen verkaufen. Für eine hochtragende
Sterke, mindestens 400 kg schwer, die auf ein staatliches Gut verkauft wurde, konnte man bis zu 12000 Zloty bekommen.
Unsere Böden waren kalkarm, doch durch den Einsatz von Kalk und Kunstdünger konnte man den Ertrag erheblich steigern.
Kalk und Kunstdünger konnte man bei der Genossenschaft(GS) bestellen, der dann auch direkt auf den Hof geliefert wurde.
Kalk wurde geliefert und gleich auf dem Feld ausgestreut. In den 1960ger Jahren waren alle Ackerflächen der Rohmaner
Felder bestellt.
Die nach dem Krieg zurückgebliebenen deutschen Bauernfamilien, aber auch die Polen, die während des Krieges beim Bauern
in Deutschland gearbeitet haben, versuchten mit teils bescheidenen, oder auch zusammen gesuchten, landwirtschaftlichen
Geräten, die bäuerlichen Betriebe aufrecht zu erhalten. Nach den schweren Anfängen in den ersten Nachkriegsjahren
erzielten sie schließlich einen beachtlichen Erfolg, der sich in wogenden Kornfeldern, sowie in grünen Wiesen auf
denen gut genährtes Vieh weidete, widerspiegelte.
Ein schwerer Einschnitt in meinem Leben.
Am 11. Mai 1956 verstarb nach langer schwerer Krankheit, meine liebe Ehefrau Marta Rattay,
geborene Brosch. Ein Jahr zuvor war schon mein Schwiegervater Gottlib Brosch verstorben. Die schweren Bedingungen
unter denen wir nach Kriegende leben mussten, haben ihrer bereits angegriffenen Gesundheit sehr zugesetzt. Sie
verstarb mit 44 Jahren und hinterließ in unserer Familie eine große Lücke, die nicht mehr zu Überbrücken war. Wir
haben sie unter großer Anteilnahme der noch verbliebenen deutschen Bevölkerung zu Grabe getragen und auf dem Rohmaner
Friedhof beigesetzt. Die Arbeit die sie sonst verrichtet hatte fiel jetzt auf mich und meine Söhne zurück. Meine
Schwester Frieda Pelkowski half auch wo sie nur konnte. Wir waren auf die Unterstützung durch Nachbarn und Freunde
angewiesen, die uns immer wenn es nötig war, tatkräftig unterstützt haben. Im laufe der Zeit haben wir wieder zum
Alltag zurück gefunden, haben sie noch etliche Jahre auf dem Friedhof besuchen können, bis wir, bedingt durch unsere
Ausreise uns endgültig von ihr trennen mussten.
Der endgültige Abschied von Ostpreußen
Ab 1956 begannen, durch die Vermittlung des Deutschen Roten Kreuzes, die ersten Ausreisen in die
Bundesrepublik Deutschland. Zuerst waren es Kinder die zu ihren Eltern ausreisen durften, Familien deren Väter aus der
Kriegsgefangenschaft in den Westen Deutschlands entlassen wurden und andere durch den Krieg getrennte
Familienangehörige. Ab 1960 erhöhte sich die Zahl der Ausreisewilligen aus dem polnisch besetzten Ostpreußen. Es setzte
sich die Überzeugung durch, dass unsere Angestammte Heimat, uns für die Zukunft keine Perspektive mehr bieten konnte.
Meistens wurden die Anträge, die wir an die Passabteilung in Allenstein stellen mussten, um einen Ausreisepass zu
bekommen, negativ beschieden. Nach mehrmaligen Versuchen gelang es dann doch, diese begehrte Ausreiseberechtigung in
Empfang zu nehmen. Die Enttäuschung der Zurückgebliebenen war groß, wenn wieder mal Verwandte oder Nachbarn, den Weg
in Richtung Bahnhof einschlugen.
Um einen Reisepass zu beantragen, musste man zuerst eine Einladung von Verwandten aus der Bundesrepublik vorlegen, in
der, diese sich verpflichten mussten, für Unterkunft und Verpflegung der Eingeladenen zu sorgen. Diese Einladung
musste durch ein Amt in der Bundesrepublik beglaubigt werden. Außerdem mussten die Kosten für die Bahnfahrt, ab
polnischer Grenze, bis zum Zielort, beim polnischen Reisebüro ORBIS, in Warschau, in DM eingezahlt werden.
Unseren ersten Ausreiseantrag haben wir 1964, bei der Kommandantur der polnischen Miliz in Allenstein eingereicht, der
nach einer gewissen Zeitspanne, ohne eine uns verständliche Begründung zu nennen, abgelehnt wurde. Gegen diese
Ablehnung wurde ein Widerspruch zugelassen, den wir sofort einreichten. Nach einer weiteren Zeitspanne erhielten wir
wieder eine Ablehnung, gegen die kein Widerspruch mehr zulässig war. Wer seine Ausreiseabsicht nicht aufgeben wollte,
musste einen neuen Antrag stellen. Es gab Familien die schon 10 Mal einen Ausreiseantrag gestellt hatten und immer
wieder abgewiesen wurden. Da meine Söhne, nicht die Absicht hatten in Rohmanen zu bleiben und ich nach 2 Weltkriegen,
an denen ich teilgenommen, die schwere Arbeit auf der Landwirtschaft, nicht aus eigener Kraft schaffen würde, haben wir
1966 wieder einen Antrag gestellt, der prompt abgelehnt wurde. Der Widerspruch auf diese Ablehnung wurde auch negativ
beantwortet, so dass wir 1968 wieder einen Antrag eingereicht haben.
Weil das Passamt in Allenstein lange nichts von sich hören ließ, hegten wir schon die Hoffnung das es jetzt klappen
würde und waren sehr enttäuscht als wieder eine Absage kam. In der Zwischenzeit sind viele Nachbarn und Bekannte aus
Rohmanen, sowie aus der näheren Umgebung, ausgereist und das Häuflein der noch verbliebenen Deutschen, wurde immer
kleiner. Die Motivation, die uns in früheren Jahren, über so manche schwierige Lage hinweg geholfen hat, ist einer
hoffnungslosen Resignation gewichen. Man war davon überzeugt, dass unser Leben, in unser Angestammten Heimat, keine
Zukunftsperspektive mehr haben konnte und wenn wir keine Ausreisegenehmigung bekommen, wir eines Tages die letzten
Deutschen in der ganzen Umgebung sein werden.
Die Ausreise-Heimat ade
Wir hatten die Hoffnung schon aufgegeben, als am 30. April 1969, der Briefträger unseren Hof
betrat und mir einen Brief überreichte, in dem uns das Passamt in Allenstein mitteilte, dass unsere Ausreise in die
Bundesrepublik Deutschland, genehmigt worden ist. Wir müssten, nach Aushändigung der Reisepapiere, den Geltungsbereich
der Volksrepublik Polen, innerhalb von 3 Monaten verlassen. Wir waren zuerst geschockt, über den Hinweis, das wir
unsere Heimat in 3 Monaten verlassen müssen, aber dann stellte sich die Zukunftsperspektive wieder ein und wir gingen,
wie von einem schweren Ballast befreit und gut gelaunt unser weiteren Tätigkeit nach.
Als der Briefträger unseren Hof betrat, waren ich und mein Sohn Kurt gerade dabei eine Fuhre Mist zu laden. Wir hatten
den Wagen gerade halb geladen und haben nach der frohen Kunde nicht mehr weiter gemacht, sondern die Pferde vorgespannt
und den Mist aufs Feld gefahren, damit wir den Wagen für alle Fälle frei hatten. Das war die letzte Tätigkeit für
unsere Landwirtschaft in Ostpreußen.
Die Nachricht von unserer Ausreise verbreitete sich, ohne dass wir darüber gesprochen haben, wie ein Lauffeuer.
Alsbald kamen Leute aus dem Dorf, die sich für das Vieh und für diverse Landwirtschaftliche Geräte interessierten.
Etliche wollten bestimmte Sachen sofort kaufen, andere haben nur zurücklegen lassen und wollten später kommen und
bezahlen, haben es aber dann doch nicht genommen.

Wenn man eine Landwirtschaft hatte, konnte man 2 Pferde, 2 Rinder, 3 Schweine, 5 Schafe und 10 Hühner, in einem
geschlossenen Viehwaggon, in die Bundesrepublik mitnehmen. Jeden Tag war man unterwegs, von einer Behörde zur Andern.
Die Aushändigung der Reisepapiere erfolgte nur nach Vorlage bestimmter Bescheinigungen: Es mussten alle Steuern bezahlt
sein, das Kontingent landwirtschaftlicher Erzeugnisse musste abgeliefert sein, je eine Bescheinigung vom Katasteramt
und vom Notar musste vorgelegt werden, das man dem polnischen Staat das Grundstück abgetreten hat. Die Gebühren für
die notarielle Beglaubigung mussten wir selbst bezahlen. Wenn man alle Bescheinigungen beisammen hatte, bekam man bei
der Kreisverwaltung eine Gesamtbescheinigung. Mit dieser Bescheinigung konnte man nach Allenstein, zur
Polizeikommandantur fahren, wo man nach dem schriftlichen Verzicht auf die polnische Staatsangehörigkeit, einen
Reisepass ausgehändigt bekam, der den Inhaber zum Grenzübertritt berechtigte, aber nicht zur Wiedereinreise.
Wir haben 2 Pferde, eine Sterke, einen Ochsen, 5 Schafe, 2 Schweine und 10 Hühner mitgenommen. Über die Schutzimpfung
der Rinder musste man eine, vom Kreistierarzt beglaubigte Bescheinigung vorweisen. Ich habe 5 Schafsböcke gekauft, die
ich in der Zwischenzeit, hinter der Scheune, zum Weiden angekettet hatte. Einer von denen hat sich losgerissen und
seinen Nachbarn getötet. Das Fleisch konnten wir noch verkaufen, mussten aber dafür einen anderen Schafsbock kaufen.
Innerhalb von 3 Monaten mussten wir alles regeln und zwei Tage vor der Abfahrt einen Eisenbahnwagen, bei der
Eisenbahndirektion in Allenstein bestellen. Reservierungen bei den polnischen Behörden waren meist immer mit
Schmiergeld verbunden, weil man sonst nie sicher sein konnte dass diese Vereinbarungen auch eingehalten werden. Schon
2 Wochen vor unserer Abfahrt, gab es in Ortelsburg keine alkoholischen Getränke zu kaufen. Meine Söhne mussten mit dem
Motorrad die umliegenden Dörfer abfahren, damit wir für die Reise einen Vorrat anlegen konnten; denn Wodka war zu der
Zeit, in Polen, wie eine zweite Währung.
Am 25. Juli haben wir zusammen, mit meinem Neffen Siegfried Brosch, unseren sonstigen Hausrat, der in Kisten verpackt
war, in einen Eisenbahnwagen, auf dem Allensteiner Bahnhof verladen. Alles musste zuerst durch den Zoll, wo die
Federbetten gewogen wurden und über das erlaubte hinausgehende Kissen, verzollt werden mussten. Dasselbe galt auch für
Fleisch und Räucherwaren.
Am 26. Juli, unserem Verladetag, kam der Eisenbahnwagen aus Allenstein, erst um 11 Uhr auf dem Ortelsburger Bahnhof an.
Die Rinder hatten wir zu Fuß, zum Bahnhof gebracht; Schweine, Schafe und Hühner auf dem Pferdewagen. Im Eisenbahnwagen
mussten, mit Hilfe von Brettern und Bohlen, Boxen für die verschiedenen Tiere erstellt werden. Jedes Pferd und jedes
Rind in eine Bucht. Die Schafe zwischen die Pferde, die Schweine zwischen die Rinder und die Hühner in einem Käfig,
unter der Decke über den Rindern. Die Hühner hatten unterwegs Eier gelegt, somit hatten wir jeden Tag frische
Verpflegung. Bei der Fahrt im Viehwagen, begleitete mich mein Sohn Manfred. Als die Lokomotive nahte, um den Wagen
abzuholen, wurden noch schnell die restlichen Sachen hinein geworfen und so mache Abschiedsträne rollte dann die Wange
hinab.
Unsere Nachbarn, Deutsche und Polen, halfen uns beim Verladen des lebendigen Inventars. Jetzt erinnerte ich mich
plötzlich, an die oft auch schönen, Ereignisse der letzten 22 Jahre. Einer Zeit, in der das Zusammenleben von
Deutschen und Polen, von Jahr zu Jahr, besser wurde. Man half sich beim einbringen der Getreideernte, beim Dreschen
des Getreides, bei der Kartoffelernte und bei anderen Arbeiten, wo viele Menschen zupacken mussten. Es war eine
Dorfgemeinschaft, in schweren Zeiten geboren; jeder half jedem wenn Hilfe nötig war. Es wurde mir plötzlich bewusst,
das jetzt ein Lebensabschnitt zu Ende ging, zu dem ich nicht mehr zurückkehren konnte. Unsere Existenzgrundlage war
jetzt ein Eisenbahnwagen auf einem Schienenstrang, dessen Ende irgendwo in weiter Ferne lag. Obwohl, von langer Hand
vorbereitet, war dieser Moment voller Wehmut.
Doch als der Zug sich plötzlich, in Bewegung setzte, war ich sofort wieder in der Gegenwart. Menschen, mit denen man
Jahrzehnte lang, in gutem Einvernehmen zusammen gelebt hat, blieben plötzlich am Bahnsteig zurück und die Entfernung
zwischen ihnen und mir vergrößerte sich mit jeder Sekunde, bis sie letztendlich aus meinem Blickfeld verschwanden.
Es war ein heißer Julitag, als wir unsere Reise gen Westen antraten. Für die Schweine, die besonders unter der Hitze
zu leiden hatten, haben wir 10 Flaschen Essig mitgenommen und sie von Zeit zu Zeit besprenkelt, damit sie besser atmen
konnten. Für die anderen Tiere war reichlich Heu und Hafer vorhanden. Eine großes Fas und zwei Milchkannen waren mit
Wasser gefüllt, die wir auf den an der Strecke liegenden Bahnstationen, bei Bedarf wieder nachgefüllt haben.
Da der Kreistierarzt nicht in seinem Büro war, konnten wir die Impfbescheinigung für das Vieh, nicht rechtzeitig
herbeischaffen. Der Zug setzte sich in Bewegung und die Bescheinigung war immer noch nicht da. Als die Bescheinigung
dann eingetroffen, wir aber schon unterwegs waren, ist mein Sohn Kurt mit dem Motorrad hinterher gefahren und hat uns
in Passenheim, wo der Zug noch andere Wagen angehängt bekam, die Impfbescheinigung übergeben. Wir waren sehr froh das
er es noch geschafft hat, denn in solch einer Situation fühlt man sich sicherer wenn man alle Bescheinigungen bei sich
hat. Auf der Rückfahrt, mit dem Motorrad hatte er noch eine Panne, musste das Motorrad stehen lassen und per Anhalter
nach Hause fahren. Am nächsten Tag kam er mit Siegfried Deptolla, der das Motorrad wieder flott machte und brachte es
wieder nach Rohmanen zurück.
Die Fahrt mit dem Viehwagen, gen Westen
Von Ortelsburg bis Allenstein(45 km) hat unser Zug 4 Stunden gebraucht, weil auf jedem Bahnhof
gehalten wurde, um neue Wagen anzuhängen. Nachdem wir in Allenstein angekommen waren, kam ein Rangierer und fragte
nach unserem Ziel. Als wir ihm mitteilten, das wir in die Bundesrepublik Deutschland wollen, sagte er nur: „In 10
Minuten fährt ein Zug los. Wenn ich von euch 500 Zloty und einen Liter Wodka bekomme, werde euch sofort anhängen,
andernfalls kommt ihr auf ein Nebengleis und müsst dann auf den nächsten Zug warten. Es blieb uns nichts anderes übrig
als seiner Forderung nachzukommen, denn über derartige Erpressungen hat man bereits von Anderen, die vor uns ausgereist
sind, gehört. Wir wurden auch sofort angehängt und fuhren dann die ganze Nacht, an Osterode, und Thorn vorbei bis
Gnesen. Dort wurde wieder rangiert.
Von einer Anhöhe wurden die einzelnen Wagen auf verschiedene Gleise verteilt und zu neuen Zügen zusammengestellt. Der
Aufprall der ungebremsten Wagen erzeugte eine derartige Erschütterung, dass manche Bretter an den Boxen geborsten waren.
Von Gnesen ging es dann in einem Zuge durch bis zur Grenzstation Reppen(Rzepin). Dort mussten wir zum Zollamt, wo
unsere Ausfuhrpapiere durch die Zollbeamten, und durch einen Tierarzt geprüft wurden. Bis Reppen(Rzepin) haben wir für
den Eisenbahnwagen 900 Zloty bezahlt; hier mussten wir noch einmal 650 Zloty bezahlen. Bei der Wagenkontrolle erklärte
uns ein Bahnbeamter das unser Wagen, sich nicht für den internationalen Transport eignet und wir deshalb den Inhalt in
einen Anderen umladen müssen, der irgendwann, auf dem Nebengleis bereitgestellt wird. Nach langer Verhandlung, sowie
einer Zulage von 500 Zloty und einem Liter Wodka haben wir ihn davon überzeugt, das der Wagen sich doch für die
Weiterfahrt eignet.
In der Nacht war Schichtwechsel, der unseren Wagen wieder abgehängt hat, weil er angeblich von der Reichsbahn der DDR,
wegen technischer Mängel nicht weiterbefördert würde. Wir mussten unsere Verhandlung vom Vorabend wiederholen, die mit
der Zusage endete, dass wir am frühen Morgen, über die Grenze auf DDR Gebiet, gebracht werden. Um 5 Uhr morgens kam
eine Lokomotive, die uns den letzten Abschnitt bis über die Grenze bringen sollte. Als der Zug hat noch einmal anhielt,
kamen polnische Grenzbeamte und Soldaten in den Wagen. Sie durchsuchten ihn und fragten, ob wir noch polnisches Geld
oder einen Grundbuchauszug bei uns hätten. Wir zeigten ihnen 800 Zloty, die sie uns, nach Ausstellung einer Quittung
über 500 Zloty, abnahmen. Die Grundbuchauszüge habe ich, im Stroh versteckt, dem Ochsen vor die Füße gelegt. Falls
jemand da suchen sollte, hätte ich gesagt, das das Tier bösartig veranlagt ist, und ich für seine Sicherheit nicht
garantieren könnte, deshalb sollte er vorsichtig sein.
Als die Grenzkontrolle den Zug verlassen hatte, setzte sich die Lokomotive wieder in Bewegung und überquerte nach
kurzer Zeit die Oderbrücke. Auf einer eingezäunten Fläche, jenseits der Grenze, hat man uns abgestellt hat und die
Lokomotive fuhr zurück auf polnisches Gebiet. Vor und hinter uns waren die Tore verschlossen. Auf den Wachtürmen,
links und Rechts von uns, standen Posten mit einem Gewehr im Anschlag. Vier Grenzbeamte der DDR, jeder mit einer
Leiter in der Hand, sowie ein Schäferhund, kamen zu unserem Wagen. Sie öffneten die Schiebetüre, stellten die Leiter
davor und ließen den Hund in den Wagen springen, der nur etwas herum schnupperte und wieder heraussprang. 2 Beamte
haben dann anschließend, die Papiere kontrolliert und das Inventar gezählt.
Nach einiger Zeit wurden wir an einen Güterzug der Reichsbahn angehängt und fuhren von Frankfurt an der Oder, vorbei
an Berlin, Ellingen und Nordhausen, über die Grenze zur Bundesrepublik bis Herzberg. Hier hat ein Zollbeamter der
Bundesrepublik, die Formalitäten erledigt und ein Tierarzt die Pferde, Rinder und Schweine gründlich untersucht. Ich
musste ihnen die Mäuler aufhalten und die Füße hochheben. Danach hat uns die Lokomotive zu einer Wasserzapfstelle
gebracht, wo wir die Tiere tränken und unsere Behälter mit Wasser auffüllen konnten. Anschließen fuhren wir über
Northeim nach Göttingen, zur Viehverwertungsgenossenschaft, die zuvor von unserer Ankunft in Kenntnis gesetzt wurde.
Der Ochse, die Sterke und die Schweine wurden, in Göttingen zum Schlachthof gebracht; die Pferde kamen nach Hannover
und die Schafsböcke nach Kassel. Wir waren mit dem Viehtransport 5 Tage unterwegs; hatten so manche Klippe umschifft
und Schwierigkeiten gemeistert, die im normalen Leben nicht vorkommen.
Wir wurden mit einem PKW, ins Durchgangslager Friedland bei Göttingen gefahren, wo mein Sohn Kurt, meine Schwester
Frieda Pelkowski und Siegfried Brosch mit Familie, die am 30 Juli, um 14 Uhr, von Warschau mit dem Zug abgefahren, und
hier am 31. Juli in den Morgenstunden eingetroffen sind, schon auf uns gewartet haben. In Friedland hat man uns mit
Familie Siegfried Brosch in einem Raum untergebracht, wir wurden registriert und erhielten 20 DM Überbrückungsgeld,
pro Person. Da wir erst am Freitag in Friedland eingetroffen sind, mussten wir hier über das Wochenende bleiben,
obwohl die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der Regel nur 3 bis 4 Tage beträgt.
Um einen Antrag für die Ausreise stellen zu können, brauchten wir eine Einladung von in der Bundesrepublik lebenden
Verwandten. Diese Einladung hat uns mein Bruder, Ernst Rattay, aus Ingelheim am Rhein zugeschickt. Ingelheim liegt im
Bundesland Rheinland-Pfalz. Das Geld für die Bahnfahrt, hat uns, Frieda Schellin, geb. Nickel, aus Duisburg, die
Tochter unseres Nachbarn, überwiesen. In Friedland wurden wir registriert. Im Registrierschein, war als unser
nächster Aufenthaltsort in der Bundesrepublik, das Durchgangslager Osthofen bei Worms, das alle Aussiedler für
Rheinland-Pfalz aufnehmen musste, eingetragen. Die Eintragung erfolgte deshalb, weil der Ort aus dem uns unsere
Einladung zugeschickt wurde, sich auch in Rheinland-Pfalz befand.
Da ich nach dem Polenfeldzug, als Soldat, ein Jahr im Kreis Opladen, im Rheinland gewesen bin, wäre ich sehr gerne in
diese Gegend gezogen, denn die Erinnerung an die schönen Tage die ich dort verlebt habe war in mir immer noch wach.
Ich versuchte die Eintragung in unseren Regiestierscheinen ändern zu lassen, was nach einigen, vielleicht auch
berechtigten Einwänden, am 4. August, vom Beauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen, genehmigt wurde. Anstelle von
Rheinlad-Pfalz stand da jetzt Nordrhein-Westfalen und am 7. August, fuhren wir, noch mit anderen Aussiedlern, ins
Durchgangslager Unna-Massen, am östlichen Rande des Ruhrgebietes gelegen. Hier wurden wir in einem Zimmer untergebracht
und konnten unser Essen in einer Gemeinschaftsküche zubereiten.
Am 8. August wurden wir in Unna-Massen, als Bürger der Bundesrepublik Deutschland registriert, erhielten
Einhundert DM Begrüßungsgeld, den Vertriebenen Ausweis -A -und 4 Wochen später den Bundespersonalausweis. In
Unna-Massen haben wir mehr als 4 Monate verbracht, weil mein Sohn Kurt, wegen fehlender Berufsausbildung, in Unna, an
einem Grundlehrgang für Metallarbeiter teilgenommen hat, der vom Arbeitsamt finanziert wurde. Am 11 Dezember 1969 sind
wir endlich an unserem vorläufigen Wohnsitz, im Durchgangswohnheim, an der Elisabethstraße 13, in Velbert angekommen.
Ab dem 5. Januar 1970 konnten meine Söhne, in der Zahnradfabrik Reining, in Velbert ihrer geregelten Arbeit nachgehen.
Von Bau- und Sparverein in Velbert wurde uns am 20. Juni 1970, unsere erste Wohnung zugewiesen.
Velbert im Februar 1972
gezeichnet: Gustav Rattay
Mein Großvater mütterlicherseits hatte nur Schulland gepachtet, dass er mit zwei Ochsen bearbeitet hat. Mit dem Geld,
das mein Vater im Kohlenbergbau, in Westfahlen verdient hat, konnte er Land dazukaufen und dadurch auch den Hof
vergrößern. Bis zu meiner Einschulung wurde ich im Elternhaus erzogen. Vom 6. bis zum 14. Lebensjahr habe ich die, in
drei Klassen eingeteilte Volksschule in Rohmanen besucht. Wir wurden in der Schule streng erzogen und man versuchte
uns alles beizubringen damit wir so gut wie möglich durchs Leben kommen würden.
Die Hauptschullehrer Reinhard, Puzicha, und Schürmann waren unsere Klassenlehrer. Wir bekamen dann den Hauptlehrer
Müller und die Klassenlehrer Willimzik und Maleyka. Hauptlehrer Müller war von Osterode nach Rohmanen gekommen. Zur
Rohmaner Schule gehörten 110 Morgen Land. Hauptlehrer Müller hatte alles bearbeitet. Auf seinem Hof arbeiteten 2
Knechte und 2 Mägde. Er hatte 4 Pferde, Rinder und eine Schweinezucht. Auch eine neue Scheune wurde in seiner Amtszeit
auf dem Schulhof errichtet. Lehrer Müller demonstrierte den Rohmaner Bauern wie man unter Verwendung von Kunstdünger
und fachgerechter Bodenbearbeitung die Erträge aus der Landwirtschaft erheblich steigern kann. Im August 1914 wurde
Lehrer Müller zusammen mit seinem Sohn Alfred und Karl Deptolla von den Russen erschossen.
Rohmanen vor dem Ersten Weltkrieg
Rohmanen ist von der Kreisstadt Ortelsburg 3 Kilometer entfernt und liegt an der Landstraße von Ortelsburg über
Kobulten nach Bischofsburg. Wegen der Nähe zur Kreisstadt wurde schon darauf geachtet, dass alles ordentlich und
sauber war. Die Zäune, an der Straßenseite, wurden, bei Bedarf immer ausgebessert und jeden Sonnabend musste die
Straße gefegt werden. Der Landjägermeister kam am Sonntag zu Pferde geritten und hat nachgesehen ob jeder seine
Pflicht getan hat. Hatte jemand vergessen die Straße zu fegen, kostete ihn das 5 Reichsmark Strafe, was zu jener Zeit
viel Geld war. Wenn er dann vor dem Gasthof anhielt, kam Frl. Trzaska mit einem Tablett heraus, auf dem sich eine
Zigarre, ein Gläschen Kognak und auch 2 Stück Würfelzucker fürs Pferd, befanden. Er nahm alles entgegen ohne vom Pferd
zu steigen und ritt dann ins nächste Dorf weiter.
Die Rohmaner Feldmark erstreckte sich etwa über 1500 Hektar. Das Dorf bestand aus etwa 80 Höfen; die Abbauten und
nicht landwirtschaftlichen Gebäude mitgerechnet. Sechs Abbauten sind nach dem zweiten Weltkrieg, teils durch
Fronteinwirkungen, teils durch Vandalismus, unwiederbringlich verloren gegangen. Auf einen Teil der Rohmaner Felder
erstreckt sich auch der Dammerauer Höhenzug. Die höchste Erhebung von 210 Meter über dem Meeresspiegel, befindet sich
auf dem Feld von Friedrich Glinka. Da ist auch ein vierkantiger Granitstein eingegraben, der als Navigtionspunkt, zur
Erstellung von Kartenmaterial, genutzt wurde. Diese Stelle war mit einer Holzpyramide gekennzeichnet und diente auch
bei Truppenmanövern als Orientierungspunkt.
Im Bereich der Rohmaner Gemarkung befinden sich so gut wie keine Wiesen. Die Rohmaner Wiesen liegen etwa 10 Kilometer
entfernt; bei der Försterei Wickno, in Schodmak, in Seedanzig und in Neu Schiemanen. Kurz vor dem zweiten Weltkrieg,
haben Herr Biella und Friedrich Trzaska sich schon mit der staatlichen Forstverwaltung, darauf geeinigt, die Wiesen in
Neu Schiemanen gegen näher gelegene zu tauschen. Die neuen Wiesen liegen vor dem Waldpuschsee und befinden sich im
Besitz der staatlichen Forste. Obwohl die eingetauschte Fläche schon neu vermessen wurde und genutzt werden konnte,
wurde sie leider vom Katasteramt, noch nicht ins Grundbuch eingetragen. Auf Grund dieser Tatsache, wurde dieser
Tausch, nach dem Krieg, von den polnischen Behörden, nicht anerkannt.

In der Mitte des Dorfes befindet sich ein, 5 Morgen großer Teich, der den Bauern als Viehtränke diente und Enten sowie
Gänse zum verweilen einlud. Es wurde dort auch Löschwasser entnommen, wenn es im Dorf brannte. Im Teich waren auch
verschiedene Fische, die der Fischer Adam Glitza, in jedem Frühjahr neu eingesetzt hat. Die Fische sind wegen des
vielen Schlammes, der den Boden bedeckte, oft erstickt sind. Aus Richtung Ortelsburg kommend, liegt 50 Meter vor dem
Dorfeingang, zur rechten Hand, ein Soldatenfriedhof. Auf ihm haben die Gefallenen des 1.Weltkrieges, Deutsche und
Russen, ihre letzte Ruhe gefunden. Von der Landstraße kommend muss man einige Stufen hinaufsteigen, die von beiden
Seiten mit Birken bepflanzt sind.
Auf einer kleinen Anhöhe befindet sich die aus zwei Klassenräumen bestehende Dorfschule, mit einer Wohnung für den
Lehrer. Die Schule wurde 1906, mit tatkräftiger Unterstützung aller Dorfbewohner, aus gebrannten Lehmziegeln, gebaut.
Auf der Anhöhe, vor der Schule sind später Kastanienbäume gepflanzt worden, die den Schulkindern, an heißen Tagen
Schatten spendeten.
Die älteste Familie in Rohmanen war die Familie Friedrich Biella. Wie ich mich noch erinnern kann war sein Vater
Gemeindevorsteher. Nach seinem Tode hat das Amt sein Sohn Friedrich übernommen bis er 1914 als Unteroffizier in den
ersten Weltkrieg einrücken musste. Friedrich Biella hat aktiv bei der Garde in Berlin gedient. Bei den Wahlen und bei
der Abstimmung 1920 hat er sich sehr für den Erhalt des Deutschtums eingesetzt. Er hat auch im Jahr 1896, die
Freiwillige Feuerwehr in Rohmanen ins Leben gerufen und war zugleich ihr erster Brandmeister. Bei der Genossenschaft
und bei der Darlehenskasse war er im Vorstand. Dadurch war es ihm möglich die Rohmaner Bauern mit Krediten und
Kunstdüngern zu versorgen. Die Söhne Fritz und Wilhelm hat er aufs Gymnasium nach Ortelsburg geschickt und studieren
lassen. Bei Bauernversammlungen hat uns Fritz Biella Vorträge gehalten.
Eine weitere Familie war die des Gasthofbesitzers Friedrich Trzaska. Der Hof von Friedrich Trzaska war der älteste in
Rohmanen. Wenn die Bauern aus weiter gelegenen Dörfern, vom Wochenmarkt nach Hause fuhren, hielten sie oft an der
Gaswirtschaft an. Die Pferde, sowie die auf dem Markt eingekauften Rinder wurden dann, an einem vor dem Haus
angebrachten Querbalken festgebunden und die Besitzer machten es sich in der Gaststube gemütlich. Zwei große
Kastanienbäume standen zu beiden Seiten der Eingangstreppe und weiter rechts war ein großes Fenster, in dem, die im
Geschäft vorrätigen Artikel, ausgestellt waren; besonders zur Weihnachtszeit. Die Kinder drückten sich an der Scheibe
die Nase platt, um die vielen schönen Sachen, die sich die meisten Dorfbewohner nicht leisten konnten, wenigstens aus
der Nähe zu bestaunen.
In der Gaststube wurde Korn, sowie auch guter Bärenfang ausgeschenkt, und wenn es den Gästen gut geschmeckt hat, haben
sie es lange ausgehalten, so das für eine weitere Rast, in einem der nächsten Dörfer keine Zeit mehr übrig blieb. Die
alten Bauern erzählten auch; das es in ganz Ortelsburg, keinen so guten Schnupftabak gab, wie im Gasthof Trzaska. Zu
diesem Grundstück gehörte einst auch der Rohmaner See. Weil dafür keine Steuern gezahlt wurden hat sich der Besitzer
von Gut Frenzken den See angeeignet.
Als Königsberg zur Festung ausgebaut wurde, haben viele Männer dort Arbeit gefunden. Zu dieser Zeit war an eine
Beschäftigung im Kohlenbergbau, in Westfalen, noch nicht zu denken. Weil auch noch keine Eisenbahnlinie vorhanden war,
mussten sie den weiten Weg zu Fuß zurücklegen. Nachdem sie den ganzen Tag marschiert sind, haben sie in der Nacht ein
Feuer angezündet, eine Malzeit zubereitet und in der Nähe des Feuers, das sie vor wilden Tieren schützen sollte,
übernachtet. Die Reise nach Königsberg hat eine ganze Woche gedauert. Sie wurden dort zum Aufschütten der
Festungswälle eingesetzt.
Das Jahr 1914 wurde zum Schicksalsjahr, für Ostpreußen und seine Bevölkerung. Nach Abschluß der Volksschule im Jahr
1912, habe ich in den Wintermonaten einen Fortbildungslehrgang für die Landwirtschaft besucht, den Hauptlehrer Aaron,
der aus Olschienen nach Rohmanen versetzt wurde, für uns organisiert hatte. Da im Dorf 2 Trompeten vorhanden waren,
hatte er uns nahe gelegt eine Kapelle zu gründen, dann könnten wir ja die Soldaten, die aus dem Krieg heimkehren
würden mit Musik empfangen. Zum Abschluss konnte man sich ein Buch oder ein Obstbäumchen wünschen. Eine Woche vor dem
Einmarsch der Russen, haben wir noch mit einem Breitdrescher, der durch ein Rosswerk dass von 6 Pferden angetrieben
wurde 110 Zentner Roggen gedroschen. Der Lehrer Malayka hat sich 1914 freiwillig zum Militär gemeldet. 1915 hat er uns
als Offiziersanwärter besucht. Im Frühjahr 1916 wurde mein Jahrgang gemustert und im Herbst 1916 wurden wir eingezogen.
Ausbruch des Ersten Weltkrieges
Am 2. August 1914 wurde die Allgemeine Mobilmachung ausgerufen. Alle wehrfähigen Männer folgten
dem Ruf des Kaisers und eilten zu den zuständigen Wehrmeldeämtern um die Grenzen des Vaterlandes zu schützen. Wir als
Grenzbewohner bekamen das Meiste zu spüren. Alle Häuser, Scheunen und Ställe waren mit Soldaten und ihrem Tross belegt.
Die Einen gingen, die Anderen kamen. Die Kosaken hatten bei Muschaken und Radzinen die Grenze überschritten. Der
Flüchtlingsstrom hatte sich von der Grenze her angestaut. Die Russen haben überall geplündert. Die Trosse mussten sich
zurückziehen und haben dazu vorwiegend die Feldwege benutzt. Die Pferde waren erschöpft. In einer Nacht kam der
Gemeindevorsteher mit einem deutschen Offizier auf unseren Hof. Mein Vater und der Nachbar Wilhelm Dorka mussten mit
ihren Pferden aushelfen. Sie waren 2 Tage unterwegs, bis zu einem Gut in Kleeberg bei Allenstein. Als sie dann wieder
nach Hause kamen waren die Russen schon am Rohmaner Friedhof. In der Zwischenzeit hatten wir schon den Leiterwagen mit
Mehl, Rauchfleisch und Betten beladen.
Der überwiegende Teil der Rohmaner war schon losgefahren. Der Hauptlehrer Müller kam noch mit dem Fahrrad vorbei und
sagte es wäre höchste Zeit das wir wegkämen weil die Russen schon Ortelsburg besetzt hätten und im Anmarsch auf
Rohmanen wären. Wir sind auf eine Anhöhe gestiegen und haben die Staubwolken beobachtet, aber wir dachten es wäre
deutsches Militär.
Auf der Flucht vor den Russen
Kurz vor Sonnenuntergang haben wir die Pferde vor den fertig gepackten Wagen gespannt und sind
sofort losgefahren. Mein Bruder und ich nahmen 4 Milchkühe und die beste Sterke mit und gingen hinterher. Schweine,
Kälber und Geflügel haben wir aus den Ställen getrieben. Wir waren die ganze Nacht unterwegs und sind bis Rheinswein
gekommen. Da hatten wir einen Onkel wohnen, bei dem haben wir den ganzen Tag verbracht.
Unterwegs haben wir einen Mann getroffen, der erzählte uns dass die Russen bei Groß Jerutten einen Personenzug
überrumpelt haben. Sie hatten aus Eisenbahnschwellen eine Sperre auf den Schienen errichtet und somit den Zug zum
Anhalten gezwungen. Die Russen haben den Zug mit Artillerie beschossen. Als die Soldaten und Zivilisten den Zug
verlassen wollten kamen die Kosaken zu Pferde und haben ein Massaker angerichtet. Nur wer sich am Boden davon
schleichen konnte hat überlebt. Die Russen wurden durch einen Verräter darüber informiert das auf diesem Gleis ein
Zug unterwegs war und waren darauf vorbereitet. Unserem Informanten ist es auch gelungen dem Massaker zu entkommen.
Ein Kosake hatte ihm im beim vorbeireiten mit dem Säbel ein Ohr abgehauen und ihn dadurch zu Boden geschlagen. Es ist
ihm danach gelungen ins Gebüsch zu schleichen. Sein Kopf war schon verbunden als wir ihn trafen. Später wurde an der
Stelle des Überfalls ein Gedächtnisstein errichtet.
Im Morgengrauen sah man viele Kosaken über die Felder reiten. Wir sind dann später wieder weiter in Richtung
Jellinowen gefahren. Unser Vater ist mit dem Pferdewagen die Landstraße entlang gefahren. Wir mit dem Vieh sind
entlang einer tiefen Schlucht durch den Wald bis zum Babanter See gegangen. Wir hatten schon vorher versucht die
Schlucht zu verlassen aber wegen der steilen Hänge ist es uns leider nicht gelungen. Am See angekommen fanden wir drei
große Schober mit Getreide vor. Von einem dieser Schober haben uns zwei Kosaken mit einem Fernglas beobachtet. Sie
schwangen sich auf ihre Pferde und kamen uns entgegen geritten, dann hielten sie uns ihre Lanzen vor die Brust und
versuchten uns auszufragen. Wir haben leider nichts verstanden und fingen an zu weinen. Plötzlich pfiff der
Patrollienführer auf einer Trillerpfeife und die Kosaken kehrten zu ihrem Ausgangspunkt zurück.
Als wir dann weiter am See entlang gingen sahen wir von weitem drei Gehöfte. In der Nähe einer dieser Höfe hatte unser
Vater den Pferdewagen im Gestrüpp abgestellt. Die vorrückenden Schützenlinien der russischen Infanterie hatten ihn
jedoch entdeckt. Sie haben den Wagen durchwühlt und den Sack mit Rauchfleisch mitgenommen. Andere Flüchtlingswagen die
in diesem Gebüsch Schutz gesucht haben sind nicht besser davon gekommen. Wir haben das Vieh auf einen der Höfe
getrieben und am Zaun festgebunden. Dann haben wir mit Hilfe einer Leiter den Heuboden erklommen und uns dort versteckt.
Als die Kosaken auf dem Hof erschienen verlangten sie Brot und Milch. Die Frauen mussten zuerst essen und trinken,
danach haben es die Russen auch getan, sie fürchteten sich davor, dass man sie vergiften könnte. Später kam dann die
russische Infanterie und hat Haus, Scheune und Schuppen durchsucht. Die Falltüre zum Heuboden ließ sich nur nach oben
hin öffnen. Wir hatten die Türe von oben mit schweren Gegenständen beschwert, aber die Russen versuchten mit aller
Gewalt auf den Heuboden zukommen. Als die Frauen das sahen, sagten sie zu den Russen, da oben würden sich ihre Kinder
versteckt halten. Die Russen forderten nun, die Kinder sollten sofort den Heuboden verlassen. Die Mütter riefen nun
nach ihren Kindern die dann auch tatsächlich den Heuboden verließen. Als wir das sahen, haben wir uns am Giebel tief
im Heu vergraben. Drei Russen kamen nun rauf und stocherten mit ihren Bajonetten im Heu herum. Glücklicherweise kamen
sie nicht in unsere Nähe. Als die Russen den Heuboden verließen haben wir befürchtet sie würden ihn in Brand setzen.
Wahrscheinlich taten sie deshalb nicht weil so viele russische Soldaten auf dem Hof waren. Einige Zeit später
erschienen russische Offiziere auf dem Hof, mit einem Auto. Sie sagten, sie hätten das Land erobert und wir hätten ab
sofort dem russischen Zaren zu gehorchen. Wir wurden angewiwsen nach Hause fahren und unbesorgt unsere Ernte
einzubringen. Sie haben uns auch eine Bescheinigung ausgestellt, damit uns auf dem Heimweg niemand die Pferde und
das Vieh wegnehmen würde.
Erst am nächsten Morgen, als die Front weiter vorgerückt war, beschlossen wir die Heimreise anzutreten. Die Straßen
waren mit vorrückenden russischen Truppen blockiert. Manchmal mussten wir stundenlang am Wegesrand warten bis die
Soldaten mit ihrem Tross vorbeigezogen waren. Unterwegs wollten sie unser Vieh zum Schlachten wegnehmen, aber die
Bescheinigung hat uns davor bewahrt. Die Eisenbahnbrücke vor Neu-Keykuth wurde von Kavallerie bewacht. Die wollten uns
nicht drüber lassen und hielten uns bis zum frühen Morgen fest. Zurück in Rohmanen angekommen, konnten wir unser Haus
nicht betreten weil der Hof und alles rundherum ein großes Militärlager war.
Wir sind dann in Richtung Seelonken gefahren, bis Abbau Brosch. Auf dem Hof angekommen haben wir zuerst Grünfutter für
die Pferde vom Feld geholt und anschließend Mittag für uns selbst gekocht. Die Nacht haben wir erstmal auf dem Hof
verbracht. Am nächsten Morgen wagten wir es ins Dorf zu gehen um die Lage zu erkunden. Die Russen waren schon wieder
weiter gezogen, aber Haus und Hof waren in einem schrecklichen Zustand. Wir sind dann gegen Abend wieder nach Hause
zurückgekehrt.
Am 23. August 1914 waren die Russen bei uns eingebrochen, bis sie am 28. August von den Deutschen zurückgeschlagen
wurden. Dann fuhren sie wieder zurück, drei Wagen nebeneinander. Ortelsburg brannte lichterloh. Ein Wagen mit Mehl war
uns gegenüber in den Straßengraben gekippt, aber wir haben nichts davon genommen, weil man ja nicht wusste ob man die
Nacht überleben würde. Wir saßen die ganze Zeit im Keller. Am nächsten Morgen zog dann russische Kavallerie und
Infanterie durch unser Dorf. Die Kavallerie ritt orientierungslos hin und her. Die Infanterie hat den ganzen
Vormittag 1,5 Meter tiefe Schützengräben ausgehoben. Um 11 Uhr kamen aus Richtung Eichtal 3 deutsche Spähwagen nicht
ahnend dass die nördliche Hälfte des Dorfes noch von Russen besetzt war. Wir haben zu diesem Zeitpunkt auf dem
Dachboden Weizen eingesackt und hatten aus diesem Grunde einen weiten Rundblick.
Um 11 Uhr kamen aus Richtung Eichtal drei deutsche Spähwagen angefahren. Als wir die deutschen Soldaten erkannt hatten,
haben wir sie durch Handzeichen gewarnt weiter nach Norden vorzustoßen. Die Kosaken hatten sich auf den Häuserdächern
positioniert und in Richtung Norden nach deutschen Truppen Ausschau gehalten. Die Deutschen sprangen von den Spähwagen
und fingen an die nichts ahnenden Russen zu beschießen. Als die sich ihrer gefährlichen Lage bewusst wurden verließen
sie ihre Aussichtsposten und bestiegen ihre Pferde. Mit Peitschenhieben versuchten sie, die sich in panikartiger Flucht
befindliche Infanterie dazu zu Bewegen, die Deutschen anzugreifen. Zwei Spähwagen wendeten sofort, der Dritte konnte
nicht mehr umkehren. Es gelang allen, bis auf den Fahrer des dritten Wagens die Flucht. Die Russen nahmen ihn sofort
unter Beschuss, doch es gelang ihm über unseren Hof zu entkommen. Auf der rückwärtigen Seite schlug er sich quer durch
die Gärten bis zum Gehöft von Friedrich Sakowski durch. Der versteckte ihn im Keller und versorgte ihn anschließend
mit Zivilkleidung.
Als die Russen den Soldaten auf unseren Hof laufen sahen nahmen sie sofort die Verfolgung auf. Sie durchstöberten auch
die Nachbarhäuser und trieben die Bewohner auf der Straße zusammen. An der Spritzenwagenremise richteten sie einen
Sammelpunkt ein. Unter dem Vorwand es würde hier eine Schlacht stattfinden, versuchten die Russen die Zivilbevölkerung
aus dem Dorf zu drängen. Alle die dem Aufruf gefolgt sind und an unserer Sammelstelle vorbeikamen wurden unserem Haufen
hinzugefügt. Unter ihnen befand sich auch der deutsche Soldat in Zivilkleidung. Er hatte einen Sack über die Schulter
geschlagen in dem sich ein Brot befand, an der anderen Hand führte er eine Kuh am Strick. Als unser Haufen schon aus
etwa 50 Leuten bestand setzten uns die Russen mit Marschrichtung Seelonken in Bewegung. Wir Jungen versuchten in einem
unbeaufsichtigten Moment wegzulaufen, doch die Begleitmanschaft prügelte uns mit Gewehrkolben wieder in Reihe und Glied.
Unterwegs gelang es dem Soldaten mit der Kuh unbemerkt zu entkommen. Er kehrte unbehelligt ins Dorf zurück und lieferte
die Kuh wieder dort ab wo er sie entführt hatte.
Uns haben die Russen an Seelonken vorbei zum Sylvensee getrieben. Wenn sie von vorbeiziehenden russischen Offizieren
gefragt wurden weshalb wir unterwegs wären, sagten sie denen wir hätten deutsche Soldaten versteckt und wollten das
Versteck nicht verraten. Als wir am See vorbei waren begann die deutsche Artillerie aus Richtung Ortelsburg zu
schießen. Unweit von uns explodierten Granaten und richten ein großes Chaos unter Freund und Feind an. Es hieß dann
rette sich wer kann. Die Russen verließen uns in Richtung Waldpuschsee und wir kehrten orientierungslos nach Seelonken
zurück. Nach Rohmanen konnten wir nicht zurück weil die deutsche Artillerie aus Richtung Eichtal anfing unser Dorf zu
beschießen. Schließlich sind wir auf dem Abbau Brosch untergekommen. Ein durch Granatsplitter schwer verletzter Russe
suchte dort auch Zuflucht. er versucht sich mit einem Messer das Leben zu nehmen. es gelang den Frauen ihn davon
abzubringen, weil sonst bei einem etwaigen erscheinen von russischen Soldaten der Verdacht auf uns gefallen wäre.
Später erschienen tatsächlich Kosaken die ihn dann mitgenommen haben. Ihnen folgten in 50 Meter Entfernung Deutsche
Ulanen, die hinter den Russen in einem in der Nähe liegenden Wäldchen verschwanden.
Nachdem die Russen Rohmanen besetzt hatten, versteckten sie sich vorwiegend in mit Stroh gedeckten Gebäuden. Durch
Schießscharten, die sie im Strohdach anlegten, schossen sie auf die deutschen Kampfverbände, die sie wieder vertreiben
wollten. Um die Angreifer zu entlasten, wunde das Dorf von deutscher Seite unter Beschuss genommen. Durch die
Geschosse der deutschen Artillerie entstanden in Rohmanen viele Brände. Die mit Stroh gedeckten Gebäude fielen zuerst
in Schutt und Asche. Unser Vater hatte uns ins Dorf geschickt, damit wir das Vieh im Stall von der Kette losbinden
sollten. Am Dorfrand kamen uns schon deutsche Ulanen und Husaren entgegen. Rohmanen brannte an mehreren Stellen. Unser
Hof war noch unversehrt, nur die Zäune standen schon in Flammen. Wir haben das Vieh los gebunden und anschließend
versucht die Brandherde rund herum zu löschen. Es gelang uns die Flammen von unserem Hof fernzuhalten und auch bei
unserem Nachbarn einzugreifen. In vielen Scheunen und Ställen hatten sich noch viele versprengte Russen versteckt. Die
wurden anschließend von deutschen Soldaten eingesammelt und in Gefangenenlager abgeführt. Am nächste Tag haben wir dann
zerbrochene Gewehre und Munition in Körbe gesammelt und im Dorfteich versenkt.
Am 29. August haben die Russen Rohmanen verlassen, doch schon am 30. August sind sie wieder zurückgekehrt. Hauptlehrer
Müller wurde mit seinem Sohn und Karl Deptolla auf Fahrrädern fahrend von einer russischen Patrouille aufgegriffen.
Sie wurden von den Russen der Spionage verdächtigt weil der Lehrer Müller ein Fernglas bei sich trug. Der Sohn hatte
eine Gymnasiastenmütze und eine Landkarte bei sich. Sie wurden in Richtung Lehmanen abgeführt. Auf einer Anhöhe des
Grundstücks von Ernst Chittka befand sich eine nicht mehr betriebstaugliche Windmühle. Dort soll ein russisches
Kriegsgericht sie zum Tode verurteilt haben. Nach der Hinrichtung wurden sie in der Nähe der Windmühle verscharrt.
Später wurden sie wieder ausgegraben, in Särge gelegt und auf dem Rohmaner Friedhof beigesetzt. Die Ehefrau von Lehrer
Müller hat die Gräber nach dem 1. Weltkrieg mit einem schmiedeeisernen Zaun umrandet.
Die Kämpfe um Rohmanen haben viele Menschenopfer gekostet. Bei uns hinter der Scheune lagen 2 tote Russen und ein
Verwundeter. Die Toten haben wir in einer Kartoffelmiete vergraben. Alle anderen Gefallenen wurden auch gleich an der
Stelle an der sie zu Tode kamen verscharrt und mit einem Kreuz gekennzeichnet. Für die im Raum Rohmanen gefallenen
Russen wurde nach dem Krieg hinterm Dorf, in Richtung Ortelsburg, auf einer Anhöhe ein Heldenfriedhof angelegt. Dort
liegen 20 Soldaten und 1 Offizier. In der Mitte befindet sich ein Trauerbaum und Birken säumen den Zugang von der
Landstraße her. Der Lehrer Dorka hat nach dem Kriege, mit seinen Schülern immer die Gräber gepflegt.
Meine Einberufung zum Militär

Bis zu meinem 17. Lebensjahr habe ich meinem Vater in der Landwirtschaft geholfen. Im Frühjahr
1916 wurde unser Jahrgang gemustert. Im Herbst 1916 erhielten Gustav Spektor, Johann Resonek und ich einen
Einberufungsbescheid. Wir mussten uns in Allenstein im Kaisergarten melden. Dort wurden Rekruten aus mehreren
Landkreisen zusammen gezogen und danach verschiedenen Ausbildungszentren zugeteilt. Wir Rohmaner kamen zum 18.
Infanterie-Regiment nach Osterode. Ein Unteroffizier mit einer Gruppe Musketiere haben uns von Allenstein abgeholt.
Als wir in der Kaserne ankamen haben wir sofort Mittagessen in Blechnäpfen bekommen. Untergebracht wurden wir im
Dachgeschoß der Kaserne. Es waren keine Betten vorhanden, nur Strohsäcke lagen auf dem Boden.
Als dann einige Tage später ausgebildete Kompanien an die Front ausrückten durften wir in einen anderen Block umziehen.
Wir wurden der Größe nach aufgestellt, in Korporalschaften eingeteilt und dann von Kopf bis Fuß eingekleidet. Die
Ausgehuniformen hatten blanke Knöpfe dazu einen Schako mit blanker Spitze. Im neuen Block hatten wir 2stöckige Betten.
Unsere Zivilbekleidung mussten wir in einen Karton verpacken und nach Hause schicken. Dann erst begann das eigentliche
Kasernenleben. Die Kaserne durfte niemand ohne Erlaubnis verlassen, nur in Begleitung eines Unteroffiziers. In der
Kaserne war eine Kantine in der man alles kaufen konnte was in der Kaserne gebraucht wurde.
Am nächsten Tag kam unser Kompanieführer, im Range eines Hauptmanns, zu Pferde angeritten. Er begrüßte uns mit;
Guten Morgen Kameraden, wir antworteten ihm mit; Guten Morgen Herr Hauptmann. Er hat dann die Front abgeschritten und
jeder musste sich mit seinem Namen vorstellen. Um 5 Uhr wurde geweckt, 6 Uhr Kaffee holen, 7-8 Uhr Unterricht, 8-11
Uhr exerzieren auf dem Kasernenhof. Um 11.30 blies der Trompeter zur Mittagspause. Die erste Zeit war noch alles
ziemlich gemütlich aber dann wurde es von Tag zu Tag strenger. Um 10 Uhr abends war Zapfenstreich, dann ging der
Unteroffizier vom Dienst von Stube zu Stube, der Stubenälteste musste die Anwesenheit aller Rekruten melden; zum
Beispiel: Stube 56 belegt mit 14 Mann, alle zu Haus. Wir mussten in 2 Reihen antreten, mit Drillichanzug bekleidet
und in Pantoffeln, ein tadelloses Aussehen präsentieren. Der Diensthabende Unteroffizier prüfte ob alle
vorschriftsmäßig angezogen, gewaschen, gekämmt und ob alle Knöpfe an der Jacke geschlossen waren. Als er bei einem
Rekruten einen offenen Knopf erspähte, hat er uns gefragt, ob jemand ein Taschenmesser bei sich hat.
Wir ahnten nicht Gutes, darum haben wir uns ganz still verhalten und nichts gesagt. Da sagte der U.v.D. plötzlich:
”Wenn niemand von euch ein Messer bei sich hat, dann habe ich ein”. Er zog sein Messer aus der Tasche und fing an, bei
dem Rekruten die Knöpfe abzuschneiden. Als die Knöpfe zu Boden purzelten, brachen wir in lautes Gelächter aus. Das hat
ihn so in Rage gebracht, das unser unwürdiges Benehmen, zuerst mit einem „Donnerwetter” bestraft wurde. Dann schrie
er: ”In den Korridor marsch, marsch, die Treppen runter bis auf den Hof”. Als wir unten angekommen waren hieß es
wieder; "Zurück auf die Stube in der 3. Etage”. Jemand hat mir bei dem Durcheinander, von hinten in den Pantoffel
getreten, so das er auseinander gerissen wurde. Ich bin dann nur mit einem Pantoffel und einem Socken die Treppen rauf
und runter gelaufen. So wurden wir 3-mal hinunter und wieder hinauf gejagt.
Danach ließ er uns wieder antreten und hat mit einer Taschenlampe unter den Betten geleuchtet. Plötzlich schrie er
wieder los: "Das nennt ihr Fegen? wenn ihr mit dem Besen nicht fegen könnt, dann mühst ihr das mit eueren Bäuchen tun.
Marsch, marsch unter die Betten” . Als wir schon alle am Schlafen waren, kam der U.v.D. wieder und hat nachgesehen ob
alle Schränke abgeschlossen waren. Ein Kamerad hatte seinen Schlüssel verloren, deshalb hat er das Schoß nur so
eingehängt. Als der U.v.D. das bemerkte hat er die Türe aufgerissen, die ganzen Sachen aus dem Schrank, quer durch die
Stube verteilt und war dann endlich gegangen.
Die Anziehsachen mussten, fein sauber gefaltet, auf dem Stuhl liegen; da drauf die Socken und die Pantoffeln unter dem
Stuhl. Die Stühle mussten in einer Reihe ausgerichtet sein; die Hosenträger im Schrank einschlossen und der Brustbeutel
mit Geld auf dem Hals tragen werden. Morgens wurden wir geweckt und kamen zuerst in den Waschraum. Jeder musste seinen
entblößten Oberkörper mit kaltem Wasser abreiben. Da draußen strenger Frost herrschte war es im Waschraum auch sehr
kalt, so das manche ihr Hemd anbehielten. Der UvD hat dann bei seinem Kontrollgang alle Verweigerer aufgeschrieben
und ihnen befohlen in 30 Minuten mit einem Besen in der Hand auf der Schreibstube zu erscheinen. Einige mussten den
Kasernenhof fegen, andere die zugefrorenen Latrinen enteisen und reinigen. Während unserer Ausbildungszeit durften wir
die Kaserne nicht verlassen. Wenn man Stuben- oder Frühdienst hatte, blieb keine Zeit zum Frühstücken.
Nach 6 Wochen wurden wir in der Grollmann Kaserne vereidigt. Die Regimentskapelle spielte "Heil dir im Siegerkranz",
danach folgten 3 Strophen des Deutschlandliedes. Vor der Vereidigung wurden die Rekruten gefragt wer keine deutsche
Staatsangehörigkeit besitzt. Es sind dann Luxemburger und auch noch welche aus anderen Ländern hervorgetreten. Sie
wurden gefragt ob sie die deutsche Staatsangehörigkeit annehmen wollen. Die das abgelehnt haben wurden auf die
Schreibstube gerufen und sofort aus dem Militärdienst entlassen. Nach der Vereidigung erfolgte ein Kirchgang, danach
konnte man einen Stadturlaub beantragen. Nach dem Mittagessen mussten alle, die einen Urlaubschein beantragt hatten
vor der Kaserne antreten. Der Hauptfeldwebel prüfte dann ob an der Uniform alle Knöpfe blank geputzt waren, die Stiefel
glänzten und der Rekrut auch vorschriftsmäßig grüßen konnte. Wer diese Anforderungen nicht erfüllen konnte musste
seinen Urlaubschein wieder abgeben und zurück auf sein Zimmer gehen.
Wenn man die Kaserne für eine gewisse Zeit verlassen wollte, mussten zuerst der Korporal, dann der Hauptfeldwebel und
letzt endlich der Hauptmann, seine Zustimmung erteilen. Es wurde geprüft; ob die Ausgeh-Uniform sitzt, alle Knöpfe
blank geputzt sind und der Helm so blank ist das man sich darin spiegeln kann. Unser Hauptmann war in Zivil,
Bürgermeister von Osterode. Er war sehr stolz wenn er seine Kompanie, in Parade Uniform und mit einem fröhlichen Lied
auf den Lippen, durch seine Stadt führen durfte.
Als wir eines Tages zum etwa 6 Kilometer entfernten Schießstand marschieren sollten, war es sehr kalt und glatt. Der
Hauptmann ritt durch das große Tor, wir aber sind durch das kleine Tor gegangen und haben eine steil bergab führende
Abkürzung gewählt. Die Zug- und Gruppenführer gingen voraus und wir im Gänsemarsch hinterher. Ein Kamerad hat sich auf
den Gewehrkolben gesetzt und ist darauf den Berg hinunter gerutscht. Als die Anderen das sahen haben sie es ihm
nachgemacht und hatten einen Riesenspaß. Da kam der Hauptmann plötzlich im Galopp angeritten; ließ alles anhalten und
hat zuerst die Zugführer ausgeschimpft, dann anschließend die ganze Kompanie. Er sagte: „Wie könnt ihr es wagen, so
mit eueren Gewehren umgehen. Ein Gewehr soll man wie seine Braut behandeln und nicht wie einen Straßenbesen”. Zur
Strafe mussten wir, links und rechts der Straße, in zwei Reihen antreten und durch den verschneiten Straßengraben
robben. Die Herrn Zug- und Gruppenführer durften die Straße benutzen und erteilten uns nur Befehle, wie: hinlegen,
nach rechts schwenken, nach links schwenken, einzeln vorarbeiten und sammeln. Als wir dann abgekämpft, in Linien zu
2 Glieder angetreten waren, ging es mit Gesang zum Schießstand.
Auf dem Schießstand angekommen, erhielten wir zuerst eine praktische Unterweisung, für den Gebrauch von Schusswaffen.
Wir mussten solange mit einem nicht geladenen Gewehr üben, bis wir unserem Vorgesetzten beweisen konnten, dass wir
alles im Griff haben. Daraufhin wurden jedem 10 Patronen zugeteilt, so das er unter der Aufsicht eines Unteroffiziers
mit den Schießübungen beginnen konnte. Der Unteroffizier hat die Position der Einschüsse, auf der Scheibe, in einem
Buch eingetragen und nach Beendigung der Übung dem Hauptmann Bericht erstattet, ob der Schütze seine Aufgabe erfüllt
hat oder nicht. Nach dem Schießen wurden die Gewehre zu Pyramiden zusammengestellt. Diejenigen die ihre Aufgabe nicht
erfüllt haben, mussten rund um die Zielscheibe, die Bleikugeln aufsammeln.
Seit unserer Einberufung hatten wir noch keinen Heimaturlaub. Urlaub bekamen nur die, die ihren Heimatort zu Fuß
erreichen konnten. Wegen der vielen Truppentransporte die täglich von Ost nach West unterwegs waren durften wir die
Eisenbahn nicht benutzen. Einmal wurde uns gesagt; wenn jemand gut schießen kann der bekommt Heimaturlaub, aber auch
das war nur ein leeres Versprechen.
Kaisers Wilhelms Geburtstag
Der beste Tag war des Kaisers Geburtstag. Am 27. Januar mussten alle in der Grollmann Kaserne
antreten, der Battalions-Kommandeur beendete seine Laudatio mit den Worten: Seine Majestät, unser Kaiser und König
Wilhelm II, erlebe hoch, hoch, hoch. Dann spielte die Regimentskapelle: Heil dir im Siegerkranz, Herrscher des
Vaterlands, Heil Kaiser dir. Danach folgten 3 Strophen des Deutschlandliedes und anschließend fand ein Gottesdienst
statt. Anschließend gab es ein vorzügliches Mittagessen, Schweinebraten, ein Stück Wurst auf die Faust und Biermarken,
die man in der Kantine gegen gutes Bier einlösen konnte, danach Urlaub bis zum Wecken, ohne Urlaubschein. Mein Vater
und die Mutter eines Kameraden waren schon morgens angekommen, konnten uns aber nicht finden, wurden von einer Kaserne
in die andere geschickt. Erst als wir mit Musik, von der Kirche zurück zur Kaserne marschiert sind habe ich sie
zufällig entdeckt. Als sie mich auch erkannt haben, sind sie nachgekommen. Da war die Freude groß: Der Vater hatte
einen großen Koffer auf einem Krückstock über die Schulter getragen. Ich ging gleich zur Wache und habe sie angemeldet,
sie sind dann bis zum Abend geblieben. Es war einer der schönsten Tage in der Grollmann-Kaserne in Osterode.
Alle 10 Tage bekamen wir Sold. Vor der Auszahlung mussten wir antreten, jeder wurde gefragt ob noch Restgeld vom
letzten Sold vorhanden war. Dann bekam jeder 3,30 Mark, davon musste man noch Sidol für das Koppelschloss und
Schuhkreme für die Stiefel kaufen. Wer geraucht hat und nichts von zu Hause bekam war schlimm dran. Beim Militär bekam
man nicht nur die Ausbildung an der Waffe beigebracht, man lernte auch putzen, nähen, Strümpfe stopfen und vieles
Andere. Man bekam einen beschädigten Strumpf, der musste aufgeribbelt werden, mit der Wolle konnte man dann andere
Strümpfe stopfen oder Kleidungsstücke mit Namen kennzeichnen. wer das nicht konnte, der musste seinen Kameraden
Zigaretten oder Geld geben die das dann für ihn erledigten.
Verschiedene Kameraden gingen nach dem Dienst noch in die Stadt. Um 21:45 Uhr wurde zum Zapfenstreich geblasen, dann
musste man schnell zurück in die Kaserne, weil um 22:00 Uhr der Wachhabende von Bett zu Bett ging und prüfte ob auch
alle anwesend waren. Zwei mal pro Woche fanden Gewaltmärsche statt, mit vollem Gepäck im Tornister. Am Ende der
Marschkolonne fuhr dann ein Pferdewagen, wenn der Feldarzt bei jemandem einen Erschöpfungszustand feststellte, der
durfte dann aufsitzen. Am Sonnabend wurden auf dem großen Exerzierplatz Felddienstübungen durchgeführt, es befand sich
dort ein großer Hügel, den wir immer wieder erstürmen mussten. Am Nachmittag war Revierreinigen angesagt, wir mussten
dann die Tische schrubben, auf einen Tisch wurde Sand mit etwas Wasser gestreut, der nächste Tisch wurde mit der den
Beinen nach oben drauf gelegt und solange hin und her geschoben bis beide sauber waren. Mit den Stühlen geschah das
Gleiche. Dann wurde der Fußboden in der Stube geschrubbt, die Schränke abgewaschen, Staub geputzt, zuletzt kamen Flur
und Treppe dran.
Für die Arbeit war eine Stunde angesetzt, wenn jemand zu früh fertig war erregte er den Argwohn des Diensthabenden
Korporals, der prüfte dann alles genau, fand natürlich immer etwas das nicht seinen Erwartungen entsprach. Der
Übereifrige musste dann Nacharbeiten bis die Stunde um war. Eine Stunde war für Gewehr reinigen und Unterricht an der
Waffe vorgesehen.
Im Februar wurden wir neu eingekleidet; Schnürschuhe, Koppel, alles gelbes Leder mussten wir mit Lederschwärze
behandeln. 2 Wolldecken, Uniform und Helm in feldgrau, da brauchten wir die Knöpfe nicht mehr zu putzen. Die neuen
Gewehre mussten zuerst eingeschossen werden. Es wurden 90 scharfe Patronen und Marschverpflegung ausgegeben, danach
mussten wir mit vollem Gepäck zum Appell antreten. Man konnte kaum gerade stehen, weil der Tornister einen in die Knie
zwang. Der Major, der die Aufstellung besichtigte rief >Brust raus<, dann informierte er uns dass wir ins
Feldrekrutendepot und in Feindesland kommen. Urlaub bekam niemand. Ich habe ein Telegramm nach Hause geschickt, mit
der Nachricht dass wir bald abrücken werden. Einen Tag vor dem ausrücken hat mich meine Mutter noch besucht, sie hat
mir vieles mitgebracht. Alles konnte ich nicht mitnehmen, weil es nicht gestattet war anderes Gepäck bei sich zu haben
als dem Soldaten zustand.
Abmarsch zum Fronteinsatz
Am nächsten Tag hat uns die Regimentskapelle mit Musik zum Bahnhof gebracht. Von Osterode ging
es über Thorn, Posen,
Annaberg, Warschau, Brestlitowsk ins Pruschana-Lager. Das war eine russische Artillerie-Kaserne, in der 2 deutsche,
3 österreichische Bataillone und eine Offiziersschule untergebracht waren. Ein Bataillon das waren wir 18 und 19
jährige, die Anderen waren Männer bis 45 Jahre. Als wir in Osterode abfuhren lag Schnee, in Annaberg/Schlesien waren
die Kühe auf der Weide und im Pruschana-Lager lag der Schnee wieder einen Meter hoch. Drei Kilometer vor unserem vor
unserem Lager war die Bahnfahrt zu Ende. Mit den schweren Tornistern waren viele überfordert, wir mussten immer wieder
warten bis alle nachkamen. Unsere Unterkünfte das waren Baracken die den Russen als Pferdeställe gedient hatten. In
jeder Baracke wurde eine Kompanie mit Schreibstube untergebracht, die nur durch ein Zelt abgegrenzt war.
Wir haben aus Brettern Doppelbetten hergestellt, in jeder Baracke war ein Ziegelofen. Unsere neuen Uniformen und die
scharfe Munition mussten wir abgeben und bekamen dafür alte Bekleidung, sowie Ecksezierpatronen. Hier ging es wieder
Kasernenmäßig zu, das jüngere Bataillon bekam besseres Essen, doppelte Portionen und nach dem Essen 2 Stunden Bettruhe.
Wenn jemand die Bettruhe nicht einhielt und dabei erwischt wurde wusste zur Strafe Holz hacken oder Schnee schaufeln.
Zwei Wochen war Frost bis minus 40 Grad, da hatten wir keinen Unterricht im Freien, alle Aktivitäten fanden in der
Baracke statt, die nur mit nassem Holz beheizt wurde und dem entsprechend war auch die Temperatur im Inneren. Um
Brennmaterial für die Küche zu besorgen mussten wir ins nächste Dorf gehen und von zerfallenen Häusern Holz holen.
Als endlich das Tauwetter einsetzte verwandelte sich die Gegend um Baranowitschi in ein unüberwindbares Sumpfgelände.
Wir wurden mit anderen Einheiten die aus Frankreich zu uns verlegt wurden, zusammengelegt. Wenn jemand nachweisen
konnte dass er Landwirt ist und mehr als 100 Morgen Ackerland besitzt, konnte er einen Urlaub zur Frühjahrsbestellung
beantragen. Ein Gottlieb Piotrowski aus Plohsen hat seinen Urlaub bewilligt bekommen und durfte für 14 Tage nach Hause.
Wenn von der unweit entfernten Front Kanonendonner zuhören war und Alarm ausgerufen wurde, dachten wir es geht los.
Obwohl wir als Reserve aufgestellt waren mussten wir allzeit einsatzbereit sein. Wir haben auch Bunker und Stollen
gebaut, Schützengräben ausgeworfen und mit scharfen Handgranaten exerziert.
Als Gottlieb Piotrowski nach 2 Wochen zurückkam waren wir schon in Alarmbereitschaft und sind dann auch 2 Tage später
ausgerückt. Kamerad Piotrowski hatte mir noch ein großes Paket von zu Hause mitgebracht.
Italien hat Deutschland und Österreich den Krieg erklärt.
Zuerst sind drei Bataillone Österreicher ausgerückt, dann die Deutschen hinterher. Bis zum
Bahnhof Linowa wurden wir von einer Musikkapelle begleitet, dann ging es per Eisenbahn ab nach Baranowitsche. Dort
wurden wir der, an der Westfront aufgeriebenen, 15ten Reserve Division zugeteilt. Es wurde uns gesagt das Kameraden
aus der Heimat gleichen Gruppen zugeordnet werden können. Ich hatte einen Freund aus meinem Dorf, Gustav Spektor,
einen aus Groß Schöndamrau, Wilhelm Lukas und einen aus Ortelsburg, Karl Schlensack, wir kamen zu zusammen in eine
Kompanie. Zuerst waren wir in einem Kinosaal einquartiert, haben jeden Tag Schützengräben ausgehoben und Feldübungen
gemacht. Es war ein sumpfiges Gelände, so dass die Soldaten wegen den vielen Mücken, Netze auf den Köpfen tragen
mussten. Nach einem Gewitter wurde es plötzlich unerträglich. Die Mücken hatten meinen Freund so zerstochen dass sein
Gesicht dermaßen angeschwollen war und ich ihn gar nicht wieder erkannt habe.
Von Baranowitsche wurden wir wieder auf die Eisenbahn verladen, die uns mit unbekanntem Ziel Richtung Osten fuhr.
Nachdem wir unterwegs einmal zum Essenfassen gehalten haben, kamen wir in der Nacht in Krakau an. In der nächsten
Nacht befanden wir uns schon in den Karpaten, wo wir die Hügelketten zu Fuß überqueren mussten, die Fahrzeuge fuhren
um die Berge herum und wir mussten manchmal 2 Stunden warten bis sie uns wieder eingeholt hatten. So ging es immer
weiter bis wir auf einen Berg kamen wo wir Zelte aufgebaut und Biwak bezogen haben. Dort stießen wir auf türkische
Einheiten die auf Mauleseln Munition und Verpflegung über die Berge transportiert haben. Die Esel hatten ein Gestell
auf dem Rücken, auf jeder Seite eine Fass mit Wasser oder Kisten mit Proviant. Ihre Artillerie wurde von 6 Mauleseln
gezogen, während die Offiziere, ohne Sattel, ohne Zaumzeug, nur mit einem Hanfseil ausgerüstet, daher kamen.
Die Mannschaften marschierten wie es jeder für richtig hielt, mit aufgekrempelten Ärmeln, das Gewehr über den Tornister
gelegt, wie die Wilddiebe. Im Gegensatz dazu herrschte bei uns strenge Disziplin, wen jemand aus der Reihe ging kam
sofort der Kompanieführer angeritten, hat uns angeschrieen, uns klar gemacht dass wir keine Türken seien und nur auf
höheren Befehl etwas an der Marschordnung ändern dürften, wer dagegen verstoße, müsste mit einem 3tägigen Arrest
rechnen. Wir haben hinter der der Front Gewaltmärsche durchgeführt die dem Feind große Truppenaufmärsche vortäuschen
sollten.
Wir lagen in einem Buchenwald in Bereitschaft. Überläufer berichteten dass auf russischer Seite eine Großoffensive
vorbereitet wird. In einer Nacht wurde plötzlich Alarm geschlagen, der Russe war zu einem Angriff mit Gasgranaten
übergegangen. Wir lagen unter Zelten und hatten die Gasmasken gar nicht bei uns, sondern nur etwas abseits liegen. In
der Dunkelheit hat mach einer keine Gasmaske mehr gefunden. Es war ein fürchterliches Durcheinander. Dabei war es
unsere Pflicht die Maske immer an dem Tragriemen über dem Hals zu tragen, mit halb geöffnetem Deckel. Uns hat es zum
Glück nicht so stark betroffen weil wir auf einer Anhöhe lagen und die Gaswolken sich im Tal verteilten. Wir wurden in
höchste Alarmbereitschaft versetzt weil der Russe die österreichische Front durchbrochen hatte.
Eigentlich sollten wir noch an einer Gulaschkanone Essen fassen, aber es blieb uns dazu keine Zeit mehr. Der
Kompanieführer befahl uns die Zelte abzubrechen, auf den Tornister aufzurollen und in fünf Minuten marschbereit zu
sein. Die Kanoniere befanden sich schon in der Batteriestellung, luden die Granaten, die sofort abgefeuert wurden. Der
Battalions-Kommandeur versammelte die Kompanieführer und erteilte ihnen die Angriffsbefehle. Derweil sollten wir in
einem Eichenwal der schon mit Granattrichter übersät war, Deckung suchen. Bald hatten wir die Verbindung zu unserem
Batteriestab verloren. Wir warfen unsere Tornister auf einen Haufen, schwärmten unverzüglich, nur mit Sturmgepäck
ausgerüstet, 4 Handgranaten im Brotbeutel, zum Angriff aus. Wir robbten uns einzeln voran. Weil der Russe unsere
Stellungen schon überrannt hatte war jeder auf sich selbst angewiesen. Mann hörte kein Kommando mehr weil der Russe
inzwischen den Rückzug angetreten hatte, um sich auf einer Bergspitze zu verschanzen, von der er uns mit
Flachbahngeschützen beschoss. Irgendwann befanden wir uns in einem Schützengraben, wo ein Leutnant und 17 Mann aus
unserer Division die Stellung hielten. Unter Androhung von Gewalt befahl er uns den Graben sofort zu verlassen und am
Gegenangriff teilzunehmen. Wir sprangen über den Stacheldraht, duckten uns aber sofort im nächsten Graben damit das
mörderische Maschinengewehrfeuer uns nicht hinwegfegte.
Dort blieben wir bis zum Eintritt der Dunkelheit liegen. Wir konnten unsere Waffen nicht mehr einsetzen weil der Sand
die Gewehrschlösser blockiert hatte. Als es Nacht wurde herrschte ein gespenstische Stille. Wir krochen aus dem
Schützengraben und lauschten nach irgendeinem Lebenszeichen von anderen Kameraden. Dann hörten wir irgendwelche Laute
die wir nicht genau zuordnen konnten. Sie kamen aus einem Holzbunker ganz in der Nähe. Wir näherten uns ganz
vorsichtig, als plötzlich eine Schar österreichischer Soldaten herausstürmte. An unseren Stahlhelmen erkannten sie
dass wir Deutsche sind. Bald danach trafen wir auch auf 69 deutsche Soldaten die zu unserer Division gehörten. Dann
kam ein Hauptmann der uns mit Vorwürfen überschüttete, wir seien Feiglinge, wir hätten uns von unserer Einheit entfernt.
Wir haben ihm den Vorgang geschildert, aber ließ nicht mit sich reden und sagte nur dass wir bestraft werden und nichts
zu essen bekommen. Wir wurden einer Maschinengewehr Einheit zugeteilt welche die vorderste Stellung verteidigen
musste. Wir hatten einen Stollen mit 2 Ausgängen.
Die Russen haben bemerkt das sich etwas bewegte und haben uns unverzüglich mit Artilleriefeuer belegt. Schon die
dritte Granate war ein Volltreffer. Vier Kameraden waren sofort tot, ich bekam mit einem Stollenbrett in den Rücken
der sofort blau und grün angelaufen war. Ich schaute nach oben, alles war verschüttet. Ich wusste nicht das da noch
ein Ausgang war, doch die Kameraden die hier in Stellung waren haben mir geholfen das Freie zu erreichen. Ich habe
mich am nächsten Tag krank gemeldet, dachte 2 Tage Schonung zu bekommen, aber der Sanitäter hat mir nur den Rücken mit
Spiritus eingerieben und mich wieder, zurück zu unserer Kompanie geschickt. Sie bestand nur noch aus 3 Gruppen, die in
einem Stollen, der in einen Berg gehauen war, Stellung bezogen hatten. Wir konnten uns hier wenigstens waschen, an
einer Quelle die aus dem Felsen sprudelte. Wir waren nicht mehr einsatzfähig und mussten durch andere Truppenteile
verstärkt werden.
Beim Essen holen musste man auch das Gewehr bei sich haben, es wurde erzählt dass hier der braune Bär herumwandert.
Ich habe keinen gesehen, nur das die Toten ausgescharrt wurden und verstümmelt herumlagen. Nach einigen Wochen haben
die Deutschen eine Gegenoffensive gestartet, von den Bergen herunter, über den Fluss Zlota Lipa, bis zu einer Stadt
die Brzezany hieß. 2 Tage später wurden wir auch eingesetzt, bei großer Hitze ging es in Dauermärschen vorwärts, man
durfte aus den Flüssen kein Wasser trinken, weil es mit Petroleum verseucht war. Nur wenn es dunkel wurde machten wir
halt, dann mussten wir Gräben ausheben um vor Überraschungen sicher zu sein.
Links von uns war Tarnopol und rechts Rumänien. Wenn es nach einer Ruhepause wieder losging dann war es am schlimmsten,
man ging wie auf Nägel, weil die Füße die Strapazen nicht so ohne weiteres wegsteckten. Im Dorf wurde niemals Rast
gemacht, denn da waren immer Brunnen, zu denen alle hinstürmten. Später wurden Melder vorausgeschickt, die von den
Dorfbewohnern Wasser in Eimern am Weg raussetzen ließen, damit die Soldaten Ihren Durst löschen konnten. Ein Soldat hat
gleich den ganzen Eimer mitgenommen und ihn dann als er leer war, irgendwo am Wegrand stehen lassen. Der Kompanieführer
kam angeritten, hat ihn ausgeschimpft und gedroht, ihn mit 3 Tagen Arrest zu bestrafen. Wir gehörten zur Südarmee
welche von Graf Bothmer befehligt wurde.
Die Stellungen waren schlecht ausgebaut, abends mussten wir, von der 2 Kilometer hinter der Front liegenden Feldküche,
Essen und andren Proviant holen. Ich war der Jüngste der Gruppe, musste immer 9 Kochgeschirre tragen, Brot und Post
habe ich in 2 Sandsäcke, die ich über der Schulter hängen hatte, verstaut. Wenn wir unterwegs waren wurde der
Laufgraben immer beschossen. Einmal schlug eine Granate am Schützengrabenrand ein und hat mich halb verschütte, die
Kochgeschirre aus den Händen gerissen, so dass ich ohne Verpflegung im vorderen Graben ankam. Nach drei Wochen sollten
wir abgelöst werden Es hat jeden Tag geregnet, wir haben unsere Mäntel angezogen und uns mit Zelten bedeckt. Nach dem
wir abgelöst wurden kamen wir in ein Dorf dass von Juden bewohnt war. Die Bewohner waren froh dass wir keine Kosaken
waren, mit denen hatten sie vor ein par Tagen schon schlechte Erfahrung gemacht, die hatten ihnen beim Abzug Vieh und
Pferde weggenommen.
Der Boden war sehr fruchtbar, es wurden Hanf, Weizen, Hafer, Mais, Bohnen, Roggen und Kartoffeln angebaut. Die
Bewohner waren gerade mit der Ernte beschäftigt. Die Häuser waren nur aus Holz und Stroh erbaut. Die Leute lebten in
sehr ärmlichen Verhältnissen. Ich hatte mir in unserer Kantine für 20 Pfennig ein Taschenmesser gekauft, das hat mir
ein Bauer für 6 Eier und 2 Pfund Brot abgekauft, daraus hat er sich dann ein Rasiermesser geschliffen. Wenn unser
Versorgungstross auf denn holperigen Wegen nicht nachkam, haben im Dorf auch Verpflegung eingekauft. Die Leute hatten
Angst dass wir nicht bezahlen werden, doch wir bekamen meistens pünktlich unseren Wehrsold ausgezahlt und konnten uns
so manches genehmigen. Um unser Marschgepäck zu erleichtern haben wir so manches aus dem Tornister weg geworfen.
Unweit eines Dorfes wurde halt gemacht, wir sollten Zelte aufschlagen, doch niemand hatte mehr Zeltstöcke im Tornister,
alles war unterwegs liegen geblieben. Der Zugführer befahl uns ins Dorf zugehen und Stöcke zu besorgen. In einer
Scheune stießen wir auf eine Hühnerschar, mit den Stöcken haben wir einige Hühner erlegt, in einem Hanffeld gerupft
und dann im Eiltempo zurück zu unserer Truppe. Als wir ankamen war die Kompanie schon marschbereit, es gleich weiter,
mit dem Huhn im Tornister. Bei der nächsten Rast haben wir die Hühner ausgenommen und Holz besorgt um sie zu kochen,
doch wir mussten schnell wieder weiter marschieren und erst nach 2 Tagen konnten wir uns mit den Hühnern befassen,
leider waren die so alt das sie nicht gar wurden. Das Fleisch mussten wir wegwerfen, nur die Suppe konnten wir noch
gebrauchen.
Meine Verwundung am Pruth.
Wir befanden uns 8 km vor der russischen Grenze. Der Kompanieführer hatte uns informiert das
wir hier zum Einsatz kommen. Wir bekamen noch ein Mittagessen aus der Gulaschkanone, konnten unsere Feldflaschen mit
Tee, der mit Rum angereichert war, auffüllen, Munition und Handgranaten in Empfang nehmen und dann ging es zum Einsatz.
Um 3 Uhr begann das ganze Bataillon auszuschwärmen, sofort hat uns der Russen entdeckt und begann uns mit Artillerie
zu beschießen, je weiter wir vorrückten desto heftiger.
Bis zu einem Eisenbahndamm hatten wir gute Deckung, doch wir sollten den dahinter fließenden Fluss überqueren. Doch
plötzlich explodierte über meinem Kopf eine Schrapnellkugel, der Stahlhelm wurde mir vom Kopf gerissen, Tornister und
Koppel flogen auch weg, ich lag auf der Erde und wusste gar nicht was passiert war. Plötzlich fing Blut aus der
Kreuzbeingegend zu rieseln, aus dem rechten Oberschenkel auch. Gleich nebenan war ein Granattrichter, dort habe ich
Schutz gesucht. In der rechten Rockecke hatte man immer ein großes Verbandspäckchen, das habe ich herausgenommen und
auf die Wunde gedrückt, doch das Blut floss mir bis in den Stiefel. Links und rechts von mir schlugen Granaten ein,
dicke Erdbrocken und Schlamm fielen auf mich herab, doch in meinem Erdloch war ich vor Maschinengewehrsalven geschützt.
Der ganze Rücken war angeschwollen und ich konnte mich überhaupt nicht bewegen.
Die Deutschen mussten die Stellung den Russen überlassen, einer hatte mich entdeckt, da ich aber so blutverschmiert da
lag, hat er bestimmt gemeint ich wäre nicht mehr am leben und ist weitergegangen. Nach zwei Stunden habe ich gehört
das die Russen sich wieder zurückzogen, danach herrschte eine gespenstische Stille. Als es dunkel wurde kamen deutsche
Sanitäter mit Spürhunden und haben die Verwundeten aufgesammelt. Ich wurde auf eine Trage gelegt, lag gebeugt und
konnte mich nicht rühren weil der blutverschmierte Rücken völlig verkrustet war. Ein Pferdegespann konnte nur vier
Tragen befördern, die Fahrt über Ackerfurchen war eine Tortur, ich habe nicht geglaubt das ich es überleben werde. In
einer Dorfkirche wurden wir dann ausgeladen und zu den etwa 50 Verwundeten gelegt die da schon lagen.
Mich haben sie zu den Bauchschüssen gelegt, weil ich einen Nervenschock hatte und am ganzen Körper gezittert habe. Zu
trinken bekam ich nichts, nur einen feuchten Lappen in den Mund. Ich sollte gleich operiert werden, aber es kamen
immer mehr Verwundete, so bekam ich nur eine Tetanusspritze, wurde verbunden und für den Weitertransport ins Hinterland
vorbereitet. Im Morgengrauen wurden wir auf Lastautos verladen, die aus auf ein Landgut brachten, wo wir in einem
Pferdestall untergebracht wurden. Die Fahrer fuhren so schnell über die Granatlöcher, das wir vor Schmerzen geschrieen
haben. Wir baten sie langsamer zu fahren, aber die bekamen es in ihrem Führerhaus nicht mit, erst alt ein Verwundeter,
der einen Krückstock bei sich hatte von hinten die Scheibe einschlug wurde die Fahrt erträglich. Lastautos, die
Munition und Verpflegung an die Front transportiert hatten, brachten in den nächsten Tagen immer wieder Verwundete
ins Hinterland. Die Deutschen hatten an diesem Fronabschnitt hohe Verluste zu beklagen. Wir können von Glück reden
dass wir dem Höllenfeuer überhaupt entkommen sind.
Wir wurden mit Lastautos, die ein Feldlazarett uns geschickt hatte, bis nach Lemberg befördert. da wurden wir gewaschen,
rasiert und frisch verbunden. Auf einem Nebengleis stand ein Lazarettzug, in dem wurden wir anschließend in frisch
bezogenen Betten untergebracht. Der Zug brachte uns über Annaberg nach Freiburg in Sachsen, eine Stunde hinter Dresden.
Hier wurden wir auf Tragen gebettet und mit einem Möbelwagen in ein Reservelazarett transportiert.
Im Heimatlazarett.
Als ich am nächsten Tag aufwachte und das schöne Bett sah in dem ich lag, dachte ich dass ich
im Himmel bin. Ich dankte meinem Herrgott das er mich bis zu diesem Ort begleitet hat. Am Nachmittag kamen Schulkinder
mit Geschenken und haben uns schöne Lieder vorgesungen. Anhand von Röntgenaufnahmen wurde in den nächsten Tagen
festgestellt dass bei mir ein Schrapnellsplitter an der Wirbelsäule in die Kreuzbeingegend eingedrungen war. Ich wurde
jeden Tag in Salzwasser gebadet und bekam wieder volle Verpflegung, da mein Magen zum Glück nicht verletzt war. Auf
dem Transport bekam ich nur Suppe und bei Bedarf einen feuchten Lappen auf die Lippen. Ich bin von 62 auf 43 Kilogramm
abgemagert, gehen konnte ich wegen dem Nervenschock den ich bei der Verwundung erlitten hatte auch noch nicht. Die
Wunde am rechten Oberschenkel war nur ein Streifschuss und wurde mit einem Schutzverband versorgt.
In den nächsten Tagen habe ich einen Brief nach Hause geschrieben und mitgeteilt wo ich mich zurzeit befinde. Meine
Eltern schickten mir ein Paket mit Lebensmitteln, jetzt konnte ich essen was ich wollte. Das Essen im Lazarett war
nicht besonders, jeden Tag nur Kohlblätter. Der weg zu den Toiletten führte durch einen Gemüsegarten. Die gehfähigen
Kameraden haben den ganzen Kohlrabi aufgegessen, so dass schließlich Wachposten aufgestellt werden mussten. Sechs
Wochen lang konnte ich mich nur auf allen Vieren fortbewegen, denn sobald ich mich aufrichtete wurde es mir
schwindelig und ich musste zurück ins Bett.
Als ich wieder bei Kräften war habe ich meinen Eltern mitgeteilt das ich mich in ein Lazarett in ihrer Nähe verlegen
lassen will. Der Chefarzt hatte mir zugesichert, wenn die Möglichkeit besteht in Ortelsburg unterzukommen, wird er dem
zustimmen. Meine Mutter hat daraufhin, in Ortelsburg, beim Lazarettinspektor Zantopf nachgefragt und er hat angedeutet
das sie mich aufnehmen können. Daraufhin bekam ich die Krankenpapiere und einen Fahrschein nach Ortelsburg. Da ich als
Soldat nie Heimaturlaub hatte, beschloss ich zuerst meine Eltern zu besuchen. Ich fühlte mich noch sehr schwach, habe
nach jedem Kilometer Rast gemacht, aber letztendlich war ich wieder daheim bei meinen Eltern. Die Wiedersehensfreude
war sehr groß. Ich bin am 30 Juli verwundet worden und am gleichen Tag wurde mein ältester Bruder beerdigt. Er bekam
den Splitter einer Gasgranate ins rechte Bein und ist an einer Blutvergiftung verstorben.
Am nächsten Tag brachte mich mein Vater ins Garnisonslazarett nach Ortelsburg. Ich wurde jeden Tag gebadet und massiert,
weil die Rückenhaut am Knochen angewachsen war konnte ich mich nicht schmerzfrei bücken. In Ortelsburg verbrachte ich
noch sechs Wochen, bis Ende Oktober, da wurde es schon ziemlich kalt und in unserer Barackenunterkunft ziemlich
ungemütlich. Kohlen und anderes Brennmaterial lagen im Hof auf Halde, aber es war verboten zu heizen. Kameraden die in
der Nähe zu Hause waren konnten Sonntagsurlaub beantragen.
Einer von ihnen brachte von zuhause Brennholz mit und entzündete damit im Ofen ein wärmendes Feuer, andere holten vom
Hof Kohlen, so dass der Ofen in kurzer Zeit glühend heiß wurde und die Gefahr bestand das die Betten Feuer fangen
würden. Wir hatten die Betten schon weg gerückt, da kam der Feldwebel herein und fragte wer das Feuer im Ofen
angezündet hat, doch niemand fühlte sich angesprochen. Der Feldwebel hatte den Vorfall dem Stabsarzt gemeldet, als der
am nächsten Morgen zur Visite kam, war seine erste Frage: ”Wer hat gestern Abend das Feuer im Ofen angezündet”. Als
sich niemand meldete, schrie er uns an: ”Morgen wird alles entlassen, zum Ersatzbatallion, in Diez an der Lahn! Wer
gehen kann, sofort zur Schreibstube, Krankenpapiere und Fahrscheine abholen”. Er erinnerte uns noch daran am nächsten
Tag pünktlich am Bahnhof zu sein, weil eine Verspätung unangenehme Folgen für uns haben würde. Das war das Ende der
schönen Erholungsphase. Ich blieb noch eine Nacht zu Hause und bin dann am nächsten Tag von dort zum Bahnhof gegangen.
Wieder Kriegsverwendungsfähig.
Als wir am nächsten Tag in Diez angekommen waren, wurde ich gefragt ob ich aus dem Heimaturlaub
käme, als ich das verneinte wurden mir 2 Tage genehmigt und 14 Tage Genesungsurlaub dazu. Wieder zurück im
Ersatzbatallion bestand unsere Tätigkeit aus Wache schieben und Kartoffel schälen. Nach einem Monat wurden wir von
einem Generalarzt untersucht, er hat mich für nicht einsatzfähig befunden weil ich noch den Steckschuss im Rücken
hatte und das linke Bein 10 Zentimeter dünner war. Jetzt fing das Kasernenleben wieder von vorne an. Wachdienst,
Gewehr laden, sichern, Ehrenbezeugung, Einzelmarsch und Appell. Wer nicht weit nach Hause hatte bekam zu Weihnachten
Urlaub. Ich hatte zu Heiligabend und Silvester Torwache, denn nach Ostpreußen wurde niemand beurlaubt.
Nach Neujahr 1918 wurden wir neu eingekleidet und kamen nach Köln zur Baukompanie. Mit Musik wurden wir zum Bahnhof
gebracht. In Köln wurden wir noch mit Soldaten die von andern Truppenteilen dorthin verlegt wurden in einem großen
Kinosaal, im Stadtteil Edengarten untergebracht. Wir brauchten keinen Dienst zu machen und konnten zu Heilige Drei
Könige den Gottesdienst im Dom besuchen. Kameraden die aus irgendwelchen Gründen im Arrest saßen wurden gefragt ob sie
auch am Gottesdienst teilnehmen möchten, dann würde ihnen die Strafe erlassen. Fast alle haben dem zugestimmt. Einige
Tage später wurden wir wieder auf einen Transportzug verladen, der uns über Herbestal, Antwerpen nach Brügge in Belgien
brachte. Hier mussten wir den Zug kurzfristig verlassen und einen Luftschutzkeller aufsuchen, weil Fliegeralarm
gemeldet wurde. Danach ging es wieder weiter nach Turut, Kortemark, Hauseme, Kautremollen, Zaren, Zarenlinde. Dort
wurden wir in verschiedene Gruppen aufgeteilt und einer Pionierkompanie auf dem Pionierpark Struwendorf zugewiesen.
Wir haben hinter Klerken Bunker für schwere Maschinengewehre gebaut. Unsere Arbeit konnten wir nur bei Nebel verrichten,
denn bei Sonnenschein waren wir sofort dem Beschuss der feindlichen Artillerie ausgesetzt. eine Kleinbahn die Munition
und Stacheldraht an die Front brachte war dem Beschuss besonders ausgesetzt. Die Gleise, von schweren Geschossen
zerfetzt, mussten immer wieder hergerichtet werden, damit der Nachschub aufrechterhalten werden konnte. Später haben
wir am Kemelberg bei Armentier, eine Brücke über die Lys gebaut. Um in dem Sumpfgelände einen Untergrund dafür zu
schaffen, mussten wir 10 bis 12 Meter lange Pfähle in den Boden rammen. Ein Feldwebel gab immer den Befehl: „Hoch den
Bär, noch viel mehr, dass man sieht, wie er zieht, denn dieser Pfahl, glatt wie ein Aal, durch Fels und Stein, durch
Wasser und Sand, fürs Vaterland”. Jedes mal mussten wir den Bär an Schnüren hochziehen und dann wieder herunterlassen.
Wenn es manchmal, trotz vieler Mühe nicht mehr weiter ging wurde der Pfahl auf eine bestimmte Länge abgeschnitten.
Nach Fertigstellung der Brücke kamen wir in die Siegfriedstellung bei Kambrei, zum Bau eines Bataillons-Gefechtstandes.
Da der Boden kreidehaltig war, mussten wir die großen Stücke von Hand zu Hand reichen, den Schutt haben wir dann mit
Sandsäcken aus der Baugrube gehoben und mit Ästen getarnt, damit der Stand nicht von feindlichen Fliegern entdeckt
werden konnte. Alle acht Stunden wechselte die Arbeitsgruppe. Wir mussten von der Baustelle durch das Gelände robben,
denn aufrecht gehend war man dem Beschuss der feindlichen Scharfschützen ausgesetzt, die von einem Fesselballon aus
informiert wurden der über den feindlichen Linien stand.
Der Wechsel war mit einem großen Risiko verbunden, und wurde wenn Möglich bei Dunkelheit vollzogen. Um vor
Überraschungen sicher zu sein haben wir spanische Reiter (Stacheldrahtverhaue) gebaut und vor die ersten Gräben
gestellt, die dann oft in der Nacht von den Franzosen geklaut, und dann vor ihren eigenen Linien wieder aufbaut wurden.
Wir hatten aus Bohlen eine Brücke auf Rädern gebaut, die dann in den Graben geschoben wurde, damit die Artillerie und
andere Fahrzeuge über die Schützengräben kamen. Weil um vier Uhr morgens der Beschuss mit Gasgranaten begann, mussten
wir Gasmasken aufsetzen, danach haben feindliche Flieger unsere Munitionskolonne bombardiert und total aufgerieben.
Es wurde auch eine Marinedivision eingesetzt, die bis dahin dem Küstenschutz gedient hatte und jetzt ihren ersten
Einsatz hatte.
Wir sind zuerst ein ganzes Stück in Richtung Amiens vorangekommen, doch dann blieb unser Angriff in den zuvor von
Engländern besetzten Stellungen, stecken. Da die Engländer ihre Stellungen fluchtartig verlassen hatten, fiel ihr
ganzer Proviant in unsere Hände; Schokolade, Weißbrot, Flaschenwein. Die erste Nacht haben wir in einem runden Zelt
verbracht, weil ich mir durch den starken Wind, der da herrschte eine Angina zugezogen hatte, die mit hohem Fieber
verbunden war, konnte ich die vielen Köstlichkeiten überhaupt nicht genießen.
An eine ärztliche Versorgung war überhaupt nicht zu denken, denn es mussten zuerst die vielen Granatlöcher eingeebnet
werden damit die vielen Fahrzeuge und Geschütze wieder weiter fahren konnten. Auch eine Bahnlinie musste repariert
werden, damit die großen Geschütze in Stellung gebracht werden konnten, dabei wurden auch die vielen Kriegsgefangenen,
die bei dieser Offensive gemacht wurden, eingesetzt. Als die Offensive dann schließlich scheiterte, wurden wir an die
Somme verlegt. Da habe ich die Ortelsburger Jäger, die aus Italien an die Westfront verlegt wurden, zum ersten Mal im
Einsatz gesehen.
Unser nächster Einsatzort waren dann Stellungen hinter Laon. Hier wurden die Vorbereitungen zu einer neuen Offensive
getroffen. Feindliche Flieger versuchten uns Tag und Nacht daran zu hindern die Aufmarschwege instand zu halten. Als
die Offensive dann endlich losging, hatten wir die Order eine Brücke über die Oise mit Bohlen und Balken zu verstärken.
Gleich am Anfang der Offensive mussten wir Gasmasken anlegen, um für alle Fälle gewappnet zu sein. Nur die Artillerie
und Kraftfahrzeuge durften die Landstraße benutzen, die Infanterie ging immer im Straßengraben und wurde von einer
Seite von Kopf bis Fuß mit Dreck bespritzt. Die Franzosen und Engländer haben hier schon Panzer eingesetzt, die von
Truppen aus den Kolonien gefahren wurden. Die Australier gingen mit umgekrempelten Ärmeln hinter den Panzern her.
Die letzte Offensive des Ersten Weltkrieges.
Zum Jahresende 1917 hatten noch 153 deutsche 175 alliierten Divisionen gegenübergestanden.
Zur Vorbereitung der Offensive ließ Ludendorff 39 Divisionen aus dem Osten und aus Italien heranziehen. Er ließ
spezielle Angriffsdivisionen formieren, die durch intensive Ausbildung auf den beabsichtigten, schnellen Vormarsch
vorbereitet wurden. 6608 Geschütze, 3500 Minenwerfer und 1070 Flugzeuge wurden hinter dem vorgesehenen
Angriffsabschnitt konzentriert. Den Ausbildungsbefehlen Ludendorffs, die bis zu den Kompanieführern herab verteilt
wurden, konnte man entnehmen, dass der Versuch, den Krieg mit einem mächtigen Schlag zu entscheiden schon in der
nächsten Zeit gewagt werden sollte. Wir übten die fast vergessenen Formen des Schützengefechts und des
Bewegungskrieges, auch wurde eifrig mit Gewehr und Maschinengewehr geschossen. Wir hegten keinen Zweifel daran, dass
der große Plan gelingen würde.
Den ganzen Winter 1917/18 über plante der Generalquartiermeister Ludendorff die deutsche Offensive. Zwar hatten die
Vereinigten Staaten von Amerika dem Deutschen Reich am 6. April 1917 den Krieg erklärt, aber vor dem Sommer des
Jahres 1918 war mit dem Auftreten von US-Truppen in relevanter Größenordnung nicht zu rechnen. Der deutschen Führung
blieb nur ein schmales Zeitfenster, um die Niederlage und den zu erwartenden Diktatfrieden abzuwenden. Ypern,
Armentieres, Arras, Cambrai oder Verdun wurden ernsthaft als Schauplätze erwogen. Ludendorf entschied sich für einen
Angriff zwischen Cambrai und La Fere – genau an der Nahtstelle zwischen der Französischen Armee und dem britischen
Expeditionscorps.
Der Fluss Somme bildete die Grenze zwischen Franzosen und Briten. Die Briten – nicht die Franzosen – sollten das Ziel
des Vorstoßes werden. Ihre Stellungen waren nur 130 Kilometer von der Kanalküste entfernt. Beim erreichen der
Sommemündung wäre die gesamte britische Armee eingeschlossen gewesen, denn hinter ihnen lag die Straße von Dover.
Am 21. März 1918 begann die letzte entscheidende Offensive des deutschen Westheeres im Ersten Weltkrieg. Der
Angriffsstreifen war 75 Kilometer breit. Dort hatte Ludendorff 43 Angriffsdivisionen konzentriert, dahinter 30
weitere Reservedivisionen, ihnen standen lediglich 26 britische Divisionen gegenüber. „Michael“ – so der Deckname der
„Kaiserschlacht“ – lief dank Ludendorffs akribischer Vorbereitung gut an. Der britische Oberbefehlshaber General
Douglas Haig erkannte die Chance, welche die Deutschen in dieser Situation hatten. Wollten die Deutschen diese Chance
nutzen, mussten sie darauf verzichten die Somme zu überschreiten, wo sie auf die französischen Reserven treffen und
sich von der Küste entfernen würden. Genau diesen Fehler begingen jedoch die Deutschen.
Am dritten Tag überschritt der linke Flügel mit der 18. Armee die Somme. Ludendorf stellte die Taktik über die
Strategie, wie er das bei Tannenberg und der Schlacht an den Masurischen Seen auch schon getan hatte. Ludendorffs
Befehl an die 18. Armee vom Abend des 22. März 1918 lautete: „Jetzt gilt es den Sieg auszunutzen, den Feind nicht zum
Stehen kommen zu lassen, Somme und Crozat-Kanal zu überschreiten, bevor feindliche Verstärkungen wirksam werden“.
Was Haig befürchtet hatte, trat nicht ein. Die deutsche Offensive Lief weiter Richtung Süden und lief sich schließlich
tot. Am 31 März war Ludendorff zu der Erkenntnis gekommen, dass „Michael“ gescheitert war. Am 5. April wurde die
Einstellung der Offensive befohlen. Im Hochsommer waren die US-Truppen in Frankreich angekommen und gingen mit den
Franzosen zum Angriff vor. Nur mühsam konnten Hindenburg und Ludendorf den Zusammenhalt der Front waren. Am 24. Oktober
1918 forderte US-Präsident Woodrow Wilson die bedingungslose Kapitulation, am 11.Nuvember Wurde der Waffenstillstand
von Compiegne unterzeichnet.
Zusammenbruch der Westfront und Waffenstillstand .
Als die Offensive dann letztendlich gescheitert war, wurden wir auf Eisenbahnwaggon verladen, in
eine Stellung vor Verdun gebracht und der siebenten bayerischen Division zugeteilt. Als wir ausgeladen wurden nahm der
Franzose den Bahnhof unter Beschuss. Eine Granate traf einen Waggon der mit Seifenpulver beladen war, so dass der ganze
Bahnhof aussah als wäre gerade Neuschnee gefallen. Wir gingen auf die Suche nach Kartoffeln. Als ich mit einem Sack,
vollbeladen die Böschung runter ging um zur Feldküche zu gelangen, schlug unweit von mir eine Granate ein und riss mir
den Sack vom Rücken. Ich bin mit dem Schrecken davon gekommen, mir war nichts passiert.
Der Bahnhof war menschenleer, nur ein par Kaninchen liefen verschreckt durch die Gegend und einigen Kameraden gelang
es welche einzufangen. Am nächsten Tag gelang es uns endlich die Feldküche zu erreichen. Als wir gerade beim Essen
fassen waren, schlug unweit eine Granate ein so dass Pflastersteine das Dach durchschlugen und wir das Weite suchen
mussten. und wir wieder nichts zu Essen bekamen. Ein Friseur aus unserer Kompanie fuhr immer ins Hinterland um uns
mit Proviant zu versorgen. Als er 14 Tage vor dem Zusammenbruch wieder mal zurückkam erzählte er uns schon das der
Krieg nicht mehr lange dauern würde, weil Kaiser Wilhelm mit Frack und Zylinder bekleidet, Deutschland verlassen und
ins Ausland gehen würde. In unserer Einheit hatten wir auch einen Juden der glaubte dass er sich alles erlauben darf.
Eines Morgens ging er in die Küche, als er keinen Koch vorfand stieg er auf die Gulaschkanone und hob den Deckel vom
Kessel in dem der Kaffee kochte an. Der kochende Kaffee verbrühte seine Füße so sehr das er sofort ins Lazarett musste,
für ihn war der Krieg somit zuende. Es kam noch ein Erlass, das Kameraden die 2 Jahre aktiv gedient hatten und
Gefreiter waren sofort zum Sergeanten befördert wurden. Für den 11. November 1918 war ein Waffenstillstand vereinbart
und ab 11 Uhr sollte nicht mehr geschossen werden. Wir hatten unsere Kopfkissen aufgetrennt und eine Kissenschlacht
veranstaltet, um auf diese Art und Weise unserer Freude Ausdruck zu verleihen. Als die Federn durch die Luft flogen
brachen wir in Tränen aus.
In jeder Kompanie wurde ein Soldatenrat gewählt, der aus drei Mann bestand. Wenn der Kompanieführer jemanden bestrafen
wollte, musste er erst den Soldatenrat fragen, der die Strafe befürworten, aber auch ablehnen konnte. Die Offiziere
durften keine Achselstücke mehr tragen, was für sie einer Degradierung gleich kam. Wir waren in einem Dorf
einquartiert und morgens zum Appell angetreten, als einer vom Soldatenrat sich stockbesoffen vor den auf dem Pferd
sitzenden Kompanieführer stellte und schrie: „Alles hört auf mein Kommando”. Der Kompaniechef war wie vom Blitz
getroffen, ihm versagte die Stimme. Wir sahen ein das dies nicht so weiter gehen kann und wählten einen neuen
Soldatenrat. Unser Rückzug begann bei Konflanz, einer Vorfestung von Metz und führte uns zunächst über die
luxemburgische Grenze, wo wir in einem Ort einquartiert wurden. Als wir für die Küche Holz aus dem Wald holen gingen,
entschieden wir uns eine Eiche abzusägen, ohne uns dessen bewusst zu sein, in welchem Forst wir uns befanden. Als wir
beim fällen waren fielen plötzlich Schüsse, die wir auch sofort erwiderten, bis uns ein Elsässer der sich in unserer
Kompanie befand aufklärte: „Kameraden, wir befinden uns hier auf Luxemburgischem Hoheitsgebiet”.
Wir sind dann weiter durch das Fürstentum Birkenfeld marschiert, wo das Städtchen Merzig für uns geflaggt hatte. Das
Elsass haben wir auch noch kurz gestreift. Wo wir bei einem Bauern, der uns kein Stroh für das Nachtlager geben wollte,
einquartiert wurden. Daraufhin gingen wir in die Scheune und haben uns selbst was besorgt. Wir haben dann noch erfahren,
sie hätten ein Schwein geschlachtet und warteten auf den Einzug der Franzosen. Als wir uns 1917, an der Ostfront, in
den in Karpaten, im Einsatz befanden, waren unter uns auch viele Elsässer. Sie durften ihre Heimatpost nicht in
französischer Sprache schreiben, mussten ihre Briefe offen auf der Schreibstube abgeben, wo sie zuerst kontrolliert
und dann abgeschickt wurden. Als ich in einer Nacht, mit einem Elsässer auf einem Vorposten Wache schieben musste,
wollte er mich überreden zum Russen überzulaufen. Als ich darauf nicht eingehen wollte verschwand er plötzlich in der
Dunkelheit und ich habe ihn nie wieder gesehen.
Wir sind dann weiter Richtung Worms und Ludwighafen gezogen, dort wurden wir bei einem Mühlenbesitzer einquartiert,
ein Unteroffizier und vier Mann. Obwohl wir verlaust und verdreckt waren bestand die Müllerin darauf das wir in ihren
Betten übernachteten. „Wenn alles durch ist”, sagte sie, „werde ich alles gründlich reinigen”. Der Müller brachte uns
eine Gießkanne voll Wein und sagte wir sollen es uns Schmecken lassen. Wir haben reichlich davon Gebrauch gemacht, so
dass ich gar nicht weiß wie ich ins Bett kam. Das war meine Erinnerung an die Pfalz. Manchmal waren wir auch 2 Tage im
Quartier.
Vor dem Weitemarsch wurde uns immer gesagt welche Truppe die Vorhut und welche Truppe die Nachhut übernehmen sollte.
Die Nachhut hielt immer Verbindung zu den nachrückenden Franzosen und man muss staunen wie alles reibungslos, ohne
Zwischenfälle von statten ging, was wir in erster Linie dem General-Feldmarschall Paul von Hindenburg zu verdanken
haben, der den Rückzug an der Westfront koordiniert hat.
In Köln angekommen, erhielten wir im Volkshaus unsere Entlassungspapiere, Eisenbahnfahrscheine, Reisepässe,
unterschrieben von Oberstleutnant Mann. Wir mussten Köln umgehend verlassen, weil schon am nächsten Tag die
französischen Besatzungstruppen in einmarschieren sollten. Wir fuhren mit einem Zug der bis Allenstein fuhr, dort
wurden unsere Papiere vom Soldatenrat kontrolliert. Die jüngren Jahrgänge wurden festgehalten, zu neuen Einheiten
zusammengestellt und zur Sicherung der Ostgrenze gegen die Bolschewisten abkommandiert. Ich hatte gesagt das ich noch
einen Schrapnellsplitter in der Kreuzbeingegend habe und durfte daraufhin nach Hause fahren.
Kaum in Ortelsburg angekommen fiel ich wieder dem Soldatenrat in die Hände. Sie haben alles durchsucht, haben mir mein
Seitengewehr und eine Decke abgenommen, aber ich durfte weiter und bin dann kurz vor Weihnachten 1918 auf dem
elterlichen Hof angekommen. Schon auf dem Hof habe ich meine Kleider vom Leib gerissen, weil vor Läusen und anderem
Ungeziefer nicht mehr aushalten konnte und mich erst gründlich gewaschen bevor ich das elterliche Haus betreten habe.
Die Freude über das Wiedersehen war sehr groß.
“ Unser Leben zwischen den beiden Weltkriegen.”
Endlich wieder zurück in der Heimat
Rohmanen war durch die Kampfhandlungen 1914/15 zu einem drittel zerstört worden, aber schon
wieder im Aufbau. Die Firma Grzella aus Ortelsburg hatte die Bauarbeiten übernommen. Unter der Aufsicht von Polier
Karl Kontor wurden die Dachstühle errichtet. Ich habe mich, nach kurzer Erholungspause, auch als Zimmermanngehilfe am
Wiederaufbau beteiligt. Die Firma Grzella hat das Material geliefert und auch unsere Löhne gezahlt. Wegen meinem
Steckschuss bin ich dem VDK beigetreten und habe mit dessen Hilfe eine Rente beantragt die mir auch bewilligt wurde.
Nach vier Jahren wurde ich nach Allenstein zur Nachuntersuchung vorgeladen. Die ärztliche Untersuchung hatte ergeben,
das Geschoß sei verkapselt, und nur das linke Bein etwas in Mitleidenschaft gezogen. Daraufhin wurde die Rentenzahlung
eingestellt.
Der Stellmacher Adam Ornowski war im Krieg als Sanitäter eingesetzt und hatte auf Grund seiner Erfahrungen,
 Beziehungen zum medizinischen Dienst in Ortelsburg aufgebaut. Es wurden dort Lehrgänge in Erster Hilfe angeboten,
die von Prof. Dr. Kutz geleitet wurden. Adam Ornowski hat dafür gesorgt das einige junge Männer aus Rohmanen daran
teilnehmen konnten. Adam Ornowski, August Linka, Emil Rosowski, Johann Dembek, Emil Baschek und ich sind dann dem
Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes beigetreten und mussten jeden Sonntag am Lehrgang teilnehmen. Unser
Gruppenführer war Kreisobersekretär Albrecht, Landrat von Poser, als unser Ehrenvorsitzender, hat viel zu unserer
finanziellen Unterstützung beigetragen und hat dafür gesorgt dass die Bereitschaft eingekleidet wurde.
Beziehungen zum medizinischen Dienst in Ortelsburg aufgebaut. Es wurden dort Lehrgänge in Erster Hilfe angeboten,
die von Prof. Dr. Kutz geleitet wurden. Adam Ornowski hat dafür gesorgt das einige junge Männer aus Rohmanen daran
teilnehmen konnten. Adam Ornowski, August Linka, Emil Rosowski, Johann Dembek, Emil Baschek und ich sind dann dem
Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes beigetreten und mussten jeden Sonntag am Lehrgang teilnehmen. Unser
Gruppenführer war Kreisobersekretär Albrecht, Landrat von Poser, als unser Ehrenvorsitzender, hat viel zu unserer
finanziellen Unterstützung beigetragen und hat dafür gesorgt dass die Bereitschaft eingekleidet wurde.
In jedem Dorf wurde eine Unfallstelle eingerichtet, mit einem Verbandskasten und mit Verbandsmaterial für die erste
Hilfe ausgerüstet. Die Unfallstelle in Rohmanen, die am Haus von der Straßenseite, durch eine Tafel mit einem roten
Kreuz gekennzeichnet war, hatte ich zu verantworten. An Sonntagen wurden wir an Badestellen und bei Fußballspielen
eingesetzt, haben viele Übungen bei Waldbränden durchgeführt und auch Ausflüge nach Rudzany am Niedersee gemacht. Bei
der Einweihung des Tannenbergdenkmals in der Nähe von Hohenstein kamen wir an Straßenkreuzungen zum Einsatz.
Rohmanen hatte auch eine freiwillige Feuerwehr. Bis zum ersten Weltkrieg hat Friedrich Biella als Brandmeister das
Kommando gehabt. Er war aktiver Unteroffizier, hatte gute Führungsqualitäten und die Männer, die allesamt aus dem
aktiven Militärdienst stammten hatten zu ihm ein großes Vertrauen. Nach dem Krieg wollten diese Männer,
(Friedrich Nickel, Friedrich Willam, Julius Wittkowski, Jakob Janowski, Johann Gloddek, Gustav Bednarz), nicht mehr
weitermachen. Friedrich Biella, der inzwischen zum Gemeindevorsteher gewählt wurde, hat sich dann auf einer
Gemeinderatsitzung vorgeschlagen, für die Freiwillige Feuerwehr jüngere Kräfte anzuwerben.
Zum Brandmeister hat er Herrn Wilhelm Pilath vorgeschlagen. Der wurde dann nach Königsberg zur Fortbildung geschickt.
Der Feuerwehr gehörten nun folgende Personen an: Wilhelm Pilath(Brandmeister), August Linka(Stellvertreter), Gustav
Deptolla, Julius Matzey, Johann Dembek, Willy Willam, Gustav Rattay. Der Kreisbrandmeister war Heinrich Thalmann aus
Ortelsburg, sein Stellvertreter war Kreisobersekretär Salzmann. Der Bezirks-Kommissar bei der Ostpreußischen
Feuersozität War Herr Ernst Trzaska. Er hat dafür gesorgt das die Wehr uniformiert und mit Löschgeräten ausgerüstet
wurde. Da die alten Schläuche schon sehr marode waren, wurden sie durch moderne ersetzt, deren Kupplungen auch mit der
Motorspritze übereinstimmten.
Ernst Trzaska hat bei der Feuersozität und beim Landratsamt Finanzmittel beantragt und auch genehmigt bekommen. Der
Schneidermeister Wilhelm Baran wurde beauftragt Tuch und Drillichanzüge nach Maas zu schneidern. Er hat uns
Stoffmuster vorgelegt aus denen wir wählen sollten. Feuerwehrhelme haben wir auch bekommen. Die Gemeinde musste
Finanzmittel bereitstellen, einen Prozentsatz vom Gemeindebudget. Im Brandfall mussten für den Spritzenwagen Pferde
zur Verfügung stehen, von Willy Willam, Gustav Rattay, Julius Matzey und Gustav Dorka, weil sie in der Nähe des
Spritzenhauses wohnten. Am Spritzenhaus wurde ein großer Baum mit Querleisten aufgestellt, wo nach jedem Brand oder
einer größeren Übung die Schläuche zum trocknen aufgehängt wurden.
Der Kreisbrandmeister hat mindestens 2-3-mal im Jahr die Wehren besichtigt. Das ganze Dorf war dann auf den Beinen,
die Bauern mit Pferden, und andere Dorfbewohner mit Eimern und Spaten, wurden dann in verschiedene Gruppen eingeteilt.
Erst hat die Wehr sämtliche Aufstellungen am Gerät geübt; Grundstellung Fahrstellung und Marschstellung. Dann wurde
ein Brand angekündigt, die Feuerwehr mit der Spritze an den Brunnen, die Gruppen dort wohin sie beordert wurden, die
Bauern brachten mit den Wasserkiwen Wasser aus dem Brunnen zum Brandort. Wenn das Wasser im Brunnen alle wurde hat
man den Saugkorb in die Kiewen gelegt und dort Wasser entnommen. Die Wassergruppe ging mit Eimern zum Dorfteich, holte
Wasser und füllte damit die leeren Kiewen.
Der Löschtrupp ging mit Feuerhaken und Löschpatschen auf die umliegenden Gehöfte und versuchte das vermeintliche Feuer
von ihnen fernzuhalten. Nach dem Alarm wurde wieder am Spritzenhaus angetreten. Die Gruppenführer mussten angeben ob
ihre Gruppe auch vollständig erschienen war, denn Übungen wurden nur vor, oder nach der Feldarbeit durchgeführt, so
dass niemand eine Entschuldigung vorbringen konnte. Wer ohne begründete Entschuldigung nicht anwesend war erhielt eine
Verwarnung. Der Kreisbrandmeister erklärte dann welche Handgriffe den Vorschriften entsprachen und welche nicht. Die
Schläuche wurden noch schnell zum Trocknen aufgehängt. Anschließend gingen wir alle in den Gasthof Trzaska, haben über
vorhandene Mängel diskutiert, Verbesserungsvorschläge unterbreitet und zwischendurch den Durst gelöscht. Der
Kreisbrandmeister ist dann, nach einer kurzen Verabschiedung, ins nächste Dorf gefahren, weil er an einem Tag mehrere
Feuerwehren betreuen musste.
Der Rohmaner Dorffriedhof

Einen Kilometer vom Ende des Dorfes entfernt, auf der rechten Seite der Landstraße in Richtung
Ortelsburg, befand sich der Rohmaner Dorffriedhof. Wann dieser Friedhof angelegt wurde entzieht sich meiner Kenntnis.
Nach Aussagen älterer Dorfbewohner soll davor auch schon eine Ruhestätte vorhanden gewesen sein, und
zwar auf der linken Straßenseite gegenüber dem jetzigen Friedhof. An dieser Stelle befand sich bis in die
Nachkriegszeit ein kleiner Brunnen, aus dem die Dorfbewohner, das Wasser zum begießen der Grabbepflanzung auf den
Gräbern ihrer verstorbenen Angehörigen holten. Der Friedhof war in einer Hanglage angelegt, wahrscheinlich weil diese
Parzelle für eine landwirtschaftliche Nutzung nicht geeignet war. Um das Gräberfeld vor herumstreunenden Tieren oder
von der Weide entlaufenen Kühen zu schützen, hat man das ganze Gelände mit einem Holzzaun umgeben. Der Zugang befand
sich von der Straßenseite. Unter einem Torbogen hindurch wurden die Verstorbenen zu Grabe getragen. Die Gräber der
einzelnen Familien waren nebeneinander angelegt, mache, wie zum Beispiel die der Familie Trzaska, sogar mit einem
schmiedeeisernen Zaun eingefasst.
Nach dem 2. Weltkrieg verfiel der Friedhof immer mehr. Die nötigen Finanzmittel für die Pflege der Einfriedung konnten
von den restlichen noch verbliebenen Deutschen nicht mehr aufgebracht werden. An den gepflegten Gräbern konnte man noch
erkennen dass es Verwandte von noch in Rohmanen wohnenden Deutschen waren, oder von bereits im Westen Deutschlands
lebenden, die ihre noch in Rohmanen wohnenden Nachbarn damit beauftragt hatten. Die übrigen Gräber wurden von Jahr zu
Jahr immer mehr von Wildkräutern überwuchert und schließlich auch von Sträuchern und schnell wachsenden Bäumen.
In den späteren Jahren konnte man nicht mehr erkennen dass dort vor Jahren Tote zur letzten Ruhe gebettet wurden. Die
Natur holte sich das ganze Gelände zurück und nur unter großen Schwierigkeiten konnten Besucher aus dem Westen das
Friedhofsgelände noch betreten.
Das Gasthaus Trzaska

Nach dem ersten Weltkrieg hat der Gastwirt Friedrich Trzaska neben dem Gasthof einen großen Saal
für Festlichkeiten und Vereinsfeiern gebaut, in dem schon mal Feuerwehrfeste veranstaltet wurden. Ernst Trzaska war
Feuerkommissar bei der Ostpreußischen Feuersozität. Erich Trzaska war Vollziehungsbeamter beim Amtsgericht in
Ortelsburg. Unser Feuerkommissar war uns beim organisieren der Veranstaltungen sehr behilflich, hat uns den Saal, die
Musik und die Theaterstücke besorgt und die Feuerwehren aus den Nachbardörfern eingeladen.
Zu Manöverzeiten, vor dem 2. Weltkrieg und dann auch während des Krieges, waren im Gasthof Soldaten, meist im Range
eines Offiziers, einquartiert. Fräulein Mariechen Trzaska hat die Poststelle im Dorf betreut. Nachdem ich 1939 zum
Militär eingezogen wurde, hat sie, nach einer Schulung im Ortelsburger Krankenhaus, auch die Unfallmeldestelle
übernommen. Nach dem Krieg, pflegte sie mit vielen Bekannten, die bereits in der Bundesrepublik wohnten, einen regen
Briefwechsel. Auf dem Rohmaner Friedhof hat sie viele Gräber, im Auftrag von Angehörigen, die auf Grund ihrer
Abwesenheit, dazu nicht mehr in der Lage waren, gepflegt. Der Bauunternehmer Kurnitzki aus Ortelsburg, äußerte die
Bitte, sie möchte ihm doch ein Blatt vom Rosenstrauch, der auf dem Grab seiner Eltern steht, in den Brief legen. Als
sie uns den Brief vorgelesen hat, waren wir zu Tränen Gerührt. Sie hat als Letzte aus ihrer Familie, bis zu ihrem Tod
im Jahre 1960, in Rohmanen, im Gebäude der Gastwirtschaft gewohnt und ist auf dem Rohmaner Friedhof beerdigt worden.
Fleisch und Wurstwaren Karl Pelkowski
Im Jahr 1931 hat der Fleischermeister Karl Pelkowski, aus Grammen, direkt neben unserem Hof ein
Anwesen gekauft und dort eine Fleischerei eingerichtet. Er war mit meiner Schwester Frieda, verheiratet. Am Anfang hat
er die Schweine noch auf seinem Hof geschlachtet, später dann im Ortelsburger Schlachthof. Jede Woche fuhr er 2-mal,
mit dem Pferdewagen(Einspänner), nach Ortelsburg zum Wochenmarkt, wo er seine Fleisch und Wurstwaren zu Verkauf anbot.
Am Tag davor, wenn er die Wurst gekocht hat, kamen viele Rohmaner mit Kannen oder anderen Gefäßen, wegen der guten
Wurstsuppe, die er umsonst unter die Leute verteilte. Als Karl Pelkowski, Ende August 1939 zum Militär eingezogen
wurde, hat seine Frau das Pferd verkauft und den Beitrieb stillgelegt. Am Haus hing, immer noch die Tafel mit der
Aufschrift: Karl Pelkowski, Fleisch und Wurstwaren. Ein Witzbold hat irgendwann darunter geschrieben; „Fleisch und
Wurst waren einmal”, drauf hin hat Frau Pelkowski die Tafel entfernen lassen. Karl Pelkowski ist im Mai 1946 in
französischer Gefangenschaft verstorben. Seine Ehefrau Frieda, verstarb an ihrem 85. Geburtstag in Mettmann bei
Düsseldorf.
Die steinreichen Rohmaner Felder
Die letzte Eiszeit hat bei der Schmelze, auf der Rohmaner Feldgemarkung viele Steine und
Granitblöcke zurück gelassen. Überirdisch, aber besonders unter der Erde, gab es viele kleine, aber auch große Steine,
die, den Bauern, beim Pflügen und anderen Feldarbeiten sehr viel Schweiß, abverlangten. In einer Kiesgrube, auf dem
Feld des Bauern August Radek, lag ein Granitblock, von schätzungsweise 100 cbm. Vor etwa 80 Jahren, als man für diese
Steine noch keine Verwendung hatte, griffen die Bauern zu einer „List”. Weil er sonst nicht pflügen konnte, hat mancher
seinem Nachbarn, die Steine in der Nacht auf dessen Feld abgeladen. Als diese Tätigkeit unter Strafe gestellt wurde,
hat man die Steine in Schluchten gekippt und mit Mutterboden zugeschüttet. In späteren Jahren kam diese jedoch beim
pflügen wieder an die Oberfläche. Dann hat man aber schon Steine für den Straßenbau gebraucht und konnte sie so zu Geld
machen. Besonders im Raum südlich von Ortelsburg, bis zur polnischen Grenze, wo Steine eine Rarität waren, kamen sie
jetzt zum Einsatz. Auch beim Bau von Häusern, besonders für die Fundamente, wurden sie eingesetzt, weil auf diese
Weise viel Ziegeln eingespart wurden. Die Firma Gribienski aus Ortelsburg hat die großen Steine mit Dynamit gesprengt
und auf diese Weise die weitere Verarbeitung erleichtert.
Die Steine welche beim Pflügen aus dem Boden geholt wurden, hat man am Feldrand auf große Haufen zusammen getragen.
Wenn die Feldarbeit beendet war, sowie auch in den Wintermonaten, waren wir jeden Tag mit Steinen unterwegs. Wir sind
vorwiegend am Abend los gefahren, weil unter der schweren Last die Wagenachsen so heiß wurden und die Gefahr bestand,
das durch die Dehnung, die Räder blockiert würden. Bei einer Fahrt konnte man bis zu 24 Reichsmark verdienen, wogegen
1 Zentner Roggen für 8 bis 9 Reichsmark zu haben war. Ich bin selbst, mit dem Pferdewagen bis Fürstenwalde, Radostowen,
Luka, Altkirchen, Höhenwerder, ja sogar bis Friedrichshof gefahren.
In Rohmanen wurden auch rote Ziegeln gebrannt. Viele Häuser wurden, mit Ziegeln erbaut, die nur wenige 100 Meter von
der Baustelle entfernt hergestellt wurden. Der Lehn wurde auf den Feldern in der näheren Umgebung entnommen, dann von
Ochsen solange getreten, bis er so geschmeidig war, das er sich in Formen einstreichen ließ. Wenn die Ziegel in der
Form trocken war, wurde sie entnommen und in einem Brennofen gestapelt. Um einen Ofen richtig anzufeuern, brauchte man
12 Raummeter Holz, das im Zeitraum von ein par Tagen verheizt wurde. Der Fischer Karl Glitza hatte schon eine
Knetmaschine, die von einem Pferd angetrieben wurde, das mit verbundenen Augen, den ganzen Tag in die Runde ging.
Im Dorf waren auch vier Kalköfen, in denen so genannte Kalksteine, die sich an gewissen Stellen, im Erdboden befanden,
gebrannt wurden. Nach dem Brennen wurden die Steine mit Wasser abgelöscht und die daraus entstandne Masse diente, nach
dem Beimischen einer gewissen Menge Sand, dann als Bindemittel beim Häuserbau. Das Gerichtsgebäude und das
Lehrerseminar in Ortelsburg wurden mit Kalk, aus dem Rohmaner Brennöfen erbaut. Auch zum Bau einer Eisenbahnbrücke, auf
der, der Zug, den Sawitzfluß, von Ortelsburg nach Allenstein überquerte, hat mein Großvater, mit einem Ochsengespann,
Kalk gefahren.
Hinter der Scheune, beim Bauern Johann Dembek hat man Tonerde gefördert, aus der man mit Hilfe einer Formerscheibe,
die von einem Arbeiter mit Muskelkraft(Fußbetrieb) angetrieben wurde, schöne Krüge, Schalen und Vasen geformt hat.
Die Töpferware wurde, nachdem sie trocken genug war, auch in einem Ofen gebrannt, anschließend mit einer Lasur
überzogen und wieder gebrannt. Es wurden auch Kacheln zum Bau von Kachelöfen hergestellt, die mit verschiedenen
Ornamenten versehen, die Wohnstuben unserer Vorfahren schmückten. So haben unsere Großväter ihr Leben gemeistert und
nach und nach, unsere Dörfer aus der Rückständigkeit in die Neuzeit geführt.
Das gesellschaftliche Leben nach dem 1. Weltkrieg

Als der Lehrer Alfred Dorka, ein Frontkämpfer des Ersten Weltkrieges und ein Sportsmann, als
zweite Lehrkraft an der Rohmaner Schule angestellt wurde, hat er die Sitten und Gebräuche aus früherer Zeit wieder zum
Leben erweckt. Zuerst hat er die Jugend zusammen gerufen, einen Jugendverein und einen Fußballclub, gegründet. Zum
Vorsitzenden des Fußballclubs wurde Johann Gloddek berufen, der ihn auch geleitet hat. Bauer Wilhelm Spittka, der am
Rohmaner See wohnte, stellte Land für einen Sportplatz unentgeltlich zur Verfügung. Lehrer Alfred Dorka hat am
Rohmaner See eine Badestelle ausgesucht und ein Sprungbrett bauen lassen. An jedem Sonnabend im Sommer, bevor die
Sonne unterging, versammelte sich die gestammte Jugend des Dorfes an der Badestelle am See. Es wurde gebadet,
Heimatlieder gesungen, gespielt, im Fackelschein eines großen Biwakfeuers, bis in die späte Nacht hinein. Der Fischer
Karl Glitza hat uns Kähne zur Verfügung gestellt, mit denen wir auf den See hinausgepaddelt sind, dabei hatten wir viel
Spaß, was wiederum den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft gefördert hat. Ich habe mit meiner Mandoline den Gesang von
Volks- und Heimatliedern begleitet.
Der Rohmaner See liegt in einem Tal, dessen Hänge zu beiden Seiten mit Kiefern und Tannen bewaldet sind. Wenn man
gesungen oder Musiziert hat, hallte es von den Hängen zurück. Die Ufer waren mit Kalmus und Schilf bewachsen, was für
die Fischaufzucht von Vorteil war. Wenn man an einem sonnigen, windstillen Tag, am Seeufer spazieren ging, traf man
oft auf Flachstellen, an denen sich die Fischbrut im Sonnenlicht wärmte, wie ein Mückenschwarm. Im See befanden sich
folgende Fische: Karpfen, Hechte, Schleie, Barsche Plötze, Rotaugen, Aale und Krebse. Am Sonntagmorgen brachten viele
Rohmaner ihre Pferde zum See um sie zu baden.
Es wurden dort, unter der Aufsicht von Lehrer Dorka, auch viele Jugendfeste mit Theatervorführungen veranstaltet, zu
denen er selbst die Vorlagen organisiert hat. Der am See wohnende Bauer Johann Nadrowski, hat uns ein Scheunentor, als
Tanzboden zur Verfügung gestellt. Der Zimmermann Wilhelm Wittek hat uns eine Windmühle gebaut, die am auf dem Boden
liegenden Scheunentor aufgestellt wurde, dazu kamen Noch Tannen und Fichten, die das Ganze wie ein Bühnenbild
erscheinen ließen. Es wunden viele Bühnenstücke aufgeführt, unter anderen >Alte Weiber werden jung gemahlen<. Dazu bot
die Windmühle die entsprechende Kulisse.
Nach der Vorführung wurde der Boden aufgeräumt, um dann als Tanzdiele zur Verfügung zu stehen. Der Gastwirt Trzaska
hatte Tische und Bänke aufgestellt, Speisen und Getränke angeboten, so dass sich die die Veranstaltung bis in die
späte Nacht hinein zog. Es waren auch Leute aus Ortelsburg und anderen Nachbardörfern dabei. Im Winter hat Lehrer
Dorka eine Kreisrodelbahn eingerichtet, die von Zeit zu Zeit mit Wasser besprengt wurde, um die Gleitfähigkeit zu
verbessern. Von einer Anhöhe ging hinunter bis auf den halben See, was für alle ein großes Vergnügen war. Es kamen
Lehrer mit Schulklassen aus der näheren Umgebung um hier zu Rodeln.
Als Herr Lehrer Jobski als Hauptlehrer nach Rohmanen kam hat er mit dem Bürgermeister und der Gemeindeverwaltung
beschlossen, in der Nähe des Dorfes, auf einem zur Schule gehörenden Grundstück, einen Sportplatz anzulegen. Dafür
wurde gleich hinter den Gärten, 6 Morgen Ackerland abgetrennt, und nach Feierabend hat Lehrer Dorka mit den
Jugendlichen eingeebnet und gleich nebenan einen Graben für Schützenstand und Kugelfang ausgehoben. Am Sonntagvormittag
wurde Fußball gespielt und um 15:00 Uhr war Kleinkalieberschießen angesagt. Es musste auch ein kleiner Beitrag erhoben
werden, um Munition kaufen zu können. Eine Büchse konnten wir aus beim Kleinkalieberverein in Ortelsburg ausleihen.
Nach Hitlers Machtergreifung
Als Adolf Hitler an die Macht kam wurde die SA gegründet. Der Bürgermeister Michael Kownatzki
wurde zum Gruppenführer ernannt und folgende Männer haben sich freiwillig gemeldet: Wilhelm Matzey, Johann Gloddek,
Gustav Nadrowski, August Buttler, Karl Baran, Emil Nickel, Wilhelm Jaschinski, Emil Bork, Ernst Rattay und Gustav Bach.
Bei Versammlungen war die SA in Uniform angetreten um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Wer versucht hat Unruhe zu
stiften, egal aus welchem Grunde, wurde aufgefordert den Saal zu verlassen, andernfalls wurde er mit Gewalt entfernt.
Herr Lehrer Jobski wurde zum politischen Leiter ernannt, seine Frau hat die NS-Frauenschaft gegründet, Lehrer Dorka
die HJ, und so bekam die Dorfgemeinschaft, nach und nach ein anderes Gesicht. Der Sportplatz und der Schützenstand
wurden jetzt mehr als früher in den Mittelpunkt gestellt. Nach der Feldarbeit hat der Bürgermeister Fuhrwerke bestellt
und den Sportplatz noch besser herrichten lassen.
Der Bauer Wilhelm Both wurde zum Ortsbauernführer ernannt, mit der Aufgabe alles Land für den Anbau von Getreide und
Futtermittel bereitzustellen, oder wenn das nicht möglich war mit Wald aufzuforsten. Durch den Einsatz von Kunstdüngern
sollten größere Erträge aus dem Boden geholt werden, um den Viehbestand zu vergrößern und mehr Milch und Butter zu
produzieren. Deutschland sollte im Stande sein sich selbst zu selbst zu ernähren, ohne auf Importe angewiesen zu sein.
Frau Jobski hat, innerhalb der der NS-Frauenschaft, mit Hilfe von Fachkräften aus Ortelsburg, Lehrgänge veranstaltet,
auf denen man Backen und Nähen lernte. Auf den Bauernhöfen befand sich auch immer mehr Rassegeflügel, das eine erhöhte
Produktion von Eiern und Geflügelfleisch sicherstellen sollte.
Die Rohmaner Bauern hatten, außer in der Landwirtschaft, noch andere Verdienstmöglichkeiten in der Kreisstadt. In
Ortelsburg wurden vier Sägewerke betrieben, die mit Langholz aus dem Walde versorgt werden mussten. Wir haben eine
Kiefer von über 8 Festmeter angefahren, der wir zuerst 6 Meter Spitze abschneiden mussten, um diese Last überhaupt
auf den Wagen zu bekommen. Sechs Pferde musste angespannt werden um den Wagen zur befestigten Straße zu bringen.
Fichten und Tannen wuchsen bis zu einer Länge von 30 Metern. Auch beim Transport von Ziegel, von der Ziegelei zum
Bahnhof, konnte man gutes Geld verdienen.
Im Jahr 1934 wurde Rohmanen an das überregionale Stromnetz angeschlossen und schaffte auf diese Weise den Sprung von
der Petroleumlampe zur Glühbirne. Neben dem Grundstück von Karl Pietzonka wurde ein Transformatorhäuschen errichtet,
in dem der ankommende Strom von einer Hochspannung auf eine Verbrauchsspannung transformiert wurde. Es gab schon eine
Überlandleitung, die aus Richtung Ortelsburg kommend, quer über die Felder, in Richtung Neu Keykuth weiter ging.
Durch eine Zwischenspanne wurde der Transformator, mit der Hauptleitung auf Kownatzkis Feld verbunden.
Ein Stromanschluss konnte die Arbeit im Haus und Hof auf vielfältige Weise erleichtern, doch nur die besser gestellten
Bauern, sowie noch manche Pensionäre, die ein festes Einkommen hatten, konnten sich dass leisten. Weil nur wenige an
der Elektrifizierung teilnahmen, war ein Stromanschluss mit hohen Kosten verbunden. Nur Gustav Pietzonka, Gasthof
Trzaska, Friedrich Nickel, die Schule und Wilhelm Both, wurden in der ersten Phase erfasst.
Im Jahr 1952 wurde von den polnischen Behörden die zweite Stufe der Elektrifizierung eingeleitet, in der alle im Dorf
stehen Gebäude erfasst wurden. Am Anfang wurden nur Leitungen für Lichtstrom gelegt und auch nur 3 Lichtstellen pro
Haushalt bewilligt. Doch im nachfolgenden Zeitraum wurden dann, wenn Material vorhanden war, weitere Lichtpunkte
angelegt. 1952, am zweiten Wochenende im Advent, wurden dann die Leitungen geschaltet und alle waren von der
plötzlichen Helligkeit sehr begeistert. Wenn man Glühbirnen auswechseln wollte musste man am Anfang weite Wege
zurücklegen, um welche zu bekommen. In den 60ger Jahren wurden dann immer mehr Starkstromleitungen gelegt, weil die
Bauern elektrische Geräte kaufen konnten. Ende der 60ger wurden auch die Abbauten an das Stromnetz angeschlossen.
Das Urnengrab auf unserem Feld
Auf unserem Feld, in Richtung Seelonken, bin ich oft beim pflügen gegen Steine gestoßen, manchmal
rissen sogar die Stränge am Pferdegeschirr. Eines Tages nahm ich einen Spaten, Brechstange und einen langen Baum, um
der Sache auf den Grund zu gehen. Als ich eine Menge Sand ausgehoben hatte stieß ich auf eine steile, aus Steinen
errichtete Wand, die ich auch mit dem Baum nicht aus der Fassung bringen konnte. Ich habe den ganzen Vormittag gegraben,
konnte jedoch nicht unter die Steine kommen. Einige Tage später hatten wir in der Schule eine Bauernversammlung, da
habe ich Herrn Biella und Herrn Lehrer Dorka von meinem Fund berichtet. Am nächsten Morgen kam der Lehrer Dorka mit der
ganzen Schulklasse, mit Spaten und Sieben ausgerüstet auf unser Feld und fingen an die ausgehobene Erde zu sieben.
Lehrer Dorka benachrichtigte daraufhin den Leiter des Ortelsburger Heimatmuseums, der am nächsten Morgen vorbei kam um
sich die Fundstelle genau anzusehen. Er beauftragte ihn 4 Mann zu besorgen, um die Steine ringsum frei zu schaufeln.
Zwischen den Steinen durften wir die Erde nur mit Esslöffeln ausheben. Als es plötzlich zu regnen anfing hat Lehrer
Dorka die Brauerei Daum, in Ortelsburg angerufen, die uns über der Fundstelle ein Zelt errichtet haben, damit wir
ungestört weiterarbeiten konnten. Wir fanden 8 flache und 8 hohe Urnen zu beiden Seiten am Körper. Die Urnen wurden in
Gipsbinden eingewickelt und ins Heimatmuseum nach Ortelsburg gebracht, wo sie durch einen Fachmann, der extra aus einem
Königsberger Museum angereist war. Nach Reinigung der Urnen hat er festgestellt, das die Grabstätte etwa 2000 Jahre vor
Christi Geburt angelegt wurde und ein Doppelgrab war, in dem ein Toter liegend und einer in Hochstellung beigesetzt
wurde.
Die Nachricht von der Fundstelle verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Es erschienen viele Schaulustige, ganze
Schulklassen aus der Umgebung, mit Autos und zu Fuß. Durch die vielen Menschen wurden die bestellten Ackerflächen auf
unserem Feld sehr in Mitleidenschaft gezogen, eine Entschädigung haben wir nicht erhalten. Das Grab wurde vor dem
Heimatmuseum in Ortelsburg wieder so aufgebaut wie man es auf unserem Feld vorgefunden hat. Für den Transport der
Steine wurde ich entlohnt. Die Urnen hat das Königsberger Museum an sich genommen und wollte sie nicht wieder hergeben,
weil die solch einen Fund noch nicht in ihrer Sammlung hatten.
Sonnenwendfeuer
Am 24 Juni fand eine Sonnenwendfeier statt. Ein Brauch der an die alten Germanen erinnern sollte.
Der Lehrer Dorka hat den Bürgermeister beauftragt 2 Fuhrwerke in den Wald zu schicken, die Holz und alten Reisig holen
und auf dem großen Schulberg abladen sollten. Das Straßenbauamt hat uns Teertonnen zur Verfügung gestellt. Die ganze
Dorfgemeinschaft wurde eingeladen, am Abend, nach der Feldarbeit, an der Sonnenwendfeier teilzunehmen. Lehrer Dorka
hielt zuerst eine Ansprache, in der er anschaulich erklärte wie unsere Vorfahren in grauer Vorzeit gefeiert haben.
Nach dem offiziellen Teil wurden das Holz und die Teertonnen angezündet, es wurden Heimatlieder gesungen, wie: Wild
flutet der See, drauf schaukelt der Schiffer den schwankenden Kahn, Schaum wälzt er wie Schnee, von grausiger Mitte
zum Ufer heran, wild fluten die Wellen auf Vaterlands See, wie schön, oh trag mich auf Spiegel zu Hügel, Masovias See.
Masovia Land, mein Heimatland, Masovia es lebe mein Vaterland.
Lehrer Alfred Dorka und sein Wirken für Rohmanen.

Friedrich Biella hatte auf seinem Feld einen Granitstein mit einer geraden Seite, den haben wir
mit viel Schweiß an den Dorfteich transportiert und auf einer Erhöhung abgelegt. Der Stein sollte zum Denkmahl für die
Gefallenen des Ersten Weltkrieges umgestaltet werden. Da zu Wenige daran ein Interesse zeigten, wurde diese Idee fallen
gelassen und der Stein irgendwann ins Wasser gerollt. Der Lehrer Dorka war viele Jahre in Rohmanen tätig, dort hat er
später seine ehemalige Schülerin, Lotte Biella geheiratet. Er hat sich sehr für die Entwicklung des Dorfes interessiert,
war bei jeder Gemeindeversammlung anwesend und hat auf Schwachstellen hingewiesen die den Fortschritt behinderten.
Gemeinsam mit den Schülern hat er den Ehrenfriedhof für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges gepflegt, an der
Wegegablung nach Eichtal und zu Ehren des Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg eine Eiche gepflanzt.
Zum Advent hat Lehrer Dorka mit der Jugend einen Adventstern, in verschiedenen Farben gebastelt.
Der Stern wurde auf einer 2 Meter langen Stange befestigt, in der Mitte wurde ein Wachslicht angezündet, am Stern
wurde eine Schnur angebracht, wenn man daran zog rollte der Stern hin und her. Am ersten Wochenende im Advent
versammelten sich jung und alt, um den Stern durch das Dorf zu tragen. Alle schlossen sich dem vorausgehenden
Sternträger an, der den Stern durch die Hauptstraße und die angrenzenden Wege trug. Dieser Sternmarsch wurde an den
folgenden Adventwochenenden wiederholt.
Am ersten Weihnachtfeiertag wurde um 4:00 Uhr morgens ein Frühgottesdienst gehalten. Zuerst hat der Pfarrer eine
Andacht gehalten, dann haben die Kinder ein Krippenspiel aufgeführt und die Gemeinde hat schöne Weihnachtslieder
gesungen. Der Gastwirt Trzaska hat uns den Saal zur Verfügung gestellt. Wir hatten eine Posaunen- u. eine
Gitarrengruppe. Unter der Leitung von Herrn Willi Doormann spielten: Gottlieb Brosch, Fritz Ollech,
Gustav Rattay(Sopran), Wilhelm Pilath, Gustav Brosch(Alt), Fritz Both(Tenor) und Fritz Brosch(Bass).
In der Gitarrengruppe wirkten mit: Martha Ollech, Hedwig Ollech, Martha Lekzik, Martha Michalick und Auguste Lekzick.
Willy Doormann hat sie auf der Geige begleitet.
Kurz vor Ausbruch des 2. Weltkrieges
Bei der Aufstellung des Grenzschutzes(Regiment Buchholz), hat er als Hauptfeldwebel die
Gruppenführerkurse überwacht und selbst die fähigsten Männer dafür vorgeschlagen. Das Ausbildungspersonal hat das
Jäger-Battalion gestellt. Wir kamen zuerst ins Stadion(Waldheim), wurden da eingekleidet und dann ging es gleich
kasernenmäßig zu, theoretisch und praktisch. Jeder musste vor die Front treten und nachweisen ob er im Stande ist,
Befehle zu erteilen. Abends wurden Filme vorgeführt die uns zeigen sollten wie eine Gruppe sich im Gelände entfalten
muss. Die Exerziervorschriften hatten sich, im Verhältnis zu Kaiser Wilhelms Zeiten, etwas geändert. Damals bestand
eine Gruppe aus 8 Mann und einem Unteroffizier, jetzt aus 10 Schützen, 3 für das leichte Maschinengewehr und einem
Unteroffizier(13 Mann). Nach der Schulung folgte eine Abschlussprüfung, danach ein gemütliches Beisammensein. Aus
Rohmanen haben folgende Männer die Prüfung bestanden: Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy, Gustav Rattay und
Gustav Deptolla. Unsere Uniformen waren alle zu klein und es gab viel zu lachen bei der Anprobe.
Die erste Übung habe ich mit Emil Rosowski, in Lenzinen gemacht. Der Gutsbesitzer Marzinzick hat seine Scheune als
Unterkunft zur Verfügung gestellt. Er war im Range eines Hauptfeldwebels. In seinem haus war die Schreibstube
untergebracht, die er selbst verwaltete. Ein Lastauto hatte Uniformen aus der Kaserne in Ortelsburg geholt, jeder
musste eine Uniform anlegen und dann wurde solange getauscht bis alle eine passende gefunden hatten. An den Namen des
Kompanieführers kann ich mich nicht mehr erinnern. 1935 wurden wir zu einer Übung in die Dragonerkaserne nach Lyk
einberufen. Die Gruppenführer, Zugführer, und Kompanieführer die schon Frontberührung im dem Ersten Weltkrieg hatten,
mussten eine Woche früher anreisen. Die Übungen waren auf 6 Wochen angelegt. Die meisten der einberufenen waren noch
nie mit dem Wehrdienst in Berührung gekommen. Jeder Gruppenführer bekam 13 Mann zugeteilt.
Unser Zugführer war Leutnant Neumann, Kompanieführer Oberleutnant Rutschko, Battalions-Kommandeur Major Gröning
(Regiment Buchholz). Hier ging es wieder Kasernenmäßig voran. Das Bataillon wurde hier vereidigt. Jeden zweiten
Sonntag durften unsere Frauen uns besuchen. Ein Jahr später wurden wir wieder zu einer Übung einberufen, auf den
Truppenübungsplatz nach Arys. Jeder Gruppenführer hatte den Auftrag die Gruppe zu entfalten, und auf bewegliche
Figuren zu schießen. Diese Übung musste später mit scharfer Munition wiederholt werden. Jedes Maschinengewehr bekam
50 Schuss, jeder Schütze 20 Schuss zugeteilt. Nach dem Abschießen wurden die Treffer gezählt und dem Kommandierenden
Bericht erstattet. In einiger Entfernung spaziert ein Storch umher, der gar nicht bemerkt hatte dass geschossen wurde,
was bei den Kameraden ein großes Gelächter hervorrief.
Nach der Übung wurde uns gesagt das jeder Gruppenführer eine arische Abstammung nachweisen sollte. Ich konnte in den
Rheinsweiner Kirchenbüchern meine Vorfahren aus Gellen, bis zum Jahr 1732 zurück, nachweisen und wurde zum
Unteroffizier befördert. Aus unserem Dorf wurden auch, Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy und Gustav Deptolla
befördert. Zwischendurch mussten wir schon mal in die Radfahrer-Kaserne nach Ortelsburg, Gewehre empfangen und im
Gelände üben. Am 31 Juli 1939 wurde mir von einem Soldaten ein Schreiben übereicht, das mich aufforderte, am 1. August
um 6:00 Uhr, bei der 3. Kompanie, des 2. Infanterieregiments zu erscheinen.
Um 5:30 hat mich meine Schwester in die Kaserne gebracht. Auf der Schreibstube erklärte mir der Hauptfeldwebel,
dass mir ab sofort der Dienstgrad eines Sanitäters zugewiesen wird, ich mich in der Kammer einzukleiden hätte und mir
in der Handwerkerstube die entsprechenden Schulterklappen annähen lassen sollte. Die aktiven Sanitäter wurden den
Feldlazaretten zugewiesen und wir kamen an ihre Stelle. Unser Bataillon wurde nach Schodmak zum Bunker bauen und
Stacheldraht verlegen eingeteilt. Wir zogen in Begleitung einer Musikkapelle bis zur Kreuzung am Krankenhaus, dann
weiter zu unserem Bestimmungsort, gefolgt von einer Gulaschkanone die in den nächsten Tagen für unsere Verpflegung
sorgen sollte.
Am 14 August haben wir die Jägerkaserne, begleitet von einer Musikkapelle endgültig verlassen und zogen zuerst durch
Ortelsburg, dann über Lehmanen ins Feldmanöver, hinter Rohmanen. Dort entfaltete sich das Bataillon im Gelände, die
Verwundetensammelstelle wurde auf dem Hof des Bauern Friedrich Neumann eingerichtet. Gegen Abend wurde zu Sammeln
geblasen und Biwak bezogen, wobei unsere 3.Kompanie, in einem kleinen Wallt, in der Nähe von Otto Nickels Gehöft
Stellung bezogen hatte. Die 2. und 4. Kompanie hatte sich in der Nähe vom Abbau Pallasch niedergelassen. Die Frau
Nickel hat am Abend ein Mädel in Dorf geschickt um meiner Frau Bescheid zu sagen, wo wir uns zurzeit befinden. Meine
Frau ist dann noch gekommen um sich von mir zu verabschieden, weil wir am nächsten Morgen um 3:00 Uhr Zelte abbrechen
und um 4:00 Uhr in Richtung Kaspersguth marschieren sollten.
Wir sind dann über Achodden, Seelonken, Lehmanen, Ortelsburg, bis nach Grammen und Schützendorf marschiert, wo wir an
einem See Biwak bezogen haben. Es wurde immer gesagt, wir kommen zum Tannenberg-Denkmal bei Hohenstein, wo ein Reichs
Kriegervereinsfest stattfinden sollte. Es wurden auch schon Vorkommandos aufgestellt, doch dann kamen wir nach Orlau
und Lahna-Mühle, da wo die Alle entspringt haben wir 2 Tage biwakiert. Unser Kompanieführer hat uns nach Waplitz auf
den Soldatenfriedhof des Ersten Weltkrieges geführt und uns erklärt wie das Jägerbataillon sich 1914 hier entfaltet
hat und aufgerieben wurde. Dann mussten wir in der Nähe von Gut Koslau über einen Fluss und bezogen in einem Waldstück,
vorbereitete Stellungen in der Nähe der polnischen Grenze. Herr und Frau Thalmann haben uns jeden Tag, bis zur Grenze,
mit Brötchen und Getränken versorgt. Es wurde scharfe Munition ausgegeben, weil wir am nächsten Morgen um 4:00 Uhr die
polnische Grenze überschreiten sollten.
Am nächsten Morgen um 10 Minuten vor 4:00 Uhr kam der Befehl; scharfe Munition abgeben, alles zurück in ein 6 Kilometer
entferntes Dorf, wo wir auch einquartiert wurden. Das alles geschah’ eine Woche vor dem 1. September 1939. Es wurde
gesagt dass der Führer dem polnischen Präsidenten Rid-Szmigly, ein Ultimatum gestellt hat und es wahrscheinlich nicht
zum Krieg mit Polen kommt. Genau nach 5 Tagen kehrten wir wieder in die gleichen Stellungen zurück, es wurde wieder
scharfe Munition ausgegeben und am nächsten Morgen um 4:00 Uhr überschritten wir die polnische Grenze.
“Der 2. Weltkrieg.”
Der erste Einsatz in Polen
Wir kamen zuerst in ein Dorf in dem sich nur alte Menschen befanden. Auf unsere Frage wo denn die Bewohner wären sagte
man uns dass alle geflohen sind, weil erzählt wurde, die Deutschen würden alle Polen misshandeln und verstümmeln. Ich
habe ihnen daraufhin gesagt dass uns, unter Androhung von Strafe verboten wurde, einem Zivilisten etwas anzutun. Das
Vieh, die Schweine und Hunde des Dorfes liefen frei herum und die Soldaten fingen an auf die Hunde zu schießen, bis
gesagt wurde es seien Meldehunde im Dienste der Deutschen Wehrmacht und dieser Unfug der eigenen Truppe schaden würde,
weil etwaige Querschläger eigene Kameraden verletzen könnten. Wir gingen weiter auf polnischer Seite entlang der Grenze,
bis wir am Nachmittag die ersten Vorposten der Festung Mlawa erreichten, da befanden wir uns plötzlich im Feuerhagel
polnischer Festungsflack.
Am nächsten Morgen hatte ich schon 3 Verwundete und wusste nicht wo sich eine Verwundeten Sammelstelle befindet. Ich
suchte den Bataillonsgefechtstand auf der sich auf einer Anhöhe befand. Ich habe unseren Oberstabsarzt gefragt wo denn
die Verwundetensammelstelle wäre. Er rief beim Tross an, wo er die Auskunft erhielt, das sich vor dem Dorf ein Bunker
befindet in dem man die Verwundeten sammeln sollte, die dann von Sanitätsautos abgeholt würden, weil das Dorf unter
Artilleriebeschuss stand. Am Sonnabend haben unsere Flieger die Bunkerstellungen bombardiert, konnten aber, trotz guter
Treffer nicht viel ausrichten, die Bunker wurden nur etwas angekratzt.
Der Beschuss unserer vordersten Linien ging mit unverminderter Heftigkeit weiter. Am Sonntag verkündete eine große
Staubwolke die Ankunft unserer Panzer, doch sie kamen nur bis zur Panzersperre und mussten wieder abdrehen ohne den
Polen einen schaden zuzufügen. Ein Panzer bekam einen Volltreffer, der Fahrer konnte noch umkehren. Er blutete am Kopf
und der Schütze war so eingeklemmt, das wir ihn nur mit einem Seil unter den Armen, durch die Luke nach oben ziehen
konnten. Ob er seine Verwundung überlebt hat ist mir nicht bekannt, denn in der Nacht wurden Panzergeschütze nach
vorne in Stellung gebracht, die direkt in die Schießscharten der Bunker geschossen und so die Verteidiger vertrieben
haben. Daraufhin sind wir weiter vorgerückt. Auf einer Wiese war ein tiefer Graben ausgehoben und mit Ästen getarnt,
da war ein Panzer hinein gefahren, so dass nur das Hinterteil herausragte und er sich nicht aus eigner Kraft befreien
konnte. In der Luft waren Flieger die Brandbomben abwarfen, ich habe mich auf den Boden geworfen weil ich dachte die
würden explodieren, aber sie zischten nur, so das Stoppeln und Graß rings herum in Brand gerieten.
Bei den Kampfhandlungen gab es mehrere Verwundete, denen ich gerade Verbände anlegen wollte, als unser Hauptmann zur
Trillerpfeife griff um mir klar zu machen, dass ich ihm folgen sollte. Die Polen fingen an zu schreien, ich sollte
sie ins Lazarett bringen denn hier im Wald würde sie niemand finden. Ich setzte mich aufs Fahrrad und folgte unserem
Kompanieführer, der mir sagte ich soll immer bei der kämpfenden Truppe bleiben, denn hinter der Front sind die
Sanitätsabteilungen, die werden die Verwundeten schon versorgen. Der Vormarsch dauerte bis in die späte Nacht. Auf
einem Gehöft, das nach allen Seiten durch Feldwachen abgesichert wurde, machten wir endlich Rast. Wir haben
Getreidegarben auf dem Hof ausgebreitet und uns zur Ruhe gelegt, als plötzlich um Mitternacht Leuchtraketen den Himmel
erhellten und Maschinengewehrfeuer uns aus dem Schlaf schreckte. Ein par polnische Soldaten hatten das Feuer eröffnet,
aber sich kurz darauf ergeben.
Die Narew-Überquerung
Als es hell wurde ging der Vormarsch weiter. Es wurde uns untersagt Tagebuch zu führen, darum
weiß ich nicht wie die Orte hießen, durch die wir marschiert sind. Als wir durch ein sumpfiges Gelände vor drangen
stand auf einer Anhöhe am Horizont, die polnische Artillerie, die uns sofort unter Beschuss nahm. Unser Hauptmann war
der Meinung dass wir schon in der Nähe des Flusses Narew sein müssten, als aus den Sträuchern ein mit Schlauchboten
beladenes Lastauto auftauchte. Wir wurden aufgefordert mit je 6 Mann ein Schlauchboot zu nehmen, an einem Aggregat
der daneben stand mit Luft zu füllen und zu Wasser zu lassen. In einer Stunde war das ganze Bataillon über die Narew,
wo der Vormarsch fortgesetzt wurde. In einem Dorf überraschte uns die polnische Kavallerie und fing sofort mit
Maschinengewehren zu schießen an. Da kam der Befehl: Alles wieder zurück. Es ging noch schneller als auf der Hinfahrt.
Wir sind erst einige Kilometer am Fluss entlang gegangen und haben dann zum zweiten Mal rüber gesetzt.
Die Gehöfte im Dorf standen alle in Brand. Auf einem waren viele Bienestöcke. 2 Kameraden wollten den Stöcken Waben
entnehmen, doch die Bienen durch das Feuer aufgeschreckt, überfielen sie sofort und stachen derart zu das sie nicht
mehr wieder zu erkennen waren. Ich habe die Einstichstellen mit Salmiak betupft, mehr konnte ich nicht tun. Wir mussten
auf unserem Vormarsch durch einen Wald der in Flammen stand, so dass man kaum atmen konnte. Es ging weiter in Richtung
Minsk und Warschau, wo schon die Sowjetische Armee durchgegangen war, die Pferde und Vieh von einem Gut mitgenommen
hatten. In einem Wald stießen wir unverhofft auf ein Kloster, in dem wir einige Gefangene machten. Dann trafen wir auf
eine gute Straße die nach Grochow ging.
Als wir dort einmarschierten wurden wir aus den oberen Stockwerken beschossen, so dass wir, um uns zu schützen, nur an
den Hauswänden entlang gehen konnten. Wir haben jedes Haus nach Feinden durchsucht. Vor einem Haus stand ein Hund der
niemanden reinlassen wollte, solange bis ihn eine Kugel traf. Die polnische Artillerie feuerte von Warschau aus, um
unseren Vormarsch zu stoppen. Wir hatten uns gerade eingegraben als plötzlich deutsche Flieger am Himmel erschienen,
die unsere Stellungen mit Bomben bewarfen und dabei viel Unheil anrichteten. Wir haben sofort Fliegertücher
ausgebreitet und Leuchtraketen abgeschossen. Da ich in dem Graben, den ich kurz zuvor ausgehoben hatte, sofort in
Deckung gegangen bin ist mir zum Glück nichts passiert. Unter den anderen Kameraden gab es viele Verwundete, so dass
ich nicht wusste wem ich zuerst helfen sollte.
Der Oberstabsarzt hat mich sofort tatkräftig unterstützt, so das bald alle Verwundeten versorgt waren, außer einem,
dem ein Bombensplitter den Arm abgerissen hat. Ich habe im 3 große Verbandspäckchen auf die Wunde gelegt, doch die
Blutung ließ sich trotzdem nicht stoppen, so dass er eine Stunde später auf der Krankensammelstelle verstarb. Wir
haben danach in einem Tomatenfeld einen Graben ausgehoben und eine neue Abwehrstellung bezogen. Die Gruppe Schwarz
bekam den Auftrag nach etwaigen versprengten polnischen Verbänden Ausschau zu halten, als sie unerwartet aus einer
Häuserreihe mit Maschinengewehrsalven überschüttet wurden. Der Gruppenführer und noch ein Soldat wurden dabei tödlich
verwundet. Danach wurde noch ein weiter Stoßtrupp, unter der Führung von Leutnant Briskorn, der sich dazu freiwillig
gemeldet hatte, hinaus geschickt um den Gruppenführer und den anderen Toten zu bergen.
Bei diesem Unternehmen, das erfolglos ausging, weil die Toten schon verscharrt waren, durchschlug eine Kugel den
Stahlhelm von Leutnant Briskorn, der auch sofort tot war. Alle Toten wurden später, an der Kirchenmauer in Grochow, in
Särgen beigesetzt: Hauptmann Schönwald sagte, das sie nach dem Kriege auf den Heldenfriedhof nach Ortelsburg überführt
werden. Drei Tage lagen wir bei Grochow in Stellungen, waren dem polnischen Maschinengewehrfeuer sowie den Bomben
deutscher Flugzeuge ausgesetzt. In der Nacht musste ich zu einem Verwundeten in die vorderste Linie und habe den
Rückweg nicht mehr finden können, als plötzlich Gewehrfeuer aufflammte habe ich in den Ruinen Schutz gesucht. Erst im
Morgengrauen konnte ich mich wieder orientieren und zu meinem Unterstand zurückfinden.
Warschau wurde tagelang bombardiert und stand auch unter Artilleriebeschuss. Aus dunklen Rauchwolken kamen oft ganze
Bündel von Papier angeflogen. Die Verwundeten kamen oft auf Krücken zu unserem Unterstand, ich habe sie dann zur
Krankensammelstelle hingeführt. Wir haben auch polnische Zivilpersonen betreut, die während der Kampfhandlungen
verwundet wurden. Als einmal 2 Jungen vorbeiliefen hat einer ihnen nachgerufen sie sollten seiner Frau Bescheid sagen,
er wäre auf der Krankensammelstelle an der Kirche. Als wir dort ankamen war seine Frau, mit einem Kind auf dem Arm,
schon da.
Nach der Kapitulation von Warschau, gingen wir über Sokolow zum Bug und haben dort Quartier bezogen. Der Russe hatte
sich bereits hinter den Fluss zurückgezogen, hatte alles Vieh und Pferde mitgenommen. Dort erreichte mich ein Telegramm
von zu Hause, dass meine Tochter gestorben ist. Es sprach sich auch herum dass verschiedene Heimaturlaub bekommen haben,
ich durfte auch für 14 Tage heim. Wir fuhren mit Lastautos nach Allenstein in die neue Reiterkaserne, zum
Ersatzbatallion, da haben wir unsere Gewehre und Munition abgeben, dann durften wir, jeder in seinen Heimatort
weiterfahren.
Als wir unsere Quartiere am Bug verlassen haben war sehr viel Schnee gefallen. Hier in Ortelsburg fanden wir die
gleiche Wetterlage vor, aber nach 3 Tagen war alles wieder weggetaut und wir konnten die Kartoffelernte, die durch den
frühen Wintereinbruch gestoppt wurde, zu Ende bringen. Ein Tag bevor ich zu Hause angekommen bin wurde die Tochter
beerdigt. Nach 14 Tagen mussten wir uns in Allenstein melden, Gewehre empfangen und wieder zurück zur Division an den
Bug 150 Kilometer hinter Warschau. Die elfte Division, zu der wir auch gehörten sollte in den Westen Deutschlands
verlegt werden und war schon unterwegs zur Verladestation Skiernewice 50 Kilometer vor Warschau.
Mein Dienst als Sanitätsunteroffizier
Unser Bataillon kam in das Städtchen Burscheid, im Kreis Opladen, wo wir in Privatquartieren
untergebracht wurden. Nach 3 Monaten, im Januar 1940, wurden wir nach Solingen verlegt, wo wir bis zum
Frankreichfeldzug stationiert waren. Wir mussten an Feldübungen teilnehmen, wie andere die in Kasernen untergebracht
waren. Während dieser Zeit musste jeder seine Zähne in Ordnung bringen lassen. Jeden Tag fuhren 20 Mann in die
Cäzilienstraße nach Köln, zur Zahnklinik. Im Rheinland wurde unsere Division neu aufgestellt. Ausfälle durch den
Polenfeldzug wurden durch neue Soldaten ergänzt. Ich kam nun zum Ersatzbatallion, war der Älteste in der ganzen
Kompanie. Als der Frankreichfeldzug losging wurde unser Ersatzbatallion mit den noch vorhandenen Verwundeten, in die
neue Reiterkaserne, nach Allenstein verlegt.
Meine Frau hat, mit Unterstützung der Bauernschaft, einen Antrag gestellt, daraufhin wurde ich zur Frühjahrsbestellung,
beurlaubt und später bis auf weiteres vom Militärdienst freigestellt. Als der Russlandfeldzug losging wurde ich von der
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg, für 14 Tage einberufen. Ich war seit 1922, Mitglied der freiwilligen
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg und habe jedes Jahr an Übungen teilgenommen. Jede Bereitschaft musste etliche Leute
stellen. Von Rohmanen wurden Emil Rosowski, Johann Dembek, und ich, zur Krankensammelstelle Wirballen, in Litauen,
abkommandiert. Dorthin kamen Lazarettzüge aus Russland mit der Breitspurbahn. Die Verwundeten wurden frisch verbunden
und auf Waggon mit Normalspur verladen und nach Deutschland gebracht.
Als die 14 Tage vergangen waren wollten wir wieder nach Haus zurück, doch man wollte uns nicht entlassen. Stattdessen
wurden wir dem Wehrkreisamt Königsberg zugeteilt, neu eingekleidet und zur Aushilfe ins Lazarett nach Gumbinnen
abkommandiert. Mehr als ein Jahr war ich in den Urlauber-Baracken, habe dort Krankenstube betreut. Später, bis zum
Dezember 1944, war ich im Reserve-Lazarett 4, in Königsberg tätig. Dort habe ich auch die Luftangriffe der Engländer,
vom 25 bis 26. August 1944 miterlebt.
Wir sollten gerade einen Lazarettzug in Rotenstein entladen, als plötzlich die Sirenen ertönten - Fliegeralarm. Im
gleichen Moment waren die ersten Flugzeuge auch schon da, zuerst warfen sie „Tannenbäume” und danach Foßforkanister ab.
Die Omnibusse standen schon zur Abfahrt bereit als es losging. Wir haben die Verwundeten schnell in den
Luftschutzkeller getragen, haben die Betten von den Fenstern weggerückt damit die Verwundeten nicht von den
Glasssplittern verletzt wurden. Im Kasernenhof brannten die Fosforkanister lichterloh. Unsere Unterkunft, die sich in
einer Baracke befand ist völlig abgebrannt, mit dem Wenigen was wir unser Eigen nannten. Am nächsten Tag wurden wir neu
eingekleidet und am 29. bis 30. kamen die englischen Bomber wieder, sie setzten genau da ihr Zerstörungswerk fort wo
sie vor 3 Tagen aufgehört hatten.
Anfang Dezember 1944 musste ich mich nach Stablack melden und musste dann zur Sanitätsabteilung 1, nach Gernau, das
liegt zwischen Lodz und Warschau. Vormittags hatten wir Felddienstübungen und nachmittags theoretischen Unterricht.
Jeden Tag wurden Gruppen zusammengestellt und zu anderen Einheiten abkommandiert. Ich kam zu einer Panzerabteilung, wo
wir an einem Morgen plötzlich auf dem Kasernenhof antreten mussten und zu unserer Überraschung mit der Nachricht
konfrontiert wurden, dass der Russe an mehreren Frontabschnitten durchgebrochen war. Wir bekamen sofort einen
Marschbefehl in Richtung Lodz, wo das Stadtbild noch intakt war, selbst die Straßenbahnen fuhren noch. In der Nacht
haben russische Flugzeuge die Stadt bombardiert. Die Kaserne in der wir untergebracht waren hatte keine
Luftschutzkeller, aber zum Glück blieben wir von Bombentreffern verschont. Am nächsten morgen bot sich uns ein Bild der
Verwüstung. Die entgleisten Straßenbahnwagen, sowie andere Fahrzeuge blockierten die Straßen. Die Älteren unter uns
bekamen Fahrscheine für einen Transportzug, der bereit hinter Lodz abfahrbereit, unter Dampf stehen sollte. Als
russische Panzer in den Straßen auftauchten, verbrannte die Schreibstube unsere Wehrpässe und andere wichtige
Dokumente. Wir liefen zu der Station auf der unser Transportzug bereitstehen sollte, aber da war kein Zug mehr zu sehen
und wir setzten unseren Rückzug zu Fuß fort.
Der Rückzug und Zusammenbruch der Ostfront
In Dobroschin, einer Stadt in Polen, wurde gerade ein Lazarettzug verladen, doch wir kamen nicht
mehr zum Einsatz, weil die russische Infanterie uns schon auf den Fersen war. Es ging weiter über den Fluss Bober,
Sagan, bis nach Glogau an der Oder. Dort wurden wir der 29. motorisierten Sanitätskompanie zugeteilt. Im
Garnisonslazarett wurden noch Operationen durchgeführt. Unsere Division hatte ihr eigenes Feldlazarett, so dass wir den
Befehl zu Weiterfahrt erhielten und noch unbeschadet die Oderbrücke passieren konnten, denn Glogau wurde zur Festung
erklärt. Wir haben 2 Pferdewagen organisiert und mit Verbänden, sowie medizinischen Instrumenten beladen. So kamen wir
bis nach Lübbenau im Spreewald, wo wir in einem Schloss, in zuvor ein Museum war, unser Lazarett untergebracht haben.
Weil die Amerikaner Cottbus bombardiert hatten, wurden die Verwundeten zu uns nach Lübbenau gebracht. Hier haben wir
Tag und Nacht gearbeitet, um die vielen Verwundeten, aus den schweren Kämpfen bei Grünberg und Sagan zu versorgen. Die
Soldaten von der Abwehrfront kamen schon mit abgestorbenen Armen oder Beinen bei uns an, weil in vorderster Linie keine
Frontlazarette mehr vorhanden waren; es mussten viele Amputationen durchgeführt werden. Als für unsere Pferde kein Heu
mehr vorhanden war, schickte mich unser Hauptfeldwebel, zu einem Bauern in den Spreewald, mit dem Auftrag, Futter zu
besorgen. Mit noch zwei Mann fuhren mit zwei Kähnen, zuerst den Hauptstrom entlang und dann in einen Nebenarm; da haben
wir die Boote beladen und brachten das Heu nach Lübbenau.
Als wir uns bei unser Einheit zurück melden wollten, war alles schon marschbereit. Ich bin schnell in einen Bus
eingestiegen der sofort losfuhr, weil russische Verbände schon in sichtweite waren. Russische Flugzeuge kreisten über
den Dächern und nahmen, mit ihren Bordwaffen jeden unter Beschuss, der sich irgendwo blicken ließ. Wir konnten nur
durch den Wald, oder in der Nacht vorwärts kommen, denn wenn ein Auto auf der Landstraße fuhr, war alsbald ein Flugzeug
hinter ihm her und schoss es in Brand. Als wir nach Tagen am Ufer der Elbe ankamen, war bereits eine Ponton-Brücke
erstellt worden, welche die zerstörte Brücke ersetzen sollte.
Durch die vielen Fahrzeuge waren in den Sand tiefe Spuren gefahren, so dass andere Fahrzeuge unsere Busse ins
Schlepptau nehmen mussten, weil wir mit eigener Kraft nicht mehr weiterkamen. Beiderseits der Trasse standen
Flüchtlingswagen, in der der Hoffnung die Brücke passieren zu können, doch SS-Polizei verhinderte das die Gespanne den
militärischen Rückzug zum Stillstand brachten. Es gelang uns die Elbe zu überqueren, um in einem Waldstück Schutz vor
feindlichen Fliegern zu suchen.
Als wir unsere Busse und Autos gut getarnt hatten, hat unser Bataillonschef die anwesenden Parteigrößen zu sich
gerufen und ihnen erklärt das wir eine Einheit des Roten Kreuzes sind und nach internationalem Recht keine Waffen
besitzen dürfen. Nach langer, erregter Diskussion wurde beschlossen einen Graben auszuheben und alles im Sand zu
verscharren. Als wir dann weiter, durch die Dörfer fuhren, sahen wir schon viele weiße Bettlaken, als Zeichen der
Kapitulation, aus den Fenstern hängen. Es wurde uns erzählt dass der Bürgermeister von der SS erschossen wurde, weil
er die Bevölkerung zu diesem Schritt ermutigt hatte. Jetzt waren hinter uns die Russen und vor uns schon die Amerikaner.
Amerikanische Panzer fuhren umher und schossen wild durch die Gegend, ohne ein Ziel anzuvisieren. Niemand wollte sich
dem Russen ergeben, doch der Weg der zu den Amerikanern führte, war durch abgesägte Bäume blockiert. Wir sind schnell
in das nächste Dorf gegangen, haben uns Sägen und Äxte besorgt, die Bäume durchgesägt und in den Straßengraben
geworfen.
“ Nach dem Ende des 2. Weltkrieges.”
In amerikanische Kriegsgefangenschaft
Dann fuhren wir unter internationaler Flagge an eine Mulde Brücke, vor der zwei amerikanische Soldaten, mit Zigarren,
zur Hälfte im Mund, standen. Sie rauchten und kauten gleichzeitig. Wir mussten auf einen freien Platz fahren, alle
aussteigen und rechts wieder antreten. Wäschebeutel und Tornister mussten wir abstellen; danach wurden wir nach Waffen
durchsucht, Wertsachen, Uhren und Messer wurden uns gleich abgenommen. Als wir anschließend an unserem Gepäck
vorbeigingen durfte niemand was mitnehmen. Als ich gebückt, nach meinem Wäschebeutel greifen wollte, in dem sich noch
3 Konservendosen und ein Brot befanden, bekam ich einen Fußtritt ins Gesicht, so dass mir ein Zahn ausgeschlagen wurde.
Wir wurden dann in einem Garten zusammen getrieben und gefragt ob jemand bei der SS gedient hat. Nachdem wir in Reihe
und Glied angetreten waren, mussten wir den Oberkörper freimachen und die Arme anheben. Es wurde nach SS-Zeichen
gesucht, die gewöhnlich unter dem Oberarm eintätowiert waren. Nachdem wir Grimma bei Leipzig, wo wir in amerikanische
Gefangenschaft geraten waren, verlassen hatten, mussten wir durch ganz Thüringen bis Hersfeld, an der Grenze zu Hessen,
marschieren. In Hersfeld wurden wir auf große Lastautos verladen, die von farbigen Soldaten gefahren wurden. Man hat
uns mit Stöcken hinauf getrieben, solange bis das Auto so voll war das man kaum stehen konnte. Die Soldaten fuhren, für
diese Straßenverhältnisse, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Wenn die Straße eine scharfe Kurve hatte, flogen
wir alle übereinander und mussten erst mit viel Kraftanstrengung auf die Beine kommen um diese Fahrt zu überstehen.
Da die Straßenränder in dieser Gegend mit Obstbäumen bepflanzt sind und deren Äste sehr niedrig hängen, hätten die
uns die Köpfe abgerissen, wenn wir uns nicht ständig geduckt hätten. Unsere Fahrt endete in Bad Kreuznach, in der Pfalz,
wo wir in ein Lager, in dem sich später 130.000 Mann und 6 Generäle befanden, eingepfercht wurden. Die Unterkunft der
Generäle befand sich unter einem Zelt, alle anderen mussten die Zeit unter freiem Himmel zubringen. Die Offiziere, die
Unteroffiziere, die Mannschaften; wurden in getrennten Camps untergebracht. Die Mannschaften wurden auch zur Arbeit
abkommandiert und konnten bei dieser Gelegenheit, Brot, Brötchen oder Zigarettenstummel organisieren, wogegen die
Offiziere und Unteroffiziere ihr Camp überhaupt nicht verlassen durften.
Die ersten Tage gab es kein Wasser und kein Brot, so dass die Kameraden vor Erschöpfung umfielen. Später standen wir
manchmal den ganzen Tag nach Wasser an, das von den, uns bewachenden Negern mit großen Wassertanks angefahren wurde. Am
dritten Tag bekamen wir mittags und abends etwas zu Essen; Brot bekamen wir erst nach zwei Wochen, nach dem aus der
Umgebung herbeigeholte Handwerker, Backöfen gebaut hatten. In den verschiedenen Gemeinden, die in den uns umgebenden
Weinbergen lagen, mussten sich alle Männer beim Bürgermeister melden. Als sie dann erschienen waren, wurden sie auf
bereitstehende Lastautos getrieben und zu uns ins Lager gebracht. Sie waren ohne Kopfbedeckung und ohne wärmere
Bekleidung angekommen, weil ihnen gesagt wurde, dass ihr Aufenthalt im Lager nur von kurzer Dauer sein würde. Man hat
uns, falls noch vorhanden, Decken und Mäntel abgenommen, mit der Begründung, sie würden für Kranke und Verwundete
gebraucht. Jeden Tag starben mehr als 200 Mann, die wir sofort in ein Zelt tragen mussten. In der Nacht wurden die
Toten dann mit unbekanntem Ziel, weggefahren.
Viele haben ihren Verstand verloren uns irrten im ganzen Camp ziellos umher. Als Latrinen wurden Gräben ausgehoben, in
die verschiedene Kameraden, bei der Verrichtung ihrer Notdurft, vor Schwäche hineingefallen sind und nicht mehr wieder
heraus kamen. Aus den Pfählen die, die jungen Obstbäume stützten, haben wir Krankentragen gebaut um unsere Kameraden,
bei Bedarf, zur Krankensammelstelle zu tragen. Es war in diesem Frühjahr auch sehr kalt, doch unsere Erdlöcher, die wir
zum Schutz vor Kälte und Wind, nur mit leeren Konservendosen ausgehoben hatten, durften nicht tiefer als 20 Zentimeter
sein. Nach jedem Regenguss mussten wir das Wasser ausschöpfen. Nach einem Gewitter, standen wir wiedermal, total
durchnässt in unserem Camp, als unerwartet am Horizont die Sonne hervortrat. Einer unserer Kameraden hatte noch eine
Trompete gerettet und fing, von dem Anblick völlig überwältigt, zu spielen an: "Es geht alles vorüber, es geht alles
vorbei, nach jedem Dezember, folgt wieder ein Mai". Daraufhin hob sich die Stimmung der tiefbetrübten Kriegsgefangenen,
so das Heimatlieder durch das ganze Camp erklangen, obwohl wir in den nassen Kleider herumgehen mussten, bis sie am
Körper trocken wurden.
In französischer Kriegsgefangenschaft
Nach etwa einem Monat, haben uns die Amerikaner, den Franzosen, zum Arbeitseinsatz, ausgeliefert.
Etwa 4 Kilometer von Bad Kreuznach entfernt, stand auf freier Strecke, ein Zug mit offenen Kohlenloren, auf den wir
verladen wurden. In jeden Waggon, wurde pro Person eine Tafel Schokolade und ein Päcken Zwieback rein geworfen, doch
viele Kameraden fanden nur leere Päckchen vor, weil die schon zuvor von der französischen Wachmannschaft geplündert
wurden. Wir haben uns darüber beschwert, doch die haben uns nur ausgelacht. Nachdem wir zunächst bei Mainz über den
Rhein fuhren, endete unsere Fahrt bei Paris in einem großen Zeltlager. Dort wurden wir auf andere Züge verladen, die uns
nach Südfrankreich, in ein Barackenlager, bei Mazarei, brachten.
Auf einer Zwischenstation hat man uns unter einer Pumpe, die Lokomotiven mit Wasser versorgt, abgestellt, den Kran
aufgedreht und uns anschließend ausgelacht, die Kinder Haben uns mit Steinen beworfen. Ein Wachmann kam in unseren
Waggon gekommen, hat unser Gepäck durchsucht, wenn er Tabak oder Zigaretten gefunden hat, nahm er sie mit. Die Kameraden
waren darüber so empört, dass sie vorhatten, ihn nachts unter den Waggon zu werfen. Wir haben sie gebeten dass zu
unterlassen, weil man uns in diesem Falle, alle erschießen würde.
Als wir ins Lager kamen wurden wir zuerst gezählt, dann mussten wir unser Gepäck stehen lassen und beiseite treten.
Wenn man bei der Nachkontrolle noch was in den Taschen fand, wurde das auch entwendet, selbst Esslöffel. Wir wurden
dann in drei Baracken, ohne Toiletten, eingeschlossen. Die Kameraden haben ihre Bedürfnisse in Kochgeschirre erledigt
und durch ein kleines Fenster, das sich fast unter der Decke befand, hinausgeworfen. Andere Fenster ließen sich nicht
öffnen, weil sie mit Stacheldraht zu geflochten waren. Als die Kameraden die Kochgeschirre auskippten, haben die
Wachposten geschossen und die Fenster zertrümmert. Sie waren der Meinung dass wir ausbrechen wollten. Es herrschte eine
große Hitze, in den überfüllten Baracken sind wir fast erstickt. Am nächsten Tag haben wir uns über fehlende Toilettem
beschwert, da haben sie Heringsfässer durch die Hälfte geschnitten und an der Ausgangstür hingestellt. Um bei den
überfüllten Räumen dort hinzukommen, musste man über die Köpfe der Anderen steigen. Viele hatten Fieber und Durchfall
und mussten in die Krankenstube eingeliefert werden, wo sie kurz darauf verstarben.
Besonders Raucher litten sehr an der Unterernährung, bekamen Wasser in den Beinen und waren die Ersten die verstarben.
Nach der Registrierung wurden wir auf andere Baracken verteilt. Die Zivilbevölkerung kam in die Räume und begann uns
auszuplündern. Wer noch gute Schuhe besaß musste sie ausziehen und bekam dafür die kaputten des Plünderers. Eine Woche
lang mussten wir diesen Zustand ertragen, erst als die Kameraden sich beschwerten, wurde am Eingang eine Tafel am
Eingang angebracht, dass die Zivilbevölkerung das Lager nicht betreten darf. Bis auf einige, wenige Ausnahmen wurde
diese Anweisung befolgt.
Als wir im Lager ankamen, war der französische Lagerkommandant, ein ehemaliger Kriegsgefangener, der bei einem Bauern
in Deutschland gearbeitet hatte. Dieser Bauer war jetzt als Kriegsgefangener in seinem Lager. Als er ihn erkannte, hat
er ihn gleich zum Küchendienst eingeteilt und mit dem nächsten Krankentransport nach Hause fahren lassen. Zu Mittag
bekamen wir nur gekochte Haferkörner, da schwamm alles oben, später war man dann auf Gerste umgestiegen. Als viele
daran gestorben waren, weil sie diese „Rohkost”, die nur ein Kuhmagen verträgt, nicht gegessen haben, hat man die
Körner durch eine Schrotmühle laufen lassen. Dann hat man uns Steckrüben gekocht; wir bekamen 250 Gramm Weißbrot,
etwas Quark und ein viertel Liter Magermilch. Später, als wir schon arbeiten mussten, hat man in unserem Essen einen
Kuhkopf mitgekocht, das hat dann bedeutend besser geschmeckt.
Bevor wir morgens zur Arbeit gingen, mussten wir zu Flaggenparade und abends, nach der Rückkehr, haben wir die Flagge
wieder eingeholt. Wir haben einen Kanal gereinigt, dessen Sohle 2 Meter dick mit Schlamm bedeckt war. Zuerst wurde das
Wasser abgelassen, dann haben wir, einer dem andern, den Schlamm mit der Schippe hoch gereicht. Der Letzte hat den
Schlamm, der so zäh war, dass er nicht von der Schippe wollte, oben am Rande abgelegt. Manchmal waren 10 Mann nötig um
den Höhenunterschied zu überwinden. Das Wachpersonal schoss über unsere Köpfe hinweg und rief: „schnell arbeiten”. Bei
der großen Hitze war das ein Ding der Unmöglichkeit, zumal es nichts zu Trinken gab. Auf dem Heimweg haben wir im Walde
Heilkräuter gesammelt, die man in der Küche getrocknet und als Tee zubereitet hat, den wir am nächsten tag zur Arbeit
mitnahmen, um unseren Durst zu stillen.
Unser Aufseher hatte einen Stock, an dem sich noch kurz abgeschnittene Äste befanden. Wer seiner Meinung nach, nicht
ordentlich gearbeitet hat, bekam gleich Schläge auf den Rücken. Die weißen Aufseher wurden irgendwann durch Neger
ersetzt, die uns bedeutend besser behandelt haben. Wenn irgendetwas schief ging, haben sie nichts gesagt, nur gelacht.
In den übrig gebliebenen Wassertümpeln hatten sich noch einige Aale versteckt, die wir zu fangen versuchten, was uns
auch manchmal gelang. Wir mussten ihnen das Genick brechen, damit sie uns nicht entwischen konnten. Wenn die Franzosen
bemerkten das wir Aale hatten, wurden sie uns abgenommen. Gelang es uns aber, sie ins Lager zu bringen, dann haben wir
uns eine köstliche Malzeit zubereitet.
Um sicherzustellen dass niemand geflüchtet ist, wurden wir, wenn wir abends ins Lager zurückkamen, zuerst gezählt.
Diese Zählung wurde mehrmals wiederholt, weil die Wachmannschaften sich immer wieder verzählt haben. Als einer von uns
hin ging, ihnen sagte dass alle da sind, wollten sie es nicht glauben und haben uns vor dem stehen lassen, bis es ihnen
irgendwann einfiel. uns doch das Tor zuöffnen. Einmal, als wir von der Arbeit zurückgekehrt waren, standen wir bis 23
Uhr neben der Flagge, weil uns niemand das Tor geöffnet hat. Als wir dann doch irgendwie ins Lager kamen haben wir
festgestellt, dass das ganze Wachpersonal betrunken war und niemand im Stande uns das Tor zu öffnen.
Eines Tages waren wir wieder abends zur Parole angetreten, als ein älterer Herr mit seinem Hund, am Stacheldraht
entlang, spazieren ging. Weil der Hund, unterm Stacheldraht hindurch, zu uns kam, hat ihn einer geschnappt, ihm das
Genick gebrochen und unter seiner Jacke versteckt. Der Franzose hat nach seinem Hund gerufen und gepfiffen, aber alles
vergebens, der Hund war nicht aufzufinden. Die Kameraden haben ihm gleich das Fell über die Ohren gezogen, das Fleisch
gekocht und das Fell in die Latrine geworfen. Das Fleisch wurde umgehend verspeist.
Als wir am nächsten Tag von der Arbeit zurückkehrten, war im Lager der Teufel los. Wir mussten sofort antreten und
wurden gefragt, wo der Hund geblieben ist, der Gestern Abend, mit seinem Herrchen, am Zaun entlang spazieren ging. Als
sich niemand dazu bekannte, mussten wir weiterhin stehen bleiben, während die Wachmannschaften von Baracke zu Baracke
gingen und alles durchsuchten. In einer Latrine hat man dann das Fell gefunden, was uns ein furchtbares „Donnerwetter”
einbrachte und in den nächsten Tagen, nach der Arbeit, unter dem Kommando eines Oberfeldwebels, eine Stunde
nachexerzieren.
In Südfrankreich regnet es den ganzen Sommer nicht; die Bauern haben da keine Scheunen und das Getreide wir nur in
Schobern aufgestellt und dann umgehend gedroschen. Vom Oktober bis Dezember regnete es fasst jeden Tag in Strömen.
Gesät wird nur im Frühjahr und im Herbst, weil im Sommer alles vertrocknet. Es wird viel Wein angebaut und die
Steckrübe wächst den ganzen Winter. Neben den Weinreben wurde aus Schieferplatten ein Zaun aufgestellt, um dem Wein
einen optimalen Standort zu sichern. Die Bauernwagen hatten nur zwei Räder und waren nur mit einem Pferd bespannt, das
die ganze Balance des Wagens zu halten hatte. Trotzdem haben sie soviel aufgeladen wie wir auf einen Leiterwagen. Viele
Kameraden wurden den Bauern zur Arbeit ausgeliehen. Wenn ein Bauer einen Arbeiter gebraucht hat und es wurde gefragt,
wer sich in der Landwirtschaft auskennt, da haben sich alle gemeldet. Der Bauer konnte sich dann aussuchen, wen er
mitnehmen wollte.
Wenn wir durch die Stadt zur Arbeit gingen, haben verschiedene Leute Fallobst in die Abfalleimer gelegt. Wenn das von
den Kameraden bemerkt wurde, schwenkten viele aus der Reihe, um sich etwas mit zunehmen, was von den Wachmannschaften
nicht gern gesehen wurde. Viele Kriegsgefangene hatten keine Schuhe mehr, sie haben die Füße nur mit Lumpen bewickelt.
Eines Tages kamen Kameraden aus Norwegen, die nach Deutschland entlassen werden sollten. Mann hat sie jedoch ins Lager
gesteckt und zur Arbeit eingeteilt. In Norwegen hatten sie Kleider und Stoffe eingekauft, hatten volle Seesäcke und
sogar Karren auf 2 Rädern, weil sie ja in die Heimat entlassen werden sollten. Als wir morgens zur Arbeit rausgeführt
wurden standen sie schon vor dem Lager. Wir haben ihnen zugerufen, dass sie uns etwas abgeben sollen, weil ihnen ja
sowieso alles abgenommen wird, aber sie haben uns nur ausgelacht. Als sie ins Lager Kamen mussten sie ihr Gepäck
ablegen, wurden dann wo anders hingeführt und haben es danach nie wieder gesehen.
Durch die vielen Läuse, Flöhe und Wanzen die wie im Lager hatten, kam es bei verschieden Kameraden, an den
Einstichstellen, zu eiternden Entzündungen. Um dem vorzubeugen hat man uns mit einem Pulver, das in Frankreich
hergestellt wurde, aber bei den Parasiten keine Wirkung zeigte, eingesprüht. Erst bei der Anwendung eines Mittels
amerikanischer Herkunft, war alles über Nacht verschwunden.
Der Sonntag war arbeitsfrei. Dann kam ein katholischer, französischer Pfarrer, eskortiert von 3 Mann, mit
aufgepflanztem Seitengewehr ins Lager und hat Gottesdienst gehalten. Einen evangelischen Pfarrer gab es nicht, nur
einen Baptisten Prediger. Der wurde würdevoll eingekleidet, bekam ein großes Kreuz und hat jeden Sonntag in einer
extra dafür hergerichteten Baracke Gottesdienst gehalten. Wer Theologie studiert hatte und sich meldete, wurde zu
einem Seminar geschickt und konnte sein Studium fortsetzen. Glasbläser durften das Lager auch verlassen und ihrem
erlernten Beruf wieder arbeiten.
Wer sich freiwillig, für 5 Jahre, zum Dienst in der Fremdenlegion verpflichtet hat, das waren etliche unter uns, wurde
neu eingekleidet, bekam gutes Essen und Rauchwaren soviel er wollte. Nach einem Jahr wurden, nach und nach, die
Kranken und Körperbehinderten in die Sowjetische Besatzungszone entlassen. Eine Entlassung von Kriegsgefangenen, die
in den Westzonen oder jenseits von Oder und Neise zu Hause waren, war nicht vorgesehen. Die Österreicher wurden alle,
unabhängig von ihrem Gesundheitszustand entlassen.
Ich habe Briefe nach Hause geschrieben, aber die kamen nur bis Allenstein und wurden wieder zurück geschickt. Als eine
Kommission des Roten Kreuzes aus der Schweiz unser Lager besichtigt hat, haben wir uns beschwert, das wir als
Sanitätsdienstgrade, zur Arbeit gehen müssen. Daraufhin erging ein Befehl: Wer einen vom Roten Kreuz, ausgestellten
Ausweis besitzt, gehört einem internationalen Verband an und braucht nicht zu Arbeit gehen. Aus unserem Lager hatten
sich 20 Mann gemeldet, die daraufhin Freigang, in Begleitung von zwei französischen Wachsoldaten erhielten. Als wir
gefragt wurden wo wir hin wollen, entschlossen wir uns, einen Soldatenfriedhof, auf dem unsere verstorbenen Kameraden
beerdigt waren, zu besuchen.
Da der Untergrund in dieser Gegend aus Felsen bestand, wurden die Gräben, in denen die Toten in selbst gezimmerten
Kisten nebeneinander gestellt wurden, mit Hilfe von Dynamit ausgehoben. Ein Leichenwagen, mit einem Pferd bespannt,
das mit einer schwarzen Decke abgedeckt war, wurde von einem Kutscher in angemessener Kleidung, gefahren. Der Wagen
konnte gleichzeitig 4 Kisten transportieren. Wenn wir von der Arbeit kommend, dem Leichenwagen begegneten, wurde
gehalten und mit einer Schweigeminute der Toten gedacht, bis der Wagen vorbei war. Die Zivilbevölkerung verharrte auch
im Schweigen, mit abgenommener Kopfbedeckung.
Ein Kamerad, der in Krottorf, Kreis Oschersleben, bei Magdeburg, zuhause war, sagte bei seiner Entlassung zu mir:
Sollte ich das Glück haben, meine Entlassungspapiere zu erhalten ohne eine Bleibe vorzuweisen, dann soll ich Krottorf
als Heimatadresse angeben. Auf der Krankenstube habe ich angegeben, dass sich noch ein Schrapnellsplitter, aus dem
Ersten Weltkrieg, in meiner Kreuzbeingegend befindet, er zwar verkapselt ist, aber immer noch Beschwerden verursacht.
Daraufhin wurde ich zur Entlassung vornotiert. Als bekannt wurde das ein Rückkehrertransport in die sowjetische
Besatzungszone zusammengestellt wird, habe ich mich sofort gemeldet und wurde für ein Entlassungslager in Angoleme
vorgesehen. War das eine Freude, als uns mitgeteilt wurde, wann der Rücktransport stattfindet.
In unserem Lager waren noch 2 Kameraden aus dem Kreis Ortelsburg: Ein Gustav Lumma aus Leynau und ein Alfred Moritz
aus Groß Schöndamerau. Sie mussten noch zurückbleiben und haben mir den Auftrag erteil, die Angehörigen in der Heimat
zu grüßen und ihnen die Anschrift mitzuteilen. Als wir im Entlassungslager ankamen, fragte man uns nach unserer
Heimatanschrift. Dann wurden die Entlassungspapiere angefertigt. Es wurde uns auch ein Barscheck, für die in Frankreich
geleistete Arbeit ausgehändigt, den wir bei jeder Kasse in Deutschland einlösen könnten. Ich habe ihn bis zum heutigen
Tage nicht einlösen können, obwohl ich irgendwann in der Zeitung gelesen habe, das Verrechnungschecks die den aus
französischer Kriegsgefangenschaft Entlassenen, ausgehändigt wurden, einzulösen sind.
Wir kamen zuerst nach Saar Elbe, dann in die Nähe der Zonengrenze zu Thüringen. Hier mussten wir 2 Tage warten, weil
aus der sowjetischen Besatzungszone keine Eisenbahnwagen bereitgestellt wurden. Angesichts dessen, das der Russe beim
letzten Transport die aus Frankreich kommenden Wagen kassiert und nicht mehr herausgeben wollte, bestand der Franzose
jetzt darauf, seine Wagen sofort wieder mitzunehmen. Als der sehnsüchtig erwartete Zug endlich eintraf, durften wir
umsteigen und kamen, immer noch hinter Stacheldraht, nach Erfurt. Von dort weiter ins Quarantänelager nach Prätsch an
der Elbe.
Unter Androhung von Strafe war es verboten das Lager zu verlassen, doch der Hunger zwang uns dazu, in den umliegenden
Dörfern um Lebensmittel zu betteln. Man drohte uns damit, dass Zuwiderhandlungen, mit einer 14-tägigen Verlängerung der
Quarantäne geahndet werden. Der Roggen war schon reif und wir haben, auf den umliegenden Feldern, die Ähren abgerissen,
das Korn, zwischen 2 Steinen zu Mehl zerrieben, um daraus eine Suppe zu kochen, denn von dem was unsere Lagerküche uns
bieten konnte, war es nicht möglich zu überleben. Als der Eigentümer bemerkte wer seine Roggenähren entwendet hat, kam
er ins Lager, gerade zu dem Zeitpunkt als wir mit dem Mahlen beschäftigt waren. Der Lagerkommandant, bei dem er sich
beschwerte, drohte uns zu bestrafen, wenn wir unsere „Rauzüge” nicht unmittelbar einstellen würden. Wir sagten ihm er
solle uns heimfahren lassen, da wir doch lange genug hinter Stacheldraht gesessen hätten.
Endlich wieder in Freiheit
14 Tage nach unserer Ankunft wurden uns Entlassungspapiere ausgehändigt, sowie auch Fahrscheine
zum den, von uns angegeben Heimatorten. So kam ich nach Krottof, Kreis Oschersleben, zu meinem ehemaligen
Kriegskameraden, bei dem ich einen Tag geblieben bin. Er hatte mir schon eine Stelle bei einem Bauern besorgt, der 70
Jahre alt und kinderlos war. Zum Hof, den er mit seiner Ehefrau bewirtschaftet hat, gehörten 36 Morgen Land, 2 Ochsen
und 3 Kühe. Das Ackerland bestand aus 17 Parzellen und sicherte mir einen Arbeitsplatz.
Jetzt, da ich ein Dach überm Kopf und genug zu essen hatte, fing ich an nach dem Verbleib meiner Familie zu forschen.
Bei meinem letzten Heimaturlaub hatte ich mit meiner Frau verabredet; falls wir uns in den Kriegswirren verlieren
sollten, unsere Kontaktadresse, die meiner Quartiersleute in Burscheid, Kreis Opladen, sein sollte. Ich habe zuerst
nach Rohmanen geschrieben, aber leider keine Antwort erhalten. Dann habe ich nach Burscheid geschrieben, und siehe, -
bei denen lag schon eine Anfrage meiner Frau vor, die nach mir gefragt, und ihre jetzige Anschrift hinterlassen hatte.
Ich habe dem Bauern erzählt dass meine Frau sich zurzeit, auf einem Gut, in Alt Steinhorst, im Kreis Rostock, befindet.
Er war sofort bereit uns ein Zimmer zur Verfügung zu stellen, wenn ich meine Frau nach Krottorf rüberholen wollte. Das
habe ich Ihr mitgeteilt und sie war sofort bereit ihren Wohnsitz nach Krottorf zu verlegen, denn sie wohnte dort in
einem kleinen Stübchen unterm Dach.
Im Herbst, als die Feldarbeit so ziemlich erledigt war, bin ich nach Alt Steinhorst gefahren, um meine Frau und meinen
Sohn Kurt, sowie meinen Sohn Manfred, den ich noch nicht kannte, weil er erst nach der Flucht, am 31. Januar, in Groß
Lüssewitz, geboren wurde, nach Krottorf zu holen. Meine Frau hatte schon Holz für den Winter besorgt und vom Gut, auf
dem sie im Sommer gearbeitet hatte, Mehl und Kartoffeln bekommen. Wir haben das Mehl und andere Habseligkeiten in
Kisten verpackt. Das Holz haben wir einem Bauern gegeben, der uns und unser Gepäck, mit seinem Pferdewagen, zum 14
Kilometer entfernten Bahnhof, nach Ribnitz gebracht hat. Wir sind auch gut in Krottorf angekommen, aber als wir am
nächsten Tag, unsere Kisten vom Bahnhof abholen wollten, haben wir zwar die Kisten vorgefunden, doch der gesamte Inhalt
wurde während der Bahnfahrt entwendet. Die Bahnstation in Krottorf hat die Vorkommnisse zur Kenntnis genommen und
protokolliert, aber unsere Sachen haben wir nie wieder gesehen und mussten wieder bei Null anfangen.
Im Winter musste ich auf der Genossenschaft, unentgeltlich, für die Russen Weizen einsacken. Ich hatte versucht eine
Arbeit als Zimmermann zu bekommen, doch auf dem Arbeitsamt wurde mir gesagt, ich bin Ladwirt und muss auf der
Landwirtschaft arbeiten. Da in den ersten Nachkriegsjahren, auch in der sowjetisch besetzten Zone Arbeitsplätze knapp
waren, mussten auch solche, die einen anderen Beruf erlernt hatten, jede zumutbare Arbeit annehmen. Aus der Heimat
erhielt ich einen Brief, von meiner dort noch lebenden Mutter. Sie schrieb das sie mich noch einmal sehen wollte und
ich sollte doch wieder zurück kommen; Unser Hof wäre nicht von Polen besetzt und sie wäre ganz alleine, weil der Vater
nach dem Durchzug der Front von den Russen erschlagen wurde. Daraufhin habe ich dem polnischen Konsulat in Magdeburg
mitgeteilt, dass ich in Rohmanen eine Landwirtschaft besitze, und um eine Einreisegenehmigung gebeten.
Nach 2 Monaten erhielt ich eine Postkarte, mit der Mitteilung, ich sollte mich persönlich beim Konsulat vorstellen.
Nach Aufnahme meiner Personalien, wurde mir gesagt, das ich benachrichtigt werde wenn mein Antrag genehmigt wird. Ende
Juli 1947 erhielten wir die Einreisegenehmigung nach Ostpreußen, das jetzt unter polnischer Verwaltung stand. Wir
mussten zuerst zum polnischen Konsulat in Berlin-Lichterfelde, wo wir umgeben von einer Trümmerlandschaft, gewartet
haben, bis alle Untersuchungen und Formalitäten erledigt waren.
“ Wieder zurück in Ostpreußen.”
Der schwere Wiederaufbau nach dem Kriege
Dann fuhren wir über Frankfurt/Oder, Posen, Thorn, Allenstein, nach Ortelsburg, wo wir am 2. August 1947 ankamen. Mit
einem zweirädrigen Karren, den ich mir von einem noch in Ortelsburg lebenden Bekanten ausgeliehen hatte und meinem
Sohn Manfred im Kinderwagen fuhren wir nach Rohmanen. Meine Mutter war inzwischen verstorben und auf dem Hof war nur
meine, inzwischen aus Russischer Gefangenschaft wiedergekehrte Schwester, Frieda Pelkowski.

Es war alles ausgeplündert; kein Vieh, keine Maschinen und der ganze Hof mit kniehohem Graß überwachsen. Nur schmale
Trampelpfade, vom Haus zum Holzschuppen und zum Klo, durchkreuzten das satte Grün. Ich habe das Gras auf dem Hof mit
einer Sense, die ich noch gefunden habe, abgemäht, damit der Hof nicht so verwahrlost aussah. Am nächsten Tag habe ich
mich bei der Polizei in Ortelsburg angemeldet, wo ich auch ein Startgeld von 100 Zloty erhielt und Gepäckstücke, die
ich in Krottorf aufgegeben, am Bahnhof abgeholt. Es hat mich sehr gewundert das, das Gepäck überhaupt angekommen ist.
Da man von der Landwirtschaft nicht Leben konnte, habe ich mich in den nächsten Tagen, bei der jetzt polnischen Bahn,
um Arbeit beworben und wurde auch angenommen. Wenn wir unseren Monatslohn bekamen, saß immer einer am Tisch, der von
uns 100 Zloty für den Wiederaufbau von Warschau verlangte. Wenn ich dran war, riefen die Anderen, ich hätte Warschau
zerstört und müsste deshalb 200 Zloty abgeben. Nach 3 Jahren kam eine Verfügung, die besagte, dass wer länger als 1
Jahr bei der Bahn beschäftigt ist, angestellt werden muss. Um diese Bestimmung zu umgehen hat man mich entlassen und
eine Woche später wieder eingestellt.
Als ich vor Ablauf des nächsten Jahres, aus dem gleichen Grunde wieder entlassen wurde, habe ich mich bei der
Stadtverwaltung in Ortelsburg(jetzt Szczytno)beworben, wo ich zuerst im Gaswerk als Heizer und später auf Baustellen
als Zimmermann gearbeitet habe. Wir haben durch den Krieg beschädigte Häuser repariert, in den ehemals touristischen
Zentren einige Ausbesserungen an den Einrichtungen durchgeführt, eine Ziegelei wieder in Betrieb gesetzt und andere
anfallende Arbeiten verrichtet. Im Dach des Rathausturmes war während der Kämpfe eine Granate eingeschlagen, die, die
Dachlatten und die Verschalung zerstört hatte. Da wir, unter schwersten Bedingungen, den Schaden repariert haben,
wurde uns eine Höhenzulage versprochen, die wir aber nicht bekommen haben.
Aus Verärgerung darüber habe ich bei der Stadtverwaltung gekündigt und bei einer Wiederaufbaufirma unter der Leitung
von Bauingenieur Laskowski wieder angefangen, wo ich bis 1954, als Zimmermann beschäftigt war. Ab da habe ich mich
nur um meinen Hof gekümmert, der wegen meiner Arbeitsstellen, gezwungenermaßen, sehr vernachlässigt wurde. Als wir
1947 zurückkamen, brachten wir unseren Sohn Manfred noch im Kinderwagen. Den hat meine Frau zum Markt gebracht,
verkauft, und dafür eine Ziege erworben, die dank guter Pflege, uns täglich mit 4 Liter Milch versorgte. Das war der
erste Baustein zum Wiederaufbau, unserer durch den Krieg zerstörten, und danach ausgeplünderten Landwirtschaft.
Während meiner Arbeit bei der Bahn haben wir uns eine Kuh gekauft, die nach einem halben Jahr, wegen nicht bezahlter
Grundsteuer, vom Gerichtsvollzieher gepfändet wurde. Man hat uns die Kuh weggenommen und bei einem Arbeiter, der in
der Ernst-Mey-Straße in Ortelsburg wohnte und sie wegen nicht vorhandener Futtermittel, nur mit Kartoffelkraut
gefüttert hat, untergestellt. Als ich bei der Bahn meinen Monatslohn bekommen habe, bin ich zur Gmina gegangen, habe
eine Rate angezahlt und durfte dann die Kuh wieder mit nach Hause nehmen. Durch die schlechte Ernährung war die Kuh
stark abgemagert und lieferte nur die Hälfte der ursprünglichen Milchleistung.
Später habe ich ein Pferd auf Abzahlung bekommen, das 140.000 alte Zloty gekostet hat. Die Stute war schwach und unser
Feld sehr hügelig, so dass man nur bergab pflügen konnte, was sehr beschwerlich war, bergauf ging es immer im Leerlauf.
Später habe ich die schweren Böden mit dem Traktor umpflügen, und in den letzten Jahren auch mit dem Binder mähen
lassen. Von der Stute habe ich 2 schöne Fohlen gezogen; ein davon habe ich bei der Ausreise in die Bundesrepublik
mitgebracht und bei der Viehverwertungs-Genossenschaft in Göttingen verkauft. In den ersten Nachkriegsjahren als noch
wenig Land bestellt wurde, breiteten sich auf den nicht beackerten Flächen, Wildkräuter aus. Disteln und andere
Schnellwachsende, erreichten manchmal eine Höhe von 2 Meter, besonders auf den schweren Böden.
Es hat viel Schweiß gekostet ehe man den Acker soweit hatte, das er auch befriedigende Erträge abwarf. Die
Währungsreform von 1950, hat unser weiniges Geld das wir schon gespart hatten, wieder vernichtet. Ich hatte 2 Pferde,
1 Fohlen, 2 Kühe und Schweine, als ich wieder aufgefordert wurde nicht bezahlte Grundsteuern nachzuzahlen. Als ich
nicht bezahlen konnte, hat der Vollziehungsbeamte, ein Fohlen, eine Kuh und ein Schwein gepfändet. Es gelang mir jedoch
nach längeren Verhandlungen, ohne größere Verluste, alles zu regeln. Später kam eine Verfügung, die besagte; wenn
jemand auf seinem Hof nur eine Kuh und ein Pferd hatte, durften sie nicht gepfändet werden. Einige haben ihr Inventar
dieser Verfügung angepasst und dadurch die Zahlung von Grundsteuer umgangen.

Wer seine Steuern pünktlich bezahlt und sein Kontingent an landwirtschaftlichen Produkten fristgerecht abgeliefert hat,
der konnte seine, darüber hinaus erwirtschafteten Produkte zu marktgerechten Preisen verkaufen. Für eine hochtragende
Sterke, mindestens 400 kg schwer, die auf ein staatliches Gut verkauft wurde, konnte man bis zu 12000 Zloty bekommen.
Unsere Böden waren kalkarm, doch durch den Einsatz von Kalk und Kunstdünger konnte man den Ertrag erheblich steigern.
Kalk und Kunstdünger konnte man bei der Genossenschaft(GS) bestellen, der dann auch direkt auf den Hof geliefert wurde.
Kalk wurde geliefert und gleich auf dem Feld ausgestreut. In den 1960ger Jahren waren alle Ackerflächen der Rohmaner
Felder bestellt.
Die nach dem Krieg zurückgebliebenen deutschen Bauernfamilien, aber auch die Polen, die während des Krieges beim Bauern
in Deutschland gearbeitet haben, versuchten mit teils bescheidenen, oder auch zusammen gesuchten, landwirtschaftlichen
Geräten, die bäuerlichen Betriebe aufrecht zu erhalten. Nach den schweren Anfängen in den ersten Nachkriegsjahren
erzielten sie schließlich einen beachtlichen Erfolg, der sich in wogenden Kornfeldern, sowie in grünen Wiesen auf
denen gut genährtes Vieh weidete, widerspiegelte.
Ein schwerer Einschnitt in meinem Leben.
Am 11. Mai 1956 verstarb nach langer schwerer Krankheit, meine liebe Ehefrau Marta Rattay,
geborene Brosch. Ein Jahr zuvor war schon mein Schwiegervater Gottlib Brosch verstorben. Die schweren Bedingungen
unter denen wir nach Kriegende leben mussten, haben ihrer bereits angegriffenen Gesundheit sehr zugesetzt. Sie
verstarb mit 44 Jahren und hinterließ in unserer Familie eine große Lücke, die nicht mehr zu Überbrücken war. Wir
haben sie unter großer Anteilnahme der noch verbliebenen deutschen Bevölkerung zu Grabe getragen und auf dem Rohmaner
Friedhof beigesetzt. Die Arbeit die sie sonst verrichtet hatte fiel jetzt auf mich und meine Söhne zurück. Meine
Schwester Frieda Pelkowski half auch wo sie nur konnte. Wir waren auf die Unterstützung durch Nachbarn und Freunde
angewiesen, die uns immer wenn es nötig war, tatkräftig unterstützt haben. Im laufe der Zeit haben wir wieder zum
Alltag zurück gefunden, haben sie noch etliche Jahre auf dem Friedhof besuchen können, bis wir, bedingt durch unsere
Ausreise uns endgültig von ihr trennen mussten.
Der endgültige Abschied von Ostpreußen
Ab 1956 begannen, durch die Vermittlung des Deutschen Roten Kreuzes, die ersten Ausreisen in die
Bundesrepublik Deutschland. Zuerst waren es Kinder die zu ihren Eltern ausreisen durften, Familien deren Väter aus der
Kriegsgefangenschaft in den Westen Deutschlands entlassen wurden und andere durch den Krieg getrennte
Familienangehörige. Ab 1960 erhöhte sich die Zahl der Ausreisewilligen aus dem polnisch besetzten Ostpreußen. Es setzte
sich die Überzeugung durch, dass unsere Angestammte Heimat, uns für die Zukunft keine Perspektive mehr bieten konnte.
Meistens wurden die Anträge, die wir an die Passabteilung in Allenstein stellen mussten, um einen Ausreisepass zu
bekommen, negativ beschieden. Nach mehrmaligen Versuchen gelang es dann doch, diese begehrte Ausreiseberechtigung in
Empfang zu nehmen. Die Enttäuschung der Zurückgebliebenen war groß, wenn wieder mal Verwandte oder Nachbarn, den Weg
in Richtung Bahnhof einschlugen.
Um einen Reisepass zu beantragen, musste man zuerst eine Einladung von Verwandten aus der Bundesrepublik vorlegen, in
der, diese sich verpflichten mussten, für Unterkunft und Verpflegung der Eingeladenen zu sorgen. Diese Einladung
musste durch ein Amt in der Bundesrepublik beglaubigt werden. Außerdem mussten die Kosten für die Bahnfahrt, ab
polnischer Grenze, bis zum Zielort, beim polnischen Reisebüro ORBIS, in Warschau, in DM eingezahlt werden.
Unseren ersten Ausreiseantrag haben wir 1964, bei der Kommandantur der polnischen Miliz in Allenstein eingereicht, der
nach einer gewissen Zeitspanne, ohne eine uns verständliche Begründung zu nennen, abgelehnt wurde. Gegen diese
Ablehnung wurde ein Widerspruch zugelassen, den wir sofort einreichten. Nach einer weiteren Zeitspanne erhielten wir
wieder eine Ablehnung, gegen die kein Widerspruch mehr zulässig war. Wer seine Ausreiseabsicht nicht aufgeben wollte,
musste einen neuen Antrag stellen. Es gab Familien die schon 10 Mal einen Ausreiseantrag gestellt hatten und immer
wieder abgewiesen wurden. Da meine Söhne, nicht die Absicht hatten in Rohmanen zu bleiben und ich nach 2 Weltkriegen,
an denen ich teilgenommen, die schwere Arbeit auf der Landwirtschaft, nicht aus eigener Kraft schaffen würde, haben wir
1966 wieder einen Antrag gestellt, der prompt abgelehnt wurde. Der Widerspruch auf diese Ablehnung wurde auch negativ
beantwortet, so dass wir 1968 wieder einen Antrag eingereicht haben.
Weil das Passamt in Allenstein lange nichts von sich hören ließ, hegten wir schon die Hoffnung das es jetzt klappen
würde und waren sehr enttäuscht als wieder eine Absage kam. In der Zwischenzeit sind viele Nachbarn und Bekannte aus
Rohmanen, sowie aus der näheren Umgebung, ausgereist und das Häuflein der noch verbliebenen Deutschen, wurde immer
kleiner. Die Motivation, die uns in früheren Jahren, über so manche schwierige Lage hinweg geholfen hat, ist einer
hoffnungslosen Resignation gewichen. Man war davon überzeugt, dass unser Leben, in unser Angestammten Heimat, keine
Zukunftsperspektive mehr haben konnte und wenn wir keine Ausreisegenehmigung bekommen, wir eines Tages die letzten
Deutschen in der ganzen Umgebung sein werden.
Die Ausreise-Heimat ade
Wir hatten die Hoffnung schon aufgegeben, als am 30. April 1969, der Briefträger unseren Hof
betrat und mir einen Brief überreichte, in dem uns das Passamt in Allenstein mitteilte, dass unsere Ausreise in die
Bundesrepublik Deutschland, genehmigt worden ist. Wir müssten, nach Aushändigung der Reisepapiere, den Geltungsbereich
der Volksrepublik Polen, innerhalb von 3 Monaten verlassen. Wir waren zuerst geschockt, über den Hinweis, das wir
unsere Heimat in 3 Monaten verlassen müssen, aber dann stellte sich die Zukunftsperspektive wieder ein und wir gingen,
wie von einem schweren Ballast befreit und gut gelaunt unser weiteren Tätigkeit nach.
Als der Briefträger unseren Hof betrat, waren ich und mein Sohn Kurt gerade dabei eine Fuhre Mist zu laden. Wir hatten
den Wagen gerade halb geladen und haben nach der frohen Kunde nicht mehr weiter gemacht, sondern die Pferde vorgespannt
und den Mist aufs Feld gefahren, damit wir den Wagen für alle Fälle frei hatten. Das war die letzte Tätigkeit für
unsere Landwirtschaft in Ostpreußen.
Die Nachricht von unserer Ausreise verbreitete sich, ohne dass wir darüber gesprochen haben, wie ein Lauffeuer.
Alsbald kamen Leute aus dem Dorf, die sich für das Vieh und für diverse Landwirtschaftliche Geräte interessierten.
Etliche wollten bestimmte Sachen sofort kaufen, andere haben nur zurücklegen lassen und wollten später kommen und
bezahlen, haben es aber dann doch nicht genommen.

Wenn man eine Landwirtschaft hatte, konnte man 2 Pferde, 2 Rinder, 3 Schweine, 5 Schafe und 10 Hühner, in einem
geschlossenen Viehwaggon, in die Bundesrepublik mitnehmen. Jeden Tag war man unterwegs, von einer Behörde zur Andern.
Die Aushändigung der Reisepapiere erfolgte nur nach Vorlage bestimmter Bescheinigungen: Es mussten alle Steuern bezahlt
sein, das Kontingent landwirtschaftlicher Erzeugnisse musste abgeliefert sein, je eine Bescheinigung vom Katasteramt
und vom Notar musste vorgelegt werden, das man dem polnischen Staat das Grundstück abgetreten hat. Die Gebühren für
die notarielle Beglaubigung mussten wir selbst bezahlen. Wenn man alle Bescheinigungen beisammen hatte, bekam man bei
der Kreisverwaltung eine Gesamtbescheinigung. Mit dieser Bescheinigung konnte man nach Allenstein, zur
Polizeikommandantur fahren, wo man nach dem schriftlichen Verzicht auf die polnische Staatsangehörigkeit, einen
Reisepass ausgehändigt bekam, der den Inhaber zum Grenzübertritt berechtigte, aber nicht zur Wiedereinreise.
Wir haben 2 Pferde, eine Sterke, einen Ochsen, 5 Schafe, 2 Schweine und 10 Hühner mitgenommen. Über die Schutzimpfung
der Rinder musste man eine, vom Kreistierarzt beglaubigte Bescheinigung vorweisen. Ich habe 5 Schafsböcke gekauft, die
ich in der Zwischenzeit, hinter der Scheune, zum Weiden angekettet hatte. Einer von denen hat sich losgerissen und
seinen Nachbarn getötet. Das Fleisch konnten wir noch verkaufen, mussten aber dafür einen anderen Schafsbock kaufen.
Innerhalb von 3 Monaten mussten wir alles regeln und zwei Tage vor der Abfahrt einen Eisenbahnwagen, bei der
Eisenbahndirektion in Allenstein bestellen. Reservierungen bei den polnischen Behörden waren meist immer mit
Schmiergeld verbunden, weil man sonst nie sicher sein konnte dass diese Vereinbarungen auch eingehalten werden. Schon
2 Wochen vor unserer Abfahrt, gab es in Ortelsburg keine alkoholischen Getränke zu kaufen. Meine Söhne mussten mit dem
Motorrad die umliegenden Dörfer abfahren, damit wir für die Reise einen Vorrat anlegen konnten; denn Wodka war zu der
Zeit, in Polen, wie eine zweite Währung.
Am 25. Juli haben wir zusammen, mit meinem Neffen Siegfried Brosch, unseren sonstigen Hausrat, der in Kisten verpackt
war, in einen Eisenbahnwagen, auf dem Allensteiner Bahnhof verladen. Alles musste zuerst durch den Zoll, wo die
Federbetten gewogen wurden und über das erlaubte hinausgehende Kissen, verzollt werden mussten. Dasselbe galt auch für
Fleisch und Räucherwaren.
Am 26. Juli, unserem Verladetag, kam der Eisenbahnwagen aus Allenstein, erst um 11 Uhr auf dem Ortelsburger Bahnhof an.
Die Rinder hatten wir zu Fuß, zum Bahnhof gebracht; Schweine, Schafe und Hühner auf dem Pferdewagen. Im Eisenbahnwagen
mussten, mit Hilfe von Brettern und Bohlen, Boxen für die verschiedenen Tiere erstellt werden. Jedes Pferd und jedes
Rind in eine Bucht. Die Schafe zwischen die Pferde, die Schweine zwischen die Rinder und die Hühner in einem Käfig,
unter der Decke über den Rindern. Die Hühner hatten unterwegs Eier gelegt, somit hatten wir jeden Tag frische
Verpflegung. Bei der Fahrt im Viehwagen, begleitete mich mein Sohn Manfred. Als die Lokomotive nahte, um den Wagen
abzuholen, wurden noch schnell die restlichen Sachen hinein geworfen und so mache Abschiedsträne rollte dann die Wange
hinab.
Unsere Nachbarn, Deutsche und Polen, halfen uns beim Verladen des lebendigen Inventars. Jetzt erinnerte ich mich
plötzlich, an die oft auch schönen, Ereignisse der letzten 22 Jahre. Einer Zeit, in der das Zusammenleben von
Deutschen und Polen, von Jahr zu Jahr, besser wurde. Man half sich beim einbringen der Getreideernte, beim Dreschen
des Getreides, bei der Kartoffelernte und bei anderen Arbeiten, wo viele Menschen zupacken mussten. Es war eine
Dorfgemeinschaft, in schweren Zeiten geboren; jeder half jedem wenn Hilfe nötig war. Es wurde mir plötzlich bewusst,
das jetzt ein Lebensabschnitt zu Ende ging, zu dem ich nicht mehr zurückkehren konnte. Unsere Existenzgrundlage war
jetzt ein Eisenbahnwagen auf einem Schienenstrang, dessen Ende irgendwo in weiter Ferne lag. Obwohl, von langer Hand
vorbereitet, war dieser Moment voller Wehmut.
Doch als der Zug sich plötzlich, in Bewegung setzte, war ich sofort wieder in der Gegenwart. Menschen, mit denen man
Jahrzehnte lang, in gutem Einvernehmen zusammen gelebt hat, blieben plötzlich am Bahnsteig zurück und die Entfernung
zwischen ihnen und mir vergrößerte sich mit jeder Sekunde, bis sie letztendlich aus meinem Blickfeld verschwanden.
Es war ein heißer Julitag, als wir unsere Reise gen Westen antraten. Für die Schweine, die besonders unter der Hitze
zu leiden hatten, haben wir 10 Flaschen Essig mitgenommen und sie von Zeit zu Zeit besprenkelt, damit sie besser atmen
konnten. Für die anderen Tiere war reichlich Heu und Hafer vorhanden. Eine großes Fas und zwei Milchkannen waren mit
Wasser gefüllt, die wir auf den an der Strecke liegenden Bahnstationen, bei Bedarf wieder nachgefüllt haben.
Da der Kreistierarzt nicht in seinem Büro war, konnten wir die Impfbescheinigung für das Vieh, nicht rechtzeitig
herbeischaffen. Der Zug setzte sich in Bewegung und die Bescheinigung war immer noch nicht da. Als die Bescheinigung
dann eingetroffen, wir aber schon unterwegs waren, ist mein Sohn Kurt mit dem Motorrad hinterher gefahren und hat uns
in Passenheim, wo der Zug noch andere Wagen angehängt bekam, die Impfbescheinigung übergeben. Wir waren sehr froh das
er es noch geschafft hat, denn in solch einer Situation fühlt man sich sicherer wenn man alle Bescheinigungen bei sich
hat. Auf der Rückfahrt, mit dem Motorrad hatte er noch eine Panne, musste das Motorrad stehen lassen und per Anhalter
nach Hause fahren. Am nächsten Tag kam er mit Siegfried Deptolla, der das Motorrad wieder flott machte und brachte es
wieder nach Rohmanen zurück.
Die Fahrt mit dem Viehwagen, gen Westen
Von Ortelsburg bis Allenstein(45 km) hat unser Zug 4 Stunden gebraucht, weil auf jedem Bahnhof
gehalten wurde, um neue Wagen anzuhängen. Nachdem wir in Allenstein angekommen waren, kam ein Rangierer und fragte
nach unserem Ziel. Als wir ihm mitteilten, das wir in die Bundesrepublik Deutschland wollen, sagte er nur: „In 10
Minuten fährt ein Zug los. Wenn ich von euch 500 Zloty und einen Liter Wodka bekomme, werde euch sofort anhängen,
andernfalls kommt ihr auf ein Nebengleis und müsst dann auf den nächsten Zug warten. Es blieb uns nichts anderes übrig
als seiner Forderung nachzukommen, denn über derartige Erpressungen hat man bereits von Anderen, die vor uns ausgereist
sind, gehört. Wir wurden auch sofort angehängt und fuhren dann die ganze Nacht, an Osterode, und Thorn vorbei bis
Gnesen. Dort wurde wieder rangiert.
Von einer Anhöhe wurden die einzelnen Wagen auf verschiedene Gleise verteilt und zu neuen Zügen zusammengestellt. Der
Aufprall der ungebremsten Wagen erzeugte eine derartige Erschütterung, dass manche Bretter an den Boxen geborsten waren.
Von Gnesen ging es dann in einem Zuge durch bis zur Grenzstation Reppen(Rzepin). Dort mussten wir zum Zollamt, wo
unsere Ausfuhrpapiere durch die Zollbeamten, und durch einen Tierarzt geprüft wurden. Bis Reppen(Rzepin) haben wir für
den Eisenbahnwagen 900 Zloty bezahlt; hier mussten wir noch einmal 650 Zloty bezahlen. Bei der Wagenkontrolle erklärte
uns ein Bahnbeamter das unser Wagen, sich nicht für den internationalen Transport eignet und wir deshalb den Inhalt in
einen Anderen umladen müssen, der irgendwann, auf dem Nebengleis bereitgestellt wird. Nach langer Verhandlung, sowie
einer Zulage von 500 Zloty und einem Liter Wodka haben wir ihn davon überzeugt, das der Wagen sich doch für die
Weiterfahrt eignet.
In der Nacht war Schichtwechsel, der unseren Wagen wieder abgehängt hat, weil er angeblich von der Reichsbahn der DDR,
wegen technischer Mängel nicht weiterbefördert würde. Wir mussten unsere Verhandlung vom Vorabend wiederholen, die mit
der Zusage endete, dass wir am frühen Morgen, über die Grenze auf DDR Gebiet, gebracht werden. Um 5 Uhr morgens kam
eine Lokomotive, die uns den letzten Abschnitt bis über die Grenze bringen sollte. Als der Zug hat noch einmal anhielt,
kamen polnische Grenzbeamte und Soldaten in den Wagen. Sie durchsuchten ihn und fragten, ob wir noch polnisches Geld
oder einen Grundbuchauszug bei uns hätten. Wir zeigten ihnen 800 Zloty, die sie uns, nach Ausstellung einer Quittung
über 500 Zloty, abnahmen. Die Grundbuchauszüge habe ich, im Stroh versteckt, dem Ochsen vor die Füße gelegt. Falls
jemand da suchen sollte, hätte ich gesagt, das das Tier bösartig veranlagt ist, und ich für seine Sicherheit nicht
garantieren könnte, deshalb sollte er vorsichtig sein.
Als die Grenzkontrolle den Zug verlassen hatte, setzte sich die Lokomotive wieder in Bewegung und überquerte nach
kurzer Zeit die Oderbrücke. Auf einer eingezäunten Fläche, jenseits der Grenze, hat man uns abgestellt hat und die
Lokomotive fuhr zurück auf polnisches Gebiet. Vor und hinter uns waren die Tore verschlossen. Auf den Wachtürmen,
links und Rechts von uns, standen Posten mit einem Gewehr im Anschlag. Vier Grenzbeamte der DDR, jeder mit einer
Leiter in der Hand, sowie ein Schäferhund, kamen zu unserem Wagen. Sie öffneten die Schiebetüre, stellten die Leiter
davor und ließen den Hund in den Wagen springen, der nur etwas herum schnupperte und wieder heraussprang. 2 Beamte
haben dann anschließend, die Papiere kontrolliert und das Inventar gezählt.
Nach einiger Zeit wurden wir an einen Güterzug der Reichsbahn angehängt und fuhren von Frankfurt an der Oder, vorbei
an Berlin, Ellingen und Nordhausen, über die Grenze zur Bundesrepublik bis Herzberg. Hier hat ein Zollbeamter der
Bundesrepublik, die Formalitäten erledigt und ein Tierarzt die Pferde, Rinder und Schweine gründlich untersucht. Ich
musste ihnen die Mäuler aufhalten und die Füße hochheben. Danach hat uns die Lokomotive zu einer Wasserzapfstelle
gebracht, wo wir die Tiere tränken und unsere Behälter mit Wasser auffüllen konnten. Anschließen fuhren wir über
Northeim nach Göttingen, zur Viehverwertungsgenossenschaft, die zuvor von unserer Ankunft in Kenntnis gesetzt wurde.
Der Ochse, die Sterke und die Schweine wurden, in Göttingen zum Schlachthof gebracht; die Pferde kamen nach Hannover
und die Schafsböcke nach Kassel. Wir waren mit dem Viehtransport 5 Tage unterwegs; hatten so manche Klippe umschifft
und Schwierigkeiten gemeistert, die im normalen Leben nicht vorkommen.
Wir wurden mit einem PKW, ins Durchgangslager Friedland bei Göttingen gefahren, wo mein Sohn Kurt, meine Schwester
Frieda Pelkowski und Siegfried Brosch mit Familie, die am 30 Juli, um 14 Uhr, von Warschau mit dem Zug abgefahren, und
hier am 31. Juli in den Morgenstunden eingetroffen sind, schon auf uns gewartet haben. In Friedland hat man uns mit
Familie Siegfried Brosch in einem Raum untergebracht, wir wurden registriert und erhielten 20 DM Überbrückungsgeld,
pro Person. Da wir erst am Freitag in Friedland eingetroffen sind, mussten wir hier über das Wochenende bleiben,
obwohl die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der Regel nur 3 bis 4 Tage beträgt.
Um einen Antrag für die Ausreise stellen zu können, brauchten wir eine Einladung von in der Bundesrepublik lebenden
Verwandten. Diese Einladung hat uns mein Bruder, Ernst Rattay, aus Ingelheim am Rhein zugeschickt. Ingelheim liegt im
Bundesland Rheinland-Pfalz. Das Geld für die Bahnfahrt, hat uns, Frieda Schellin, geb. Nickel, aus Duisburg, die
Tochter unseres Nachbarn, überwiesen. In Friedland wurden wir registriert. Im Registrierschein, war als unser
nächster Aufenthaltsort in der Bundesrepublik, das Durchgangslager Osthofen bei Worms, das alle Aussiedler für
Rheinland-Pfalz aufnehmen musste, eingetragen. Die Eintragung erfolgte deshalb, weil der Ort aus dem uns unsere
Einladung zugeschickt wurde, sich auch in Rheinland-Pfalz befand.
Da ich nach dem Polenfeldzug, als Soldat, ein Jahr im Kreis Opladen, im Rheinland gewesen bin, wäre ich sehr gerne in
diese Gegend gezogen, denn die Erinnerung an die schönen Tage die ich dort verlebt habe war in mir immer noch wach.
Ich versuchte die Eintragung in unseren Regiestierscheinen ändern zu lassen, was nach einigen, vielleicht auch
berechtigten Einwänden, am 4. August, vom Beauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen, genehmigt wurde. Anstelle von
Rheinlad-Pfalz stand da jetzt Nordrhein-Westfalen und am 7. August, fuhren wir, noch mit anderen Aussiedlern, ins
Durchgangslager Unna-Massen, am östlichen Rande des Ruhrgebietes gelegen. Hier wurden wir in einem Zimmer untergebracht
und konnten unser Essen in einer Gemeinschaftsküche zubereiten.
Am 8. August wurden wir in Unna-Massen, als Bürger der Bundesrepublik Deutschland registriert, erhielten
Einhundert DM Begrüßungsgeld, den Vertriebenen Ausweis -A -und 4 Wochen später den Bundespersonalausweis. In
Unna-Massen haben wir mehr als 4 Monate verbracht, weil mein Sohn Kurt, wegen fehlender Berufsausbildung, in Unna, an
einem Grundlehrgang für Metallarbeiter teilgenommen hat, der vom Arbeitsamt finanziert wurde. Am 11 Dezember 1969 sind
wir endlich an unserem vorläufigen Wohnsitz, im Durchgangswohnheim, an der Elisabethstraße 13, in Velbert angekommen.
Ab dem 5. Januar 1970 konnten meine Söhne, in der Zahnradfabrik Reining, in Velbert ihrer geregelten Arbeit nachgehen.
Von Bau- und Sparverein in Velbert wurde uns am 20. Juni 1970, unsere erste Wohnung zugewiesen.
Velbert im Februar 1972
gezeichnet: Gustav Rattay
Rohmanen vor dem Ersten Weltkrieg
Rohmanen ist von der Kreisstadt Ortelsburg 3 Kilometer entfernt und liegt an der Landstraße von Ortelsburg über
Kobulten nach Bischofsburg. Wegen der Nähe zur Kreisstadt wurde schon darauf geachtet, dass alles ordentlich und
sauber war. Die Zäune, an der Straßenseite, wurden, bei Bedarf immer ausgebessert und jeden Sonnabend musste die
Straße gefegt werden. Der Landjägermeister kam am Sonntag zu Pferde geritten und hat nachgesehen ob jeder seine
Pflicht getan hat. Hatte jemand vergessen die Straße zu fegen, kostete ihn das 5 Reichsmark Strafe, was zu jener Zeit
viel Geld war. Wenn er dann vor dem Gasthof anhielt, kam Frl. Trzaska mit einem Tablett heraus, auf dem sich eine
Zigarre, ein Gläschen Kognak und auch 2 Stück Würfelzucker fürs Pferd, befanden. Er nahm alles entgegen ohne vom Pferd
zu steigen und ritt dann ins nächste Dorf weiter.
Die Rohmaner Feldmark erstreckte sich etwa über 1500 Hektar. Das Dorf bestand aus etwa 80 Höfen; die Abbauten und
nicht landwirtschaftlichen Gebäude mitgerechnet. Sechs Abbauten sind nach dem zweiten Weltkrieg, teils durch
Fronteinwirkungen, teils durch Vandalismus, unwiederbringlich verloren gegangen. Auf einen Teil der Rohmaner Felder
erstreckt sich auch der Dammerauer Höhenzug. Die höchste Erhebung von 210 Meter über dem Meeresspiegel, befindet sich
auf dem Feld von Friedrich Glinka. Da ist auch ein vierkantiger Granitstein eingegraben, der als Navigtionspunkt, zur
Erstellung von Kartenmaterial, genutzt wurde. Diese Stelle war mit einer Holzpyramide gekennzeichnet und diente auch
bei Truppenmanövern als Orientierungspunkt.
Im Bereich der Rohmaner Gemarkung befinden sich so gut wie keine Wiesen. Die Rohmaner Wiesen liegen etwa 10 Kilometer
entfernt; bei der Försterei Wickno, in Schodmak, in Seedanzig und in Neu Schiemanen. Kurz vor dem zweiten Weltkrieg,
haben Herr Biella und Friedrich Trzaska sich schon mit der staatlichen Forstverwaltung, darauf geeinigt, die Wiesen in
Neu Schiemanen gegen näher gelegene zu tauschen. Die neuen Wiesen liegen vor dem Waldpuschsee und befinden sich im
Besitz der staatlichen Forste. Obwohl die eingetauschte Fläche schon neu vermessen wurde und genutzt werden konnte,
wurde sie leider vom Katasteramt, noch nicht ins Grundbuch eingetragen. Auf Grund dieser Tatsache, wurde dieser
Tausch, nach dem Krieg, von den polnischen Behörden, nicht anerkannt.

In der Mitte des Dorfes befindet sich ein, 5 Morgen großer Teich, der den Bauern als Viehtränke diente und Enten sowie
Gänse zum verweilen einlud. Es wurde dort auch Löschwasser entnommen, wenn es im Dorf brannte. Im Teich waren auch
verschiedene Fische, die der Fischer Adam Glitza, in jedem Frühjahr neu eingesetzt hat. Die Fische sind wegen des
vielen Schlammes, der den Boden bedeckte, oft erstickt sind. Aus Richtung Ortelsburg kommend, liegt 50 Meter vor dem
Dorfeingang, zur rechten Hand, ein Soldatenfriedhof. Auf ihm haben die Gefallenen des 1.Weltkrieges, Deutsche und
Russen, ihre letzte Ruhe gefunden. Von der Landstraße kommend muss man einige Stufen hinaufsteigen, die von beiden
Seiten mit Birken bepflanzt sind.
Auf einer kleinen Anhöhe befindet sich die aus zwei Klassenräumen bestehende Dorfschule, mit einer Wohnung für den
Lehrer. Die Schule wurde 1906, mit tatkräftiger Unterstützung aller Dorfbewohner, aus gebrannten Lehmziegeln, gebaut.
Auf der Anhöhe, vor der Schule sind später Kastanienbäume gepflanzt worden, die den Schulkindern, an heißen Tagen
Schatten spendeten.
Die älteste Familie in Rohmanen war die Familie Friedrich Biella. Wie ich mich noch erinnern kann war sein Vater
Gemeindevorsteher. Nach seinem Tode hat das Amt sein Sohn Friedrich übernommen bis er 1914 als Unteroffizier in den
ersten Weltkrieg einrücken musste. Friedrich Biella hat aktiv bei der Garde in Berlin gedient. Bei den Wahlen und bei
der Abstimmung 1920 hat er sich sehr für den Erhalt des Deutschtums eingesetzt. Er hat auch im Jahr 1896, die
Freiwillige Feuerwehr in Rohmanen ins Leben gerufen und war zugleich ihr erster Brandmeister. Bei der Genossenschaft
und bei der Darlehenskasse war er im Vorstand. Dadurch war es ihm möglich die Rohmaner Bauern mit Krediten und
Kunstdüngern zu versorgen. Die Söhne Fritz und Wilhelm hat er aufs Gymnasium nach Ortelsburg geschickt und studieren
lassen. Bei Bauernversammlungen hat uns Fritz Biella Vorträge gehalten.
Eine weitere Familie war die des Gasthofbesitzers Friedrich Trzaska. Der Hof von Friedrich Trzaska war der älteste in
Rohmanen. Wenn die Bauern aus weiter gelegenen Dörfern, vom Wochenmarkt nach Hause fuhren, hielten sie oft an der
Gaswirtschaft an. Die Pferde, sowie die auf dem Markt eingekauften Rinder wurden dann, an einem vor dem Haus
angebrachten Querbalken festgebunden und die Besitzer machten es sich in der Gaststube gemütlich. Zwei große
Kastanienbäume standen zu beiden Seiten der Eingangstreppe und weiter rechts war ein großes Fenster, in dem, die im
Geschäft vorrätigen Artikel, ausgestellt waren; besonders zur Weihnachtszeit. Die Kinder drückten sich an der Scheibe
die Nase platt, um die vielen schönen Sachen, die sich die meisten Dorfbewohner nicht leisten konnten, wenigstens aus
der Nähe zu bestaunen.
In der Gaststube wurde Korn, sowie auch guter Bärenfang ausgeschenkt, und wenn es den Gästen gut geschmeckt hat, haben
sie es lange ausgehalten, so das für eine weitere Rast, in einem der nächsten Dörfer keine Zeit mehr übrig blieb. Die
alten Bauern erzählten auch; das es in ganz Ortelsburg, keinen so guten Schnupftabak gab, wie im Gasthof Trzaska. Zu
diesem Grundstück gehörte einst auch der Rohmaner See. Weil dafür keine Steuern gezahlt wurden hat sich der Besitzer
von Gut Frenzken den See angeeignet.
Als Königsberg zur Festung ausgebaut wurde, haben viele Männer dort Arbeit gefunden. Zu dieser Zeit war an eine
Beschäftigung im Kohlenbergbau, in Westfalen, noch nicht zu denken. Weil auch noch keine Eisenbahnlinie vorhanden war,
mussten sie den weiten Weg zu Fuß zurücklegen. Nachdem sie den ganzen Tag marschiert sind, haben sie in der Nacht ein
Feuer angezündet, eine Malzeit zubereitet und in der Nähe des Feuers, das sie vor wilden Tieren schützen sollte,
übernachtet. Die Reise nach Königsberg hat eine ganze Woche gedauert. Sie wurden dort zum Aufschütten der
Festungswälle eingesetzt.
Das Jahr 1914 wurde zum Schicksalsjahr, für Ostpreußen und seine Bevölkerung. Nach Abschluß der Volksschule im Jahr
1912, habe ich in den Wintermonaten einen Fortbildungslehrgang für die Landwirtschaft besucht, den Hauptlehrer Aaron,
der aus Olschienen nach Rohmanen versetzt wurde, für uns organisiert hatte. Da im Dorf 2 Trompeten vorhanden waren,
hatte er uns nahe gelegt eine Kapelle zu gründen, dann könnten wir ja die Soldaten, die aus dem Krieg heimkehren
würden mit Musik empfangen. Zum Abschluss konnte man sich ein Buch oder ein Obstbäumchen wünschen. Eine Woche vor dem
Einmarsch der Russen, haben wir noch mit einem Breitdrescher, der durch ein Rosswerk dass von 6 Pferden angetrieben
wurde 110 Zentner Roggen gedroschen. Der Lehrer Malayka hat sich 1914 freiwillig zum Militär gemeldet. 1915 hat er uns
als Offiziersanwärter besucht. Im Frühjahr 1916 wurde mein Jahrgang gemustert und im Herbst 1916 wurden wir eingezogen.
Ausbruch des Ersten Weltkrieges
Am 2. August 1914 wurde die Allgemeine Mobilmachung ausgerufen. Alle wehrfähigen Männer folgten
dem Ruf des Kaisers und eilten zu den zuständigen Wehrmeldeämtern um die Grenzen des Vaterlandes zu schützen. Wir als
Grenzbewohner bekamen das Meiste zu spüren. Alle Häuser, Scheunen und Ställe waren mit Soldaten und ihrem Tross belegt.
Die Einen gingen, die Anderen kamen. Die Kosaken hatten bei Muschaken und Radzinen die Grenze überschritten. Der
Flüchtlingsstrom hatte sich von der Grenze her angestaut. Die Russen haben überall geplündert. Die Trosse mussten sich
zurückziehen und haben dazu vorwiegend die Feldwege benutzt. Die Pferde waren erschöpft. In einer Nacht kam der
Gemeindevorsteher mit einem deutschen Offizier auf unseren Hof. Mein Vater und der Nachbar Wilhelm Dorka mussten mit
ihren Pferden aushelfen. Sie waren 2 Tage unterwegs, bis zu einem Gut in Kleeberg bei Allenstein. Als sie dann wieder
nach Hause kamen waren die Russen schon am Rohmaner Friedhof. In der Zwischenzeit hatten wir schon den Leiterwagen mit
Mehl, Rauchfleisch und Betten beladen.
Der überwiegende Teil der Rohmaner war schon losgefahren. Der Hauptlehrer Müller kam noch mit dem Fahrrad vorbei und
sagte es wäre höchste Zeit das wir wegkämen weil die Russen schon Ortelsburg besetzt hätten und im Anmarsch auf
Rohmanen wären. Wir sind auf eine Anhöhe gestiegen und haben die Staubwolken beobachtet, aber wir dachten es wäre
deutsches Militär.
Auf der Flucht vor den Russen
Kurz vor Sonnenuntergang haben wir die Pferde vor den fertig gepackten Wagen gespannt und sind
sofort losgefahren. Mein Bruder und ich nahmen 4 Milchkühe und die beste Sterke mit und gingen hinterher. Schweine,
Kälber und Geflügel haben wir aus den Ställen getrieben. Wir waren die ganze Nacht unterwegs und sind bis Rheinswein
gekommen. Da hatten wir einen Onkel wohnen, bei dem haben wir den ganzen Tag verbracht.
Unterwegs haben wir einen Mann getroffen, der erzählte uns dass die Russen bei Groß Jerutten einen Personenzug
überrumpelt haben. Sie hatten aus Eisenbahnschwellen eine Sperre auf den Schienen errichtet und somit den Zug zum
Anhalten gezwungen. Die Russen haben den Zug mit Artillerie beschossen. Als die Soldaten und Zivilisten den Zug
verlassen wollten kamen die Kosaken zu Pferde und haben ein Massaker angerichtet. Nur wer sich am Boden davon
schleichen konnte hat überlebt. Die Russen wurden durch einen Verräter darüber informiert das auf diesem Gleis ein
Zug unterwegs war und waren darauf vorbereitet. Unserem Informanten ist es auch gelungen dem Massaker zu entkommen.
Ein Kosake hatte ihm im beim vorbeireiten mit dem Säbel ein Ohr abgehauen und ihn dadurch zu Boden geschlagen. Es ist
ihm danach gelungen ins Gebüsch zu schleichen. Sein Kopf war schon verbunden als wir ihn trafen. Später wurde an der
Stelle des Überfalls ein Gedächtnisstein errichtet.
Im Morgengrauen sah man viele Kosaken über die Felder reiten. Wir sind dann später wieder weiter in Richtung
Jellinowen gefahren. Unser Vater ist mit dem Pferdewagen die Landstraße entlang gefahren. Wir mit dem Vieh sind
entlang einer tiefen Schlucht durch den Wald bis zum Babanter See gegangen. Wir hatten schon vorher versucht die
Schlucht zu verlassen aber wegen der steilen Hänge ist es uns leider nicht gelungen. Am See angekommen fanden wir drei
große Schober mit Getreide vor. Von einem dieser Schober haben uns zwei Kosaken mit einem Fernglas beobachtet. Sie
schwangen sich auf ihre Pferde und kamen uns entgegen geritten, dann hielten sie uns ihre Lanzen vor die Brust und
versuchten uns auszufragen. Wir haben leider nichts verstanden und fingen an zu weinen. Plötzlich pfiff der
Patrollienführer auf einer Trillerpfeife und die Kosaken kehrten zu ihrem Ausgangspunkt zurück.
Als wir dann weiter am See entlang gingen sahen wir von weitem drei Gehöfte. In der Nähe einer dieser Höfe hatte unser
Vater den Pferdewagen im Gestrüpp abgestellt. Die vorrückenden Schützenlinien der russischen Infanterie hatten ihn
jedoch entdeckt. Sie haben den Wagen durchwühlt und den Sack mit Rauchfleisch mitgenommen. Andere Flüchtlingswagen die
in diesem Gebüsch Schutz gesucht haben sind nicht besser davon gekommen. Wir haben das Vieh auf einen der Höfe
getrieben und am Zaun festgebunden. Dann haben wir mit Hilfe einer Leiter den Heuboden erklommen und uns dort versteckt.
Als die Kosaken auf dem Hof erschienen verlangten sie Brot und Milch. Die Frauen mussten zuerst essen und trinken,
danach haben es die Russen auch getan, sie fürchteten sich davor, dass man sie vergiften könnte. Später kam dann die
russische Infanterie und hat Haus, Scheune und Schuppen durchsucht. Die Falltüre zum Heuboden ließ sich nur nach oben
hin öffnen. Wir hatten die Türe von oben mit schweren Gegenständen beschwert, aber die Russen versuchten mit aller
Gewalt auf den Heuboden zukommen. Als die Frauen das sahen, sagten sie zu den Russen, da oben würden sich ihre Kinder
versteckt halten. Die Russen forderten nun, die Kinder sollten sofort den Heuboden verlassen. Die Mütter riefen nun
nach ihren Kindern die dann auch tatsächlich den Heuboden verließen. Als wir das sahen, haben wir uns am Giebel tief
im Heu vergraben. Drei Russen kamen nun rauf und stocherten mit ihren Bajonetten im Heu herum. Glücklicherweise kamen
sie nicht in unsere Nähe. Als die Russen den Heuboden verließen haben wir befürchtet sie würden ihn in Brand setzen.
Wahrscheinlich taten sie deshalb nicht weil so viele russische Soldaten auf dem Hof waren. Einige Zeit später
erschienen russische Offiziere auf dem Hof, mit einem Auto. Sie sagten, sie hätten das Land erobert und wir hätten ab
sofort dem russischen Zaren zu gehorchen. Wir wurden angewiwsen nach Hause fahren und unbesorgt unsere Ernte
einzubringen. Sie haben uns auch eine Bescheinigung ausgestellt, damit uns auf dem Heimweg niemand die Pferde und
das Vieh wegnehmen würde.
Erst am nächsten Morgen, als die Front weiter vorgerückt war, beschlossen wir die Heimreise anzutreten. Die Straßen
waren mit vorrückenden russischen Truppen blockiert. Manchmal mussten wir stundenlang am Wegesrand warten bis die
Soldaten mit ihrem Tross vorbeigezogen waren. Unterwegs wollten sie unser Vieh zum Schlachten wegnehmen, aber die
Bescheinigung hat uns davor bewahrt. Die Eisenbahnbrücke vor Neu-Keykuth wurde von Kavallerie bewacht. Die wollten uns
nicht drüber lassen und hielten uns bis zum frühen Morgen fest. Zurück in Rohmanen angekommen, konnten wir unser Haus
nicht betreten weil der Hof und alles rundherum ein großes Militärlager war.
Wir sind dann in Richtung Seelonken gefahren, bis Abbau Brosch. Auf dem Hof angekommen haben wir zuerst Grünfutter für
die Pferde vom Feld geholt und anschließend Mittag für uns selbst gekocht. Die Nacht haben wir erstmal auf dem Hof
verbracht. Am nächsten Morgen wagten wir es ins Dorf zu gehen um die Lage zu erkunden. Die Russen waren schon wieder
weiter gezogen, aber Haus und Hof waren in einem schrecklichen Zustand. Wir sind dann gegen Abend wieder nach Hause
zurückgekehrt.
Am 23. August 1914 waren die Russen bei uns eingebrochen, bis sie am 28. August von den Deutschen zurückgeschlagen
wurden. Dann fuhren sie wieder zurück, drei Wagen nebeneinander. Ortelsburg brannte lichterloh. Ein Wagen mit Mehl war
uns gegenüber in den Straßengraben gekippt, aber wir haben nichts davon genommen, weil man ja nicht wusste ob man die
Nacht überleben würde. Wir saßen die ganze Zeit im Keller. Am nächsten Morgen zog dann russische Kavallerie und
Infanterie durch unser Dorf. Die Kavallerie ritt orientierungslos hin und her. Die Infanterie hat den ganzen
Vormittag 1,5 Meter tiefe Schützengräben ausgehoben. Um 11 Uhr kamen aus Richtung Eichtal 3 deutsche Spähwagen nicht
ahnend dass die nördliche Hälfte des Dorfes noch von Russen besetzt war. Wir haben zu diesem Zeitpunkt auf dem
Dachboden Weizen eingesackt und hatten aus diesem Grunde einen weiten Rundblick.
Um 11 Uhr kamen aus Richtung Eichtal drei deutsche Spähwagen angefahren. Als wir die deutschen Soldaten erkannt hatten,
haben wir sie durch Handzeichen gewarnt weiter nach Norden vorzustoßen. Die Kosaken hatten sich auf den Häuserdächern
positioniert und in Richtung Norden nach deutschen Truppen Ausschau gehalten. Die Deutschen sprangen von den Spähwagen
und fingen an die nichts ahnenden Russen zu beschießen. Als die sich ihrer gefährlichen Lage bewusst wurden verließen
sie ihre Aussichtsposten und bestiegen ihre Pferde. Mit Peitschenhieben versuchten sie, die sich in panikartiger Flucht
befindliche Infanterie dazu zu Bewegen, die Deutschen anzugreifen. Zwei Spähwagen wendeten sofort, der Dritte konnte
nicht mehr umkehren. Es gelang allen, bis auf den Fahrer des dritten Wagens die Flucht. Die Russen nahmen ihn sofort
unter Beschuss, doch es gelang ihm über unseren Hof zu entkommen. Auf der rückwärtigen Seite schlug er sich quer durch
die Gärten bis zum Gehöft von Friedrich Sakowski durch. Der versteckte ihn im Keller und versorgte ihn anschließend
mit Zivilkleidung.
Als die Russen den Soldaten auf unseren Hof laufen sahen nahmen sie sofort die Verfolgung auf. Sie durchstöberten auch
die Nachbarhäuser und trieben die Bewohner auf der Straße zusammen. An der Spritzenwagenremise richteten sie einen
Sammelpunkt ein. Unter dem Vorwand es würde hier eine Schlacht stattfinden, versuchten die Russen die Zivilbevölkerung
aus dem Dorf zu drängen. Alle die dem Aufruf gefolgt sind und an unserer Sammelstelle vorbeikamen wurden unserem Haufen
hinzugefügt. Unter ihnen befand sich auch der deutsche Soldat in Zivilkleidung. Er hatte einen Sack über die Schulter
geschlagen in dem sich ein Brot befand, an der anderen Hand führte er eine Kuh am Strick. Als unser Haufen schon aus
etwa 50 Leuten bestand setzten uns die Russen mit Marschrichtung Seelonken in Bewegung. Wir Jungen versuchten in einem
unbeaufsichtigten Moment wegzulaufen, doch die Begleitmanschaft prügelte uns mit Gewehrkolben wieder in Reihe und Glied.
Unterwegs gelang es dem Soldaten mit der Kuh unbemerkt zu entkommen. Er kehrte unbehelligt ins Dorf zurück und lieferte
die Kuh wieder dort ab wo er sie entführt hatte.
Uns haben die Russen an Seelonken vorbei zum Sylvensee getrieben. Wenn sie von vorbeiziehenden russischen Offizieren
gefragt wurden weshalb wir unterwegs wären, sagten sie denen wir hätten deutsche Soldaten versteckt und wollten das
Versteck nicht verraten. Als wir am See vorbei waren begann die deutsche Artillerie aus Richtung Ortelsburg zu
schießen. Unweit von uns explodierten Granaten und richten ein großes Chaos unter Freund und Feind an. Es hieß dann
rette sich wer kann. Die Russen verließen uns in Richtung Waldpuschsee und wir kehrten orientierungslos nach Seelonken
zurück. Nach Rohmanen konnten wir nicht zurück weil die deutsche Artillerie aus Richtung Eichtal anfing unser Dorf zu
beschießen. Schließlich sind wir auf dem Abbau Brosch untergekommen. Ein durch Granatsplitter schwer verletzter Russe
suchte dort auch Zuflucht. er versucht sich mit einem Messer das Leben zu nehmen. es gelang den Frauen ihn davon
abzubringen, weil sonst bei einem etwaigen erscheinen von russischen Soldaten der Verdacht auf uns gefallen wäre.
Später erschienen tatsächlich Kosaken die ihn dann mitgenommen haben. Ihnen folgten in 50 Meter Entfernung Deutsche
Ulanen, die hinter den Russen in einem in der Nähe liegenden Wäldchen verschwanden.
Nachdem die Russen Rohmanen besetzt hatten, versteckten sie sich vorwiegend in mit Stroh gedeckten Gebäuden. Durch
Schießscharten, die sie im Strohdach anlegten, schossen sie auf die deutschen Kampfverbände, die sie wieder vertreiben
wollten. Um die Angreifer zu entlasten, wunde das Dorf von deutscher Seite unter Beschuss genommen. Durch die
Geschosse der deutschen Artillerie entstanden in Rohmanen viele Brände. Die mit Stroh gedeckten Gebäude fielen zuerst
in Schutt und Asche. Unser Vater hatte uns ins Dorf geschickt, damit wir das Vieh im Stall von der Kette losbinden
sollten. Am Dorfrand kamen uns schon deutsche Ulanen und Husaren entgegen. Rohmanen brannte an mehreren Stellen. Unser
Hof war noch unversehrt, nur die Zäune standen schon in Flammen. Wir haben das Vieh los gebunden und anschließend
versucht die Brandherde rund herum zu löschen. Es gelang uns die Flammen von unserem Hof fernzuhalten und auch bei
unserem Nachbarn einzugreifen. In vielen Scheunen und Ställen hatten sich noch viele versprengte Russen versteckt. Die
wurden anschließend von deutschen Soldaten eingesammelt und in Gefangenenlager abgeführt. Am nächste Tag haben wir dann
zerbrochene Gewehre und Munition in Körbe gesammelt und im Dorfteich versenkt.
Am 29. August haben die Russen Rohmanen verlassen, doch schon am 30. August sind sie wieder zurückgekehrt. Hauptlehrer
Müller wurde mit seinem Sohn und Karl Deptolla auf Fahrrädern fahrend von einer russischen Patrouille aufgegriffen.
Sie wurden von den Russen der Spionage verdächtigt weil der Lehrer Müller ein Fernglas bei sich trug. Der Sohn hatte
eine Gymnasiastenmütze und eine Landkarte bei sich. Sie wurden in Richtung Lehmanen abgeführt. Auf einer Anhöhe des
Grundstücks von Ernst Chittka befand sich eine nicht mehr betriebstaugliche Windmühle. Dort soll ein russisches
Kriegsgericht sie zum Tode verurteilt haben. Nach der Hinrichtung wurden sie in der Nähe der Windmühle verscharrt.
Später wurden sie wieder ausgegraben, in Särge gelegt und auf dem Rohmaner Friedhof beigesetzt. Die Ehefrau von Lehrer
Müller hat die Gräber nach dem 1. Weltkrieg mit einem schmiedeeisernen Zaun umrandet.
Die Kämpfe um Rohmanen haben viele Menschenopfer gekostet. Bei uns hinter der Scheune lagen 2 tote Russen und ein
Verwundeter. Die Toten haben wir in einer Kartoffelmiete vergraben. Alle anderen Gefallenen wurden auch gleich an der
Stelle an der sie zu Tode kamen verscharrt und mit einem Kreuz gekennzeichnet. Für die im Raum Rohmanen gefallenen
Russen wurde nach dem Krieg hinterm Dorf, in Richtung Ortelsburg, auf einer Anhöhe ein Heldenfriedhof angelegt. Dort
liegen 20 Soldaten und 1 Offizier. In der Mitte befindet sich ein Trauerbaum und Birken säumen den Zugang von der
Landstraße her. Der Lehrer Dorka hat nach dem Kriege, mit seinen Schülern immer die Gräber gepflegt.
Meine Einberufung zum Militär

Bis zu meinem 17. Lebensjahr habe ich meinem Vater in der Landwirtschaft geholfen. Im Frühjahr
1916 wurde unser Jahrgang gemustert. Im Herbst 1916 erhielten Gustav Spektor, Johann Resonek und ich einen
Einberufungsbescheid. Wir mussten uns in Allenstein im Kaisergarten melden. Dort wurden Rekruten aus mehreren
Landkreisen zusammen gezogen und danach verschiedenen Ausbildungszentren zugeteilt. Wir Rohmaner kamen zum 18.
Infanterie-Regiment nach Osterode. Ein Unteroffizier mit einer Gruppe Musketiere haben uns von Allenstein abgeholt.
Als wir in der Kaserne ankamen haben wir sofort Mittagessen in Blechnäpfen bekommen. Untergebracht wurden wir im
Dachgeschoß der Kaserne. Es waren keine Betten vorhanden, nur Strohsäcke lagen auf dem Boden.
Als dann einige Tage später ausgebildete Kompanien an die Front ausrückten durften wir in einen anderen Block umziehen.
Wir wurden der Größe nach aufgestellt, in Korporalschaften eingeteilt und dann von Kopf bis Fuß eingekleidet. Die
Ausgehuniformen hatten blanke Knöpfe dazu einen Schako mit blanker Spitze. Im neuen Block hatten wir 2stöckige Betten.
Unsere Zivilbekleidung mussten wir in einen Karton verpacken und nach Hause schicken. Dann erst begann das eigentliche
Kasernenleben. Die Kaserne durfte niemand ohne Erlaubnis verlassen, nur in Begleitung eines Unteroffiziers. In der
Kaserne war eine Kantine in der man alles kaufen konnte was in der Kaserne gebraucht wurde.
Am nächsten Tag kam unser Kompanieführer, im Range eines Hauptmanns, zu Pferde angeritten. Er begrüßte uns mit;
Guten Morgen Kameraden, wir antworteten ihm mit; Guten Morgen Herr Hauptmann. Er hat dann die Front abgeschritten und
jeder musste sich mit seinem Namen vorstellen. Um 5 Uhr wurde geweckt, 6 Uhr Kaffee holen, 7-8 Uhr Unterricht, 8-11
Uhr exerzieren auf dem Kasernenhof. Um 11.30 blies der Trompeter zur Mittagspause. Die erste Zeit war noch alles
ziemlich gemütlich aber dann wurde es von Tag zu Tag strenger. Um 10 Uhr abends war Zapfenstreich, dann ging der
Unteroffizier vom Dienst von Stube zu Stube, der Stubenälteste musste die Anwesenheit aller Rekruten melden; zum
Beispiel: Stube 56 belegt mit 14 Mann, alle zu Haus. Wir mussten in 2 Reihen antreten, mit Drillichanzug bekleidet
und in Pantoffeln, ein tadelloses Aussehen präsentieren. Der Diensthabende Unteroffizier prüfte ob alle
vorschriftsmäßig angezogen, gewaschen, gekämmt und ob alle Knöpfe an der Jacke geschlossen waren. Als er bei einem
Rekruten einen offenen Knopf erspähte, hat er uns gefragt, ob jemand ein Taschenmesser bei sich hat.
Wir ahnten nicht Gutes, darum haben wir uns ganz still verhalten und nichts gesagt. Da sagte der U.v.D. plötzlich:
”Wenn niemand von euch ein Messer bei sich hat, dann habe ich ein”. Er zog sein Messer aus der Tasche und fing an, bei
dem Rekruten die Knöpfe abzuschneiden. Als die Knöpfe zu Boden purzelten, brachen wir in lautes Gelächter aus. Das hat
ihn so in Rage gebracht, das unser unwürdiges Benehmen, zuerst mit einem „Donnerwetter” bestraft wurde. Dann schrie
er: ”In den Korridor marsch, marsch, die Treppen runter bis auf den Hof”. Als wir unten angekommen waren hieß es
wieder; "Zurück auf die Stube in der 3. Etage”. Jemand hat mir bei dem Durcheinander, von hinten in den Pantoffel
getreten, so das er auseinander gerissen wurde. Ich bin dann nur mit einem Pantoffel und einem Socken die Treppen rauf
und runter gelaufen. So wurden wir 3-mal hinunter und wieder hinauf gejagt.
Danach ließ er uns wieder antreten und hat mit einer Taschenlampe unter den Betten geleuchtet. Plötzlich schrie er
wieder los: "Das nennt ihr Fegen? wenn ihr mit dem Besen nicht fegen könnt, dann mühst ihr das mit eueren Bäuchen tun.
Marsch, marsch unter die Betten” . Als wir schon alle am Schlafen waren, kam der U.v.D. wieder und hat nachgesehen ob
alle Schränke abgeschlossen waren. Ein Kamerad hatte seinen Schlüssel verloren, deshalb hat er das Schoß nur so
eingehängt. Als der U.v.D. das bemerkte hat er die Türe aufgerissen, die ganzen Sachen aus dem Schrank, quer durch die
Stube verteilt und war dann endlich gegangen.
Die Anziehsachen mussten, fein sauber gefaltet, auf dem Stuhl liegen; da drauf die Socken und die Pantoffeln unter dem
Stuhl. Die Stühle mussten in einer Reihe ausgerichtet sein; die Hosenträger im Schrank einschlossen und der Brustbeutel
mit Geld auf dem Hals tragen werden. Morgens wurden wir geweckt und kamen zuerst in den Waschraum. Jeder musste seinen
entblößten Oberkörper mit kaltem Wasser abreiben. Da draußen strenger Frost herrschte war es im Waschraum auch sehr
kalt, so das manche ihr Hemd anbehielten. Der UvD hat dann bei seinem Kontrollgang alle Verweigerer aufgeschrieben
und ihnen befohlen in 30 Minuten mit einem Besen in der Hand auf der Schreibstube zu erscheinen. Einige mussten den
Kasernenhof fegen, andere die zugefrorenen Latrinen enteisen und reinigen. Während unserer Ausbildungszeit durften wir
die Kaserne nicht verlassen. Wenn man Stuben- oder Frühdienst hatte, blieb keine Zeit zum Frühstücken.
Nach 6 Wochen wurden wir in der Grollmann Kaserne vereidigt. Die Regimentskapelle spielte "Heil dir im Siegerkranz",
danach folgten 3 Strophen des Deutschlandliedes. Vor der Vereidigung wurden die Rekruten gefragt wer keine deutsche
Staatsangehörigkeit besitzt. Es sind dann Luxemburger und auch noch welche aus anderen Ländern hervorgetreten. Sie
wurden gefragt ob sie die deutsche Staatsangehörigkeit annehmen wollen. Die das abgelehnt haben wurden auf die
Schreibstube gerufen und sofort aus dem Militärdienst entlassen. Nach der Vereidigung erfolgte ein Kirchgang, danach
konnte man einen Stadturlaub beantragen. Nach dem Mittagessen mussten alle, die einen Urlaubschein beantragt hatten
vor der Kaserne antreten. Der Hauptfeldwebel prüfte dann ob an der Uniform alle Knöpfe blank geputzt waren, die Stiefel
glänzten und der Rekrut auch vorschriftsmäßig grüßen konnte. Wer diese Anforderungen nicht erfüllen konnte musste
seinen Urlaubschein wieder abgeben und zurück auf sein Zimmer gehen.
Wenn man die Kaserne für eine gewisse Zeit verlassen wollte, mussten zuerst der Korporal, dann der Hauptfeldwebel und
letzt endlich der Hauptmann, seine Zustimmung erteilen. Es wurde geprüft; ob die Ausgeh-Uniform sitzt, alle Knöpfe
blank geputzt sind und der Helm so blank ist das man sich darin spiegeln kann. Unser Hauptmann war in Zivil,
Bürgermeister von Osterode. Er war sehr stolz wenn er seine Kompanie, in Parade Uniform und mit einem fröhlichen Lied
auf den Lippen, durch seine Stadt führen durfte.
Als wir eines Tages zum etwa 6 Kilometer entfernten Schießstand marschieren sollten, war es sehr kalt und glatt. Der
Hauptmann ritt durch das große Tor, wir aber sind durch das kleine Tor gegangen und haben eine steil bergab führende
Abkürzung gewählt. Die Zug- und Gruppenführer gingen voraus und wir im Gänsemarsch hinterher. Ein Kamerad hat sich auf
den Gewehrkolben gesetzt und ist darauf den Berg hinunter gerutscht. Als die Anderen das sahen haben sie es ihm
nachgemacht und hatten einen Riesenspaß. Da kam der Hauptmann plötzlich im Galopp angeritten; ließ alles anhalten und
hat zuerst die Zugführer ausgeschimpft, dann anschließend die ganze Kompanie. Er sagte: „Wie könnt ihr es wagen, so
mit eueren Gewehren umgehen. Ein Gewehr soll man wie seine Braut behandeln und nicht wie einen Straßenbesen”. Zur
Strafe mussten wir, links und rechts der Straße, in zwei Reihen antreten und durch den verschneiten Straßengraben
robben. Die Herrn Zug- und Gruppenführer durften die Straße benutzen und erteilten uns nur Befehle, wie: hinlegen,
nach rechts schwenken, nach links schwenken, einzeln vorarbeiten und sammeln. Als wir dann abgekämpft, in Linien zu
2 Glieder angetreten waren, ging es mit Gesang zum Schießstand.
Auf dem Schießstand angekommen, erhielten wir zuerst eine praktische Unterweisung, für den Gebrauch von Schusswaffen.
Wir mussten solange mit einem nicht geladenen Gewehr üben, bis wir unserem Vorgesetzten beweisen konnten, dass wir
alles im Griff haben. Daraufhin wurden jedem 10 Patronen zugeteilt, so das er unter der Aufsicht eines Unteroffiziers
mit den Schießübungen beginnen konnte. Der Unteroffizier hat die Position der Einschüsse, auf der Scheibe, in einem
Buch eingetragen und nach Beendigung der Übung dem Hauptmann Bericht erstattet, ob der Schütze seine Aufgabe erfüllt
hat oder nicht. Nach dem Schießen wurden die Gewehre zu Pyramiden zusammengestellt. Diejenigen die ihre Aufgabe nicht
erfüllt haben, mussten rund um die Zielscheibe, die Bleikugeln aufsammeln.
Seit unserer Einberufung hatten wir noch keinen Heimaturlaub. Urlaub bekamen nur die, die ihren Heimatort zu Fuß
erreichen konnten. Wegen der vielen Truppentransporte die täglich von Ost nach West unterwegs waren durften wir die
Eisenbahn nicht benutzen. Einmal wurde uns gesagt; wenn jemand gut schießen kann der bekommt Heimaturlaub, aber auch
das war nur ein leeres Versprechen.
Kaisers Wilhelms Geburtstag
Der beste Tag war des Kaisers Geburtstag. Am 27. Januar mussten alle in der Grollmann Kaserne
antreten, der Battalions-Kommandeur beendete seine Laudatio mit den Worten: Seine Majestät, unser Kaiser und König
Wilhelm II, erlebe hoch, hoch, hoch. Dann spielte die Regimentskapelle: Heil dir im Siegerkranz, Herrscher des
Vaterlands, Heil Kaiser dir. Danach folgten 3 Strophen des Deutschlandliedes und anschließend fand ein Gottesdienst
statt. Anschließend gab es ein vorzügliches Mittagessen, Schweinebraten, ein Stück Wurst auf die Faust und Biermarken,
die man in der Kantine gegen gutes Bier einlösen konnte, danach Urlaub bis zum Wecken, ohne Urlaubschein. Mein Vater
und die Mutter eines Kameraden waren schon morgens angekommen, konnten uns aber nicht finden, wurden von einer Kaserne
in die andere geschickt. Erst als wir mit Musik, von der Kirche zurück zur Kaserne marschiert sind habe ich sie
zufällig entdeckt. Als sie mich auch erkannt haben, sind sie nachgekommen. Da war die Freude groß: Der Vater hatte
einen großen Koffer auf einem Krückstock über die Schulter getragen. Ich ging gleich zur Wache und habe sie angemeldet,
sie sind dann bis zum Abend geblieben. Es war einer der schönsten Tage in der Grollmann-Kaserne in Osterode.
Alle 10 Tage bekamen wir Sold. Vor der Auszahlung mussten wir antreten, jeder wurde gefragt ob noch Restgeld vom
letzten Sold vorhanden war. Dann bekam jeder 3,30 Mark, davon musste man noch Sidol für das Koppelschloss und
Schuhkreme für die Stiefel kaufen. Wer geraucht hat und nichts von zu Hause bekam war schlimm dran. Beim Militär bekam
man nicht nur die Ausbildung an der Waffe beigebracht, man lernte auch putzen, nähen, Strümpfe stopfen und vieles
Andere. Man bekam einen beschädigten Strumpf, der musste aufgeribbelt werden, mit der Wolle konnte man dann andere
Strümpfe stopfen oder Kleidungsstücke mit Namen kennzeichnen. wer das nicht konnte, der musste seinen Kameraden
Zigaretten oder Geld geben die das dann für ihn erledigten.
Verschiedene Kameraden gingen nach dem Dienst noch in die Stadt. Um 21:45 Uhr wurde zum Zapfenstreich geblasen, dann
musste man schnell zurück in die Kaserne, weil um 22:00 Uhr der Wachhabende von Bett zu Bett ging und prüfte ob auch
alle anwesend waren. Zwei mal pro Woche fanden Gewaltmärsche statt, mit vollem Gepäck im Tornister. Am Ende der
Marschkolonne fuhr dann ein Pferdewagen, wenn der Feldarzt bei jemandem einen Erschöpfungszustand feststellte, der
durfte dann aufsitzen. Am Sonnabend wurden auf dem großen Exerzierplatz Felddienstübungen durchgeführt, es befand sich
dort ein großer Hügel, den wir immer wieder erstürmen mussten. Am Nachmittag war Revierreinigen angesagt, wir mussten
dann die Tische schrubben, auf einen Tisch wurde Sand mit etwas Wasser gestreut, der nächste Tisch wurde mit der den
Beinen nach oben drauf gelegt und solange hin und her geschoben bis beide sauber waren. Mit den Stühlen geschah das
Gleiche. Dann wurde der Fußboden in der Stube geschrubbt, die Schränke abgewaschen, Staub geputzt, zuletzt kamen Flur
und Treppe dran.
Für die Arbeit war eine Stunde angesetzt, wenn jemand zu früh fertig war erregte er den Argwohn des Diensthabenden
Korporals, der prüfte dann alles genau, fand natürlich immer etwas das nicht seinen Erwartungen entsprach. Der
Übereifrige musste dann Nacharbeiten bis die Stunde um war. Eine Stunde war für Gewehr reinigen und Unterricht an der
Waffe vorgesehen.
Im Februar wurden wir neu eingekleidet; Schnürschuhe, Koppel, alles gelbes Leder mussten wir mit Lederschwärze
behandeln. 2 Wolldecken, Uniform und Helm in feldgrau, da brauchten wir die Knöpfe nicht mehr zu putzen. Die neuen
Gewehre mussten zuerst eingeschossen werden. Es wurden 90 scharfe Patronen und Marschverpflegung ausgegeben, danach
mussten wir mit vollem Gepäck zum Appell antreten. Man konnte kaum gerade stehen, weil der Tornister einen in die Knie
zwang. Der Major, der die Aufstellung besichtigte rief >Brust raus<, dann informierte er uns dass wir ins
Feldrekrutendepot und in Feindesland kommen. Urlaub bekam niemand. Ich habe ein Telegramm nach Hause geschickt, mit
der Nachricht dass wir bald abrücken werden. Einen Tag vor dem ausrücken hat mich meine Mutter noch besucht, sie hat
mir vieles mitgebracht. Alles konnte ich nicht mitnehmen, weil es nicht gestattet war anderes Gepäck bei sich zu haben
als dem Soldaten zustand.
Abmarsch zum Fronteinsatz
Am nächsten Tag hat uns die Regimentskapelle mit Musik zum Bahnhof gebracht. Von Osterode ging
es über Thorn, Posen,
Annaberg, Warschau, Brestlitowsk ins Pruschana-Lager. Das war eine russische Artillerie-Kaserne, in der 2 deutsche,
3 österreichische Bataillone und eine Offiziersschule untergebracht waren. Ein Bataillon das waren wir 18 und 19
jährige, die Anderen waren Männer bis 45 Jahre. Als wir in Osterode abfuhren lag Schnee, in Annaberg/Schlesien waren
die Kühe auf der Weide und im Pruschana-Lager lag der Schnee wieder einen Meter hoch. Drei Kilometer vor unserem vor
unserem Lager war die Bahnfahrt zu Ende. Mit den schweren Tornistern waren viele überfordert, wir mussten immer wieder
warten bis alle nachkamen. Unsere Unterkünfte das waren Baracken die den Russen als Pferdeställe gedient hatten. In
jeder Baracke wurde eine Kompanie mit Schreibstube untergebracht, die nur durch ein Zelt abgegrenzt war.
Wir haben aus Brettern Doppelbetten hergestellt, in jeder Baracke war ein Ziegelofen. Unsere neuen Uniformen und die
scharfe Munition mussten wir abgeben und bekamen dafür alte Bekleidung, sowie Ecksezierpatronen. Hier ging es wieder
Kasernenmäßig zu, das jüngere Bataillon bekam besseres Essen, doppelte Portionen und nach dem Essen 2 Stunden Bettruhe.
Wenn jemand die Bettruhe nicht einhielt und dabei erwischt wurde wusste zur Strafe Holz hacken oder Schnee schaufeln.
Zwei Wochen war Frost bis minus 40 Grad, da hatten wir keinen Unterricht im Freien, alle Aktivitäten fanden in der
Baracke statt, die nur mit nassem Holz beheizt wurde und dem entsprechend war auch die Temperatur im Inneren. Um
Brennmaterial für die Küche zu besorgen mussten wir ins nächste Dorf gehen und von zerfallenen Häusern Holz holen.
Als endlich das Tauwetter einsetzte verwandelte sich die Gegend um Baranowitschi in ein unüberwindbares Sumpfgelände.
Wir wurden mit anderen Einheiten die aus Frankreich zu uns verlegt wurden, zusammengelegt. Wenn jemand nachweisen
konnte dass er Landwirt ist und mehr als 100 Morgen Ackerland besitzt, konnte er einen Urlaub zur Frühjahrsbestellung
beantragen. Ein Gottlieb Piotrowski aus Plohsen hat seinen Urlaub bewilligt bekommen und durfte für 14 Tage nach Hause.
Wenn von der unweit entfernten Front Kanonendonner zuhören war und Alarm ausgerufen wurde, dachten wir es geht los.
Obwohl wir als Reserve aufgestellt waren mussten wir allzeit einsatzbereit sein. Wir haben auch Bunker und Stollen
gebaut, Schützengräben ausgeworfen und mit scharfen Handgranaten exerziert.
Als Gottlieb Piotrowski nach 2 Wochen zurückkam waren wir schon in Alarmbereitschaft und sind dann auch 2 Tage später
ausgerückt. Kamerad Piotrowski hatte mir noch ein großes Paket von zu Hause mitgebracht.
Italien hat Deutschland und Österreich den Krieg erklärt.
Zuerst sind drei Bataillone Österreicher ausgerückt, dann die Deutschen hinterher. Bis zum
Bahnhof Linowa wurden wir von einer Musikkapelle begleitet, dann ging es per Eisenbahn ab nach Baranowitsche. Dort
wurden wir der, an der Westfront aufgeriebenen, 15ten Reserve Division zugeteilt. Es wurde uns gesagt das Kameraden
aus der Heimat gleichen Gruppen zugeordnet werden können. Ich hatte einen Freund aus meinem Dorf, Gustav Spektor,
einen aus Groß Schöndamrau, Wilhelm Lukas und einen aus Ortelsburg, Karl Schlensack, wir kamen zu zusammen in eine
Kompanie. Zuerst waren wir in einem Kinosaal einquartiert, haben jeden Tag Schützengräben ausgehoben und Feldübungen
gemacht. Es war ein sumpfiges Gelände, so dass die Soldaten wegen den vielen Mücken, Netze auf den Köpfen tragen
mussten. Nach einem Gewitter wurde es plötzlich unerträglich. Die Mücken hatten meinen Freund so zerstochen dass sein
Gesicht dermaßen angeschwollen war und ich ihn gar nicht wieder erkannt habe.
Von Baranowitsche wurden wir wieder auf die Eisenbahn verladen, die uns mit unbekanntem Ziel Richtung Osten fuhr.
Nachdem wir unterwegs einmal zum Essenfassen gehalten haben, kamen wir in der Nacht in Krakau an. In der nächsten
Nacht befanden wir uns schon in den Karpaten, wo wir die Hügelketten zu Fuß überqueren mussten, die Fahrzeuge fuhren
um die Berge herum und wir mussten manchmal 2 Stunden warten bis sie uns wieder eingeholt hatten. So ging es immer
weiter bis wir auf einen Berg kamen wo wir Zelte aufgebaut und Biwak bezogen haben. Dort stießen wir auf türkische
Einheiten die auf Mauleseln Munition und Verpflegung über die Berge transportiert haben. Die Esel hatten ein Gestell
auf dem Rücken, auf jeder Seite eine Fass mit Wasser oder Kisten mit Proviant. Ihre Artillerie wurde von 6 Mauleseln
gezogen, während die Offiziere, ohne Sattel, ohne Zaumzeug, nur mit einem Hanfseil ausgerüstet, daher kamen.
Die Mannschaften marschierten wie es jeder für richtig hielt, mit aufgekrempelten Ärmeln, das Gewehr über den Tornister
gelegt, wie die Wilddiebe. Im Gegensatz dazu herrschte bei uns strenge Disziplin, wen jemand aus der Reihe ging kam
sofort der Kompanieführer angeritten, hat uns angeschrieen, uns klar gemacht dass wir keine Türken seien und nur auf
höheren Befehl etwas an der Marschordnung ändern dürften, wer dagegen verstoße, müsste mit einem 3tägigen Arrest
rechnen. Wir haben hinter der der Front Gewaltmärsche durchgeführt die dem Feind große Truppenaufmärsche vortäuschen
sollten.
Wir lagen in einem Buchenwald in Bereitschaft. Überläufer berichteten dass auf russischer Seite eine Großoffensive
vorbereitet wird. In einer Nacht wurde plötzlich Alarm geschlagen, der Russe war zu einem Angriff mit Gasgranaten
übergegangen. Wir lagen unter Zelten und hatten die Gasmasken gar nicht bei uns, sondern nur etwas abseits liegen. In
der Dunkelheit hat mach einer keine Gasmaske mehr gefunden. Es war ein fürchterliches Durcheinander. Dabei war es
unsere Pflicht die Maske immer an dem Tragriemen über dem Hals zu tragen, mit halb geöffnetem Deckel. Uns hat es zum
Glück nicht so stark betroffen weil wir auf einer Anhöhe lagen und die Gaswolken sich im Tal verteilten. Wir wurden in
höchste Alarmbereitschaft versetzt weil der Russe die österreichische Front durchbrochen hatte.
Eigentlich sollten wir noch an einer Gulaschkanone Essen fassen, aber es blieb uns dazu keine Zeit mehr. Der
Kompanieführer befahl uns die Zelte abzubrechen, auf den Tornister aufzurollen und in fünf Minuten marschbereit zu
sein. Die Kanoniere befanden sich schon in der Batteriestellung, luden die Granaten, die sofort abgefeuert wurden. Der
Battalions-Kommandeur versammelte die Kompanieführer und erteilte ihnen die Angriffsbefehle. Derweil sollten wir in
einem Eichenwal der schon mit Granattrichter übersät war, Deckung suchen. Bald hatten wir die Verbindung zu unserem
Batteriestab verloren. Wir warfen unsere Tornister auf einen Haufen, schwärmten unverzüglich, nur mit Sturmgepäck
ausgerüstet, 4 Handgranaten im Brotbeutel, zum Angriff aus. Wir robbten uns einzeln voran. Weil der Russe unsere
Stellungen schon überrannt hatte war jeder auf sich selbst angewiesen. Mann hörte kein Kommando mehr weil der Russe
inzwischen den Rückzug angetreten hatte, um sich auf einer Bergspitze zu verschanzen, von der er uns mit
Flachbahngeschützen beschoss. Irgendwann befanden wir uns in einem Schützengraben, wo ein Leutnant und 17 Mann aus
unserer Division die Stellung hielten. Unter Androhung von Gewalt befahl er uns den Graben sofort zu verlassen und am
Gegenangriff teilzunehmen. Wir sprangen über den Stacheldraht, duckten uns aber sofort im nächsten Graben damit das
mörderische Maschinengewehrfeuer uns nicht hinwegfegte.
Dort blieben wir bis zum Eintritt der Dunkelheit liegen. Wir konnten unsere Waffen nicht mehr einsetzen weil der Sand
die Gewehrschlösser blockiert hatte. Als es Nacht wurde herrschte ein gespenstische Stille. Wir krochen aus dem
Schützengraben und lauschten nach irgendeinem Lebenszeichen von anderen Kameraden. Dann hörten wir irgendwelche Laute
die wir nicht genau zuordnen konnten. Sie kamen aus einem Holzbunker ganz in der Nähe. Wir näherten uns ganz
vorsichtig, als plötzlich eine Schar österreichischer Soldaten herausstürmte. An unseren Stahlhelmen erkannten sie
dass wir Deutsche sind. Bald danach trafen wir auch auf 69 deutsche Soldaten die zu unserer Division gehörten. Dann
kam ein Hauptmann der uns mit Vorwürfen überschüttete, wir seien Feiglinge, wir hätten uns von unserer Einheit entfernt.
Wir haben ihm den Vorgang geschildert, aber ließ nicht mit sich reden und sagte nur dass wir bestraft werden und nichts
zu essen bekommen. Wir wurden einer Maschinengewehr Einheit zugeteilt welche die vorderste Stellung verteidigen
musste. Wir hatten einen Stollen mit 2 Ausgängen.
Die Russen haben bemerkt das sich etwas bewegte und haben uns unverzüglich mit Artilleriefeuer belegt. Schon die
dritte Granate war ein Volltreffer. Vier Kameraden waren sofort tot, ich bekam mit einem Stollenbrett in den Rücken
der sofort blau und grün angelaufen war. Ich schaute nach oben, alles war verschüttet. Ich wusste nicht das da noch
ein Ausgang war, doch die Kameraden die hier in Stellung waren haben mir geholfen das Freie zu erreichen. Ich habe
mich am nächsten Tag krank gemeldet, dachte 2 Tage Schonung zu bekommen, aber der Sanitäter hat mir nur den Rücken mit
Spiritus eingerieben und mich wieder, zurück zu unserer Kompanie geschickt. Sie bestand nur noch aus 3 Gruppen, die in
einem Stollen, der in einen Berg gehauen war, Stellung bezogen hatten. Wir konnten uns hier wenigstens waschen, an
einer Quelle die aus dem Felsen sprudelte. Wir waren nicht mehr einsatzfähig und mussten durch andere Truppenteile
verstärkt werden.
Beim Essen holen musste man auch das Gewehr bei sich haben, es wurde erzählt dass hier der braune Bär herumwandert.
Ich habe keinen gesehen, nur das die Toten ausgescharrt wurden und verstümmelt herumlagen. Nach einigen Wochen haben
die Deutschen eine Gegenoffensive gestartet, von den Bergen herunter, über den Fluss Zlota Lipa, bis zu einer Stadt
die Brzezany hieß. 2 Tage später wurden wir auch eingesetzt, bei großer Hitze ging es in Dauermärschen vorwärts, man
durfte aus den Flüssen kein Wasser trinken, weil es mit Petroleum verseucht war. Nur wenn es dunkel wurde machten wir
halt, dann mussten wir Gräben ausheben um vor Überraschungen sicher zu sein.
Links von uns war Tarnopol und rechts Rumänien. Wenn es nach einer Ruhepause wieder losging dann war es am schlimmsten,
man ging wie auf Nägel, weil die Füße die Strapazen nicht so ohne weiteres wegsteckten. Im Dorf wurde niemals Rast
gemacht, denn da waren immer Brunnen, zu denen alle hinstürmten. Später wurden Melder vorausgeschickt, die von den
Dorfbewohnern Wasser in Eimern am Weg raussetzen ließen, damit die Soldaten Ihren Durst löschen konnten. Ein Soldat hat
gleich den ganzen Eimer mitgenommen und ihn dann als er leer war, irgendwo am Wegrand stehen lassen. Der Kompanieführer
kam angeritten, hat ihn ausgeschimpft und gedroht, ihn mit 3 Tagen Arrest zu bestrafen. Wir gehörten zur Südarmee
welche von Graf Bothmer befehligt wurde.
Die Stellungen waren schlecht ausgebaut, abends mussten wir, von der 2 Kilometer hinter der Front liegenden Feldküche,
Essen und andren Proviant holen. Ich war der Jüngste der Gruppe, musste immer 9 Kochgeschirre tragen, Brot und Post
habe ich in 2 Sandsäcke, die ich über der Schulter hängen hatte, verstaut. Wenn wir unterwegs waren wurde der
Laufgraben immer beschossen. Einmal schlug eine Granate am Schützengrabenrand ein und hat mich halb verschütte, die
Kochgeschirre aus den Händen gerissen, so dass ich ohne Verpflegung im vorderen Graben ankam. Nach drei Wochen sollten
wir abgelöst werden Es hat jeden Tag geregnet, wir haben unsere Mäntel angezogen und uns mit Zelten bedeckt. Nach dem
wir abgelöst wurden kamen wir in ein Dorf dass von Juden bewohnt war. Die Bewohner waren froh dass wir keine Kosaken
waren, mit denen hatten sie vor ein par Tagen schon schlechte Erfahrung gemacht, die hatten ihnen beim Abzug Vieh und
Pferde weggenommen.
Der Boden war sehr fruchtbar, es wurden Hanf, Weizen, Hafer, Mais, Bohnen, Roggen und Kartoffeln angebaut. Die
Bewohner waren gerade mit der Ernte beschäftigt. Die Häuser waren nur aus Holz und Stroh erbaut. Die Leute lebten in
sehr ärmlichen Verhältnissen. Ich hatte mir in unserer Kantine für 20 Pfennig ein Taschenmesser gekauft, das hat mir
ein Bauer für 6 Eier und 2 Pfund Brot abgekauft, daraus hat er sich dann ein Rasiermesser geschliffen. Wenn unser
Versorgungstross auf denn holperigen Wegen nicht nachkam, haben im Dorf auch Verpflegung eingekauft. Die Leute hatten
Angst dass wir nicht bezahlen werden, doch wir bekamen meistens pünktlich unseren Wehrsold ausgezahlt und konnten uns
so manches genehmigen. Um unser Marschgepäck zu erleichtern haben wir so manches aus dem Tornister weg geworfen.
Unweit eines Dorfes wurde halt gemacht, wir sollten Zelte aufschlagen, doch niemand hatte mehr Zeltstöcke im Tornister,
alles war unterwegs liegen geblieben. Der Zugführer befahl uns ins Dorf zugehen und Stöcke zu besorgen. In einer
Scheune stießen wir auf eine Hühnerschar, mit den Stöcken haben wir einige Hühner erlegt, in einem Hanffeld gerupft
und dann im Eiltempo zurück zu unserer Truppe. Als wir ankamen war die Kompanie schon marschbereit, es gleich weiter,
mit dem Huhn im Tornister. Bei der nächsten Rast haben wir die Hühner ausgenommen und Holz besorgt um sie zu kochen,
doch wir mussten schnell wieder weiter marschieren und erst nach 2 Tagen konnten wir uns mit den Hühnern befassen,
leider waren die so alt das sie nicht gar wurden. Das Fleisch mussten wir wegwerfen, nur die Suppe konnten wir noch
gebrauchen.
Meine Verwundung am Pruth.
Wir befanden uns 8 km vor der russischen Grenze. Der Kompanieführer hatte uns informiert das
wir hier zum Einsatz kommen. Wir bekamen noch ein Mittagessen aus der Gulaschkanone, konnten unsere Feldflaschen mit
Tee, der mit Rum angereichert war, auffüllen, Munition und Handgranaten in Empfang nehmen und dann ging es zum Einsatz.
Um 3 Uhr begann das ganze Bataillon auszuschwärmen, sofort hat uns der Russen entdeckt und begann uns mit Artillerie
zu beschießen, je weiter wir vorrückten desto heftiger.
Bis zu einem Eisenbahndamm hatten wir gute Deckung, doch wir sollten den dahinter fließenden Fluss überqueren. Doch
plötzlich explodierte über meinem Kopf eine Schrapnellkugel, der Stahlhelm wurde mir vom Kopf gerissen, Tornister und
Koppel flogen auch weg, ich lag auf der Erde und wusste gar nicht was passiert war. Plötzlich fing Blut aus der
Kreuzbeingegend zu rieseln, aus dem rechten Oberschenkel auch. Gleich nebenan war ein Granattrichter, dort habe ich
Schutz gesucht. In der rechten Rockecke hatte man immer ein großes Verbandspäckchen, das habe ich herausgenommen und
auf die Wunde gedrückt, doch das Blut floss mir bis in den Stiefel. Links und rechts von mir schlugen Granaten ein,
dicke Erdbrocken und Schlamm fielen auf mich herab, doch in meinem Erdloch war ich vor Maschinengewehrsalven geschützt.
Der ganze Rücken war angeschwollen und ich konnte mich überhaupt nicht bewegen.
Die Deutschen mussten die Stellung den Russen überlassen, einer hatte mich entdeckt, da ich aber so blutverschmiert da
lag, hat er bestimmt gemeint ich wäre nicht mehr am leben und ist weitergegangen. Nach zwei Stunden habe ich gehört
das die Russen sich wieder zurückzogen, danach herrschte eine gespenstische Stille. Als es dunkel wurde kamen deutsche
Sanitäter mit Spürhunden und haben die Verwundeten aufgesammelt. Ich wurde auf eine Trage gelegt, lag gebeugt und
konnte mich nicht rühren weil der blutverschmierte Rücken völlig verkrustet war. Ein Pferdegespann konnte nur vier
Tragen befördern, die Fahrt über Ackerfurchen war eine Tortur, ich habe nicht geglaubt das ich es überleben werde. In
einer Dorfkirche wurden wir dann ausgeladen und zu den etwa 50 Verwundeten gelegt die da schon lagen.
Mich haben sie zu den Bauchschüssen gelegt, weil ich einen Nervenschock hatte und am ganzen Körper gezittert habe. Zu
trinken bekam ich nichts, nur einen feuchten Lappen in den Mund. Ich sollte gleich operiert werden, aber es kamen
immer mehr Verwundete, so bekam ich nur eine Tetanusspritze, wurde verbunden und für den Weitertransport ins Hinterland
vorbereitet. Im Morgengrauen wurden wir auf Lastautos verladen, die aus auf ein Landgut brachten, wo wir in einem
Pferdestall untergebracht wurden. Die Fahrer fuhren so schnell über die Granatlöcher, das wir vor Schmerzen geschrieen
haben. Wir baten sie langsamer zu fahren, aber die bekamen es in ihrem Führerhaus nicht mit, erst alt ein Verwundeter,
der einen Krückstock bei sich hatte von hinten die Scheibe einschlug wurde die Fahrt erträglich. Lastautos, die
Munition und Verpflegung an die Front transportiert hatten, brachten in den nächsten Tagen immer wieder Verwundete
ins Hinterland. Die Deutschen hatten an diesem Fronabschnitt hohe Verluste zu beklagen. Wir können von Glück reden
dass wir dem Höllenfeuer überhaupt entkommen sind.
Wir wurden mit Lastautos, die ein Feldlazarett uns geschickt hatte, bis nach Lemberg befördert. da wurden wir gewaschen,
rasiert und frisch verbunden. Auf einem Nebengleis stand ein Lazarettzug, in dem wurden wir anschließend in frisch
bezogenen Betten untergebracht. Der Zug brachte uns über Annaberg nach Freiburg in Sachsen, eine Stunde hinter Dresden.
Hier wurden wir auf Tragen gebettet und mit einem Möbelwagen in ein Reservelazarett transportiert.
Im Heimatlazarett.
Als ich am nächsten Tag aufwachte und das schöne Bett sah in dem ich lag, dachte ich dass ich
im Himmel bin. Ich dankte meinem Herrgott das er mich bis zu diesem Ort begleitet hat. Am Nachmittag kamen Schulkinder
mit Geschenken und haben uns schöne Lieder vorgesungen. Anhand von Röntgenaufnahmen wurde in den nächsten Tagen
festgestellt dass bei mir ein Schrapnellsplitter an der Wirbelsäule in die Kreuzbeingegend eingedrungen war. Ich wurde
jeden Tag in Salzwasser gebadet und bekam wieder volle Verpflegung, da mein Magen zum Glück nicht verletzt war. Auf
dem Transport bekam ich nur Suppe und bei Bedarf einen feuchten Lappen auf die Lippen. Ich bin von 62 auf 43 Kilogramm
abgemagert, gehen konnte ich wegen dem Nervenschock den ich bei der Verwundung erlitten hatte auch noch nicht. Die
Wunde am rechten Oberschenkel war nur ein Streifschuss und wurde mit einem Schutzverband versorgt.
In den nächsten Tagen habe ich einen Brief nach Hause geschrieben und mitgeteilt wo ich mich zurzeit befinde. Meine
Eltern schickten mir ein Paket mit Lebensmitteln, jetzt konnte ich essen was ich wollte. Das Essen im Lazarett war
nicht besonders, jeden Tag nur Kohlblätter. Der weg zu den Toiletten führte durch einen Gemüsegarten. Die gehfähigen
Kameraden haben den ganzen Kohlrabi aufgegessen, so dass schließlich Wachposten aufgestellt werden mussten. Sechs
Wochen lang konnte ich mich nur auf allen Vieren fortbewegen, denn sobald ich mich aufrichtete wurde es mir
schwindelig und ich musste zurück ins Bett.
Als ich wieder bei Kräften war habe ich meinen Eltern mitgeteilt das ich mich in ein Lazarett in ihrer Nähe verlegen
lassen will. Der Chefarzt hatte mir zugesichert, wenn die Möglichkeit besteht in Ortelsburg unterzukommen, wird er dem
zustimmen. Meine Mutter hat daraufhin, in Ortelsburg, beim Lazarettinspektor Zantopf nachgefragt und er hat angedeutet
das sie mich aufnehmen können. Daraufhin bekam ich die Krankenpapiere und einen Fahrschein nach Ortelsburg. Da ich als
Soldat nie Heimaturlaub hatte, beschloss ich zuerst meine Eltern zu besuchen. Ich fühlte mich noch sehr schwach, habe
nach jedem Kilometer Rast gemacht, aber letztendlich war ich wieder daheim bei meinen Eltern. Die Wiedersehensfreude
war sehr groß. Ich bin am 30 Juli verwundet worden und am gleichen Tag wurde mein ältester Bruder beerdigt. Er bekam
den Splitter einer Gasgranate ins rechte Bein und ist an einer Blutvergiftung verstorben.
Am nächsten Tag brachte mich mein Vater ins Garnisonslazarett nach Ortelsburg. Ich wurde jeden Tag gebadet und massiert,
weil die Rückenhaut am Knochen angewachsen war konnte ich mich nicht schmerzfrei bücken. In Ortelsburg verbrachte ich
noch sechs Wochen, bis Ende Oktober, da wurde es schon ziemlich kalt und in unserer Barackenunterkunft ziemlich
ungemütlich. Kohlen und anderes Brennmaterial lagen im Hof auf Halde, aber es war verboten zu heizen. Kameraden die in
der Nähe zu Hause waren konnten Sonntagsurlaub beantragen.
Einer von ihnen brachte von zuhause Brennholz mit und entzündete damit im Ofen ein wärmendes Feuer, andere holten vom
Hof Kohlen, so dass der Ofen in kurzer Zeit glühend heiß wurde und die Gefahr bestand das die Betten Feuer fangen
würden. Wir hatten die Betten schon weg gerückt, da kam der Feldwebel herein und fragte wer das Feuer im Ofen
angezündet hat, doch niemand fühlte sich angesprochen. Der Feldwebel hatte den Vorfall dem Stabsarzt gemeldet, als der
am nächsten Morgen zur Visite kam, war seine erste Frage: ”Wer hat gestern Abend das Feuer im Ofen angezündet”. Als
sich niemand meldete, schrie er uns an: ”Morgen wird alles entlassen, zum Ersatzbatallion, in Diez an der Lahn! Wer
gehen kann, sofort zur Schreibstube, Krankenpapiere und Fahrscheine abholen”. Er erinnerte uns noch daran am nächsten
Tag pünktlich am Bahnhof zu sein, weil eine Verspätung unangenehme Folgen für uns haben würde. Das war das Ende der
schönen Erholungsphase. Ich blieb noch eine Nacht zu Hause und bin dann am nächsten Tag von dort zum Bahnhof gegangen.
Wieder Kriegsverwendungsfähig.
Als wir am nächsten Tag in Diez angekommen waren, wurde ich gefragt ob ich aus dem Heimaturlaub
käme, als ich das verneinte wurden mir 2 Tage genehmigt und 14 Tage Genesungsurlaub dazu. Wieder zurück im
Ersatzbatallion bestand unsere Tätigkeit aus Wache schieben und Kartoffel schälen. Nach einem Monat wurden wir von
einem Generalarzt untersucht, er hat mich für nicht einsatzfähig befunden weil ich noch den Steckschuss im Rücken
hatte und das linke Bein 10 Zentimeter dünner war. Jetzt fing das Kasernenleben wieder von vorne an. Wachdienst,
Gewehr laden, sichern, Ehrenbezeugung, Einzelmarsch und Appell. Wer nicht weit nach Hause hatte bekam zu Weihnachten
Urlaub. Ich hatte zu Heiligabend und Silvester Torwache, denn nach Ostpreußen wurde niemand beurlaubt.
Nach Neujahr 1918 wurden wir neu eingekleidet und kamen nach Köln zur Baukompanie. Mit Musik wurden wir zum Bahnhof
gebracht. In Köln wurden wir noch mit Soldaten die von andern Truppenteilen dorthin verlegt wurden in einem großen
Kinosaal, im Stadtteil Edengarten untergebracht. Wir brauchten keinen Dienst zu machen und konnten zu Heilige Drei
Könige den Gottesdienst im Dom besuchen. Kameraden die aus irgendwelchen Gründen im Arrest saßen wurden gefragt ob sie
auch am Gottesdienst teilnehmen möchten, dann würde ihnen die Strafe erlassen. Fast alle haben dem zugestimmt. Einige
Tage später wurden wir wieder auf einen Transportzug verladen, der uns über Herbestal, Antwerpen nach Brügge in Belgien
brachte. Hier mussten wir den Zug kurzfristig verlassen und einen Luftschutzkeller aufsuchen, weil Fliegeralarm
gemeldet wurde. Danach ging es wieder weiter nach Turut, Kortemark, Hauseme, Kautremollen, Zaren, Zarenlinde. Dort
wurden wir in verschiedene Gruppen aufgeteilt und einer Pionierkompanie auf dem Pionierpark Struwendorf zugewiesen.
Wir haben hinter Klerken Bunker für schwere Maschinengewehre gebaut. Unsere Arbeit konnten wir nur bei Nebel verrichten,
denn bei Sonnenschein waren wir sofort dem Beschuss der feindlichen Artillerie ausgesetzt. eine Kleinbahn die Munition
und Stacheldraht an die Front brachte war dem Beschuss besonders ausgesetzt. Die Gleise, von schweren Geschossen
zerfetzt, mussten immer wieder hergerichtet werden, damit der Nachschub aufrechterhalten werden konnte. Später haben
wir am Kemelberg bei Armentier, eine Brücke über die Lys gebaut. Um in dem Sumpfgelände einen Untergrund dafür zu
schaffen, mussten wir 10 bis 12 Meter lange Pfähle in den Boden rammen. Ein Feldwebel gab immer den Befehl: „Hoch den
Bär, noch viel mehr, dass man sieht, wie er zieht, denn dieser Pfahl, glatt wie ein Aal, durch Fels und Stein, durch
Wasser und Sand, fürs Vaterland”. Jedes mal mussten wir den Bär an Schnüren hochziehen und dann wieder herunterlassen.
Wenn es manchmal, trotz vieler Mühe nicht mehr weiter ging wurde der Pfahl auf eine bestimmte Länge abgeschnitten.
Nach Fertigstellung der Brücke kamen wir in die Siegfriedstellung bei Kambrei, zum Bau eines Bataillons-Gefechtstandes.
Da der Boden kreidehaltig war, mussten wir die großen Stücke von Hand zu Hand reichen, den Schutt haben wir dann mit
Sandsäcken aus der Baugrube gehoben und mit Ästen getarnt, damit der Stand nicht von feindlichen Fliegern entdeckt
werden konnte. Alle acht Stunden wechselte die Arbeitsgruppe. Wir mussten von der Baustelle durch das Gelände robben,
denn aufrecht gehend war man dem Beschuss der feindlichen Scharfschützen ausgesetzt, die von einem Fesselballon aus
informiert wurden der über den feindlichen Linien stand.
Der Wechsel war mit einem großen Risiko verbunden, und wurde wenn Möglich bei Dunkelheit vollzogen. Um vor
Überraschungen sicher zu sein haben wir spanische Reiter (Stacheldrahtverhaue) gebaut und vor die ersten Gräben
gestellt, die dann oft in der Nacht von den Franzosen geklaut, und dann vor ihren eigenen Linien wieder aufbaut wurden.
Wir hatten aus Bohlen eine Brücke auf Rädern gebaut, die dann in den Graben geschoben wurde, damit die Artillerie und
andere Fahrzeuge über die Schützengräben kamen. Weil um vier Uhr morgens der Beschuss mit Gasgranaten begann, mussten
wir Gasmasken aufsetzen, danach haben feindliche Flieger unsere Munitionskolonne bombardiert und total aufgerieben.
Es wurde auch eine Marinedivision eingesetzt, die bis dahin dem Küstenschutz gedient hatte und jetzt ihren ersten
Einsatz hatte.
Wir sind zuerst ein ganzes Stück in Richtung Amiens vorangekommen, doch dann blieb unser Angriff in den zuvor von
Engländern besetzten Stellungen, stecken. Da die Engländer ihre Stellungen fluchtartig verlassen hatten, fiel ihr
ganzer Proviant in unsere Hände; Schokolade, Weißbrot, Flaschenwein. Die erste Nacht haben wir in einem runden Zelt
verbracht, weil ich mir durch den starken Wind, der da herrschte eine Angina zugezogen hatte, die mit hohem Fieber
verbunden war, konnte ich die vielen Köstlichkeiten überhaupt nicht genießen.
An eine ärztliche Versorgung war überhaupt nicht zu denken, denn es mussten zuerst die vielen Granatlöcher eingeebnet
werden damit die vielen Fahrzeuge und Geschütze wieder weiter fahren konnten. Auch eine Bahnlinie musste repariert
werden, damit die großen Geschütze in Stellung gebracht werden konnten, dabei wurden auch die vielen Kriegsgefangenen,
die bei dieser Offensive gemacht wurden, eingesetzt. Als die Offensive dann schließlich scheiterte, wurden wir an die
Somme verlegt. Da habe ich die Ortelsburger Jäger, die aus Italien an die Westfront verlegt wurden, zum ersten Mal im
Einsatz gesehen.
Unser nächster Einsatzort waren dann Stellungen hinter Laon. Hier wurden die Vorbereitungen zu einer neuen Offensive
getroffen. Feindliche Flieger versuchten uns Tag und Nacht daran zu hindern die Aufmarschwege instand zu halten. Als
die Offensive dann endlich losging, hatten wir die Order eine Brücke über die Oise mit Bohlen und Balken zu verstärken.
Gleich am Anfang der Offensive mussten wir Gasmasken anlegen, um für alle Fälle gewappnet zu sein. Nur die Artillerie
und Kraftfahrzeuge durften die Landstraße benutzen, die Infanterie ging immer im Straßengraben und wurde von einer
Seite von Kopf bis Fuß mit Dreck bespritzt. Die Franzosen und Engländer haben hier schon Panzer eingesetzt, die von
Truppen aus den Kolonien gefahren wurden. Die Australier gingen mit umgekrempelten Ärmeln hinter den Panzern her.
Die letzte Offensive des Ersten Weltkrieges.
Zum Jahresende 1917 hatten noch 153 deutsche 175 alliierten Divisionen gegenübergestanden.
Zur Vorbereitung der Offensive ließ Ludendorff 39 Divisionen aus dem Osten und aus Italien heranziehen. Er ließ
spezielle Angriffsdivisionen formieren, die durch intensive Ausbildung auf den beabsichtigten, schnellen Vormarsch
vorbereitet wurden. 6608 Geschütze, 3500 Minenwerfer und 1070 Flugzeuge wurden hinter dem vorgesehenen
Angriffsabschnitt konzentriert. Den Ausbildungsbefehlen Ludendorffs, die bis zu den Kompanieführern herab verteilt
wurden, konnte man entnehmen, dass der Versuch, den Krieg mit einem mächtigen Schlag zu entscheiden schon in der
nächsten Zeit gewagt werden sollte. Wir übten die fast vergessenen Formen des Schützengefechts und des
Bewegungskrieges, auch wurde eifrig mit Gewehr und Maschinengewehr geschossen. Wir hegten keinen Zweifel daran, dass
der große Plan gelingen würde.
Den ganzen Winter 1917/18 über plante der Generalquartiermeister Ludendorff die deutsche Offensive. Zwar hatten die
Vereinigten Staaten von Amerika dem Deutschen Reich am 6. April 1917 den Krieg erklärt, aber vor dem Sommer des
Jahres 1918 war mit dem Auftreten von US-Truppen in relevanter Größenordnung nicht zu rechnen. Der deutschen Führung
blieb nur ein schmales Zeitfenster, um die Niederlage und den zu erwartenden Diktatfrieden abzuwenden. Ypern,
Armentieres, Arras, Cambrai oder Verdun wurden ernsthaft als Schauplätze erwogen. Ludendorf entschied sich für einen
Angriff zwischen Cambrai und La Fere – genau an der Nahtstelle zwischen der Französischen Armee und dem britischen
Expeditionscorps.
Der Fluss Somme bildete die Grenze zwischen Franzosen und Briten. Die Briten – nicht die Franzosen – sollten das Ziel
des Vorstoßes werden. Ihre Stellungen waren nur 130 Kilometer von der Kanalküste entfernt. Beim erreichen der
Sommemündung wäre die gesamte britische Armee eingeschlossen gewesen, denn hinter ihnen lag die Straße von Dover.
Am 21. März 1918 begann die letzte entscheidende Offensive des deutschen Westheeres im Ersten Weltkrieg. Der
Angriffsstreifen war 75 Kilometer breit. Dort hatte Ludendorff 43 Angriffsdivisionen konzentriert, dahinter 30
weitere Reservedivisionen, ihnen standen lediglich 26 britische Divisionen gegenüber. „Michael“ – so der Deckname der
„Kaiserschlacht“ – lief dank Ludendorffs akribischer Vorbereitung gut an. Der britische Oberbefehlshaber General
Douglas Haig erkannte die Chance, welche die Deutschen in dieser Situation hatten. Wollten die Deutschen diese Chance
nutzen, mussten sie darauf verzichten die Somme zu überschreiten, wo sie auf die französischen Reserven treffen und
sich von der Küste entfernen würden. Genau diesen Fehler begingen jedoch die Deutschen.
Am dritten Tag überschritt der linke Flügel mit der 18. Armee die Somme. Ludendorf stellte die Taktik über die
Strategie, wie er das bei Tannenberg und der Schlacht an den Masurischen Seen auch schon getan hatte. Ludendorffs
Befehl an die 18. Armee vom Abend des 22. März 1918 lautete: „Jetzt gilt es den Sieg auszunutzen, den Feind nicht zum
Stehen kommen zu lassen, Somme und Crozat-Kanal zu überschreiten, bevor feindliche Verstärkungen wirksam werden“.
Was Haig befürchtet hatte, trat nicht ein. Die deutsche Offensive Lief weiter Richtung Süden und lief sich schließlich
tot. Am 31 März war Ludendorff zu der Erkenntnis gekommen, dass „Michael“ gescheitert war. Am 5. April wurde die
Einstellung der Offensive befohlen. Im Hochsommer waren die US-Truppen in Frankreich angekommen und gingen mit den
Franzosen zum Angriff vor. Nur mühsam konnten Hindenburg und Ludendorf den Zusammenhalt der Front waren. Am 24. Oktober
1918 forderte US-Präsident Woodrow Wilson die bedingungslose Kapitulation, am 11.Nuvember Wurde der Waffenstillstand
von Compiegne unterzeichnet.
Zusammenbruch der Westfront und Waffenstillstand .
Als die Offensive dann letztendlich gescheitert war, wurden wir auf Eisenbahnwaggon verladen, in
eine Stellung vor Verdun gebracht und der siebenten bayerischen Division zugeteilt. Als wir ausgeladen wurden nahm der
Franzose den Bahnhof unter Beschuss. Eine Granate traf einen Waggon der mit Seifenpulver beladen war, so dass der ganze
Bahnhof aussah als wäre gerade Neuschnee gefallen. Wir gingen auf die Suche nach Kartoffeln. Als ich mit einem Sack,
vollbeladen die Böschung runter ging um zur Feldküche zu gelangen, schlug unweit von mir eine Granate ein und riss mir
den Sack vom Rücken. Ich bin mit dem Schrecken davon gekommen, mir war nichts passiert.
Der Bahnhof war menschenleer, nur ein par Kaninchen liefen verschreckt durch die Gegend und einigen Kameraden gelang
es welche einzufangen. Am nächsten Tag gelang es uns endlich die Feldküche zu erreichen. Als wir gerade beim Essen
fassen waren, schlug unweit eine Granate ein so dass Pflastersteine das Dach durchschlugen und wir das Weite suchen
mussten. und wir wieder nichts zu Essen bekamen. Ein Friseur aus unserer Kompanie fuhr immer ins Hinterland um uns
mit Proviant zu versorgen. Als er 14 Tage vor dem Zusammenbruch wieder mal zurückkam erzählte er uns schon das der
Krieg nicht mehr lange dauern würde, weil Kaiser Wilhelm mit Frack und Zylinder bekleidet, Deutschland verlassen und
ins Ausland gehen würde. In unserer Einheit hatten wir auch einen Juden der glaubte dass er sich alles erlauben darf.
Eines Morgens ging er in die Küche, als er keinen Koch vorfand stieg er auf die Gulaschkanone und hob den Deckel vom
Kessel in dem der Kaffee kochte an. Der kochende Kaffee verbrühte seine Füße so sehr das er sofort ins Lazarett musste,
für ihn war der Krieg somit zuende. Es kam noch ein Erlass, das Kameraden die 2 Jahre aktiv gedient hatten und
Gefreiter waren sofort zum Sergeanten befördert wurden. Für den 11. November 1918 war ein Waffenstillstand vereinbart
und ab 11 Uhr sollte nicht mehr geschossen werden. Wir hatten unsere Kopfkissen aufgetrennt und eine Kissenschlacht
veranstaltet, um auf diese Art und Weise unserer Freude Ausdruck zu verleihen. Als die Federn durch die Luft flogen
brachen wir in Tränen aus.
In jeder Kompanie wurde ein Soldatenrat gewählt, der aus drei Mann bestand. Wenn der Kompanieführer jemanden bestrafen
wollte, musste er erst den Soldatenrat fragen, der die Strafe befürworten, aber auch ablehnen konnte. Die Offiziere
durften keine Achselstücke mehr tragen, was für sie einer Degradierung gleich kam. Wir waren in einem Dorf
einquartiert und morgens zum Appell angetreten, als einer vom Soldatenrat sich stockbesoffen vor den auf dem Pferd
sitzenden Kompanieführer stellte und schrie: „Alles hört auf mein Kommando”. Der Kompaniechef war wie vom Blitz
getroffen, ihm versagte die Stimme. Wir sahen ein das dies nicht so weiter gehen kann und wählten einen neuen
Soldatenrat. Unser Rückzug begann bei Konflanz, einer Vorfestung von Metz und führte uns zunächst über die
luxemburgische Grenze, wo wir in einem Ort einquartiert wurden. Als wir für die Küche Holz aus dem Wald holen gingen,
entschieden wir uns eine Eiche abzusägen, ohne uns dessen bewusst zu sein, in welchem Forst wir uns befanden. Als wir
beim fällen waren fielen plötzlich Schüsse, die wir auch sofort erwiderten, bis uns ein Elsässer der sich in unserer
Kompanie befand aufklärte: „Kameraden, wir befinden uns hier auf Luxemburgischem Hoheitsgebiet”.
Wir sind dann weiter durch das Fürstentum Birkenfeld marschiert, wo das Städtchen Merzig für uns geflaggt hatte. Das
Elsass haben wir auch noch kurz gestreift. Wo wir bei einem Bauern, der uns kein Stroh für das Nachtlager geben wollte,
einquartiert wurden. Daraufhin gingen wir in die Scheune und haben uns selbst was besorgt. Wir haben dann noch erfahren,
sie hätten ein Schwein geschlachtet und warteten auf den Einzug der Franzosen. Als wir uns 1917, an der Ostfront, in
den in Karpaten, im Einsatz befanden, waren unter uns auch viele Elsässer. Sie durften ihre Heimatpost nicht in
französischer Sprache schreiben, mussten ihre Briefe offen auf der Schreibstube abgeben, wo sie zuerst kontrolliert
und dann abgeschickt wurden. Als ich in einer Nacht, mit einem Elsässer auf einem Vorposten Wache schieben musste,
wollte er mich überreden zum Russen überzulaufen. Als ich darauf nicht eingehen wollte verschwand er plötzlich in der
Dunkelheit und ich habe ihn nie wieder gesehen.
Wir sind dann weiter Richtung Worms und Ludwighafen gezogen, dort wurden wir bei einem Mühlenbesitzer einquartiert,
ein Unteroffizier und vier Mann. Obwohl wir verlaust und verdreckt waren bestand die Müllerin darauf das wir in ihren
Betten übernachteten. „Wenn alles durch ist”, sagte sie, „werde ich alles gründlich reinigen”. Der Müller brachte uns
eine Gießkanne voll Wein und sagte wir sollen es uns Schmecken lassen. Wir haben reichlich davon Gebrauch gemacht, so
dass ich gar nicht weiß wie ich ins Bett kam. Das war meine Erinnerung an die Pfalz. Manchmal waren wir auch 2 Tage im
Quartier.
Vor dem Weitemarsch wurde uns immer gesagt welche Truppe die Vorhut und welche Truppe die Nachhut übernehmen sollte.
Die Nachhut hielt immer Verbindung zu den nachrückenden Franzosen und man muss staunen wie alles reibungslos, ohne
Zwischenfälle von statten ging, was wir in erster Linie dem General-Feldmarschall Paul von Hindenburg zu verdanken
haben, der den Rückzug an der Westfront koordiniert hat.
In Köln angekommen, erhielten wir im Volkshaus unsere Entlassungspapiere, Eisenbahnfahrscheine, Reisepässe,
unterschrieben von Oberstleutnant Mann. Wir mussten Köln umgehend verlassen, weil schon am nächsten Tag die
französischen Besatzungstruppen in einmarschieren sollten. Wir fuhren mit einem Zug der bis Allenstein fuhr, dort
wurden unsere Papiere vom Soldatenrat kontrolliert. Die jüngren Jahrgänge wurden festgehalten, zu neuen Einheiten
zusammengestellt und zur Sicherung der Ostgrenze gegen die Bolschewisten abkommandiert. Ich hatte gesagt das ich noch
einen Schrapnellsplitter in der Kreuzbeingegend habe und durfte daraufhin nach Hause fahren.
Kaum in Ortelsburg angekommen fiel ich wieder dem Soldatenrat in die Hände. Sie haben alles durchsucht, haben mir mein
Seitengewehr und eine Decke abgenommen, aber ich durfte weiter und bin dann kurz vor Weihnachten 1918 auf dem
elterlichen Hof angekommen. Schon auf dem Hof habe ich meine Kleider vom Leib gerissen, weil vor Läusen und anderem
Ungeziefer nicht mehr aushalten konnte und mich erst gründlich gewaschen bevor ich das elterliche Haus betreten habe.
Die Freude über das Wiedersehen war sehr groß.
“ Unser Leben zwischen den beiden Weltkriegen.”
Endlich wieder zurück in der Heimat
Rohmanen war durch die Kampfhandlungen 1914/15 zu einem drittel zerstört worden, aber schon
wieder im Aufbau. Die Firma Grzella aus Ortelsburg hatte die Bauarbeiten übernommen. Unter der Aufsicht von Polier
Karl Kontor wurden die Dachstühle errichtet. Ich habe mich, nach kurzer Erholungspause, auch als Zimmermanngehilfe am
Wiederaufbau beteiligt. Die Firma Grzella hat das Material geliefert und auch unsere Löhne gezahlt. Wegen meinem
Steckschuss bin ich dem VDK beigetreten und habe mit dessen Hilfe eine Rente beantragt die mir auch bewilligt wurde.
Nach vier Jahren wurde ich nach Allenstein zur Nachuntersuchung vorgeladen. Die ärztliche Untersuchung hatte ergeben,
das Geschoß sei verkapselt, und nur das linke Bein etwas in Mitleidenschaft gezogen. Daraufhin wurde die Rentenzahlung
eingestellt.
Der Stellmacher Adam Ornowski war im Krieg als Sanitäter eingesetzt und hatte auf Grund seiner Erfahrungen,
 Beziehungen zum medizinischen Dienst in Ortelsburg aufgebaut. Es wurden dort Lehrgänge in Erster Hilfe angeboten,
die von Prof. Dr. Kutz geleitet wurden. Adam Ornowski hat dafür gesorgt das einige junge Männer aus Rohmanen daran
teilnehmen konnten. Adam Ornowski, August Linka, Emil Rosowski, Johann Dembek, Emil Baschek und ich sind dann dem
Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes beigetreten und mussten jeden Sonntag am Lehrgang teilnehmen. Unser
Gruppenführer war Kreisobersekretär Albrecht, Landrat von Poser, als unser Ehrenvorsitzender, hat viel zu unserer
finanziellen Unterstützung beigetragen und hat dafür gesorgt dass die Bereitschaft eingekleidet wurde.
Beziehungen zum medizinischen Dienst in Ortelsburg aufgebaut. Es wurden dort Lehrgänge in Erster Hilfe angeboten,
die von Prof. Dr. Kutz geleitet wurden. Adam Ornowski hat dafür gesorgt das einige junge Männer aus Rohmanen daran
teilnehmen konnten. Adam Ornowski, August Linka, Emil Rosowski, Johann Dembek, Emil Baschek und ich sind dann dem
Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes beigetreten und mussten jeden Sonntag am Lehrgang teilnehmen. Unser
Gruppenführer war Kreisobersekretär Albrecht, Landrat von Poser, als unser Ehrenvorsitzender, hat viel zu unserer
finanziellen Unterstützung beigetragen und hat dafür gesorgt dass die Bereitschaft eingekleidet wurde.
In jedem Dorf wurde eine Unfallstelle eingerichtet, mit einem Verbandskasten und mit Verbandsmaterial für die erste
Hilfe ausgerüstet. Die Unfallstelle in Rohmanen, die am Haus von der Straßenseite, durch eine Tafel mit einem roten
Kreuz gekennzeichnet war, hatte ich zu verantworten. An Sonntagen wurden wir an Badestellen und bei Fußballspielen
eingesetzt, haben viele Übungen bei Waldbränden durchgeführt und auch Ausflüge nach Rudzany am Niedersee gemacht. Bei
der Einweihung des Tannenbergdenkmals in der Nähe von Hohenstein kamen wir an Straßenkreuzungen zum Einsatz.
Rohmanen hatte auch eine freiwillige Feuerwehr. Bis zum ersten Weltkrieg hat Friedrich Biella als Brandmeister das
Kommando gehabt. Er war aktiver Unteroffizier, hatte gute Führungsqualitäten und die Männer, die allesamt aus dem
aktiven Militärdienst stammten hatten zu ihm ein großes Vertrauen. Nach dem Krieg wollten diese Männer,
(Friedrich Nickel, Friedrich Willam, Julius Wittkowski, Jakob Janowski, Johann Gloddek, Gustav Bednarz), nicht mehr
weitermachen. Friedrich Biella, der inzwischen zum Gemeindevorsteher gewählt wurde, hat sich dann auf einer
Gemeinderatsitzung vorgeschlagen, für die Freiwillige Feuerwehr jüngere Kräfte anzuwerben.
Zum Brandmeister hat er Herrn Wilhelm Pilath vorgeschlagen. Der wurde dann nach Königsberg zur Fortbildung geschickt.
Der Feuerwehr gehörten nun folgende Personen an: Wilhelm Pilath(Brandmeister), August Linka(Stellvertreter), Gustav
Deptolla, Julius Matzey, Johann Dembek, Willy Willam, Gustav Rattay. Der Kreisbrandmeister war Heinrich Thalmann aus
Ortelsburg, sein Stellvertreter war Kreisobersekretär Salzmann. Der Bezirks-Kommissar bei der Ostpreußischen
Feuersozität War Herr Ernst Trzaska. Er hat dafür gesorgt das die Wehr uniformiert und mit Löschgeräten ausgerüstet
wurde. Da die alten Schläuche schon sehr marode waren, wurden sie durch moderne ersetzt, deren Kupplungen auch mit der
Motorspritze übereinstimmten.
Ernst Trzaska hat bei der Feuersozität und beim Landratsamt Finanzmittel beantragt und auch genehmigt bekommen. Der
Schneidermeister Wilhelm Baran wurde beauftragt Tuch und Drillichanzüge nach Maas zu schneidern. Er hat uns
Stoffmuster vorgelegt aus denen wir wählen sollten. Feuerwehrhelme haben wir auch bekommen. Die Gemeinde musste
Finanzmittel bereitstellen, einen Prozentsatz vom Gemeindebudget. Im Brandfall mussten für den Spritzenwagen Pferde
zur Verfügung stehen, von Willy Willam, Gustav Rattay, Julius Matzey und Gustav Dorka, weil sie in der Nähe des
Spritzenhauses wohnten. Am Spritzenhaus wurde ein großer Baum mit Querleisten aufgestellt, wo nach jedem Brand oder
einer größeren Übung die Schläuche zum trocknen aufgehängt wurden.
Der Kreisbrandmeister hat mindestens 2-3-mal im Jahr die Wehren besichtigt. Das ganze Dorf war dann auf den Beinen,
die Bauern mit Pferden, und andere Dorfbewohner mit Eimern und Spaten, wurden dann in verschiedene Gruppen eingeteilt.
Erst hat die Wehr sämtliche Aufstellungen am Gerät geübt; Grundstellung Fahrstellung und Marschstellung. Dann wurde
ein Brand angekündigt, die Feuerwehr mit der Spritze an den Brunnen, die Gruppen dort wohin sie beordert wurden, die
Bauern brachten mit den Wasserkiwen Wasser aus dem Brunnen zum Brandort. Wenn das Wasser im Brunnen alle wurde hat
man den Saugkorb in die Kiewen gelegt und dort Wasser entnommen. Die Wassergruppe ging mit Eimern zum Dorfteich, holte
Wasser und füllte damit die leeren Kiewen.
Der Löschtrupp ging mit Feuerhaken und Löschpatschen auf die umliegenden Gehöfte und versuchte das vermeintliche Feuer
von ihnen fernzuhalten. Nach dem Alarm wurde wieder am Spritzenhaus angetreten. Die Gruppenführer mussten angeben ob
ihre Gruppe auch vollständig erschienen war, denn Übungen wurden nur vor, oder nach der Feldarbeit durchgeführt, so
dass niemand eine Entschuldigung vorbringen konnte. Wer ohne begründete Entschuldigung nicht anwesend war erhielt eine
Verwarnung. Der Kreisbrandmeister erklärte dann welche Handgriffe den Vorschriften entsprachen und welche nicht. Die
Schläuche wurden noch schnell zum Trocknen aufgehängt. Anschließend gingen wir alle in den Gasthof Trzaska, haben über
vorhandene Mängel diskutiert, Verbesserungsvorschläge unterbreitet und zwischendurch den Durst gelöscht. Der
Kreisbrandmeister ist dann, nach einer kurzen Verabschiedung, ins nächste Dorf gefahren, weil er an einem Tag mehrere
Feuerwehren betreuen musste.
Der Rohmaner Dorffriedhof

Einen Kilometer vom Ende des Dorfes entfernt, auf der rechten Seite der Landstraße in Richtung
Ortelsburg, befand sich der Rohmaner Dorffriedhof. Wann dieser Friedhof angelegt wurde entzieht sich meiner Kenntnis.
Nach Aussagen älterer Dorfbewohner soll davor auch schon eine Ruhestätte vorhanden gewesen sein, und
zwar auf der linken Straßenseite gegenüber dem jetzigen Friedhof. An dieser Stelle befand sich bis in die
Nachkriegszeit ein kleiner Brunnen, aus dem die Dorfbewohner, das Wasser zum begießen der Grabbepflanzung auf den
Gräbern ihrer verstorbenen Angehörigen holten. Der Friedhof war in einer Hanglage angelegt, wahrscheinlich weil diese
Parzelle für eine landwirtschaftliche Nutzung nicht geeignet war. Um das Gräberfeld vor herumstreunenden Tieren oder
von der Weide entlaufenen Kühen zu schützen, hat man das ganze Gelände mit einem Holzzaun umgeben. Der Zugang befand
sich von der Straßenseite. Unter einem Torbogen hindurch wurden die Verstorbenen zu Grabe getragen. Die Gräber der
einzelnen Familien waren nebeneinander angelegt, mache, wie zum Beispiel die der Familie Trzaska, sogar mit einem
schmiedeeisernen Zaun eingefasst.
Nach dem 2. Weltkrieg verfiel der Friedhof immer mehr. Die nötigen Finanzmittel für die Pflege der Einfriedung konnten
von den restlichen noch verbliebenen Deutschen nicht mehr aufgebracht werden. An den gepflegten Gräbern konnte man noch
erkennen dass es Verwandte von noch in Rohmanen wohnenden Deutschen waren, oder von bereits im Westen Deutschlands
lebenden, die ihre noch in Rohmanen wohnenden Nachbarn damit beauftragt hatten. Die übrigen Gräber wurden von Jahr zu
Jahr immer mehr von Wildkräutern überwuchert und schließlich auch von Sträuchern und schnell wachsenden Bäumen.
In den späteren Jahren konnte man nicht mehr erkennen dass dort vor Jahren Tote zur letzten Ruhe gebettet wurden. Die
Natur holte sich das ganze Gelände zurück und nur unter großen Schwierigkeiten konnten Besucher aus dem Westen das
Friedhofsgelände noch betreten.
Das Gasthaus Trzaska

Nach dem ersten Weltkrieg hat der Gastwirt Friedrich Trzaska neben dem Gasthof einen großen Saal
für Festlichkeiten und Vereinsfeiern gebaut, in dem schon mal Feuerwehrfeste veranstaltet wurden. Ernst Trzaska war
Feuerkommissar bei der Ostpreußischen Feuersozität. Erich Trzaska war Vollziehungsbeamter beim Amtsgericht in
Ortelsburg. Unser Feuerkommissar war uns beim organisieren der Veranstaltungen sehr behilflich, hat uns den Saal, die
Musik und die Theaterstücke besorgt und die Feuerwehren aus den Nachbardörfern eingeladen.
Zu Manöverzeiten, vor dem 2. Weltkrieg und dann auch während des Krieges, waren im Gasthof Soldaten, meist im Range
eines Offiziers, einquartiert. Fräulein Mariechen Trzaska hat die Poststelle im Dorf betreut. Nachdem ich 1939 zum
Militär eingezogen wurde, hat sie, nach einer Schulung im Ortelsburger Krankenhaus, auch die Unfallmeldestelle
übernommen. Nach dem Krieg, pflegte sie mit vielen Bekannten, die bereits in der Bundesrepublik wohnten, einen regen
Briefwechsel. Auf dem Rohmaner Friedhof hat sie viele Gräber, im Auftrag von Angehörigen, die auf Grund ihrer
Abwesenheit, dazu nicht mehr in der Lage waren, gepflegt. Der Bauunternehmer Kurnitzki aus Ortelsburg, äußerte die
Bitte, sie möchte ihm doch ein Blatt vom Rosenstrauch, der auf dem Grab seiner Eltern steht, in den Brief legen. Als
sie uns den Brief vorgelesen hat, waren wir zu Tränen Gerührt. Sie hat als Letzte aus ihrer Familie, bis zu ihrem Tod
im Jahre 1960, in Rohmanen, im Gebäude der Gastwirtschaft gewohnt und ist auf dem Rohmaner Friedhof beerdigt worden.
Fleisch und Wurstwaren Karl Pelkowski
Im Jahr 1931 hat der Fleischermeister Karl Pelkowski, aus Grammen, direkt neben unserem Hof ein
Anwesen gekauft und dort eine Fleischerei eingerichtet. Er war mit meiner Schwester Frieda, verheiratet. Am Anfang hat
er die Schweine noch auf seinem Hof geschlachtet, später dann im Ortelsburger Schlachthof. Jede Woche fuhr er 2-mal,
mit dem Pferdewagen(Einspänner), nach Ortelsburg zum Wochenmarkt, wo er seine Fleisch und Wurstwaren zu Verkauf anbot.
Am Tag davor, wenn er die Wurst gekocht hat, kamen viele Rohmaner mit Kannen oder anderen Gefäßen, wegen der guten
Wurstsuppe, die er umsonst unter die Leute verteilte. Als Karl Pelkowski, Ende August 1939 zum Militär eingezogen
wurde, hat seine Frau das Pferd verkauft und den Beitrieb stillgelegt. Am Haus hing, immer noch die Tafel mit der
Aufschrift: Karl Pelkowski, Fleisch und Wurstwaren. Ein Witzbold hat irgendwann darunter geschrieben; „Fleisch und
Wurst waren einmal”, drauf hin hat Frau Pelkowski die Tafel entfernen lassen. Karl Pelkowski ist im Mai 1946 in
französischer Gefangenschaft verstorben. Seine Ehefrau Frieda, verstarb an ihrem 85. Geburtstag in Mettmann bei
Düsseldorf.
Die steinreichen Rohmaner Felder
Die letzte Eiszeit hat bei der Schmelze, auf der Rohmaner Feldgemarkung viele Steine und
Granitblöcke zurück gelassen. Überirdisch, aber besonders unter der Erde, gab es viele kleine, aber auch große Steine,
die, den Bauern, beim Pflügen und anderen Feldarbeiten sehr viel Schweiß, abverlangten. In einer Kiesgrube, auf dem
Feld des Bauern August Radek, lag ein Granitblock, von schätzungsweise 100 cbm. Vor etwa 80 Jahren, als man für diese
Steine noch keine Verwendung hatte, griffen die Bauern zu einer „List”. Weil er sonst nicht pflügen konnte, hat mancher
seinem Nachbarn, die Steine in der Nacht auf dessen Feld abgeladen. Als diese Tätigkeit unter Strafe gestellt wurde,
hat man die Steine in Schluchten gekippt und mit Mutterboden zugeschüttet. In späteren Jahren kam diese jedoch beim
pflügen wieder an die Oberfläche. Dann hat man aber schon Steine für den Straßenbau gebraucht und konnte sie so zu Geld
machen. Besonders im Raum südlich von Ortelsburg, bis zur polnischen Grenze, wo Steine eine Rarität waren, kamen sie
jetzt zum Einsatz. Auch beim Bau von Häusern, besonders für die Fundamente, wurden sie eingesetzt, weil auf diese
Weise viel Ziegeln eingespart wurden. Die Firma Gribienski aus Ortelsburg hat die großen Steine mit Dynamit gesprengt
und auf diese Weise die weitere Verarbeitung erleichtert.
Die Steine welche beim Pflügen aus dem Boden geholt wurden, hat man am Feldrand auf große Haufen zusammen getragen.
Wenn die Feldarbeit beendet war, sowie auch in den Wintermonaten, waren wir jeden Tag mit Steinen unterwegs. Wir sind
vorwiegend am Abend los gefahren, weil unter der schweren Last die Wagenachsen so heiß wurden und die Gefahr bestand,
das durch die Dehnung, die Räder blockiert würden. Bei einer Fahrt konnte man bis zu 24 Reichsmark verdienen, wogegen
1 Zentner Roggen für 8 bis 9 Reichsmark zu haben war. Ich bin selbst, mit dem Pferdewagen bis Fürstenwalde, Radostowen,
Luka, Altkirchen, Höhenwerder, ja sogar bis Friedrichshof gefahren.
In Rohmanen wurden auch rote Ziegeln gebrannt. Viele Häuser wurden, mit Ziegeln erbaut, die nur wenige 100 Meter von
der Baustelle entfernt hergestellt wurden. Der Lehn wurde auf den Feldern in der näheren Umgebung entnommen, dann von
Ochsen solange getreten, bis er so geschmeidig war, das er sich in Formen einstreichen ließ. Wenn die Ziegel in der
Form trocken war, wurde sie entnommen und in einem Brennofen gestapelt. Um einen Ofen richtig anzufeuern, brauchte man
12 Raummeter Holz, das im Zeitraum von ein par Tagen verheizt wurde. Der Fischer Karl Glitza hatte schon eine
Knetmaschine, die von einem Pferd angetrieben wurde, das mit verbundenen Augen, den ganzen Tag in die Runde ging.
Im Dorf waren auch vier Kalköfen, in denen so genannte Kalksteine, die sich an gewissen Stellen, im Erdboden befanden,
gebrannt wurden. Nach dem Brennen wurden die Steine mit Wasser abgelöscht und die daraus entstandne Masse diente, nach
dem Beimischen einer gewissen Menge Sand, dann als Bindemittel beim Häuserbau. Das Gerichtsgebäude und das
Lehrerseminar in Ortelsburg wurden mit Kalk, aus dem Rohmaner Brennöfen erbaut. Auch zum Bau einer Eisenbahnbrücke, auf
der, der Zug, den Sawitzfluß, von Ortelsburg nach Allenstein überquerte, hat mein Großvater, mit einem Ochsengespann,
Kalk gefahren.
Hinter der Scheune, beim Bauern Johann Dembek hat man Tonerde gefördert, aus der man mit Hilfe einer Formerscheibe,
die von einem Arbeiter mit Muskelkraft(Fußbetrieb) angetrieben wurde, schöne Krüge, Schalen und Vasen geformt hat.
Die Töpferware wurde, nachdem sie trocken genug war, auch in einem Ofen gebrannt, anschließend mit einer Lasur
überzogen und wieder gebrannt. Es wurden auch Kacheln zum Bau von Kachelöfen hergestellt, die mit verschiedenen
Ornamenten versehen, die Wohnstuben unserer Vorfahren schmückten. So haben unsere Großväter ihr Leben gemeistert und
nach und nach, unsere Dörfer aus der Rückständigkeit in die Neuzeit geführt.
Das gesellschaftliche Leben nach dem 1. Weltkrieg

Als der Lehrer Alfred Dorka, ein Frontkämpfer des Ersten Weltkrieges und ein Sportsmann, als
zweite Lehrkraft an der Rohmaner Schule angestellt wurde, hat er die Sitten und Gebräuche aus früherer Zeit wieder zum
Leben erweckt. Zuerst hat er die Jugend zusammen gerufen, einen Jugendverein und einen Fußballclub, gegründet. Zum
Vorsitzenden des Fußballclubs wurde Johann Gloddek berufen, der ihn auch geleitet hat. Bauer Wilhelm Spittka, der am
Rohmaner See wohnte, stellte Land für einen Sportplatz unentgeltlich zur Verfügung. Lehrer Alfred Dorka hat am
Rohmaner See eine Badestelle ausgesucht und ein Sprungbrett bauen lassen. An jedem Sonnabend im Sommer, bevor die
Sonne unterging, versammelte sich die gestammte Jugend des Dorfes an der Badestelle am See. Es wurde gebadet,
Heimatlieder gesungen, gespielt, im Fackelschein eines großen Biwakfeuers, bis in die späte Nacht hinein. Der Fischer
Karl Glitza hat uns Kähne zur Verfügung gestellt, mit denen wir auf den See hinausgepaddelt sind, dabei hatten wir viel
Spaß, was wiederum den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft gefördert hat. Ich habe mit meiner Mandoline den Gesang von
Volks- und Heimatliedern begleitet.
Der Rohmaner See liegt in einem Tal, dessen Hänge zu beiden Seiten mit Kiefern und Tannen bewaldet sind. Wenn man
gesungen oder Musiziert hat, hallte es von den Hängen zurück. Die Ufer waren mit Kalmus und Schilf bewachsen, was für
die Fischaufzucht von Vorteil war. Wenn man an einem sonnigen, windstillen Tag, am Seeufer spazieren ging, traf man
oft auf Flachstellen, an denen sich die Fischbrut im Sonnenlicht wärmte, wie ein Mückenschwarm. Im See befanden sich
folgende Fische: Karpfen, Hechte, Schleie, Barsche Plötze, Rotaugen, Aale und Krebse. Am Sonntagmorgen brachten viele
Rohmaner ihre Pferde zum See um sie zu baden.
Es wurden dort, unter der Aufsicht von Lehrer Dorka, auch viele Jugendfeste mit Theatervorführungen veranstaltet, zu
denen er selbst die Vorlagen organisiert hat. Der am See wohnende Bauer Johann Nadrowski, hat uns ein Scheunentor, als
Tanzboden zur Verfügung gestellt. Der Zimmermann Wilhelm Wittek hat uns eine Windmühle gebaut, die am auf dem Boden
liegenden Scheunentor aufgestellt wurde, dazu kamen Noch Tannen und Fichten, die das Ganze wie ein Bühnenbild
erscheinen ließen. Es wunden viele Bühnenstücke aufgeführt, unter anderen >Alte Weiber werden jung gemahlen<. Dazu bot
die Windmühle die entsprechende Kulisse.
Nach der Vorführung wurde der Boden aufgeräumt, um dann als Tanzdiele zur Verfügung zu stehen. Der Gastwirt Trzaska
hatte Tische und Bänke aufgestellt, Speisen und Getränke angeboten, so dass sich die die Veranstaltung bis in die
späte Nacht hinein zog. Es waren auch Leute aus Ortelsburg und anderen Nachbardörfern dabei. Im Winter hat Lehrer
Dorka eine Kreisrodelbahn eingerichtet, die von Zeit zu Zeit mit Wasser besprengt wurde, um die Gleitfähigkeit zu
verbessern. Von einer Anhöhe ging hinunter bis auf den halben See, was für alle ein großes Vergnügen war. Es kamen
Lehrer mit Schulklassen aus der näheren Umgebung um hier zu Rodeln.
Als Herr Lehrer Jobski als Hauptlehrer nach Rohmanen kam hat er mit dem Bürgermeister und der Gemeindeverwaltung
beschlossen, in der Nähe des Dorfes, auf einem zur Schule gehörenden Grundstück, einen Sportplatz anzulegen. Dafür
wurde gleich hinter den Gärten, 6 Morgen Ackerland abgetrennt, und nach Feierabend hat Lehrer Dorka mit den
Jugendlichen eingeebnet und gleich nebenan einen Graben für Schützenstand und Kugelfang ausgehoben. Am Sonntagvormittag
wurde Fußball gespielt und um 15:00 Uhr war Kleinkalieberschießen angesagt. Es musste auch ein kleiner Beitrag erhoben
werden, um Munition kaufen zu können. Eine Büchse konnten wir aus beim Kleinkalieberverein in Ortelsburg ausleihen.
Nach Hitlers Machtergreifung
Als Adolf Hitler an die Macht kam wurde die SA gegründet. Der Bürgermeister Michael Kownatzki
wurde zum Gruppenführer ernannt und folgende Männer haben sich freiwillig gemeldet: Wilhelm Matzey, Johann Gloddek,
Gustav Nadrowski, August Buttler, Karl Baran, Emil Nickel, Wilhelm Jaschinski, Emil Bork, Ernst Rattay und Gustav Bach.
Bei Versammlungen war die SA in Uniform angetreten um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Wer versucht hat Unruhe zu
stiften, egal aus welchem Grunde, wurde aufgefordert den Saal zu verlassen, andernfalls wurde er mit Gewalt entfernt.
Herr Lehrer Jobski wurde zum politischen Leiter ernannt, seine Frau hat die NS-Frauenschaft gegründet, Lehrer Dorka
die HJ, und so bekam die Dorfgemeinschaft, nach und nach ein anderes Gesicht. Der Sportplatz und der Schützenstand
wurden jetzt mehr als früher in den Mittelpunkt gestellt. Nach der Feldarbeit hat der Bürgermeister Fuhrwerke bestellt
und den Sportplatz noch besser herrichten lassen.
Der Bauer Wilhelm Both wurde zum Ortsbauernführer ernannt, mit der Aufgabe alles Land für den Anbau von Getreide und
Futtermittel bereitzustellen, oder wenn das nicht möglich war mit Wald aufzuforsten. Durch den Einsatz von Kunstdüngern
sollten größere Erträge aus dem Boden geholt werden, um den Viehbestand zu vergrößern und mehr Milch und Butter zu
produzieren. Deutschland sollte im Stande sein sich selbst zu selbst zu ernähren, ohne auf Importe angewiesen zu sein.
Frau Jobski hat, innerhalb der der NS-Frauenschaft, mit Hilfe von Fachkräften aus Ortelsburg, Lehrgänge veranstaltet,
auf denen man Backen und Nähen lernte. Auf den Bauernhöfen befand sich auch immer mehr Rassegeflügel, das eine erhöhte
Produktion von Eiern und Geflügelfleisch sicherstellen sollte.
Die Rohmaner Bauern hatten, außer in der Landwirtschaft, noch andere Verdienstmöglichkeiten in der Kreisstadt. In
Ortelsburg wurden vier Sägewerke betrieben, die mit Langholz aus dem Walde versorgt werden mussten. Wir haben eine
Kiefer von über 8 Festmeter angefahren, der wir zuerst 6 Meter Spitze abschneiden mussten, um diese Last überhaupt
auf den Wagen zu bekommen. Sechs Pferde musste angespannt werden um den Wagen zur befestigten Straße zu bringen.
Fichten und Tannen wuchsen bis zu einer Länge von 30 Metern. Auch beim Transport von Ziegel, von der Ziegelei zum
Bahnhof, konnte man gutes Geld verdienen.
Im Jahr 1934 wurde Rohmanen an das überregionale Stromnetz angeschlossen und schaffte auf diese Weise den Sprung von
der Petroleumlampe zur Glühbirne. Neben dem Grundstück von Karl Pietzonka wurde ein Transformatorhäuschen errichtet,
in dem der ankommende Strom von einer Hochspannung auf eine Verbrauchsspannung transformiert wurde. Es gab schon eine
Überlandleitung, die aus Richtung Ortelsburg kommend, quer über die Felder, in Richtung Neu Keykuth weiter ging.
Durch eine Zwischenspanne wurde der Transformator, mit der Hauptleitung auf Kownatzkis Feld verbunden.
Ein Stromanschluss konnte die Arbeit im Haus und Hof auf vielfältige Weise erleichtern, doch nur die besser gestellten
Bauern, sowie noch manche Pensionäre, die ein festes Einkommen hatten, konnten sich dass leisten. Weil nur wenige an
der Elektrifizierung teilnahmen, war ein Stromanschluss mit hohen Kosten verbunden. Nur Gustav Pietzonka, Gasthof
Trzaska, Friedrich Nickel, die Schule und Wilhelm Both, wurden in der ersten Phase erfasst.
Im Jahr 1952 wurde von den polnischen Behörden die zweite Stufe der Elektrifizierung eingeleitet, in der alle im Dorf
stehen Gebäude erfasst wurden. Am Anfang wurden nur Leitungen für Lichtstrom gelegt und auch nur 3 Lichtstellen pro
Haushalt bewilligt. Doch im nachfolgenden Zeitraum wurden dann, wenn Material vorhanden war, weitere Lichtpunkte
angelegt. 1952, am zweiten Wochenende im Advent, wurden dann die Leitungen geschaltet und alle waren von der
plötzlichen Helligkeit sehr begeistert. Wenn man Glühbirnen auswechseln wollte musste man am Anfang weite Wege
zurücklegen, um welche zu bekommen. In den 60ger Jahren wurden dann immer mehr Starkstromleitungen gelegt, weil die
Bauern elektrische Geräte kaufen konnten. Ende der 60ger wurden auch die Abbauten an das Stromnetz angeschlossen.
Das Urnengrab auf unserem Feld
Auf unserem Feld, in Richtung Seelonken, bin ich oft beim pflügen gegen Steine gestoßen, manchmal
rissen sogar die Stränge am Pferdegeschirr. Eines Tages nahm ich einen Spaten, Brechstange und einen langen Baum, um
der Sache auf den Grund zu gehen. Als ich eine Menge Sand ausgehoben hatte stieß ich auf eine steile, aus Steinen
errichtete Wand, die ich auch mit dem Baum nicht aus der Fassung bringen konnte. Ich habe den ganzen Vormittag gegraben,
konnte jedoch nicht unter die Steine kommen. Einige Tage später hatten wir in der Schule eine Bauernversammlung, da
habe ich Herrn Biella und Herrn Lehrer Dorka von meinem Fund berichtet. Am nächsten Morgen kam der Lehrer Dorka mit der
ganzen Schulklasse, mit Spaten und Sieben ausgerüstet auf unser Feld und fingen an die ausgehobene Erde zu sieben.
Lehrer Dorka benachrichtigte daraufhin den Leiter des Ortelsburger Heimatmuseums, der am nächsten Morgen vorbei kam um
sich die Fundstelle genau anzusehen. Er beauftragte ihn 4 Mann zu besorgen, um die Steine ringsum frei zu schaufeln.
Zwischen den Steinen durften wir die Erde nur mit Esslöffeln ausheben. Als es plötzlich zu regnen anfing hat Lehrer
Dorka die Brauerei Daum, in Ortelsburg angerufen, die uns über der Fundstelle ein Zelt errichtet haben, damit wir
ungestört weiterarbeiten konnten. Wir fanden 8 flache und 8 hohe Urnen zu beiden Seiten am Körper. Die Urnen wurden in
Gipsbinden eingewickelt und ins Heimatmuseum nach Ortelsburg gebracht, wo sie durch einen Fachmann, der extra aus einem
Königsberger Museum angereist war. Nach Reinigung der Urnen hat er festgestellt, das die Grabstätte etwa 2000 Jahre vor
Christi Geburt angelegt wurde und ein Doppelgrab war, in dem ein Toter liegend und einer in Hochstellung beigesetzt
wurde.
Die Nachricht von der Fundstelle verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Es erschienen viele Schaulustige, ganze
Schulklassen aus der Umgebung, mit Autos und zu Fuß. Durch die vielen Menschen wurden die bestellten Ackerflächen auf
unserem Feld sehr in Mitleidenschaft gezogen, eine Entschädigung haben wir nicht erhalten. Das Grab wurde vor dem
Heimatmuseum in Ortelsburg wieder so aufgebaut wie man es auf unserem Feld vorgefunden hat. Für den Transport der
Steine wurde ich entlohnt. Die Urnen hat das Königsberger Museum an sich genommen und wollte sie nicht wieder hergeben,
weil die solch einen Fund noch nicht in ihrer Sammlung hatten.
Sonnenwendfeuer
Am 24 Juni fand eine Sonnenwendfeier statt. Ein Brauch der an die alten Germanen erinnern sollte.
Der Lehrer Dorka hat den Bürgermeister beauftragt 2 Fuhrwerke in den Wald zu schicken, die Holz und alten Reisig holen
und auf dem großen Schulberg abladen sollten. Das Straßenbauamt hat uns Teertonnen zur Verfügung gestellt. Die ganze
Dorfgemeinschaft wurde eingeladen, am Abend, nach der Feldarbeit, an der Sonnenwendfeier teilzunehmen. Lehrer Dorka
hielt zuerst eine Ansprache, in der er anschaulich erklärte wie unsere Vorfahren in grauer Vorzeit gefeiert haben.
Nach dem offiziellen Teil wurden das Holz und die Teertonnen angezündet, es wurden Heimatlieder gesungen, wie: Wild
flutet der See, drauf schaukelt der Schiffer den schwankenden Kahn, Schaum wälzt er wie Schnee, von grausiger Mitte
zum Ufer heran, wild fluten die Wellen auf Vaterlands See, wie schön, oh trag mich auf Spiegel zu Hügel, Masovias See.
Masovia Land, mein Heimatland, Masovia es lebe mein Vaterland.
Lehrer Alfred Dorka und sein Wirken für Rohmanen.

Friedrich Biella hatte auf seinem Feld einen Granitstein mit einer geraden Seite, den haben wir
mit viel Schweiß an den Dorfteich transportiert und auf einer Erhöhung abgelegt. Der Stein sollte zum Denkmahl für die
Gefallenen des Ersten Weltkrieges umgestaltet werden. Da zu Wenige daran ein Interesse zeigten, wurde diese Idee fallen
gelassen und der Stein irgendwann ins Wasser gerollt. Der Lehrer Dorka war viele Jahre in Rohmanen tätig, dort hat er
später seine ehemalige Schülerin, Lotte Biella geheiratet. Er hat sich sehr für die Entwicklung des Dorfes interessiert,
war bei jeder Gemeindeversammlung anwesend und hat auf Schwachstellen hingewiesen die den Fortschritt behinderten.
Gemeinsam mit den Schülern hat er den Ehrenfriedhof für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges gepflegt, an der
Wegegablung nach Eichtal und zu Ehren des Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg eine Eiche gepflanzt.
Zum Advent hat Lehrer Dorka mit der Jugend einen Adventstern, in verschiedenen Farben gebastelt.
Der Stern wurde auf einer 2 Meter langen Stange befestigt, in der Mitte wurde ein Wachslicht angezündet, am Stern
wurde eine Schnur angebracht, wenn man daran zog rollte der Stern hin und her. Am ersten Wochenende im Advent
versammelten sich jung und alt, um den Stern durch das Dorf zu tragen. Alle schlossen sich dem vorausgehenden
Sternträger an, der den Stern durch die Hauptstraße und die angrenzenden Wege trug. Dieser Sternmarsch wurde an den
folgenden Adventwochenenden wiederholt.
Am ersten Weihnachtfeiertag wurde um 4:00 Uhr morgens ein Frühgottesdienst gehalten. Zuerst hat der Pfarrer eine
Andacht gehalten, dann haben die Kinder ein Krippenspiel aufgeführt und die Gemeinde hat schöne Weihnachtslieder
gesungen. Der Gastwirt Trzaska hat uns den Saal zur Verfügung gestellt. Wir hatten eine Posaunen- u. eine
Gitarrengruppe. Unter der Leitung von Herrn Willi Doormann spielten: Gottlieb Brosch, Fritz Ollech,
Gustav Rattay(Sopran), Wilhelm Pilath, Gustav Brosch(Alt), Fritz Both(Tenor) und Fritz Brosch(Bass).
In der Gitarrengruppe wirkten mit: Martha Ollech, Hedwig Ollech, Martha Lekzik, Martha Michalick und Auguste Lekzick.
Willy Doormann hat sie auf der Geige begleitet.
Kurz vor Ausbruch des 2. Weltkrieges
Bei der Aufstellung des Grenzschutzes(Regiment Buchholz), hat er als Hauptfeldwebel die
Gruppenführerkurse überwacht und selbst die fähigsten Männer dafür vorgeschlagen. Das Ausbildungspersonal hat das
Jäger-Battalion gestellt. Wir kamen zuerst ins Stadion(Waldheim), wurden da eingekleidet und dann ging es gleich
kasernenmäßig zu, theoretisch und praktisch. Jeder musste vor die Front treten und nachweisen ob er im Stande ist,
Befehle zu erteilen. Abends wurden Filme vorgeführt die uns zeigen sollten wie eine Gruppe sich im Gelände entfalten
muss. Die Exerziervorschriften hatten sich, im Verhältnis zu Kaiser Wilhelms Zeiten, etwas geändert. Damals bestand
eine Gruppe aus 8 Mann und einem Unteroffizier, jetzt aus 10 Schützen, 3 für das leichte Maschinengewehr und einem
Unteroffizier(13 Mann). Nach der Schulung folgte eine Abschlussprüfung, danach ein gemütliches Beisammensein. Aus
Rohmanen haben folgende Männer die Prüfung bestanden: Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy, Gustav Rattay und
Gustav Deptolla. Unsere Uniformen waren alle zu klein und es gab viel zu lachen bei der Anprobe.
Die erste Übung habe ich mit Emil Rosowski, in Lenzinen gemacht. Der Gutsbesitzer Marzinzick hat seine Scheune als
Unterkunft zur Verfügung gestellt. Er war im Range eines Hauptfeldwebels. In seinem haus war die Schreibstube
untergebracht, die er selbst verwaltete. Ein Lastauto hatte Uniformen aus der Kaserne in Ortelsburg geholt, jeder
musste eine Uniform anlegen und dann wurde solange getauscht bis alle eine passende gefunden hatten. An den Namen des
Kompanieführers kann ich mich nicht mehr erinnern. 1935 wurden wir zu einer Übung in die Dragonerkaserne nach Lyk
einberufen. Die Gruppenführer, Zugführer, und Kompanieführer die schon Frontberührung im dem Ersten Weltkrieg hatten,
mussten eine Woche früher anreisen. Die Übungen waren auf 6 Wochen angelegt. Die meisten der einberufenen waren noch
nie mit dem Wehrdienst in Berührung gekommen. Jeder Gruppenführer bekam 13 Mann zugeteilt.
Unser Zugführer war Leutnant Neumann, Kompanieführer Oberleutnant Rutschko, Battalions-Kommandeur Major Gröning
(Regiment Buchholz). Hier ging es wieder Kasernenmäßig voran. Das Bataillon wurde hier vereidigt. Jeden zweiten
Sonntag durften unsere Frauen uns besuchen. Ein Jahr später wurden wir wieder zu einer Übung einberufen, auf den
Truppenübungsplatz nach Arys. Jeder Gruppenführer hatte den Auftrag die Gruppe zu entfalten, und auf bewegliche
Figuren zu schießen. Diese Übung musste später mit scharfer Munition wiederholt werden. Jedes Maschinengewehr bekam
50 Schuss, jeder Schütze 20 Schuss zugeteilt. Nach dem Abschießen wurden die Treffer gezählt und dem Kommandierenden
Bericht erstattet. In einiger Entfernung spaziert ein Storch umher, der gar nicht bemerkt hatte dass geschossen wurde,
was bei den Kameraden ein großes Gelächter hervorrief.
Nach der Übung wurde uns gesagt das jeder Gruppenführer eine arische Abstammung nachweisen sollte. Ich konnte in den
Rheinsweiner Kirchenbüchern meine Vorfahren aus Gellen, bis zum Jahr 1732 zurück, nachweisen und wurde zum
Unteroffizier befördert. Aus unserem Dorf wurden auch, Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy und Gustav Deptolla
befördert. Zwischendurch mussten wir schon mal in die Radfahrer-Kaserne nach Ortelsburg, Gewehre empfangen und im
Gelände üben. Am 31 Juli 1939 wurde mir von einem Soldaten ein Schreiben übereicht, das mich aufforderte, am 1. August
um 6:00 Uhr, bei der 3. Kompanie, des 2. Infanterieregiments zu erscheinen.
Um 5:30 hat mich meine Schwester in die Kaserne gebracht. Auf der Schreibstube erklärte mir der Hauptfeldwebel,
dass mir ab sofort der Dienstgrad eines Sanitäters zugewiesen wird, ich mich in der Kammer einzukleiden hätte und mir
in der Handwerkerstube die entsprechenden Schulterklappen annähen lassen sollte. Die aktiven Sanitäter wurden den
Feldlazaretten zugewiesen und wir kamen an ihre Stelle. Unser Bataillon wurde nach Schodmak zum Bunker bauen und
Stacheldraht verlegen eingeteilt. Wir zogen in Begleitung einer Musikkapelle bis zur Kreuzung am Krankenhaus, dann
weiter zu unserem Bestimmungsort, gefolgt von einer Gulaschkanone die in den nächsten Tagen für unsere Verpflegung
sorgen sollte.
Am 14 August haben wir die Jägerkaserne, begleitet von einer Musikkapelle endgültig verlassen und zogen zuerst durch
Ortelsburg, dann über Lehmanen ins Feldmanöver, hinter Rohmanen. Dort entfaltete sich das Bataillon im Gelände, die
Verwundetensammelstelle wurde auf dem Hof des Bauern Friedrich Neumann eingerichtet. Gegen Abend wurde zu Sammeln
geblasen und Biwak bezogen, wobei unsere 3.Kompanie, in einem kleinen Wallt, in der Nähe von Otto Nickels Gehöft
Stellung bezogen hatte. Die 2. und 4. Kompanie hatte sich in der Nähe vom Abbau Pallasch niedergelassen. Die Frau
Nickel hat am Abend ein Mädel in Dorf geschickt um meiner Frau Bescheid zu sagen, wo wir uns zurzeit befinden. Meine
Frau ist dann noch gekommen um sich von mir zu verabschieden, weil wir am nächsten Morgen um 3:00 Uhr Zelte abbrechen
und um 4:00 Uhr in Richtung Kaspersguth marschieren sollten.
Wir sind dann über Achodden, Seelonken, Lehmanen, Ortelsburg, bis nach Grammen und Schützendorf marschiert, wo wir an
einem See Biwak bezogen haben. Es wurde immer gesagt, wir kommen zum Tannenberg-Denkmal bei Hohenstein, wo ein Reichs
Kriegervereinsfest stattfinden sollte. Es wurden auch schon Vorkommandos aufgestellt, doch dann kamen wir nach Orlau
und Lahna-Mühle, da wo die Alle entspringt haben wir 2 Tage biwakiert. Unser Kompanieführer hat uns nach Waplitz auf
den Soldatenfriedhof des Ersten Weltkrieges geführt und uns erklärt wie das Jägerbataillon sich 1914 hier entfaltet
hat und aufgerieben wurde. Dann mussten wir in der Nähe von Gut Koslau über einen Fluss und bezogen in einem Waldstück,
vorbereitete Stellungen in der Nähe der polnischen Grenze. Herr und Frau Thalmann haben uns jeden Tag, bis zur Grenze,
mit Brötchen und Getränken versorgt. Es wurde scharfe Munition ausgegeben, weil wir am nächsten Morgen um 4:00 Uhr die
polnische Grenze überschreiten sollten.
Am nächsten Morgen um 10 Minuten vor 4:00 Uhr kam der Befehl; scharfe Munition abgeben, alles zurück in ein 6 Kilometer
entferntes Dorf, wo wir auch einquartiert wurden. Das alles geschah’ eine Woche vor dem 1. September 1939. Es wurde
gesagt dass der Führer dem polnischen Präsidenten Rid-Szmigly, ein Ultimatum gestellt hat und es wahrscheinlich nicht
zum Krieg mit Polen kommt. Genau nach 5 Tagen kehrten wir wieder in die gleichen Stellungen zurück, es wurde wieder
scharfe Munition ausgegeben und am nächsten Morgen um 4:00 Uhr überschritten wir die polnische Grenze.
“Der 2. Weltkrieg.”
Der erste Einsatz in Polen
Wir kamen zuerst in ein Dorf in dem sich nur alte Menschen befanden. Auf unsere Frage wo denn die Bewohner wären sagte
man uns dass alle geflohen sind, weil erzählt wurde, die Deutschen würden alle Polen misshandeln und verstümmeln. Ich
habe ihnen daraufhin gesagt dass uns, unter Androhung von Strafe verboten wurde, einem Zivilisten etwas anzutun. Das
Vieh, die Schweine und Hunde des Dorfes liefen frei herum und die Soldaten fingen an auf die Hunde zu schießen, bis
gesagt wurde es seien Meldehunde im Dienste der Deutschen Wehrmacht und dieser Unfug der eigenen Truppe schaden würde,
weil etwaige Querschläger eigene Kameraden verletzen könnten. Wir gingen weiter auf polnischer Seite entlang der Grenze,
bis wir am Nachmittag die ersten Vorposten der Festung Mlawa erreichten, da befanden wir uns plötzlich im Feuerhagel
polnischer Festungsflack.
Am nächsten Morgen hatte ich schon 3 Verwundete und wusste nicht wo sich eine Verwundeten Sammelstelle befindet. Ich
suchte den Bataillonsgefechtstand auf der sich auf einer Anhöhe befand. Ich habe unseren Oberstabsarzt gefragt wo denn
die Verwundetensammelstelle wäre. Er rief beim Tross an, wo er die Auskunft erhielt, das sich vor dem Dorf ein Bunker
befindet in dem man die Verwundeten sammeln sollte, die dann von Sanitätsautos abgeholt würden, weil das Dorf unter
Artilleriebeschuss stand. Am Sonnabend haben unsere Flieger die Bunkerstellungen bombardiert, konnten aber, trotz guter
Treffer nicht viel ausrichten, die Bunker wurden nur etwas angekratzt.
Der Beschuss unserer vordersten Linien ging mit unverminderter Heftigkeit weiter. Am Sonntag verkündete eine große
Staubwolke die Ankunft unserer Panzer, doch sie kamen nur bis zur Panzersperre und mussten wieder abdrehen ohne den
Polen einen schaden zuzufügen. Ein Panzer bekam einen Volltreffer, der Fahrer konnte noch umkehren. Er blutete am Kopf
und der Schütze war so eingeklemmt, das wir ihn nur mit einem Seil unter den Armen, durch die Luke nach oben ziehen
konnten. Ob er seine Verwundung überlebt hat ist mir nicht bekannt, denn in der Nacht wurden Panzergeschütze nach
vorne in Stellung gebracht, die direkt in die Schießscharten der Bunker geschossen und so die Verteidiger vertrieben
haben. Daraufhin sind wir weiter vorgerückt. Auf einer Wiese war ein tiefer Graben ausgehoben und mit Ästen getarnt,
da war ein Panzer hinein gefahren, so dass nur das Hinterteil herausragte und er sich nicht aus eigner Kraft befreien
konnte. In der Luft waren Flieger die Brandbomben abwarfen, ich habe mich auf den Boden geworfen weil ich dachte die
würden explodieren, aber sie zischten nur, so das Stoppeln und Graß rings herum in Brand gerieten.
Bei den Kampfhandlungen gab es mehrere Verwundete, denen ich gerade Verbände anlegen wollte, als unser Hauptmann zur
Trillerpfeife griff um mir klar zu machen, dass ich ihm folgen sollte. Die Polen fingen an zu schreien, ich sollte
sie ins Lazarett bringen denn hier im Wald würde sie niemand finden. Ich setzte mich aufs Fahrrad und folgte unserem
Kompanieführer, der mir sagte ich soll immer bei der kämpfenden Truppe bleiben, denn hinter der Front sind die
Sanitätsabteilungen, die werden die Verwundeten schon versorgen. Der Vormarsch dauerte bis in die späte Nacht. Auf
einem Gehöft, das nach allen Seiten durch Feldwachen abgesichert wurde, machten wir endlich Rast. Wir haben
Getreidegarben auf dem Hof ausgebreitet und uns zur Ruhe gelegt, als plötzlich um Mitternacht Leuchtraketen den Himmel
erhellten und Maschinengewehrfeuer uns aus dem Schlaf schreckte. Ein par polnische Soldaten hatten das Feuer eröffnet,
aber sich kurz darauf ergeben.
Die Narew-Überquerung
Als es hell wurde ging der Vormarsch weiter. Es wurde uns untersagt Tagebuch zu führen, darum
weiß ich nicht wie die Orte hießen, durch die wir marschiert sind. Als wir durch ein sumpfiges Gelände vor drangen
stand auf einer Anhöhe am Horizont, die polnische Artillerie, die uns sofort unter Beschuss nahm. Unser Hauptmann war
der Meinung dass wir schon in der Nähe des Flusses Narew sein müssten, als aus den Sträuchern ein mit Schlauchboten
beladenes Lastauto auftauchte. Wir wurden aufgefordert mit je 6 Mann ein Schlauchboot zu nehmen, an einem Aggregat
der daneben stand mit Luft zu füllen und zu Wasser zu lassen. In einer Stunde war das ganze Bataillon über die Narew,
wo der Vormarsch fortgesetzt wurde. In einem Dorf überraschte uns die polnische Kavallerie und fing sofort mit
Maschinengewehren zu schießen an. Da kam der Befehl: Alles wieder zurück. Es ging noch schneller als auf der Hinfahrt.
Wir sind erst einige Kilometer am Fluss entlang gegangen und haben dann zum zweiten Mal rüber gesetzt.
Die Gehöfte im Dorf standen alle in Brand. Auf einem waren viele Bienestöcke. 2 Kameraden wollten den Stöcken Waben
entnehmen, doch die Bienen durch das Feuer aufgeschreckt, überfielen sie sofort und stachen derart zu das sie nicht
mehr wieder zu erkennen waren. Ich habe die Einstichstellen mit Salmiak betupft, mehr konnte ich nicht tun. Wir mussten
auf unserem Vormarsch durch einen Wald der in Flammen stand, so dass man kaum atmen konnte. Es ging weiter in Richtung
Minsk und Warschau, wo schon die Sowjetische Armee durchgegangen war, die Pferde und Vieh von einem Gut mitgenommen
hatten. In einem Wald stießen wir unverhofft auf ein Kloster, in dem wir einige Gefangene machten. Dann trafen wir auf
eine gute Straße die nach Grochow ging.
Als wir dort einmarschierten wurden wir aus den oberen Stockwerken beschossen, so dass wir, um uns zu schützen, nur an
den Hauswänden entlang gehen konnten. Wir haben jedes Haus nach Feinden durchsucht. Vor einem Haus stand ein Hund der
niemanden reinlassen wollte, solange bis ihn eine Kugel traf. Die polnische Artillerie feuerte von Warschau aus, um
unseren Vormarsch zu stoppen. Wir hatten uns gerade eingegraben als plötzlich deutsche Flieger am Himmel erschienen,
die unsere Stellungen mit Bomben bewarfen und dabei viel Unheil anrichteten. Wir haben sofort Fliegertücher
ausgebreitet und Leuchtraketen abgeschossen. Da ich in dem Graben, den ich kurz zuvor ausgehoben hatte, sofort in
Deckung gegangen bin ist mir zum Glück nichts passiert. Unter den anderen Kameraden gab es viele Verwundete, so dass
ich nicht wusste wem ich zuerst helfen sollte.
Der Oberstabsarzt hat mich sofort tatkräftig unterstützt, so das bald alle Verwundeten versorgt waren, außer einem,
dem ein Bombensplitter den Arm abgerissen hat. Ich habe im 3 große Verbandspäckchen auf die Wunde gelegt, doch die
Blutung ließ sich trotzdem nicht stoppen, so dass er eine Stunde später auf der Krankensammelstelle verstarb. Wir
haben danach in einem Tomatenfeld einen Graben ausgehoben und eine neue Abwehrstellung bezogen. Die Gruppe Schwarz
bekam den Auftrag nach etwaigen versprengten polnischen Verbänden Ausschau zu halten, als sie unerwartet aus einer
Häuserreihe mit Maschinengewehrsalven überschüttet wurden. Der Gruppenführer und noch ein Soldat wurden dabei tödlich
verwundet. Danach wurde noch ein weiter Stoßtrupp, unter der Führung von Leutnant Briskorn, der sich dazu freiwillig
gemeldet hatte, hinaus geschickt um den Gruppenführer und den anderen Toten zu bergen.
Bei diesem Unternehmen, das erfolglos ausging, weil die Toten schon verscharrt waren, durchschlug eine Kugel den
Stahlhelm von Leutnant Briskorn, der auch sofort tot war. Alle Toten wurden später, an der Kirchenmauer in Grochow, in
Särgen beigesetzt: Hauptmann Schönwald sagte, das sie nach dem Kriege auf den Heldenfriedhof nach Ortelsburg überführt
werden. Drei Tage lagen wir bei Grochow in Stellungen, waren dem polnischen Maschinengewehrfeuer sowie den Bomben
deutscher Flugzeuge ausgesetzt. In der Nacht musste ich zu einem Verwundeten in die vorderste Linie und habe den
Rückweg nicht mehr finden können, als plötzlich Gewehrfeuer aufflammte habe ich in den Ruinen Schutz gesucht. Erst im
Morgengrauen konnte ich mich wieder orientieren und zu meinem Unterstand zurückfinden.
Warschau wurde tagelang bombardiert und stand auch unter Artilleriebeschuss. Aus dunklen Rauchwolken kamen oft ganze
Bündel von Papier angeflogen. Die Verwundeten kamen oft auf Krücken zu unserem Unterstand, ich habe sie dann zur
Krankensammelstelle hingeführt. Wir haben auch polnische Zivilpersonen betreut, die während der Kampfhandlungen
verwundet wurden. Als einmal 2 Jungen vorbeiliefen hat einer ihnen nachgerufen sie sollten seiner Frau Bescheid sagen,
er wäre auf der Krankensammelstelle an der Kirche. Als wir dort ankamen war seine Frau, mit einem Kind auf dem Arm,
schon da.
Nach der Kapitulation von Warschau, gingen wir über Sokolow zum Bug und haben dort Quartier bezogen. Der Russe hatte
sich bereits hinter den Fluss zurückgezogen, hatte alles Vieh und Pferde mitgenommen. Dort erreichte mich ein Telegramm
von zu Hause, dass meine Tochter gestorben ist. Es sprach sich auch herum dass verschiedene Heimaturlaub bekommen haben,
ich durfte auch für 14 Tage heim. Wir fuhren mit Lastautos nach Allenstein in die neue Reiterkaserne, zum
Ersatzbatallion, da haben wir unsere Gewehre und Munition abgeben, dann durften wir, jeder in seinen Heimatort
weiterfahren.
Als wir unsere Quartiere am Bug verlassen haben war sehr viel Schnee gefallen. Hier in Ortelsburg fanden wir die
gleiche Wetterlage vor, aber nach 3 Tagen war alles wieder weggetaut und wir konnten die Kartoffelernte, die durch den
frühen Wintereinbruch gestoppt wurde, zu Ende bringen. Ein Tag bevor ich zu Hause angekommen bin wurde die Tochter
beerdigt. Nach 14 Tagen mussten wir uns in Allenstein melden, Gewehre empfangen und wieder zurück zur Division an den
Bug 150 Kilometer hinter Warschau. Die elfte Division, zu der wir auch gehörten sollte in den Westen Deutschlands
verlegt werden und war schon unterwegs zur Verladestation Skiernewice 50 Kilometer vor Warschau.
Mein Dienst als Sanitätsunteroffizier
Unser Bataillon kam in das Städtchen Burscheid, im Kreis Opladen, wo wir in Privatquartieren
untergebracht wurden. Nach 3 Monaten, im Januar 1940, wurden wir nach Solingen verlegt, wo wir bis zum
Frankreichfeldzug stationiert waren. Wir mussten an Feldübungen teilnehmen, wie andere die in Kasernen untergebracht
waren. Während dieser Zeit musste jeder seine Zähne in Ordnung bringen lassen. Jeden Tag fuhren 20 Mann in die
Cäzilienstraße nach Köln, zur Zahnklinik. Im Rheinland wurde unsere Division neu aufgestellt. Ausfälle durch den
Polenfeldzug wurden durch neue Soldaten ergänzt. Ich kam nun zum Ersatzbatallion, war der Älteste in der ganzen
Kompanie. Als der Frankreichfeldzug losging wurde unser Ersatzbatallion mit den noch vorhandenen Verwundeten, in die
neue Reiterkaserne, nach Allenstein verlegt.
Meine Frau hat, mit Unterstützung der Bauernschaft, einen Antrag gestellt, daraufhin wurde ich zur Frühjahrsbestellung,
beurlaubt und später bis auf weiteres vom Militärdienst freigestellt. Als der Russlandfeldzug losging wurde ich von der
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg, für 14 Tage einberufen. Ich war seit 1922, Mitglied der freiwilligen
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg und habe jedes Jahr an Übungen teilgenommen. Jede Bereitschaft musste etliche Leute
stellen. Von Rohmanen wurden Emil Rosowski, Johann Dembek, und ich, zur Krankensammelstelle Wirballen, in Litauen,
abkommandiert. Dorthin kamen Lazarettzüge aus Russland mit der Breitspurbahn. Die Verwundeten wurden frisch verbunden
und auf Waggon mit Normalspur verladen und nach Deutschland gebracht.
Als die 14 Tage vergangen waren wollten wir wieder nach Haus zurück, doch man wollte uns nicht entlassen. Stattdessen
wurden wir dem Wehrkreisamt Königsberg zugeteilt, neu eingekleidet und zur Aushilfe ins Lazarett nach Gumbinnen
abkommandiert. Mehr als ein Jahr war ich in den Urlauber-Baracken, habe dort Krankenstube betreut. Später, bis zum
Dezember 1944, war ich im Reserve-Lazarett 4, in Königsberg tätig. Dort habe ich auch die Luftangriffe der Engländer,
vom 25 bis 26. August 1944 miterlebt.
Wir sollten gerade einen Lazarettzug in Rotenstein entladen, als plötzlich die Sirenen ertönten - Fliegeralarm. Im
gleichen Moment waren die ersten Flugzeuge auch schon da, zuerst warfen sie „Tannenbäume” und danach Foßforkanister ab.
Die Omnibusse standen schon zur Abfahrt bereit als es losging. Wir haben die Verwundeten schnell in den
Luftschutzkeller getragen, haben die Betten von den Fenstern weggerückt damit die Verwundeten nicht von den
Glasssplittern verletzt wurden. Im Kasernenhof brannten die Fosforkanister lichterloh. Unsere Unterkunft, die sich in
einer Baracke befand ist völlig abgebrannt, mit dem Wenigen was wir unser Eigen nannten. Am nächsten Tag wurden wir neu
eingekleidet und am 29. bis 30. kamen die englischen Bomber wieder, sie setzten genau da ihr Zerstörungswerk fort wo
sie vor 3 Tagen aufgehört hatten.
Anfang Dezember 1944 musste ich mich nach Stablack melden und musste dann zur Sanitätsabteilung 1, nach Gernau, das
liegt zwischen Lodz und Warschau. Vormittags hatten wir Felddienstübungen und nachmittags theoretischen Unterricht.
Jeden Tag wurden Gruppen zusammengestellt und zu anderen Einheiten abkommandiert. Ich kam zu einer Panzerabteilung, wo
wir an einem Morgen plötzlich auf dem Kasernenhof antreten mussten und zu unserer Überraschung mit der Nachricht
konfrontiert wurden, dass der Russe an mehreren Frontabschnitten durchgebrochen war. Wir bekamen sofort einen
Marschbefehl in Richtung Lodz, wo das Stadtbild noch intakt war, selbst die Straßenbahnen fuhren noch. In der Nacht
haben russische Flugzeuge die Stadt bombardiert. Die Kaserne in der wir untergebracht waren hatte keine
Luftschutzkeller, aber zum Glück blieben wir von Bombentreffern verschont. Am nächsten morgen bot sich uns ein Bild der
Verwüstung. Die entgleisten Straßenbahnwagen, sowie andere Fahrzeuge blockierten die Straßen. Die Älteren unter uns
bekamen Fahrscheine für einen Transportzug, der bereit hinter Lodz abfahrbereit, unter Dampf stehen sollte. Als
russische Panzer in den Straßen auftauchten, verbrannte die Schreibstube unsere Wehrpässe und andere wichtige
Dokumente. Wir liefen zu der Station auf der unser Transportzug bereitstehen sollte, aber da war kein Zug mehr zu sehen
und wir setzten unseren Rückzug zu Fuß fort.
Der Rückzug und Zusammenbruch der Ostfront
In Dobroschin, einer Stadt in Polen, wurde gerade ein Lazarettzug verladen, doch wir kamen nicht
mehr zum Einsatz, weil die russische Infanterie uns schon auf den Fersen war. Es ging weiter über den Fluss Bober,
Sagan, bis nach Glogau an der Oder. Dort wurden wir der 29. motorisierten Sanitätskompanie zugeteilt. Im
Garnisonslazarett wurden noch Operationen durchgeführt. Unsere Division hatte ihr eigenes Feldlazarett, so dass wir den
Befehl zu Weiterfahrt erhielten und noch unbeschadet die Oderbrücke passieren konnten, denn Glogau wurde zur Festung
erklärt. Wir haben 2 Pferdewagen organisiert und mit Verbänden, sowie medizinischen Instrumenten beladen. So kamen wir
bis nach Lübbenau im Spreewald, wo wir in einem Schloss, in zuvor ein Museum war, unser Lazarett untergebracht haben.
Weil die Amerikaner Cottbus bombardiert hatten, wurden die Verwundeten zu uns nach Lübbenau gebracht. Hier haben wir
Tag und Nacht gearbeitet, um die vielen Verwundeten, aus den schweren Kämpfen bei Grünberg und Sagan zu versorgen. Die
Soldaten von der Abwehrfront kamen schon mit abgestorbenen Armen oder Beinen bei uns an, weil in vorderster Linie keine
Frontlazarette mehr vorhanden waren; es mussten viele Amputationen durchgeführt werden. Als für unsere Pferde kein Heu
mehr vorhanden war, schickte mich unser Hauptfeldwebel, zu einem Bauern in den Spreewald, mit dem Auftrag, Futter zu
besorgen. Mit noch zwei Mann fuhren mit zwei Kähnen, zuerst den Hauptstrom entlang und dann in einen Nebenarm; da haben
wir die Boote beladen und brachten das Heu nach Lübbenau.
Als wir uns bei unser Einheit zurück melden wollten, war alles schon marschbereit. Ich bin schnell in einen Bus
eingestiegen der sofort losfuhr, weil russische Verbände schon in sichtweite waren. Russische Flugzeuge kreisten über
den Dächern und nahmen, mit ihren Bordwaffen jeden unter Beschuss, der sich irgendwo blicken ließ. Wir konnten nur
durch den Wald, oder in der Nacht vorwärts kommen, denn wenn ein Auto auf der Landstraße fuhr, war alsbald ein Flugzeug
hinter ihm her und schoss es in Brand. Als wir nach Tagen am Ufer der Elbe ankamen, war bereits eine Ponton-Brücke
erstellt worden, welche die zerstörte Brücke ersetzen sollte.
Durch die vielen Fahrzeuge waren in den Sand tiefe Spuren gefahren, so dass andere Fahrzeuge unsere Busse ins
Schlepptau nehmen mussten, weil wir mit eigener Kraft nicht mehr weiterkamen. Beiderseits der Trasse standen
Flüchtlingswagen, in der der Hoffnung die Brücke passieren zu können, doch SS-Polizei verhinderte das die Gespanne den
militärischen Rückzug zum Stillstand brachten. Es gelang uns die Elbe zu überqueren, um in einem Waldstück Schutz vor
feindlichen Fliegern zu suchen.
Als wir unsere Busse und Autos gut getarnt hatten, hat unser Bataillonschef die anwesenden Parteigrößen zu sich
gerufen und ihnen erklärt das wir eine Einheit des Roten Kreuzes sind und nach internationalem Recht keine Waffen
besitzen dürfen. Nach langer, erregter Diskussion wurde beschlossen einen Graben auszuheben und alles im Sand zu
verscharren. Als wir dann weiter, durch die Dörfer fuhren, sahen wir schon viele weiße Bettlaken, als Zeichen der
Kapitulation, aus den Fenstern hängen. Es wurde uns erzählt dass der Bürgermeister von der SS erschossen wurde, weil
er die Bevölkerung zu diesem Schritt ermutigt hatte. Jetzt waren hinter uns die Russen und vor uns schon die Amerikaner.
Amerikanische Panzer fuhren umher und schossen wild durch die Gegend, ohne ein Ziel anzuvisieren. Niemand wollte sich
dem Russen ergeben, doch der Weg der zu den Amerikanern führte, war durch abgesägte Bäume blockiert. Wir sind schnell
in das nächste Dorf gegangen, haben uns Sägen und Äxte besorgt, die Bäume durchgesägt und in den Straßengraben
geworfen.
“ Nach dem Ende des 2. Weltkrieges.”
In amerikanische Kriegsgefangenschaft
Dann fuhren wir unter internationaler Flagge an eine Mulde Brücke, vor der zwei amerikanische Soldaten, mit Zigarren,
zur Hälfte im Mund, standen. Sie rauchten und kauten gleichzeitig. Wir mussten auf einen freien Platz fahren, alle
aussteigen und rechts wieder antreten. Wäschebeutel und Tornister mussten wir abstellen; danach wurden wir nach Waffen
durchsucht, Wertsachen, Uhren und Messer wurden uns gleich abgenommen. Als wir anschließend an unserem Gepäck
vorbeigingen durfte niemand was mitnehmen. Als ich gebückt, nach meinem Wäschebeutel greifen wollte, in dem sich noch
3 Konservendosen und ein Brot befanden, bekam ich einen Fußtritt ins Gesicht, so dass mir ein Zahn ausgeschlagen wurde.
Wir wurden dann in einem Garten zusammen getrieben und gefragt ob jemand bei der SS gedient hat. Nachdem wir in Reihe
und Glied angetreten waren, mussten wir den Oberkörper freimachen und die Arme anheben. Es wurde nach SS-Zeichen
gesucht, die gewöhnlich unter dem Oberarm eintätowiert waren. Nachdem wir Grimma bei Leipzig, wo wir in amerikanische
Gefangenschaft geraten waren, verlassen hatten, mussten wir durch ganz Thüringen bis Hersfeld, an der Grenze zu Hessen,
marschieren. In Hersfeld wurden wir auf große Lastautos verladen, die von farbigen Soldaten gefahren wurden. Man hat
uns mit Stöcken hinauf getrieben, solange bis das Auto so voll war das man kaum stehen konnte. Die Soldaten fuhren, für
diese Straßenverhältnisse, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Wenn die Straße eine scharfe Kurve hatte, flogen
wir alle übereinander und mussten erst mit viel Kraftanstrengung auf die Beine kommen um diese Fahrt zu überstehen.
Da die Straßenränder in dieser Gegend mit Obstbäumen bepflanzt sind und deren Äste sehr niedrig hängen, hätten die
uns die Köpfe abgerissen, wenn wir uns nicht ständig geduckt hätten. Unsere Fahrt endete in Bad Kreuznach, in der Pfalz,
wo wir in ein Lager, in dem sich später 130.000 Mann und 6 Generäle befanden, eingepfercht wurden. Die Unterkunft der
Generäle befand sich unter einem Zelt, alle anderen mussten die Zeit unter freiem Himmel zubringen. Die Offiziere, die
Unteroffiziere, die Mannschaften; wurden in getrennten Camps untergebracht. Die Mannschaften wurden auch zur Arbeit
abkommandiert und konnten bei dieser Gelegenheit, Brot, Brötchen oder Zigarettenstummel organisieren, wogegen die
Offiziere und Unteroffiziere ihr Camp überhaupt nicht verlassen durften.
Die ersten Tage gab es kein Wasser und kein Brot, so dass die Kameraden vor Erschöpfung umfielen. Später standen wir
manchmal den ganzen Tag nach Wasser an, das von den, uns bewachenden Negern mit großen Wassertanks angefahren wurde. Am
dritten Tag bekamen wir mittags und abends etwas zu Essen; Brot bekamen wir erst nach zwei Wochen, nach dem aus der
Umgebung herbeigeholte Handwerker, Backöfen gebaut hatten. In den verschiedenen Gemeinden, die in den uns umgebenden
Weinbergen lagen, mussten sich alle Männer beim Bürgermeister melden. Als sie dann erschienen waren, wurden sie auf
bereitstehende Lastautos getrieben und zu uns ins Lager gebracht. Sie waren ohne Kopfbedeckung und ohne wärmere
Bekleidung angekommen, weil ihnen gesagt wurde, dass ihr Aufenthalt im Lager nur von kurzer Dauer sein würde. Man hat
uns, falls noch vorhanden, Decken und Mäntel abgenommen, mit der Begründung, sie würden für Kranke und Verwundete
gebraucht. Jeden Tag starben mehr als 200 Mann, die wir sofort in ein Zelt tragen mussten. In der Nacht wurden die
Toten dann mit unbekanntem Ziel, weggefahren.
Viele haben ihren Verstand verloren uns irrten im ganzen Camp ziellos umher. Als Latrinen wurden Gräben ausgehoben, in
die verschiedene Kameraden, bei der Verrichtung ihrer Notdurft, vor Schwäche hineingefallen sind und nicht mehr wieder
heraus kamen. Aus den Pfählen die, die jungen Obstbäume stützten, haben wir Krankentragen gebaut um unsere Kameraden,
bei Bedarf, zur Krankensammelstelle zu tragen. Es war in diesem Frühjahr auch sehr kalt, doch unsere Erdlöcher, die wir
zum Schutz vor Kälte und Wind, nur mit leeren Konservendosen ausgehoben hatten, durften nicht tiefer als 20 Zentimeter
sein. Nach jedem Regenguss mussten wir das Wasser ausschöpfen. Nach einem Gewitter, standen wir wiedermal, total
durchnässt in unserem Camp, als unerwartet am Horizont die Sonne hervortrat. Einer unserer Kameraden hatte noch eine
Trompete gerettet und fing, von dem Anblick völlig überwältigt, zu spielen an: "Es geht alles vorüber, es geht alles
vorbei, nach jedem Dezember, folgt wieder ein Mai". Daraufhin hob sich die Stimmung der tiefbetrübten Kriegsgefangenen,
so das Heimatlieder durch das ganze Camp erklangen, obwohl wir in den nassen Kleider herumgehen mussten, bis sie am
Körper trocken wurden.
In französischer Kriegsgefangenschaft
Nach etwa einem Monat, haben uns die Amerikaner, den Franzosen, zum Arbeitseinsatz, ausgeliefert.
Etwa 4 Kilometer von Bad Kreuznach entfernt, stand auf freier Strecke, ein Zug mit offenen Kohlenloren, auf den wir
verladen wurden. In jeden Waggon, wurde pro Person eine Tafel Schokolade und ein Päcken Zwieback rein geworfen, doch
viele Kameraden fanden nur leere Päckchen vor, weil die schon zuvor von der französischen Wachmannschaft geplündert
wurden. Wir haben uns darüber beschwert, doch die haben uns nur ausgelacht. Nachdem wir zunächst bei Mainz über den
Rhein fuhren, endete unsere Fahrt bei Paris in einem großen Zeltlager. Dort wurden wir auf andere Züge verladen, die uns
nach Südfrankreich, in ein Barackenlager, bei Mazarei, brachten.
Auf einer Zwischenstation hat man uns unter einer Pumpe, die Lokomotiven mit Wasser versorgt, abgestellt, den Kran
aufgedreht und uns anschließend ausgelacht, die Kinder Haben uns mit Steinen beworfen. Ein Wachmann kam in unseren
Waggon gekommen, hat unser Gepäck durchsucht, wenn er Tabak oder Zigaretten gefunden hat, nahm er sie mit. Die Kameraden
waren darüber so empört, dass sie vorhatten, ihn nachts unter den Waggon zu werfen. Wir haben sie gebeten dass zu
unterlassen, weil man uns in diesem Falle, alle erschießen würde.
Als wir ins Lager kamen wurden wir zuerst gezählt, dann mussten wir unser Gepäck stehen lassen und beiseite treten.
Wenn man bei der Nachkontrolle noch was in den Taschen fand, wurde das auch entwendet, selbst Esslöffel. Wir wurden
dann in drei Baracken, ohne Toiletten, eingeschlossen. Die Kameraden haben ihre Bedürfnisse in Kochgeschirre erledigt
und durch ein kleines Fenster, das sich fast unter der Decke befand, hinausgeworfen. Andere Fenster ließen sich nicht
öffnen, weil sie mit Stacheldraht zu geflochten waren. Als die Kameraden die Kochgeschirre auskippten, haben die
Wachposten geschossen und die Fenster zertrümmert. Sie waren der Meinung dass wir ausbrechen wollten. Es herrschte eine
große Hitze, in den überfüllten Baracken sind wir fast erstickt. Am nächsten Tag haben wir uns über fehlende Toilettem
beschwert, da haben sie Heringsfässer durch die Hälfte geschnitten und an der Ausgangstür hingestellt. Um bei den
überfüllten Räumen dort hinzukommen, musste man über die Köpfe der Anderen steigen. Viele hatten Fieber und Durchfall
und mussten in die Krankenstube eingeliefert werden, wo sie kurz darauf verstarben.
Besonders Raucher litten sehr an der Unterernährung, bekamen Wasser in den Beinen und waren die Ersten die verstarben.
Nach der Registrierung wurden wir auf andere Baracken verteilt. Die Zivilbevölkerung kam in die Räume und begann uns
auszuplündern. Wer noch gute Schuhe besaß musste sie ausziehen und bekam dafür die kaputten des Plünderers. Eine Woche
lang mussten wir diesen Zustand ertragen, erst als die Kameraden sich beschwerten, wurde am Eingang eine Tafel am
Eingang angebracht, dass die Zivilbevölkerung das Lager nicht betreten darf. Bis auf einige, wenige Ausnahmen wurde
diese Anweisung befolgt.
Als wir im Lager ankamen, war der französische Lagerkommandant, ein ehemaliger Kriegsgefangener, der bei einem Bauern
in Deutschland gearbeitet hatte. Dieser Bauer war jetzt als Kriegsgefangener in seinem Lager. Als er ihn erkannte, hat
er ihn gleich zum Küchendienst eingeteilt und mit dem nächsten Krankentransport nach Hause fahren lassen. Zu Mittag
bekamen wir nur gekochte Haferkörner, da schwamm alles oben, später war man dann auf Gerste umgestiegen. Als viele
daran gestorben waren, weil sie diese „Rohkost”, die nur ein Kuhmagen verträgt, nicht gegessen haben, hat man die
Körner durch eine Schrotmühle laufen lassen. Dann hat man uns Steckrüben gekocht; wir bekamen 250 Gramm Weißbrot,
etwas Quark und ein viertel Liter Magermilch. Später, als wir schon arbeiten mussten, hat man in unserem Essen einen
Kuhkopf mitgekocht, das hat dann bedeutend besser geschmeckt.
Bevor wir morgens zur Arbeit gingen, mussten wir zu Flaggenparade und abends, nach der Rückkehr, haben wir die Flagge
wieder eingeholt. Wir haben einen Kanal gereinigt, dessen Sohle 2 Meter dick mit Schlamm bedeckt war. Zuerst wurde das
Wasser abgelassen, dann haben wir, einer dem andern, den Schlamm mit der Schippe hoch gereicht. Der Letzte hat den
Schlamm, der so zäh war, dass er nicht von der Schippe wollte, oben am Rande abgelegt. Manchmal waren 10 Mann nötig um
den Höhenunterschied zu überwinden. Das Wachpersonal schoss über unsere Köpfe hinweg und rief: „schnell arbeiten”. Bei
der großen Hitze war das ein Ding der Unmöglichkeit, zumal es nichts zu Trinken gab. Auf dem Heimweg haben wir im Walde
Heilkräuter gesammelt, die man in der Küche getrocknet und als Tee zubereitet hat, den wir am nächsten tag zur Arbeit
mitnahmen, um unseren Durst zu stillen.
Unser Aufseher hatte einen Stock, an dem sich noch kurz abgeschnittene Äste befanden. Wer seiner Meinung nach, nicht
ordentlich gearbeitet hat, bekam gleich Schläge auf den Rücken. Die weißen Aufseher wurden irgendwann durch Neger
ersetzt, die uns bedeutend besser behandelt haben. Wenn irgendetwas schief ging, haben sie nichts gesagt, nur gelacht.
In den übrig gebliebenen Wassertümpeln hatten sich noch einige Aale versteckt, die wir zu fangen versuchten, was uns
auch manchmal gelang. Wir mussten ihnen das Genick brechen, damit sie uns nicht entwischen konnten. Wenn die Franzosen
bemerkten das wir Aale hatten, wurden sie uns abgenommen. Gelang es uns aber, sie ins Lager zu bringen, dann haben wir
uns eine köstliche Malzeit zubereitet.
Um sicherzustellen dass niemand geflüchtet ist, wurden wir, wenn wir abends ins Lager zurückkamen, zuerst gezählt.
Diese Zählung wurde mehrmals wiederholt, weil die Wachmannschaften sich immer wieder verzählt haben. Als einer von uns
hin ging, ihnen sagte dass alle da sind, wollten sie es nicht glauben und haben uns vor dem stehen lassen, bis es ihnen
irgendwann einfiel. uns doch das Tor zuöffnen. Einmal, als wir von der Arbeit zurückgekehrt waren, standen wir bis 23
Uhr neben der Flagge, weil uns niemand das Tor geöffnet hat. Als wir dann doch irgendwie ins Lager kamen haben wir
festgestellt, dass das ganze Wachpersonal betrunken war und niemand im Stande uns das Tor zu öffnen.
Eines Tages waren wir wieder abends zur Parole angetreten, als ein älterer Herr mit seinem Hund, am Stacheldraht
entlang, spazieren ging. Weil der Hund, unterm Stacheldraht hindurch, zu uns kam, hat ihn einer geschnappt, ihm das
Genick gebrochen und unter seiner Jacke versteckt. Der Franzose hat nach seinem Hund gerufen und gepfiffen, aber alles
vergebens, der Hund war nicht aufzufinden. Die Kameraden haben ihm gleich das Fell über die Ohren gezogen, das Fleisch
gekocht und das Fell in die Latrine geworfen. Das Fleisch wurde umgehend verspeist.
Als wir am nächsten Tag von der Arbeit zurückkehrten, war im Lager der Teufel los. Wir mussten sofort antreten und
wurden gefragt, wo der Hund geblieben ist, der Gestern Abend, mit seinem Herrchen, am Zaun entlang spazieren ging. Als
sich niemand dazu bekannte, mussten wir weiterhin stehen bleiben, während die Wachmannschaften von Baracke zu Baracke
gingen und alles durchsuchten. In einer Latrine hat man dann das Fell gefunden, was uns ein furchtbares „Donnerwetter”
einbrachte und in den nächsten Tagen, nach der Arbeit, unter dem Kommando eines Oberfeldwebels, eine Stunde
nachexerzieren.
In Südfrankreich regnet es den ganzen Sommer nicht; die Bauern haben da keine Scheunen und das Getreide wir nur in
Schobern aufgestellt und dann umgehend gedroschen. Vom Oktober bis Dezember regnete es fasst jeden Tag in Strömen.
Gesät wird nur im Frühjahr und im Herbst, weil im Sommer alles vertrocknet. Es wird viel Wein angebaut und die
Steckrübe wächst den ganzen Winter. Neben den Weinreben wurde aus Schieferplatten ein Zaun aufgestellt, um dem Wein
einen optimalen Standort zu sichern. Die Bauernwagen hatten nur zwei Räder und waren nur mit einem Pferd bespannt, das
die ganze Balance des Wagens zu halten hatte. Trotzdem haben sie soviel aufgeladen wie wir auf einen Leiterwagen. Viele
Kameraden wurden den Bauern zur Arbeit ausgeliehen. Wenn ein Bauer einen Arbeiter gebraucht hat und es wurde gefragt,
wer sich in der Landwirtschaft auskennt, da haben sich alle gemeldet. Der Bauer konnte sich dann aussuchen, wen er
mitnehmen wollte.
Wenn wir durch die Stadt zur Arbeit gingen, haben verschiedene Leute Fallobst in die Abfalleimer gelegt. Wenn das von
den Kameraden bemerkt wurde, schwenkten viele aus der Reihe, um sich etwas mit zunehmen, was von den Wachmannschaften
nicht gern gesehen wurde. Viele Kriegsgefangene hatten keine Schuhe mehr, sie haben die Füße nur mit Lumpen bewickelt.
Eines Tages kamen Kameraden aus Norwegen, die nach Deutschland entlassen werden sollten. Mann hat sie jedoch ins Lager
gesteckt und zur Arbeit eingeteilt. In Norwegen hatten sie Kleider und Stoffe eingekauft, hatten volle Seesäcke und
sogar Karren auf 2 Rädern, weil sie ja in die Heimat entlassen werden sollten. Als wir morgens zur Arbeit rausgeführt
wurden standen sie schon vor dem Lager. Wir haben ihnen zugerufen, dass sie uns etwas abgeben sollen, weil ihnen ja
sowieso alles abgenommen wird, aber sie haben uns nur ausgelacht. Als sie ins Lager Kamen mussten sie ihr Gepäck
ablegen, wurden dann wo anders hingeführt und haben es danach nie wieder gesehen.
Durch die vielen Läuse, Flöhe und Wanzen die wie im Lager hatten, kam es bei verschieden Kameraden, an den
Einstichstellen, zu eiternden Entzündungen. Um dem vorzubeugen hat man uns mit einem Pulver, das in Frankreich
hergestellt wurde, aber bei den Parasiten keine Wirkung zeigte, eingesprüht. Erst bei der Anwendung eines Mittels
amerikanischer Herkunft, war alles über Nacht verschwunden.
Der Sonntag war arbeitsfrei. Dann kam ein katholischer, französischer Pfarrer, eskortiert von 3 Mann, mit
aufgepflanztem Seitengewehr ins Lager und hat Gottesdienst gehalten. Einen evangelischen Pfarrer gab es nicht, nur
einen Baptisten Prediger. Der wurde würdevoll eingekleidet, bekam ein großes Kreuz und hat jeden Sonntag in einer
extra dafür hergerichteten Baracke Gottesdienst gehalten. Wer Theologie studiert hatte und sich meldete, wurde zu
einem Seminar geschickt und konnte sein Studium fortsetzen. Glasbläser durften das Lager auch verlassen und ihrem
erlernten Beruf wieder arbeiten.
Wer sich freiwillig, für 5 Jahre, zum Dienst in der Fremdenlegion verpflichtet hat, das waren etliche unter uns, wurde
neu eingekleidet, bekam gutes Essen und Rauchwaren soviel er wollte. Nach einem Jahr wurden, nach und nach, die
Kranken und Körperbehinderten in die Sowjetische Besatzungszone entlassen. Eine Entlassung von Kriegsgefangenen, die
in den Westzonen oder jenseits von Oder und Neise zu Hause waren, war nicht vorgesehen. Die Österreicher wurden alle,
unabhängig von ihrem Gesundheitszustand entlassen.
Ich habe Briefe nach Hause geschrieben, aber die kamen nur bis Allenstein und wurden wieder zurück geschickt. Als eine
Kommission des Roten Kreuzes aus der Schweiz unser Lager besichtigt hat, haben wir uns beschwert, das wir als
Sanitätsdienstgrade, zur Arbeit gehen müssen. Daraufhin erging ein Befehl: Wer einen vom Roten Kreuz, ausgestellten
Ausweis besitzt, gehört einem internationalen Verband an und braucht nicht zu Arbeit gehen. Aus unserem Lager hatten
sich 20 Mann gemeldet, die daraufhin Freigang, in Begleitung von zwei französischen Wachsoldaten erhielten. Als wir
gefragt wurden wo wir hin wollen, entschlossen wir uns, einen Soldatenfriedhof, auf dem unsere verstorbenen Kameraden
beerdigt waren, zu besuchen.
Da der Untergrund in dieser Gegend aus Felsen bestand, wurden die Gräben, in denen die Toten in selbst gezimmerten
Kisten nebeneinander gestellt wurden, mit Hilfe von Dynamit ausgehoben. Ein Leichenwagen, mit einem Pferd bespannt,
das mit einer schwarzen Decke abgedeckt war, wurde von einem Kutscher in angemessener Kleidung, gefahren. Der Wagen
konnte gleichzeitig 4 Kisten transportieren. Wenn wir von der Arbeit kommend, dem Leichenwagen begegneten, wurde
gehalten und mit einer Schweigeminute der Toten gedacht, bis der Wagen vorbei war. Die Zivilbevölkerung verharrte auch
im Schweigen, mit abgenommener Kopfbedeckung.
Ein Kamerad, der in Krottorf, Kreis Oschersleben, bei Magdeburg, zuhause war, sagte bei seiner Entlassung zu mir:
Sollte ich das Glück haben, meine Entlassungspapiere zu erhalten ohne eine Bleibe vorzuweisen, dann soll ich Krottorf
als Heimatadresse angeben. Auf der Krankenstube habe ich angegeben, dass sich noch ein Schrapnellsplitter, aus dem
Ersten Weltkrieg, in meiner Kreuzbeingegend befindet, er zwar verkapselt ist, aber immer noch Beschwerden verursacht.
Daraufhin wurde ich zur Entlassung vornotiert. Als bekannt wurde das ein Rückkehrertransport in die sowjetische
Besatzungszone zusammengestellt wird, habe ich mich sofort gemeldet und wurde für ein Entlassungslager in Angoleme
vorgesehen. War das eine Freude, als uns mitgeteilt wurde, wann der Rücktransport stattfindet.
In unserem Lager waren noch 2 Kameraden aus dem Kreis Ortelsburg: Ein Gustav Lumma aus Leynau und ein Alfred Moritz
aus Groß Schöndamerau. Sie mussten noch zurückbleiben und haben mir den Auftrag erteil, die Angehörigen in der Heimat
zu grüßen und ihnen die Anschrift mitzuteilen. Als wir im Entlassungslager ankamen, fragte man uns nach unserer
Heimatanschrift. Dann wurden die Entlassungspapiere angefertigt. Es wurde uns auch ein Barscheck, für die in Frankreich
geleistete Arbeit ausgehändigt, den wir bei jeder Kasse in Deutschland einlösen könnten. Ich habe ihn bis zum heutigen
Tage nicht einlösen können, obwohl ich irgendwann in der Zeitung gelesen habe, das Verrechnungschecks die den aus
französischer Kriegsgefangenschaft Entlassenen, ausgehändigt wurden, einzulösen sind.
Wir kamen zuerst nach Saar Elbe, dann in die Nähe der Zonengrenze zu Thüringen. Hier mussten wir 2 Tage warten, weil
aus der sowjetischen Besatzungszone keine Eisenbahnwagen bereitgestellt wurden. Angesichts dessen, das der Russe beim
letzten Transport die aus Frankreich kommenden Wagen kassiert und nicht mehr herausgeben wollte, bestand der Franzose
jetzt darauf, seine Wagen sofort wieder mitzunehmen. Als der sehnsüchtig erwartete Zug endlich eintraf, durften wir
umsteigen und kamen, immer noch hinter Stacheldraht, nach Erfurt. Von dort weiter ins Quarantänelager nach Prätsch an
der Elbe.
Unter Androhung von Strafe war es verboten das Lager zu verlassen, doch der Hunger zwang uns dazu, in den umliegenden
Dörfern um Lebensmittel zu betteln. Man drohte uns damit, dass Zuwiderhandlungen, mit einer 14-tägigen Verlängerung der
Quarantäne geahndet werden. Der Roggen war schon reif und wir haben, auf den umliegenden Feldern, die Ähren abgerissen,
das Korn, zwischen 2 Steinen zu Mehl zerrieben, um daraus eine Suppe zu kochen, denn von dem was unsere Lagerküche uns
bieten konnte, war es nicht möglich zu überleben. Als der Eigentümer bemerkte wer seine Roggenähren entwendet hat, kam
er ins Lager, gerade zu dem Zeitpunkt als wir mit dem Mahlen beschäftigt waren. Der Lagerkommandant, bei dem er sich
beschwerte, drohte uns zu bestrafen, wenn wir unsere „Rauzüge” nicht unmittelbar einstellen würden. Wir sagten ihm er
solle uns heimfahren lassen, da wir doch lange genug hinter Stacheldraht gesessen hätten.
Endlich wieder in Freiheit
14 Tage nach unserer Ankunft wurden uns Entlassungspapiere ausgehändigt, sowie auch Fahrscheine
zum den, von uns angegeben Heimatorten. So kam ich nach Krottof, Kreis Oschersleben, zu meinem ehemaligen
Kriegskameraden, bei dem ich einen Tag geblieben bin. Er hatte mir schon eine Stelle bei einem Bauern besorgt, der 70
Jahre alt und kinderlos war. Zum Hof, den er mit seiner Ehefrau bewirtschaftet hat, gehörten 36 Morgen Land, 2 Ochsen
und 3 Kühe. Das Ackerland bestand aus 17 Parzellen und sicherte mir einen Arbeitsplatz.
Jetzt, da ich ein Dach überm Kopf und genug zu essen hatte, fing ich an nach dem Verbleib meiner Familie zu forschen.
Bei meinem letzten Heimaturlaub hatte ich mit meiner Frau verabredet; falls wir uns in den Kriegswirren verlieren
sollten, unsere Kontaktadresse, die meiner Quartiersleute in Burscheid, Kreis Opladen, sein sollte. Ich habe zuerst
nach Rohmanen geschrieben, aber leider keine Antwort erhalten. Dann habe ich nach Burscheid geschrieben, und siehe, -
bei denen lag schon eine Anfrage meiner Frau vor, die nach mir gefragt, und ihre jetzige Anschrift hinterlassen hatte.
Ich habe dem Bauern erzählt dass meine Frau sich zurzeit, auf einem Gut, in Alt Steinhorst, im Kreis Rostock, befindet.
Er war sofort bereit uns ein Zimmer zur Verfügung zu stellen, wenn ich meine Frau nach Krottorf rüberholen wollte. Das
habe ich Ihr mitgeteilt und sie war sofort bereit ihren Wohnsitz nach Krottorf zu verlegen, denn sie wohnte dort in
einem kleinen Stübchen unterm Dach.
Im Herbst, als die Feldarbeit so ziemlich erledigt war, bin ich nach Alt Steinhorst gefahren, um meine Frau und meinen
Sohn Kurt, sowie meinen Sohn Manfred, den ich noch nicht kannte, weil er erst nach der Flucht, am 31. Januar, in Groß
Lüssewitz, geboren wurde, nach Krottorf zu holen. Meine Frau hatte schon Holz für den Winter besorgt und vom Gut, auf
dem sie im Sommer gearbeitet hatte, Mehl und Kartoffeln bekommen. Wir haben das Mehl und andere Habseligkeiten in
Kisten verpackt. Das Holz haben wir einem Bauern gegeben, der uns und unser Gepäck, mit seinem Pferdewagen, zum 14
Kilometer entfernten Bahnhof, nach Ribnitz gebracht hat. Wir sind auch gut in Krottorf angekommen, aber als wir am
nächsten Tag, unsere Kisten vom Bahnhof abholen wollten, haben wir zwar die Kisten vorgefunden, doch der gesamte Inhalt
wurde während der Bahnfahrt entwendet. Die Bahnstation in Krottorf hat die Vorkommnisse zur Kenntnis genommen und
protokolliert, aber unsere Sachen haben wir nie wieder gesehen und mussten wieder bei Null anfangen.
Im Winter musste ich auf der Genossenschaft, unentgeltlich, für die Russen Weizen einsacken. Ich hatte versucht eine
Arbeit als Zimmermann zu bekommen, doch auf dem Arbeitsamt wurde mir gesagt, ich bin Ladwirt und muss auf der
Landwirtschaft arbeiten. Da in den ersten Nachkriegsjahren, auch in der sowjetisch besetzten Zone Arbeitsplätze knapp
waren, mussten auch solche, die einen anderen Beruf erlernt hatten, jede zumutbare Arbeit annehmen. Aus der Heimat
erhielt ich einen Brief, von meiner dort noch lebenden Mutter. Sie schrieb das sie mich noch einmal sehen wollte und
ich sollte doch wieder zurück kommen; Unser Hof wäre nicht von Polen besetzt und sie wäre ganz alleine, weil der Vater
nach dem Durchzug der Front von den Russen erschlagen wurde. Daraufhin habe ich dem polnischen Konsulat in Magdeburg
mitgeteilt, dass ich in Rohmanen eine Landwirtschaft besitze, und um eine Einreisegenehmigung gebeten.
Nach 2 Monaten erhielt ich eine Postkarte, mit der Mitteilung, ich sollte mich persönlich beim Konsulat vorstellen.
Nach Aufnahme meiner Personalien, wurde mir gesagt, das ich benachrichtigt werde wenn mein Antrag genehmigt wird. Ende
Juli 1947 erhielten wir die Einreisegenehmigung nach Ostpreußen, das jetzt unter polnischer Verwaltung stand. Wir
mussten zuerst zum polnischen Konsulat in Berlin-Lichterfelde, wo wir umgeben von einer Trümmerlandschaft, gewartet
haben, bis alle Untersuchungen und Formalitäten erledigt waren.
“ Wieder zurück in Ostpreußen.”
Der schwere Wiederaufbau nach dem Kriege
Dann fuhren wir über Frankfurt/Oder, Posen, Thorn, Allenstein, nach Ortelsburg, wo wir am 2. August 1947 ankamen. Mit
einem zweirädrigen Karren, den ich mir von einem noch in Ortelsburg lebenden Bekanten ausgeliehen hatte und meinem
Sohn Manfred im Kinderwagen fuhren wir nach Rohmanen. Meine Mutter war inzwischen verstorben und auf dem Hof war nur
meine, inzwischen aus Russischer Gefangenschaft wiedergekehrte Schwester, Frieda Pelkowski.

Es war alles ausgeplündert; kein Vieh, keine Maschinen und der ganze Hof mit kniehohem Graß überwachsen. Nur schmale
Trampelpfade, vom Haus zum Holzschuppen und zum Klo, durchkreuzten das satte Grün. Ich habe das Gras auf dem Hof mit
einer Sense, die ich noch gefunden habe, abgemäht, damit der Hof nicht so verwahrlost aussah. Am nächsten Tag habe ich
mich bei der Polizei in Ortelsburg angemeldet, wo ich auch ein Startgeld von 100 Zloty erhielt und Gepäckstücke, die
ich in Krottorf aufgegeben, am Bahnhof abgeholt. Es hat mich sehr gewundert das, das Gepäck überhaupt angekommen ist.
Da man von der Landwirtschaft nicht Leben konnte, habe ich mich in den nächsten Tagen, bei der jetzt polnischen Bahn,
um Arbeit beworben und wurde auch angenommen. Wenn wir unseren Monatslohn bekamen, saß immer einer am Tisch, der von
uns 100 Zloty für den Wiederaufbau von Warschau verlangte. Wenn ich dran war, riefen die Anderen, ich hätte Warschau
zerstört und müsste deshalb 200 Zloty abgeben. Nach 3 Jahren kam eine Verfügung, die besagte, dass wer länger als 1
Jahr bei der Bahn beschäftigt ist, angestellt werden muss. Um diese Bestimmung zu umgehen hat man mich entlassen und
eine Woche später wieder eingestellt.
Als ich vor Ablauf des nächsten Jahres, aus dem gleichen Grunde wieder entlassen wurde, habe ich mich bei der
Stadtverwaltung in Ortelsburg(jetzt Szczytno)beworben, wo ich zuerst im Gaswerk als Heizer und später auf Baustellen
als Zimmermann gearbeitet habe. Wir haben durch den Krieg beschädigte Häuser repariert, in den ehemals touristischen
Zentren einige Ausbesserungen an den Einrichtungen durchgeführt, eine Ziegelei wieder in Betrieb gesetzt und andere
anfallende Arbeiten verrichtet. Im Dach des Rathausturmes war während der Kämpfe eine Granate eingeschlagen, die, die
Dachlatten und die Verschalung zerstört hatte. Da wir, unter schwersten Bedingungen, den Schaden repariert haben,
wurde uns eine Höhenzulage versprochen, die wir aber nicht bekommen haben.
Aus Verärgerung darüber habe ich bei der Stadtverwaltung gekündigt und bei einer Wiederaufbaufirma unter der Leitung
von Bauingenieur Laskowski wieder angefangen, wo ich bis 1954, als Zimmermann beschäftigt war. Ab da habe ich mich
nur um meinen Hof gekümmert, der wegen meiner Arbeitsstellen, gezwungenermaßen, sehr vernachlässigt wurde. Als wir
1947 zurückkamen, brachten wir unseren Sohn Manfred noch im Kinderwagen. Den hat meine Frau zum Markt gebracht,
verkauft, und dafür eine Ziege erworben, die dank guter Pflege, uns täglich mit 4 Liter Milch versorgte. Das war der
erste Baustein zum Wiederaufbau, unserer durch den Krieg zerstörten, und danach ausgeplünderten Landwirtschaft.
Während meiner Arbeit bei der Bahn haben wir uns eine Kuh gekauft, die nach einem halben Jahr, wegen nicht bezahlter
Grundsteuer, vom Gerichtsvollzieher gepfändet wurde. Man hat uns die Kuh weggenommen und bei einem Arbeiter, der in
der Ernst-Mey-Straße in Ortelsburg wohnte und sie wegen nicht vorhandener Futtermittel, nur mit Kartoffelkraut
gefüttert hat, untergestellt. Als ich bei der Bahn meinen Monatslohn bekommen habe, bin ich zur Gmina gegangen, habe
eine Rate angezahlt und durfte dann die Kuh wieder mit nach Hause nehmen. Durch die schlechte Ernährung war die Kuh
stark abgemagert und lieferte nur die Hälfte der ursprünglichen Milchleistung.
Später habe ich ein Pferd auf Abzahlung bekommen, das 140.000 alte Zloty gekostet hat. Die Stute war schwach und unser
Feld sehr hügelig, so dass man nur bergab pflügen konnte, was sehr beschwerlich war, bergauf ging es immer im Leerlauf.
Später habe ich die schweren Böden mit dem Traktor umpflügen, und in den letzten Jahren auch mit dem Binder mähen
lassen. Von der Stute habe ich 2 schöne Fohlen gezogen; ein davon habe ich bei der Ausreise in die Bundesrepublik
mitgebracht und bei der Viehverwertungs-Genossenschaft in Göttingen verkauft. In den ersten Nachkriegsjahren als noch
wenig Land bestellt wurde, breiteten sich auf den nicht beackerten Flächen, Wildkräuter aus. Disteln und andere
Schnellwachsende, erreichten manchmal eine Höhe von 2 Meter, besonders auf den schweren Böden.
Es hat viel Schweiß gekostet ehe man den Acker soweit hatte, das er auch befriedigende Erträge abwarf. Die
Währungsreform von 1950, hat unser weiniges Geld das wir schon gespart hatten, wieder vernichtet. Ich hatte 2 Pferde,
1 Fohlen, 2 Kühe und Schweine, als ich wieder aufgefordert wurde nicht bezahlte Grundsteuern nachzuzahlen. Als ich
nicht bezahlen konnte, hat der Vollziehungsbeamte, ein Fohlen, eine Kuh und ein Schwein gepfändet. Es gelang mir jedoch
nach längeren Verhandlungen, ohne größere Verluste, alles zu regeln. Später kam eine Verfügung, die besagte; wenn
jemand auf seinem Hof nur eine Kuh und ein Pferd hatte, durften sie nicht gepfändet werden. Einige haben ihr Inventar
dieser Verfügung angepasst und dadurch die Zahlung von Grundsteuer umgangen.

Wer seine Steuern pünktlich bezahlt und sein Kontingent an landwirtschaftlichen Produkten fristgerecht abgeliefert hat,
der konnte seine, darüber hinaus erwirtschafteten Produkte zu marktgerechten Preisen verkaufen. Für eine hochtragende
Sterke, mindestens 400 kg schwer, die auf ein staatliches Gut verkauft wurde, konnte man bis zu 12000 Zloty bekommen.
Unsere Böden waren kalkarm, doch durch den Einsatz von Kalk und Kunstdünger konnte man den Ertrag erheblich steigern.
Kalk und Kunstdünger konnte man bei der Genossenschaft(GS) bestellen, der dann auch direkt auf den Hof geliefert wurde.
Kalk wurde geliefert und gleich auf dem Feld ausgestreut. In den 1960ger Jahren waren alle Ackerflächen der Rohmaner
Felder bestellt.
Die nach dem Krieg zurückgebliebenen deutschen Bauernfamilien, aber auch die Polen, die während des Krieges beim Bauern
in Deutschland gearbeitet haben, versuchten mit teils bescheidenen, oder auch zusammen gesuchten, landwirtschaftlichen
Geräten, die bäuerlichen Betriebe aufrecht zu erhalten. Nach den schweren Anfängen in den ersten Nachkriegsjahren
erzielten sie schließlich einen beachtlichen Erfolg, der sich in wogenden Kornfeldern, sowie in grünen Wiesen auf
denen gut genährtes Vieh weidete, widerspiegelte.
Ein schwerer Einschnitt in meinem Leben.
Am 11. Mai 1956 verstarb nach langer schwerer Krankheit, meine liebe Ehefrau Marta Rattay,
geborene Brosch. Ein Jahr zuvor war schon mein Schwiegervater Gottlib Brosch verstorben. Die schweren Bedingungen
unter denen wir nach Kriegende leben mussten, haben ihrer bereits angegriffenen Gesundheit sehr zugesetzt. Sie
verstarb mit 44 Jahren und hinterließ in unserer Familie eine große Lücke, die nicht mehr zu Überbrücken war. Wir
haben sie unter großer Anteilnahme der noch verbliebenen deutschen Bevölkerung zu Grabe getragen und auf dem Rohmaner
Friedhof beigesetzt. Die Arbeit die sie sonst verrichtet hatte fiel jetzt auf mich und meine Söhne zurück. Meine
Schwester Frieda Pelkowski half auch wo sie nur konnte. Wir waren auf die Unterstützung durch Nachbarn und Freunde
angewiesen, die uns immer wenn es nötig war, tatkräftig unterstützt haben. Im laufe der Zeit haben wir wieder zum
Alltag zurück gefunden, haben sie noch etliche Jahre auf dem Friedhof besuchen können, bis wir, bedingt durch unsere
Ausreise uns endgültig von ihr trennen mussten.
Der endgültige Abschied von Ostpreußen
Ab 1956 begannen, durch die Vermittlung des Deutschen Roten Kreuzes, die ersten Ausreisen in die
Bundesrepublik Deutschland. Zuerst waren es Kinder die zu ihren Eltern ausreisen durften, Familien deren Väter aus der
Kriegsgefangenschaft in den Westen Deutschlands entlassen wurden und andere durch den Krieg getrennte
Familienangehörige. Ab 1960 erhöhte sich die Zahl der Ausreisewilligen aus dem polnisch besetzten Ostpreußen. Es setzte
sich die Überzeugung durch, dass unsere Angestammte Heimat, uns für die Zukunft keine Perspektive mehr bieten konnte.
Meistens wurden die Anträge, die wir an die Passabteilung in Allenstein stellen mussten, um einen Ausreisepass zu
bekommen, negativ beschieden. Nach mehrmaligen Versuchen gelang es dann doch, diese begehrte Ausreiseberechtigung in
Empfang zu nehmen. Die Enttäuschung der Zurückgebliebenen war groß, wenn wieder mal Verwandte oder Nachbarn, den Weg
in Richtung Bahnhof einschlugen.
Um einen Reisepass zu beantragen, musste man zuerst eine Einladung von Verwandten aus der Bundesrepublik vorlegen, in
der, diese sich verpflichten mussten, für Unterkunft und Verpflegung der Eingeladenen zu sorgen. Diese Einladung
musste durch ein Amt in der Bundesrepublik beglaubigt werden. Außerdem mussten die Kosten für die Bahnfahrt, ab
polnischer Grenze, bis zum Zielort, beim polnischen Reisebüro ORBIS, in Warschau, in DM eingezahlt werden.
Unseren ersten Ausreiseantrag haben wir 1964, bei der Kommandantur der polnischen Miliz in Allenstein eingereicht, der
nach einer gewissen Zeitspanne, ohne eine uns verständliche Begründung zu nennen, abgelehnt wurde. Gegen diese
Ablehnung wurde ein Widerspruch zugelassen, den wir sofort einreichten. Nach einer weiteren Zeitspanne erhielten wir
wieder eine Ablehnung, gegen die kein Widerspruch mehr zulässig war. Wer seine Ausreiseabsicht nicht aufgeben wollte,
musste einen neuen Antrag stellen. Es gab Familien die schon 10 Mal einen Ausreiseantrag gestellt hatten und immer
wieder abgewiesen wurden. Da meine Söhne, nicht die Absicht hatten in Rohmanen zu bleiben und ich nach 2 Weltkriegen,
an denen ich teilgenommen, die schwere Arbeit auf der Landwirtschaft, nicht aus eigener Kraft schaffen würde, haben wir
1966 wieder einen Antrag gestellt, der prompt abgelehnt wurde. Der Widerspruch auf diese Ablehnung wurde auch negativ
beantwortet, so dass wir 1968 wieder einen Antrag eingereicht haben.
Weil das Passamt in Allenstein lange nichts von sich hören ließ, hegten wir schon die Hoffnung das es jetzt klappen
würde und waren sehr enttäuscht als wieder eine Absage kam. In der Zwischenzeit sind viele Nachbarn und Bekannte aus
Rohmanen, sowie aus der näheren Umgebung, ausgereist und das Häuflein der noch verbliebenen Deutschen, wurde immer
kleiner. Die Motivation, die uns in früheren Jahren, über so manche schwierige Lage hinweg geholfen hat, ist einer
hoffnungslosen Resignation gewichen. Man war davon überzeugt, dass unser Leben, in unser Angestammten Heimat, keine
Zukunftsperspektive mehr haben konnte und wenn wir keine Ausreisegenehmigung bekommen, wir eines Tages die letzten
Deutschen in der ganzen Umgebung sein werden.
Die Ausreise-Heimat ade
Wir hatten die Hoffnung schon aufgegeben, als am 30. April 1969, der Briefträger unseren Hof
betrat und mir einen Brief überreichte, in dem uns das Passamt in Allenstein mitteilte, dass unsere Ausreise in die
Bundesrepublik Deutschland, genehmigt worden ist. Wir müssten, nach Aushändigung der Reisepapiere, den Geltungsbereich
der Volksrepublik Polen, innerhalb von 3 Monaten verlassen. Wir waren zuerst geschockt, über den Hinweis, das wir
unsere Heimat in 3 Monaten verlassen müssen, aber dann stellte sich die Zukunftsperspektive wieder ein und wir gingen,
wie von einem schweren Ballast befreit und gut gelaunt unser weiteren Tätigkeit nach.
Als der Briefträger unseren Hof betrat, waren ich und mein Sohn Kurt gerade dabei eine Fuhre Mist zu laden. Wir hatten
den Wagen gerade halb geladen und haben nach der frohen Kunde nicht mehr weiter gemacht, sondern die Pferde vorgespannt
und den Mist aufs Feld gefahren, damit wir den Wagen für alle Fälle frei hatten. Das war die letzte Tätigkeit für
unsere Landwirtschaft in Ostpreußen.
Die Nachricht von unserer Ausreise verbreitete sich, ohne dass wir darüber gesprochen haben, wie ein Lauffeuer.
Alsbald kamen Leute aus dem Dorf, die sich für das Vieh und für diverse Landwirtschaftliche Geräte interessierten.
Etliche wollten bestimmte Sachen sofort kaufen, andere haben nur zurücklegen lassen und wollten später kommen und
bezahlen, haben es aber dann doch nicht genommen.

Wenn man eine Landwirtschaft hatte, konnte man 2 Pferde, 2 Rinder, 3 Schweine, 5 Schafe und 10 Hühner, in einem
geschlossenen Viehwaggon, in die Bundesrepublik mitnehmen. Jeden Tag war man unterwegs, von einer Behörde zur Andern.
Die Aushändigung der Reisepapiere erfolgte nur nach Vorlage bestimmter Bescheinigungen: Es mussten alle Steuern bezahlt
sein, das Kontingent landwirtschaftlicher Erzeugnisse musste abgeliefert sein, je eine Bescheinigung vom Katasteramt
und vom Notar musste vorgelegt werden, das man dem polnischen Staat das Grundstück abgetreten hat. Die Gebühren für
die notarielle Beglaubigung mussten wir selbst bezahlen. Wenn man alle Bescheinigungen beisammen hatte, bekam man bei
der Kreisverwaltung eine Gesamtbescheinigung. Mit dieser Bescheinigung konnte man nach Allenstein, zur
Polizeikommandantur fahren, wo man nach dem schriftlichen Verzicht auf die polnische Staatsangehörigkeit, einen
Reisepass ausgehändigt bekam, der den Inhaber zum Grenzübertritt berechtigte, aber nicht zur Wiedereinreise.
Wir haben 2 Pferde, eine Sterke, einen Ochsen, 5 Schafe, 2 Schweine und 10 Hühner mitgenommen. Über die Schutzimpfung
der Rinder musste man eine, vom Kreistierarzt beglaubigte Bescheinigung vorweisen. Ich habe 5 Schafsböcke gekauft, die
ich in der Zwischenzeit, hinter der Scheune, zum Weiden angekettet hatte. Einer von denen hat sich losgerissen und
seinen Nachbarn getötet. Das Fleisch konnten wir noch verkaufen, mussten aber dafür einen anderen Schafsbock kaufen.
Innerhalb von 3 Monaten mussten wir alles regeln und zwei Tage vor der Abfahrt einen Eisenbahnwagen, bei der
Eisenbahndirektion in Allenstein bestellen. Reservierungen bei den polnischen Behörden waren meist immer mit
Schmiergeld verbunden, weil man sonst nie sicher sein konnte dass diese Vereinbarungen auch eingehalten werden. Schon
2 Wochen vor unserer Abfahrt, gab es in Ortelsburg keine alkoholischen Getränke zu kaufen. Meine Söhne mussten mit dem
Motorrad die umliegenden Dörfer abfahren, damit wir für die Reise einen Vorrat anlegen konnten; denn Wodka war zu der
Zeit, in Polen, wie eine zweite Währung.
Am 25. Juli haben wir zusammen, mit meinem Neffen Siegfried Brosch, unseren sonstigen Hausrat, der in Kisten verpackt
war, in einen Eisenbahnwagen, auf dem Allensteiner Bahnhof verladen. Alles musste zuerst durch den Zoll, wo die
Federbetten gewogen wurden und über das erlaubte hinausgehende Kissen, verzollt werden mussten. Dasselbe galt auch für
Fleisch und Räucherwaren.
Am 26. Juli, unserem Verladetag, kam der Eisenbahnwagen aus Allenstein, erst um 11 Uhr auf dem Ortelsburger Bahnhof an.
Die Rinder hatten wir zu Fuß, zum Bahnhof gebracht; Schweine, Schafe und Hühner auf dem Pferdewagen. Im Eisenbahnwagen
mussten, mit Hilfe von Brettern und Bohlen, Boxen für die verschiedenen Tiere erstellt werden. Jedes Pferd und jedes
Rind in eine Bucht. Die Schafe zwischen die Pferde, die Schweine zwischen die Rinder und die Hühner in einem Käfig,
unter der Decke über den Rindern. Die Hühner hatten unterwegs Eier gelegt, somit hatten wir jeden Tag frische
Verpflegung. Bei der Fahrt im Viehwagen, begleitete mich mein Sohn Manfred. Als die Lokomotive nahte, um den Wagen
abzuholen, wurden noch schnell die restlichen Sachen hinein geworfen und so mache Abschiedsträne rollte dann die Wange
hinab.
Unsere Nachbarn, Deutsche und Polen, halfen uns beim Verladen des lebendigen Inventars. Jetzt erinnerte ich mich
plötzlich, an die oft auch schönen, Ereignisse der letzten 22 Jahre. Einer Zeit, in der das Zusammenleben von
Deutschen und Polen, von Jahr zu Jahr, besser wurde. Man half sich beim einbringen der Getreideernte, beim Dreschen
des Getreides, bei der Kartoffelernte und bei anderen Arbeiten, wo viele Menschen zupacken mussten. Es war eine
Dorfgemeinschaft, in schweren Zeiten geboren; jeder half jedem wenn Hilfe nötig war. Es wurde mir plötzlich bewusst,
das jetzt ein Lebensabschnitt zu Ende ging, zu dem ich nicht mehr zurückkehren konnte. Unsere Existenzgrundlage war
jetzt ein Eisenbahnwagen auf einem Schienenstrang, dessen Ende irgendwo in weiter Ferne lag. Obwohl, von langer Hand
vorbereitet, war dieser Moment voller Wehmut.
Doch als der Zug sich plötzlich, in Bewegung setzte, war ich sofort wieder in der Gegenwart. Menschen, mit denen man
Jahrzehnte lang, in gutem Einvernehmen zusammen gelebt hat, blieben plötzlich am Bahnsteig zurück und die Entfernung
zwischen ihnen und mir vergrößerte sich mit jeder Sekunde, bis sie letztendlich aus meinem Blickfeld verschwanden.
Es war ein heißer Julitag, als wir unsere Reise gen Westen antraten. Für die Schweine, die besonders unter der Hitze
zu leiden hatten, haben wir 10 Flaschen Essig mitgenommen und sie von Zeit zu Zeit besprenkelt, damit sie besser atmen
konnten. Für die anderen Tiere war reichlich Heu und Hafer vorhanden. Eine großes Fas und zwei Milchkannen waren mit
Wasser gefüllt, die wir auf den an der Strecke liegenden Bahnstationen, bei Bedarf wieder nachgefüllt haben.
Da der Kreistierarzt nicht in seinem Büro war, konnten wir die Impfbescheinigung für das Vieh, nicht rechtzeitig
herbeischaffen. Der Zug setzte sich in Bewegung und die Bescheinigung war immer noch nicht da. Als die Bescheinigung
dann eingetroffen, wir aber schon unterwegs waren, ist mein Sohn Kurt mit dem Motorrad hinterher gefahren und hat uns
in Passenheim, wo der Zug noch andere Wagen angehängt bekam, die Impfbescheinigung übergeben. Wir waren sehr froh das
er es noch geschafft hat, denn in solch einer Situation fühlt man sich sicherer wenn man alle Bescheinigungen bei sich
hat. Auf der Rückfahrt, mit dem Motorrad hatte er noch eine Panne, musste das Motorrad stehen lassen und per Anhalter
nach Hause fahren. Am nächsten Tag kam er mit Siegfried Deptolla, der das Motorrad wieder flott machte und brachte es
wieder nach Rohmanen zurück.
Die Fahrt mit dem Viehwagen, gen Westen
Von Ortelsburg bis Allenstein(45 km) hat unser Zug 4 Stunden gebraucht, weil auf jedem Bahnhof
gehalten wurde, um neue Wagen anzuhängen. Nachdem wir in Allenstein angekommen waren, kam ein Rangierer und fragte
nach unserem Ziel. Als wir ihm mitteilten, das wir in die Bundesrepublik Deutschland wollen, sagte er nur: „In 10
Minuten fährt ein Zug los. Wenn ich von euch 500 Zloty und einen Liter Wodka bekomme, werde euch sofort anhängen,
andernfalls kommt ihr auf ein Nebengleis und müsst dann auf den nächsten Zug warten. Es blieb uns nichts anderes übrig
als seiner Forderung nachzukommen, denn über derartige Erpressungen hat man bereits von Anderen, die vor uns ausgereist
sind, gehört. Wir wurden auch sofort angehängt und fuhren dann die ganze Nacht, an Osterode, und Thorn vorbei bis
Gnesen. Dort wurde wieder rangiert.
Von einer Anhöhe wurden die einzelnen Wagen auf verschiedene Gleise verteilt und zu neuen Zügen zusammengestellt. Der
Aufprall der ungebremsten Wagen erzeugte eine derartige Erschütterung, dass manche Bretter an den Boxen geborsten waren.
Von Gnesen ging es dann in einem Zuge durch bis zur Grenzstation Reppen(Rzepin). Dort mussten wir zum Zollamt, wo
unsere Ausfuhrpapiere durch die Zollbeamten, und durch einen Tierarzt geprüft wurden. Bis Reppen(Rzepin) haben wir für
den Eisenbahnwagen 900 Zloty bezahlt; hier mussten wir noch einmal 650 Zloty bezahlen. Bei der Wagenkontrolle erklärte
uns ein Bahnbeamter das unser Wagen, sich nicht für den internationalen Transport eignet und wir deshalb den Inhalt in
einen Anderen umladen müssen, der irgendwann, auf dem Nebengleis bereitgestellt wird. Nach langer Verhandlung, sowie
einer Zulage von 500 Zloty und einem Liter Wodka haben wir ihn davon überzeugt, das der Wagen sich doch für die
Weiterfahrt eignet.
In der Nacht war Schichtwechsel, der unseren Wagen wieder abgehängt hat, weil er angeblich von der Reichsbahn der DDR,
wegen technischer Mängel nicht weiterbefördert würde. Wir mussten unsere Verhandlung vom Vorabend wiederholen, die mit
der Zusage endete, dass wir am frühen Morgen, über die Grenze auf DDR Gebiet, gebracht werden. Um 5 Uhr morgens kam
eine Lokomotive, die uns den letzten Abschnitt bis über die Grenze bringen sollte. Als der Zug hat noch einmal anhielt,
kamen polnische Grenzbeamte und Soldaten in den Wagen. Sie durchsuchten ihn und fragten, ob wir noch polnisches Geld
oder einen Grundbuchauszug bei uns hätten. Wir zeigten ihnen 800 Zloty, die sie uns, nach Ausstellung einer Quittung
über 500 Zloty, abnahmen. Die Grundbuchauszüge habe ich, im Stroh versteckt, dem Ochsen vor die Füße gelegt. Falls
jemand da suchen sollte, hätte ich gesagt, das das Tier bösartig veranlagt ist, und ich für seine Sicherheit nicht
garantieren könnte, deshalb sollte er vorsichtig sein.
Als die Grenzkontrolle den Zug verlassen hatte, setzte sich die Lokomotive wieder in Bewegung und überquerte nach
kurzer Zeit die Oderbrücke. Auf einer eingezäunten Fläche, jenseits der Grenze, hat man uns abgestellt hat und die
Lokomotive fuhr zurück auf polnisches Gebiet. Vor und hinter uns waren die Tore verschlossen. Auf den Wachtürmen,
links und Rechts von uns, standen Posten mit einem Gewehr im Anschlag. Vier Grenzbeamte der DDR, jeder mit einer
Leiter in der Hand, sowie ein Schäferhund, kamen zu unserem Wagen. Sie öffneten die Schiebetüre, stellten die Leiter
davor und ließen den Hund in den Wagen springen, der nur etwas herum schnupperte und wieder heraussprang. 2 Beamte
haben dann anschließend, die Papiere kontrolliert und das Inventar gezählt.
Nach einiger Zeit wurden wir an einen Güterzug der Reichsbahn angehängt und fuhren von Frankfurt an der Oder, vorbei
an Berlin, Ellingen und Nordhausen, über die Grenze zur Bundesrepublik bis Herzberg. Hier hat ein Zollbeamter der
Bundesrepublik, die Formalitäten erledigt und ein Tierarzt die Pferde, Rinder und Schweine gründlich untersucht. Ich
musste ihnen die Mäuler aufhalten und die Füße hochheben. Danach hat uns die Lokomotive zu einer Wasserzapfstelle
gebracht, wo wir die Tiere tränken und unsere Behälter mit Wasser auffüllen konnten. Anschließen fuhren wir über
Northeim nach Göttingen, zur Viehverwertungsgenossenschaft, die zuvor von unserer Ankunft in Kenntnis gesetzt wurde.
Der Ochse, die Sterke und die Schweine wurden, in Göttingen zum Schlachthof gebracht; die Pferde kamen nach Hannover
und die Schafsböcke nach Kassel. Wir waren mit dem Viehtransport 5 Tage unterwegs; hatten so manche Klippe umschifft
und Schwierigkeiten gemeistert, die im normalen Leben nicht vorkommen.
Wir wurden mit einem PKW, ins Durchgangslager Friedland bei Göttingen gefahren, wo mein Sohn Kurt, meine Schwester
Frieda Pelkowski und Siegfried Brosch mit Familie, die am 30 Juli, um 14 Uhr, von Warschau mit dem Zug abgefahren, und
hier am 31. Juli in den Morgenstunden eingetroffen sind, schon auf uns gewartet haben. In Friedland hat man uns mit
Familie Siegfried Brosch in einem Raum untergebracht, wir wurden registriert und erhielten 20 DM Überbrückungsgeld,
pro Person. Da wir erst am Freitag in Friedland eingetroffen sind, mussten wir hier über das Wochenende bleiben,
obwohl die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der Regel nur 3 bis 4 Tage beträgt.
Um einen Antrag für die Ausreise stellen zu können, brauchten wir eine Einladung von in der Bundesrepublik lebenden
Verwandten. Diese Einladung hat uns mein Bruder, Ernst Rattay, aus Ingelheim am Rhein zugeschickt. Ingelheim liegt im
Bundesland Rheinland-Pfalz. Das Geld für die Bahnfahrt, hat uns, Frieda Schellin, geb. Nickel, aus Duisburg, die
Tochter unseres Nachbarn, überwiesen. In Friedland wurden wir registriert. Im Registrierschein, war als unser
nächster Aufenthaltsort in der Bundesrepublik, das Durchgangslager Osthofen bei Worms, das alle Aussiedler für
Rheinland-Pfalz aufnehmen musste, eingetragen. Die Eintragung erfolgte deshalb, weil der Ort aus dem uns unsere
Einladung zugeschickt wurde, sich auch in Rheinland-Pfalz befand.
Da ich nach dem Polenfeldzug, als Soldat, ein Jahr im Kreis Opladen, im Rheinland gewesen bin, wäre ich sehr gerne in
diese Gegend gezogen, denn die Erinnerung an die schönen Tage die ich dort verlebt habe war in mir immer noch wach.
Ich versuchte die Eintragung in unseren Regiestierscheinen ändern zu lassen, was nach einigen, vielleicht auch
berechtigten Einwänden, am 4. August, vom Beauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen, genehmigt wurde. Anstelle von
Rheinlad-Pfalz stand da jetzt Nordrhein-Westfalen und am 7. August, fuhren wir, noch mit anderen Aussiedlern, ins
Durchgangslager Unna-Massen, am östlichen Rande des Ruhrgebietes gelegen. Hier wurden wir in einem Zimmer untergebracht
und konnten unser Essen in einer Gemeinschaftsküche zubereiten.
Am 8. August wurden wir in Unna-Massen, als Bürger der Bundesrepublik Deutschland registriert, erhielten
Einhundert DM Begrüßungsgeld, den Vertriebenen Ausweis -A -und 4 Wochen später den Bundespersonalausweis. In
Unna-Massen haben wir mehr als 4 Monate verbracht, weil mein Sohn Kurt, wegen fehlender Berufsausbildung, in Unna, an
einem Grundlehrgang für Metallarbeiter teilgenommen hat, der vom Arbeitsamt finanziert wurde. Am 11 Dezember 1969 sind
wir endlich an unserem vorläufigen Wohnsitz, im Durchgangswohnheim, an der Elisabethstraße 13, in Velbert angekommen.
Ab dem 5. Januar 1970 konnten meine Söhne, in der Zahnradfabrik Reining, in Velbert ihrer geregelten Arbeit nachgehen.
Von Bau- und Sparverein in Velbert wurde uns am 20. Juni 1970, unsere erste Wohnung zugewiesen.
Velbert im Februar 1972
gezeichnet: Gustav Rattay
Die Rohmaner Feldmark erstreckte sich etwa über 1500 Hektar. Das Dorf bestand aus etwa 80 Höfen; die Abbauten und
nicht landwirtschaftlichen Gebäude mitgerechnet. Sechs Abbauten sind nach dem zweiten Weltkrieg, teils durch
Fronteinwirkungen, teils durch Vandalismus, unwiederbringlich verloren gegangen. Auf einen Teil der Rohmaner Felder
erstreckt sich auch der Dammerauer Höhenzug. Die höchste Erhebung von 210 Meter über dem Meeresspiegel, befindet sich
auf dem Feld von Friedrich Glinka. Da ist auch ein vierkantiger Granitstein eingegraben, der als Navigtionspunkt, zur
Erstellung von Kartenmaterial, genutzt wurde. Diese Stelle war mit einer Holzpyramide gekennzeichnet und diente auch
bei Truppenmanövern als Orientierungspunkt.
Im Bereich der Rohmaner Gemarkung befinden sich so gut wie keine Wiesen. Die Rohmaner Wiesen liegen etwa 10 Kilometer
entfernt; bei der Försterei Wickno, in Schodmak, in Seedanzig und in Neu Schiemanen. Kurz vor dem zweiten Weltkrieg,
haben Herr Biella und Friedrich Trzaska sich schon mit der staatlichen Forstverwaltung, darauf geeinigt, die Wiesen in
Neu Schiemanen gegen näher gelegene zu tauschen. Die neuen Wiesen liegen vor dem Waldpuschsee und befinden sich im
Besitz der staatlichen Forste. Obwohl die eingetauschte Fläche schon neu vermessen wurde und genutzt werden konnte,
wurde sie leider vom Katasteramt, noch nicht ins Grundbuch eingetragen. Auf Grund dieser Tatsache, wurde dieser
Tausch, nach dem Krieg, von den polnischen Behörden, nicht anerkannt.

In der Mitte des Dorfes befindet sich ein, 5 Morgen großer Teich, der den Bauern als Viehtränke diente und Enten sowie
Gänse zum verweilen einlud. Es wurde dort auch Löschwasser entnommen, wenn es im Dorf brannte. Im Teich waren auch
verschiedene Fische, die der Fischer Adam Glitza, in jedem Frühjahr neu eingesetzt hat. Die Fische sind wegen des
vielen Schlammes, der den Boden bedeckte, oft erstickt sind. Aus Richtung Ortelsburg kommend, liegt 50 Meter vor dem
Dorfeingang, zur rechten Hand, ein Soldatenfriedhof. Auf ihm haben die Gefallenen des 1.Weltkrieges, Deutsche und
Russen, ihre letzte Ruhe gefunden. Von der Landstraße kommend muss man einige Stufen hinaufsteigen, die von beiden
Seiten mit Birken bepflanzt sind.
Auf einer kleinen Anhöhe befindet sich die aus zwei Klassenräumen bestehende Dorfschule, mit einer Wohnung für den
Lehrer. Die Schule wurde 1906, mit tatkräftiger Unterstützung aller Dorfbewohner, aus gebrannten Lehmziegeln, gebaut.
Auf der Anhöhe, vor der Schule sind später Kastanienbäume gepflanzt worden, die den Schulkindern, an heißen Tagen
Schatten spendeten.
Die älteste Familie in Rohmanen war die Familie Friedrich Biella. Wie ich mich noch erinnern kann war sein Vater
Gemeindevorsteher. Nach seinem Tode hat das Amt sein Sohn Friedrich übernommen bis er 1914 als Unteroffizier in den
ersten Weltkrieg einrücken musste. Friedrich Biella hat aktiv bei der Garde in Berlin gedient. Bei den Wahlen und bei
der Abstimmung 1920 hat er sich sehr für den Erhalt des Deutschtums eingesetzt. Er hat auch im Jahr 1896, die
Freiwillige Feuerwehr in Rohmanen ins Leben gerufen und war zugleich ihr erster Brandmeister. Bei der Genossenschaft
und bei der Darlehenskasse war er im Vorstand. Dadurch war es ihm möglich die Rohmaner Bauern mit Krediten und
Kunstdüngern zu versorgen. Die Söhne Fritz und Wilhelm hat er aufs Gymnasium nach Ortelsburg geschickt und studieren
lassen. Bei Bauernversammlungen hat uns Fritz Biella Vorträge gehalten.
Eine weitere Familie war die des Gasthofbesitzers Friedrich Trzaska. Der Hof von Friedrich Trzaska war der älteste in
Rohmanen. Wenn die Bauern aus weiter gelegenen Dörfern, vom Wochenmarkt nach Hause fuhren, hielten sie oft an der
Gaswirtschaft an. Die Pferde, sowie die auf dem Markt eingekauften Rinder wurden dann, an einem vor dem Haus
angebrachten Querbalken festgebunden und die Besitzer machten es sich in der Gaststube gemütlich. Zwei große
Kastanienbäume standen zu beiden Seiten der Eingangstreppe und weiter rechts war ein großes Fenster, in dem, die im
Geschäft vorrätigen Artikel, ausgestellt waren; besonders zur Weihnachtszeit. Die Kinder drückten sich an der Scheibe
die Nase platt, um die vielen schönen Sachen, die sich die meisten Dorfbewohner nicht leisten konnten, wenigstens aus
der Nähe zu bestaunen.
In der Gaststube wurde Korn, sowie auch guter Bärenfang ausgeschenkt, und wenn es den Gästen gut geschmeckt hat, haben
sie es lange ausgehalten, so das für eine weitere Rast, in einem der nächsten Dörfer keine Zeit mehr übrig blieb. Die
alten Bauern erzählten auch; das es in ganz Ortelsburg, keinen so guten Schnupftabak gab, wie im Gasthof Trzaska. Zu
diesem Grundstück gehörte einst auch der Rohmaner See. Weil dafür keine Steuern gezahlt wurden hat sich der Besitzer
von Gut Frenzken den See angeeignet.
Als Königsberg zur Festung ausgebaut wurde, haben viele Männer dort Arbeit gefunden. Zu dieser Zeit war an eine
Beschäftigung im Kohlenbergbau, in Westfalen, noch nicht zu denken. Weil auch noch keine Eisenbahnlinie vorhanden war,
mussten sie den weiten Weg zu Fuß zurücklegen. Nachdem sie den ganzen Tag marschiert sind, haben sie in der Nacht ein
Feuer angezündet, eine Malzeit zubereitet und in der Nähe des Feuers, das sie vor wilden Tieren schützen sollte,
übernachtet. Die Reise nach Königsberg hat eine ganze Woche gedauert. Sie wurden dort zum Aufschütten der
Festungswälle eingesetzt.
Das Jahr 1914 wurde zum Schicksalsjahr, für Ostpreußen und seine Bevölkerung. Nach Abschluß der Volksschule im Jahr
1912, habe ich in den Wintermonaten einen Fortbildungslehrgang für die Landwirtschaft besucht, den Hauptlehrer Aaron,
der aus Olschienen nach Rohmanen versetzt wurde, für uns organisiert hatte. Da im Dorf 2 Trompeten vorhanden waren,
hatte er uns nahe gelegt eine Kapelle zu gründen, dann könnten wir ja die Soldaten, die aus dem Krieg heimkehren
würden mit Musik empfangen. Zum Abschluss konnte man sich ein Buch oder ein Obstbäumchen wünschen. Eine Woche vor dem
Einmarsch der Russen, haben wir noch mit einem Breitdrescher, der durch ein Rosswerk dass von 6 Pferden angetrieben
wurde 110 Zentner Roggen gedroschen. Der Lehrer Malayka hat sich 1914 freiwillig zum Militär gemeldet. 1915 hat er uns
als Offiziersanwärter besucht. Im Frühjahr 1916 wurde mein Jahrgang gemustert und im Herbst 1916 wurden wir eingezogen.
Ausbruch des Ersten Weltkrieges
Am 2. August 1914 wurde die Allgemeine Mobilmachung ausgerufen. Alle wehrfähigen Männer folgten
dem Ruf des Kaisers und eilten zu den zuständigen Wehrmeldeämtern um die Grenzen des Vaterlandes zu schützen. Wir als
Grenzbewohner bekamen das Meiste zu spüren. Alle Häuser, Scheunen und Ställe waren mit Soldaten und ihrem Tross belegt.
Die Einen gingen, die Anderen kamen. Die Kosaken hatten bei Muschaken und Radzinen die Grenze überschritten. Der
Flüchtlingsstrom hatte sich von der Grenze her angestaut. Die Russen haben überall geplündert. Die Trosse mussten sich
zurückziehen und haben dazu vorwiegend die Feldwege benutzt. Die Pferde waren erschöpft. In einer Nacht kam der
Gemeindevorsteher mit einem deutschen Offizier auf unseren Hof. Mein Vater und der Nachbar Wilhelm Dorka mussten mit
ihren Pferden aushelfen. Sie waren 2 Tage unterwegs, bis zu einem Gut in Kleeberg bei Allenstein. Als sie dann wieder
nach Hause kamen waren die Russen schon am Rohmaner Friedhof. In der Zwischenzeit hatten wir schon den Leiterwagen mit
Mehl, Rauchfleisch und Betten beladen.
Der überwiegende Teil der Rohmaner war schon losgefahren. Der Hauptlehrer Müller kam noch mit dem Fahrrad vorbei und
sagte es wäre höchste Zeit das wir wegkämen weil die Russen schon Ortelsburg besetzt hätten und im Anmarsch auf
Rohmanen wären. Wir sind auf eine Anhöhe gestiegen und haben die Staubwolken beobachtet, aber wir dachten es wäre
deutsches Militär.
Auf der Flucht vor den Russen
Kurz vor Sonnenuntergang haben wir die Pferde vor den fertig gepackten Wagen gespannt und sind
sofort losgefahren. Mein Bruder und ich nahmen 4 Milchkühe und die beste Sterke mit und gingen hinterher. Schweine,
Kälber und Geflügel haben wir aus den Ställen getrieben. Wir waren die ganze Nacht unterwegs und sind bis Rheinswein
gekommen. Da hatten wir einen Onkel wohnen, bei dem haben wir den ganzen Tag verbracht.
Unterwegs haben wir einen Mann getroffen, der erzählte uns dass die Russen bei Groß Jerutten einen Personenzug
überrumpelt haben. Sie hatten aus Eisenbahnschwellen eine Sperre auf den Schienen errichtet und somit den Zug zum
Anhalten gezwungen. Die Russen haben den Zug mit Artillerie beschossen. Als die Soldaten und Zivilisten den Zug
verlassen wollten kamen die Kosaken zu Pferde und haben ein Massaker angerichtet. Nur wer sich am Boden davon
schleichen konnte hat überlebt. Die Russen wurden durch einen Verräter darüber informiert das auf diesem Gleis ein
Zug unterwegs war und waren darauf vorbereitet. Unserem Informanten ist es auch gelungen dem Massaker zu entkommen.
Ein Kosake hatte ihm im beim vorbeireiten mit dem Säbel ein Ohr abgehauen und ihn dadurch zu Boden geschlagen. Es ist
ihm danach gelungen ins Gebüsch zu schleichen. Sein Kopf war schon verbunden als wir ihn trafen. Später wurde an der
Stelle des Überfalls ein Gedächtnisstein errichtet.
Im Morgengrauen sah man viele Kosaken über die Felder reiten. Wir sind dann später wieder weiter in Richtung
Jellinowen gefahren. Unser Vater ist mit dem Pferdewagen die Landstraße entlang gefahren. Wir mit dem Vieh sind
entlang einer tiefen Schlucht durch den Wald bis zum Babanter See gegangen. Wir hatten schon vorher versucht die
Schlucht zu verlassen aber wegen der steilen Hänge ist es uns leider nicht gelungen. Am See angekommen fanden wir drei
große Schober mit Getreide vor. Von einem dieser Schober haben uns zwei Kosaken mit einem Fernglas beobachtet. Sie
schwangen sich auf ihre Pferde und kamen uns entgegen geritten, dann hielten sie uns ihre Lanzen vor die Brust und
versuchten uns auszufragen. Wir haben leider nichts verstanden und fingen an zu weinen. Plötzlich pfiff der
Patrollienführer auf einer Trillerpfeife und die Kosaken kehrten zu ihrem Ausgangspunkt zurück.
Als wir dann weiter am See entlang gingen sahen wir von weitem drei Gehöfte. In der Nähe einer dieser Höfe hatte unser
Vater den Pferdewagen im Gestrüpp abgestellt. Die vorrückenden Schützenlinien der russischen Infanterie hatten ihn
jedoch entdeckt. Sie haben den Wagen durchwühlt und den Sack mit Rauchfleisch mitgenommen. Andere Flüchtlingswagen die
in diesem Gebüsch Schutz gesucht haben sind nicht besser davon gekommen. Wir haben das Vieh auf einen der Höfe
getrieben und am Zaun festgebunden. Dann haben wir mit Hilfe einer Leiter den Heuboden erklommen und uns dort versteckt.
Als die Kosaken auf dem Hof erschienen verlangten sie Brot und Milch. Die Frauen mussten zuerst essen und trinken,
danach haben es die Russen auch getan, sie fürchteten sich davor, dass man sie vergiften könnte. Später kam dann die
russische Infanterie und hat Haus, Scheune und Schuppen durchsucht. Die Falltüre zum Heuboden ließ sich nur nach oben
hin öffnen. Wir hatten die Türe von oben mit schweren Gegenständen beschwert, aber die Russen versuchten mit aller
Gewalt auf den Heuboden zukommen. Als die Frauen das sahen, sagten sie zu den Russen, da oben würden sich ihre Kinder
versteckt halten. Die Russen forderten nun, die Kinder sollten sofort den Heuboden verlassen. Die Mütter riefen nun
nach ihren Kindern die dann auch tatsächlich den Heuboden verließen. Als wir das sahen, haben wir uns am Giebel tief
im Heu vergraben. Drei Russen kamen nun rauf und stocherten mit ihren Bajonetten im Heu herum. Glücklicherweise kamen
sie nicht in unsere Nähe. Als die Russen den Heuboden verließen haben wir befürchtet sie würden ihn in Brand setzen.
Wahrscheinlich taten sie deshalb nicht weil so viele russische Soldaten auf dem Hof waren. Einige Zeit später
erschienen russische Offiziere auf dem Hof, mit einem Auto. Sie sagten, sie hätten das Land erobert und wir hätten ab
sofort dem russischen Zaren zu gehorchen. Wir wurden angewiwsen nach Hause fahren und unbesorgt unsere Ernte
einzubringen. Sie haben uns auch eine Bescheinigung ausgestellt, damit uns auf dem Heimweg niemand die Pferde und
das Vieh wegnehmen würde.
Erst am nächsten Morgen, als die Front weiter vorgerückt war, beschlossen wir die Heimreise anzutreten. Die Straßen
waren mit vorrückenden russischen Truppen blockiert. Manchmal mussten wir stundenlang am Wegesrand warten bis die
Soldaten mit ihrem Tross vorbeigezogen waren. Unterwegs wollten sie unser Vieh zum Schlachten wegnehmen, aber die
Bescheinigung hat uns davor bewahrt. Die Eisenbahnbrücke vor Neu-Keykuth wurde von Kavallerie bewacht. Die wollten uns
nicht drüber lassen und hielten uns bis zum frühen Morgen fest. Zurück in Rohmanen angekommen, konnten wir unser Haus
nicht betreten weil der Hof und alles rundherum ein großes Militärlager war.
Wir sind dann in Richtung Seelonken gefahren, bis Abbau Brosch. Auf dem Hof angekommen haben wir zuerst Grünfutter für
die Pferde vom Feld geholt und anschließend Mittag für uns selbst gekocht. Die Nacht haben wir erstmal auf dem Hof
verbracht. Am nächsten Morgen wagten wir es ins Dorf zu gehen um die Lage zu erkunden. Die Russen waren schon wieder
weiter gezogen, aber Haus und Hof waren in einem schrecklichen Zustand. Wir sind dann gegen Abend wieder nach Hause
zurückgekehrt.
Am 23. August 1914 waren die Russen bei uns eingebrochen, bis sie am 28. August von den Deutschen zurückgeschlagen
wurden. Dann fuhren sie wieder zurück, drei Wagen nebeneinander. Ortelsburg brannte lichterloh. Ein Wagen mit Mehl war
uns gegenüber in den Straßengraben gekippt, aber wir haben nichts davon genommen, weil man ja nicht wusste ob man die
Nacht überleben würde. Wir saßen die ganze Zeit im Keller. Am nächsten Morgen zog dann russische Kavallerie und
Infanterie durch unser Dorf. Die Kavallerie ritt orientierungslos hin und her. Die Infanterie hat den ganzen
Vormittag 1,5 Meter tiefe Schützengräben ausgehoben. Um 11 Uhr kamen aus Richtung Eichtal 3 deutsche Spähwagen nicht
ahnend dass die nördliche Hälfte des Dorfes noch von Russen besetzt war. Wir haben zu diesem Zeitpunkt auf dem
Dachboden Weizen eingesackt und hatten aus diesem Grunde einen weiten Rundblick.
Um 11 Uhr kamen aus Richtung Eichtal drei deutsche Spähwagen angefahren. Als wir die deutschen Soldaten erkannt hatten,
haben wir sie durch Handzeichen gewarnt weiter nach Norden vorzustoßen. Die Kosaken hatten sich auf den Häuserdächern
positioniert und in Richtung Norden nach deutschen Truppen Ausschau gehalten. Die Deutschen sprangen von den Spähwagen
und fingen an die nichts ahnenden Russen zu beschießen. Als die sich ihrer gefährlichen Lage bewusst wurden verließen
sie ihre Aussichtsposten und bestiegen ihre Pferde. Mit Peitschenhieben versuchten sie, die sich in panikartiger Flucht
befindliche Infanterie dazu zu Bewegen, die Deutschen anzugreifen. Zwei Spähwagen wendeten sofort, der Dritte konnte
nicht mehr umkehren. Es gelang allen, bis auf den Fahrer des dritten Wagens die Flucht. Die Russen nahmen ihn sofort
unter Beschuss, doch es gelang ihm über unseren Hof zu entkommen. Auf der rückwärtigen Seite schlug er sich quer durch
die Gärten bis zum Gehöft von Friedrich Sakowski durch. Der versteckte ihn im Keller und versorgte ihn anschließend
mit Zivilkleidung.
Als die Russen den Soldaten auf unseren Hof laufen sahen nahmen sie sofort die Verfolgung auf. Sie durchstöberten auch
die Nachbarhäuser und trieben die Bewohner auf der Straße zusammen. An der Spritzenwagenremise richteten sie einen
Sammelpunkt ein. Unter dem Vorwand es würde hier eine Schlacht stattfinden, versuchten die Russen die Zivilbevölkerung
aus dem Dorf zu drängen. Alle die dem Aufruf gefolgt sind und an unserer Sammelstelle vorbeikamen wurden unserem Haufen
hinzugefügt. Unter ihnen befand sich auch der deutsche Soldat in Zivilkleidung. Er hatte einen Sack über die Schulter
geschlagen in dem sich ein Brot befand, an der anderen Hand führte er eine Kuh am Strick. Als unser Haufen schon aus
etwa 50 Leuten bestand setzten uns die Russen mit Marschrichtung Seelonken in Bewegung. Wir Jungen versuchten in einem
unbeaufsichtigten Moment wegzulaufen, doch die Begleitmanschaft prügelte uns mit Gewehrkolben wieder in Reihe und Glied.
Unterwegs gelang es dem Soldaten mit der Kuh unbemerkt zu entkommen. Er kehrte unbehelligt ins Dorf zurück und lieferte
die Kuh wieder dort ab wo er sie entführt hatte.
Uns haben die Russen an Seelonken vorbei zum Sylvensee getrieben. Wenn sie von vorbeiziehenden russischen Offizieren
gefragt wurden weshalb wir unterwegs wären, sagten sie denen wir hätten deutsche Soldaten versteckt und wollten das
Versteck nicht verraten. Als wir am See vorbei waren begann die deutsche Artillerie aus Richtung Ortelsburg zu
schießen. Unweit von uns explodierten Granaten und richten ein großes Chaos unter Freund und Feind an. Es hieß dann
rette sich wer kann. Die Russen verließen uns in Richtung Waldpuschsee und wir kehrten orientierungslos nach Seelonken
zurück. Nach Rohmanen konnten wir nicht zurück weil die deutsche Artillerie aus Richtung Eichtal anfing unser Dorf zu
beschießen. Schließlich sind wir auf dem Abbau Brosch untergekommen. Ein durch Granatsplitter schwer verletzter Russe
suchte dort auch Zuflucht. er versucht sich mit einem Messer das Leben zu nehmen. es gelang den Frauen ihn davon
abzubringen, weil sonst bei einem etwaigen erscheinen von russischen Soldaten der Verdacht auf uns gefallen wäre.
Später erschienen tatsächlich Kosaken die ihn dann mitgenommen haben. Ihnen folgten in 50 Meter Entfernung Deutsche
Ulanen, die hinter den Russen in einem in der Nähe liegenden Wäldchen verschwanden.
Nachdem die Russen Rohmanen besetzt hatten, versteckten sie sich vorwiegend in mit Stroh gedeckten Gebäuden. Durch
Schießscharten, die sie im Strohdach anlegten, schossen sie auf die deutschen Kampfverbände, die sie wieder vertreiben
wollten. Um die Angreifer zu entlasten, wunde das Dorf von deutscher Seite unter Beschuss genommen. Durch die
Geschosse der deutschen Artillerie entstanden in Rohmanen viele Brände. Die mit Stroh gedeckten Gebäude fielen zuerst
in Schutt und Asche. Unser Vater hatte uns ins Dorf geschickt, damit wir das Vieh im Stall von der Kette losbinden
sollten. Am Dorfrand kamen uns schon deutsche Ulanen und Husaren entgegen. Rohmanen brannte an mehreren Stellen. Unser
Hof war noch unversehrt, nur die Zäune standen schon in Flammen. Wir haben das Vieh los gebunden und anschließend
versucht die Brandherde rund herum zu löschen. Es gelang uns die Flammen von unserem Hof fernzuhalten und auch bei
unserem Nachbarn einzugreifen. In vielen Scheunen und Ställen hatten sich noch viele versprengte Russen versteckt. Die
wurden anschließend von deutschen Soldaten eingesammelt und in Gefangenenlager abgeführt. Am nächste Tag haben wir dann
zerbrochene Gewehre und Munition in Körbe gesammelt und im Dorfteich versenkt.
Am 29. August haben die Russen Rohmanen verlassen, doch schon am 30. August sind sie wieder zurückgekehrt. Hauptlehrer
Müller wurde mit seinem Sohn und Karl Deptolla auf Fahrrädern fahrend von einer russischen Patrouille aufgegriffen.
Sie wurden von den Russen der Spionage verdächtigt weil der Lehrer Müller ein Fernglas bei sich trug. Der Sohn hatte
eine Gymnasiastenmütze und eine Landkarte bei sich. Sie wurden in Richtung Lehmanen abgeführt. Auf einer Anhöhe des
Grundstücks von Ernst Chittka befand sich eine nicht mehr betriebstaugliche Windmühle. Dort soll ein russisches
Kriegsgericht sie zum Tode verurteilt haben. Nach der Hinrichtung wurden sie in der Nähe der Windmühle verscharrt.
Später wurden sie wieder ausgegraben, in Särge gelegt und auf dem Rohmaner Friedhof beigesetzt. Die Ehefrau von Lehrer
Müller hat die Gräber nach dem 1. Weltkrieg mit einem schmiedeeisernen Zaun umrandet.
Die Kämpfe um Rohmanen haben viele Menschenopfer gekostet. Bei uns hinter der Scheune lagen 2 tote Russen und ein
Verwundeter. Die Toten haben wir in einer Kartoffelmiete vergraben. Alle anderen Gefallenen wurden auch gleich an der
Stelle an der sie zu Tode kamen verscharrt und mit einem Kreuz gekennzeichnet. Für die im Raum Rohmanen gefallenen
Russen wurde nach dem Krieg hinterm Dorf, in Richtung Ortelsburg, auf einer Anhöhe ein Heldenfriedhof angelegt. Dort
liegen 20 Soldaten und 1 Offizier. In der Mitte befindet sich ein Trauerbaum und Birken säumen den Zugang von der
Landstraße her. Der Lehrer Dorka hat nach dem Kriege, mit seinen Schülern immer die Gräber gepflegt.
Meine Einberufung zum Militär

Bis zu meinem 17. Lebensjahr habe ich meinem Vater in der Landwirtschaft geholfen. Im Frühjahr
1916 wurde unser Jahrgang gemustert. Im Herbst 1916 erhielten Gustav Spektor, Johann Resonek und ich einen
Einberufungsbescheid. Wir mussten uns in Allenstein im Kaisergarten melden. Dort wurden Rekruten aus mehreren
Landkreisen zusammen gezogen und danach verschiedenen Ausbildungszentren zugeteilt. Wir Rohmaner kamen zum 18.
Infanterie-Regiment nach Osterode. Ein Unteroffizier mit einer Gruppe Musketiere haben uns von Allenstein abgeholt.
Als wir in der Kaserne ankamen haben wir sofort Mittagessen in Blechnäpfen bekommen. Untergebracht wurden wir im
Dachgeschoß der Kaserne. Es waren keine Betten vorhanden, nur Strohsäcke lagen auf dem Boden.
Als dann einige Tage später ausgebildete Kompanien an die Front ausrückten durften wir in einen anderen Block umziehen.
Wir wurden der Größe nach aufgestellt, in Korporalschaften eingeteilt und dann von Kopf bis Fuß eingekleidet. Die
Ausgehuniformen hatten blanke Knöpfe dazu einen Schako mit blanker Spitze. Im neuen Block hatten wir 2stöckige Betten.
Unsere Zivilbekleidung mussten wir in einen Karton verpacken und nach Hause schicken. Dann erst begann das eigentliche
Kasernenleben. Die Kaserne durfte niemand ohne Erlaubnis verlassen, nur in Begleitung eines Unteroffiziers. In der
Kaserne war eine Kantine in der man alles kaufen konnte was in der Kaserne gebraucht wurde.
Am nächsten Tag kam unser Kompanieführer, im Range eines Hauptmanns, zu Pferde angeritten. Er begrüßte uns mit;
Guten Morgen Kameraden, wir antworteten ihm mit; Guten Morgen Herr Hauptmann. Er hat dann die Front abgeschritten und
jeder musste sich mit seinem Namen vorstellen. Um 5 Uhr wurde geweckt, 6 Uhr Kaffee holen, 7-8 Uhr Unterricht, 8-11
Uhr exerzieren auf dem Kasernenhof. Um 11.30 blies der Trompeter zur Mittagspause. Die erste Zeit war noch alles
ziemlich gemütlich aber dann wurde es von Tag zu Tag strenger. Um 10 Uhr abends war Zapfenstreich, dann ging der
Unteroffizier vom Dienst von Stube zu Stube, der Stubenälteste musste die Anwesenheit aller Rekruten melden; zum
Beispiel: Stube 56 belegt mit 14 Mann, alle zu Haus. Wir mussten in 2 Reihen antreten, mit Drillichanzug bekleidet
und in Pantoffeln, ein tadelloses Aussehen präsentieren. Der Diensthabende Unteroffizier prüfte ob alle
vorschriftsmäßig angezogen, gewaschen, gekämmt und ob alle Knöpfe an der Jacke geschlossen waren. Als er bei einem
Rekruten einen offenen Knopf erspähte, hat er uns gefragt, ob jemand ein Taschenmesser bei sich hat.
Wir ahnten nicht Gutes, darum haben wir uns ganz still verhalten und nichts gesagt. Da sagte der U.v.D. plötzlich:
”Wenn niemand von euch ein Messer bei sich hat, dann habe ich ein”. Er zog sein Messer aus der Tasche und fing an, bei
dem Rekruten die Knöpfe abzuschneiden. Als die Knöpfe zu Boden purzelten, brachen wir in lautes Gelächter aus. Das hat
ihn so in Rage gebracht, das unser unwürdiges Benehmen, zuerst mit einem „Donnerwetter” bestraft wurde. Dann schrie
er: ”In den Korridor marsch, marsch, die Treppen runter bis auf den Hof”. Als wir unten angekommen waren hieß es
wieder; "Zurück auf die Stube in der 3. Etage”. Jemand hat mir bei dem Durcheinander, von hinten in den Pantoffel
getreten, so das er auseinander gerissen wurde. Ich bin dann nur mit einem Pantoffel und einem Socken die Treppen rauf
und runter gelaufen. So wurden wir 3-mal hinunter und wieder hinauf gejagt.
Danach ließ er uns wieder antreten und hat mit einer Taschenlampe unter den Betten geleuchtet. Plötzlich schrie er
wieder los: "Das nennt ihr Fegen? wenn ihr mit dem Besen nicht fegen könnt, dann mühst ihr das mit eueren Bäuchen tun.
Marsch, marsch unter die Betten” . Als wir schon alle am Schlafen waren, kam der U.v.D. wieder und hat nachgesehen ob
alle Schränke abgeschlossen waren. Ein Kamerad hatte seinen Schlüssel verloren, deshalb hat er das Schoß nur so
eingehängt. Als der U.v.D. das bemerkte hat er die Türe aufgerissen, die ganzen Sachen aus dem Schrank, quer durch die
Stube verteilt und war dann endlich gegangen.
Die Anziehsachen mussten, fein sauber gefaltet, auf dem Stuhl liegen; da drauf die Socken und die Pantoffeln unter dem
Stuhl. Die Stühle mussten in einer Reihe ausgerichtet sein; die Hosenträger im Schrank einschlossen und der Brustbeutel
mit Geld auf dem Hals tragen werden. Morgens wurden wir geweckt und kamen zuerst in den Waschraum. Jeder musste seinen
entblößten Oberkörper mit kaltem Wasser abreiben. Da draußen strenger Frost herrschte war es im Waschraum auch sehr
kalt, so das manche ihr Hemd anbehielten. Der UvD hat dann bei seinem Kontrollgang alle Verweigerer aufgeschrieben
und ihnen befohlen in 30 Minuten mit einem Besen in der Hand auf der Schreibstube zu erscheinen. Einige mussten den
Kasernenhof fegen, andere die zugefrorenen Latrinen enteisen und reinigen. Während unserer Ausbildungszeit durften wir
die Kaserne nicht verlassen. Wenn man Stuben- oder Frühdienst hatte, blieb keine Zeit zum Frühstücken.
Nach 6 Wochen wurden wir in der Grollmann Kaserne vereidigt. Die Regimentskapelle spielte "Heil dir im Siegerkranz",
danach folgten 3 Strophen des Deutschlandliedes. Vor der Vereidigung wurden die Rekruten gefragt wer keine deutsche
Staatsangehörigkeit besitzt. Es sind dann Luxemburger und auch noch welche aus anderen Ländern hervorgetreten. Sie
wurden gefragt ob sie die deutsche Staatsangehörigkeit annehmen wollen. Die das abgelehnt haben wurden auf die
Schreibstube gerufen und sofort aus dem Militärdienst entlassen. Nach der Vereidigung erfolgte ein Kirchgang, danach
konnte man einen Stadturlaub beantragen. Nach dem Mittagessen mussten alle, die einen Urlaubschein beantragt hatten
vor der Kaserne antreten. Der Hauptfeldwebel prüfte dann ob an der Uniform alle Knöpfe blank geputzt waren, die Stiefel
glänzten und der Rekrut auch vorschriftsmäßig grüßen konnte. Wer diese Anforderungen nicht erfüllen konnte musste
seinen Urlaubschein wieder abgeben und zurück auf sein Zimmer gehen.
Wenn man die Kaserne für eine gewisse Zeit verlassen wollte, mussten zuerst der Korporal, dann der Hauptfeldwebel und
letzt endlich der Hauptmann, seine Zustimmung erteilen. Es wurde geprüft; ob die Ausgeh-Uniform sitzt, alle Knöpfe
blank geputzt sind und der Helm so blank ist das man sich darin spiegeln kann. Unser Hauptmann war in Zivil,
Bürgermeister von Osterode. Er war sehr stolz wenn er seine Kompanie, in Parade Uniform und mit einem fröhlichen Lied
auf den Lippen, durch seine Stadt führen durfte.
Als wir eines Tages zum etwa 6 Kilometer entfernten Schießstand marschieren sollten, war es sehr kalt und glatt. Der
Hauptmann ritt durch das große Tor, wir aber sind durch das kleine Tor gegangen und haben eine steil bergab führende
Abkürzung gewählt. Die Zug- und Gruppenführer gingen voraus und wir im Gänsemarsch hinterher. Ein Kamerad hat sich auf
den Gewehrkolben gesetzt und ist darauf den Berg hinunter gerutscht. Als die Anderen das sahen haben sie es ihm
nachgemacht und hatten einen Riesenspaß. Da kam der Hauptmann plötzlich im Galopp angeritten; ließ alles anhalten und
hat zuerst die Zugführer ausgeschimpft, dann anschließend die ganze Kompanie. Er sagte: „Wie könnt ihr es wagen, so
mit eueren Gewehren umgehen. Ein Gewehr soll man wie seine Braut behandeln und nicht wie einen Straßenbesen”. Zur
Strafe mussten wir, links und rechts der Straße, in zwei Reihen antreten und durch den verschneiten Straßengraben
robben. Die Herrn Zug- und Gruppenführer durften die Straße benutzen und erteilten uns nur Befehle, wie: hinlegen,
nach rechts schwenken, nach links schwenken, einzeln vorarbeiten und sammeln. Als wir dann abgekämpft, in Linien zu
2 Glieder angetreten waren, ging es mit Gesang zum Schießstand.
Auf dem Schießstand angekommen, erhielten wir zuerst eine praktische Unterweisung, für den Gebrauch von Schusswaffen.
Wir mussten solange mit einem nicht geladenen Gewehr üben, bis wir unserem Vorgesetzten beweisen konnten, dass wir
alles im Griff haben. Daraufhin wurden jedem 10 Patronen zugeteilt, so das er unter der Aufsicht eines Unteroffiziers
mit den Schießübungen beginnen konnte. Der Unteroffizier hat die Position der Einschüsse, auf der Scheibe, in einem
Buch eingetragen und nach Beendigung der Übung dem Hauptmann Bericht erstattet, ob der Schütze seine Aufgabe erfüllt
hat oder nicht. Nach dem Schießen wurden die Gewehre zu Pyramiden zusammengestellt. Diejenigen die ihre Aufgabe nicht
erfüllt haben, mussten rund um die Zielscheibe, die Bleikugeln aufsammeln.
Seit unserer Einberufung hatten wir noch keinen Heimaturlaub. Urlaub bekamen nur die, die ihren Heimatort zu Fuß
erreichen konnten. Wegen der vielen Truppentransporte die täglich von Ost nach West unterwegs waren durften wir die
Eisenbahn nicht benutzen. Einmal wurde uns gesagt; wenn jemand gut schießen kann der bekommt Heimaturlaub, aber auch
das war nur ein leeres Versprechen.
Kaisers Wilhelms Geburtstag
Der beste Tag war des Kaisers Geburtstag. Am 27. Januar mussten alle in der Grollmann Kaserne
antreten, der Battalions-Kommandeur beendete seine Laudatio mit den Worten: Seine Majestät, unser Kaiser und König
Wilhelm II, erlebe hoch, hoch, hoch. Dann spielte die Regimentskapelle: Heil dir im Siegerkranz, Herrscher des
Vaterlands, Heil Kaiser dir. Danach folgten 3 Strophen des Deutschlandliedes und anschließend fand ein Gottesdienst
statt. Anschließend gab es ein vorzügliches Mittagessen, Schweinebraten, ein Stück Wurst auf die Faust und Biermarken,
die man in der Kantine gegen gutes Bier einlösen konnte, danach Urlaub bis zum Wecken, ohne Urlaubschein. Mein Vater
und die Mutter eines Kameraden waren schon morgens angekommen, konnten uns aber nicht finden, wurden von einer Kaserne
in die andere geschickt. Erst als wir mit Musik, von der Kirche zurück zur Kaserne marschiert sind habe ich sie
zufällig entdeckt. Als sie mich auch erkannt haben, sind sie nachgekommen. Da war die Freude groß: Der Vater hatte
einen großen Koffer auf einem Krückstock über die Schulter getragen. Ich ging gleich zur Wache und habe sie angemeldet,
sie sind dann bis zum Abend geblieben. Es war einer der schönsten Tage in der Grollmann-Kaserne in Osterode.
Alle 10 Tage bekamen wir Sold. Vor der Auszahlung mussten wir antreten, jeder wurde gefragt ob noch Restgeld vom
letzten Sold vorhanden war. Dann bekam jeder 3,30 Mark, davon musste man noch Sidol für das Koppelschloss und
Schuhkreme für die Stiefel kaufen. Wer geraucht hat und nichts von zu Hause bekam war schlimm dran. Beim Militär bekam
man nicht nur die Ausbildung an der Waffe beigebracht, man lernte auch putzen, nähen, Strümpfe stopfen und vieles
Andere. Man bekam einen beschädigten Strumpf, der musste aufgeribbelt werden, mit der Wolle konnte man dann andere
Strümpfe stopfen oder Kleidungsstücke mit Namen kennzeichnen. wer das nicht konnte, der musste seinen Kameraden
Zigaretten oder Geld geben die das dann für ihn erledigten.
Verschiedene Kameraden gingen nach dem Dienst noch in die Stadt. Um 21:45 Uhr wurde zum Zapfenstreich geblasen, dann
musste man schnell zurück in die Kaserne, weil um 22:00 Uhr der Wachhabende von Bett zu Bett ging und prüfte ob auch
alle anwesend waren. Zwei mal pro Woche fanden Gewaltmärsche statt, mit vollem Gepäck im Tornister. Am Ende der
Marschkolonne fuhr dann ein Pferdewagen, wenn der Feldarzt bei jemandem einen Erschöpfungszustand feststellte, der
durfte dann aufsitzen. Am Sonnabend wurden auf dem großen Exerzierplatz Felddienstübungen durchgeführt, es befand sich
dort ein großer Hügel, den wir immer wieder erstürmen mussten. Am Nachmittag war Revierreinigen angesagt, wir mussten
dann die Tische schrubben, auf einen Tisch wurde Sand mit etwas Wasser gestreut, der nächste Tisch wurde mit der den
Beinen nach oben drauf gelegt und solange hin und her geschoben bis beide sauber waren. Mit den Stühlen geschah das
Gleiche. Dann wurde der Fußboden in der Stube geschrubbt, die Schränke abgewaschen, Staub geputzt, zuletzt kamen Flur
und Treppe dran.
Für die Arbeit war eine Stunde angesetzt, wenn jemand zu früh fertig war erregte er den Argwohn des Diensthabenden
Korporals, der prüfte dann alles genau, fand natürlich immer etwas das nicht seinen Erwartungen entsprach. Der
Übereifrige musste dann Nacharbeiten bis die Stunde um war. Eine Stunde war für Gewehr reinigen und Unterricht an der
Waffe vorgesehen.
Im Februar wurden wir neu eingekleidet; Schnürschuhe, Koppel, alles gelbes Leder mussten wir mit Lederschwärze
behandeln. 2 Wolldecken, Uniform und Helm in feldgrau, da brauchten wir die Knöpfe nicht mehr zu putzen. Die neuen
Gewehre mussten zuerst eingeschossen werden. Es wurden 90 scharfe Patronen und Marschverpflegung ausgegeben, danach
mussten wir mit vollem Gepäck zum Appell antreten. Man konnte kaum gerade stehen, weil der Tornister einen in die Knie
zwang. Der Major, der die Aufstellung besichtigte rief >Brust raus<, dann informierte er uns dass wir ins
Feldrekrutendepot und in Feindesland kommen. Urlaub bekam niemand. Ich habe ein Telegramm nach Hause geschickt, mit
der Nachricht dass wir bald abrücken werden. Einen Tag vor dem ausrücken hat mich meine Mutter noch besucht, sie hat
mir vieles mitgebracht. Alles konnte ich nicht mitnehmen, weil es nicht gestattet war anderes Gepäck bei sich zu haben
als dem Soldaten zustand.
Abmarsch zum Fronteinsatz
Am nächsten Tag hat uns die Regimentskapelle mit Musik zum Bahnhof gebracht. Von Osterode ging
es über Thorn, Posen,
Annaberg, Warschau, Brestlitowsk ins Pruschana-Lager. Das war eine russische Artillerie-Kaserne, in der 2 deutsche,
3 österreichische Bataillone und eine Offiziersschule untergebracht waren. Ein Bataillon das waren wir 18 und 19
jährige, die Anderen waren Männer bis 45 Jahre. Als wir in Osterode abfuhren lag Schnee, in Annaberg/Schlesien waren
die Kühe auf der Weide und im Pruschana-Lager lag der Schnee wieder einen Meter hoch. Drei Kilometer vor unserem vor
unserem Lager war die Bahnfahrt zu Ende. Mit den schweren Tornistern waren viele überfordert, wir mussten immer wieder
warten bis alle nachkamen. Unsere Unterkünfte das waren Baracken die den Russen als Pferdeställe gedient hatten. In
jeder Baracke wurde eine Kompanie mit Schreibstube untergebracht, die nur durch ein Zelt abgegrenzt war.
Wir haben aus Brettern Doppelbetten hergestellt, in jeder Baracke war ein Ziegelofen. Unsere neuen Uniformen und die
scharfe Munition mussten wir abgeben und bekamen dafür alte Bekleidung, sowie Ecksezierpatronen. Hier ging es wieder
Kasernenmäßig zu, das jüngere Bataillon bekam besseres Essen, doppelte Portionen und nach dem Essen 2 Stunden Bettruhe.
Wenn jemand die Bettruhe nicht einhielt und dabei erwischt wurde wusste zur Strafe Holz hacken oder Schnee schaufeln.
Zwei Wochen war Frost bis minus 40 Grad, da hatten wir keinen Unterricht im Freien, alle Aktivitäten fanden in der
Baracke statt, die nur mit nassem Holz beheizt wurde und dem entsprechend war auch die Temperatur im Inneren. Um
Brennmaterial für die Küche zu besorgen mussten wir ins nächste Dorf gehen und von zerfallenen Häusern Holz holen.
Als endlich das Tauwetter einsetzte verwandelte sich die Gegend um Baranowitschi in ein unüberwindbares Sumpfgelände.
Wir wurden mit anderen Einheiten die aus Frankreich zu uns verlegt wurden, zusammengelegt. Wenn jemand nachweisen
konnte dass er Landwirt ist und mehr als 100 Morgen Ackerland besitzt, konnte er einen Urlaub zur Frühjahrsbestellung
beantragen. Ein Gottlieb Piotrowski aus Plohsen hat seinen Urlaub bewilligt bekommen und durfte für 14 Tage nach Hause.
Wenn von der unweit entfernten Front Kanonendonner zuhören war und Alarm ausgerufen wurde, dachten wir es geht los.
Obwohl wir als Reserve aufgestellt waren mussten wir allzeit einsatzbereit sein. Wir haben auch Bunker und Stollen
gebaut, Schützengräben ausgeworfen und mit scharfen Handgranaten exerziert.
Als Gottlieb Piotrowski nach 2 Wochen zurückkam waren wir schon in Alarmbereitschaft und sind dann auch 2 Tage später
ausgerückt. Kamerad Piotrowski hatte mir noch ein großes Paket von zu Hause mitgebracht.
Italien hat Deutschland und Österreich den Krieg erklärt.
Zuerst sind drei Bataillone Österreicher ausgerückt, dann die Deutschen hinterher. Bis zum
Bahnhof Linowa wurden wir von einer Musikkapelle begleitet, dann ging es per Eisenbahn ab nach Baranowitsche. Dort
wurden wir der, an der Westfront aufgeriebenen, 15ten Reserve Division zugeteilt. Es wurde uns gesagt das Kameraden
aus der Heimat gleichen Gruppen zugeordnet werden können. Ich hatte einen Freund aus meinem Dorf, Gustav Spektor,
einen aus Groß Schöndamrau, Wilhelm Lukas und einen aus Ortelsburg, Karl Schlensack, wir kamen zu zusammen in eine
Kompanie. Zuerst waren wir in einem Kinosaal einquartiert, haben jeden Tag Schützengräben ausgehoben und Feldübungen
gemacht. Es war ein sumpfiges Gelände, so dass die Soldaten wegen den vielen Mücken, Netze auf den Köpfen tragen
mussten. Nach einem Gewitter wurde es plötzlich unerträglich. Die Mücken hatten meinen Freund so zerstochen dass sein
Gesicht dermaßen angeschwollen war und ich ihn gar nicht wieder erkannt habe.
Von Baranowitsche wurden wir wieder auf die Eisenbahn verladen, die uns mit unbekanntem Ziel Richtung Osten fuhr.
Nachdem wir unterwegs einmal zum Essenfassen gehalten haben, kamen wir in der Nacht in Krakau an. In der nächsten
Nacht befanden wir uns schon in den Karpaten, wo wir die Hügelketten zu Fuß überqueren mussten, die Fahrzeuge fuhren
um die Berge herum und wir mussten manchmal 2 Stunden warten bis sie uns wieder eingeholt hatten. So ging es immer
weiter bis wir auf einen Berg kamen wo wir Zelte aufgebaut und Biwak bezogen haben. Dort stießen wir auf türkische
Einheiten die auf Mauleseln Munition und Verpflegung über die Berge transportiert haben. Die Esel hatten ein Gestell
auf dem Rücken, auf jeder Seite eine Fass mit Wasser oder Kisten mit Proviant. Ihre Artillerie wurde von 6 Mauleseln
gezogen, während die Offiziere, ohne Sattel, ohne Zaumzeug, nur mit einem Hanfseil ausgerüstet, daher kamen.
Die Mannschaften marschierten wie es jeder für richtig hielt, mit aufgekrempelten Ärmeln, das Gewehr über den Tornister
gelegt, wie die Wilddiebe. Im Gegensatz dazu herrschte bei uns strenge Disziplin, wen jemand aus der Reihe ging kam
sofort der Kompanieführer angeritten, hat uns angeschrieen, uns klar gemacht dass wir keine Türken seien und nur auf
höheren Befehl etwas an der Marschordnung ändern dürften, wer dagegen verstoße, müsste mit einem 3tägigen Arrest
rechnen. Wir haben hinter der der Front Gewaltmärsche durchgeführt die dem Feind große Truppenaufmärsche vortäuschen
sollten.
Wir lagen in einem Buchenwald in Bereitschaft. Überläufer berichteten dass auf russischer Seite eine Großoffensive
vorbereitet wird. In einer Nacht wurde plötzlich Alarm geschlagen, der Russe war zu einem Angriff mit Gasgranaten
übergegangen. Wir lagen unter Zelten und hatten die Gasmasken gar nicht bei uns, sondern nur etwas abseits liegen. In
der Dunkelheit hat mach einer keine Gasmaske mehr gefunden. Es war ein fürchterliches Durcheinander. Dabei war es
unsere Pflicht die Maske immer an dem Tragriemen über dem Hals zu tragen, mit halb geöffnetem Deckel. Uns hat es zum
Glück nicht so stark betroffen weil wir auf einer Anhöhe lagen und die Gaswolken sich im Tal verteilten. Wir wurden in
höchste Alarmbereitschaft versetzt weil der Russe die österreichische Front durchbrochen hatte.
Eigentlich sollten wir noch an einer Gulaschkanone Essen fassen, aber es blieb uns dazu keine Zeit mehr. Der
Kompanieführer befahl uns die Zelte abzubrechen, auf den Tornister aufzurollen und in fünf Minuten marschbereit zu
sein. Die Kanoniere befanden sich schon in der Batteriestellung, luden die Granaten, die sofort abgefeuert wurden. Der
Battalions-Kommandeur versammelte die Kompanieführer und erteilte ihnen die Angriffsbefehle. Derweil sollten wir in
einem Eichenwal der schon mit Granattrichter übersät war, Deckung suchen. Bald hatten wir die Verbindung zu unserem
Batteriestab verloren. Wir warfen unsere Tornister auf einen Haufen, schwärmten unverzüglich, nur mit Sturmgepäck
ausgerüstet, 4 Handgranaten im Brotbeutel, zum Angriff aus. Wir robbten uns einzeln voran. Weil der Russe unsere
Stellungen schon überrannt hatte war jeder auf sich selbst angewiesen. Mann hörte kein Kommando mehr weil der Russe
inzwischen den Rückzug angetreten hatte, um sich auf einer Bergspitze zu verschanzen, von der er uns mit
Flachbahngeschützen beschoss. Irgendwann befanden wir uns in einem Schützengraben, wo ein Leutnant und 17 Mann aus
unserer Division die Stellung hielten. Unter Androhung von Gewalt befahl er uns den Graben sofort zu verlassen und am
Gegenangriff teilzunehmen. Wir sprangen über den Stacheldraht, duckten uns aber sofort im nächsten Graben damit das
mörderische Maschinengewehrfeuer uns nicht hinwegfegte.
Dort blieben wir bis zum Eintritt der Dunkelheit liegen. Wir konnten unsere Waffen nicht mehr einsetzen weil der Sand
die Gewehrschlösser blockiert hatte. Als es Nacht wurde herrschte ein gespenstische Stille. Wir krochen aus dem
Schützengraben und lauschten nach irgendeinem Lebenszeichen von anderen Kameraden. Dann hörten wir irgendwelche Laute
die wir nicht genau zuordnen konnten. Sie kamen aus einem Holzbunker ganz in der Nähe. Wir näherten uns ganz
vorsichtig, als plötzlich eine Schar österreichischer Soldaten herausstürmte. An unseren Stahlhelmen erkannten sie
dass wir Deutsche sind. Bald danach trafen wir auch auf 69 deutsche Soldaten die zu unserer Division gehörten. Dann
kam ein Hauptmann der uns mit Vorwürfen überschüttete, wir seien Feiglinge, wir hätten uns von unserer Einheit entfernt.
Wir haben ihm den Vorgang geschildert, aber ließ nicht mit sich reden und sagte nur dass wir bestraft werden und nichts
zu essen bekommen. Wir wurden einer Maschinengewehr Einheit zugeteilt welche die vorderste Stellung verteidigen
musste. Wir hatten einen Stollen mit 2 Ausgängen.
Die Russen haben bemerkt das sich etwas bewegte und haben uns unverzüglich mit Artilleriefeuer belegt. Schon die
dritte Granate war ein Volltreffer. Vier Kameraden waren sofort tot, ich bekam mit einem Stollenbrett in den Rücken
der sofort blau und grün angelaufen war. Ich schaute nach oben, alles war verschüttet. Ich wusste nicht das da noch
ein Ausgang war, doch die Kameraden die hier in Stellung waren haben mir geholfen das Freie zu erreichen. Ich habe
mich am nächsten Tag krank gemeldet, dachte 2 Tage Schonung zu bekommen, aber der Sanitäter hat mir nur den Rücken mit
Spiritus eingerieben und mich wieder, zurück zu unserer Kompanie geschickt. Sie bestand nur noch aus 3 Gruppen, die in
einem Stollen, der in einen Berg gehauen war, Stellung bezogen hatten. Wir konnten uns hier wenigstens waschen, an
einer Quelle die aus dem Felsen sprudelte. Wir waren nicht mehr einsatzfähig und mussten durch andere Truppenteile
verstärkt werden.
Beim Essen holen musste man auch das Gewehr bei sich haben, es wurde erzählt dass hier der braune Bär herumwandert.
Ich habe keinen gesehen, nur das die Toten ausgescharrt wurden und verstümmelt herumlagen. Nach einigen Wochen haben
die Deutschen eine Gegenoffensive gestartet, von den Bergen herunter, über den Fluss Zlota Lipa, bis zu einer Stadt
die Brzezany hieß. 2 Tage später wurden wir auch eingesetzt, bei großer Hitze ging es in Dauermärschen vorwärts, man
durfte aus den Flüssen kein Wasser trinken, weil es mit Petroleum verseucht war. Nur wenn es dunkel wurde machten wir
halt, dann mussten wir Gräben ausheben um vor Überraschungen sicher zu sein.
Links von uns war Tarnopol und rechts Rumänien. Wenn es nach einer Ruhepause wieder losging dann war es am schlimmsten,
man ging wie auf Nägel, weil die Füße die Strapazen nicht so ohne weiteres wegsteckten. Im Dorf wurde niemals Rast
gemacht, denn da waren immer Brunnen, zu denen alle hinstürmten. Später wurden Melder vorausgeschickt, die von den
Dorfbewohnern Wasser in Eimern am Weg raussetzen ließen, damit die Soldaten Ihren Durst löschen konnten. Ein Soldat hat
gleich den ganzen Eimer mitgenommen und ihn dann als er leer war, irgendwo am Wegrand stehen lassen. Der Kompanieführer
kam angeritten, hat ihn ausgeschimpft und gedroht, ihn mit 3 Tagen Arrest zu bestrafen. Wir gehörten zur Südarmee
welche von Graf Bothmer befehligt wurde.
Die Stellungen waren schlecht ausgebaut, abends mussten wir, von der 2 Kilometer hinter der Front liegenden Feldküche,
Essen und andren Proviant holen. Ich war der Jüngste der Gruppe, musste immer 9 Kochgeschirre tragen, Brot und Post
habe ich in 2 Sandsäcke, die ich über der Schulter hängen hatte, verstaut. Wenn wir unterwegs waren wurde der
Laufgraben immer beschossen. Einmal schlug eine Granate am Schützengrabenrand ein und hat mich halb verschütte, die
Kochgeschirre aus den Händen gerissen, so dass ich ohne Verpflegung im vorderen Graben ankam. Nach drei Wochen sollten
wir abgelöst werden Es hat jeden Tag geregnet, wir haben unsere Mäntel angezogen und uns mit Zelten bedeckt. Nach dem
wir abgelöst wurden kamen wir in ein Dorf dass von Juden bewohnt war. Die Bewohner waren froh dass wir keine Kosaken
waren, mit denen hatten sie vor ein par Tagen schon schlechte Erfahrung gemacht, die hatten ihnen beim Abzug Vieh und
Pferde weggenommen.
Der Boden war sehr fruchtbar, es wurden Hanf, Weizen, Hafer, Mais, Bohnen, Roggen und Kartoffeln angebaut. Die
Bewohner waren gerade mit der Ernte beschäftigt. Die Häuser waren nur aus Holz und Stroh erbaut. Die Leute lebten in
sehr ärmlichen Verhältnissen. Ich hatte mir in unserer Kantine für 20 Pfennig ein Taschenmesser gekauft, das hat mir
ein Bauer für 6 Eier und 2 Pfund Brot abgekauft, daraus hat er sich dann ein Rasiermesser geschliffen. Wenn unser
Versorgungstross auf denn holperigen Wegen nicht nachkam, haben im Dorf auch Verpflegung eingekauft. Die Leute hatten
Angst dass wir nicht bezahlen werden, doch wir bekamen meistens pünktlich unseren Wehrsold ausgezahlt und konnten uns
so manches genehmigen. Um unser Marschgepäck zu erleichtern haben wir so manches aus dem Tornister weg geworfen.
Unweit eines Dorfes wurde halt gemacht, wir sollten Zelte aufschlagen, doch niemand hatte mehr Zeltstöcke im Tornister,
alles war unterwegs liegen geblieben. Der Zugführer befahl uns ins Dorf zugehen und Stöcke zu besorgen. In einer
Scheune stießen wir auf eine Hühnerschar, mit den Stöcken haben wir einige Hühner erlegt, in einem Hanffeld gerupft
und dann im Eiltempo zurück zu unserer Truppe. Als wir ankamen war die Kompanie schon marschbereit, es gleich weiter,
mit dem Huhn im Tornister. Bei der nächsten Rast haben wir die Hühner ausgenommen und Holz besorgt um sie zu kochen,
doch wir mussten schnell wieder weiter marschieren und erst nach 2 Tagen konnten wir uns mit den Hühnern befassen,
leider waren die so alt das sie nicht gar wurden. Das Fleisch mussten wir wegwerfen, nur die Suppe konnten wir noch
gebrauchen.
Meine Verwundung am Pruth.
Wir befanden uns 8 km vor der russischen Grenze. Der Kompanieführer hatte uns informiert das
wir hier zum Einsatz kommen. Wir bekamen noch ein Mittagessen aus der Gulaschkanone, konnten unsere Feldflaschen mit
Tee, der mit Rum angereichert war, auffüllen, Munition und Handgranaten in Empfang nehmen und dann ging es zum Einsatz.
Um 3 Uhr begann das ganze Bataillon auszuschwärmen, sofort hat uns der Russen entdeckt und begann uns mit Artillerie
zu beschießen, je weiter wir vorrückten desto heftiger.
Bis zu einem Eisenbahndamm hatten wir gute Deckung, doch wir sollten den dahinter fließenden Fluss überqueren. Doch
plötzlich explodierte über meinem Kopf eine Schrapnellkugel, der Stahlhelm wurde mir vom Kopf gerissen, Tornister und
Koppel flogen auch weg, ich lag auf der Erde und wusste gar nicht was passiert war. Plötzlich fing Blut aus der
Kreuzbeingegend zu rieseln, aus dem rechten Oberschenkel auch. Gleich nebenan war ein Granattrichter, dort habe ich
Schutz gesucht. In der rechten Rockecke hatte man immer ein großes Verbandspäckchen, das habe ich herausgenommen und
auf die Wunde gedrückt, doch das Blut floss mir bis in den Stiefel. Links und rechts von mir schlugen Granaten ein,
dicke Erdbrocken und Schlamm fielen auf mich herab, doch in meinem Erdloch war ich vor Maschinengewehrsalven geschützt.
Der ganze Rücken war angeschwollen und ich konnte mich überhaupt nicht bewegen.
Die Deutschen mussten die Stellung den Russen überlassen, einer hatte mich entdeckt, da ich aber so blutverschmiert da
lag, hat er bestimmt gemeint ich wäre nicht mehr am leben und ist weitergegangen. Nach zwei Stunden habe ich gehört
das die Russen sich wieder zurückzogen, danach herrschte eine gespenstische Stille. Als es dunkel wurde kamen deutsche
Sanitäter mit Spürhunden und haben die Verwundeten aufgesammelt. Ich wurde auf eine Trage gelegt, lag gebeugt und
konnte mich nicht rühren weil der blutverschmierte Rücken völlig verkrustet war. Ein Pferdegespann konnte nur vier
Tragen befördern, die Fahrt über Ackerfurchen war eine Tortur, ich habe nicht geglaubt das ich es überleben werde. In
einer Dorfkirche wurden wir dann ausgeladen und zu den etwa 50 Verwundeten gelegt die da schon lagen.
Mich haben sie zu den Bauchschüssen gelegt, weil ich einen Nervenschock hatte und am ganzen Körper gezittert habe. Zu
trinken bekam ich nichts, nur einen feuchten Lappen in den Mund. Ich sollte gleich operiert werden, aber es kamen
immer mehr Verwundete, so bekam ich nur eine Tetanusspritze, wurde verbunden und für den Weitertransport ins Hinterland
vorbereitet. Im Morgengrauen wurden wir auf Lastautos verladen, die aus auf ein Landgut brachten, wo wir in einem
Pferdestall untergebracht wurden. Die Fahrer fuhren so schnell über die Granatlöcher, das wir vor Schmerzen geschrieen
haben. Wir baten sie langsamer zu fahren, aber die bekamen es in ihrem Führerhaus nicht mit, erst alt ein Verwundeter,
der einen Krückstock bei sich hatte von hinten die Scheibe einschlug wurde die Fahrt erträglich. Lastautos, die
Munition und Verpflegung an die Front transportiert hatten, brachten in den nächsten Tagen immer wieder Verwundete
ins Hinterland. Die Deutschen hatten an diesem Fronabschnitt hohe Verluste zu beklagen. Wir können von Glück reden
dass wir dem Höllenfeuer überhaupt entkommen sind.
Wir wurden mit Lastautos, die ein Feldlazarett uns geschickt hatte, bis nach Lemberg befördert. da wurden wir gewaschen,
rasiert und frisch verbunden. Auf einem Nebengleis stand ein Lazarettzug, in dem wurden wir anschließend in frisch
bezogenen Betten untergebracht. Der Zug brachte uns über Annaberg nach Freiburg in Sachsen, eine Stunde hinter Dresden.
Hier wurden wir auf Tragen gebettet und mit einem Möbelwagen in ein Reservelazarett transportiert.
Im Heimatlazarett.
Als ich am nächsten Tag aufwachte und das schöne Bett sah in dem ich lag, dachte ich dass ich
im Himmel bin. Ich dankte meinem Herrgott das er mich bis zu diesem Ort begleitet hat. Am Nachmittag kamen Schulkinder
mit Geschenken und haben uns schöne Lieder vorgesungen. Anhand von Röntgenaufnahmen wurde in den nächsten Tagen
festgestellt dass bei mir ein Schrapnellsplitter an der Wirbelsäule in die Kreuzbeingegend eingedrungen war. Ich wurde
jeden Tag in Salzwasser gebadet und bekam wieder volle Verpflegung, da mein Magen zum Glück nicht verletzt war. Auf
dem Transport bekam ich nur Suppe und bei Bedarf einen feuchten Lappen auf die Lippen. Ich bin von 62 auf 43 Kilogramm
abgemagert, gehen konnte ich wegen dem Nervenschock den ich bei der Verwundung erlitten hatte auch noch nicht. Die
Wunde am rechten Oberschenkel war nur ein Streifschuss und wurde mit einem Schutzverband versorgt.
In den nächsten Tagen habe ich einen Brief nach Hause geschrieben und mitgeteilt wo ich mich zurzeit befinde. Meine
Eltern schickten mir ein Paket mit Lebensmitteln, jetzt konnte ich essen was ich wollte. Das Essen im Lazarett war
nicht besonders, jeden Tag nur Kohlblätter. Der weg zu den Toiletten führte durch einen Gemüsegarten. Die gehfähigen
Kameraden haben den ganzen Kohlrabi aufgegessen, so dass schließlich Wachposten aufgestellt werden mussten. Sechs
Wochen lang konnte ich mich nur auf allen Vieren fortbewegen, denn sobald ich mich aufrichtete wurde es mir
schwindelig und ich musste zurück ins Bett.
Als ich wieder bei Kräften war habe ich meinen Eltern mitgeteilt das ich mich in ein Lazarett in ihrer Nähe verlegen
lassen will. Der Chefarzt hatte mir zugesichert, wenn die Möglichkeit besteht in Ortelsburg unterzukommen, wird er dem
zustimmen. Meine Mutter hat daraufhin, in Ortelsburg, beim Lazarettinspektor Zantopf nachgefragt und er hat angedeutet
das sie mich aufnehmen können. Daraufhin bekam ich die Krankenpapiere und einen Fahrschein nach Ortelsburg. Da ich als
Soldat nie Heimaturlaub hatte, beschloss ich zuerst meine Eltern zu besuchen. Ich fühlte mich noch sehr schwach, habe
nach jedem Kilometer Rast gemacht, aber letztendlich war ich wieder daheim bei meinen Eltern. Die Wiedersehensfreude
war sehr groß. Ich bin am 30 Juli verwundet worden und am gleichen Tag wurde mein ältester Bruder beerdigt. Er bekam
den Splitter einer Gasgranate ins rechte Bein und ist an einer Blutvergiftung verstorben.
Am nächsten Tag brachte mich mein Vater ins Garnisonslazarett nach Ortelsburg. Ich wurde jeden Tag gebadet und massiert,
weil die Rückenhaut am Knochen angewachsen war konnte ich mich nicht schmerzfrei bücken. In Ortelsburg verbrachte ich
noch sechs Wochen, bis Ende Oktober, da wurde es schon ziemlich kalt und in unserer Barackenunterkunft ziemlich
ungemütlich. Kohlen und anderes Brennmaterial lagen im Hof auf Halde, aber es war verboten zu heizen. Kameraden die in
der Nähe zu Hause waren konnten Sonntagsurlaub beantragen.
Einer von ihnen brachte von zuhause Brennholz mit und entzündete damit im Ofen ein wärmendes Feuer, andere holten vom
Hof Kohlen, so dass der Ofen in kurzer Zeit glühend heiß wurde und die Gefahr bestand das die Betten Feuer fangen
würden. Wir hatten die Betten schon weg gerückt, da kam der Feldwebel herein und fragte wer das Feuer im Ofen
angezündet hat, doch niemand fühlte sich angesprochen. Der Feldwebel hatte den Vorfall dem Stabsarzt gemeldet, als der
am nächsten Morgen zur Visite kam, war seine erste Frage: ”Wer hat gestern Abend das Feuer im Ofen angezündet”. Als
sich niemand meldete, schrie er uns an: ”Morgen wird alles entlassen, zum Ersatzbatallion, in Diez an der Lahn! Wer
gehen kann, sofort zur Schreibstube, Krankenpapiere und Fahrscheine abholen”. Er erinnerte uns noch daran am nächsten
Tag pünktlich am Bahnhof zu sein, weil eine Verspätung unangenehme Folgen für uns haben würde. Das war das Ende der
schönen Erholungsphase. Ich blieb noch eine Nacht zu Hause und bin dann am nächsten Tag von dort zum Bahnhof gegangen.
Wieder Kriegsverwendungsfähig.
Als wir am nächsten Tag in Diez angekommen waren, wurde ich gefragt ob ich aus dem Heimaturlaub
käme, als ich das verneinte wurden mir 2 Tage genehmigt und 14 Tage Genesungsurlaub dazu. Wieder zurück im
Ersatzbatallion bestand unsere Tätigkeit aus Wache schieben und Kartoffel schälen. Nach einem Monat wurden wir von
einem Generalarzt untersucht, er hat mich für nicht einsatzfähig befunden weil ich noch den Steckschuss im Rücken
hatte und das linke Bein 10 Zentimeter dünner war. Jetzt fing das Kasernenleben wieder von vorne an. Wachdienst,
Gewehr laden, sichern, Ehrenbezeugung, Einzelmarsch und Appell. Wer nicht weit nach Hause hatte bekam zu Weihnachten
Urlaub. Ich hatte zu Heiligabend und Silvester Torwache, denn nach Ostpreußen wurde niemand beurlaubt.
Nach Neujahr 1918 wurden wir neu eingekleidet und kamen nach Köln zur Baukompanie. Mit Musik wurden wir zum Bahnhof
gebracht. In Köln wurden wir noch mit Soldaten die von andern Truppenteilen dorthin verlegt wurden in einem großen
Kinosaal, im Stadtteil Edengarten untergebracht. Wir brauchten keinen Dienst zu machen und konnten zu Heilige Drei
Könige den Gottesdienst im Dom besuchen. Kameraden die aus irgendwelchen Gründen im Arrest saßen wurden gefragt ob sie
auch am Gottesdienst teilnehmen möchten, dann würde ihnen die Strafe erlassen. Fast alle haben dem zugestimmt. Einige
Tage später wurden wir wieder auf einen Transportzug verladen, der uns über Herbestal, Antwerpen nach Brügge in Belgien
brachte. Hier mussten wir den Zug kurzfristig verlassen und einen Luftschutzkeller aufsuchen, weil Fliegeralarm
gemeldet wurde. Danach ging es wieder weiter nach Turut, Kortemark, Hauseme, Kautremollen, Zaren, Zarenlinde. Dort
wurden wir in verschiedene Gruppen aufgeteilt und einer Pionierkompanie auf dem Pionierpark Struwendorf zugewiesen.
Wir haben hinter Klerken Bunker für schwere Maschinengewehre gebaut. Unsere Arbeit konnten wir nur bei Nebel verrichten,
denn bei Sonnenschein waren wir sofort dem Beschuss der feindlichen Artillerie ausgesetzt. eine Kleinbahn die Munition
und Stacheldraht an die Front brachte war dem Beschuss besonders ausgesetzt. Die Gleise, von schweren Geschossen
zerfetzt, mussten immer wieder hergerichtet werden, damit der Nachschub aufrechterhalten werden konnte. Später haben
wir am Kemelberg bei Armentier, eine Brücke über die Lys gebaut. Um in dem Sumpfgelände einen Untergrund dafür zu
schaffen, mussten wir 10 bis 12 Meter lange Pfähle in den Boden rammen. Ein Feldwebel gab immer den Befehl: „Hoch den
Bär, noch viel mehr, dass man sieht, wie er zieht, denn dieser Pfahl, glatt wie ein Aal, durch Fels und Stein, durch
Wasser und Sand, fürs Vaterland”. Jedes mal mussten wir den Bär an Schnüren hochziehen und dann wieder herunterlassen.
Wenn es manchmal, trotz vieler Mühe nicht mehr weiter ging wurde der Pfahl auf eine bestimmte Länge abgeschnitten.
Nach Fertigstellung der Brücke kamen wir in die Siegfriedstellung bei Kambrei, zum Bau eines Bataillons-Gefechtstandes.
Da der Boden kreidehaltig war, mussten wir die großen Stücke von Hand zu Hand reichen, den Schutt haben wir dann mit
Sandsäcken aus der Baugrube gehoben und mit Ästen getarnt, damit der Stand nicht von feindlichen Fliegern entdeckt
werden konnte. Alle acht Stunden wechselte die Arbeitsgruppe. Wir mussten von der Baustelle durch das Gelände robben,
denn aufrecht gehend war man dem Beschuss der feindlichen Scharfschützen ausgesetzt, die von einem Fesselballon aus
informiert wurden der über den feindlichen Linien stand.
Der Wechsel war mit einem großen Risiko verbunden, und wurde wenn Möglich bei Dunkelheit vollzogen. Um vor
Überraschungen sicher zu sein haben wir spanische Reiter (Stacheldrahtverhaue) gebaut und vor die ersten Gräben
gestellt, die dann oft in der Nacht von den Franzosen geklaut, und dann vor ihren eigenen Linien wieder aufbaut wurden.
Wir hatten aus Bohlen eine Brücke auf Rädern gebaut, die dann in den Graben geschoben wurde, damit die Artillerie und
andere Fahrzeuge über die Schützengräben kamen. Weil um vier Uhr morgens der Beschuss mit Gasgranaten begann, mussten
wir Gasmasken aufsetzen, danach haben feindliche Flieger unsere Munitionskolonne bombardiert und total aufgerieben.
Es wurde auch eine Marinedivision eingesetzt, die bis dahin dem Küstenschutz gedient hatte und jetzt ihren ersten
Einsatz hatte.
Wir sind zuerst ein ganzes Stück in Richtung Amiens vorangekommen, doch dann blieb unser Angriff in den zuvor von
Engländern besetzten Stellungen, stecken. Da die Engländer ihre Stellungen fluchtartig verlassen hatten, fiel ihr
ganzer Proviant in unsere Hände; Schokolade, Weißbrot, Flaschenwein. Die erste Nacht haben wir in einem runden Zelt
verbracht, weil ich mir durch den starken Wind, der da herrschte eine Angina zugezogen hatte, die mit hohem Fieber
verbunden war, konnte ich die vielen Köstlichkeiten überhaupt nicht genießen.
An eine ärztliche Versorgung war überhaupt nicht zu denken, denn es mussten zuerst die vielen Granatlöcher eingeebnet
werden damit die vielen Fahrzeuge und Geschütze wieder weiter fahren konnten. Auch eine Bahnlinie musste repariert
werden, damit die großen Geschütze in Stellung gebracht werden konnten, dabei wurden auch die vielen Kriegsgefangenen,
die bei dieser Offensive gemacht wurden, eingesetzt. Als die Offensive dann schließlich scheiterte, wurden wir an die
Somme verlegt. Da habe ich die Ortelsburger Jäger, die aus Italien an die Westfront verlegt wurden, zum ersten Mal im
Einsatz gesehen.
Unser nächster Einsatzort waren dann Stellungen hinter Laon. Hier wurden die Vorbereitungen zu einer neuen Offensive
getroffen. Feindliche Flieger versuchten uns Tag und Nacht daran zu hindern die Aufmarschwege instand zu halten. Als
die Offensive dann endlich losging, hatten wir die Order eine Brücke über die Oise mit Bohlen und Balken zu verstärken.
Gleich am Anfang der Offensive mussten wir Gasmasken anlegen, um für alle Fälle gewappnet zu sein. Nur die Artillerie
und Kraftfahrzeuge durften die Landstraße benutzen, die Infanterie ging immer im Straßengraben und wurde von einer
Seite von Kopf bis Fuß mit Dreck bespritzt. Die Franzosen und Engländer haben hier schon Panzer eingesetzt, die von
Truppen aus den Kolonien gefahren wurden. Die Australier gingen mit umgekrempelten Ärmeln hinter den Panzern her.
Die letzte Offensive des Ersten Weltkrieges.
Zum Jahresende 1917 hatten noch 153 deutsche 175 alliierten Divisionen gegenübergestanden.
Zur Vorbereitung der Offensive ließ Ludendorff 39 Divisionen aus dem Osten und aus Italien heranziehen. Er ließ
spezielle Angriffsdivisionen formieren, die durch intensive Ausbildung auf den beabsichtigten, schnellen Vormarsch
vorbereitet wurden. 6608 Geschütze, 3500 Minenwerfer und 1070 Flugzeuge wurden hinter dem vorgesehenen
Angriffsabschnitt konzentriert. Den Ausbildungsbefehlen Ludendorffs, die bis zu den Kompanieführern herab verteilt
wurden, konnte man entnehmen, dass der Versuch, den Krieg mit einem mächtigen Schlag zu entscheiden schon in der
nächsten Zeit gewagt werden sollte. Wir übten die fast vergessenen Formen des Schützengefechts und des
Bewegungskrieges, auch wurde eifrig mit Gewehr und Maschinengewehr geschossen. Wir hegten keinen Zweifel daran, dass
der große Plan gelingen würde.
Den ganzen Winter 1917/18 über plante der Generalquartiermeister Ludendorff die deutsche Offensive. Zwar hatten die
Vereinigten Staaten von Amerika dem Deutschen Reich am 6. April 1917 den Krieg erklärt, aber vor dem Sommer des
Jahres 1918 war mit dem Auftreten von US-Truppen in relevanter Größenordnung nicht zu rechnen. Der deutschen Führung
blieb nur ein schmales Zeitfenster, um die Niederlage und den zu erwartenden Diktatfrieden abzuwenden. Ypern,
Armentieres, Arras, Cambrai oder Verdun wurden ernsthaft als Schauplätze erwogen. Ludendorf entschied sich für einen
Angriff zwischen Cambrai und La Fere – genau an der Nahtstelle zwischen der Französischen Armee und dem britischen
Expeditionscorps.
Der Fluss Somme bildete die Grenze zwischen Franzosen und Briten. Die Briten – nicht die Franzosen – sollten das Ziel
des Vorstoßes werden. Ihre Stellungen waren nur 130 Kilometer von der Kanalküste entfernt. Beim erreichen der
Sommemündung wäre die gesamte britische Armee eingeschlossen gewesen, denn hinter ihnen lag die Straße von Dover.
Am 21. März 1918 begann die letzte entscheidende Offensive des deutschen Westheeres im Ersten Weltkrieg. Der
Angriffsstreifen war 75 Kilometer breit. Dort hatte Ludendorff 43 Angriffsdivisionen konzentriert, dahinter 30
weitere Reservedivisionen, ihnen standen lediglich 26 britische Divisionen gegenüber. „Michael“ – so der Deckname der
„Kaiserschlacht“ – lief dank Ludendorffs akribischer Vorbereitung gut an. Der britische Oberbefehlshaber General
Douglas Haig erkannte die Chance, welche die Deutschen in dieser Situation hatten. Wollten die Deutschen diese Chance
nutzen, mussten sie darauf verzichten die Somme zu überschreiten, wo sie auf die französischen Reserven treffen und
sich von der Küste entfernen würden. Genau diesen Fehler begingen jedoch die Deutschen.
Am dritten Tag überschritt der linke Flügel mit der 18. Armee die Somme. Ludendorf stellte die Taktik über die
Strategie, wie er das bei Tannenberg und der Schlacht an den Masurischen Seen auch schon getan hatte. Ludendorffs
Befehl an die 18. Armee vom Abend des 22. März 1918 lautete: „Jetzt gilt es den Sieg auszunutzen, den Feind nicht zum
Stehen kommen zu lassen, Somme und Crozat-Kanal zu überschreiten, bevor feindliche Verstärkungen wirksam werden“.
Was Haig befürchtet hatte, trat nicht ein. Die deutsche Offensive Lief weiter Richtung Süden und lief sich schließlich
tot. Am 31 März war Ludendorff zu der Erkenntnis gekommen, dass „Michael“ gescheitert war. Am 5. April wurde die
Einstellung der Offensive befohlen. Im Hochsommer waren die US-Truppen in Frankreich angekommen und gingen mit den
Franzosen zum Angriff vor. Nur mühsam konnten Hindenburg und Ludendorf den Zusammenhalt der Front waren. Am 24. Oktober
1918 forderte US-Präsident Woodrow Wilson die bedingungslose Kapitulation, am 11.Nuvember Wurde der Waffenstillstand
von Compiegne unterzeichnet.
Zusammenbruch der Westfront und Waffenstillstand .
Als die Offensive dann letztendlich gescheitert war, wurden wir auf Eisenbahnwaggon verladen, in
eine Stellung vor Verdun gebracht und der siebenten bayerischen Division zugeteilt. Als wir ausgeladen wurden nahm der
Franzose den Bahnhof unter Beschuss. Eine Granate traf einen Waggon der mit Seifenpulver beladen war, so dass der ganze
Bahnhof aussah als wäre gerade Neuschnee gefallen. Wir gingen auf die Suche nach Kartoffeln. Als ich mit einem Sack,
vollbeladen die Böschung runter ging um zur Feldküche zu gelangen, schlug unweit von mir eine Granate ein und riss mir
den Sack vom Rücken. Ich bin mit dem Schrecken davon gekommen, mir war nichts passiert.
Der Bahnhof war menschenleer, nur ein par Kaninchen liefen verschreckt durch die Gegend und einigen Kameraden gelang
es welche einzufangen. Am nächsten Tag gelang es uns endlich die Feldküche zu erreichen. Als wir gerade beim Essen
fassen waren, schlug unweit eine Granate ein so dass Pflastersteine das Dach durchschlugen und wir das Weite suchen
mussten. und wir wieder nichts zu Essen bekamen. Ein Friseur aus unserer Kompanie fuhr immer ins Hinterland um uns
mit Proviant zu versorgen. Als er 14 Tage vor dem Zusammenbruch wieder mal zurückkam erzählte er uns schon das der
Krieg nicht mehr lange dauern würde, weil Kaiser Wilhelm mit Frack und Zylinder bekleidet, Deutschland verlassen und
ins Ausland gehen würde. In unserer Einheit hatten wir auch einen Juden der glaubte dass er sich alles erlauben darf.
Eines Morgens ging er in die Küche, als er keinen Koch vorfand stieg er auf die Gulaschkanone und hob den Deckel vom
Kessel in dem der Kaffee kochte an. Der kochende Kaffee verbrühte seine Füße so sehr das er sofort ins Lazarett musste,
für ihn war der Krieg somit zuende. Es kam noch ein Erlass, das Kameraden die 2 Jahre aktiv gedient hatten und
Gefreiter waren sofort zum Sergeanten befördert wurden. Für den 11. November 1918 war ein Waffenstillstand vereinbart
und ab 11 Uhr sollte nicht mehr geschossen werden. Wir hatten unsere Kopfkissen aufgetrennt und eine Kissenschlacht
veranstaltet, um auf diese Art und Weise unserer Freude Ausdruck zu verleihen. Als die Federn durch die Luft flogen
brachen wir in Tränen aus.
In jeder Kompanie wurde ein Soldatenrat gewählt, der aus drei Mann bestand. Wenn der Kompanieführer jemanden bestrafen
wollte, musste er erst den Soldatenrat fragen, der die Strafe befürworten, aber auch ablehnen konnte. Die Offiziere
durften keine Achselstücke mehr tragen, was für sie einer Degradierung gleich kam. Wir waren in einem Dorf
einquartiert und morgens zum Appell angetreten, als einer vom Soldatenrat sich stockbesoffen vor den auf dem Pferd
sitzenden Kompanieführer stellte und schrie: „Alles hört auf mein Kommando”. Der Kompaniechef war wie vom Blitz
getroffen, ihm versagte die Stimme. Wir sahen ein das dies nicht so weiter gehen kann und wählten einen neuen
Soldatenrat. Unser Rückzug begann bei Konflanz, einer Vorfestung von Metz und führte uns zunächst über die
luxemburgische Grenze, wo wir in einem Ort einquartiert wurden. Als wir für die Küche Holz aus dem Wald holen gingen,
entschieden wir uns eine Eiche abzusägen, ohne uns dessen bewusst zu sein, in welchem Forst wir uns befanden. Als wir
beim fällen waren fielen plötzlich Schüsse, die wir auch sofort erwiderten, bis uns ein Elsässer der sich in unserer
Kompanie befand aufklärte: „Kameraden, wir befinden uns hier auf Luxemburgischem Hoheitsgebiet”.
Wir sind dann weiter durch das Fürstentum Birkenfeld marschiert, wo das Städtchen Merzig für uns geflaggt hatte. Das
Elsass haben wir auch noch kurz gestreift. Wo wir bei einem Bauern, der uns kein Stroh für das Nachtlager geben wollte,
einquartiert wurden. Daraufhin gingen wir in die Scheune und haben uns selbst was besorgt. Wir haben dann noch erfahren,
sie hätten ein Schwein geschlachtet und warteten auf den Einzug der Franzosen. Als wir uns 1917, an der Ostfront, in
den in Karpaten, im Einsatz befanden, waren unter uns auch viele Elsässer. Sie durften ihre Heimatpost nicht in
französischer Sprache schreiben, mussten ihre Briefe offen auf der Schreibstube abgeben, wo sie zuerst kontrolliert
und dann abgeschickt wurden. Als ich in einer Nacht, mit einem Elsässer auf einem Vorposten Wache schieben musste,
wollte er mich überreden zum Russen überzulaufen. Als ich darauf nicht eingehen wollte verschwand er plötzlich in der
Dunkelheit und ich habe ihn nie wieder gesehen.
Wir sind dann weiter Richtung Worms und Ludwighafen gezogen, dort wurden wir bei einem Mühlenbesitzer einquartiert,
ein Unteroffizier und vier Mann. Obwohl wir verlaust und verdreckt waren bestand die Müllerin darauf das wir in ihren
Betten übernachteten. „Wenn alles durch ist”, sagte sie, „werde ich alles gründlich reinigen”. Der Müller brachte uns
eine Gießkanne voll Wein und sagte wir sollen es uns Schmecken lassen. Wir haben reichlich davon Gebrauch gemacht, so
dass ich gar nicht weiß wie ich ins Bett kam. Das war meine Erinnerung an die Pfalz. Manchmal waren wir auch 2 Tage im
Quartier.
Vor dem Weitemarsch wurde uns immer gesagt welche Truppe die Vorhut und welche Truppe die Nachhut übernehmen sollte.
Die Nachhut hielt immer Verbindung zu den nachrückenden Franzosen und man muss staunen wie alles reibungslos, ohne
Zwischenfälle von statten ging, was wir in erster Linie dem General-Feldmarschall Paul von Hindenburg zu verdanken
haben, der den Rückzug an der Westfront koordiniert hat.
In Köln angekommen, erhielten wir im Volkshaus unsere Entlassungspapiere, Eisenbahnfahrscheine, Reisepässe,
unterschrieben von Oberstleutnant Mann. Wir mussten Köln umgehend verlassen, weil schon am nächsten Tag die
französischen Besatzungstruppen in einmarschieren sollten. Wir fuhren mit einem Zug der bis Allenstein fuhr, dort
wurden unsere Papiere vom Soldatenrat kontrolliert. Die jüngren Jahrgänge wurden festgehalten, zu neuen Einheiten
zusammengestellt und zur Sicherung der Ostgrenze gegen die Bolschewisten abkommandiert. Ich hatte gesagt das ich noch
einen Schrapnellsplitter in der Kreuzbeingegend habe und durfte daraufhin nach Hause fahren.
Kaum in Ortelsburg angekommen fiel ich wieder dem Soldatenrat in die Hände. Sie haben alles durchsucht, haben mir mein
Seitengewehr und eine Decke abgenommen, aber ich durfte weiter und bin dann kurz vor Weihnachten 1918 auf dem
elterlichen Hof angekommen. Schon auf dem Hof habe ich meine Kleider vom Leib gerissen, weil vor Läusen und anderem
Ungeziefer nicht mehr aushalten konnte und mich erst gründlich gewaschen bevor ich das elterliche Haus betreten habe.
Die Freude über das Wiedersehen war sehr groß.
“ Unser Leben zwischen den beiden Weltkriegen.”
Endlich wieder zurück in der Heimat
Rohmanen war durch die Kampfhandlungen 1914/15 zu einem drittel zerstört worden, aber schon
wieder im Aufbau. Die Firma Grzella aus Ortelsburg hatte die Bauarbeiten übernommen. Unter der Aufsicht von Polier
Karl Kontor wurden die Dachstühle errichtet. Ich habe mich, nach kurzer Erholungspause, auch als Zimmermanngehilfe am
Wiederaufbau beteiligt. Die Firma Grzella hat das Material geliefert und auch unsere Löhne gezahlt. Wegen meinem
Steckschuss bin ich dem VDK beigetreten und habe mit dessen Hilfe eine Rente beantragt die mir auch bewilligt wurde.
Nach vier Jahren wurde ich nach Allenstein zur Nachuntersuchung vorgeladen. Die ärztliche Untersuchung hatte ergeben,
das Geschoß sei verkapselt, und nur das linke Bein etwas in Mitleidenschaft gezogen. Daraufhin wurde die Rentenzahlung
eingestellt.
Der Stellmacher Adam Ornowski war im Krieg als Sanitäter eingesetzt und hatte auf Grund seiner Erfahrungen,
 Beziehungen zum medizinischen Dienst in Ortelsburg aufgebaut. Es wurden dort Lehrgänge in Erster Hilfe angeboten,
die von Prof. Dr. Kutz geleitet wurden. Adam Ornowski hat dafür gesorgt das einige junge Männer aus Rohmanen daran
teilnehmen konnten. Adam Ornowski, August Linka, Emil Rosowski, Johann Dembek, Emil Baschek und ich sind dann dem
Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes beigetreten und mussten jeden Sonntag am Lehrgang teilnehmen. Unser
Gruppenführer war Kreisobersekretär Albrecht, Landrat von Poser, als unser Ehrenvorsitzender, hat viel zu unserer
finanziellen Unterstützung beigetragen und hat dafür gesorgt dass die Bereitschaft eingekleidet wurde.
Beziehungen zum medizinischen Dienst in Ortelsburg aufgebaut. Es wurden dort Lehrgänge in Erster Hilfe angeboten,
die von Prof. Dr. Kutz geleitet wurden. Adam Ornowski hat dafür gesorgt das einige junge Männer aus Rohmanen daran
teilnehmen konnten. Adam Ornowski, August Linka, Emil Rosowski, Johann Dembek, Emil Baschek und ich sind dann dem
Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes beigetreten und mussten jeden Sonntag am Lehrgang teilnehmen. Unser
Gruppenführer war Kreisobersekretär Albrecht, Landrat von Poser, als unser Ehrenvorsitzender, hat viel zu unserer
finanziellen Unterstützung beigetragen und hat dafür gesorgt dass die Bereitschaft eingekleidet wurde.
In jedem Dorf wurde eine Unfallstelle eingerichtet, mit einem Verbandskasten und mit Verbandsmaterial für die erste
Hilfe ausgerüstet. Die Unfallstelle in Rohmanen, die am Haus von der Straßenseite, durch eine Tafel mit einem roten
Kreuz gekennzeichnet war, hatte ich zu verantworten. An Sonntagen wurden wir an Badestellen und bei Fußballspielen
eingesetzt, haben viele Übungen bei Waldbränden durchgeführt und auch Ausflüge nach Rudzany am Niedersee gemacht. Bei
der Einweihung des Tannenbergdenkmals in der Nähe von Hohenstein kamen wir an Straßenkreuzungen zum Einsatz.
Rohmanen hatte auch eine freiwillige Feuerwehr. Bis zum ersten Weltkrieg hat Friedrich Biella als Brandmeister das
Kommando gehabt. Er war aktiver Unteroffizier, hatte gute Führungsqualitäten und die Männer, die allesamt aus dem
aktiven Militärdienst stammten hatten zu ihm ein großes Vertrauen. Nach dem Krieg wollten diese Männer,
(Friedrich Nickel, Friedrich Willam, Julius Wittkowski, Jakob Janowski, Johann Gloddek, Gustav Bednarz), nicht mehr
weitermachen. Friedrich Biella, der inzwischen zum Gemeindevorsteher gewählt wurde, hat sich dann auf einer
Gemeinderatsitzung vorgeschlagen, für die Freiwillige Feuerwehr jüngere Kräfte anzuwerben.
Zum Brandmeister hat er Herrn Wilhelm Pilath vorgeschlagen. Der wurde dann nach Königsberg zur Fortbildung geschickt.
Der Feuerwehr gehörten nun folgende Personen an: Wilhelm Pilath(Brandmeister), August Linka(Stellvertreter), Gustav
Deptolla, Julius Matzey, Johann Dembek, Willy Willam, Gustav Rattay. Der Kreisbrandmeister war Heinrich Thalmann aus
Ortelsburg, sein Stellvertreter war Kreisobersekretär Salzmann. Der Bezirks-Kommissar bei der Ostpreußischen
Feuersozität War Herr Ernst Trzaska. Er hat dafür gesorgt das die Wehr uniformiert und mit Löschgeräten ausgerüstet
wurde. Da die alten Schläuche schon sehr marode waren, wurden sie durch moderne ersetzt, deren Kupplungen auch mit der
Motorspritze übereinstimmten.
Ernst Trzaska hat bei der Feuersozität und beim Landratsamt Finanzmittel beantragt und auch genehmigt bekommen. Der
Schneidermeister Wilhelm Baran wurde beauftragt Tuch und Drillichanzüge nach Maas zu schneidern. Er hat uns
Stoffmuster vorgelegt aus denen wir wählen sollten. Feuerwehrhelme haben wir auch bekommen. Die Gemeinde musste
Finanzmittel bereitstellen, einen Prozentsatz vom Gemeindebudget. Im Brandfall mussten für den Spritzenwagen Pferde
zur Verfügung stehen, von Willy Willam, Gustav Rattay, Julius Matzey und Gustav Dorka, weil sie in der Nähe des
Spritzenhauses wohnten. Am Spritzenhaus wurde ein großer Baum mit Querleisten aufgestellt, wo nach jedem Brand oder
einer größeren Übung die Schläuche zum trocknen aufgehängt wurden.
Der Kreisbrandmeister hat mindestens 2-3-mal im Jahr die Wehren besichtigt. Das ganze Dorf war dann auf den Beinen,
die Bauern mit Pferden, und andere Dorfbewohner mit Eimern und Spaten, wurden dann in verschiedene Gruppen eingeteilt.
Erst hat die Wehr sämtliche Aufstellungen am Gerät geübt; Grundstellung Fahrstellung und Marschstellung. Dann wurde
ein Brand angekündigt, die Feuerwehr mit der Spritze an den Brunnen, die Gruppen dort wohin sie beordert wurden, die
Bauern brachten mit den Wasserkiwen Wasser aus dem Brunnen zum Brandort. Wenn das Wasser im Brunnen alle wurde hat
man den Saugkorb in die Kiewen gelegt und dort Wasser entnommen. Die Wassergruppe ging mit Eimern zum Dorfteich, holte
Wasser und füllte damit die leeren Kiewen.
Der Löschtrupp ging mit Feuerhaken und Löschpatschen auf die umliegenden Gehöfte und versuchte das vermeintliche Feuer
von ihnen fernzuhalten. Nach dem Alarm wurde wieder am Spritzenhaus angetreten. Die Gruppenführer mussten angeben ob
ihre Gruppe auch vollständig erschienen war, denn Übungen wurden nur vor, oder nach der Feldarbeit durchgeführt, so
dass niemand eine Entschuldigung vorbringen konnte. Wer ohne begründete Entschuldigung nicht anwesend war erhielt eine
Verwarnung. Der Kreisbrandmeister erklärte dann welche Handgriffe den Vorschriften entsprachen und welche nicht. Die
Schläuche wurden noch schnell zum Trocknen aufgehängt. Anschließend gingen wir alle in den Gasthof Trzaska, haben über
vorhandene Mängel diskutiert, Verbesserungsvorschläge unterbreitet und zwischendurch den Durst gelöscht. Der
Kreisbrandmeister ist dann, nach einer kurzen Verabschiedung, ins nächste Dorf gefahren, weil er an einem Tag mehrere
Feuerwehren betreuen musste.
Der Rohmaner Dorffriedhof

Einen Kilometer vom Ende des Dorfes entfernt, auf der rechten Seite der Landstraße in Richtung
Ortelsburg, befand sich der Rohmaner Dorffriedhof. Wann dieser Friedhof angelegt wurde entzieht sich meiner Kenntnis.
Nach Aussagen älterer Dorfbewohner soll davor auch schon eine Ruhestätte vorhanden gewesen sein, und
zwar auf der linken Straßenseite gegenüber dem jetzigen Friedhof. An dieser Stelle befand sich bis in die
Nachkriegszeit ein kleiner Brunnen, aus dem die Dorfbewohner, das Wasser zum begießen der Grabbepflanzung auf den
Gräbern ihrer verstorbenen Angehörigen holten. Der Friedhof war in einer Hanglage angelegt, wahrscheinlich weil diese
Parzelle für eine landwirtschaftliche Nutzung nicht geeignet war. Um das Gräberfeld vor herumstreunenden Tieren oder
von der Weide entlaufenen Kühen zu schützen, hat man das ganze Gelände mit einem Holzzaun umgeben. Der Zugang befand
sich von der Straßenseite. Unter einem Torbogen hindurch wurden die Verstorbenen zu Grabe getragen. Die Gräber der
einzelnen Familien waren nebeneinander angelegt, mache, wie zum Beispiel die der Familie Trzaska, sogar mit einem
schmiedeeisernen Zaun eingefasst.
Nach dem 2. Weltkrieg verfiel der Friedhof immer mehr. Die nötigen Finanzmittel für die Pflege der Einfriedung konnten
von den restlichen noch verbliebenen Deutschen nicht mehr aufgebracht werden. An den gepflegten Gräbern konnte man noch
erkennen dass es Verwandte von noch in Rohmanen wohnenden Deutschen waren, oder von bereits im Westen Deutschlands
lebenden, die ihre noch in Rohmanen wohnenden Nachbarn damit beauftragt hatten. Die übrigen Gräber wurden von Jahr zu
Jahr immer mehr von Wildkräutern überwuchert und schließlich auch von Sträuchern und schnell wachsenden Bäumen.
In den späteren Jahren konnte man nicht mehr erkennen dass dort vor Jahren Tote zur letzten Ruhe gebettet wurden. Die
Natur holte sich das ganze Gelände zurück und nur unter großen Schwierigkeiten konnten Besucher aus dem Westen das
Friedhofsgelände noch betreten.
Das Gasthaus Trzaska

Nach dem ersten Weltkrieg hat der Gastwirt Friedrich Trzaska neben dem Gasthof einen großen Saal
für Festlichkeiten und Vereinsfeiern gebaut, in dem schon mal Feuerwehrfeste veranstaltet wurden. Ernst Trzaska war
Feuerkommissar bei der Ostpreußischen Feuersozität. Erich Trzaska war Vollziehungsbeamter beim Amtsgericht in
Ortelsburg. Unser Feuerkommissar war uns beim organisieren der Veranstaltungen sehr behilflich, hat uns den Saal, die
Musik und die Theaterstücke besorgt und die Feuerwehren aus den Nachbardörfern eingeladen.
Zu Manöverzeiten, vor dem 2. Weltkrieg und dann auch während des Krieges, waren im Gasthof Soldaten, meist im Range
eines Offiziers, einquartiert. Fräulein Mariechen Trzaska hat die Poststelle im Dorf betreut. Nachdem ich 1939 zum
Militär eingezogen wurde, hat sie, nach einer Schulung im Ortelsburger Krankenhaus, auch die Unfallmeldestelle
übernommen. Nach dem Krieg, pflegte sie mit vielen Bekannten, die bereits in der Bundesrepublik wohnten, einen regen
Briefwechsel. Auf dem Rohmaner Friedhof hat sie viele Gräber, im Auftrag von Angehörigen, die auf Grund ihrer
Abwesenheit, dazu nicht mehr in der Lage waren, gepflegt. Der Bauunternehmer Kurnitzki aus Ortelsburg, äußerte die
Bitte, sie möchte ihm doch ein Blatt vom Rosenstrauch, der auf dem Grab seiner Eltern steht, in den Brief legen. Als
sie uns den Brief vorgelesen hat, waren wir zu Tränen Gerührt. Sie hat als Letzte aus ihrer Familie, bis zu ihrem Tod
im Jahre 1960, in Rohmanen, im Gebäude der Gastwirtschaft gewohnt und ist auf dem Rohmaner Friedhof beerdigt worden.
Fleisch und Wurstwaren Karl Pelkowski
Im Jahr 1931 hat der Fleischermeister Karl Pelkowski, aus Grammen, direkt neben unserem Hof ein
Anwesen gekauft und dort eine Fleischerei eingerichtet. Er war mit meiner Schwester Frieda, verheiratet. Am Anfang hat
er die Schweine noch auf seinem Hof geschlachtet, später dann im Ortelsburger Schlachthof. Jede Woche fuhr er 2-mal,
mit dem Pferdewagen(Einspänner), nach Ortelsburg zum Wochenmarkt, wo er seine Fleisch und Wurstwaren zu Verkauf anbot.
Am Tag davor, wenn er die Wurst gekocht hat, kamen viele Rohmaner mit Kannen oder anderen Gefäßen, wegen der guten
Wurstsuppe, die er umsonst unter die Leute verteilte. Als Karl Pelkowski, Ende August 1939 zum Militär eingezogen
wurde, hat seine Frau das Pferd verkauft und den Beitrieb stillgelegt. Am Haus hing, immer noch die Tafel mit der
Aufschrift: Karl Pelkowski, Fleisch und Wurstwaren. Ein Witzbold hat irgendwann darunter geschrieben; „Fleisch und
Wurst waren einmal”, drauf hin hat Frau Pelkowski die Tafel entfernen lassen. Karl Pelkowski ist im Mai 1946 in
französischer Gefangenschaft verstorben. Seine Ehefrau Frieda, verstarb an ihrem 85. Geburtstag in Mettmann bei
Düsseldorf.
Die steinreichen Rohmaner Felder
Die letzte Eiszeit hat bei der Schmelze, auf der Rohmaner Feldgemarkung viele Steine und
Granitblöcke zurück gelassen. Überirdisch, aber besonders unter der Erde, gab es viele kleine, aber auch große Steine,
die, den Bauern, beim Pflügen und anderen Feldarbeiten sehr viel Schweiß, abverlangten. In einer Kiesgrube, auf dem
Feld des Bauern August Radek, lag ein Granitblock, von schätzungsweise 100 cbm. Vor etwa 80 Jahren, als man für diese
Steine noch keine Verwendung hatte, griffen die Bauern zu einer „List”. Weil er sonst nicht pflügen konnte, hat mancher
seinem Nachbarn, die Steine in der Nacht auf dessen Feld abgeladen. Als diese Tätigkeit unter Strafe gestellt wurde,
hat man die Steine in Schluchten gekippt und mit Mutterboden zugeschüttet. In späteren Jahren kam diese jedoch beim
pflügen wieder an die Oberfläche. Dann hat man aber schon Steine für den Straßenbau gebraucht und konnte sie so zu Geld
machen. Besonders im Raum südlich von Ortelsburg, bis zur polnischen Grenze, wo Steine eine Rarität waren, kamen sie
jetzt zum Einsatz. Auch beim Bau von Häusern, besonders für die Fundamente, wurden sie eingesetzt, weil auf diese
Weise viel Ziegeln eingespart wurden. Die Firma Gribienski aus Ortelsburg hat die großen Steine mit Dynamit gesprengt
und auf diese Weise die weitere Verarbeitung erleichtert.
Die Steine welche beim Pflügen aus dem Boden geholt wurden, hat man am Feldrand auf große Haufen zusammen getragen.
Wenn die Feldarbeit beendet war, sowie auch in den Wintermonaten, waren wir jeden Tag mit Steinen unterwegs. Wir sind
vorwiegend am Abend los gefahren, weil unter der schweren Last die Wagenachsen so heiß wurden und die Gefahr bestand,
das durch die Dehnung, die Räder blockiert würden. Bei einer Fahrt konnte man bis zu 24 Reichsmark verdienen, wogegen
1 Zentner Roggen für 8 bis 9 Reichsmark zu haben war. Ich bin selbst, mit dem Pferdewagen bis Fürstenwalde, Radostowen,
Luka, Altkirchen, Höhenwerder, ja sogar bis Friedrichshof gefahren.
In Rohmanen wurden auch rote Ziegeln gebrannt. Viele Häuser wurden, mit Ziegeln erbaut, die nur wenige 100 Meter von
der Baustelle entfernt hergestellt wurden. Der Lehn wurde auf den Feldern in der näheren Umgebung entnommen, dann von
Ochsen solange getreten, bis er so geschmeidig war, das er sich in Formen einstreichen ließ. Wenn die Ziegel in der
Form trocken war, wurde sie entnommen und in einem Brennofen gestapelt. Um einen Ofen richtig anzufeuern, brauchte man
12 Raummeter Holz, das im Zeitraum von ein par Tagen verheizt wurde. Der Fischer Karl Glitza hatte schon eine
Knetmaschine, die von einem Pferd angetrieben wurde, das mit verbundenen Augen, den ganzen Tag in die Runde ging.
Im Dorf waren auch vier Kalköfen, in denen so genannte Kalksteine, die sich an gewissen Stellen, im Erdboden befanden,
gebrannt wurden. Nach dem Brennen wurden die Steine mit Wasser abgelöscht und die daraus entstandne Masse diente, nach
dem Beimischen einer gewissen Menge Sand, dann als Bindemittel beim Häuserbau. Das Gerichtsgebäude und das
Lehrerseminar in Ortelsburg wurden mit Kalk, aus dem Rohmaner Brennöfen erbaut. Auch zum Bau einer Eisenbahnbrücke, auf
der, der Zug, den Sawitzfluß, von Ortelsburg nach Allenstein überquerte, hat mein Großvater, mit einem Ochsengespann,
Kalk gefahren.
Hinter der Scheune, beim Bauern Johann Dembek hat man Tonerde gefördert, aus der man mit Hilfe einer Formerscheibe,
die von einem Arbeiter mit Muskelkraft(Fußbetrieb) angetrieben wurde, schöne Krüge, Schalen und Vasen geformt hat.
Die Töpferware wurde, nachdem sie trocken genug war, auch in einem Ofen gebrannt, anschließend mit einer Lasur
überzogen und wieder gebrannt. Es wurden auch Kacheln zum Bau von Kachelöfen hergestellt, die mit verschiedenen
Ornamenten versehen, die Wohnstuben unserer Vorfahren schmückten. So haben unsere Großväter ihr Leben gemeistert und
nach und nach, unsere Dörfer aus der Rückständigkeit in die Neuzeit geführt.
Das gesellschaftliche Leben nach dem 1. Weltkrieg

Als der Lehrer Alfred Dorka, ein Frontkämpfer des Ersten Weltkrieges und ein Sportsmann, als
zweite Lehrkraft an der Rohmaner Schule angestellt wurde, hat er die Sitten und Gebräuche aus früherer Zeit wieder zum
Leben erweckt. Zuerst hat er die Jugend zusammen gerufen, einen Jugendverein und einen Fußballclub, gegründet. Zum
Vorsitzenden des Fußballclubs wurde Johann Gloddek berufen, der ihn auch geleitet hat. Bauer Wilhelm Spittka, der am
Rohmaner See wohnte, stellte Land für einen Sportplatz unentgeltlich zur Verfügung. Lehrer Alfred Dorka hat am
Rohmaner See eine Badestelle ausgesucht und ein Sprungbrett bauen lassen. An jedem Sonnabend im Sommer, bevor die
Sonne unterging, versammelte sich die gestammte Jugend des Dorfes an der Badestelle am See. Es wurde gebadet,
Heimatlieder gesungen, gespielt, im Fackelschein eines großen Biwakfeuers, bis in die späte Nacht hinein. Der Fischer
Karl Glitza hat uns Kähne zur Verfügung gestellt, mit denen wir auf den See hinausgepaddelt sind, dabei hatten wir viel
Spaß, was wiederum den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft gefördert hat. Ich habe mit meiner Mandoline den Gesang von
Volks- und Heimatliedern begleitet.
Der Rohmaner See liegt in einem Tal, dessen Hänge zu beiden Seiten mit Kiefern und Tannen bewaldet sind. Wenn man
gesungen oder Musiziert hat, hallte es von den Hängen zurück. Die Ufer waren mit Kalmus und Schilf bewachsen, was für
die Fischaufzucht von Vorteil war. Wenn man an einem sonnigen, windstillen Tag, am Seeufer spazieren ging, traf man
oft auf Flachstellen, an denen sich die Fischbrut im Sonnenlicht wärmte, wie ein Mückenschwarm. Im See befanden sich
folgende Fische: Karpfen, Hechte, Schleie, Barsche Plötze, Rotaugen, Aale und Krebse. Am Sonntagmorgen brachten viele
Rohmaner ihre Pferde zum See um sie zu baden.
Es wurden dort, unter der Aufsicht von Lehrer Dorka, auch viele Jugendfeste mit Theatervorführungen veranstaltet, zu
denen er selbst die Vorlagen organisiert hat. Der am See wohnende Bauer Johann Nadrowski, hat uns ein Scheunentor, als
Tanzboden zur Verfügung gestellt. Der Zimmermann Wilhelm Wittek hat uns eine Windmühle gebaut, die am auf dem Boden
liegenden Scheunentor aufgestellt wurde, dazu kamen Noch Tannen und Fichten, die das Ganze wie ein Bühnenbild
erscheinen ließen. Es wunden viele Bühnenstücke aufgeführt, unter anderen >Alte Weiber werden jung gemahlen<. Dazu bot
die Windmühle die entsprechende Kulisse.
Nach der Vorführung wurde der Boden aufgeräumt, um dann als Tanzdiele zur Verfügung zu stehen. Der Gastwirt Trzaska
hatte Tische und Bänke aufgestellt, Speisen und Getränke angeboten, so dass sich die die Veranstaltung bis in die
späte Nacht hinein zog. Es waren auch Leute aus Ortelsburg und anderen Nachbardörfern dabei. Im Winter hat Lehrer
Dorka eine Kreisrodelbahn eingerichtet, die von Zeit zu Zeit mit Wasser besprengt wurde, um die Gleitfähigkeit zu
verbessern. Von einer Anhöhe ging hinunter bis auf den halben See, was für alle ein großes Vergnügen war. Es kamen
Lehrer mit Schulklassen aus der näheren Umgebung um hier zu Rodeln.
Als Herr Lehrer Jobski als Hauptlehrer nach Rohmanen kam hat er mit dem Bürgermeister und der Gemeindeverwaltung
beschlossen, in der Nähe des Dorfes, auf einem zur Schule gehörenden Grundstück, einen Sportplatz anzulegen. Dafür
wurde gleich hinter den Gärten, 6 Morgen Ackerland abgetrennt, und nach Feierabend hat Lehrer Dorka mit den
Jugendlichen eingeebnet und gleich nebenan einen Graben für Schützenstand und Kugelfang ausgehoben. Am Sonntagvormittag
wurde Fußball gespielt und um 15:00 Uhr war Kleinkalieberschießen angesagt. Es musste auch ein kleiner Beitrag erhoben
werden, um Munition kaufen zu können. Eine Büchse konnten wir aus beim Kleinkalieberverein in Ortelsburg ausleihen.
Nach Hitlers Machtergreifung
Als Adolf Hitler an die Macht kam wurde die SA gegründet. Der Bürgermeister Michael Kownatzki
wurde zum Gruppenführer ernannt und folgende Männer haben sich freiwillig gemeldet: Wilhelm Matzey, Johann Gloddek,
Gustav Nadrowski, August Buttler, Karl Baran, Emil Nickel, Wilhelm Jaschinski, Emil Bork, Ernst Rattay und Gustav Bach.
Bei Versammlungen war die SA in Uniform angetreten um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Wer versucht hat Unruhe zu
stiften, egal aus welchem Grunde, wurde aufgefordert den Saal zu verlassen, andernfalls wurde er mit Gewalt entfernt.
Herr Lehrer Jobski wurde zum politischen Leiter ernannt, seine Frau hat die NS-Frauenschaft gegründet, Lehrer Dorka
die HJ, und so bekam die Dorfgemeinschaft, nach und nach ein anderes Gesicht. Der Sportplatz und der Schützenstand
wurden jetzt mehr als früher in den Mittelpunkt gestellt. Nach der Feldarbeit hat der Bürgermeister Fuhrwerke bestellt
und den Sportplatz noch besser herrichten lassen.
Der Bauer Wilhelm Both wurde zum Ortsbauernführer ernannt, mit der Aufgabe alles Land für den Anbau von Getreide und
Futtermittel bereitzustellen, oder wenn das nicht möglich war mit Wald aufzuforsten. Durch den Einsatz von Kunstdüngern
sollten größere Erträge aus dem Boden geholt werden, um den Viehbestand zu vergrößern und mehr Milch und Butter zu
produzieren. Deutschland sollte im Stande sein sich selbst zu selbst zu ernähren, ohne auf Importe angewiesen zu sein.
Frau Jobski hat, innerhalb der der NS-Frauenschaft, mit Hilfe von Fachkräften aus Ortelsburg, Lehrgänge veranstaltet,
auf denen man Backen und Nähen lernte. Auf den Bauernhöfen befand sich auch immer mehr Rassegeflügel, das eine erhöhte
Produktion von Eiern und Geflügelfleisch sicherstellen sollte.
Die Rohmaner Bauern hatten, außer in der Landwirtschaft, noch andere Verdienstmöglichkeiten in der Kreisstadt. In
Ortelsburg wurden vier Sägewerke betrieben, die mit Langholz aus dem Walde versorgt werden mussten. Wir haben eine
Kiefer von über 8 Festmeter angefahren, der wir zuerst 6 Meter Spitze abschneiden mussten, um diese Last überhaupt
auf den Wagen zu bekommen. Sechs Pferde musste angespannt werden um den Wagen zur befestigten Straße zu bringen.
Fichten und Tannen wuchsen bis zu einer Länge von 30 Metern. Auch beim Transport von Ziegel, von der Ziegelei zum
Bahnhof, konnte man gutes Geld verdienen.
Im Jahr 1934 wurde Rohmanen an das überregionale Stromnetz angeschlossen und schaffte auf diese Weise den Sprung von
der Petroleumlampe zur Glühbirne. Neben dem Grundstück von Karl Pietzonka wurde ein Transformatorhäuschen errichtet,
in dem der ankommende Strom von einer Hochspannung auf eine Verbrauchsspannung transformiert wurde. Es gab schon eine
Überlandleitung, die aus Richtung Ortelsburg kommend, quer über die Felder, in Richtung Neu Keykuth weiter ging.
Durch eine Zwischenspanne wurde der Transformator, mit der Hauptleitung auf Kownatzkis Feld verbunden.
Ein Stromanschluss konnte die Arbeit im Haus und Hof auf vielfältige Weise erleichtern, doch nur die besser gestellten
Bauern, sowie noch manche Pensionäre, die ein festes Einkommen hatten, konnten sich dass leisten. Weil nur wenige an
der Elektrifizierung teilnahmen, war ein Stromanschluss mit hohen Kosten verbunden. Nur Gustav Pietzonka, Gasthof
Trzaska, Friedrich Nickel, die Schule und Wilhelm Both, wurden in der ersten Phase erfasst.
Im Jahr 1952 wurde von den polnischen Behörden die zweite Stufe der Elektrifizierung eingeleitet, in der alle im Dorf
stehen Gebäude erfasst wurden. Am Anfang wurden nur Leitungen für Lichtstrom gelegt und auch nur 3 Lichtstellen pro
Haushalt bewilligt. Doch im nachfolgenden Zeitraum wurden dann, wenn Material vorhanden war, weitere Lichtpunkte
angelegt. 1952, am zweiten Wochenende im Advent, wurden dann die Leitungen geschaltet und alle waren von der
plötzlichen Helligkeit sehr begeistert. Wenn man Glühbirnen auswechseln wollte musste man am Anfang weite Wege
zurücklegen, um welche zu bekommen. In den 60ger Jahren wurden dann immer mehr Starkstromleitungen gelegt, weil die
Bauern elektrische Geräte kaufen konnten. Ende der 60ger wurden auch die Abbauten an das Stromnetz angeschlossen.
Das Urnengrab auf unserem Feld
Auf unserem Feld, in Richtung Seelonken, bin ich oft beim pflügen gegen Steine gestoßen, manchmal
rissen sogar die Stränge am Pferdegeschirr. Eines Tages nahm ich einen Spaten, Brechstange und einen langen Baum, um
der Sache auf den Grund zu gehen. Als ich eine Menge Sand ausgehoben hatte stieß ich auf eine steile, aus Steinen
errichtete Wand, die ich auch mit dem Baum nicht aus der Fassung bringen konnte. Ich habe den ganzen Vormittag gegraben,
konnte jedoch nicht unter die Steine kommen. Einige Tage später hatten wir in der Schule eine Bauernversammlung, da
habe ich Herrn Biella und Herrn Lehrer Dorka von meinem Fund berichtet. Am nächsten Morgen kam der Lehrer Dorka mit der
ganzen Schulklasse, mit Spaten und Sieben ausgerüstet auf unser Feld und fingen an die ausgehobene Erde zu sieben.
Lehrer Dorka benachrichtigte daraufhin den Leiter des Ortelsburger Heimatmuseums, der am nächsten Morgen vorbei kam um
sich die Fundstelle genau anzusehen. Er beauftragte ihn 4 Mann zu besorgen, um die Steine ringsum frei zu schaufeln.
Zwischen den Steinen durften wir die Erde nur mit Esslöffeln ausheben. Als es plötzlich zu regnen anfing hat Lehrer
Dorka die Brauerei Daum, in Ortelsburg angerufen, die uns über der Fundstelle ein Zelt errichtet haben, damit wir
ungestört weiterarbeiten konnten. Wir fanden 8 flache und 8 hohe Urnen zu beiden Seiten am Körper. Die Urnen wurden in
Gipsbinden eingewickelt und ins Heimatmuseum nach Ortelsburg gebracht, wo sie durch einen Fachmann, der extra aus einem
Königsberger Museum angereist war. Nach Reinigung der Urnen hat er festgestellt, das die Grabstätte etwa 2000 Jahre vor
Christi Geburt angelegt wurde und ein Doppelgrab war, in dem ein Toter liegend und einer in Hochstellung beigesetzt
wurde.
Die Nachricht von der Fundstelle verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Es erschienen viele Schaulustige, ganze
Schulklassen aus der Umgebung, mit Autos und zu Fuß. Durch die vielen Menschen wurden die bestellten Ackerflächen auf
unserem Feld sehr in Mitleidenschaft gezogen, eine Entschädigung haben wir nicht erhalten. Das Grab wurde vor dem
Heimatmuseum in Ortelsburg wieder so aufgebaut wie man es auf unserem Feld vorgefunden hat. Für den Transport der
Steine wurde ich entlohnt. Die Urnen hat das Königsberger Museum an sich genommen und wollte sie nicht wieder hergeben,
weil die solch einen Fund noch nicht in ihrer Sammlung hatten.
Sonnenwendfeuer
Am 24 Juni fand eine Sonnenwendfeier statt. Ein Brauch der an die alten Germanen erinnern sollte.
Der Lehrer Dorka hat den Bürgermeister beauftragt 2 Fuhrwerke in den Wald zu schicken, die Holz und alten Reisig holen
und auf dem großen Schulberg abladen sollten. Das Straßenbauamt hat uns Teertonnen zur Verfügung gestellt. Die ganze
Dorfgemeinschaft wurde eingeladen, am Abend, nach der Feldarbeit, an der Sonnenwendfeier teilzunehmen. Lehrer Dorka
hielt zuerst eine Ansprache, in der er anschaulich erklärte wie unsere Vorfahren in grauer Vorzeit gefeiert haben.
Nach dem offiziellen Teil wurden das Holz und die Teertonnen angezündet, es wurden Heimatlieder gesungen, wie: Wild
flutet der See, drauf schaukelt der Schiffer den schwankenden Kahn, Schaum wälzt er wie Schnee, von grausiger Mitte
zum Ufer heran, wild fluten die Wellen auf Vaterlands See, wie schön, oh trag mich auf Spiegel zu Hügel, Masovias See.
Masovia Land, mein Heimatland, Masovia es lebe mein Vaterland.
Lehrer Alfred Dorka und sein Wirken für Rohmanen.

Friedrich Biella hatte auf seinem Feld einen Granitstein mit einer geraden Seite, den haben wir
mit viel Schweiß an den Dorfteich transportiert und auf einer Erhöhung abgelegt. Der Stein sollte zum Denkmahl für die
Gefallenen des Ersten Weltkrieges umgestaltet werden. Da zu Wenige daran ein Interesse zeigten, wurde diese Idee fallen
gelassen und der Stein irgendwann ins Wasser gerollt. Der Lehrer Dorka war viele Jahre in Rohmanen tätig, dort hat er
später seine ehemalige Schülerin, Lotte Biella geheiratet. Er hat sich sehr für die Entwicklung des Dorfes interessiert,
war bei jeder Gemeindeversammlung anwesend und hat auf Schwachstellen hingewiesen die den Fortschritt behinderten.
Gemeinsam mit den Schülern hat er den Ehrenfriedhof für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges gepflegt, an der
Wegegablung nach Eichtal und zu Ehren des Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg eine Eiche gepflanzt.
Zum Advent hat Lehrer Dorka mit der Jugend einen Adventstern, in verschiedenen Farben gebastelt.
Der Stern wurde auf einer 2 Meter langen Stange befestigt, in der Mitte wurde ein Wachslicht angezündet, am Stern
wurde eine Schnur angebracht, wenn man daran zog rollte der Stern hin und her. Am ersten Wochenende im Advent
versammelten sich jung und alt, um den Stern durch das Dorf zu tragen. Alle schlossen sich dem vorausgehenden
Sternträger an, der den Stern durch die Hauptstraße und die angrenzenden Wege trug. Dieser Sternmarsch wurde an den
folgenden Adventwochenenden wiederholt.
Am ersten Weihnachtfeiertag wurde um 4:00 Uhr morgens ein Frühgottesdienst gehalten. Zuerst hat der Pfarrer eine
Andacht gehalten, dann haben die Kinder ein Krippenspiel aufgeführt und die Gemeinde hat schöne Weihnachtslieder
gesungen. Der Gastwirt Trzaska hat uns den Saal zur Verfügung gestellt. Wir hatten eine Posaunen- u. eine
Gitarrengruppe. Unter der Leitung von Herrn Willi Doormann spielten: Gottlieb Brosch, Fritz Ollech,
Gustav Rattay(Sopran), Wilhelm Pilath, Gustav Brosch(Alt), Fritz Both(Tenor) und Fritz Brosch(Bass).
In der Gitarrengruppe wirkten mit: Martha Ollech, Hedwig Ollech, Martha Lekzik, Martha Michalick und Auguste Lekzick.
Willy Doormann hat sie auf der Geige begleitet.
Kurz vor Ausbruch des 2. Weltkrieges
Bei der Aufstellung des Grenzschutzes(Regiment Buchholz), hat er als Hauptfeldwebel die
Gruppenführerkurse überwacht und selbst die fähigsten Männer dafür vorgeschlagen. Das Ausbildungspersonal hat das
Jäger-Battalion gestellt. Wir kamen zuerst ins Stadion(Waldheim), wurden da eingekleidet und dann ging es gleich
kasernenmäßig zu, theoretisch und praktisch. Jeder musste vor die Front treten und nachweisen ob er im Stande ist,
Befehle zu erteilen. Abends wurden Filme vorgeführt die uns zeigen sollten wie eine Gruppe sich im Gelände entfalten
muss. Die Exerziervorschriften hatten sich, im Verhältnis zu Kaiser Wilhelms Zeiten, etwas geändert. Damals bestand
eine Gruppe aus 8 Mann und einem Unteroffizier, jetzt aus 10 Schützen, 3 für das leichte Maschinengewehr und einem
Unteroffizier(13 Mann). Nach der Schulung folgte eine Abschlussprüfung, danach ein gemütliches Beisammensein. Aus
Rohmanen haben folgende Männer die Prüfung bestanden: Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy, Gustav Rattay und
Gustav Deptolla. Unsere Uniformen waren alle zu klein und es gab viel zu lachen bei der Anprobe.
Die erste Übung habe ich mit Emil Rosowski, in Lenzinen gemacht. Der Gutsbesitzer Marzinzick hat seine Scheune als
Unterkunft zur Verfügung gestellt. Er war im Range eines Hauptfeldwebels. In seinem haus war die Schreibstube
untergebracht, die er selbst verwaltete. Ein Lastauto hatte Uniformen aus der Kaserne in Ortelsburg geholt, jeder
musste eine Uniform anlegen und dann wurde solange getauscht bis alle eine passende gefunden hatten. An den Namen des
Kompanieführers kann ich mich nicht mehr erinnern. 1935 wurden wir zu einer Übung in die Dragonerkaserne nach Lyk
einberufen. Die Gruppenführer, Zugführer, und Kompanieführer die schon Frontberührung im dem Ersten Weltkrieg hatten,
mussten eine Woche früher anreisen. Die Übungen waren auf 6 Wochen angelegt. Die meisten der einberufenen waren noch
nie mit dem Wehrdienst in Berührung gekommen. Jeder Gruppenführer bekam 13 Mann zugeteilt.
Unser Zugführer war Leutnant Neumann, Kompanieführer Oberleutnant Rutschko, Battalions-Kommandeur Major Gröning
(Regiment Buchholz). Hier ging es wieder Kasernenmäßig voran. Das Bataillon wurde hier vereidigt. Jeden zweiten
Sonntag durften unsere Frauen uns besuchen. Ein Jahr später wurden wir wieder zu einer Übung einberufen, auf den
Truppenübungsplatz nach Arys. Jeder Gruppenführer hatte den Auftrag die Gruppe zu entfalten, und auf bewegliche
Figuren zu schießen. Diese Übung musste später mit scharfer Munition wiederholt werden. Jedes Maschinengewehr bekam
50 Schuss, jeder Schütze 20 Schuss zugeteilt. Nach dem Abschießen wurden die Treffer gezählt und dem Kommandierenden
Bericht erstattet. In einiger Entfernung spaziert ein Storch umher, der gar nicht bemerkt hatte dass geschossen wurde,
was bei den Kameraden ein großes Gelächter hervorrief.
Nach der Übung wurde uns gesagt das jeder Gruppenführer eine arische Abstammung nachweisen sollte. Ich konnte in den
Rheinsweiner Kirchenbüchern meine Vorfahren aus Gellen, bis zum Jahr 1732 zurück, nachweisen und wurde zum
Unteroffizier befördert. Aus unserem Dorf wurden auch, Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy und Gustav Deptolla
befördert. Zwischendurch mussten wir schon mal in die Radfahrer-Kaserne nach Ortelsburg, Gewehre empfangen und im
Gelände üben. Am 31 Juli 1939 wurde mir von einem Soldaten ein Schreiben übereicht, das mich aufforderte, am 1. August
um 6:00 Uhr, bei der 3. Kompanie, des 2. Infanterieregiments zu erscheinen.
Um 5:30 hat mich meine Schwester in die Kaserne gebracht. Auf der Schreibstube erklärte mir der Hauptfeldwebel,
dass mir ab sofort der Dienstgrad eines Sanitäters zugewiesen wird, ich mich in der Kammer einzukleiden hätte und mir
in der Handwerkerstube die entsprechenden Schulterklappen annähen lassen sollte. Die aktiven Sanitäter wurden den
Feldlazaretten zugewiesen und wir kamen an ihre Stelle. Unser Bataillon wurde nach Schodmak zum Bunker bauen und
Stacheldraht verlegen eingeteilt. Wir zogen in Begleitung einer Musikkapelle bis zur Kreuzung am Krankenhaus, dann
weiter zu unserem Bestimmungsort, gefolgt von einer Gulaschkanone die in den nächsten Tagen für unsere Verpflegung
sorgen sollte.
Am 14 August haben wir die Jägerkaserne, begleitet von einer Musikkapelle endgültig verlassen und zogen zuerst durch
Ortelsburg, dann über Lehmanen ins Feldmanöver, hinter Rohmanen. Dort entfaltete sich das Bataillon im Gelände, die
Verwundetensammelstelle wurde auf dem Hof des Bauern Friedrich Neumann eingerichtet. Gegen Abend wurde zu Sammeln
geblasen und Biwak bezogen, wobei unsere 3.Kompanie, in einem kleinen Wallt, in der Nähe von Otto Nickels Gehöft
Stellung bezogen hatte. Die 2. und 4. Kompanie hatte sich in der Nähe vom Abbau Pallasch niedergelassen. Die Frau
Nickel hat am Abend ein Mädel in Dorf geschickt um meiner Frau Bescheid zu sagen, wo wir uns zurzeit befinden. Meine
Frau ist dann noch gekommen um sich von mir zu verabschieden, weil wir am nächsten Morgen um 3:00 Uhr Zelte abbrechen
und um 4:00 Uhr in Richtung Kaspersguth marschieren sollten.
Wir sind dann über Achodden, Seelonken, Lehmanen, Ortelsburg, bis nach Grammen und Schützendorf marschiert, wo wir an
einem See Biwak bezogen haben. Es wurde immer gesagt, wir kommen zum Tannenberg-Denkmal bei Hohenstein, wo ein Reichs
Kriegervereinsfest stattfinden sollte. Es wurden auch schon Vorkommandos aufgestellt, doch dann kamen wir nach Orlau
und Lahna-Mühle, da wo die Alle entspringt haben wir 2 Tage biwakiert. Unser Kompanieführer hat uns nach Waplitz auf
den Soldatenfriedhof des Ersten Weltkrieges geführt und uns erklärt wie das Jägerbataillon sich 1914 hier entfaltet
hat und aufgerieben wurde. Dann mussten wir in der Nähe von Gut Koslau über einen Fluss und bezogen in einem Waldstück,
vorbereitete Stellungen in der Nähe der polnischen Grenze. Herr und Frau Thalmann haben uns jeden Tag, bis zur Grenze,
mit Brötchen und Getränken versorgt. Es wurde scharfe Munition ausgegeben, weil wir am nächsten Morgen um 4:00 Uhr die
polnische Grenze überschreiten sollten.
Am nächsten Morgen um 10 Minuten vor 4:00 Uhr kam der Befehl; scharfe Munition abgeben, alles zurück in ein 6 Kilometer
entferntes Dorf, wo wir auch einquartiert wurden. Das alles geschah’ eine Woche vor dem 1. September 1939. Es wurde
gesagt dass der Führer dem polnischen Präsidenten Rid-Szmigly, ein Ultimatum gestellt hat und es wahrscheinlich nicht
zum Krieg mit Polen kommt. Genau nach 5 Tagen kehrten wir wieder in die gleichen Stellungen zurück, es wurde wieder
scharfe Munition ausgegeben und am nächsten Morgen um 4:00 Uhr überschritten wir die polnische Grenze.
“Der 2. Weltkrieg.”
Der erste Einsatz in Polen
Wir kamen zuerst in ein Dorf in dem sich nur alte Menschen befanden. Auf unsere Frage wo denn die Bewohner wären sagte
man uns dass alle geflohen sind, weil erzählt wurde, die Deutschen würden alle Polen misshandeln und verstümmeln. Ich
habe ihnen daraufhin gesagt dass uns, unter Androhung von Strafe verboten wurde, einem Zivilisten etwas anzutun. Das
Vieh, die Schweine und Hunde des Dorfes liefen frei herum und die Soldaten fingen an auf die Hunde zu schießen, bis
gesagt wurde es seien Meldehunde im Dienste der Deutschen Wehrmacht und dieser Unfug der eigenen Truppe schaden würde,
weil etwaige Querschläger eigene Kameraden verletzen könnten. Wir gingen weiter auf polnischer Seite entlang der Grenze,
bis wir am Nachmittag die ersten Vorposten der Festung Mlawa erreichten, da befanden wir uns plötzlich im Feuerhagel
polnischer Festungsflack.
Am nächsten Morgen hatte ich schon 3 Verwundete und wusste nicht wo sich eine Verwundeten Sammelstelle befindet. Ich
suchte den Bataillonsgefechtstand auf der sich auf einer Anhöhe befand. Ich habe unseren Oberstabsarzt gefragt wo denn
die Verwundetensammelstelle wäre. Er rief beim Tross an, wo er die Auskunft erhielt, das sich vor dem Dorf ein Bunker
befindet in dem man die Verwundeten sammeln sollte, die dann von Sanitätsautos abgeholt würden, weil das Dorf unter
Artilleriebeschuss stand. Am Sonnabend haben unsere Flieger die Bunkerstellungen bombardiert, konnten aber, trotz guter
Treffer nicht viel ausrichten, die Bunker wurden nur etwas angekratzt.
Der Beschuss unserer vordersten Linien ging mit unverminderter Heftigkeit weiter. Am Sonntag verkündete eine große
Staubwolke die Ankunft unserer Panzer, doch sie kamen nur bis zur Panzersperre und mussten wieder abdrehen ohne den
Polen einen schaden zuzufügen. Ein Panzer bekam einen Volltreffer, der Fahrer konnte noch umkehren. Er blutete am Kopf
und der Schütze war so eingeklemmt, das wir ihn nur mit einem Seil unter den Armen, durch die Luke nach oben ziehen
konnten. Ob er seine Verwundung überlebt hat ist mir nicht bekannt, denn in der Nacht wurden Panzergeschütze nach
vorne in Stellung gebracht, die direkt in die Schießscharten der Bunker geschossen und so die Verteidiger vertrieben
haben. Daraufhin sind wir weiter vorgerückt. Auf einer Wiese war ein tiefer Graben ausgehoben und mit Ästen getarnt,
da war ein Panzer hinein gefahren, so dass nur das Hinterteil herausragte und er sich nicht aus eigner Kraft befreien
konnte. In der Luft waren Flieger die Brandbomben abwarfen, ich habe mich auf den Boden geworfen weil ich dachte die
würden explodieren, aber sie zischten nur, so das Stoppeln und Graß rings herum in Brand gerieten.
Bei den Kampfhandlungen gab es mehrere Verwundete, denen ich gerade Verbände anlegen wollte, als unser Hauptmann zur
Trillerpfeife griff um mir klar zu machen, dass ich ihm folgen sollte. Die Polen fingen an zu schreien, ich sollte
sie ins Lazarett bringen denn hier im Wald würde sie niemand finden. Ich setzte mich aufs Fahrrad und folgte unserem
Kompanieführer, der mir sagte ich soll immer bei der kämpfenden Truppe bleiben, denn hinter der Front sind die
Sanitätsabteilungen, die werden die Verwundeten schon versorgen. Der Vormarsch dauerte bis in die späte Nacht. Auf
einem Gehöft, das nach allen Seiten durch Feldwachen abgesichert wurde, machten wir endlich Rast. Wir haben
Getreidegarben auf dem Hof ausgebreitet und uns zur Ruhe gelegt, als plötzlich um Mitternacht Leuchtraketen den Himmel
erhellten und Maschinengewehrfeuer uns aus dem Schlaf schreckte. Ein par polnische Soldaten hatten das Feuer eröffnet,
aber sich kurz darauf ergeben.
Die Narew-Überquerung
Als es hell wurde ging der Vormarsch weiter. Es wurde uns untersagt Tagebuch zu führen, darum
weiß ich nicht wie die Orte hießen, durch die wir marschiert sind. Als wir durch ein sumpfiges Gelände vor drangen
stand auf einer Anhöhe am Horizont, die polnische Artillerie, die uns sofort unter Beschuss nahm. Unser Hauptmann war
der Meinung dass wir schon in der Nähe des Flusses Narew sein müssten, als aus den Sträuchern ein mit Schlauchboten
beladenes Lastauto auftauchte. Wir wurden aufgefordert mit je 6 Mann ein Schlauchboot zu nehmen, an einem Aggregat
der daneben stand mit Luft zu füllen und zu Wasser zu lassen. In einer Stunde war das ganze Bataillon über die Narew,
wo der Vormarsch fortgesetzt wurde. In einem Dorf überraschte uns die polnische Kavallerie und fing sofort mit
Maschinengewehren zu schießen an. Da kam der Befehl: Alles wieder zurück. Es ging noch schneller als auf der Hinfahrt.
Wir sind erst einige Kilometer am Fluss entlang gegangen und haben dann zum zweiten Mal rüber gesetzt.
Die Gehöfte im Dorf standen alle in Brand. Auf einem waren viele Bienestöcke. 2 Kameraden wollten den Stöcken Waben
entnehmen, doch die Bienen durch das Feuer aufgeschreckt, überfielen sie sofort und stachen derart zu das sie nicht
mehr wieder zu erkennen waren. Ich habe die Einstichstellen mit Salmiak betupft, mehr konnte ich nicht tun. Wir mussten
auf unserem Vormarsch durch einen Wald der in Flammen stand, so dass man kaum atmen konnte. Es ging weiter in Richtung
Minsk und Warschau, wo schon die Sowjetische Armee durchgegangen war, die Pferde und Vieh von einem Gut mitgenommen
hatten. In einem Wald stießen wir unverhofft auf ein Kloster, in dem wir einige Gefangene machten. Dann trafen wir auf
eine gute Straße die nach Grochow ging.
Als wir dort einmarschierten wurden wir aus den oberen Stockwerken beschossen, so dass wir, um uns zu schützen, nur an
den Hauswänden entlang gehen konnten. Wir haben jedes Haus nach Feinden durchsucht. Vor einem Haus stand ein Hund der
niemanden reinlassen wollte, solange bis ihn eine Kugel traf. Die polnische Artillerie feuerte von Warschau aus, um
unseren Vormarsch zu stoppen. Wir hatten uns gerade eingegraben als plötzlich deutsche Flieger am Himmel erschienen,
die unsere Stellungen mit Bomben bewarfen und dabei viel Unheil anrichteten. Wir haben sofort Fliegertücher
ausgebreitet und Leuchtraketen abgeschossen. Da ich in dem Graben, den ich kurz zuvor ausgehoben hatte, sofort in
Deckung gegangen bin ist mir zum Glück nichts passiert. Unter den anderen Kameraden gab es viele Verwundete, so dass
ich nicht wusste wem ich zuerst helfen sollte.
Der Oberstabsarzt hat mich sofort tatkräftig unterstützt, so das bald alle Verwundeten versorgt waren, außer einem,
dem ein Bombensplitter den Arm abgerissen hat. Ich habe im 3 große Verbandspäckchen auf die Wunde gelegt, doch die
Blutung ließ sich trotzdem nicht stoppen, so dass er eine Stunde später auf der Krankensammelstelle verstarb. Wir
haben danach in einem Tomatenfeld einen Graben ausgehoben und eine neue Abwehrstellung bezogen. Die Gruppe Schwarz
bekam den Auftrag nach etwaigen versprengten polnischen Verbänden Ausschau zu halten, als sie unerwartet aus einer
Häuserreihe mit Maschinengewehrsalven überschüttet wurden. Der Gruppenführer und noch ein Soldat wurden dabei tödlich
verwundet. Danach wurde noch ein weiter Stoßtrupp, unter der Führung von Leutnant Briskorn, der sich dazu freiwillig
gemeldet hatte, hinaus geschickt um den Gruppenführer und den anderen Toten zu bergen.
Bei diesem Unternehmen, das erfolglos ausging, weil die Toten schon verscharrt waren, durchschlug eine Kugel den
Stahlhelm von Leutnant Briskorn, der auch sofort tot war. Alle Toten wurden später, an der Kirchenmauer in Grochow, in
Särgen beigesetzt: Hauptmann Schönwald sagte, das sie nach dem Kriege auf den Heldenfriedhof nach Ortelsburg überführt
werden. Drei Tage lagen wir bei Grochow in Stellungen, waren dem polnischen Maschinengewehrfeuer sowie den Bomben
deutscher Flugzeuge ausgesetzt. In der Nacht musste ich zu einem Verwundeten in die vorderste Linie und habe den
Rückweg nicht mehr finden können, als plötzlich Gewehrfeuer aufflammte habe ich in den Ruinen Schutz gesucht. Erst im
Morgengrauen konnte ich mich wieder orientieren und zu meinem Unterstand zurückfinden.
Warschau wurde tagelang bombardiert und stand auch unter Artilleriebeschuss. Aus dunklen Rauchwolken kamen oft ganze
Bündel von Papier angeflogen. Die Verwundeten kamen oft auf Krücken zu unserem Unterstand, ich habe sie dann zur
Krankensammelstelle hingeführt. Wir haben auch polnische Zivilpersonen betreut, die während der Kampfhandlungen
verwundet wurden. Als einmal 2 Jungen vorbeiliefen hat einer ihnen nachgerufen sie sollten seiner Frau Bescheid sagen,
er wäre auf der Krankensammelstelle an der Kirche. Als wir dort ankamen war seine Frau, mit einem Kind auf dem Arm,
schon da.
Nach der Kapitulation von Warschau, gingen wir über Sokolow zum Bug und haben dort Quartier bezogen. Der Russe hatte
sich bereits hinter den Fluss zurückgezogen, hatte alles Vieh und Pferde mitgenommen. Dort erreichte mich ein Telegramm
von zu Hause, dass meine Tochter gestorben ist. Es sprach sich auch herum dass verschiedene Heimaturlaub bekommen haben,
ich durfte auch für 14 Tage heim. Wir fuhren mit Lastautos nach Allenstein in die neue Reiterkaserne, zum
Ersatzbatallion, da haben wir unsere Gewehre und Munition abgeben, dann durften wir, jeder in seinen Heimatort
weiterfahren.
Als wir unsere Quartiere am Bug verlassen haben war sehr viel Schnee gefallen. Hier in Ortelsburg fanden wir die
gleiche Wetterlage vor, aber nach 3 Tagen war alles wieder weggetaut und wir konnten die Kartoffelernte, die durch den
frühen Wintereinbruch gestoppt wurde, zu Ende bringen. Ein Tag bevor ich zu Hause angekommen bin wurde die Tochter
beerdigt. Nach 14 Tagen mussten wir uns in Allenstein melden, Gewehre empfangen und wieder zurück zur Division an den
Bug 150 Kilometer hinter Warschau. Die elfte Division, zu der wir auch gehörten sollte in den Westen Deutschlands
verlegt werden und war schon unterwegs zur Verladestation Skiernewice 50 Kilometer vor Warschau.
Mein Dienst als Sanitätsunteroffizier
Unser Bataillon kam in das Städtchen Burscheid, im Kreis Opladen, wo wir in Privatquartieren
untergebracht wurden. Nach 3 Monaten, im Januar 1940, wurden wir nach Solingen verlegt, wo wir bis zum
Frankreichfeldzug stationiert waren. Wir mussten an Feldübungen teilnehmen, wie andere die in Kasernen untergebracht
waren. Während dieser Zeit musste jeder seine Zähne in Ordnung bringen lassen. Jeden Tag fuhren 20 Mann in die
Cäzilienstraße nach Köln, zur Zahnklinik. Im Rheinland wurde unsere Division neu aufgestellt. Ausfälle durch den
Polenfeldzug wurden durch neue Soldaten ergänzt. Ich kam nun zum Ersatzbatallion, war der Älteste in der ganzen
Kompanie. Als der Frankreichfeldzug losging wurde unser Ersatzbatallion mit den noch vorhandenen Verwundeten, in die
neue Reiterkaserne, nach Allenstein verlegt.
Meine Frau hat, mit Unterstützung der Bauernschaft, einen Antrag gestellt, daraufhin wurde ich zur Frühjahrsbestellung,
beurlaubt und später bis auf weiteres vom Militärdienst freigestellt. Als der Russlandfeldzug losging wurde ich von der
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg, für 14 Tage einberufen. Ich war seit 1922, Mitglied der freiwilligen
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg und habe jedes Jahr an Übungen teilgenommen. Jede Bereitschaft musste etliche Leute
stellen. Von Rohmanen wurden Emil Rosowski, Johann Dembek, und ich, zur Krankensammelstelle Wirballen, in Litauen,
abkommandiert. Dorthin kamen Lazarettzüge aus Russland mit der Breitspurbahn. Die Verwundeten wurden frisch verbunden
und auf Waggon mit Normalspur verladen und nach Deutschland gebracht.
Als die 14 Tage vergangen waren wollten wir wieder nach Haus zurück, doch man wollte uns nicht entlassen. Stattdessen
wurden wir dem Wehrkreisamt Königsberg zugeteilt, neu eingekleidet und zur Aushilfe ins Lazarett nach Gumbinnen
abkommandiert. Mehr als ein Jahr war ich in den Urlauber-Baracken, habe dort Krankenstube betreut. Später, bis zum
Dezember 1944, war ich im Reserve-Lazarett 4, in Königsberg tätig. Dort habe ich auch die Luftangriffe der Engländer,
vom 25 bis 26. August 1944 miterlebt.
Wir sollten gerade einen Lazarettzug in Rotenstein entladen, als plötzlich die Sirenen ertönten - Fliegeralarm. Im
gleichen Moment waren die ersten Flugzeuge auch schon da, zuerst warfen sie „Tannenbäume” und danach Foßforkanister ab.
Die Omnibusse standen schon zur Abfahrt bereit als es losging. Wir haben die Verwundeten schnell in den
Luftschutzkeller getragen, haben die Betten von den Fenstern weggerückt damit die Verwundeten nicht von den
Glasssplittern verletzt wurden. Im Kasernenhof brannten die Fosforkanister lichterloh. Unsere Unterkunft, die sich in
einer Baracke befand ist völlig abgebrannt, mit dem Wenigen was wir unser Eigen nannten. Am nächsten Tag wurden wir neu
eingekleidet und am 29. bis 30. kamen die englischen Bomber wieder, sie setzten genau da ihr Zerstörungswerk fort wo
sie vor 3 Tagen aufgehört hatten.
Anfang Dezember 1944 musste ich mich nach Stablack melden und musste dann zur Sanitätsabteilung 1, nach Gernau, das
liegt zwischen Lodz und Warschau. Vormittags hatten wir Felddienstübungen und nachmittags theoretischen Unterricht.
Jeden Tag wurden Gruppen zusammengestellt und zu anderen Einheiten abkommandiert. Ich kam zu einer Panzerabteilung, wo
wir an einem Morgen plötzlich auf dem Kasernenhof antreten mussten und zu unserer Überraschung mit der Nachricht
konfrontiert wurden, dass der Russe an mehreren Frontabschnitten durchgebrochen war. Wir bekamen sofort einen
Marschbefehl in Richtung Lodz, wo das Stadtbild noch intakt war, selbst die Straßenbahnen fuhren noch. In der Nacht
haben russische Flugzeuge die Stadt bombardiert. Die Kaserne in der wir untergebracht waren hatte keine
Luftschutzkeller, aber zum Glück blieben wir von Bombentreffern verschont. Am nächsten morgen bot sich uns ein Bild der
Verwüstung. Die entgleisten Straßenbahnwagen, sowie andere Fahrzeuge blockierten die Straßen. Die Älteren unter uns
bekamen Fahrscheine für einen Transportzug, der bereit hinter Lodz abfahrbereit, unter Dampf stehen sollte. Als
russische Panzer in den Straßen auftauchten, verbrannte die Schreibstube unsere Wehrpässe und andere wichtige
Dokumente. Wir liefen zu der Station auf der unser Transportzug bereitstehen sollte, aber da war kein Zug mehr zu sehen
und wir setzten unseren Rückzug zu Fuß fort.
Der Rückzug und Zusammenbruch der Ostfront
In Dobroschin, einer Stadt in Polen, wurde gerade ein Lazarettzug verladen, doch wir kamen nicht
mehr zum Einsatz, weil die russische Infanterie uns schon auf den Fersen war. Es ging weiter über den Fluss Bober,
Sagan, bis nach Glogau an der Oder. Dort wurden wir der 29. motorisierten Sanitätskompanie zugeteilt. Im
Garnisonslazarett wurden noch Operationen durchgeführt. Unsere Division hatte ihr eigenes Feldlazarett, so dass wir den
Befehl zu Weiterfahrt erhielten und noch unbeschadet die Oderbrücke passieren konnten, denn Glogau wurde zur Festung
erklärt. Wir haben 2 Pferdewagen organisiert und mit Verbänden, sowie medizinischen Instrumenten beladen. So kamen wir
bis nach Lübbenau im Spreewald, wo wir in einem Schloss, in zuvor ein Museum war, unser Lazarett untergebracht haben.
Weil die Amerikaner Cottbus bombardiert hatten, wurden die Verwundeten zu uns nach Lübbenau gebracht. Hier haben wir
Tag und Nacht gearbeitet, um die vielen Verwundeten, aus den schweren Kämpfen bei Grünberg und Sagan zu versorgen. Die
Soldaten von der Abwehrfront kamen schon mit abgestorbenen Armen oder Beinen bei uns an, weil in vorderster Linie keine
Frontlazarette mehr vorhanden waren; es mussten viele Amputationen durchgeführt werden. Als für unsere Pferde kein Heu
mehr vorhanden war, schickte mich unser Hauptfeldwebel, zu einem Bauern in den Spreewald, mit dem Auftrag, Futter zu
besorgen. Mit noch zwei Mann fuhren mit zwei Kähnen, zuerst den Hauptstrom entlang und dann in einen Nebenarm; da haben
wir die Boote beladen und brachten das Heu nach Lübbenau.
Als wir uns bei unser Einheit zurück melden wollten, war alles schon marschbereit. Ich bin schnell in einen Bus
eingestiegen der sofort losfuhr, weil russische Verbände schon in sichtweite waren. Russische Flugzeuge kreisten über
den Dächern und nahmen, mit ihren Bordwaffen jeden unter Beschuss, der sich irgendwo blicken ließ. Wir konnten nur
durch den Wald, oder in der Nacht vorwärts kommen, denn wenn ein Auto auf der Landstraße fuhr, war alsbald ein Flugzeug
hinter ihm her und schoss es in Brand. Als wir nach Tagen am Ufer der Elbe ankamen, war bereits eine Ponton-Brücke
erstellt worden, welche die zerstörte Brücke ersetzen sollte.
Durch die vielen Fahrzeuge waren in den Sand tiefe Spuren gefahren, so dass andere Fahrzeuge unsere Busse ins
Schlepptau nehmen mussten, weil wir mit eigener Kraft nicht mehr weiterkamen. Beiderseits der Trasse standen
Flüchtlingswagen, in der der Hoffnung die Brücke passieren zu können, doch SS-Polizei verhinderte das die Gespanne den
militärischen Rückzug zum Stillstand brachten. Es gelang uns die Elbe zu überqueren, um in einem Waldstück Schutz vor
feindlichen Fliegern zu suchen.
Als wir unsere Busse und Autos gut getarnt hatten, hat unser Bataillonschef die anwesenden Parteigrößen zu sich
gerufen und ihnen erklärt das wir eine Einheit des Roten Kreuzes sind und nach internationalem Recht keine Waffen
besitzen dürfen. Nach langer, erregter Diskussion wurde beschlossen einen Graben auszuheben und alles im Sand zu
verscharren. Als wir dann weiter, durch die Dörfer fuhren, sahen wir schon viele weiße Bettlaken, als Zeichen der
Kapitulation, aus den Fenstern hängen. Es wurde uns erzählt dass der Bürgermeister von der SS erschossen wurde, weil
er die Bevölkerung zu diesem Schritt ermutigt hatte. Jetzt waren hinter uns die Russen und vor uns schon die Amerikaner.
Amerikanische Panzer fuhren umher und schossen wild durch die Gegend, ohne ein Ziel anzuvisieren. Niemand wollte sich
dem Russen ergeben, doch der Weg der zu den Amerikanern führte, war durch abgesägte Bäume blockiert. Wir sind schnell
in das nächste Dorf gegangen, haben uns Sägen und Äxte besorgt, die Bäume durchgesägt und in den Straßengraben
geworfen.
“ Nach dem Ende des 2. Weltkrieges.”
In amerikanische Kriegsgefangenschaft
Dann fuhren wir unter internationaler Flagge an eine Mulde Brücke, vor der zwei amerikanische Soldaten, mit Zigarren,
zur Hälfte im Mund, standen. Sie rauchten und kauten gleichzeitig. Wir mussten auf einen freien Platz fahren, alle
aussteigen und rechts wieder antreten. Wäschebeutel und Tornister mussten wir abstellen; danach wurden wir nach Waffen
durchsucht, Wertsachen, Uhren und Messer wurden uns gleich abgenommen. Als wir anschließend an unserem Gepäck
vorbeigingen durfte niemand was mitnehmen. Als ich gebückt, nach meinem Wäschebeutel greifen wollte, in dem sich noch
3 Konservendosen und ein Brot befanden, bekam ich einen Fußtritt ins Gesicht, so dass mir ein Zahn ausgeschlagen wurde.
Wir wurden dann in einem Garten zusammen getrieben und gefragt ob jemand bei der SS gedient hat. Nachdem wir in Reihe
und Glied angetreten waren, mussten wir den Oberkörper freimachen und die Arme anheben. Es wurde nach SS-Zeichen
gesucht, die gewöhnlich unter dem Oberarm eintätowiert waren. Nachdem wir Grimma bei Leipzig, wo wir in amerikanische
Gefangenschaft geraten waren, verlassen hatten, mussten wir durch ganz Thüringen bis Hersfeld, an der Grenze zu Hessen,
marschieren. In Hersfeld wurden wir auf große Lastautos verladen, die von farbigen Soldaten gefahren wurden. Man hat
uns mit Stöcken hinauf getrieben, solange bis das Auto so voll war das man kaum stehen konnte. Die Soldaten fuhren, für
diese Straßenverhältnisse, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Wenn die Straße eine scharfe Kurve hatte, flogen
wir alle übereinander und mussten erst mit viel Kraftanstrengung auf die Beine kommen um diese Fahrt zu überstehen.
Da die Straßenränder in dieser Gegend mit Obstbäumen bepflanzt sind und deren Äste sehr niedrig hängen, hätten die
uns die Köpfe abgerissen, wenn wir uns nicht ständig geduckt hätten. Unsere Fahrt endete in Bad Kreuznach, in der Pfalz,
wo wir in ein Lager, in dem sich später 130.000 Mann und 6 Generäle befanden, eingepfercht wurden. Die Unterkunft der
Generäle befand sich unter einem Zelt, alle anderen mussten die Zeit unter freiem Himmel zubringen. Die Offiziere, die
Unteroffiziere, die Mannschaften; wurden in getrennten Camps untergebracht. Die Mannschaften wurden auch zur Arbeit
abkommandiert und konnten bei dieser Gelegenheit, Brot, Brötchen oder Zigarettenstummel organisieren, wogegen die
Offiziere und Unteroffiziere ihr Camp überhaupt nicht verlassen durften.
Die ersten Tage gab es kein Wasser und kein Brot, so dass die Kameraden vor Erschöpfung umfielen. Später standen wir
manchmal den ganzen Tag nach Wasser an, das von den, uns bewachenden Negern mit großen Wassertanks angefahren wurde. Am
dritten Tag bekamen wir mittags und abends etwas zu Essen; Brot bekamen wir erst nach zwei Wochen, nach dem aus der
Umgebung herbeigeholte Handwerker, Backöfen gebaut hatten. In den verschiedenen Gemeinden, die in den uns umgebenden
Weinbergen lagen, mussten sich alle Männer beim Bürgermeister melden. Als sie dann erschienen waren, wurden sie auf
bereitstehende Lastautos getrieben und zu uns ins Lager gebracht. Sie waren ohne Kopfbedeckung und ohne wärmere
Bekleidung angekommen, weil ihnen gesagt wurde, dass ihr Aufenthalt im Lager nur von kurzer Dauer sein würde. Man hat
uns, falls noch vorhanden, Decken und Mäntel abgenommen, mit der Begründung, sie würden für Kranke und Verwundete
gebraucht. Jeden Tag starben mehr als 200 Mann, die wir sofort in ein Zelt tragen mussten. In der Nacht wurden die
Toten dann mit unbekanntem Ziel, weggefahren.
Viele haben ihren Verstand verloren uns irrten im ganzen Camp ziellos umher. Als Latrinen wurden Gräben ausgehoben, in
die verschiedene Kameraden, bei der Verrichtung ihrer Notdurft, vor Schwäche hineingefallen sind und nicht mehr wieder
heraus kamen. Aus den Pfählen die, die jungen Obstbäume stützten, haben wir Krankentragen gebaut um unsere Kameraden,
bei Bedarf, zur Krankensammelstelle zu tragen. Es war in diesem Frühjahr auch sehr kalt, doch unsere Erdlöcher, die wir
zum Schutz vor Kälte und Wind, nur mit leeren Konservendosen ausgehoben hatten, durften nicht tiefer als 20 Zentimeter
sein. Nach jedem Regenguss mussten wir das Wasser ausschöpfen. Nach einem Gewitter, standen wir wiedermal, total
durchnässt in unserem Camp, als unerwartet am Horizont die Sonne hervortrat. Einer unserer Kameraden hatte noch eine
Trompete gerettet und fing, von dem Anblick völlig überwältigt, zu spielen an: "Es geht alles vorüber, es geht alles
vorbei, nach jedem Dezember, folgt wieder ein Mai". Daraufhin hob sich die Stimmung der tiefbetrübten Kriegsgefangenen,
so das Heimatlieder durch das ganze Camp erklangen, obwohl wir in den nassen Kleider herumgehen mussten, bis sie am
Körper trocken wurden.
In französischer Kriegsgefangenschaft
Nach etwa einem Monat, haben uns die Amerikaner, den Franzosen, zum Arbeitseinsatz, ausgeliefert.
Etwa 4 Kilometer von Bad Kreuznach entfernt, stand auf freier Strecke, ein Zug mit offenen Kohlenloren, auf den wir
verladen wurden. In jeden Waggon, wurde pro Person eine Tafel Schokolade und ein Päcken Zwieback rein geworfen, doch
viele Kameraden fanden nur leere Päckchen vor, weil die schon zuvor von der französischen Wachmannschaft geplündert
wurden. Wir haben uns darüber beschwert, doch die haben uns nur ausgelacht. Nachdem wir zunächst bei Mainz über den
Rhein fuhren, endete unsere Fahrt bei Paris in einem großen Zeltlager. Dort wurden wir auf andere Züge verladen, die uns
nach Südfrankreich, in ein Barackenlager, bei Mazarei, brachten.
Auf einer Zwischenstation hat man uns unter einer Pumpe, die Lokomotiven mit Wasser versorgt, abgestellt, den Kran
aufgedreht und uns anschließend ausgelacht, die Kinder Haben uns mit Steinen beworfen. Ein Wachmann kam in unseren
Waggon gekommen, hat unser Gepäck durchsucht, wenn er Tabak oder Zigaretten gefunden hat, nahm er sie mit. Die Kameraden
waren darüber so empört, dass sie vorhatten, ihn nachts unter den Waggon zu werfen. Wir haben sie gebeten dass zu
unterlassen, weil man uns in diesem Falle, alle erschießen würde.
Als wir ins Lager kamen wurden wir zuerst gezählt, dann mussten wir unser Gepäck stehen lassen und beiseite treten.
Wenn man bei der Nachkontrolle noch was in den Taschen fand, wurde das auch entwendet, selbst Esslöffel. Wir wurden
dann in drei Baracken, ohne Toiletten, eingeschlossen. Die Kameraden haben ihre Bedürfnisse in Kochgeschirre erledigt
und durch ein kleines Fenster, das sich fast unter der Decke befand, hinausgeworfen. Andere Fenster ließen sich nicht
öffnen, weil sie mit Stacheldraht zu geflochten waren. Als die Kameraden die Kochgeschirre auskippten, haben die
Wachposten geschossen und die Fenster zertrümmert. Sie waren der Meinung dass wir ausbrechen wollten. Es herrschte eine
große Hitze, in den überfüllten Baracken sind wir fast erstickt. Am nächsten Tag haben wir uns über fehlende Toilettem
beschwert, da haben sie Heringsfässer durch die Hälfte geschnitten und an der Ausgangstür hingestellt. Um bei den
überfüllten Räumen dort hinzukommen, musste man über die Köpfe der Anderen steigen. Viele hatten Fieber und Durchfall
und mussten in die Krankenstube eingeliefert werden, wo sie kurz darauf verstarben.
Besonders Raucher litten sehr an der Unterernährung, bekamen Wasser in den Beinen und waren die Ersten die verstarben.
Nach der Registrierung wurden wir auf andere Baracken verteilt. Die Zivilbevölkerung kam in die Räume und begann uns
auszuplündern. Wer noch gute Schuhe besaß musste sie ausziehen und bekam dafür die kaputten des Plünderers. Eine Woche
lang mussten wir diesen Zustand ertragen, erst als die Kameraden sich beschwerten, wurde am Eingang eine Tafel am
Eingang angebracht, dass die Zivilbevölkerung das Lager nicht betreten darf. Bis auf einige, wenige Ausnahmen wurde
diese Anweisung befolgt.
Als wir im Lager ankamen, war der französische Lagerkommandant, ein ehemaliger Kriegsgefangener, der bei einem Bauern
in Deutschland gearbeitet hatte. Dieser Bauer war jetzt als Kriegsgefangener in seinem Lager. Als er ihn erkannte, hat
er ihn gleich zum Küchendienst eingeteilt und mit dem nächsten Krankentransport nach Hause fahren lassen. Zu Mittag
bekamen wir nur gekochte Haferkörner, da schwamm alles oben, später war man dann auf Gerste umgestiegen. Als viele
daran gestorben waren, weil sie diese „Rohkost”, die nur ein Kuhmagen verträgt, nicht gegessen haben, hat man die
Körner durch eine Schrotmühle laufen lassen. Dann hat man uns Steckrüben gekocht; wir bekamen 250 Gramm Weißbrot,
etwas Quark und ein viertel Liter Magermilch. Später, als wir schon arbeiten mussten, hat man in unserem Essen einen
Kuhkopf mitgekocht, das hat dann bedeutend besser geschmeckt.
Bevor wir morgens zur Arbeit gingen, mussten wir zu Flaggenparade und abends, nach der Rückkehr, haben wir die Flagge
wieder eingeholt. Wir haben einen Kanal gereinigt, dessen Sohle 2 Meter dick mit Schlamm bedeckt war. Zuerst wurde das
Wasser abgelassen, dann haben wir, einer dem andern, den Schlamm mit der Schippe hoch gereicht. Der Letzte hat den
Schlamm, der so zäh war, dass er nicht von der Schippe wollte, oben am Rande abgelegt. Manchmal waren 10 Mann nötig um
den Höhenunterschied zu überwinden. Das Wachpersonal schoss über unsere Köpfe hinweg und rief: „schnell arbeiten”. Bei
der großen Hitze war das ein Ding der Unmöglichkeit, zumal es nichts zu Trinken gab. Auf dem Heimweg haben wir im Walde
Heilkräuter gesammelt, die man in der Küche getrocknet und als Tee zubereitet hat, den wir am nächsten tag zur Arbeit
mitnahmen, um unseren Durst zu stillen.
Unser Aufseher hatte einen Stock, an dem sich noch kurz abgeschnittene Äste befanden. Wer seiner Meinung nach, nicht
ordentlich gearbeitet hat, bekam gleich Schläge auf den Rücken. Die weißen Aufseher wurden irgendwann durch Neger
ersetzt, die uns bedeutend besser behandelt haben. Wenn irgendetwas schief ging, haben sie nichts gesagt, nur gelacht.
In den übrig gebliebenen Wassertümpeln hatten sich noch einige Aale versteckt, die wir zu fangen versuchten, was uns
auch manchmal gelang. Wir mussten ihnen das Genick brechen, damit sie uns nicht entwischen konnten. Wenn die Franzosen
bemerkten das wir Aale hatten, wurden sie uns abgenommen. Gelang es uns aber, sie ins Lager zu bringen, dann haben wir
uns eine köstliche Malzeit zubereitet.
Um sicherzustellen dass niemand geflüchtet ist, wurden wir, wenn wir abends ins Lager zurückkamen, zuerst gezählt.
Diese Zählung wurde mehrmals wiederholt, weil die Wachmannschaften sich immer wieder verzählt haben. Als einer von uns
hin ging, ihnen sagte dass alle da sind, wollten sie es nicht glauben und haben uns vor dem stehen lassen, bis es ihnen
irgendwann einfiel. uns doch das Tor zuöffnen. Einmal, als wir von der Arbeit zurückgekehrt waren, standen wir bis 23
Uhr neben der Flagge, weil uns niemand das Tor geöffnet hat. Als wir dann doch irgendwie ins Lager kamen haben wir
festgestellt, dass das ganze Wachpersonal betrunken war und niemand im Stande uns das Tor zu öffnen.
Eines Tages waren wir wieder abends zur Parole angetreten, als ein älterer Herr mit seinem Hund, am Stacheldraht
entlang, spazieren ging. Weil der Hund, unterm Stacheldraht hindurch, zu uns kam, hat ihn einer geschnappt, ihm das
Genick gebrochen und unter seiner Jacke versteckt. Der Franzose hat nach seinem Hund gerufen und gepfiffen, aber alles
vergebens, der Hund war nicht aufzufinden. Die Kameraden haben ihm gleich das Fell über die Ohren gezogen, das Fleisch
gekocht und das Fell in die Latrine geworfen. Das Fleisch wurde umgehend verspeist.
Als wir am nächsten Tag von der Arbeit zurückkehrten, war im Lager der Teufel los. Wir mussten sofort antreten und
wurden gefragt, wo der Hund geblieben ist, der Gestern Abend, mit seinem Herrchen, am Zaun entlang spazieren ging. Als
sich niemand dazu bekannte, mussten wir weiterhin stehen bleiben, während die Wachmannschaften von Baracke zu Baracke
gingen und alles durchsuchten. In einer Latrine hat man dann das Fell gefunden, was uns ein furchtbares „Donnerwetter”
einbrachte und in den nächsten Tagen, nach der Arbeit, unter dem Kommando eines Oberfeldwebels, eine Stunde
nachexerzieren.
In Südfrankreich regnet es den ganzen Sommer nicht; die Bauern haben da keine Scheunen und das Getreide wir nur in
Schobern aufgestellt und dann umgehend gedroschen. Vom Oktober bis Dezember regnete es fasst jeden Tag in Strömen.
Gesät wird nur im Frühjahr und im Herbst, weil im Sommer alles vertrocknet. Es wird viel Wein angebaut und die
Steckrübe wächst den ganzen Winter. Neben den Weinreben wurde aus Schieferplatten ein Zaun aufgestellt, um dem Wein
einen optimalen Standort zu sichern. Die Bauernwagen hatten nur zwei Räder und waren nur mit einem Pferd bespannt, das
die ganze Balance des Wagens zu halten hatte. Trotzdem haben sie soviel aufgeladen wie wir auf einen Leiterwagen. Viele
Kameraden wurden den Bauern zur Arbeit ausgeliehen. Wenn ein Bauer einen Arbeiter gebraucht hat und es wurde gefragt,
wer sich in der Landwirtschaft auskennt, da haben sich alle gemeldet. Der Bauer konnte sich dann aussuchen, wen er
mitnehmen wollte.
Wenn wir durch die Stadt zur Arbeit gingen, haben verschiedene Leute Fallobst in die Abfalleimer gelegt. Wenn das von
den Kameraden bemerkt wurde, schwenkten viele aus der Reihe, um sich etwas mit zunehmen, was von den Wachmannschaften
nicht gern gesehen wurde. Viele Kriegsgefangene hatten keine Schuhe mehr, sie haben die Füße nur mit Lumpen bewickelt.
Eines Tages kamen Kameraden aus Norwegen, die nach Deutschland entlassen werden sollten. Mann hat sie jedoch ins Lager
gesteckt und zur Arbeit eingeteilt. In Norwegen hatten sie Kleider und Stoffe eingekauft, hatten volle Seesäcke und
sogar Karren auf 2 Rädern, weil sie ja in die Heimat entlassen werden sollten. Als wir morgens zur Arbeit rausgeführt
wurden standen sie schon vor dem Lager. Wir haben ihnen zugerufen, dass sie uns etwas abgeben sollen, weil ihnen ja
sowieso alles abgenommen wird, aber sie haben uns nur ausgelacht. Als sie ins Lager Kamen mussten sie ihr Gepäck
ablegen, wurden dann wo anders hingeführt und haben es danach nie wieder gesehen.
Durch die vielen Läuse, Flöhe und Wanzen die wie im Lager hatten, kam es bei verschieden Kameraden, an den
Einstichstellen, zu eiternden Entzündungen. Um dem vorzubeugen hat man uns mit einem Pulver, das in Frankreich
hergestellt wurde, aber bei den Parasiten keine Wirkung zeigte, eingesprüht. Erst bei der Anwendung eines Mittels
amerikanischer Herkunft, war alles über Nacht verschwunden.
Der Sonntag war arbeitsfrei. Dann kam ein katholischer, französischer Pfarrer, eskortiert von 3 Mann, mit
aufgepflanztem Seitengewehr ins Lager und hat Gottesdienst gehalten. Einen evangelischen Pfarrer gab es nicht, nur
einen Baptisten Prediger. Der wurde würdevoll eingekleidet, bekam ein großes Kreuz und hat jeden Sonntag in einer
extra dafür hergerichteten Baracke Gottesdienst gehalten. Wer Theologie studiert hatte und sich meldete, wurde zu
einem Seminar geschickt und konnte sein Studium fortsetzen. Glasbläser durften das Lager auch verlassen und ihrem
erlernten Beruf wieder arbeiten.
Wer sich freiwillig, für 5 Jahre, zum Dienst in der Fremdenlegion verpflichtet hat, das waren etliche unter uns, wurde
neu eingekleidet, bekam gutes Essen und Rauchwaren soviel er wollte. Nach einem Jahr wurden, nach und nach, die
Kranken und Körperbehinderten in die Sowjetische Besatzungszone entlassen. Eine Entlassung von Kriegsgefangenen, die
in den Westzonen oder jenseits von Oder und Neise zu Hause waren, war nicht vorgesehen. Die Österreicher wurden alle,
unabhängig von ihrem Gesundheitszustand entlassen.
Ich habe Briefe nach Hause geschrieben, aber die kamen nur bis Allenstein und wurden wieder zurück geschickt. Als eine
Kommission des Roten Kreuzes aus der Schweiz unser Lager besichtigt hat, haben wir uns beschwert, das wir als
Sanitätsdienstgrade, zur Arbeit gehen müssen. Daraufhin erging ein Befehl: Wer einen vom Roten Kreuz, ausgestellten
Ausweis besitzt, gehört einem internationalen Verband an und braucht nicht zu Arbeit gehen. Aus unserem Lager hatten
sich 20 Mann gemeldet, die daraufhin Freigang, in Begleitung von zwei französischen Wachsoldaten erhielten. Als wir
gefragt wurden wo wir hin wollen, entschlossen wir uns, einen Soldatenfriedhof, auf dem unsere verstorbenen Kameraden
beerdigt waren, zu besuchen.
Da der Untergrund in dieser Gegend aus Felsen bestand, wurden die Gräben, in denen die Toten in selbst gezimmerten
Kisten nebeneinander gestellt wurden, mit Hilfe von Dynamit ausgehoben. Ein Leichenwagen, mit einem Pferd bespannt,
das mit einer schwarzen Decke abgedeckt war, wurde von einem Kutscher in angemessener Kleidung, gefahren. Der Wagen
konnte gleichzeitig 4 Kisten transportieren. Wenn wir von der Arbeit kommend, dem Leichenwagen begegneten, wurde
gehalten und mit einer Schweigeminute der Toten gedacht, bis der Wagen vorbei war. Die Zivilbevölkerung verharrte auch
im Schweigen, mit abgenommener Kopfbedeckung.
Ein Kamerad, der in Krottorf, Kreis Oschersleben, bei Magdeburg, zuhause war, sagte bei seiner Entlassung zu mir:
Sollte ich das Glück haben, meine Entlassungspapiere zu erhalten ohne eine Bleibe vorzuweisen, dann soll ich Krottorf
als Heimatadresse angeben. Auf der Krankenstube habe ich angegeben, dass sich noch ein Schrapnellsplitter, aus dem
Ersten Weltkrieg, in meiner Kreuzbeingegend befindet, er zwar verkapselt ist, aber immer noch Beschwerden verursacht.
Daraufhin wurde ich zur Entlassung vornotiert. Als bekannt wurde das ein Rückkehrertransport in die sowjetische
Besatzungszone zusammengestellt wird, habe ich mich sofort gemeldet und wurde für ein Entlassungslager in Angoleme
vorgesehen. War das eine Freude, als uns mitgeteilt wurde, wann der Rücktransport stattfindet.
In unserem Lager waren noch 2 Kameraden aus dem Kreis Ortelsburg: Ein Gustav Lumma aus Leynau und ein Alfred Moritz
aus Groß Schöndamerau. Sie mussten noch zurückbleiben und haben mir den Auftrag erteil, die Angehörigen in der Heimat
zu grüßen und ihnen die Anschrift mitzuteilen. Als wir im Entlassungslager ankamen, fragte man uns nach unserer
Heimatanschrift. Dann wurden die Entlassungspapiere angefertigt. Es wurde uns auch ein Barscheck, für die in Frankreich
geleistete Arbeit ausgehändigt, den wir bei jeder Kasse in Deutschland einlösen könnten. Ich habe ihn bis zum heutigen
Tage nicht einlösen können, obwohl ich irgendwann in der Zeitung gelesen habe, das Verrechnungschecks die den aus
französischer Kriegsgefangenschaft Entlassenen, ausgehändigt wurden, einzulösen sind.
Wir kamen zuerst nach Saar Elbe, dann in die Nähe der Zonengrenze zu Thüringen. Hier mussten wir 2 Tage warten, weil
aus der sowjetischen Besatzungszone keine Eisenbahnwagen bereitgestellt wurden. Angesichts dessen, das der Russe beim
letzten Transport die aus Frankreich kommenden Wagen kassiert und nicht mehr herausgeben wollte, bestand der Franzose
jetzt darauf, seine Wagen sofort wieder mitzunehmen. Als der sehnsüchtig erwartete Zug endlich eintraf, durften wir
umsteigen und kamen, immer noch hinter Stacheldraht, nach Erfurt. Von dort weiter ins Quarantänelager nach Prätsch an
der Elbe.
Unter Androhung von Strafe war es verboten das Lager zu verlassen, doch der Hunger zwang uns dazu, in den umliegenden
Dörfern um Lebensmittel zu betteln. Man drohte uns damit, dass Zuwiderhandlungen, mit einer 14-tägigen Verlängerung der
Quarantäne geahndet werden. Der Roggen war schon reif und wir haben, auf den umliegenden Feldern, die Ähren abgerissen,
das Korn, zwischen 2 Steinen zu Mehl zerrieben, um daraus eine Suppe zu kochen, denn von dem was unsere Lagerküche uns
bieten konnte, war es nicht möglich zu überleben. Als der Eigentümer bemerkte wer seine Roggenähren entwendet hat, kam
er ins Lager, gerade zu dem Zeitpunkt als wir mit dem Mahlen beschäftigt waren. Der Lagerkommandant, bei dem er sich
beschwerte, drohte uns zu bestrafen, wenn wir unsere „Rauzüge” nicht unmittelbar einstellen würden. Wir sagten ihm er
solle uns heimfahren lassen, da wir doch lange genug hinter Stacheldraht gesessen hätten.
Endlich wieder in Freiheit
14 Tage nach unserer Ankunft wurden uns Entlassungspapiere ausgehändigt, sowie auch Fahrscheine
zum den, von uns angegeben Heimatorten. So kam ich nach Krottof, Kreis Oschersleben, zu meinem ehemaligen
Kriegskameraden, bei dem ich einen Tag geblieben bin. Er hatte mir schon eine Stelle bei einem Bauern besorgt, der 70
Jahre alt und kinderlos war. Zum Hof, den er mit seiner Ehefrau bewirtschaftet hat, gehörten 36 Morgen Land, 2 Ochsen
und 3 Kühe. Das Ackerland bestand aus 17 Parzellen und sicherte mir einen Arbeitsplatz.
Jetzt, da ich ein Dach überm Kopf und genug zu essen hatte, fing ich an nach dem Verbleib meiner Familie zu forschen.
Bei meinem letzten Heimaturlaub hatte ich mit meiner Frau verabredet; falls wir uns in den Kriegswirren verlieren
sollten, unsere Kontaktadresse, die meiner Quartiersleute in Burscheid, Kreis Opladen, sein sollte. Ich habe zuerst
nach Rohmanen geschrieben, aber leider keine Antwort erhalten. Dann habe ich nach Burscheid geschrieben, und siehe, -
bei denen lag schon eine Anfrage meiner Frau vor, die nach mir gefragt, und ihre jetzige Anschrift hinterlassen hatte.
Ich habe dem Bauern erzählt dass meine Frau sich zurzeit, auf einem Gut, in Alt Steinhorst, im Kreis Rostock, befindet.
Er war sofort bereit uns ein Zimmer zur Verfügung zu stellen, wenn ich meine Frau nach Krottorf rüberholen wollte. Das
habe ich Ihr mitgeteilt und sie war sofort bereit ihren Wohnsitz nach Krottorf zu verlegen, denn sie wohnte dort in
einem kleinen Stübchen unterm Dach.
Im Herbst, als die Feldarbeit so ziemlich erledigt war, bin ich nach Alt Steinhorst gefahren, um meine Frau und meinen
Sohn Kurt, sowie meinen Sohn Manfred, den ich noch nicht kannte, weil er erst nach der Flucht, am 31. Januar, in Groß
Lüssewitz, geboren wurde, nach Krottorf zu holen. Meine Frau hatte schon Holz für den Winter besorgt und vom Gut, auf
dem sie im Sommer gearbeitet hatte, Mehl und Kartoffeln bekommen. Wir haben das Mehl und andere Habseligkeiten in
Kisten verpackt. Das Holz haben wir einem Bauern gegeben, der uns und unser Gepäck, mit seinem Pferdewagen, zum 14
Kilometer entfernten Bahnhof, nach Ribnitz gebracht hat. Wir sind auch gut in Krottorf angekommen, aber als wir am
nächsten Tag, unsere Kisten vom Bahnhof abholen wollten, haben wir zwar die Kisten vorgefunden, doch der gesamte Inhalt
wurde während der Bahnfahrt entwendet. Die Bahnstation in Krottorf hat die Vorkommnisse zur Kenntnis genommen und
protokolliert, aber unsere Sachen haben wir nie wieder gesehen und mussten wieder bei Null anfangen.
Im Winter musste ich auf der Genossenschaft, unentgeltlich, für die Russen Weizen einsacken. Ich hatte versucht eine
Arbeit als Zimmermann zu bekommen, doch auf dem Arbeitsamt wurde mir gesagt, ich bin Ladwirt und muss auf der
Landwirtschaft arbeiten. Da in den ersten Nachkriegsjahren, auch in der sowjetisch besetzten Zone Arbeitsplätze knapp
waren, mussten auch solche, die einen anderen Beruf erlernt hatten, jede zumutbare Arbeit annehmen. Aus der Heimat
erhielt ich einen Brief, von meiner dort noch lebenden Mutter. Sie schrieb das sie mich noch einmal sehen wollte und
ich sollte doch wieder zurück kommen; Unser Hof wäre nicht von Polen besetzt und sie wäre ganz alleine, weil der Vater
nach dem Durchzug der Front von den Russen erschlagen wurde. Daraufhin habe ich dem polnischen Konsulat in Magdeburg
mitgeteilt, dass ich in Rohmanen eine Landwirtschaft besitze, und um eine Einreisegenehmigung gebeten.
Nach 2 Monaten erhielt ich eine Postkarte, mit der Mitteilung, ich sollte mich persönlich beim Konsulat vorstellen.
Nach Aufnahme meiner Personalien, wurde mir gesagt, das ich benachrichtigt werde wenn mein Antrag genehmigt wird. Ende
Juli 1947 erhielten wir die Einreisegenehmigung nach Ostpreußen, das jetzt unter polnischer Verwaltung stand. Wir
mussten zuerst zum polnischen Konsulat in Berlin-Lichterfelde, wo wir umgeben von einer Trümmerlandschaft, gewartet
haben, bis alle Untersuchungen und Formalitäten erledigt waren.
“ Wieder zurück in Ostpreußen.”
Der schwere Wiederaufbau nach dem Kriege
Dann fuhren wir über Frankfurt/Oder, Posen, Thorn, Allenstein, nach Ortelsburg, wo wir am 2. August 1947 ankamen. Mit
einem zweirädrigen Karren, den ich mir von einem noch in Ortelsburg lebenden Bekanten ausgeliehen hatte und meinem
Sohn Manfred im Kinderwagen fuhren wir nach Rohmanen. Meine Mutter war inzwischen verstorben und auf dem Hof war nur
meine, inzwischen aus Russischer Gefangenschaft wiedergekehrte Schwester, Frieda Pelkowski.

Es war alles ausgeplündert; kein Vieh, keine Maschinen und der ganze Hof mit kniehohem Graß überwachsen. Nur schmale
Trampelpfade, vom Haus zum Holzschuppen und zum Klo, durchkreuzten das satte Grün. Ich habe das Gras auf dem Hof mit
einer Sense, die ich noch gefunden habe, abgemäht, damit der Hof nicht so verwahrlost aussah. Am nächsten Tag habe ich
mich bei der Polizei in Ortelsburg angemeldet, wo ich auch ein Startgeld von 100 Zloty erhielt und Gepäckstücke, die
ich in Krottorf aufgegeben, am Bahnhof abgeholt. Es hat mich sehr gewundert das, das Gepäck überhaupt angekommen ist.
Da man von der Landwirtschaft nicht Leben konnte, habe ich mich in den nächsten Tagen, bei der jetzt polnischen Bahn,
um Arbeit beworben und wurde auch angenommen. Wenn wir unseren Monatslohn bekamen, saß immer einer am Tisch, der von
uns 100 Zloty für den Wiederaufbau von Warschau verlangte. Wenn ich dran war, riefen die Anderen, ich hätte Warschau
zerstört und müsste deshalb 200 Zloty abgeben. Nach 3 Jahren kam eine Verfügung, die besagte, dass wer länger als 1
Jahr bei der Bahn beschäftigt ist, angestellt werden muss. Um diese Bestimmung zu umgehen hat man mich entlassen und
eine Woche später wieder eingestellt.
Als ich vor Ablauf des nächsten Jahres, aus dem gleichen Grunde wieder entlassen wurde, habe ich mich bei der
Stadtverwaltung in Ortelsburg(jetzt Szczytno)beworben, wo ich zuerst im Gaswerk als Heizer und später auf Baustellen
als Zimmermann gearbeitet habe. Wir haben durch den Krieg beschädigte Häuser repariert, in den ehemals touristischen
Zentren einige Ausbesserungen an den Einrichtungen durchgeführt, eine Ziegelei wieder in Betrieb gesetzt und andere
anfallende Arbeiten verrichtet. Im Dach des Rathausturmes war während der Kämpfe eine Granate eingeschlagen, die, die
Dachlatten und die Verschalung zerstört hatte. Da wir, unter schwersten Bedingungen, den Schaden repariert haben,
wurde uns eine Höhenzulage versprochen, die wir aber nicht bekommen haben.
Aus Verärgerung darüber habe ich bei der Stadtverwaltung gekündigt und bei einer Wiederaufbaufirma unter der Leitung
von Bauingenieur Laskowski wieder angefangen, wo ich bis 1954, als Zimmermann beschäftigt war. Ab da habe ich mich
nur um meinen Hof gekümmert, der wegen meiner Arbeitsstellen, gezwungenermaßen, sehr vernachlässigt wurde. Als wir
1947 zurückkamen, brachten wir unseren Sohn Manfred noch im Kinderwagen. Den hat meine Frau zum Markt gebracht,
verkauft, und dafür eine Ziege erworben, die dank guter Pflege, uns täglich mit 4 Liter Milch versorgte. Das war der
erste Baustein zum Wiederaufbau, unserer durch den Krieg zerstörten, und danach ausgeplünderten Landwirtschaft.
Während meiner Arbeit bei der Bahn haben wir uns eine Kuh gekauft, die nach einem halben Jahr, wegen nicht bezahlter
Grundsteuer, vom Gerichtsvollzieher gepfändet wurde. Man hat uns die Kuh weggenommen und bei einem Arbeiter, der in
der Ernst-Mey-Straße in Ortelsburg wohnte und sie wegen nicht vorhandener Futtermittel, nur mit Kartoffelkraut
gefüttert hat, untergestellt. Als ich bei der Bahn meinen Monatslohn bekommen habe, bin ich zur Gmina gegangen, habe
eine Rate angezahlt und durfte dann die Kuh wieder mit nach Hause nehmen. Durch die schlechte Ernährung war die Kuh
stark abgemagert und lieferte nur die Hälfte der ursprünglichen Milchleistung.
Später habe ich ein Pferd auf Abzahlung bekommen, das 140.000 alte Zloty gekostet hat. Die Stute war schwach und unser
Feld sehr hügelig, so dass man nur bergab pflügen konnte, was sehr beschwerlich war, bergauf ging es immer im Leerlauf.
Später habe ich die schweren Böden mit dem Traktor umpflügen, und in den letzten Jahren auch mit dem Binder mähen
lassen. Von der Stute habe ich 2 schöne Fohlen gezogen; ein davon habe ich bei der Ausreise in die Bundesrepublik
mitgebracht und bei der Viehverwertungs-Genossenschaft in Göttingen verkauft. In den ersten Nachkriegsjahren als noch
wenig Land bestellt wurde, breiteten sich auf den nicht beackerten Flächen, Wildkräuter aus. Disteln und andere
Schnellwachsende, erreichten manchmal eine Höhe von 2 Meter, besonders auf den schweren Böden.
Es hat viel Schweiß gekostet ehe man den Acker soweit hatte, das er auch befriedigende Erträge abwarf. Die
Währungsreform von 1950, hat unser weiniges Geld das wir schon gespart hatten, wieder vernichtet. Ich hatte 2 Pferde,
1 Fohlen, 2 Kühe und Schweine, als ich wieder aufgefordert wurde nicht bezahlte Grundsteuern nachzuzahlen. Als ich
nicht bezahlen konnte, hat der Vollziehungsbeamte, ein Fohlen, eine Kuh und ein Schwein gepfändet. Es gelang mir jedoch
nach längeren Verhandlungen, ohne größere Verluste, alles zu regeln. Später kam eine Verfügung, die besagte; wenn
jemand auf seinem Hof nur eine Kuh und ein Pferd hatte, durften sie nicht gepfändet werden. Einige haben ihr Inventar
dieser Verfügung angepasst und dadurch die Zahlung von Grundsteuer umgangen.

Wer seine Steuern pünktlich bezahlt und sein Kontingent an landwirtschaftlichen Produkten fristgerecht abgeliefert hat,
der konnte seine, darüber hinaus erwirtschafteten Produkte zu marktgerechten Preisen verkaufen. Für eine hochtragende
Sterke, mindestens 400 kg schwer, die auf ein staatliches Gut verkauft wurde, konnte man bis zu 12000 Zloty bekommen.
Unsere Böden waren kalkarm, doch durch den Einsatz von Kalk und Kunstdünger konnte man den Ertrag erheblich steigern.
Kalk und Kunstdünger konnte man bei der Genossenschaft(GS) bestellen, der dann auch direkt auf den Hof geliefert wurde.
Kalk wurde geliefert und gleich auf dem Feld ausgestreut. In den 1960ger Jahren waren alle Ackerflächen der Rohmaner
Felder bestellt.
Die nach dem Krieg zurückgebliebenen deutschen Bauernfamilien, aber auch die Polen, die während des Krieges beim Bauern
in Deutschland gearbeitet haben, versuchten mit teils bescheidenen, oder auch zusammen gesuchten, landwirtschaftlichen
Geräten, die bäuerlichen Betriebe aufrecht zu erhalten. Nach den schweren Anfängen in den ersten Nachkriegsjahren
erzielten sie schließlich einen beachtlichen Erfolg, der sich in wogenden Kornfeldern, sowie in grünen Wiesen auf
denen gut genährtes Vieh weidete, widerspiegelte.
Ein schwerer Einschnitt in meinem Leben.
Am 11. Mai 1956 verstarb nach langer schwerer Krankheit, meine liebe Ehefrau Marta Rattay,
geborene Brosch. Ein Jahr zuvor war schon mein Schwiegervater Gottlib Brosch verstorben. Die schweren Bedingungen
unter denen wir nach Kriegende leben mussten, haben ihrer bereits angegriffenen Gesundheit sehr zugesetzt. Sie
verstarb mit 44 Jahren und hinterließ in unserer Familie eine große Lücke, die nicht mehr zu Überbrücken war. Wir
haben sie unter großer Anteilnahme der noch verbliebenen deutschen Bevölkerung zu Grabe getragen und auf dem Rohmaner
Friedhof beigesetzt. Die Arbeit die sie sonst verrichtet hatte fiel jetzt auf mich und meine Söhne zurück. Meine
Schwester Frieda Pelkowski half auch wo sie nur konnte. Wir waren auf die Unterstützung durch Nachbarn und Freunde
angewiesen, die uns immer wenn es nötig war, tatkräftig unterstützt haben. Im laufe der Zeit haben wir wieder zum
Alltag zurück gefunden, haben sie noch etliche Jahre auf dem Friedhof besuchen können, bis wir, bedingt durch unsere
Ausreise uns endgültig von ihr trennen mussten.
Der endgültige Abschied von Ostpreußen
Ab 1956 begannen, durch die Vermittlung des Deutschen Roten Kreuzes, die ersten Ausreisen in die
Bundesrepublik Deutschland. Zuerst waren es Kinder die zu ihren Eltern ausreisen durften, Familien deren Väter aus der
Kriegsgefangenschaft in den Westen Deutschlands entlassen wurden und andere durch den Krieg getrennte
Familienangehörige. Ab 1960 erhöhte sich die Zahl der Ausreisewilligen aus dem polnisch besetzten Ostpreußen. Es setzte
sich die Überzeugung durch, dass unsere Angestammte Heimat, uns für die Zukunft keine Perspektive mehr bieten konnte.
Meistens wurden die Anträge, die wir an die Passabteilung in Allenstein stellen mussten, um einen Ausreisepass zu
bekommen, negativ beschieden. Nach mehrmaligen Versuchen gelang es dann doch, diese begehrte Ausreiseberechtigung in
Empfang zu nehmen. Die Enttäuschung der Zurückgebliebenen war groß, wenn wieder mal Verwandte oder Nachbarn, den Weg
in Richtung Bahnhof einschlugen.
Um einen Reisepass zu beantragen, musste man zuerst eine Einladung von Verwandten aus der Bundesrepublik vorlegen, in
der, diese sich verpflichten mussten, für Unterkunft und Verpflegung der Eingeladenen zu sorgen. Diese Einladung
musste durch ein Amt in der Bundesrepublik beglaubigt werden. Außerdem mussten die Kosten für die Bahnfahrt, ab
polnischer Grenze, bis zum Zielort, beim polnischen Reisebüro ORBIS, in Warschau, in DM eingezahlt werden.
Unseren ersten Ausreiseantrag haben wir 1964, bei der Kommandantur der polnischen Miliz in Allenstein eingereicht, der
nach einer gewissen Zeitspanne, ohne eine uns verständliche Begründung zu nennen, abgelehnt wurde. Gegen diese
Ablehnung wurde ein Widerspruch zugelassen, den wir sofort einreichten. Nach einer weiteren Zeitspanne erhielten wir
wieder eine Ablehnung, gegen die kein Widerspruch mehr zulässig war. Wer seine Ausreiseabsicht nicht aufgeben wollte,
musste einen neuen Antrag stellen. Es gab Familien die schon 10 Mal einen Ausreiseantrag gestellt hatten und immer
wieder abgewiesen wurden. Da meine Söhne, nicht die Absicht hatten in Rohmanen zu bleiben und ich nach 2 Weltkriegen,
an denen ich teilgenommen, die schwere Arbeit auf der Landwirtschaft, nicht aus eigener Kraft schaffen würde, haben wir
1966 wieder einen Antrag gestellt, der prompt abgelehnt wurde. Der Widerspruch auf diese Ablehnung wurde auch negativ
beantwortet, so dass wir 1968 wieder einen Antrag eingereicht haben.
Weil das Passamt in Allenstein lange nichts von sich hören ließ, hegten wir schon die Hoffnung das es jetzt klappen
würde und waren sehr enttäuscht als wieder eine Absage kam. In der Zwischenzeit sind viele Nachbarn und Bekannte aus
Rohmanen, sowie aus der näheren Umgebung, ausgereist und das Häuflein der noch verbliebenen Deutschen, wurde immer
kleiner. Die Motivation, die uns in früheren Jahren, über so manche schwierige Lage hinweg geholfen hat, ist einer
hoffnungslosen Resignation gewichen. Man war davon überzeugt, dass unser Leben, in unser Angestammten Heimat, keine
Zukunftsperspektive mehr haben konnte und wenn wir keine Ausreisegenehmigung bekommen, wir eines Tages die letzten
Deutschen in der ganzen Umgebung sein werden.
Die Ausreise-Heimat ade
Wir hatten die Hoffnung schon aufgegeben, als am 30. April 1969, der Briefträger unseren Hof
betrat und mir einen Brief überreichte, in dem uns das Passamt in Allenstein mitteilte, dass unsere Ausreise in die
Bundesrepublik Deutschland, genehmigt worden ist. Wir müssten, nach Aushändigung der Reisepapiere, den Geltungsbereich
der Volksrepublik Polen, innerhalb von 3 Monaten verlassen. Wir waren zuerst geschockt, über den Hinweis, das wir
unsere Heimat in 3 Monaten verlassen müssen, aber dann stellte sich die Zukunftsperspektive wieder ein und wir gingen,
wie von einem schweren Ballast befreit und gut gelaunt unser weiteren Tätigkeit nach.
Als der Briefträger unseren Hof betrat, waren ich und mein Sohn Kurt gerade dabei eine Fuhre Mist zu laden. Wir hatten
den Wagen gerade halb geladen und haben nach der frohen Kunde nicht mehr weiter gemacht, sondern die Pferde vorgespannt
und den Mist aufs Feld gefahren, damit wir den Wagen für alle Fälle frei hatten. Das war die letzte Tätigkeit für
unsere Landwirtschaft in Ostpreußen.
Die Nachricht von unserer Ausreise verbreitete sich, ohne dass wir darüber gesprochen haben, wie ein Lauffeuer.
Alsbald kamen Leute aus dem Dorf, die sich für das Vieh und für diverse Landwirtschaftliche Geräte interessierten.
Etliche wollten bestimmte Sachen sofort kaufen, andere haben nur zurücklegen lassen und wollten später kommen und
bezahlen, haben es aber dann doch nicht genommen.

Wenn man eine Landwirtschaft hatte, konnte man 2 Pferde, 2 Rinder, 3 Schweine, 5 Schafe und 10 Hühner, in einem
geschlossenen Viehwaggon, in die Bundesrepublik mitnehmen. Jeden Tag war man unterwegs, von einer Behörde zur Andern.
Die Aushändigung der Reisepapiere erfolgte nur nach Vorlage bestimmter Bescheinigungen: Es mussten alle Steuern bezahlt
sein, das Kontingent landwirtschaftlicher Erzeugnisse musste abgeliefert sein, je eine Bescheinigung vom Katasteramt
und vom Notar musste vorgelegt werden, das man dem polnischen Staat das Grundstück abgetreten hat. Die Gebühren für
die notarielle Beglaubigung mussten wir selbst bezahlen. Wenn man alle Bescheinigungen beisammen hatte, bekam man bei
der Kreisverwaltung eine Gesamtbescheinigung. Mit dieser Bescheinigung konnte man nach Allenstein, zur
Polizeikommandantur fahren, wo man nach dem schriftlichen Verzicht auf die polnische Staatsangehörigkeit, einen
Reisepass ausgehändigt bekam, der den Inhaber zum Grenzübertritt berechtigte, aber nicht zur Wiedereinreise.
Wir haben 2 Pferde, eine Sterke, einen Ochsen, 5 Schafe, 2 Schweine und 10 Hühner mitgenommen. Über die Schutzimpfung
der Rinder musste man eine, vom Kreistierarzt beglaubigte Bescheinigung vorweisen. Ich habe 5 Schafsböcke gekauft, die
ich in der Zwischenzeit, hinter der Scheune, zum Weiden angekettet hatte. Einer von denen hat sich losgerissen und
seinen Nachbarn getötet. Das Fleisch konnten wir noch verkaufen, mussten aber dafür einen anderen Schafsbock kaufen.
Innerhalb von 3 Monaten mussten wir alles regeln und zwei Tage vor der Abfahrt einen Eisenbahnwagen, bei der
Eisenbahndirektion in Allenstein bestellen. Reservierungen bei den polnischen Behörden waren meist immer mit
Schmiergeld verbunden, weil man sonst nie sicher sein konnte dass diese Vereinbarungen auch eingehalten werden. Schon
2 Wochen vor unserer Abfahrt, gab es in Ortelsburg keine alkoholischen Getränke zu kaufen. Meine Söhne mussten mit dem
Motorrad die umliegenden Dörfer abfahren, damit wir für die Reise einen Vorrat anlegen konnten; denn Wodka war zu der
Zeit, in Polen, wie eine zweite Währung.
Am 25. Juli haben wir zusammen, mit meinem Neffen Siegfried Brosch, unseren sonstigen Hausrat, der in Kisten verpackt
war, in einen Eisenbahnwagen, auf dem Allensteiner Bahnhof verladen. Alles musste zuerst durch den Zoll, wo die
Federbetten gewogen wurden und über das erlaubte hinausgehende Kissen, verzollt werden mussten. Dasselbe galt auch für
Fleisch und Räucherwaren.
Am 26. Juli, unserem Verladetag, kam der Eisenbahnwagen aus Allenstein, erst um 11 Uhr auf dem Ortelsburger Bahnhof an.
Die Rinder hatten wir zu Fuß, zum Bahnhof gebracht; Schweine, Schafe und Hühner auf dem Pferdewagen. Im Eisenbahnwagen
mussten, mit Hilfe von Brettern und Bohlen, Boxen für die verschiedenen Tiere erstellt werden. Jedes Pferd und jedes
Rind in eine Bucht. Die Schafe zwischen die Pferde, die Schweine zwischen die Rinder und die Hühner in einem Käfig,
unter der Decke über den Rindern. Die Hühner hatten unterwegs Eier gelegt, somit hatten wir jeden Tag frische
Verpflegung. Bei der Fahrt im Viehwagen, begleitete mich mein Sohn Manfred. Als die Lokomotive nahte, um den Wagen
abzuholen, wurden noch schnell die restlichen Sachen hinein geworfen und so mache Abschiedsträne rollte dann die Wange
hinab.
Unsere Nachbarn, Deutsche und Polen, halfen uns beim Verladen des lebendigen Inventars. Jetzt erinnerte ich mich
plötzlich, an die oft auch schönen, Ereignisse der letzten 22 Jahre. Einer Zeit, in der das Zusammenleben von
Deutschen und Polen, von Jahr zu Jahr, besser wurde. Man half sich beim einbringen der Getreideernte, beim Dreschen
des Getreides, bei der Kartoffelernte und bei anderen Arbeiten, wo viele Menschen zupacken mussten. Es war eine
Dorfgemeinschaft, in schweren Zeiten geboren; jeder half jedem wenn Hilfe nötig war. Es wurde mir plötzlich bewusst,
das jetzt ein Lebensabschnitt zu Ende ging, zu dem ich nicht mehr zurückkehren konnte. Unsere Existenzgrundlage war
jetzt ein Eisenbahnwagen auf einem Schienenstrang, dessen Ende irgendwo in weiter Ferne lag. Obwohl, von langer Hand
vorbereitet, war dieser Moment voller Wehmut.
Doch als der Zug sich plötzlich, in Bewegung setzte, war ich sofort wieder in der Gegenwart. Menschen, mit denen man
Jahrzehnte lang, in gutem Einvernehmen zusammen gelebt hat, blieben plötzlich am Bahnsteig zurück und die Entfernung
zwischen ihnen und mir vergrößerte sich mit jeder Sekunde, bis sie letztendlich aus meinem Blickfeld verschwanden.
Es war ein heißer Julitag, als wir unsere Reise gen Westen antraten. Für die Schweine, die besonders unter der Hitze
zu leiden hatten, haben wir 10 Flaschen Essig mitgenommen und sie von Zeit zu Zeit besprenkelt, damit sie besser atmen
konnten. Für die anderen Tiere war reichlich Heu und Hafer vorhanden. Eine großes Fas und zwei Milchkannen waren mit
Wasser gefüllt, die wir auf den an der Strecke liegenden Bahnstationen, bei Bedarf wieder nachgefüllt haben.
Da der Kreistierarzt nicht in seinem Büro war, konnten wir die Impfbescheinigung für das Vieh, nicht rechtzeitig
herbeischaffen. Der Zug setzte sich in Bewegung und die Bescheinigung war immer noch nicht da. Als die Bescheinigung
dann eingetroffen, wir aber schon unterwegs waren, ist mein Sohn Kurt mit dem Motorrad hinterher gefahren und hat uns
in Passenheim, wo der Zug noch andere Wagen angehängt bekam, die Impfbescheinigung übergeben. Wir waren sehr froh das
er es noch geschafft hat, denn in solch einer Situation fühlt man sich sicherer wenn man alle Bescheinigungen bei sich
hat. Auf der Rückfahrt, mit dem Motorrad hatte er noch eine Panne, musste das Motorrad stehen lassen und per Anhalter
nach Hause fahren. Am nächsten Tag kam er mit Siegfried Deptolla, der das Motorrad wieder flott machte und brachte es
wieder nach Rohmanen zurück.
Die Fahrt mit dem Viehwagen, gen Westen
Von Ortelsburg bis Allenstein(45 km) hat unser Zug 4 Stunden gebraucht, weil auf jedem Bahnhof
gehalten wurde, um neue Wagen anzuhängen. Nachdem wir in Allenstein angekommen waren, kam ein Rangierer und fragte
nach unserem Ziel. Als wir ihm mitteilten, das wir in die Bundesrepublik Deutschland wollen, sagte er nur: „In 10
Minuten fährt ein Zug los. Wenn ich von euch 500 Zloty und einen Liter Wodka bekomme, werde euch sofort anhängen,
andernfalls kommt ihr auf ein Nebengleis und müsst dann auf den nächsten Zug warten. Es blieb uns nichts anderes übrig
als seiner Forderung nachzukommen, denn über derartige Erpressungen hat man bereits von Anderen, die vor uns ausgereist
sind, gehört. Wir wurden auch sofort angehängt und fuhren dann die ganze Nacht, an Osterode, und Thorn vorbei bis
Gnesen. Dort wurde wieder rangiert.
Von einer Anhöhe wurden die einzelnen Wagen auf verschiedene Gleise verteilt und zu neuen Zügen zusammengestellt. Der
Aufprall der ungebremsten Wagen erzeugte eine derartige Erschütterung, dass manche Bretter an den Boxen geborsten waren.
Von Gnesen ging es dann in einem Zuge durch bis zur Grenzstation Reppen(Rzepin). Dort mussten wir zum Zollamt, wo
unsere Ausfuhrpapiere durch die Zollbeamten, und durch einen Tierarzt geprüft wurden. Bis Reppen(Rzepin) haben wir für
den Eisenbahnwagen 900 Zloty bezahlt; hier mussten wir noch einmal 650 Zloty bezahlen. Bei der Wagenkontrolle erklärte
uns ein Bahnbeamter das unser Wagen, sich nicht für den internationalen Transport eignet und wir deshalb den Inhalt in
einen Anderen umladen müssen, der irgendwann, auf dem Nebengleis bereitgestellt wird. Nach langer Verhandlung, sowie
einer Zulage von 500 Zloty und einem Liter Wodka haben wir ihn davon überzeugt, das der Wagen sich doch für die
Weiterfahrt eignet.
In der Nacht war Schichtwechsel, der unseren Wagen wieder abgehängt hat, weil er angeblich von der Reichsbahn der DDR,
wegen technischer Mängel nicht weiterbefördert würde. Wir mussten unsere Verhandlung vom Vorabend wiederholen, die mit
der Zusage endete, dass wir am frühen Morgen, über die Grenze auf DDR Gebiet, gebracht werden. Um 5 Uhr morgens kam
eine Lokomotive, die uns den letzten Abschnitt bis über die Grenze bringen sollte. Als der Zug hat noch einmal anhielt,
kamen polnische Grenzbeamte und Soldaten in den Wagen. Sie durchsuchten ihn und fragten, ob wir noch polnisches Geld
oder einen Grundbuchauszug bei uns hätten. Wir zeigten ihnen 800 Zloty, die sie uns, nach Ausstellung einer Quittung
über 500 Zloty, abnahmen. Die Grundbuchauszüge habe ich, im Stroh versteckt, dem Ochsen vor die Füße gelegt. Falls
jemand da suchen sollte, hätte ich gesagt, das das Tier bösartig veranlagt ist, und ich für seine Sicherheit nicht
garantieren könnte, deshalb sollte er vorsichtig sein.
Als die Grenzkontrolle den Zug verlassen hatte, setzte sich die Lokomotive wieder in Bewegung und überquerte nach
kurzer Zeit die Oderbrücke. Auf einer eingezäunten Fläche, jenseits der Grenze, hat man uns abgestellt hat und die
Lokomotive fuhr zurück auf polnisches Gebiet. Vor und hinter uns waren die Tore verschlossen. Auf den Wachtürmen,
links und Rechts von uns, standen Posten mit einem Gewehr im Anschlag. Vier Grenzbeamte der DDR, jeder mit einer
Leiter in der Hand, sowie ein Schäferhund, kamen zu unserem Wagen. Sie öffneten die Schiebetüre, stellten die Leiter
davor und ließen den Hund in den Wagen springen, der nur etwas herum schnupperte und wieder heraussprang. 2 Beamte
haben dann anschließend, die Papiere kontrolliert und das Inventar gezählt.
Nach einiger Zeit wurden wir an einen Güterzug der Reichsbahn angehängt und fuhren von Frankfurt an der Oder, vorbei
an Berlin, Ellingen und Nordhausen, über die Grenze zur Bundesrepublik bis Herzberg. Hier hat ein Zollbeamter der
Bundesrepublik, die Formalitäten erledigt und ein Tierarzt die Pferde, Rinder und Schweine gründlich untersucht. Ich
musste ihnen die Mäuler aufhalten und die Füße hochheben. Danach hat uns die Lokomotive zu einer Wasserzapfstelle
gebracht, wo wir die Tiere tränken und unsere Behälter mit Wasser auffüllen konnten. Anschließen fuhren wir über
Northeim nach Göttingen, zur Viehverwertungsgenossenschaft, die zuvor von unserer Ankunft in Kenntnis gesetzt wurde.
Der Ochse, die Sterke und die Schweine wurden, in Göttingen zum Schlachthof gebracht; die Pferde kamen nach Hannover
und die Schafsböcke nach Kassel. Wir waren mit dem Viehtransport 5 Tage unterwegs; hatten so manche Klippe umschifft
und Schwierigkeiten gemeistert, die im normalen Leben nicht vorkommen.
Wir wurden mit einem PKW, ins Durchgangslager Friedland bei Göttingen gefahren, wo mein Sohn Kurt, meine Schwester
Frieda Pelkowski und Siegfried Brosch mit Familie, die am 30 Juli, um 14 Uhr, von Warschau mit dem Zug abgefahren, und
hier am 31. Juli in den Morgenstunden eingetroffen sind, schon auf uns gewartet haben. In Friedland hat man uns mit
Familie Siegfried Brosch in einem Raum untergebracht, wir wurden registriert und erhielten 20 DM Überbrückungsgeld,
pro Person. Da wir erst am Freitag in Friedland eingetroffen sind, mussten wir hier über das Wochenende bleiben,
obwohl die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der Regel nur 3 bis 4 Tage beträgt.
Um einen Antrag für die Ausreise stellen zu können, brauchten wir eine Einladung von in der Bundesrepublik lebenden
Verwandten. Diese Einladung hat uns mein Bruder, Ernst Rattay, aus Ingelheim am Rhein zugeschickt. Ingelheim liegt im
Bundesland Rheinland-Pfalz. Das Geld für die Bahnfahrt, hat uns, Frieda Schellin, geb. Nickel, aus Duisburg, die
Tochter unseres Nachbarn, überwiesen. In Friedland wurden wir registriert. Im Registrierschein, war als unser
nächster Aufenthaltsort in der Bundesrepublik, das Durchgangslager Osthofen bei Worms, das alle Aussiedler für
Rheinland-Pfalz aufnehmen musste, eingetragen. Die Eintragung erfolgte deshalb, weil der Ort aus dem uns unsere
Einladung zugeschickt wurde, sich auch in Rheinland-Pfalz befand.
Da ich nach dem Polenfeldzug, als Soldat, ein Jahr im Kreis Opladen, im Rheinland gewesen bin, wäre ich sehr gerne in
diese Gegend gezogen, denn die Erinnerung an die schönen Tage die ich dort verlebt habe war in mir immer noch wach.
Ich versuchte die Eintragung in unseren Regiestierscheinen ändern zu lassen, was nach einigen, vielleicht auch
berechtigten Einwänden, am 4. August, vom Beauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen, genehmigt wurde. Anstelle von
Rheinlad-Pfalz stand da jetzt Nordrhein-Westfalen und am 7. August, fuhren wir, noch mit anderen Aussiedlern, ins
Durchgangslager Unna-Massen, am östlichen Rande des Ruhrgebietes gelegen. Hier wurden wir in einem Zimmer untergebracht
und konnten unser Essen in einer Gemeinschaftsküche zubereiten.
Am 8. August wurden wir in Unna-Massen, als Bürger der Bundesrepublik Deutschland registriert, erhielten
Einhundert DM Begrüßungsgeld, den Vertriebenen Ausweis -A -und 4 Wochen später den Bundespersonalausweis. In
Unna-Massen haben wir mehr als 4 Monate verbracht, weil mein Sohn Kurt, wegen fehlender Berufsausbildung, in Unna, an
einem Grundlehrgang für Metallarbeiter teilgenommen hat, der vom Arbeitsamt finanziert wurde. Am 11 Dezember 1969 sind
wir endlich an unserem vorläufigen Wohnsitz, im Durchgangswohnheim, an der Elisabethstraße 13, in Velbert angekommen.
Ab dem 5. Januar 1970 konnten meine Söhne, in der Zahnradfabrik Reining, in Velbert ihrer geregelten Arbeit nachgehen.
Von Bau- und Sparverein in Velbert wurde uns am 20. Juni 1970, unsere erste Wohnung zugewiesen.
Velbert im Februar 1972
gezeichnet: Gustav Rattay

In der Mitte des Dorfes befindet sich ein, 5 Morgen großer Teich, der den Bauern als Viehtränke diente und Enten sowie
Gänse zum verweilen einlud. Es wurde dort auch Löschwasser entnommen, wenn es im Dorf brannte. Im Teich waren auch
verschiedene Fische, die der Fischer Adam Glitza, in jedem Frühjahr neu eingesetzt hat. Die Fische sind wegen des
vielen Schlammes, der den Boden bedeckte, oft erstickt sind. Aus Richtung Ortelsburg kommend, liegt 50 Meter vor dem
Dorfeingang, zur rechten Hand, ein Soldatenfriedhof. Auf ihm haben die Gefallenen des 1.Weltkrieges, Deutsche und
Russen, ihre letzte Ruhe gefunden. Von der Landstraße kommend muss man einige Stufen hinaufsteigen, die von beiden
Seiten mit Birken bepflanzt sind.
Auf einer kleinen Anhöhe befindet sich die aus zwei Klassenräumen bestehende Dorfschule, mit einer Wohnung für den
Lehrer. Die Schule wurde 1906, mit tatkräftiger Unterstützung aller Dorfbewohner, aus gebrannten Lehmziegeln, gebaut.
Auf der Anhöhe, vor der Schule sind später Kastanienbäume gepflanzt worden, die den Schulkindern, an heißen Tagen
Schatten spendeten.
Die älteste Familie in Rohmanen war die Familie Friedrich Biella. Wie ich mich noch erinnern kann war sein Vater
Gemeindevorsteher. Nach seinem Tode hat das Amt sein Sohn Friedrich übernommen bis er 1914 als Unteroffizier in den
ersten Weltkrieg einrücken musste. Friedrich Biella hat aktiv bei der Garde in Berlin gedient. Bei den Wahlen und bei
der Abstimmung 1920 hat er sich sehr für den Erhalt des Deutschtums eingesetzt. Er hat auch im Jahr 1896, die
Freiwillige Feuerwehr in Rohmanen ins Leben gerufen und war zugleich ihr erster Brandmeister. Bei der Genossenschaft
und bei der Darlehenskasse war er im Vorstand. Dadurch war es ihm möglich die Rohmaner Bauern mit Krediten und
Kunstdüngern zu versorgen. Die Söhne Fritz und Wilhelm hat er aufs Gymnasium nach Ortelsburg geschickt und studieren
lassen. Bei Bauernversammlungen hat uns Fritz Biella Vorträge gehalten.
Eine weitere Familie war die des Gasthofbesitzers Friedrich Trzaska. Der Hof von Friedrich Trzaska war der älteste in
Rohmanen. Wenn die Bauern aus weiter gelegenen Dörfern, vom Wochenmarkt nach Hause fuhren, hielten sie oft an der
Gaswirtschaft an. Die Pferde, sowie die auf dem Markt eingekauften Rinder wurden dann, an einem vor dem Haus
angebrachten Querbalken festgebunden und die Besitzer machten es sich in der Gaststube gemütlich. Zwei große
Kastanienbäume standen zu beiden Seiten der Eingangstreppe und weiter rechts war ein großes Fenster, in dem, die im
Geschäft vorrätigen Artikel, ausgestellt waren; besonders zur Weihnachtszeit. Die Kinder drückten sich an der Scheibe
die Nase platt, um die vielen schönen Sachen, die sich die meisten Dorfbewohner nicht leisten konnten, wenigstens aus
der Nähe zu bestaunen.
In der Gaststube wurde Korn, sowie auch guter Bärenfang ausgeschenkt, und wenn es den Gästen gut geschmeckt hat, haben
sie es lange ausgehalten, so das für eine weitere Rast, in einem der nächsten Dörfer keine Zeit mehr übrig blieb. Die
alten Bauern erzählten auch; das es in ganz Ortelsburg, keinen so guten Schnupftabak gab, wie im Gasthof Trzaska. Zu
diesem Grundstück gehörte einst auch der Rohmaner See. Weil dafür keine Steuern gezahlt wurden hat sich der Besitzer
von Gut Frenzken den See angeeignet.
Als Königsberg zur Festung ausgebaut wurde, haben viele Männer dort Arbeit gefunden. Zu dieser Zeit war an eine
Beschäftigung im Kohlenbergbau, in Westfalen, noch nicht zu denken. Weil auch noch keine Eisenbahnlinie vorhanden war,
mussten sie den weiten Weg zu Fuß zurücklegen. Nachdem sie den ganzen Tag marschiert sind, haben sie in der Nacht ein
Feuer angezündet, eine Malzeit zubereitet und in der Nähe des Feuers, das sie vor wilden Tieren schützen sollte,
übernachtet. Die Reise nach Königsberg hat eine ganze Woche gedauert. Sie wurden dort zum Aufschütten der
Festungswälle eingesetzt.
Das Jahr 1914 wurde zum Schicksalsjahr, für Ostpreußen und seine Bevölkerung. Nach Abschluß der Volksschule im Jahr
1912, habe ich in den Wintermonaten einen Fortbildungslehrgang für die Landwirtschaft besucht, den Hauptlehrer Aaron,
der aus Olschienen nach Rohmanen versetzt wurde, für uns organisiert hatte. Da im Dorf 2 Trompeten vorhanden waren,
hatte er uns nahe gelegt eine Kapelle zu gründen, dann könnten wir ja die Soldaten, die aus dem Krieg heimkehren
würden mit Musik empfangen. Zum Abschluss konnte man sich ein Buch oder ein Obstbäumchen wünschen. Eine Woche vor dem
Einmarsch der Russen, haben wir noch mit einem Breitdrescher, der durch ein Rosswerk dass von 6 Pferden angetrieben
wurde 110 Zentner Roggen gedroschen. Der Lehrer Malayka hat sich 1914 freiwillig zum Militär gemeldet. 1915 hat er uns
als Offiziersanwärter besucht. Im Frühjahr 1916 wurde mein Jahrgang gemustert und im Herbst 1916 wurden wir eingezogen.
Ausbruch des Ersten Weltkrieges
Am 2. August 1914 wurde die Allgemeine Mobilmachung ausgerufen. Alle wehrfähigen Männer folgten
dem Ruf des Kaisers und eilten zu den zuständigen Wehrmeldeämtern um die Grenzen des Vaterlandes zu schützen. Wir als
Grenzbewohner bekamen das Meiste zu spüren. Alle Häuser, Scheunen und Ställe waren mit Soldaten und ihrem Tross belegt.
Die Einen gingen, die Anderen kamen. Die Kosaken hatten bei Muschaken und Radzinen die Grenze überschritten. Der
Flüchtlingsstrom hatte sich von der Grenze her angestaut. Die Russen haben überall geplündert. Die Trosse mussten sich
zurückziehen und haben dazu vorwiegend die Feldwege benutzt. Die Pferde waren erschöpft. In einer Nacht kam der
Gemeindevorsteher mit einem deutschen Offizier auf unseren Hof. Mein Vater und der Nachbar Wilhelm Dorka mussten mit
ihren Pferden aushelfen. Sie waren 2 Tage unterwegs, bis zu einem Gut in Kleeberg bei Allenstein. Als sie dann wieder
nach Hause kamen waren die Russen schon am Rohmaner Friedhof. In der Zwischenzeit hatten wir schon den Leiterwagen mit
Mehl, Rauchfleisch und Betten beladen.
Der überwiegende Teil der Rohmaner war schon losgefahren. Der Hauptlehrer Müller kam noch mit dem Fahrrad vorbei und
sagte es wäre höchste Zeit das wir wegkämen weil die Russen schon Ortelsburg besetzt hätten und im Anmarsch auf
Rohmanen wären. Wir sind auf eine Anhöhe gestiegen und haben die Staubwolken beobachtet, aber wir dachten es wäre
deutsches Militär.
Auf der Flucht vor den Russen
Kurz vor Sonnenuntergang haben wir die Pferde vor den fertig gepackten Wagen gespannt und sind
sofort losgefahren. Mein Bruder und ich nahmen 4 Milchkühe und die beste Sterke mit und gingen hinterher. Schweine,
Kälber und Geflügel haben wir aus den Ställen getrieben. Wir waren die ganze Nacht unterwegs und sind bis Rheinswein
gekommen. Da hatten wir einen Onkel wohnen, bei dem haben wir den ganzen Tag verbracht.
Unterwegs haben wir einen Mann getroffen, der erzählte uns dass die Russen bei Groß Jerutten einen Personenzug
überrumpelt haben. Sie hatten aus Eisenbahnschwellen eine Sperre auf den Schienen errichtet und somit den Zug zum
Anhalten gezwungen. Die Russen haben den Zug mit Artillerie beschossen. Als die Soldaten und Zivilisten den Zug
verlassen wollten kamen die Kosaken zu Pferde und haben ein Massaker angerichtet. Nur wer sich am Boden davon
schleichen konnte hat überlebt. Die Russen wurden durch einen Verräter darüber informiert das auf diesem Gleis ein
Zug unterwegs war und waren darauf vorbereitet. Unserem Informanten ist es auch gelungen dem Massaker zu entkommen.
Ein Kosake hatte ihm im beim vorbeireiten mit dem Säbel ein Ohr abgehauen und ihn dadurch zu Boden geschlagen. Es ist
ihm danach gelungen ins Gebüsch zu schleichen. Sein Kopf war schon verbunden als wir ihn trafen. Später wurde an der
Stelle des Überfalls ein Gedächtnisstein errichtet.
Im Morgengrauen sah man viele Kosaken über die Felder reiten. Wir sind dann später wieder weiter in Richtung
Jellinowen gefahren. Unser Vater ist mit dem Pferdewagen die Landstraße entlang gefahren. Wir mit dem Vieh sind
entlang einer tiefen Schlucht durch den Wald bis zum Babanter See gegangen. Wir hatten schon vorher versucht die
Schlucht zu verlassen aber wegen der steilen Hänge ist es uns leider nicht gelungen. Am See angekommen fanden wir drei
große Schober mit Getreide vor. Von einem dieser Schober haben uns zwei Kosaken mit einem Fernglas beobachtet. Sie
schwangen sich auf ihre Pferde und kamen uns entgegen geritten, dann hielten sie uns ihre Lanzen vor die Brust und
versuchten uns auszufragen. Wir haben leider nichts verstanden und fingen an zu weinen. Plötzlich pfiff der
Patrollienführer auf einer Trillerpfeife und die Kosaken kehrten zu ihrem Ausgangspunkt zurück.
Als wir dann weiter am See entlang gingen sahen wir von weitem drei Gehöfte. In der Nähe einer dieser Höfe hatte unser
Vater den Pferdewagen im Gestrüpp abgestellt. Die vorrückenden Schützenlinien der russischen Infanterie hatten ihn
jedoch entdeckt. Sie haben den Wagen durchwühlt und den Sack mit Rauchfleisch mitgenommen. Andere Flüchtlingswagen die
in diesem Gebüsch Schutz gesucht haben sind nicht besser davon gekommen. Wir haben das Vieh auf einen der Höfe
getrieben und am Zaun festgebunden. Dann haben wir mit Hilfe einer Leiter den Heuboden erklommen und uns dort versteckt.
Als die Kosaken auf dem Hof erschienen verlangten sie Brot und Milch. Die Frauen mussten zuerst essen und trinken,
danach haben es die Russen auch getan, sie fürchteten sich davor, dass man sie vergiften könnte. Später kam dann die
russische Infanterie und hat Haus, Scheune und Schuppen durchsucht. Die Falltüre zum Heuboden ließ sich nur nach oben
hin öffnen. Wir hatten die Türe von oben mit schweren Gegenständen beschwert, aber die Russen versuchten mit aller
Gewalt auf den Heuboden zukommen. Als die Frauen das sahen, sagten sie zu den Russen, da oben würden sich ihre Kinder
versteckt halten. Die Russen forderten nun, die Kinder sollten sofort den Heuboden verlassen. Die Mütter riefen nun
nach ihren Kindern die dann auch tatsächlich den Heuboden verließen. Als wir das sahen, haben wir uns am Giebel tief
im Heu vergraben. Drei Russen kamen nun rauf und stocherten mit ihren Bajonetten im Heu herum. Glücklicherweise kamen
sie nicht in unsere Nähe. Als die Russen den Heuboden verließen haben wir befürchtet sie würden ihn in Brand setzen.
Wahrscheinlich taten sie deshalb nicht weil so viele russische Soldaten auf dem Hof waren. Einige Zeit später
erschienen russische Offiziere auf dem Hof, mit einem Auto. Sie sagten, sie hätten das Land erobert und wir hätten ab
sofort dem russischen Zaren zu gehorchen. Wir wurden angewiwsen nach Hause fahren und unbesorgt unsere Ernte
einzubringen. Sie haben uns auch eine Bescheinigung ausgestellt, damit uns auf dem Heimweg niemand die Pferde und
das Vieh wegnehmen würde.
Erst am nächsten Morgen, als die Front weiter vorgerückt war, beschlossen wir die Heimreise anzutreten. Die Straßen
waren mit vorrückenden russischen Truppen blockiert. Manchmal mussten wir stundenlang am Wegesrand warten bis die
Soldaten mit ihrem Tross vorbeigezogen waren. Unterwegs wollten sie unser Vieh zum Schlachten wegnehmen, aber die
Bescheinigung hat uns davor bewahrt. Die Eisenbahnbrücke vor Neu-Keykuth wurde von Kavallerie bewacht. Die wollten uns
nicht drüber lassen und hielten uns bis zum frühen Morgen fest. Zurück in Rohmanen angekommen, konnten wir unser Haus
nicht betreten weil der Hof und alles rundherum ein großes Militärlager war.
Wir sind dann in Richtung Seelonken gefahren, bis Abbau Brosch. Auf dem Hof angekommen haben wir zuerst Grünfutter für
die Pferde vom Feld geholt und anschließend Mittag für uns selbst gekocht. Die Nacht haben wir erstmal auf dem Hof
verbracht. Am nächsten Morgen wagten wir es ins Dorf zu gehen um die Lage zu erkunden. Die Russen waren schon wieder
weiter gezogen, aber Haus und Hof waren in einem schrecklichen Zustand. Wir sind dann gegen Abend wieder nach Hause
zurückgekehrt.
Am 23. August 1914 waren die Russen bei uns eingebrochen, bis sie am 28. August von den Deutschen zurückgeschlagen
wurden. Dann fuhren sie wieder zurück, drei Wagen nebeneinander. Ortelsburg brannte lichterloh. Ein Wagen mit Mehl war
uns gegenüber in den Straßengraben gekippt, aber wir haben nichts davon genommen, weil man ja nicht wusste ob man die
Nacht überleben würde. Wir saßen die ganze Zeit im Keller. Am nächsten Morgen zog dann russische Kavallerie und
Infanterie durch unser Dorf. Die Kavallerie ritt orientierungslos hin und her. Die Infanterie hat den ganzen
Vormittag 1,5 Meter tiefe Schützengräben ausgehoben. Um 11 Uhr kamen aus Richtung Eichtal 3 deutsche Spähwagen nicht
ahnend dass die nördliche Hälfte des Dorfes noch von Russen besetzt war. Wir haben zu diesem Zeitpunkt auf dem
Dachboden Weizen eingesackt und hatten aus diesem Grunde einen weiten Rundblick.
Um 11 Uhr kamen aus Richtung Eichtal drei deutsche Spähwagen angefahren. Als wir die deutschen Soldaten erkannt hatten,
haben wir sie durch Handzeichen gewarnt weiter nach Norden vorzustoßen. Die Kosaken hatten sich auf den Häuserdächern
positioniert und in Richtung Norden nach deutschen Truppen Ausschau gehalten. Die Deutschen sprangen von den Spähwagen
und fingen an die nichts ahnenden Russen zu beschießen. Als die sich ihrer gefährlichen Lage bewusst wurden verließen
sie ihre Aussichtsposten und bestiegen ihre Pferde. Mit Peitschenhieben versuchten sie, die sich in panikartiger Flucht
befindliche Infanterie dazu zu Bewegen, die Deutschen anzugreifen. Zwei Spähwagen wendeten sofort, der Dritte konnte
nicht mehr umkehren. Es gelang allen, bis auf den Fahrer des dritten Wagens die Flucht. Die Russen nahmen ihn sofort
unter Beschuss, doch es gelang ihm über unseren Hof zu entkommen. Auf der rückwärtigen Seite schlug er sich quer durch
die Gärten bis zum Gehöft von Friedrich Sakowski durch. Der versteckte ihn im Keller und versorgte ihn anschließend
mit Zivilkleidung.
Als die Russen den Soldaten auf unseren Hof laufen sahen nahmen sie sofort die Verfolgung auf. Sie durchstöberten auch
die Nachbarhäuser und trieben die Bewohner auf der Straße zusammen. An der Spritzenwagenremise richteten sie einen
Sammelpunkt ein. Unter dem Vorwand es würde hier eine Schlacht stattfinden, versuchten die Russen die Zivilbevölkerung
aus dem Dorf zu drängen. Alle die dem Aufruf gefolgt sind und an unserer Sammelstelle vorbeikamen wurden unserem Haufen
hinzugefügt. Unter ihnen befand sich auch der deutsche Soldat in Zivilkleidung. Er hatte einen Sack über die Schulter
geschlagen in dem sich ein Brot befand, an der anderen Hand führte er eine Kuh am Strick. Als unser Haufen schon aus
etwa 50 Leuten bestand setzten uns die Russen mit Marschrichtung Seelonken in Bewegung. Wir Jungen versuchten in einem
unbeaufsichtigten Moment wegzulaufen, doch die Begleitmanschaft prügelte uns mit Gewehrkolben wieder in Reihe und Glied.
Unterwegs gelang es dem Soldaten mit der Kuh unbemerkt zu entkommen. Er kehrte unbehelligt ins Dorf zurück und lieferte
die Kuh wieder dort ab wo er sie entführt hatte.
Uns haben die Russen an Seelonken vorbei zum Sylvensee getrieben. Wenn sie von vorbeiziehenden russischen Offizieren
gefragt wurden weshalb wir unterwegs wären, sagten sie denen wir hätten deutsche Soldaten versteckt und wollten das
Versteck nicht verraten. Als wir am See vorbei waren begann die deutsche Artillerie aus Richtung Ortelsburg zu
schießen. Unweit von uns explodierten Granaten und richten ein großes Chaos unter Freund und Feind an. Es hieß dann
rette sich wer kann. Die Russen verließen uns in Richtung Waldpuschsee und wir kehrten orientierungslos nach Seelonken
zurück. Nach Rohmanen konnten wir nicht zurück weil die deutsche Artillerie aus Richtung Eichtal anfing unser Dorf zu
beschießen. Schließlich sind wir auf dem Abbau Brosch untergekommen. Ein durch Granatsplitter schwer verletzter Russe
suchte dort auch Zuflucht. er versucht sich mit einem Messer das Leben zu nehmen. es gelang den Frauen ihn davon
abzubringen, weil sonst bei einem etwaigen erscheinen von russischen Soldaten der Verdacht auf uns gefallen wäre.
Später erschienen tatsächlich Kosaken die ihn dann mitgenommen haben. Ihnen folgten in 50 Meter Entfernung Deutsche
Ulanen, die hinter den Russen in einem in der Nähe liegenden Wäldchen verschwanden.
Nachdem die Russen Rohmanen besetzt hatten, versteckten sie sich vorwiegend in mit Stroh gedeckten Gebäuden. Durch
Schießscharten, die sie im Strohdach anlegten, schossen sie auf die deutschen Kampfverbände, die sie wieder vertreiben
wollten. Um die Angreifer zu entlasten, wunde das Dorf von deutscher Seite unter Beschuss genommen. Durch die
Geschosse der deutschen Artillerie entstanden in Rohmanen viele Brände. Die mit Stroh gedeckten Gebäude fielen zuerst
in Schutt und Asche. Unser Vater hatte uns ins Dorf geschickt, damit wir das Vieh im Stall von der Kette losbinden
sollten. Am Dorfrand kamen uns schon deutsche Ulanen und Husaren entgegen. Rohmanen brannte an mehreren Stellen. Unser
Hof war noch unversehrt, nur die Zäune standen schon in Flammen. Wir haben das Vieh los gebunden und anschließend
versucht die Brandherde rund herum zu löschen. Es gelang uns die Flammen von unserem Hof fernzuhalten und auch bei
unserem Nachbarn einzugreifen. In vielen Scheunen und Ställen hatten sich noch viele versprengte Russen versteckt. Die
wurden anschließend von deutschen Soldaten eingesammelt und in Gefangenenlager abgeführt. Am nächste Tag haben wir dann
zerbrochene Gewehre und Munition in Körbe gesammelt und im Dorfteich versenkt.
Am 29. August haben die Russen Rohmanen verlassen, doch schon am 30. August sind sie wieder zurückgekehrt. Hauptlehrer
Müller wurde mit seinem Sohn und Karl Deptolla auf Fahrrädern fahrend von einer russischen Patrouille aufgegriffen.
Sie wurden von den Russen der Spionage verdächtigt weil der Lehrer Müller ein Fernglas bei sich trug. Der Sohn hatte
eine Gymnasiastenmütze und eine Landkarte bei sich. Sie wurden in Richtung Lehmanen abgeführt. Auf einer Anhöhe des
Grundstücks von Ernst Chittka befand sich eine nicht mehr betriebstaugliche Windmühle. Dort soll ein russisches
Kriegsgericht sie zum Tode verurteilt haben. Nach der Hinrichtung wurden sie in der Nähe der Windmühle verscharrt.
Später wurden sie wieder ausgegraben, in Särge gelegt und auf dem Rohmaner Friedhof beigesetzt. Die Ehefrau von Lehrer
Müller hat die Gräber nach dem 1. Weltkrieg mit einem schmiedeeisernen Zaun umrandet.
Die Kämpfe um Rohmanen haben viele Menschenopfer gekostet. Bei uns hinter der Scheune lagen 2 tote Russen und ein
Verwundeter. Die Toten haben wir in einer Kartoffelmiete vergraben. Alle anderen Gefallenen wurden auch gleich an der
Stelle an der sie zu Tode kamen verscharrt und mit einem Kreuz gekennzeichnet. Für die im Raum Rohmanen gefallenen
Russen wurde nach dem Krieg hinterm Dorf, in Richtung Ortelsburg, auf einer Anhöhe ein Heldenfriedhof angelegt. Dort
liegen 20 Soldaten und 1 Offizier. In der Mitte befindet sich ein Trauerbaum und Birken säumen den Zugang von der
Landstraße her. Der Lehrer Dorka hat nach dem Kriege, mit seinen Schülern immer die Gräber gepflegt.
Meine Einberufung zum Militär

Bis zu meinem 17. Lebensjahr habe ich meinem Vater in der Landwirtschaft geholfen. Im Frühjahr
1916 wurde unser Jahrgang gemustert. Im Herbst 1916 erhielten Gustav Spektor, Johann Resonek und ich einen
Einberufungsbescheid. Wir mussten uns in Allenstein im Kaisergarten melden. Dort wurden Rekruten aus mehreren
Landkreisen zusammen gezogen und danach verschiedenen Ausbildungszentren zugeteilt. Wir Rohmaner kamen zum 18.
Infanterie-Regiment nach Osterode. Ein Unteroffizier mit einer Gruppe Musketiere haben uns von Allenstein abgeholt.
Als wir in der Kaserne ankamen haben wir sofort Mittagessen in Blechnäpfen bekommen. Untergebracht wurden wir im
Dachgeschoß der Kaserne. Es waren keine Betten vorhanden, nur Strohsäcke lagen auf dem Boden.
Als dann einige Tage später ausgebildete Kompanien an die Front ausrückten durften wir in einen anderen Block umziehen.
Wir wurden der Größe nach aufgestellt, in Korporalschaften eingeteilt und dann von Kopf bis Fuß eingekleidet. Die
Ausgehuniformen hatten blanke Knöpfe dazu einen Schako mit blanker Spitze. Im neuen Block hatten wir 2stöckige Betten.
Unsere Zivilbekleidung mussten wir in einen Karton verpacken und nach Hause schicken. Dann erst begann das eigentliche
Kasernenleben. Die Kaserne durfte niemand ohne Erlaubnis verlassen, nur in Begleitung eines Unteroffiziers. In der
Kaserne war eine Kantine in der man alles kaufen konnte was in der Kaserne gebraucht wurde.
Am nächsten Tag kam unser Kompanieführer, im Range eines Hauptmanns, zu Pferde angeritten. Er begrüßte uns mit;
Guten Morgen Kameraden, wir antworteten ihm mit; Guten Morgen Herr Hauptmann. Er hat dann die Front abgeschritten und
jeder musste sich mit seinem Namen vorstellen. Um 5 Uhr wurde geweckt, 6 Uhr Kaffee holen, 7-8 Uhr Unterricht, 8-11
Uhr exerzieren auf dem Kasernenhof. Um 11.30 blies der Trompeter zur Mittagspause. Die erste Zeit war noch alles
ziemlich gemütlich aber dann wurde es von Tag zu Tag strenger. Um 10 Uhr abends war Zapfenstreich, dann ging der
Unteroffizier vom Dienst von Stube zu Stube, der Stubenälteste musste die Anwesenheit aller Rekruten melden; zum
Beispiel: Stube 56 belegt mit 14 Mann, alle zu Haus. Wir mussten in 2 Reihen antreten, mit Drillichanzug bekleidet
und in Pantoffeln, ein tadelloses Aussehen präsentieren. Der Diensthabende Unteroffizier prüfte ob alle
vorschriftsmäßig angezogen, gewaschen, gekämmt und ob alle Knöpfe an der Jacke geschlossen waren. Als er bei einem
Rekruten einen offenen Knopf erspähte, hat er uns gefragt, ob jemand ein Taschenmesser bei sich hat.
Wir ahnten nicht Gutes, darum haben wir uns ganz still verhalten und nichts gesagt. Da sagte der U.v.D. plötzlich:
”Wenn niemand von euch ein Messer bei sich hat, dann habe ich ein”. Er zog sein Messer aus der Tasche und fing an, bei
dem Rekruten die Knöpfe abzuschneiden. Als die Knöpfe zu Boden purzelten, brachen wir in lautes Gelächter aus. Das hat
ihn so in Rage gebracht, das unser unwürdiges Benehmen, zuerst mit einem „Donnerwetter” bestraft wurde. Dann schrie
er: ”In den Korridor marsch, marsch, die Treppen runter bis auf den Hof”. Als wir unten angekommen waren hieß es
wieder; "Zurück auf die Stube in der 3. Etage”. Jemand hat mir bei dem Durcheinander, von hinten in den Pantoffel
getreten, so das er auseinander gerissen wurde. Ich bin dann nur mit einem Pantoffel und einem Socken die Treppen rauf
und runter gelaufen. So wurden wir 3-mal hinunter und wieder hinauf gejagt.
Danach ließ er uns wieder antreten und hat mit einer Taschenlampe unter den Betten geleuchtet. Plötzlich schrie er
wieder los: "Das nennt ihr Fegen? wenn ihr mit dem Besen nicht fegen könnt, dann mühst ihr das mit eueren Bäuchen tun.
Marsch, marsch unter die Betten” . Als wir schon alle am Schlafen waren, kam der U.v.D. wieder und hat nachgesehen ob
alle Schränke abgeschlossen waren. Ein Kamerad hatte seinen Schlüssel verloren, deshalb hat er das Schoß nur so
eingehängt. Als der U.v.D. das bemerkte hat er die Türe aufgerissen, die ganzen Sachen aus dem Schrank, quer durch die
Stube verteilt und war dann endlich gegangen.
Die Anziehsachen mussten, fein sauber gefaltet, auf dem Stuhl liegen; da drauf die Socken und die Pantoffeln unter dem
Stuhl. Die Stühle mussten in einer Reihe ausgerichtet sein; die Hosenträger im Schrank einschlossen und der Brustbeutel
mit Geld auf dem Hals tragen werden. Morgens wurden wir geweckt und kamen zuerst in den Waschraum. Jeder musste seinen
entblößten Oberkörper mit kaltem Wasser abreiben. Da draußen strenger Frost herrschte war es im Waschraum auch sehr
kalt, so das manche ihr Hemd anbehielten. Der UvD hat dann bei seinem Kontrollgang alle Verweigerer aufgeschrieben
und ihnen befohlen in 30 Minuten mit einem Besen in der Hand auf der Schreibstube zu erscheinen. Einige mussten den
Kasernenhof fegen, andere die zugefrorenen Latrinen enteisen und reinigen. Während unserer Ausbildungszeit durften wir
die Kaserne nicht verlassen. Wenn man Stuben- oder Frühdienst hatte, blieb keine Zeit zum Frühstücken.
Nach 6 Wochen wurden wir in der Grollmann Kaserne vereidigt. Die Regimentskapelle spielte "Heil dir im Siegerkranz",
danach folgten 3 Strophen des Deutschlandliedes. Vor der Vereidigung wurden die Rekruten gefragt wer keine deutsche
Staatsangehörigkeit besitzt. Es sind dann Luxemburger und auch noch welche aus anderen Ländern hervorgetreten. Sie
wurden gefragt ob sie die deutsche Staatsangehörigkeit annehmen wollen. Die das abgelehnt haben wurden auf die
Schreibstube gerufen und sofort aus dem Militärdienst entlassen. Nach der Vereidigung erfolgte ein Kirchgang, danach
konnte man einen Stadturlaub beantragen. Nach dem Mittagessen mussten alle, die einen Urlaubschein beantragt hatten
vor der Kaserne antreten. Der Hauptfeldwebel prüfte dann ob an der Uniform alle Knöpfe blank geputzt waren, die Stiefel
glänzten und der Rekrut auch vorschriftsmäßig grüßen konnte. Wer diese Anforderungen nicht erfüllen konnte musste
seinen Urlaubschein wieder abgeben und zurück auf sein Zimmer gehen.
Wenn man die Kaserne für eine gewisse Zeit verlassen wollte, mussten zuerst der Korporal, dann der Hauptfeldwebel und
letzt endlich der Hauptmann, seine Zustimmung erteilen. Es wurde geprüft; ob die Ausgeh-Uniform sitzt, alle Knöpfe
blank geputzt sind und der Helm so blank ist das man sich darin spiegeln kann. Unser Hauptmann war in Zivil,
Bürgermeister von Osterode. Er war sehr stolz wenn er seine Kompanie, in Parade Uniform und mit einem fröhlichen Lied
auf den Lippen, durch seine Stadt führen durfte.
Als wir eines Tages zum etwa 6 Kilometer entfernten Schießstand marschieren sollten, war es sehr kalt und glatt. Der
Hauptmann ritt durch das große Tor, wir aber sind durch das kleine Tor gegangen und haben eine steil bergab führende
Abkürzung gewählt. Die Zug- und Gruppenführer gingen voraus und wir im Gänsemarsch hinterher. Ein Kamerad hat sich auf
den Gewehrkolben gesetzt und ist darauf den Berg hinunter gerutscht. Als die Anderen das sahen haben sie es ihm
nachgemacht und hatten einen Riesenspaß. Da kam der Hauptmann plötzlich im Galopp angeritten; ließ alles anhalten und
hat zuerst die Zugführer ausgeschimpft, dann anschließend die ganze Kompanie. Er sagte: „Wie könnt ihr es wagen, so
mit eueren Gewehren umgehen. Ein Gewehr soll man wie seine Braut behandeln und nicht wie einen Straßenbesen”. Zur
Strafe mussten wir, links und rechts der Straße, in zwei Reihen antreten und durch den verschneiten Straßengraben
robben. Die Herrn Zug- und Gruppenführer durften die Straße benutzen und erteilten uns nur Befehle, wie: hinlegen,
nach rechts schwenken, nach links schwenken, einzeln vorarbeiten und sammeln. Als wir dann abgekämpft, in Linien zu
2 Glieder angetreten waren, ging es mit Gesang zum Schießstand.
Auf dem Schießstand angekommen, erhielten wir zuerst eine praktische Unterweisung, für den Gebrauch von Schusswaffen.
Wir mussten solange mit einem nicht geladenen Gewehr üben, bis wir unserem Vorgesetzten beweisen konnten, dass wir
alles im Griff haben. Daraufhin wurden jedem 10 Patronen zugeteilt, so das er unter der Aufsicht eines Unteroffiziers
mit den Schießübungen beginnen konnte. Der Unteroffizier hat die Position der Einschüsse, auf der Scheibe, in einem
Buch eingetragen und nach Beendigung der Übung dem Hauptmann Bericht erstattet, ob der Schütze seine Aufgabe erfüllt
hat oder nicht. Nach dem Schießen wurden die Gewehre zu Pyramiden zusammengestellt. Diejenigen die ihre Aufgabe nicht
erfüllt haben, mussten rund um die Zielscheibe, die Bleikugeln aufsammeln.
Seit unserer Einberufung hatten wir noch keinen Heimaturlaub. Urlaub bekamen nur die, die ihren Heimatort zu Fuß
erreichen konnten. Wegen der vielen Truppentransporte die täglich von Ost nach West unterwegs waren durften wir die
Eisenbahn nicht benutzen. Einmal wurde uns gesagt; wenn jemand gut schießen kann der bekommt Heimaturlaub, aber auch
das war nur ein leeres Versprechen.
Kaisers Wilhelms Geburtstag
Der beste Tag war des Kaisers Geburtstag. Am 27. Januar mussten alle in der Grollmann Kaserne
antreten, der Battalions-Kommandeur beendete seine Laudatio mit den Worten: Seine Majestät, unser Kaiser und König
Wilhelm II, erlebe hoch, hoch, hoch. Dann spielte die Regimentskapelle: Heil dir im Siegerkranz, Herrscher des
Vaterlands, Heil Kaiser dir. Danach folgten 3 Strophen des Deutschlandliedes und anschließend fand ein Gottesdienst
statt. Anschließend gab es ein vorzügliches Mittagessen, Schweinebraten, ein Stück Wurst auf die Faust und Biermarken,
die man in der Kantine gegen gutes Bier einlösen konnte, danach Urlaub bis zum Wecken, ohne Urlaubschein. Mein Vater
und die Mutter eines Kameraden waren schon morgens angekommen, konnten uns aber nicht finden, wurden von einer Kaserne
in die andere geschickt. Erst als wir mit Musik, von der Kirche zurück zur Kaserne marschiert sind habe ich sie
zufällig entdeckt. Als sie mich auch erkannt haben, sind sie nachgekommen. Da war die Freude groß: Der Vater hatte
einen großen Koffer auf einem Krückstock über die Schulter getragen. Ich ging gleich zur Wache und habe sie angemeldet,
sie sind dann bis zum Abend geblieben. Es war einer der schönsten Tage in der Grollmann-Kaserne in Osterode.
Alle 10 Tage bekamen wir Sold. Vor der Auszahlung mussten wir antreten, jeder wurde gefragt ob noch Restgeld vom
letzten Sold vorhanden war. Dann bekam jeder 3,30 Mark, davon musste man noch Sidol für das Koppelschloss und
Schuhkreme für die Stiefel kaufen. Wer geraucht hat und nichts von zu Hause bekam war schlimm dran. Beim Militär bekam
man nicht nur die Ausbildung an der Waffe beigebracht, man lernte auch putzen, nähen, Strümpfe stopfen und vieles
Andere. Man bekam einen beschädigten Strumpf, der musste aufgeribbelt werden, mit der Wolle konnte man dann andere
Strümpfe stopfen oder Kleidungsstücke mit Namen kennzeichnen. wer das nicht konnte, der musste seinen Kameraden
Zigaretten oder Geld geben die das dann für ihn erledigten.
Verschiedene Kameraden gingen nach dem Dienst noch in die Stadt. Um 21:45 Uhr wurde zum Zapfenstreich geblasen, dann
musste man schnell zurück in die Kaserne, weil um 22:00 Uhr der Wachhabende von Bett zu Bett ging und prüfte ob auch
alle anwesend waren. Zwei mal pro Woche fanden Gewaltmärsche statt, mit vollem Gepäck im Tornister. Am Ende der
Marschkolonne fuhr dann ein Pferdewagen, wenn der Feldarzt bei jemandem einen Erschöpfungszustand feststellte, der
durfte dann aufsitzen. Am Sonnabend wurden auf dem großen Exerzierplatz Felddienstübungen durchgeführt, es befand sich
dort ein großer Hügel, den wir immer wieder erstürmen mussten. Am Nachmittag war Revierreinigen angesagt, wir mussten
dann die Tische schrubben, auf einen Tisch wurde Sand mit etwas Wasser gestreut, der nächste Tisch wurde mit der den
Beinen nach oben drauf gelegt und solange hin und her geschoben bis beide sauber waren. Mit den Stühlen geschah das
Gleiche. Dann wurde der Fußboden in der Stube geschrubbt, die Schränke abgewaschen, Staub geputzt, zuletzt kamen Flur
und Treppe dran.
Für die Arbeit war eine Stunde angesetzt, wenn jemand zu früh fertig war erregte er den Argwohn des Diensthabenden
Korporals, der prüfte dann alles genau, fand natürlich immer etwas das nicht seinen Erwartungen entsprach. Der
Übereifrige musste dann Nacharbeiten bis die Stunde um war. Eine Stunde war für Gewehr reinigen und Unterricht an der
Waffe vorgesehen.
Im Februar wurden wir neu eingekleidet; Schnürschuhe, Koppel, alles gelbes Leder mussten wir mit Lederschwärze
behandeln. 2 Wolldecken, Uniform und Helm in feldgrau, da brauchten wir die Knöpfe nicht mehr zu putzen. Die neuen
Gewehre mussten zuerst eingeschossen werden. Es wurden 90 scharfe Patronen und Marschverpflegung ausgegeben, danach
mussten wir mit vollem Gepäck zum Appell antreten. Man konnte kaum gerade stehen, weil der Tornister einen in die Knie
zwang. Der Major, der die Aufstellung besichtigte rief >Brust raus<, dann informierte er uns dass wir ins
Feldrekrutendepot und in Feindesland kommen. Urlaub bekam niemand. Ich habe ein Telegramm nach Hause geschickt, mit
der Nachricht dass wir bald abrücken werden. Einen Tag vor dem ausrücken hat mich meine Mutter noch besucht, sie hat
mir vieles mitgebracht. Alles konnte ich nicht mitnehmen, weil es nicht gestattet war anderes Gepäck bei sich zu haben
als dem Soldaten zustand.
Abmarsch zum Fronteinsatz
Am nächsten Tag hat uns die Regimentskapelle mit Musik zum Bahnhof gebracht. Von Osterode ging
es über Thorn, Posen,
Annaberg, Warschau, Brestlitowsk ins Pruschana-Lager. Das war eine russische Artillerie-Kaserne, in der 2 deutsche,
3 österreichische Bataillone und eine Offiziersschule untergebracht waren. Ein Bataillon das waren wir 18 und 19
jährige, die Anderen waren Männer bis 45 Jahre. Als wir in Osterode abfuhren lag Schnee, in Annaberg/Schlesien waren
die Kühe auf der Weide und im Pruschana-Lager lag der Schnee wieder einen Meter hoch. Drei Kilometer vor unserem vor
unserem Lager war die Bahnfahrt zu Ende. Mit den schweren Tornistern waren viele überfordert, wir mussten immer wieder
warten bis alle nachkamen. Unsere Unterkünfte das waren Baracken die den Russen als Pferdeställe gedient hatten. In
jeder Baracke wurde eine Kompanie mit Schreibstube untergebracht, die nur durch ein Zelt abgegrenzt war.
Wir haben aus Brettern Doppelbetten hergestellt, in jeder Baracke war ein Ziegelofen. Unsere neuen Uniformen und die
scharfe Munition mussten wir abgeben und bekamen dafür alte Bekleidung, sowie Ecksezierpatronen. Hier ging es wieder
Kasernenmäßig zu, das jüngere Bataillon bekam besseres Essen, doppelte Portionen und nach dem Essen 2 Stunden Bettruhe.
Wenn jemand die Bettruhe nicht einhielt und dabei erwischt wurde wusste zur Strafe Holz hacken oder Schnee schaufeln.
Zwei Wochen war Frost bis minus 40 Grad, da hatten wir keinen Unterricht im Freien, alle Aktivitäten fanden in der
Baracke statt, die nur mit nassem Holz beheizt wurde und dem entsprechend war auch die Temperatur im Inneren. Um
Brennmaterial für die Küche zu besorgen mussten wir ins nächste Dorf gehen und von zerfallenen Häusern Holz holen.
Als endlich das Tauwetter einsetzte verwandelte sich die Gegend um Baranowitschi in ein unüberwindbares Sumpfgelände.
Wir wurden mit anderen Einheiten die aus Frankreich zu uns verlegt wurden, zusammengelegt. Wenn jemand nachweisen
konnte dass er Landwirt ist und mehr als 100 Morgen Ackerland besitzt, konnte er einen Urlaub zur Frühjahrsbestellung
beantragen. Ein Gottlieb Piotrowski aus Plohsen hat seinen Urlaub bewilligt bekommen und durfte für 14 Tage nach Hause.
Wenn von der unweit entfernten Front Kanonendonner zuhören war und Alarm ausgerufen wurde, dachten wir es geht los.
Obwohl wir als Reserve aufgestellt waren mussten wir allzeit einsatzbereit sein. Wir haben auch Bunker und Stollen
gebaut, Schützengräben ausgeworfen und mit scharfen Handgranaten exerziert.
Als Gottlieb Piotrowski nach 2 Wochen zurückkam waren wir schon in Alarmbereitschaft und sind dann auch 2 Tage später
ausgerückt. Kamerad Piotrowski hatte mir noch ein großes Paket von zu Hause mitgebracht.
Italien hat Deutschland und Österreich den Krieg erklärt.
Zuerst sind drei Bataillone Österreicher ausgerückt, dann die Deutschen hinterher. Bis zum
Bahnhof Linowa wurden wir von einer Musikkapelle begleitet, dann ging es per Eisenbahn ab nach Baranowitsche. Dort
wurden wir der, an der Westfront aufgeriebenen, 15ten Reserve Division zugeteilt. Es wurde uns gesagt das Kameraden
aus der Heimat gleichen Gruppen zugeordnet werden können. Ich hatte einen Freund aus meinem Dorf, Gustav Spektor,
einen aus Groß Schöndamrau, Wilhelm Lukas und einen aus Ortelsburg, Karl Schlensack, wir kamen zu zusammen in eine
Kompanie. Zuerst waren wir in einem Kinosaal einquartiert, haben jeden Tag Schützengräben ausgehoben und Feldübungen
gemacht. Es war ein sumpfiges Gelände, so dass die Soldaten wegen den vielen Mücken, Netze auf den Köpfen tragen
mussten. Nach einem Gewitter wurde es plötzlich unerträglich. Die Mücken hatten meinen Freund so zerstochen dass sein
Gesicht dermaßen angeschwollen war und ich ihn gar nicht wieder erkannt habe.
Von Baranowitsche wurden wir wieder auf die Eisenbahn verladen, die uns mit unbekanntem Ziel Richtung Osten fuhr.
Nachdem wir unterwegs einmal zum Essenfassen gehalten haben, kamen wir in der Nacht in Krakau an. In der nächsten
Nacht befanden wir uns schon in den Karpaten, wo wir die Hügelketten zu Fuß überqueren mussten, die Fahrzeuge fuhren
um die Berge herum und wir mussten manchmal 2 Stunden warten bis sie uns wieder eingeholt hatten. So ging es immer
weiter bis wir auf einen Berg kamen wo wir Zelte aufgebaut und Biwak bezogen haben. Dort stießen wir auf türkische
Einheiten die auf Mauleseln Munition und Verpflegung über die Berge transportiert haben. Die Esel hatten ein Gestell
auf dem Rücken, auf jeder Seite eine Fass mit Wasser oder Kisten mit Proviant. Ihre Artillerie wurde von 6 Mauleseln
gezogen, während die Offiziere, ohne Sattel, ohne Zaumzeug, nur mit einem Hanfseil ausgerüstet, daher kamen.
Die Mannschaften marschierten wie es jeder für richtig hielt, mit aufgekrempelten Ärmeln, das Gewehr über den Tornister
gelegt, wie die Wilddiebe. Im Gegensatz dazu herrschte bei uns strenge Disziplin, wen jemand aus der Reihe ging kam
sofort der Kompanieführer angeritten, hat uns angeschrieen, uns klar gemacht dass wir keine Türken seien und nur auf
höheren Befehl etwas an der Marschordnung ändern dürften, wer dagegen verstoße, müsste mit einem 3tägigen Arrest
rechnen. Wir haben hinter der der Front Gewaltmärsche durchgeführt die dem Feind große Truppenaufmärsche vortäuschen
sollten.
Wir lagen in einem Buchenwald in Bereitschaft. Überläufer berichteten dass auf russischer Seite eine Großoffensive
vorbereitet wird. In einer Nacht wurde plötzlich Alarm geschlagen, der Russe war zu einem Angriff mit Gasgranaten
übergegangen. Wir lagen unter Zelten und hatten die Gasmasken gar nicht bei uns, sondern nur etwas abseits liegen. In
der Dunkelheit hat mach einer keine Gasmaske mehr gefunden. Es war ein fürchterliches Durcheinander. Dabei war es
unsere Pflicht die Maske immer an dem Tragriemen über dem Hals zu tragen, mit halb geöffnetem Deckel. Uns hat es zum
Glück nicht so stark betroffen weil wir auf einer Anhöhe lagen und die Gaswolken sich im Tal verteilten. Wir wurden in
höchste Alarmbereitschaft versetzt weil der Russe die österreichische Front durchbrochen hatte.
Eigentlich sollten wir noch an einer Gulaschkanone Essen fassen, aber es blieb uns dazu keine Zeit mehr. Der
Kompanieführer befahl uns die Zelte abzubrechen, auf den Tornister aufzurollen und in fünf Minuten marschbereit zu
sein. Die Kanoniere befanden sich schon in der Batteriestellung, luden die Granaten, die sofort abgefeuert wurden. Der
Battalions-Kommandeur versammelte die Kompanieführer und erteilte ihnen die Angriffsbefehle. Derweil sollten wir in
einem Eichenwal der schon mit Granattrichter übersät war, Deckung suchen. Bald hatten wir die Verbindung zu unserem
Batteriestab verloren. Wir warfen unsere Tornister auf einen Haufen, schwärmten unverzüglich, nur mit Sturmgepäck
ausgerüstet, 4 Handgranaten im Brotbeutel, zum Angriff aus. Wir robbten uns einzeln voran. Weil der Russe unsere
Stellungen schon überrannt hatte war jeder auf sich selbst angewiesen. Mann hörte kein Kommando mehr weil der Russe
inzwischen den Rückzug angetreten hatte, um sich auf einer Bergspitze zu verschanzen, von der er uns mit
Flachbahngeschützen beschoss. Irgendwann befanden wir uns in einem Schützengraben, wo ein Leutnant und 17 Mann aus
unserer Division die Stellung hielten. Unter Androhung von Gewalt befahl er uns den Graben sofort zu verlassen und am
Gegenangriff teilzunehmen. Wir sprangen über den Stacheldraht, duckten uns aber sofort im nächsten Graben damit das
mörderische Maschinengewehrfeuer uns nicht hinwegfegte.
Dort blieben wir bis zum Eintritt der Dunkelheit liegen. Wir konnten unsere Waffen nicht mehr einsetzen weil der Sand
die Gewehrschlösser blockiert hatte. Als es Nacht wurde herrschte ein gespenstische Stille. Wir krochen aus dem
Schützengraben und lauschten nach irgendeinem Lebenszeichen von anderen Kameraden. Dann hörten wir irgendwelche Laute
die wir nicht genau zuordnen konnten. Sie kamen aus einem Holzbunker ganz in der Nähe. Wir näherten uns ganz
vorsichtig, als plötzlich eine Schar österreichischer Soldaten herausstürmte. An unseren Stahlhelmen erkannten sie
dass wir Deutsche sind. Bald danach trafen wir auch auf 69 deutsche Soldaten die zu unserer Division gehörten. Dann
kam ein Hauptmann der uns mit Vorwürfen überschüttete, wir seien Feiglinge, wir hätten uns von unserer Einheit entfernt.
Wir haben ihm den Vorgang geschildert, aber ließ nicht mit sich reden und sagte nur dass wir bestraft werden und nichts
zu essen bekommen. Wir wurden einer Maschinengewehr Einheit zugeteilt welche die vorderste Stellung verteidigen
musste. Wir hatten einen Stollen mit 2 Ausgängen.
Die Russen haben bemerkt das sich etwas bewegte und haben uns unverzüglich mit Artilleriefeuer belegt. Schon die
dritte Granate war ein Volltreffer. Vier Kameraden waren sofort tot, ich bekam mit einem Stollenbrett in den Rücken
der sofort blau und grün angelaufen war. Ich schaute nach oben, alles war verschüttet. Ich wusste nicht das da noch
ein Ausgang war, doch die Kameraden die hier in Stellung waren haben mir geholfen das Freie zu erreichen. Ich habe
mich am nächsten Tag krank gemeldet, dachte 2 Tage Schonung zu bekommen, aber der Sanitäter hat mir nur den Rücken mit
Spiritus eingerieben und mich wieder, zurück zu unserer Kompanie geschickt. Sie bestand nur noch aus 3 Gruppen, die in
einem Stollen, der in einen Berg gehauen war, Stellung bezogen hatten. Wir konnten uns hier wenigstens waschen, an
einer Quelle die aus dem Felsen sprudelte. Wir waren nicht mehr einsatzfähig und mussten durch andere Truppenteile
verstärkt werden.
Beim Essen holen musste man auch das Gewehr bei sich haben, es wurde erzählt dass hier der braune Bär herumwandert.
Ich habe keinen gesehen, nur das die Toten ausgescharrt wurden und verstümmelt herumlagen. Nach einigen Wochen haben
die Deutschen eine Gegenoffensive gestartet, von den Bergen herunter, über den Fluss Zlota Lipa, bis zu einer Stadt
die Brzezany hieß. 2 Tage später wurden wir auch eingesetzt, bei großer Hitze ging es in Dauermärschen vorwärts, man
durfte aus den Flüssen kein Wasser trinken, weil es mit Petroleum verseucht war. Nur wenn es dunkel wurde machten wir
halt, dann mussten wir Gräben ausheben um vor Überraschungen sicher zu sein.
Links von uns war Tarnopol und rechts Rumänien. Wenn es nach einer Ruhepause wieder losging dann war es am schlimmsten,
man ging wie auf Nägel, weil die Füße die Strapazen nicht so ohne weiteres wegsteckten. Im Dorf wurde niemals Rast
gemacht, denn da waren immer Brunnen, zu denen alle hinstürmten. Später wurden Melder vorausgeschickt, die von den
Dorfbewohnern Wasser in Eimern am Weg raussetzen ließen, damit die Soldaten Ihren Durst löschen konnten. Ein Soldat hat
gleich den ganzen Eimer mitgenommen und ihn dann als er leer war, irgendwo am Wegrand stehen lassen. Der Kompanieführer
kam angeritten, hat ihn ausgeschimpft und gedroht, ihn mit 3 Tagen Arrest zu bestrafen. Wir gehörten zur Südarmee
welche von Graf Bothmer befehligt wurde.
Die Stellungen waren schlecht ausgebaut, abends mussten wir, von der 2 Kilometer hinter der Front liegenden Feldküche,
Essen und andren Proviant holen. Ich war der Jüngste der Gruppe, musste immer 9 Kochgeschirre tragen, Brot und Post
habe ich in 2 Sandsäcke, die ich über der Schulter hängen hatte, verstaut. Wenn wir unterwegs waren wurde der
Laufgraben immer beschossen. Einmal schlug eine Granate am Schützengrabenrand ein und hat mich halb verschütte, die
Kochgeschirre aus den Händen gerissen, so dass ich ohne Verpflegung im vorderen Graben ankam. Nach drei Wochen sollten
wir abgelöst werden Es hat jeden Tag geregnet, wir haben unsere Mäntel angezogen und uns mit Zelten bedeckt. Nach dem
wir abgelöst wurden kamen wir in ein Dorf dass von Juden bewohnt war. Die Bewohner waren froh dass wir keine Kosaken
waren, mit denen hatten sie vor ein par Tagen schon schlechte Erfahrung gemacht, die hatten ihnen beim Abzug Vieh und
Pferde weggenommen.
Der Boden war sehr fruchtbar, es wurden Hanf, Weizen, Hafer, Mais, Bohnen, Roggen und Kartoffeln angebaut. Die
Bewohner waren gerade mit der Ernte beschäftigt. Die Häuser waren nur aus Holz und Stroh erbaut. Die Leute lebten in
sehr ärmlichen Verhältnissen. Ich hatte mir in unserer Kantine für 20 Pfennig ein Taschenmesser gekauft, das hat mir
ein Bauer für 6 Eier und 2 Pfund Brot abgekauft, daraus hat er sich dann ein Rasiermesser geschliffen. Wenn unser
Versorgungstross auf denn holperigen Wegen nicht nachkam, haben im Dorf auch Verpflegung eingekauft. Die Leute hatten
Angst dass wir nicht bezahlen werden, doch wir bekamen meistens pünktlich unseren Wehrsold ausgezahlt und konnten uns
so manches genehmigen. Um unser Marschgepäck zu erleichtern haben wir so manches aus dem Tornister weg geworfen.
Unweit eines Dorfes wurde halt gemacht, wir sollten Zelte aufschlagen, doch niemand hatte mehr Zeltstöcke im Tornister,
alles war unterwegs liegen geblieben. Der Zugführer befahl uns ins Dorf zugehen und Stöcke zu besorgen. In einer
Scheune stießen wir auf eine Hühnerschar, mit den Stöcken haben wir einige Hühner erlegt, in einem Hanffeld gerupft
und dann im Eiltempo zurück zu unserer Truppe. Als wir ankamen war die Kompanie schon marschbereit, es gleich weiter,
mit dem Huhn im Tornister. Bei der nächsten Rast haben wir die Hühner ausgenommen und Holz besorgt um sie zu kochen,
doch wir mussten schnell wieder weiter marschieren und erst nach 2 Tagen konnten wir uns mit den Hühnern befassen,
leider waren die so alt das sie nicht gar wurden. Das Fleisch mussten wir wegwerfen, nur die Suppe konnten wir noch
gebrauchen.
Meine Verwundung am Pruth.
Wir befanden uns 8 km vor der russischen Grenze. Der Kompanieführer hatte uns informiert das
wir hier zum Einsatz kommen. Wir bekamen noch ein Mittagessen aus der Gulaschkanone, konnten unsere Feldflaschen mit
Tee, der mit Rum angereichert war, auffüllen, Munition und Handgranaten in Empfang nehmen und dann ging es zum Einsatz.
Um 3 Uhr begann das ganze Bataillon auszuschwärmen, sofort hat uns der Russen entdeckt und begann uns mit Artillerie
zu beschießen, je weiter wir vorrückten desto heftiger.
Bis zu einem Eisenbahndamm hatten wir gute Deckung, doch wir sollten den dahinter fließenden Fluss überqueren. Doch
plötzlich explodierte über meinem Kopf eine Schrapnellkugel, der Stahlhelm wurde mir vom Kopf gerissen, Tornister und
Koppel flogen auch weg, ich lag auf der Erde und wusste gar nicht was passiert war. Plötzlich fing Blut aus der
Kreuzbeingegend zu rieseln, aus dem rechten Oberschenkel auch. Gleich nebenan war ein Granattrichter, dort habe ich
Schutz gesucht. In der rechten Rockecke hatte man immer ein großes Verbandspäckchen, das habe ich herausgenommen und
auf die Wunde gedrückt, doch das Blut floss mir bis in den Stiefel. Links und rechts von mir schlugen Granaten ein,
dicke Erdbrocken und Schlamm fielen auf mich herab, doch in meinem Erdloch war ich vor Maschinengewehrsalven geschützt.
Der ganze Rücken war angeschwollen und ich konnte mich überhaupt nicht bewegen.
Die Deutschen mussten die Stellung den Russen überlassen, einer hatte mich entdeckt, da ich aber so blutverschmiert da
lag, hat er bestimmt gemeint ich wäre nicht mehr am leben und ist weitergegangen. Nach zwei Stunden habe ich gehört
das die Russen sich wieder zurückzogen, danach herrschte eine gespenstische Stille. Als es dunkel wurde kamen deutsche
Sanitäter mit Spürhunden und haben die Verwundeten aufgesammelt. Ich wurde auf eine Trage gelegt, lag gebeugt und
konnte mich nicht rühren weil der blutverschmierte Rücken völlig verkrustet war. Ein Pferdegespann konnte nur vier
Tragen befördern, die Fahrt über Ackerfurchen war eine Tortur, ich habe nicht geglaubt das ich es überleben werde. In
einer Dorfkirche wurden wir dann ausgeladen und zu den etwa 50 Verwundeten gelegt die da schon lagen.
Mich haben sie zu den Bauchschüssen gelegt, weil ich einen Nervenschock hatte und am ganzen Körper gezittert habe. Zu
trinken bekam ich nichts, nur einen feuchten Lappen in den Mund. Ich sollte gleich operiert werden, aber es kamen
immer mehr Verwundete, so bekam ich nur eine Tetanusspritze, wurde verbunden und für den Weitertransport ins Hinterland
vorbereitet. Im Morgengrauen wurden wir auf Lastautos verladen, die aus auf ein Landgut brachten, wo wir in einem
Pferdestall untergebracht wurden. Die Fahrer fuhren so schnell über die Granatlöcher, das wir vor Schmerzen geschrieen
haben. Wir baten sie langsamer zu fahren, aber die bekamen es in ihrem Führerhaus nicht mit, erst alt ein Verwundeter,
der einen Krückstock bei sich hatte von hinten die Scheibe einschlug wurde die Fahrt erträglich. Lastautos, die
Munition und Verpflegung an die Front transportiert hatten, brachten in den nächsten Tagen immer wieder Verwundete
ins Hinterland. Die Deutschen hatten an diesem Fronabschnitt hohe Verluste zu beklagen. Wir können von Glück reden
dass wir dem Höllenfeuer überhaupt entkommen sind.
Wir wurden mit Lastautos, die ein Feldlazarett uns geschickt hatte, bis nach Lemberg befördert. da wurden wir gewaschen,
rasiert und frisch verbunden. Auf einem Nebengleis stand ein Lazarettzug, in dem wurden wir anschließend in frisch
bezogenen Betten untergebracht. Der Zug brachte uns über Annaberg nach Freiburg in Sachsen, eine Stunde hinter Dresden.
Hier wurden wir auf Tragen gebettet und mit einem Möbelwagen in ein Reservelazarett transportiert.
Im Heimatlazarett.
Als ich am nächsten Tag aufwachte und das schöne Bett sah in dem ich lag, dachte ich dass ich
im Himmel bin. Ich dankte meinem Herrgott das er mich bis zu diesem Ort begleitet hat. Am Nachmittag kamen Schulkinder
mit Geschenken und haben uns schöne Lieder vorgesungen. Anhand von Röntgenaufnahmen wurde in den nächsten Tagen
festgestellt dass bei mir ein Schrapnellsplitter an der Wirbelsäule in die Kreuzbeingegend eingedrungen war. Ich wurde
jeden Tag in Salzwasser gebadet und bekam wieder volle Verpflegung, da mein Magen zum Glück nicht verletzt war. Auf
dem Transport bekam ich nur Suppe und bei Bedarf einen feuchten Lappen auf die Lippen. Ich bin von 62 auf 43 Kilogramm
abgemagert, gehen konnte ich wegen dem Nervenschock den ich bei der Verwundung erlitten hatte auch noch nicht. Die
Wunde am rechten Oberschenkel war nur ein Streifschuss und wurde mit einem Schutzverband versorgt.
In den nächsten Tagen habe ich einen Brief nach Hause geschrieben und mitgeteilt wo ich mich zurzeit befinde. Meine
Eltern schickten mir ein Paket mit Lebensmitteln, jetzt konnte ich essen was ich wollte. Das Essen im Lazarett war
nicht besonders, jeden Tag nur Kohlblätter. Der weg zu den Toiletten führte durch einen Gemüsegarten. Die gehfähigen
Kameraden haben den ganzen Kohlrabi aufgegessen, so dass schließlich Wachposten aufgestellt werden mussten. Sechs
Wochen lang konnte ich mich nur auf allen Vieren fortbewegen, denn sobald ich mich aufrichtete wurde es mir
schwindelig und ich musste zurück ins Bett.
Als ich wieder bei Kräften war habe ich meinen Eltern mitgeteilt das ich mich in ein Lazarett in ihrer Nähe verlegen
lassen will. Der Chefarzt hatte mir zugesichert, wenn die Möglichkeit besteht in Ortelsburg unterzukommen, wird er dem
zustimmen. Meine Mutter hat daraufhin, in Ortelsburg, beim Lazarettinspektor Zantopf nachgefragt und er hat angedeutet
das sie mich aufnehmen können. Daraufhin bekam ich die Krankenpapiere und einen Fahrschein nach Ortelsburg. Da ich als
Soldat nie Heimaturlaub hatte, beschloss ich zuerst meine Eltern zu besuchen. Ich fühlte mich noch sehr schwach, habe
nach jedem Kilometer Rast gemacht, aber letztendlich war ich wieder daheim bei meinen Eltern. Die Wiedersehensfreude
war sehr groß. Ich bin am 30 Juli verwundet worden und am gleichen Tag wurde mein ältester Bruder beerdigt. Er bekam
den Splitter einer Gasgranate ins rechte Bein und ist an einer Blutvergiftung verstorben.
Am nächsten Tag brachte mich mein Vater ins Garnisonslazarett nach Ortelsburg. Ich wurde jeden Tag gebadet und massiert,
weil die Rückenhaut am Knochen angewachsen war konnte ich mich nicht schmerzfrei bücken. In Ortelsburg verbrachte ich
noch sechs Wochen, bis Ende Oktober, da wurde es schon ziemlich kalt und in unserer Barackenunterkunft ziemlich
ungemütlich. Kohlen und anderes Brennmaterial lagen im Hof auf Halde, aber es war verboten zu heizen. Kameraden die in
der Nähe zu Hause waren konnten Sonntagsurlaub beantragen.
Einer von ihnen brachte von zuhause Brennholz mit und entzündete damit im Ofen ein wärmendes Feuer, andere holten vom
Hof Kohlen, so dass der Ofen in kurzer Zeit glühend heiß wurde und die Gefahr bestand das die Betten Feuer fangen
würden. Wir hatten die Betten schon weg gerückt, da kam der Feldwebel herein und fragte wer das Feuer im Ofen
angezündet hat, doch niemand fühlte sich angesprochen. Der Feldwebel hatte den Vorfall dem Stabsarzt gemeldet, als der
am nächsten Morgen zur Visite kam, war seine erste Frage: ”Wer hat gestern Abend das Feuer im Ofen angezündet”. Als
sich niemand meldete, schrie er uns an: ”Morgen wird alles entlassen, zum Ersatzbatallion, in Diez an der Lahn! Wer
gehen kann, sofort zur Schreibstube, Krankenpapiere und Fahrscheine abholen”. Er erinnerte uns noch daran am nächsten
Tag pünktlich am Bahnhof zu sein, weil eine Verspätung unangenehme Folgen für uns haben würde. Das war das Ende der
schönen Erholungsphase. Ich blieb noch eine Nacht zu Hause und bin dann am nächsten Tag von dort zum Bahnhof gegangen.
Wieder Kriegsverwendungsfähig.
Als wir am nächsten Tag in Diez angekommen waren, wurde ich gefragt ob ich aus dem Heimaturlaub
käme, als ich das verneinte wurden mir 2 Tage genehmigt und 14 Tage Genesungsurlaub dazu. Wieder zurück im
Ersatzbatallion bestand unsere Tätigkeit aus Wache schieben und Kartoffel schälen. Nach einem Monat wurden wir von
einem Generalarzt untersucht, er hat mich für nicht einsatzfähig befunden weil ich noch den Steckschuss im Rücken
hatte und das linke Bein 10 Zentimeter dünner war. Jetzt fing das Kasernenleben wieder von vorne an. Wachdienst,
Gewehr laden, sichern, Ehrenbezeugung, Einzelmarsch und Appell. Wer nicht weit nach Hause hatte bekam zu Weihnachten
Urlaub. Ich hatte zu Heiligabend und Silvester Torwache, denn nach Ostpreußen wurde niemand beurlaubt.
Nach Neujahr 1918 wurden wir neu eingekleidet und kamen nach Köln zur Baukompanie. Mit Musik wurden wir zum Bahnhof
gebracht. In Köln wurden wir noch mit Soldaten die von andern Truppenteilen dorthin verlegt wurden in einem großen
Kinosaal, im Stadtteil Edengarten untergebracht. Wir brauchten keinen Dienst zu machen und konnten zu Heilige Drei
Könige den Gottesdienst im Dom besuchen. Kameraden die aus irgendwelchen Gründen im Arrest saßen wurden gefragt ob sie
auch am Gottesdienst teilnehmen möchten, dann würde ihnen die Strafe erlassen. Fast alle haben dem zugestimmt. Einige
Tage später wurden wir wieder auf einen Transportzug verladen, der uns über Herbestal, Antwerpen nach Brügge in Belgien
brachte. Hier mussten wir den Zug kurzfristig verlassen und einen Luftschutzkeller aufsuchen, weil Fliegeralarm
gemeldet wurde. Danach ging es wieder weiter nach Turut, Kortemark, Hauseme, Kautremollen, Zaren, Zarenlinde. Dort
wurden wir in verschiedene Gruppen aufgeteilt und einer Pionierkompanie auf dem Pionierpark Struwendorf zugewiesen.
Wir haben hinter Klerken Bunker für schwere Maschinengewehre gebaut. Unsere Arbeit konnten wir nur bei Nebel verrichten,
denn bei Sonnenschein waren wir sofort dem Beschuss der feindlichen Artillerie ausgesetzt. eine Kleinbahn die Munition
und Stacheldraht an die Front brachte war dem Beschuss besonders ausgesetzt. Die Gleise, von schweren Geschossen
zerfetzt, mussten immer wieder hergerichtet werden, damit der Nachschub aufrechterhalten werden konnte. Später haben
wir am Kemelberg bei Armentier, eine Brücke über die Lys gebaut. Um in dem Sumpfgelände einen Untergrund dafür zu
schaffen, mussten wir 10 bis 12 Meter lange Pfähle in den Boden rammen. Ein Feldwebel gab immer den Befehl: „Hoch den
Bär, noch viel mehr, dass man sieht, wie er zieht, denn dieser Pfahl, glatt wie ein Aal, durch Fels und Stein, durch
Wasser und Sand, fürs Vaterland”. Jedes mal mussten wir den Bär an Schnüren hochziehen und dann wieder herunterlassen.
Wenn es manchmal, trotz vieler Mühe nicht mehr weiter ging wurde der Pfahl auf eine bestimmte Länge abgeschnitten.
Nach Fertigstellung der Brücke kamen wir in die Siegfriedstellung bei Kambrei, zum Bau eines Bataillons-Gefechtstandes.
Da der Boden kreidehaltig war, mussten wir die großen Stücke von Hand zu Hand reichen, den Schutt haben wir dann mit
Sandsäcken aus der Baugrube gehoben und mit Ästen getarnt, damit der Stand nicht von feindlichen Fliegern entdeckt
werden konnte. Alle acht Stunden wechselte die Arbeitsgruppe. Wir mussten von der Baustelle durch das Gelände robben,
denn aufrecht gehend war man dem Beschuss der feindlichen Scharfschützen ausgesetzt, die von einem Fesselballon aus
informiert wurden der über den feindlichen Linien stand.
Der Wechsel war mit einem großen Risiko verbunden, und wurde wenn Möglich bei Dunkelheit vollzogen. Um vor
Überraschungen sicher zu sein haben wir spanische Reiter (Stacheldrahtverhaue) gebaut und vor die ersten Gräben
gestellt, die dann oft in der Nacht von den Franzosen geklaut, und dann vor ihren eigenen Linien wieder aufbaut wurden.
Wir hatten aus Bohlen eine Brücke auf Rädern gebaut, die dann in den Graben geschoben wurde, damit die Artillerie und
andere Fahrzeuge über die Schützengräben kamen. Weil um vier Uhr morgens der Beschuss mit Gasgranaten begann, mussten
wir Gasmasken aufsetzen, danach haben feindliche Flieger unsere Munitionskolonne bombardiert und total aufgerieben.
Es wurde auch eine Marinedivision eingesetzt, die bis dahin dem Küstenschutz gedient hatte und jetzt ihren ersten
Einsatz hatte.
Wir sind zuerst ein ganzes Stück in Richtung Amiens vorangekommen, doch dann blieb unser Angriff in den zuvor von
Engländern besetzten Stellungen, stecken. Da die Engländer ihre Stellungen fluchtartig verlassen hatten, fiel ihr
ganzer Proviant in unsere Hände; Schokolade, Weißbrot, Flaschenwein. Die erste Nacht haben wir in einem runden Zelt
verbracht, weil ich mir durch den starken Wind, der da herrschte eine Angina zugezogen hatte, die mit hohem Fieber
verbunden war, konnte ich die vielen Köstlichkeiten überhaupt nicht genießen.
An eine ärztliche Versorgung war überhaupt nicht zu denken, denn es mussten zuerst die vielen Granatlöcher eingeebnet
werden damit die vielen Fahrzeuge und Geschütze wieder weiter fahren konnten. Auch eine Bahnlinie musste repariert
werden, damit die großen Geschütze in Stellung gebracht werden konnten, dabei wurden auch die vielen Kriegsgefangenen,
die bei dieser Offensive gemacht wurden, eingesetzt. Als die Offensive dann schließlich scheiterte, wurden wir an die
Somme verlegt. Da habe ich die Ortelsburger Jäger, die aus Italien an die Westfront verlegt wurden, zum ersten Mal im
Einsatz gesehen.
Unser nächster Einsatzort waren dann Stellungen hinter Laon. Hier wurden die Vorbereitungen zu einer neuen Offensive
getroffen. Feindliche Flieger versuchten uns Tag und Nacht daran zu hindern die Aufmarschwege instand zu halten. Als
die Offensive dann endlich losging, hatten wir die Order eine Brücke über die Oise mit Bohlen und Balken zu verstärken.
Gleich am Anfang der Offensive mussten wir Gasmasken anlegen, um für alle Fälle gewappnet zu sein. Nur die Artillerie
und Kraftfahrzeuge durften die Landstraße benutzen, die Infanterie ging immer im Straßengraben und wurde von einer
Seite von Kopf bis Fuß mit Dreck bespritzt. Die Franzosen und Engländer haben hier schon Panzer eingesetzt, die von
Truppen aus den Kolonien gefahren wurden. Die Australier gingen mit umgekrempelten Ärmeln hinter den Panzern her.
Die letzte Offensive des Ersten Weltkrieges.
Zum Jahresende 1917 hatten noch 153 deutsche 175 alliierten Divisionen gegenübergestanden.
Zur Vorbereitung der Offensive ließ Ludendorff 39 Divisionen aus dem Osten und aus Italien heranziehen. Er ließ
spezielle Angriffsdivisionen formieren, die durch intensive Ausbildung auf den beabsichtigten, schnellen Vormarsch
vorbereitet wurden. 6608 Geschütze, 3500 Minenwerfer und 1070 Flugzeuge wurden hinter dem vorgesehenen
Angriffsabschnitt konzentriert. Den Ausbildungsbefehlen Ludendorffs, die bis zu den Kompanieführern herab verteilt
wurden, konnte man entnehmen, dass der Versuch, den Krieg mit einem mächtigen Schlag zu entscheiden schon in der
nächsten Zeit gewagt werden sollte. Wir übten die fast vergessenen Formen des Schützengefechts und des
Bewegungskrieges, auch wurde eifrig mit Gewehr und Maschinengewehr geschossen. Wir hegten keinen Zweifel daran, dass
der große Plan gelingen würde.
Den ganzen Winter 1917/18 über plante der Generalquartiermeister Ludendorff die deutsche Offensive. Zwar hatten die
Vereinigten Staaten von Amerika dem Deutschen Reich am 6. April 1917 den Krieg erklärt, aber vor dem Sommer des
Jahres 1918 war mit dem Auftreten von US-Truppen in relevanter Größenordnung nicht zu rechnen. Der deutschen Führung
blieb nur ein schmales Zeitfenster, um die Niederlage und den zu erwartenden Diktatfrieden abzuwenden. Ypern,
Armentieres, Arras, Cambrai oder Verdun wurden ernsthaft als Schauplätze erwogen. Ludendorf entschied sich für einen
Angriff zwischen Cambrai und La Fere – genau an der Nahtstelle zwischen der Französischen Armee und dem britischen
Expeditionscorps.
Der Fluss Somme bildete die Grenze zwischen Franzosen und Briten. Die Briten – nicht die Franzosen – sollten das Ziel
des Vorstoßes werden. Ihre Stellungen waren nur 130 Kilometer von der Kanalküste entfernt. Beim erreichen der
Sommemündung wäre die gesamte britische Armee eingeschlossen gewesen, denn hinter ihnen lag die Straße von Dover.
Am 21. März 1918 begann die letzte entscheidende Offensive des deutschen Westheeres im Ersten Weltkrieg. Der
Angriffsstreifen war 75 Kilometer breit. Dort hatte Ludendorff 43 Angriffsdivisionen konzentriert, dahinter 30
weitere Reservedivisionen, ihnen standen lediglich 26 britische Divisionen gegenüber. „Michael“ – so der Deckname der
„Kaiserschlacht“ – lief dank Ludendorffs akribischer Vorbereitung gut an. Der britische Oberbefehlshaber General
Douglas Haig erkannte die Chance, welche die Deutschen in dieser Situation hatten. Wollten die Deutschen diese Chance
nutzen, mussten sie darauf verzichten die Somme zu überschreiten, wo sie auf die französischen Reserven treffen und
sich von der Küste entfernen würden. Genau diesen Fehler begingen jedoch die Deutschen.
Am dritten Tag überschritt der linke Flügel mit der 18. Armee die Somme. Ludendorf stellte die Taktik über die
Strategie, wie er das bei Tannenberg und der Schlacht an den Masurischen Seen auch schon getan hatte. Ludendorffs
Befehl an die 18. Armee vom Abend des 22. März 1918 lautete: „Jetzt gilt es den Sieg auszunutzen, den Feind nicht zum
Stehen kommen zu lassen, Somme und Crozat-Kanal zu überschreiten, bevor feindliche Verstärkungen wirksam werden“.
Was Haig befürchtet hatte, trat nicht ein. Die deutsche Offensive Lief weiter Richtung Süden und lief sich schließlich
tot. Am 31 März war Ludendorff zu der Erkenntnis gekommen, dass „Michael“ gescheitert war. Am 5. April wurde die
Einstellung der Offensive befohlen. Im Hochsommer waren die US-Truppen in Frankreich angekommen und gingen mit den
Franzosen zum Angriff vor. Nur mühsam konnten Hindenburg und Ludendorf den Zusammenhalt der Front waren. Am 24. Oktober
1918 forderte US-Präsident Woodrow Wilson die bedingungslose Kapitulation, am 11.Nuvember Wurde der Waffenstillstand
von Compiegne unterzeichnet.
Zusammenbruch der Westfront und Waffenstillstand .
Als die Offensive dann letztendlich gescheitert war, wurden wir auf Eisenbahnwaggon verladen, in
eine Stellung vor Verdun gebracht und der siebenten bayerischen Division zugeteilt. Als wir ausgeladen wurden nahm der
Franzose den Bahnhof unter Beschuss. Eine Granate traf einen Waggon der mit Seifenpulver beladen war, so dass der ganze
Bahnhof aussah als wäre gerade Neuschnee gefallen. Wir gingen auf die Suche nach Kartoffeln. Als ich mit einem Sack,
vollbeladen die Böschung runter ging um zur Feldküche zu gelangen, schlug unweit von mir eine Granate ein und riss mir
den Sack vom Rücken. Ich bin mit dem Schrecken davon gekommen, mir war nichts passiert.
Der Bahnhof war menschenleer, nur ein par Kaninchen liefen verschreckt durch die Gegend und einigen Kameraden gelang
es welche einzufangen. Am nächsten Tag gelang es uns endlich die Feldküche zu erreichen. Als wir gerade beim Essen
fassen waren, schlug unweit eine Granate ein so dass Pflastersteine das Dach durchschlugen und wir das Weite suchen
mussten. und wir wieder nichts zu Essen bekamen. Ein Friseur aus unserer Kompanie fuhr immer ins Hinterland um uns
mit Proviant zu versorgen. Als er 14 Tage vor dem Zusammenbruch wieder mal zurückkam erzählte er uns schon das der
Krieg nicht mehr lange dauern würde, weil Kaiser Wilhelm mit Frack und Zylinder bekleidet, Deutschland verlassen und
ins Ausland gehen würde. In unserer Einheit hatten wir auch einen Juden der glaubte dass er sich alles erlauben darf.
Eines Morgens ging er in die Küche, als er keinen Koch vorfand stieg er auf die Gulaschkanone und hob den Deckel vom
Kessel in dem der Kaffee kochte an. Der kochende Kaffee verbrühte seine Füße so sehr das er sofort ins Lazarett musste,
für ihn war der Krieg somit zuende. Es kam noch ein Erlass, das Kameraden die 2 Jahre aktiv gedient hatten und
Gefreiter waren sofort zum Sergeanten befördert wurden. Für den 11. November 1918 war ein Waffenstillstand vereinbart
und ab 11 Uhr sollte nicht mehr geschossen werden. Wir hatten unsere Kopfkissen aufgetrennt und eine Kissenschlacht
veranstaltet, um auf diese Art und Weise unserer Freude Ausdruck zu verleihen. Als die Federn durch die Luft flogen
brachen wir in Tränen aus.
In jeder Kompanie wurde ein Soldatenrat gewählt, der aus drei Mann bestand. Wenn der Kompanieführer jemanden bestrafen
wollte, musste er erst den Soldatenrat fragen, der die Strafe befürworten, aber auch ablehnen konnte. Die Offiziere
durften keine Achselstücke mehr tragen, was für sie einer Degradierung gleich kam. Wir waren in einem Dorf
einquartiert und morgens zum Appell angetreten, als einer vom Soldatenrat sich stockbesoffen vor den auf dem Pferd
sitzenden Kompanieführer stellte und schrie: „Alles hört auf mein Kommando”. Der Kompaniechef war wie vom Blitz
getroffen, ihm versagte die Stimme. Wir sahen ein das dies nicht so weiter gehen kann und wählten einen neuen
Soldatenrat. Unser Rückzug begann bei Konflanz, einer Vorfestung von Metz und führte uns zunächst über die
luxemburgische Grenze, wo wir in einem Ort einquartiert wurden. Als wir für die Küche Holz aus dem Wald holen gingen,
entschieden wir uns eine Eiche abzusägen, ohne uns dessen bewusst zu sein, in welchem Forst wir uns befanden. Als wir
beim fällen waren fielen plötzlich Schüsse, die wir auch sofort erwiderten, bis uns ein Elsässer der sich in unserer
Kompanie befand aufklärte: „Kameraden, wir befinden uns hier auf Luxemburgischem Hoheitsgebiet”.
Wir sind dann weiter durch das Fürstentum Birkenfeld marschiert, wo das Städtchen Merzig für uns geflaggt hatte. Das
Elsass haben wir auch noch kurz gestreift. Wo wir bei einem Bauern, der uns kein Stroh für das Nachtlager geben wollte,
einquartiert wurden. Daraufhin gingen wir in die Scheune und haben uns selbst was besorgt. Wir haben dann noch erfahren,
sie hätten ein Schwein geschlachtet und warteten auf den Einzug der Franzosen. Als wir uns 1917, an der Ostfront, in
den in Karpaten, im Einsatz befanden, waren unter uns auch viele Elsässer. Sie durften ihre Heimatpost nicht in
französischer Sprache schreiben, mussten ihre Briefe offen auf der Schreibstube abgeben, wo sie zuerst kontrolliert
und dann abgeschickt wurden. Als ich in einer Nacht, mit einem Elsässer auf einem Vorposten Wache schieben musste,
wollte er mich überreden zum Russen überzulaufen. Als ich darauf nicht eingehen wollte verschwand er plötzlich in der
Dunkelheit und ich habe ihn nie wieder gesehen.
Wir sind dann weiter Richtung Worms und Ludwighafen gezogen, dort wurden wir bei einem Mühlenbesitzer einquartiert,
ein Unteroffizier und vier Mann. Obwohl wir verlaust und verdreckt waren bestand die Müllerin darauf das wir in ihren
Betten übernachteten. „Wenn alles durch ist”, sagte sie, „werde ich alles gründlich reinigen”. Der Müller brachte uns
eine Gießkanne voll Wein und sagte wir sollen es uns Schmecken lassen. Wir haben reichlich davon Gebrauch gemacht, so
dass ich gar nicht weiß wie ich ins Bett kam. Das war meine Erinnerung an die Pfalz. Manchmal waren wir auch 2 Tage im
Quartier.
Vor dem Weitemarsch wurde uns immer gesagt welche Truppe die Vorhut und welche Truppe die Nachhut übernehmen sollte.
Die Nachhut hielt immer Verbindung zu den nachrückenden Franzosen und man muss staunen wie alles reibungslos, ohne
Zwischenfälle von statten ging, was wir in erster Linie dem General-Feldmarschall Paul von Hindenburg zu verdanken
haben, der den Rückzug an der Westfront koordiniert hat.
In Köln angekommen, erhielten wir im Volkshaus unsere Entlassungspapiere, Eisenbahnfahrscheine, Reisepässe,
unterschrieben von Oberstleutnant Mann. Wir mussten Köln umgehend verlassen, weil schon am nächsten Tag die
französischen Besatzungstruppen in einmarschieren sollten. Wir fuhren mit einem Zug der bis Allenstein fuhr, dort
wurden unsere Papiere vom Soldatenrat kontrolliert. Die jüngren Jahrgänge wurden festgehalten, zu neuen Einheiten
zusammengestellt und zur Sicherung der Ostgrenze gegen die Bolschewisten abkommandiert. Ich hatte gesagt das ich noch
einen Schrapnellsplitter in der Kreuzbeingegend habe und durfte daraufhin nach Hause fahren.
Kaum in Ortelsburg angekommen fiel ich wieder dem Soldatenrat in die Hände. Sie haben alles durchsucht, haben mir mein
Seitengewehr und eine Decke abgenommen, aber ich durfte weiter und bin dann kurz vor Weihnachten 1918 auf dem
elterlichen Hof angekommen. Schon auf dem Hof habe ich meine Kleider vom Leib gerissen, weil vor Läusen und anderem
Ungeziefer nicht mehr aushalten konnte und mich erst gründlich gewaschen bevor ich das elterliche Haus betreten habe.
Die Freude über das Wiedersehen war sehr groß.
“ Unser Leben zwischen den beiden Weltkriegen.”
Endlich wieder zurück in der Heimat
Rohmanen war durch die Kampfhandlungen 1914/15 zu einem drittel zerstört worden, aber schon
wieder im Aufbau. Die Firma Grzella aus Ortelsburg hatte die Bauarbeiten übernommen. Unter der Aufsicht von Polier
Karl Kontor wurden die Dachstühle errichtet. Ich habe mich, nach kurzer Erholungspause, auch als Zimmermanngehilfe am
Wiederaufbau beteiligt. Die Firma Grzella hat das Material geliefert und auch unsere Löhne gezahlt. Wegen meinem
Steckschuss bin ich dem VDK beigetreten und habe mit dessen Hilfe eine Rente beantragt die mir auch bewilligt wurde.
Nach vier Jahren wurde ich nach Allenstein zur Nachuntersuchung vorgeladen. Die ärztliche Untersuchung hatte ergeben,
das Geschoß sei verkapselt, und nur das linke Bein etwas in Mitleidenschaft gezogen. Daraufhin wurde die Rentenzahlung
eingestellt.
Der Stellmacher Adam Ornowski war im Krieg als Sanitäter eingesetzt und hatte auf Grund seiner Erfahrungen,
 Beziehungen zum medizinischen Dienst in Ortelsburg aufgebaut. Es wurden dort Lehrgänge in Erster Hilfe angeboten,
die von Prof. Dr. Kutz geleitet wurden. Adam Ornowski hat dafür gesorgt das einige junge Männer aus Rohmanen daran
teilnehmen konnten. Adam Ornowski, August Linka, Emil Rosowski, Johann Dembek, Emil Baschek und ich sind dann dem
Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes beigetreten und mussten jeden Sonntag am Lehrgang teilnehmen. Unser
Gruppenführer war Kreisobersekretär Albrecht, Landrat von Poser, als unser Ehrenvorsitzender, hat viel zu unserer
finanziellen Unterstützung beigetragen und hat dafür gesorgt dass die Bereitschaft eingekleidet wurde.
Beziehungen zum medizinischen Dienst in Ortelsburg aufgebaut. Es wurden dort Lehrgänge in Erster Hilfe angeboten,
die von Prof. Dr. Kutz geleitet wurden. Adam Ornowski hat dafür gesorgt das einige junge Männer aus Rohmanen daran
teilnehmen konnten. Adam Ornowski, August Linka, Emil Rosowski, Johann Dembek, Emil Baschek und ich sind dann dem
Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes beigetreten und mussten jeden Sonntag am Lehrgang teilnehmen. Unser
Gruppenführer war Kreisobersekretär Albrecht, Landrat von Poser, als unser Ehrenvorsitzender, hat viel zu unserer
finanziellen Unterstützung beigetragen und hat dafür gesorgt dass die Bereitschaft eingekleidet wurde.
In jedem Dorf wurde eine Unfallstelle eingerichtet, mit einem Verbandskasten und mit Verbandsmaterial für die erste
Hilfe ausgerüstet. Die Unfallstelle in Rohmanen, die am Haus von der Straßenseite, durch eine Tafel mit einem roten
Kreuz gekennzeichnet war, hatte ich zu verantworten. An Sonntagen wurden wir an Badestellen und bei Fußballspielen
eingesetzt, haben viele Übungen bei Waldbränden durchgeführt und auch Ausflüge nach Rudzany am Niedersee gemacht. Bei
der Einweihung des Tannenbergdenkmals in der Nähe von Hohenstein kamen wir an Straßenkreuzungen zum Einsatz.
Rohmanen hatte auch eine freiwillige Feuerwehr. Bis zum ersten Weltkrieg hat Friedrich Biella als Brandmeister das
Kommando gehabt. Er war aktiver Unteroffizier, hatte gute Führungsqualitäten und die Männer, die allesamt aus dem
aktiven Militärdienst stammten hatten zu ihm ein großes Vertrauen. Nach dem Krieg wollten diese Männer,
(Friedrich Nickel, Friedrich Willam, Julius Wittkowski, Jakob Janowski, Johann Gloddek, Gustav Bednarz), nicht mehr
weitermachen. Friedrich Biella, der inzwischen zum Gemeindevorsteher gewählt wurde, hat sich dann auf einer
Gemeinderatsitzung vorgeschlagen, für die Freiwillige Feuerwehr jüngere Kräfte anzuwerben.
Zum Brandmeister hat er Herrn Wilhelm Pilath vorgeschlagen. Der wurde dann nach Königsberg zur Fortbildung geschickt.
Der Feuerwehr gehörten nun folgende Personen an: Wilhelm Pilath(Brandmeister), August Linka(Stellvertreter), Gustav
Deptolla, Julius Matzey, Johann Dembek, Willy Willam, Gustav Rattay. Der Kreisbrandmeister war Heinrich Thalmann aus
Ortelsburg, sein Stellvertreter war Kreisobersekretär Salzmann. Der Bezirks-Kommissar bei der Ostpreußischen
Feuersozität War Herr Ernst Trzaska. Er hat dafür gesorgt das die Wehr uniformiert und mit Löschgeräten ausgerüstet
wurde. Da die alten Schläuche schon sehr marode waren, wurden sie durch moderne ersetzt, deren Kupplungen auch mit der
Motorspritze übereinstimmten.
Ernst Trzaska hat bei der Feuersozität und beim Landratsamt Finanzmittel beantragt und auch genehmigt bekommen. Der
Schneidermeister Wilhelm Baran wurde beauftragt Tuch und Drillichanzüge nach Maas zu schneidern. Er hat uns
Stoffmuster vorgelegt aus denen wir wählen sollten. Feuerwehrhelme haben wir auch bekommen. Die Gemeinde musste
Finanzmittel bereitstellen, einen Prozentsatz vom Gemeindebudget. Im Brandfall mussten für den Spritzenwagen Pferde
zur Verfügung stehen, von Willy Willam, Gustav Rattay, Julius Matzey und Gustav Dorka, weil sie in der Nähe des
Spritzenhauses wohnten. Am Spritzenhaus wurde ein großer Baum mit Querleisten aufgestellt, wo nach jedem Brand oder
einer größeren Übung die Schläuche zum trocknen aufgehängt wurden.
Der Kreisbrandmeister hat mindestens 2-3-mal im Jahr die Wehren besichtigt. Das ganze Dorf war dann auf den Beinen,
die Bauern mit Pferden, und andere Dorfbewohner mit Eimern und Spaten, wurden dann in verschiedene Gruppen eingeteilt.
Erst hat die Wehr sämtliche Aufstellungen am Gerät geübt; Grundstellung Fahrstellung und Marschstellung. Dann wurde
ein Brand angekündigt, die Feuerwehr mit der Spritze an den Brunnen, die Gruppen dort wohin sie beordert wurden, die
Bauern brachten mit den Wasserkiwen Wasser aus dem Brunnen zum Brandort. Wenn das Wasser im Brunnen alle wurde hat
man den Saugkorb in die Kiewen gelegt und dort Wasser entnommen. Die Wassergruppe ging mit Eimern zum Dorfteich, holte
Wasser und füllte damit die leeren Kiewen.
Der Löschtrupp ging mit Feuerhaken und Löschpatschen auf die umliegenden Gehöfte und versuchte das vermeintliche Feuer
von ihnen fernzuhalten. Nach dem Alarm wurde wieder am Spritzenhaus angetreten. Die Gruppenführer mussten angeben ob
ihre Gruppe auch vollständig erschienen war, denn Übungen wurden nur vor, oder nach der Feldarbeit durchgeführt, so
dass niemand eine Entschuldigung vorbringen konnte. Wer ohne begründete Entschuldigung nicht anwesend war erhielt eine
Verwarnung. Der Kreisbrandmeister erklärte dann welche Handgriffe den Vorschriften entsprachen und welche nicht. Die
Schläuche wurden noch schnell zum Trocknen aufgehängt. Anschließend gingen wir alle in den Gasthof Trzaska, haben über
vorhandene Mängel diskutiert, Verbesserungsvorschläge unterbreitet und zwischendurch den Durst gelöscht. Der
Kreisbrandmeister ist dann, nach einer kurzen Verabschiedung, ins nächste Dorf gefahren, weil er an einem Tag mehrere
Feuerwehren betreuen musste.
Der Rohmaner Dorffriedhof

Einen Kilometer vom Ende des Dorfes entfernt, auf der rechten Seite der Landstraße in Richtung
Ortelsburg, befand sich der Rohmaner Dorffriedhof. Wann dieser Friedhof angelegt wurde entzieht sich meiner Kenntnis.
Nach Aussagen älterer Dorfbewohner soll davor auch schon eine Ruhestätte vorhanden gewesen sein, und
zwar auf der linken Straßenseite gegenüber dem jetzigen Friedhof. An dieser Stelle befand sich bis in die
Nachkriegszeit ein kleiner Brunnen, aus dem die Dorfbewohner, das Wasser zum begießen der Grabbepflanzung auf den
Gräbern ihrer verstorbenen Angehörigen holten. Der Friedhof war in einer Hanglage angelegt, wahrscheinlich weil diese
Parzelle für eine landwirtschaftliche Nutzung nicht geeignet war. Um das Gräberfeld vor herumstreunenden Tieren oder
von der Weide entlaufenen Kühen zu schützen, hat man das ganze Gelände mit einem Holzzaun umgeben. Der Zugang befand
sich von der Straßenseite. Unter einem Torbogen hindurch wurden die Verstorbenen zu Grabe getragen. Die Gräber der
einzelnen Familien waren nebeneinander angelegt, mache, wie zum Beispiel die der Familie Trzaska, sogar mit einem
schmiedeeisernen Zaun eingefasst.
Nach dem 2. Weltkrieg verfiel der Friedhof immer mehr. Die nötigen Finanzmittel für die Pflege der Einfriedung konnten
von den restlichen noch verbliebenen Deutschen nicht mehr aufgebracht werden. An den gepflegten Gräbern konnte man noch
erkennen dass es Verwandte von noch in Rohmanen wohnenden Deutschen waren, oder von bereits im Westen Deutschlands
lebenden, die ihre noch in Rohmanen wohnenden Nachbarn damit beauftragt hatten. Die übrigen Gräber wurden von Jahr zu
Jahr immer mehr von Wildkräutern überwuchert und schließlich auch von Sträuchern und schnell wachsenden Bäumen.
In den späteren Jahren konnte man nicht mehr erkennen dass dort vor Jahren Tote zur letzten Ruhe gebettet wurden. Die
Natur holte sich das ganze Gelände zurück und nur unter großen Schwierigkeiten konnten Besucher aus dem Westen das
Friedhofsgelände noch betreten.
Das Gasthaus Trzaska

Nach dem ersten Weltkrieg hat der Gastwirt Friedrich Trzaska neben dem Gasthof einen großen Saal
für Festlichkeiten und Vereinsfeiern gebaut, in dem schon mal Feuerwehrfeste veranstaltet wurden. Ernst Trzaska war
Feuerkommissar bei der Ostpreußischen Feuersozität. Erich Trzaska war Vollziehungsbeamter beim Amtsgericht in
Ortelsburg. Unser Feuerkommissar war uns beim organisieren der Veranstaltungen sehr behilflich, hat uns den Saal, die
Musik und die Theaterstücke besorgt und die Feuerwehren aus den Nachbardörfern eingeladen.
Zu Manöverzeiten, vor dem 2. Weltkrieg und dann auch während des Krieges, waren im Gasthof Soldaten, meist im Range
eines Offiziers, einquartiert. Fräulein Mariechen Trzaska hat die Poststelle im Dorf betreut. Nachdem ich 1939 zum
Militär eingezogen wurde, hat sie, nach einer Schulung im Ortelsburger Krankenhaus, auch die Unfallmeldestelle
übernommen. Nach dem Krieg, pflegte sie mit vielen Bekannten, die bereits in der Bundesrepublik wohnten, einen regen
Briefwechsel. Auf dem Rohmaner Friedhof hat sie viele Gräber, im Auftrag von Angehörigen, die auf Grund ihrer
Abwesenheit, dazu nicht mehr in der Lage waren, gepflegt. Der Bauunternehmer Kurnitzki aus Ortelsburg, äußerte die
Bitte, sie möchte ihm doch ein Blatt vom Rosenstrauch, der auf dem Grab seiner Eltern steht, in den Brief legen. Als
sie uns den Brief vorgelesen hat, waren wir zu Tränen Gerührt. Sie hat als Letzte aus ihrer Familie, bis zu ihrem Tod
im Jahre 1960, in Rohmanen, im Gebäude der Gastwirtschaft gewohnt und ist auf dem Rohmaner Friedhof beerdigt worden.
Fleisch und Wurstwaren Karl Pelkowski
Im Jahr 1931 hat der Fleischermeister Karl Pelkowski, aus Grammen, direkt neben unserem Hof ein
Anwesen gekauft und dort eine Fleischerei eingerichtet. Er war mit meiner Schwester Frieda, verheiratet. Am Anfang hat
er die Schweine noch auf seinem Hof geschlachtet, später dann im Ortelsburger Schlachthof. Jede Woche fuhr er 2-mal,
mit dem Pferdewagen(Einspänner), nach Ortelsburg zum Wochenmarkt, wo er seine Fleisch und Wurstwaren zu Verkauf anbot.
Am Tag davor, wenn er die Wurst gekocht hat, kamen viele Rohmaner mit Kannen oder anderen Gefäßen, wegen der guten
Wurstsuppe, die er umsonst unter die Leute verteilte. Als Karl Pelkowski, Ende August 1939 zum Militär eingezogen
wurde, hat seine Frau das Pferd verkauft und den Beitrieb stillgelegt. Am Haus hing, immer noch die Tafel mit der
Aufschrift: Karl Pelkowski, Fleisch und Wurstwaren. Ein Witzbold hat irgendwann darunter geschrieben; „Fleisch und
Wurst waren einmal”, drauf hin hat Frau Pelkowski die Tafel entfernen lassen. Karl Pelkowski ist im Mai 1946 in
französischer Gefangenschaft verstorben. Seine Ehefrau Frieda, verstarb an ihrem 85. Geburtstag in Mettmann bei
Düsseldorf.
Die steinreichen Rohmaner Felder
Die letzte Eiszeit hat bei der Schmelze, auf der Rohmaner Feldgemarkung viele Steine und
Granitblöcke zurück gelassen. Überirdisch, aber besonders unter der Erde, gab es viele kleine, aber auch große Steine,
die, den Bauern, beim Pflügen und anderen Feldarbeiten sehr viel Schweiß, abverlangten. In einer Kiesgrube, auf dem
Feld des Bauern August Radek, lag ein Granitblock, von schätzungsweise 100 cbm. Vor etwa 80 Jahren, als man für diese
Steine noch keine Verwendung hatte, griffen die Bauern zu einer „List”. Weil er sonst nicht pflügen konnte, hat mancher
seinem Nachbarn, die Steine in der Nacht auf dessen Feld abgeladen. Als diese Tätigkeit unter Strafe gestellt wurde,
hat man die Steine in Schluchten gekippt und mit Mutterboden zugeschüttet. In späteren Jahren kam diese jedoch beim
pflügen wieder an die Oberfläche. Dann hat man aber schon Steine für den Straßenbau gebraucht und konnte sie so zu Geld
machen. Besonders im Raum südlich von Ortelsburg, bis zur polnischen Grenze, wo Steine eine Rarität waren, kamen sie
jetzt zum Einsatz. Auch beim Bau von Häusern, besonders für die Fundamente, wurden sie eingesetzt, weil auf diese
Weise viel Ziegeln eingespart wurden. Die Firma Gribienski aus Ortelsburg hat die großen Steine mit Dynamit gesprengt
und auf diese Weise die weitere Verarbeitung erleichtert.
Die Steine welche beim Pflügen aus dem Boden geholt wurden, hat man am Feldrand auf große Haufen zusammen getragen.
Wenn die Feldarbeit beendet war, sowie auch in den Wintermonaten, waren wir jeden Tag mit Steinen unterwegs. Wir sind
vorwiegend am Abend los gefahren, weil unter der schweren Last die Wagenachsen so heiß wurden und die Gefahr bestand,
das durch die Dehnung, die Räder blockiert würden. Bei einer Fahrt konnte man bis zu 24 Reichsmark verdienen, wogegen
1 Zentner Roggen für 8 bis 9 Reichsmark zu haben war. Ich bin selbst, mit dem Pferdewagen bis Fürstenwalde, Radostowen,
Luka, Altkirchen, Höhenwerder, ja sogar bis Friedrichshof gefahren.
In Rohmanen wurden auch rote Ziegeln gebrannt. Viele Häuser wurden, mit Ziegeln erbaut, die nur wenige 100 Meter von
der Baustelle entfernt hergestellt wurden. Der Lehn wurde auf den Feldern in der näheren Umgebung entnommen, dann von
Ochsen solange getreten, bis er so geschmeidig war, das er sich in Formen einstreichen ließ. Wenn die Ziegel in der
Form trocken war, wurde sie entnommen und in einem Brennofen gestapelt. Um einen Ofen richtig anzufeuern, brauchte man
12 Raummeter Holz, das im Zeitraum von ein par Tagen verheizt wurde. Der Fischer Karl Glitza hatte schon eine
Knetmaschine, die von einem Pferd angetrieben wurde, das mit verbundenen Augen, den ganzen Tag in die Runde ging.
Im Dorf waren auch vier Kalköfen, in denen so genannte Kalksteine, die sich an gewissen Stellen, im Erdboden befanden,
gebrannt wurden. Nach dem Brennen wurden die Steine mit Wasser abgelöscht und die daraus entstandne Masse diente, nach
dem Beimischen einer gewissen Menge Sand, dann als Bindemittel beim Häuserbau. Das Gerichtsgebäude und das
Lehrerseminar in Ortelsburg wurden mit Kalk, aus dem Rohmaner Brennöfen erbaut. Auch zum Bau einer Eisenbahnbrücke, auf
der, der Zug, den Sawitzfluß, von Ortelsburg nach Allenstein überquerte, hat mein Großvater, mit einem Ochsengespann,
Kalk gefahren.
Hinter der Scheune, beim Bauern Johann Dembek hat man Tonerde gefördert, aus der man mit Hilfe einer Formerscheibe,
die von einem Arbeiter mit Muskelkraft(Fußbetrieb) angetrieben wurde, schöne Krüge, Schalen und Vasen geformt hat.
Die Töpferware wurde, nachdem sie trocken genug war, auch in einem Ofen gebrannt, anschließend mit einer Lasur
überzogen und wieder gebrannt. Es wurden auch Kacheln zum Bau von Kachelöfen hergestellt, die mit verschiedenen
Ornamenten versehen, die Wohnstuben unserer Vorfahren schmückten. So haben unsere Großväter ihr Leben gemeistert und
nach und nach, unsere Dörfer aus der Rückständigkeit in die Neuzeit geführt.
Das gesellschaftliche Leben nach dem 1. Weltkrieg

Als der Lehrer Alfred Dorka, ein Frontkämpfer des Ersten Weltkrieges und ein Sportsmann, als
zweite Lehrkraft an der Rohmaner Schule angestellt wurde, hat er die Sitten und Gebräuche aus früherer Zeit wieder zum
Leben erweckt. Zuerst hat er die Jugend zusammen gerufen, einen Jugendverein und einen Fußballclub, gegründet. Zum
Vorsitzenden des Fußballclubs wurde Johann Gloddek berufen, der ihn auch geleitet hat. Bauer Wilhelm Spittka, der am
Rohmaner See wohnte, stellte Land für einen Sportplatz unentgeltlich zur Verfügung. Lehrer Alfred Dorka hat am
Rohmaner See eine Badestelle ausgesucht und ein Sprungbrett bauen lassen. An jedem Sonnabend im Sommer, bevor die
Sonne unterging, versammelte sich die gestammte Jugend des Dorfes an der Badestelle am See. Es wurde gebadet,
Heimatlieder gesungen, gespielt, im Fackelschein eines großen Biwakfeuers, bis in die späte Nacht hinein. Der Fischer
Karl Glitza hat uns Kähne zur Verfügung gestellt, mit denen wir auf den See hinausgepaddelt sind, dabei hatten wir viel
Spaß, was wiederum den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft gefördert hat. Ich habe mit meiner Mandoline den Gesang von
Volks- und Heimatliedern begleitet.
Der Rohmaner See liegt in einem Tal, dessen Hänge zu beiden Seiten mit Kiefern und Tannen bewaldet sind. Wenn man
gesungen oder Musiziert hat, hallte es von den Hängen zurück. Die Ufer waren mit Kalmus und Schilf bewachsen, was für
die Fischaufzucht von Vorteil war. Wenn man an einem sonnigen, windstillen Tag, am Seeufer spazieren ging, traf man
oft auf Flachstellen, an denen sich die Fischbrut im Sonnenlicht wärmte, wie ein Mückenschwarm. Im See befanden sich
folgende Fische: Karpfen, Hechte, Schleie, Barsche Plötze, Rotaugen, Aale und Krebse. Am Sonntagmorgen brachten viele
Rohmaner ihre Pferde zum See um sie zu baden.
Es wurden dort, unter der Aufsicht von Lehrer Dorka, auch viele Jugendfeste mit Theatervorführungen veranstaltet, zu
denen er selbst die Vorlagen organisiert hat. Der am See wohnende Bauer Johann Nadrowski, hat uns ein Scheunentor, als
Tanzboden zur Verfügung gestellt. Der Zimmermann Wilhelm Wittek hat uns eine Windmühle gebaut, die am auf dem Boden
liegenden Scheunentor aufgestellt wurde, dazu kamen Noch Tannen und Fichten, die das Ganze wie ein Bühnenbild
erscheinen ließen. Es wunden viele Bühnenstücke aufgeführt, unter anderen >Alte Weiber werden jung gemahlen<. Dazu bot
die Windmühle die entsprechende Kulisse.
Nach der Vorführung wurde der Boden aufgeräumt, um dann als Tanzdiele zur Verfügung zu stehen. Der Gastwirt Trzaska
hatte Tische und Bänke aufgestellt, Speisen und Getränke angeboten, so dass sich die die Veranstaltung bis in die
späte Nacht hinein zog. Es waren auch Leute aus Ortelsburg und anderen Nachbardörfern dabei. Im Winter hat Lehrer
Dorka eine Kreisrodelbahn eingerichtet, die von Zeit zu Zeit mit Wasser besprengt wurde, um die Gleitfähigkeit zu
verbessern. Von einer Anhöhe ging hinunter bis auf den halben See, was für alle ein großes Vergnügen war. Es kamen
Lehrer mit Schulklassen aus der näheren Umgebung um hier zu Rodeln.
Als Herr Lehrer Jobski als Hauptlehrer nach Rohmanen kam hat er mit dem Bürgermeister und der Gemeindeverwaltung
beschlossen, in der Nähe des Dorfes, auf einem zur Schule gehörenden Grundstück, einen Sportplatz anzulegen. Dafür
wurde gleich hinter den Gärten, 6 Morgen Ackerland abgetrennt, und nach Feierabend hat Lehrer Dorka mit den
Jugendlichen eingeebnet und gleich nebenan einen Graben für Schützenstand und Kugelfang ausgehoben. Am Sonntagvormittag
wurde Fußball gespielt und um 15:00 Uhr war Kleinkalieberschießen angesagt. Es musste auch ein kleiner Beitrag erhoben
werden, um Munition kaufen zu können. Eine Büchse konnten wir aus beim Kleinkalieberverein in Ortelsburg ausleihen.
Nach Hitlers Machtergreifung
Als Adolf Hitler an die Macht kam wurde die SA gegründet. Der Bürgermeister Michael Kownatzki
wurde zum Gruppenführer ernannt und folgende Männer haben sich freiwillig gemeldet: Wilhelm Matzey, Johann Gloddek,
Gustav Nadrowski, August Buttler, Karl Baran, Emil Nickel, Wilhelm Jaschinski, Emil Bork, Ernst Rattay und Gustav Bach.
Bei Versammlungen war die SA in Uniform angetreten um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Wer versucht hat Unruhe zu
stiften, egal aus welchem Grunde, wurde aufgefordert den Saal zu verlassen, andernfalls wurde er mit Gewalt entfernt.
Herr Lehrer Jobski wurde zum politischen Leiter ernannt, seine Frau hat die NS-Frauenschaft gegründet, Lehrer Dorka
die HJ, und so bekam die Dorfgemeinschaft, nach und nach ein anderes Gesicht. Der Sportplatz und der Schützenstand
wurden jetzt mehr als früher in den Mittelpunkt gestellt. Nach der Feldarbeit hat der Bürgermeister Fuhrwerke bestellt
und den Sportplatz noch besser herrichten lassen.
Der Bauer Wilhelm Both wurde zum Ortsbauernführer ernannt, mit der Aufgabe alles Land für den Anbau von Getreide und
Futtermittel bereitzustellen, oder wenn das nicht möglich war mit Wald aufzuforsten. Durch den Einsatz von Kunstdüngern
sollten größere Erträge aus dem Boden geholt werden, um den Viehbestand zu vergrößern und mehr Milch und Butter zu
produzieren. Deutschland sollte im Stande sein sich selbst zu selbst zu ernähren, ohne auf Importe angewiesen zu sein.
Frau Jobski hat, innerhalb der der NS-Frauenschaft, mit Hilfe von Fachkräften aus Ortelsburg, Lehrgänge veranstaltet,
auf denen man Backen und Nähen lernte. Auf den Bauernhöfen befand sich auch immer mehr Rassegeflügel, das eine erhöhte
Produktion von Eiern und Geflügelfleisch sicherstellen sollte.
Die Rohmaner Bauern hatten, außer in der Landwirtschaft, noch andere Verdienstmöglichkeiten in der Kreisstadt. In
Ortelsburg wurden vier Sägewerke betrieben, die mit Langholz aus dem Walde versorgt werden mussten. Wir haben eine
Kiefer von über 8 Festmeter angefahren, der wir zuerst 6 Meter Spitze abschneiden mussten, um diese Last überhaupt
auf den Wagen zu bekommen. Sechs Pferde musste angespannt werden um den Wagen zur befestigten Straße zu bringen.
Fichten und Tannen wuchsen bis zu einer Länge von 30 Metern. Auch beim Transport von Ziegel, von der Ziegelei zum
Bahnhof, konnte man gutes Geld verdienen.
Im Jahr 1934 wurde Rohmanen an das überregionale Stromnetz angeschlossen und schaffte auf diese Weise den Sprung von
der Petroleumlampe zur Glühbirne. Neben dem Grundstück von Karl Pietzonka wurde ein Transformatorhäuschen errichtet,
in dem der ankommende Strom von einer Hochspannung auf eine Verbrauchsspannung transformiert wurde. Es gab schon eine
Überlandleitung, die aus Richtung Ortelsburg kommend, quer über die Felder, in Richtung Neu Keykuth weiter ging.
Durch eine Zwischenspanne wurde der Transformator, mit der Hauptleitung auf Kownatzkis Feld verbunden.
Ein Stromanschluss konnte die Arbeit im Haus und Hof auf vielfältige Weise erleichtern, doch nur die besser gestellten
Bauern, sowie noch manche Pensionäre, die ein festes Einkommen hatten, konnten sich dass leisten. Weil nur wenige an
der Elektrifizierung teilnahmen, war ein Stromanschluss mit hohen Kosten verbunden. Nur Gustav Pietzonka, Gasthof
Trzaska, Friedrich Nickel, die Schule und Wilhelm Both, wurden in der ersten Phase erfasst.
Im Jahr 1952 wurde von den polnischen Behörden die zweite Stufe der Elektrifizierung eingeleitet, in der alle im Dorf
stehen Gebäude erfasst wurden. Am Anfang wurden nur Leitungen für Lichtstrom gelegt und auch nur 3 Lichtstellen pro
Haushalt bewilligt. Doch im nachfolgenden Zeitraum wurden dann, wenn Material vorhanden war, weitere Lichtpunkte
angelegt. 1952, am zweiten Wochenende im Advent, wurden dann die Leitungen geschaltet und alle waren von der
plötzlichen Helligkeit sehr begeistert. Wenn man Glühbirnen auswechseln wollte musste man am Anfang weite Wege
zurücklegen, um welche zu bekommen. In den 60ger Jahren wurden dann immer mehr Starkstromleitungen gelegt, weil die
Bauern elektrische Geräte kaufen konnten. Ende der 60ger wurden auch die Abbauten an das Stromnetz angeschlossen.
Das Urnengrab auf unserem Feld
Auf unserem Feld, in Richtung Seelonken, bin ich oft beim pflügen gegen Steine gestoßen, manchmal
rissen sogar die Stränge am Pferdegeschirr. Eines Tages nahm ich einen Spaten, Brechstange und einen langen Baum, um
der Sache auf den Grund zu gehen. Als ich eine Menge Sand ausgehoben hatte stieß ich auf eine steile, aus Steinen
errichtete Wand, die ich auch mit dem Baum nicht aus der Fassung bringen konnte. Ich habe den ganzen Vormittag gegraben,
konnte jedoch nicht unter die Steine kommen. Einige Tage später hatten wir in der Schule eine Bauernversammlung, da
habe ich Herrn Biella und Herrn Lehrer Dorka von meinem Fund berichtet. Am nächsten Morgen kam der Lehrer Dorka mit der
ganzen Schulklasse, mit Spaten und Sieben ausgerüstet auf unser Feld und fingen an die ausgehobene Erde zu sieben.
Lehrer Dorka benachrichtigte daraufhin den Leiter des Ortelsburger Heimatmuseums, der am nächsten Morgen vorbei kam um
sich die Fundstelle genau anzusehen. Er beauftragte ihn 4 Mann zu besorgen, um die Steine ringsum frei zu schaufeln.
Zwischen den Steinen durften wir die Erde nur mit Esslöffeln ausheben. Als es plötzlich zu regnen anfing hat Lehrer
Dorka die Brauerei Daum, in Ortelsburg angerufen, die uns über der Fundstelle ein Zelt errichtet haben, damit wir
ungestört weiterarbeiten konnten. Wir fanden 8 flache und 8 hohe Urnen zu beiden Seiten am Körper. Die Urnen wurden in
Gipsbinden eingewickelt und ins Heimatmuseum nach Ortelsburg gebracht, wo sie durch einen Fachmann, der extra aus einem
Königsberger Museum angereist war. Nach Reinigung der Urnen hat er festgestellt, das die Grabstätte etwa 2000 Jahre vor
Christi Geburt angelegt wurde und ein Doppelgrab war, in dem ein Toter liegend und einer in Hochstellung beigesetzt
wurde.
Die Nachricht von der Fundstelle verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Es erschienen viele Schaulustige, ganze
Schulklassen aus der Umgebung, mit Autos und zu Fuß. Durch die vielen Menschen wurden die bestellten Ackerflächen auf
unserem Feld sehr in Mitleidenschaft gezogen, eine Entschädigung haben wir nicht erhalten. Das Grab wurde vor dem
Heimatmuseum in Ortelsburg wieder so aufgebaut wie man es auf unserem Feld vorgefunden hat. Für den Transport der
Steine wurde ich entlohnt. Die Urnen hat das Königsberger Museum an sich genommen und wollte sie nicht wieder hergeben,
weil die solch einen Fund noch nicht in ihrer Sammlung hatten.
Sonnenwendfeuer
Am 24 Juni fand eine Sonnenwendfeier statt. Ein Brauch der an die alten Germanen erinnern sollte.
Der Lehrer Dorka hat den Bürgermeister beauftragt 2 Fuhrwerke in den Wald zu schicken, die Holz und alten Reisig holen
und auf dem großen Schulberg abladen sollten. Das Straßenbauamt hat uns Teertonnen zur Verfügung gestellt. Die ganze
Dorfgemeinschaft wurde eingeladen, am Abend, nach der Feldarbeit, an der Sonnenwendfeier teilzunehmen. Lehrer Dorka
hielt zuerst eine Ansprache, in der er anschaulich erklärte wie unsere Vorfahren in grauer Vorzeit gefeiert haben.
Nach dem offiziellen Teil wurden das Holz und die Teertonnen angezündet, es wurden Heimatlieder gesungen, wie: Wild
flutet der See, drauf schaukelt der Schiffer den schwankenden Kahn, Schaum wälzt er wie Schnee, von grausiger Mitte
zum Ufer heran, wild fluten die Wellen auf Vaterlands See, wie schön, oh trag mich auf Spiegel zu Hügel, Masovias See.
Masovia Land, mein Heimatland, Masovia es lebe mein Vaterland.
Lehrer Alfred Dorka und sein Wirken für Rohmanen.

Friedrich Biella hatte auf seinem Feld einen Granitstein mit einer geraden Seite, den haben wir
mit viel Schweiß an den Dorfteich transportiert und auf einer Erhöhung abgelegt. Der Stein sollte zum Denkmahl für die
Gefallenen des Ersten Weltkrieges umgestaltet werden. Da zu Wenige daran ein Interesse zeigten, wurde diese Idee fallen
gelassen und der Stein irgendwann ins Wasser gerollt. Der Lehrer Dorka war viele Jahre in Rohmanen tätig, dort hat er
später seine ehemalige Schülerin, Lotte Biella geheiratet. Er hat sich sehr für die Entwicklung des Dorfes interessiert,
war bei jeder Gemeindeversammlung anwesend und hat auf Schwachstellen hingewiesen die den Fortschritt behinderten.
Gemeinsam mit den Schülern hat er den Ehrenfriedhof für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges gepflegt, an der
Wegegablung nach Eichtal und zu Ehren des Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg eine Eiche gepflanzt.
Zum Advent hat Lehrer Dorka mit der Jugend einen Adventstern, in verschiedenen Farben gebastelt.
Der Stern wurde auf einer 2 Meter langen Stange befestigt, in der Mitte wurde ein Wachslicht angezündet, am Stern
wurde eine Schnur angebracht, wenn man daran zog rollte der Stern hin und her. Am ersten Wochenende im Advent
versammelten sich jung und alt, um den Stern durch das Dorf zu tragen. Alle schlossen sich dem vorausgehenden
Sternträger an, der den Stern durch die Hauptstraße und die angrenzenden Wege trug. Dieser Sternmarsch wurde an den
folgenden Adventwochenenden wiederholt.
Am ersten Weihnachtfeiertag wurde um 4:00 Uhr morgens ein Frühgottesdienst gehalten. Zuerst hat der Pfarrer eine
Andacht gehalten, dann haben die Kinder ein Krippenspiel aufgeführt und die Gemeinde hat schöne Weihnachtslieder
gesungen. Der Gastwirt Trzaska hat uns den Saal zur Verfügung gestellt. Wir hatten eine Posaunen- u. eine
Gitarrengruppe. Unter der Leitung von Herrn Willi Doormann spielten: Gottlieb Brosch, Fritz Ollech,
Gustav Rattay(Sopran), Wilhelm Pilath, Gustav Brosch(Alt), Fritz Both(Tenor) und Fritz Brosch(Bass).
In der Gitarrengruppe wirkten mit: Martha Ollech, Hedwig Ollech, Martha Lekzik, Martha Michalick und Auguste Lekzick.
Willy Doormann hat sie auf der Geige begleitet.
Kurz vor Ausbruch des 2. Weltkrieges
Bei der Aufstellung des Grenzschutzes(Regiment Buchholz), hat er als Hauptfeldwebel die
Gruppenführerkurse überwacht und selbst die fähigsten Männer dafür vorgeschlagen. Das Ausbildungspersonal hat das
Jäger-Battalion gestellt. Wir kamen zuerst ins Stadion(Waldheim), wurden da eingekleidet und dann ging es gleich
kasernenmäßig zu, theoretisch und praktisch. Jeder musste vor die Front treten und nachweisen ob er im Stande ist,
Befehle zu erteilen. Abends wurden Filme vorgeführt die uns zeigen sollten wie eine Gruppe sich im Gelände entfalten
muss. Die Exerziervorschriften hatten sich, im Verhältnis zu Kaiser Wilhelms Zeiten, etwas geändert. Damals bestand
eine Gruppe aus 8 Mann und einem Unteroffizier, jetzt aus 10 Schützen, 3 für das leichte Maschinengewehr und einem
Unteroffizier(13 Mann). Nach der Schulung folgte eine Abschlussprüfung, danach ein gemütliches Beisammensein. Aus
Rohmanen haben folgende Männer die Prüfung bestanden: Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy, Gustav Rattay und
Gustav Deptolla. Unsere Uniformen waren alle zu klein und es gab viel zu lachen bei der Anprobe.
Die erste Übung habe ich mit Emil Rosowski, in Lenzinen gemacht. Der Gutsbesitzer Marzinzick hat seine Scheune als
Unterkunft zur Verfügung gestellt. Er war im Range eines Hauptfeldwebels. In seinem haus war die Schreibstube
untergebracht, die er selbst verwaltete. Ein Lastauto hatte Uniformen aus der Kaserne in Ortelsburg geholt, jeder
musste eine Uniform anlegen und dann wurde solange getauscht bis alle eine passende gefunden hatten. An den Namen des
Kompanieführers kann ich mich nicht mehr erinnern. 1935 wurden wir zu einer Übung in die Dragonerkaserne nach Lyk
einberufen. Die Gruppenführer, Zugführer, und Kompanieführer die schon Frontberührung im dem Ersten Weltkrieg hatten,
mussten eine Woche früher anreisen. Die Übungen waren auf 6 Wochen angelegt. Die meisten der einberufenen waren noch
nie mit dem Wehrdienst in Berührung gekommen. Jeder Gruppenführer bekam 13 Mann zugeteilt.
Unser Zugführer war Leutnant Neumann, Kompanieführer Oberleutnant Rutschko, Battalions-Kommandeur Major Gröning
(Regiment Buchholz). Hier ging es wieder Kasernenmäßig voran. Das Bataillon wurde hier vereidigt. Jeden zweiten
Sonntag durften unsere Frauen uns besuchen. Ein Jahr später wurden wir wieder zu einer Übung einberufen, auf den
Truppenübungsplatz nach Arys. Jeder Gruppenführer hatte den Auftrag die Gruppe zu entfalten, und auf bewegliche
Figuren zu schießen. Diese Übung musste später mit scharfer Munition wiederholt werden. Jedes Maschinengewehr bekam
50 Schuss, jeder Schütze 20 Schuss zugeteilt. Nach dem Abschießen wurden die Treffer gezählt und dem Kommandierenden
Bericht erstattet. In einiger Entfernung spaziert ein Storch umher, der gar nicht bemerkt hatte dass geschossen wurde,
was bei den Kameraden ein großes Gelächter hervorrief.
Nach der Übung wurde uns gesagt das jeder Gruppenführer eine arische Abstammung nachweisen sollte. Ich konnte in den
Rheinsweiner Kirchenbüchern meine Vorfahren aus Gellen, bis zum Jahr 1732 zurück, nachweisen und wurde zum
Unteroffizier befördert. Aus unserem Dorf wurden auch, Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy und Gustav Deptolla
befördert. Zwischendurch mussten wir schon mal in die Radfahrer-Kaserne nach Ortelsburg, Gewehre empfangen und im
Gelände üben. Am 31 Juli 1939 wurde mir von einem Soldaten ein Schreiben übereicht, das mich aufforderte, am 1. August
um 6:00 Uhr, bei der 3. Kompanie, des 2. Infanterieregiments zu erscheinen.
Um 5:30 hat mich meine Schwester in die Kaserne gebracht. Auf der Schreibstube erklärte mir der Hauptfeldwebel,
dass mir ab sofort der Dienstgrad eines Sanitäters zugewiesen wird, ich mich in der Kammer einzukleiden hätte und mir
in der Handwerkerstube die entsprechenden Schulterklappen annähen lassen sollte. Die aktiven Sanitäter wurden den
Feldlazaretten zugewiesen und wir kamen an ihre Stelle. Unser Bataillon wurde nach Schodmak zum Bunker bauen und
Stacheldraht verlegen eingeteilt. Wir zogen in Begleitung einer Musikkapelle bis zur Kreuzung am Krankenhaus, dann
weiter zu unserem Bestimmungsort, gefolgt von einer Gulaschkanone die in den nächsten Tagen für unsere Verpflegung
sorgen sollte.
Am 14 August haben wir die Jägerkaserne, begleitet von einer Musikkapelle endgültig verlassen und zogen zuerst durch
Ortelsburg, dann über Lehmanen ins Feldmanöver, hinter Rohmanen. Dort entfaltete sich das Bataillon im Gelände, die
Verwundetensammelstelle wurde auf dem Hof des Bauern Friedrich Neumann eingerichtet. Gegen Abend wurde zu Sammeln
geblasen und Biwak bezogen, wobei unsere 3.Kompanie, in einem kleinen Wallt, in der Nähe von Otto Nickels Gehöft
Stellung bezogen hatte. Die 2. und 4. Kompanie hatte sich in der Nähe vom Abbau Pallasch niedergelassen. Die Frau
Nickel hat am Abend ein Mädel in Dorf geschickt um meiner Frau Bescheid zu sagen, wo wir uns zurzeit befinden. Meine
Frau ist dann noch gekommen um sich von mir zu verabschieden, weil wir am nächsten Morgen um 3:00 Uhr Zelte abbrechen
und um 4:00 Uhr in Richtung Kaspersguth marschieren sollten.
Wir sind dann über Achodden, Seelonken, Lehmanen, Ortelsburg, bis nach Grammen und Schützendorf marschiert, wo wir an
einem See Biwak bezogen haben. Es wurde immer gesagt, wir kommen zum Tannenberg-Denkmal bei Hohenstein, wo ein Reichs
Kriegervereinsfest stattfinden sollte. Es wurden auch schon Vorkommandos aufgestellt, doch dann kamen wir nach Orlau
und Lahna-Mühle, da wo die Alle entspringt haben wir 2 Tage biwakiert. Unser Kompanieführer hat uns nach Waplitz auf
den Soldatenfriedhof des Ersten Weltkrieges geführt und uns erklärt wie das Jägerbataillon sich 1914 hier entfaltet
hat und aufgerieben wurde. Dann mussten wir in der Nähe von Gut Koslau über einen Fluss und bezogen in einem Waldstück,
vorbereitete Stellungen in der Nähe der polnischen Grenze. Herr und Frau Thalmann haben uns jeden Tag, bis zur Grenze,
mit Brötchen und Getränken versorgt. Es wurde scharfe Munition ausgegeben, weil wir am nächsten Morgen um 4:00 Uhr die
polnische Grenze überschreiten sollten.
Am nächsten Morgen um 10 Minuten vor 4:00 Uhr kam der Befehl; scharfe Munition abgeben, alles zurück in ein 6 Kilometer
entferntes Dorf, wo wir auch einquartiert wurden. Das alles geschah’ eine Woche vor dem 1. September 1939. Es wurde
gesagt dass der Führer dem polnischen Präsidenten Rid-Szmigly, ein Ultimatum gestellt hat und es wahrscheinlich nicht
zum Krieg mit Polen kommt. Genau nach 5 Tagen kehrten wir wieder in die gleichen Stellungen zurück, es wurde wieder
scharfe Munition ausgegeben und am nächsten Morgen um 4:00 Uhr überschritten wir die polnische Grenze.
“Der 2. Weltkrieg.”
Der erste Einsatz in Polen
Wir kamen zuerst in ein Dorf in dem sich nur alte Menschen befanden. Auf unsere Frage wo denn die Bewohner wären sagte
man uns dass alle geflohen sind, weil erzählt wurde, die Deutschen würden alle Polen misshandeln und verstümmeln. Ich
habe ihnen daraufhin gesagt dass uns, unter Androhung von Strafe verboten wurde, einem Zivilisten etwas anzutun. Das
Vieh, die Schweine und Hunde des Dorfes liefen frei herum und die Soldaten fingen an auf die Hunde zu schießen, bis
gesagt wurde es seien Meldehunde im Dienste der Deutschen Wehrmacht und dieser Unfug der eigenen Truppe schaden würde,
weil etwaige Querschläger eigene Kameraden verletzen könnten. Wir gingen weiter auf polnischer Seite entlang der Grenze,
bis wir am Nachmittag die ersten Vorposten der Festung Mlawa erreichten, da befanden wir uns plötzlich im Feuerhagel
polnischer Festungsflack.
Am nächsten Morgen hatte ich schon 3 Verwundete und wusste nicht wo sich eine Verwundeten Sammelstelle befindet. Ich
suchte den Bataillonsgefechtstand auf der sich auf einer Anhöhe befand. Ich habe unseren Oberstabsarzt gefragt wo denn
die Verwundetensammelstelle wäre. Er rief beim Tross an, wo er die Auskunft erhielt, das sich vor dem Dorf ein Bunker
befindet in dem man die Verwundeten sammeln sollte, die dann von Sanitätsautos abgeholt würden, weil das Dorf unter
Artilleriebeschuss stand. Am Sonnabend haben unsere Flieger die Bunkerstellungen bombardiert, konnten aber, trotz guter
Treffer nicht viel ausrichten, die Bunker wurden nur etwas angekratzt.
Der Beschuss unserer vordersten Linien ging mit unverminderter Heftigkeit weiter. Am Sonntag verkündete eine große
Staubwolke die Ankunft unserer Panzer, doch sie kamen nur bis zur Panzersperre und mussten wieder abdrehen ohne den
Polen einen schaden zuzufügen. Ein Panzer bekam einen Volltreffer, der Fahrer konnte noch umkehren. Er blutete am Kopf
und der Schütze war so eingeklemmt, das wir ihn nur mit einem Seil unter den Armen, durch die Luke nach oben ziehen
konnten. Ob er seine Verwundung überlebt hat ist mir nicht bekannt, denn in der Nacht wurden Panzergeschütze nach
vorne in Stellung gebracht, die direkt in die Schießscharten der Bunker geschossen und so die Verteidiger vertrieben
haben. Daraufhin sind wir weiter vorgerückt. Auf einer Wiese war ein tiefer Graben ausgehoben und mit Ästen getarnt,
da war ein Panzer hinein gefahren, so dass nur das Hinterteil herausragte und er sich nicht aus eigner Kraft befreien
konnte. In der Luft waren Flieger die Brandbomben abwarfen, ich habe mich auf den Boden geworfen weil ich dachte die
würden explodieren, aber sie zischten nur, so das Stoppeln und Graß rings herum in Brand gerieten.
Bei den Kampfhandlungen gab es mehrere Verwundete, denen ich gerade Verbände anlegen wollte, als unser Hauptmann zur
Trillerpfeife griff um mir klar zu machen, dass ich ihm folgen sollte. Die Polen fingen an zu schreien, ich sollte
sie ins Lazarett bringen denn hier im Wald würde sie niemand finden. Ich setzte mich aufs Fahrrad und folgte unserem
Kompanieführer, der mir sagte ich soll immer bei der kämpfenden Truppe bleiben, denn hinter der Front sind die
Sanitätsabteilungen, die werden die Verwundeten schon versorgen. Der Vormarsch dauerte bis in die späte Nacht. Auf
einem Gehöft, das nach allen Seiten durch Feldwachen abgesichert wurde, machten wir endlich Rast. Wir haben
Getreidegarben auf dem Hof ausgebreitet und uns zur Ruhe gelegt, als plötzlich um Mitternacht Leuchtraketen den Himmel
erhellten und Maschinengewehrfeuer uns aus dem Schlaf schreckte. Ein par polnische Soldaten hatten das Feuer eröffnet,
aber sich kurz darauf ergeben.
Die Narew-Überquerung
Als es hell wurde ging der Vormarsch weiter. Es wurde uns untersagt Tagebuch zu führen, darum
weiß ich nicht wie die Orte hießen, durch die wir marschiert sind. Als wir durch ein sumpfiges Gelände vor drangen
stand auf einer Anhöhe am Horizont, die polnische Artillerie, die uns sofort unter Beschuss nahm. Unser Hauptmann war
der Meinung dass wir schon in der Nähe des Flusses Narew sein müssten, als aus den Sträuchern ein mit Schlauchboten
beladenes Lastauto auftauchte. Wir wurden aufgefordert mit je 6 Mann ein Schlauchboot zu nehmen, an einem Aggregat
der daneben stand mit Luft zu füllen und zu Wasser zu lassen. In einer Stunde war das ganze Bataillon über die Narew,
wo der Vormarsch fortgesetzt wurde. In einem Dorf überraschte uns die polnische Kavallerie und fing sofort mit
Maschinengewehren zu schießen an. Da kam der Befehl: Alles wieder zurück. Es ging noch schneller als auf der Hinfahrt.
Wir sind erst einige Kilometer am Fluss entlang gegangen und haben dann zum zweiten Mal rüber gesetzt.
Die Gehöfte im Dorf standen alle in Brand. Auf einem waren viele Bienestöcke. 2 Kameraden wollten den Stöcken Waben
entnehmen, doch die Bienen durch das Feuer aufgeschreckt, überfielen sie sofort und stachen derart zu das sie nicht
mehr wieder zu erkennen waren. Ich habe die Einstichstellen mit Salmiak betupft, mehr konnte ich nicht tun. Wir mussten
auf unserem Vormarsch durch einen Wald der in Flammen stand, so dass man kaum atmen konnte. Es ging weiter in Richtung
Minsk und Warschau, wo schon die Sowjetische Armee durchgegangen war, die Pferde und Vieh von einem Gut mitgenommen
hatten. In einem Wald stießen wir unverhofft auf ein Kloster, in dem wir einige Gefangene machten. Dann trafen wir auf
eine gute Straße die nach Grochow ging.
Als wir dort einmarschierten wurden wir aus den oberen Stockwerken beschossen, so dass wir, um uns zu schützen, nur an
den Hauswänden entlang gehen konnten. Wir haben jedes Haus nach Feinden durchsucht. Vor einem Haus stand ein Hund der
niemanden reinlassen wollte, solange bis ihn eine Kugel traf. Die polnische Artillerie feuerte von Warschau aus, um
unseren Vormarsch zu stoppen. Wir hatten uns gerade eingegraben als plötzlich deutsche Flieger am Himmel erschienen,
die unsere Stellungen mit Bomben bewarfen und dabei viel Unheil anrichteten. Wir haben sofort Fliegertücher
ausgebreitet und Leuchtraketen abgeschossen. Da ich in dem Graben, den ich kurz zuvor ausgehoben hatte, sofort in
Deckung gegangen bin ist mir zum Glück nichts passiert. Unter den anderen Kameraden gab es viele Verwundete, so dass
ich nicht wusste wem ich zuerst helfen sollte.
Der Oberstabsarzt hat mich sofort tatkräftig unterstützt, so das bald alle Verwundeten versorgt waren, außer einem,
dem ein Bombensplitter den Arm abgerissen hat. Ich habe im 3 große Verbandspäckchen auf die Wunde gelegt, doch die
Blutung ließ sich trotzdem nicht stoppen, so dass er eine Stunde später auf der Krankensammelstelle verstarb. Wir
haben danach in einem Tomatenfeld einen Graben ausgehoben und eine neue Abwehrstellung bezogen. Die Gruppe Schwarz
bekam den Auftrag nach etwaigen versprengten polnischen Verbänden Ausschau zu halten, als sie unerwartet aus einer
Häuserreihe mit Maschinengewehrsalven überschüttet wurden. Der Gruppenführer und noch ein Soldat wurden dabei tödlich
verwundet. Danach wurde noch ein weiter Stoßtrupp, unter der Führung von Leutnant Briskorn, der sich dazu freiwillig
gemeldet hatte, hinaus geschickt um den Gruppenführer und den anderen Toten zu bergen.
Bei diesem Unternehmen, das erfolglos ausging, weil die Toten schon verscharrt waren, durchschlug eine Kugel den
Stahlhelm von Leutnant Briskorn, der auch sofort tot war. Alle Toten wurden später, an der Kirchenmauer in Grochow, in
Särgen beigesetzt: Hauptmann Schönwald sagte, das sie nach dem Kriege auf den Heldenfriedhof nach Ortelsburg überführt
werden. Drei Tage lagen wir bei Grochow in Stellungen, waren dem polnischen Maschinengewehrfeuer sowie den Bomben
deutscher Flugzeuge ausgesetzt. In der Nacht musste ich zu einem Verwundeten in die vorderste Linie und habe den
Rückweg nicht mehr finden können, als plötzlich Gewehrfeuer aufflammte habe ich in den Ruinen Schutz gesucht. Erst im
Morgengrauen konnte ich mich wieder orientieren und zu meinem Unterstand zurückfinden.
Warschau wurde tagelang bombardiert und stand auch unter Artilleriebeschuss. Aus dunklen Rauchwolken kamen oft ganze
Bündel von Papier angeflogen. Die Verwundeten kamen oft auf Krücken zu unserem Unterstand, ich habe sie dann zur
Krankensammelstelle hingeführt. Wir haben auch polnische Zivilpersonen betreut, die während der Kampfhandlungen
verwundet wurden. Als einmal 2 Jungen vorbeiliefen hat einer ihnen nachgerufen sie sollten seiner Frau Bescheid sagen,
er wäre auf der Krankensammelstelle an der Kirche. Als wir dort ankamen war seine Frau, mit einem Kind auf dem Arm,
schon da.
Nach der Kapitulation von Warschau, gingen wir über Sokolow zum Bug und haben dort Quartier bezogen. Der Russe hatte
sich bereits hinter den Fluss zurückgezogen, hatte alles Vieh und Pferde mitgenommen. Dort erreichte mich ein Telegramm
von zu Hause, dass meine Tochter gestorben ist. Es sprach sich auch herum dass verschiedene Heimaturlaub bekommen haben,
ich durfte auch für 14 Tage heim. Wir fuhren mit Lastautos nach Allenstein in die neue Reiterkaserne, zum
Ersatzbatallion, da haben wir unsere Gewehre und Munition abgeben, dann durften wir, jeder in seinen Heimatort
weiterfahren.
Als wir unsere Quartiere am Bug verlassen haben war sehr viel Schnee gefallen. Hier in Ortelsburg fanden wir die
gleiche Wetterlage vor, aber nach 3 Tagen war alles wieder weggetaut und wir konnten die Kartoffelernte, die durch den
frühen Wintereinbruch gestoppt wurde, zu Ende bringen. Ein Tag bevor ich zu Hause angekommen bin wurde die Tochter
beerdigt. Nach 14 Tagen mussten wir uns in Allenstein melden, Gewehre empfangen und wieder zurück zur Division an den
Bug 150 Kilometer hinter Warschau. Die elfte Division, zu der wir auch gehörten sollte in den Westen Deutschlands
verlegt werden und war schon unterwegs zur Verladestation Skiernewice 50 Kilometer vor Warschau.
Mein Dienst als Sanitätsunteroffizier
Unser Bataillon kam in das Städtchen Burscheid, im Kreis Opladen, wo wir in Privatquartieren
untergebracht wurden. Nach 3 Monaten, im Januar 1940, wurden wir nach Solingen verlegt, wo wir bis zum
Frankreichfeldzug stationiert waren. Wir mussten an Feldübungen teilnehmen, wie andere die in Kasernen untergebracht
waren. Während dieser Zeit musste jeder seine Zähne in Ordnung bringen lassen. Jeden Tag fuhren 20 Mann in die
Cäzilienstraße nach Köln, zur Zahnklinik. Im Rheinland wurde unsere Division neu aufgestellt. Ausfälle durch den
Polenfeldzug wurden durch neue Soldaten ergänzt. Ich kam nun zum Ersatzbatallion, war der Älteste in der ganzen
Kompanie. Als der Frankreichfeldzug losging wurde unser Ersatzbatallion mit den noch vorhandenen Verwundeten, in die
neue Reiterkaserne, nach Allenstein verlegt.
Meine Frau hat, mit Unterstützung der Bauernschaft, einen Antrag gestellt, daraufhin wurde ich zur Frühjahrsbestellung,
beurlaubt und später bis auf weiteres vom Militärdienst freigestellt. Als der Russlandfeldzug losging wurde ich von der
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg, für 14 Tage einberufen. Ich war seit 1922, Mitglied der freiwilligen
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg und habe jedes Jahr an Übungen teilgenommen. Jede Bereitschaft musste etliche Leute
stellen. Von Rohmanen wurden Emil Rosowski, Johann Dembek, und ich, zur Krankensammelstelle Wirballen, in Litauen,
abkommandiert. Dorthin kamen Lazarettzüge aus Russland mit der Breitspurbahn. Die Verwundeten wurden frisch verbunden
und auf Waggon mit Normalspur verladen und nach Deutschland gebracht.
Als die 14 Tage vergangen waren wollten wir wieder nach Haus zurück, doch man wollte uns nicht entlassen. Stattdessen
wurden wir dem Wehrkreisamt Königsberg zugeteilt, neu eingekleidet und zur Aushilfe ins Lazarett nach Gumbinnen
abkommandiert. Mehr als ein Jahr war ich in den Urlauber-Baracken, habe dort Krankenstube betreut. Später, bis zum
Dezember 1944, war ich im Reserve-Lazarett 4, in Königsberg tätig. Dort habe ich auch die Luftangriffe der Engländer,
vom 25 bis 26. August 1944 miterlebt.
Wir sollten gerade einen Lazarettzug in Rotenstein entladen, als plötzlich die Sirenen ertönten - Fliegeralarm. Im
gleichen Moment waren die ersten Flugzeuge auch schon da, zuerst warfen sie „Tannenbäume” und danach Foßforkanister ab.
Die Omnibusse standen schon zur Abfahrt bereit als es losging. Wir haben die Verwundeten schnell in den
Luftschutzkeller getragen, haben die Betten von den Fenstern weggerückt damit die Verwundeten nicht von den
Glasssplittern verletzt wurden. Im Kasernenhof brannten die Fosforkanister lichterloh. Unsere Unterkunft, die sich in
einer Baracke befand ist völlig abgebrannt, mit dem Wenigen was wir unser Eigen nannten. Am nächsten Tag wurden wir neu
eingekleidet und am 29. bis 30. kamen die englischen Bomber wieder, sie setzten genau da ihr Zerstörungswerk fort wo
sie vor 3 Tagen aufgehört hatten.
Anfang Dezember 1944 musste ich mich nach Stablack melden und musste dann zur Sanitätsabteilung 1, nach Gernau, das
liegt zwischen Lodz und Warschau. Vormittags hatten wir Felddienstübungen und nachmittags theoretischen Unterricht.
Jeden Tag wurden Gruppen zusammengestellt und zu anderen Einheiten abkommandiert. Ich kam zu einer Panzerabteilung, wo
wir an einem Morgen plötzlich auf dem Kasernenhof antreten mussten und zu unserer Überraschung mit der Nachricht
konfrontiert wurden, dass der Russe an mehreren Frontabschnitten durchgebrochen war. Wir bekamen sofort einen
Marschbefehl in Richtung Lodz, wo das Stadtbild noch intakt war, selbst die Straßenbahnen fuhren noch. In der Nacht
haben russische Flugzeuge die Stadt bombardiert. Die Kaserne in der wir untergebracht waren hatte keine
Luftschutzkeller, aber zum Glück blieben wir von Bombentreffern verschont. Am nächsten morgen bot sich uns ein Bild der
Verwüstung. Die entgleisten Straßenbahnwagen, sowie andere Fahrzeuge blockierten die Straßen. Die Älteren unter uns
bekamen Fahrscheine für einen Transportzug, der bereit hinter Lodz abfahrbereit, unter Dampf stehen sollte. Als
russische Panzer in den Straßen auftauchten, verbrannte die Schreibstube unsere Wehrpässe und andere wichtige
Dokumente. Wir liefen zu der Station auf der unser Transportzug bereitstehen sollte, aber da war kein Zug mehr zu sehen
und wir setzten unseren Rückzug zu Fuß fort.
Der Rückzug und Zusammenbruch der Ostfront
In Dobroschin, einer Stadt in Polen, wurde gerade ein Lazarettzug verladen, doch wir kamen nicht
mehr zum Einsatz, weil die russische Infanterie uns schon auf den Fersen war. Es ging weiter über den Fluss Bober,
Sagan, bis nach Glogau an der Oder. Dort wurden wir der 29. motorisierten Sanitätskompanie zugeteilt. Im
Garnisonslazarett wurden noch Operationen durchgeführt. Unsere Division hatte ihr eigenes Feldlazarett, so dass wir den
Befehl zu Weiterfahrt erhielten und noch unbeschadet die Oderbrücke passieren konnten, denn Glogau wurde zur Festung
erklärt. Wir haben 2 Pferdewagen organisiert und mit Verbänden, sowie medizinischen Instrumenten beladen. So kamen wir
bis nach Lübbenau im Spreewald, wo wir in einem Schloss, in zuvor ein Museum war, unser Lazarett untergebracht haben.
Weil die Amerikaner Cottbus bombardiert hatten, wurden die Verwundeten zu uns nach Lübbenau gebracht. Hier haben wir
Tag und Nacht gearbeitet, um die vielen Verwundeten, aus den schweren Kämpfen bei Grünberg und Sagan zu versorgen. Die
Soldaten von der Abwehrfront kamen schon mit abgestorbenen Armen oder Beinen bei uns an, weil in vorderster Linie keine
Frontlazarette mehr vorhanden waren; es mussten viele Amputationen durchgeführt werden. Als für unsere Pferde kein Heu
mehr vorhanden war, schickte mich unser Hauptfeldwebel, zu einem Bauern in den Spreewald, mit dem Auftrag, Futter zu
besorgen. Mit noch zwei Mann fuhren mit zwei Kähnen, zuerst den Hauptstrom entlang und dann in einen Nebenarm; da haben
wir die Boote beladen und brachten das Heu nach Lübbenau.
Als wir uns bei unser Einheit zurück melden wollten, war alles schon marschbereit. Ich bin schnell in einen Bus
eingestiegen der sofort losfuhr, weil russische Verbände schon in sichtweite waren. Russische Flugzeuge kreisten über
den Dächern und nahmen, mit ihren Bordwaffen jeden unter Beschuss, der sich irgendwo blicken ließ. Wir konnten nur
durch den Wald, oder in der Nacht vorwärts kommen, denn wenn ein Auto auf der Landstraße fuhr, war alsbald ein Flugzeug
hinter ihm her und schoss es in Brand. Als wir nach Tagen am Ufer der Elbe ankamen, war bereits eine Ponton-Brücke
erstellt worden, welche die zerstörte Brücke ersetzen sollte.
Durch die vielen Fahrzeuge waren in den Sand tiefe Spuren gefahren, so dass andere Fahrzeuge unsere Busse ins
Schlepptau nehmen mussten, weil wir mit eigener Kraft nicht mehr weiterkamen. Beiderseits der Trasse standen
Flüchtlingswagen, in der der Hoffnung die Brücke passieren zu können, doch SS-Polizei verhinderte das die Gespanne den
militärischen Rückzug zum Stillstand brachten. Es gelang uns die Elbe zu überqueren, um in einem Waldstück Schutz vor
feindlichen Fliegern zu suchen.
Als wir unsere Busse und Autos gut getarnt hatten, hat unser Bataillonschef die anwesenden Parteigrößen zu sich
gerufen und ihnen erklärt das wir eine Einheit des Roten Kreuzes sind und nach internationalem Recht keine Waffen
besitzen dürfen. Nach langer, erregter Diskussion wurde beschlossen einen Graben auszuheben und alles im Sand zu
verscharren. Als wir dann weiter, durch die Dörfer fuhren, sahen wir schon viele weiße Bettlaken, als Zeichen der
Kapitulation, aus den Fenstern hängen. Es wurde uns erzählt dass der Bürgermeister von der SS erschossen wurde, weil
er die Bevölkerung zu diesem Schritt ermutigt hatte. Jetzt waren hinter uns die Russen und vor uns schon die Amerikaner.
Amerikanische Panzer fuhren umher und schossen wild durch die Gegend, ohne ein Ziel anzuvisieren. Niemand wollte sich
dem Russen ergeben, doch der Weg der zu den Amerikanern führte, war durch abgesägte Bäume blockiert. Wir sind schnell
in das nächste Dorf gegangen, haben uns Sägen und Äxte besorgt, die Bäume durchgesägt und in den Straßengraben
geworfen.
“ Nach dem Ende des 2. Weltkrieges.”
In amerikanische Kriegsgefangenschaft
Dann fuhren wir unter internationaler Flagge an eine Mulde Brücke, vor der zwei amerikanische Soldaten, mit Zigarren,
zur Hälfte im Mund, standen. Sie rauchten und kauten gleichzeitig. Wir mussten auf einen freien Platz fahren, alle
aussteigen und rechts wieder antreten. Wäschebeutel und Tornister mussten wir abstellen; danach wurden wir nach Waffen
durchsucht, Wertsachen, Uhren und Messer wurden uns gleich abgenommen. Als wir anschließend an unserem Gepäck
vorbeigingen durfte niemand was mitnehmen. Als ich gebückt, nach meinem Wäschebeutel greifen wollte, in dem sich noch
3 Konservendosen und ein Brot befanden, bekam ich einen Fußtritt ins Gesicht, so dass mir ein Zahn ausgeschlagen wurde.
Wir wurden dann in einem Garten zusammen getrieben und gefragt ob jemand bei der SS gedient hat. Nachdem wir in Reihe
und Glied angetreten waren, mussten wir den Oberkörper freimachen und die Arme anheben. Es wurde nach SS-Zeichen
gesucht, die gewöhnlich unter dem Oberarm eintätowiert waren. Nachdem wir Grimma bei Leipzig, wo wir in amerikanische
Gefangenschaft geraten waren, verlassen hatten, mussten wir durch ganz Thüringen bis Hersfeld, an der Grenze zu Hessen,
marschieren. In Hersfeld wurden wir auf große Lastautos verladen, die von farbigen Soldaten gefahren wurden. Man hat
uns mit Stöcken hinauf getrieben, solange bis das Auto so voll war das man kaum stehen konnte. Die Soldaten fuhren, für
diese Straßenverhältnisse, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Wenn die Straße eine scharfe Kurve hatte, flogen
wir alle übereinander und mussten erst mit viel Kraftanstrengung auf die Beine kommen um diese Fahrt zu überstehen.
Da die Straßenränder in dieser Gegend mit Obstbäumen bepflanzt sind und deren Äste sehr niedrig hängen, hätten die
uns die Köpfe abgerissen, wenn wir uns nicht ständig geduckt hätten. Unsere Fahrt endete in Bad Kreuznach, in der Pfalz,
wo wir in ein Lager, in dem sich später 130.000 Mann und 6 Generäle befanden, eingepfercht wurden. Die Unterkunft der
Generäle befand sich unter einem Zelt, alle anderen mussten die Zeit unter freiem Himmel zubringen. Die Offiziere, die
Unteroffiziere, die Mannschaften; wurden in getrennten Camps untergebracht. Die Mannschaften wurden auch zur Arbeit
abkommandiert und konnten bei dieser Gelegenheit, Brot, Brötchen oder Zigarettenstummel organisieren, wogegen die
Offiziere und Unteroffiziere ihr Camp überhaupt nicht verlassen durften.
Die ersten Tage gab es kein Wasser und kein Brot, so dass die Kameraden vor Erschöpfung umfielen. Später standen wir
manchmal den ganzen Tag nach Wasser an, das von den, uns bewachenden Negern mit großen Wassertanks angefahren wurde. Am
dritten Tag bekamen wir mittags und abends etwas zu Essen; Brot bekamen wir erst nach zwei Wochen, nach dem aus der
Umgebung herbeigeholte Handwerker, Backöfen gebaut hatten. In den verschiedenen Gemeinden, die in den uns umgebenden
Weinbergen lagen, mussten sich alle Männer beim Bürgermeister melden. Als sie dann erschienen waren, wurden sie auf
bereitstehende Lastautos getrieben und zu uns ins Lager gebracht. Sie waren ohne Kopfbedeckung und ohne wärmere
Bekleidung angekommen, weil ihnen gesagt wurde, dass ihr Aufenthalt im Lager nur von kurzer Dauer sein würde. Man hat
uns, falls noch vorhanden, Decken und Mäntel abgenommen, mit der Begründung, sie würden für Kranke und Verwundete
gebraucht. Jeden Tag starben mehr als 200 Mann, die wir sofort in ein Zelt tragen mussten. In der Nacht wurden die
Toten dann mit unbekanntem Ziel, weggefahren.
Viele haben ihren Verstand verloren uns irrten im ganzen Camp ziellos umher. Als Latrinen wurden Gräben ausgehoben, in
die verschiedene Kameraden, bei der Verrichtung ihrer Notdurft, vor Schwäche hineingefallen sind und nicht mehr wieder
heraus kamen. Aus den Pfählen die, die jungen Obstbäume stützten, haben wir Krankentragen gebaut um unsere Kameraden,
bei Bedarf, zur Krankensammelstelle zu tragen. Es war in diesem Frühjahr auch sehr kalt, doch unsere Erdlöcher, die wir
zum Schutz vor Kälte und Wind, nur mit leeren Konservendosen ausgehoben hatten, durften nicht tiefer als 20 Zentimeter
sein. Nach jedem Regenguss mussten wir das Wasser ausschöpfen. Nach einem Gewitter, standen wir wiedermal, total
durchnässt in unserem Camp, als unerwartet am Horizont die Sonne hervortrat. Einer unserer Kameraden hatte noch eine
Trompete gerettet und fing, von dem Anblick völlig überwältigt, zu spielen an: "Es geht alles vorüber, es geht alles
vorbei, nach jedem Dezember, folgt wieder ein Mai". Daraufhin hob sich die Stimmung der tiefbetrübten Kriegsgefangenen,
so das Heimatlieder durch das ganze Camp erklangen, obwohl wir in den nassen Kleider herumgehen mussten, bis sie am
Körper trocken wurden.
In französischer Kriegsgefangenschaft
Nach etwa einem Monat, haben uns die Amerikaner, den Franzosen, zum Arbeitseinsatz, ausgeliefert.
Etwa 4 Kilometer von Bad Kreuznach entfernt, stand auf freier Strecke, ein Zug mit offenen Kohlenloren, auf den wir
verladen wurden. In jeden Waggon, wurde pro Person eine Tafel Schokolade und ein Päcken Zwieback rein geworfen, doch
viele Kameraden fanden nur leere Päckchen vor, weil die schon zuvor von der französischen Wachmannschaft geplündert
wurden. Wir haben uns darüber beschwert, doch die haben uns nur ausgelacht. Nachdem wir zunächst bei Mainz über den
Rhein fuhren, endete unsere Fahrt bei Paris in einem großen Zeltlager. Dort wurden wir auf andere Züge verladen, die uns
nach Südfrankreich, in ein Barackenlager, bei Mazarei, brachten.
Auf einer Zwischenstation hat man uns unter einer Pumpe, die Lokomotiven mit Wasser versorgt, abgestellt, den Kran
aufgedreht und uns anschließend ausgelacht, die Kinder Haben uns mit Steinen beworfen. Ein Wachmann kam in unseren
Waggon gekommen, hat unser Gepäck durchsucht, wenn er Tabak oder Zigaretten gefunden hat, nahm er sie mit. Die Kameraden
waren darüber so empört, dass sie vorhatten, ihn nachts unter den Waggon zu werfen. Wir haben sie gebeten dass zu
unterlassen, weil man uns in diesem Falle, alle erschießen würde.
Als wir ins Lager kamen wurden wir zuerst gezählt, dann mussten wir unser Gepäck stehen lassen und beiseite treten.
Wenn man bei der Nachkontrolle noch was in den Taschen fand, wurde das auch entwendet, selbst Esslöffel. Wir wurden
dann in drei Baracken, ohne Toiletten, eingeschlossen. Die Kameraden haben ihre Bedürfnisse in Kochgeschirre erledigt
und durch ein kleines Fenster, das sich fast unter der Decke befand, hinausgeworfen. Andere Fenster ließen sich nicht
öffnen, weil sie mit Stacheldraht zu geflochten waren. Als die Kameraden die Kochgeschirre auskippten, haben die
Wachposten geschossen und die Fenster zertrümmert. Sie waren der Meinung dass wir ausbrechen wollten. Es herrschte eine
große Hitze, in den überfüllten Baracken sind wir fast erstickt. Am nächsten Tag haben wir uns über fehlende Toilettem
beschwert, da haben sie Heringsfässer durch die Hälfte geschnitten und an der Ausgangstür hingestellt. Um bei den
überfüllten Räumen dort hinzukommen, musste man über die Köpfe der Anderen steigen. Viele hatten Fieber und Durchfall
und mussten in die Krankenstube eingeliefert werden, wo sie kurz darauf verstarben.
Besonders Raucher litten sehr an der Unterernährung, bekamen Wasser in den Beinen und waren die Ersten die verstarben.
Nach der Registrierung wurden wir auf andere Baracken verteilt. Die Zivilbevölkerung kam in die Räume und begann uns
auszuplündern. Wer noch gute Schuhe besaß musste sie ausziehen und bekam dafür die kaputten des Plünderers. Eine Woche
lang mussten wir diesen Zustand ertragen, erst als die Kameraden sich beschwerten, wurde am Eingang eine Tafel am
Eingang angebracht, dass die Zivilbevölkerung das Lager nicht betreten darf. Bis auf einige, wenige Ausnahmen wurde
diese Anweisung befolgt.
Als wir im Lager ankamen, war der französische Lagerkommandant, ein ehemaliger Kriegsgefangener, der bei einem Bauern
in Deutschland gearbeitet hatte. Dieser Bauer war jetzt als Kriegsgefangener in seinem Lager. Als er ihn erkannte, hat
er ihn gleich zum Küchendienst eingeteilt und mit dem nächsten Krankentransport nach Hause fahren lassen. Zu Mittag
bekamen wir nur gekochte Haferkörner, da schwamm alles oben, später war man dann auf Gerste umgestiegen. Als viele
daran gestorben waren, weil sie diese „Rohkost”, die nur ein Kuhmagen verträgt, nicht gegessen haben, hat man die
Körner durch eine Schrotmühle laufen lassen. Dann hat man uns Steckrüben gekocht; wir bekamen 250 Gramm Weißbrot,
etwas Quark und ein viertel Liter Magermilch. Später, als wir schon arbeiten mussten, hat man in unserem Essen einen
Kuhkopf mitgekocht, das hat dann bedeutend besser geschmeckt.
Bevor wir morgens zur Arbeit gingen, mussten wir zu Flaggenparade und abends, nach der Rückkehr, haben wir die Flagge
wieder eingeholt. Wir haben einen Kanal gereinigt, dessen Sohle 2 Meter dick mit Schlamm bedeckt war. Zuerst wurde das
Wasser abgelassen, dann haben wir, einer dem andern, den Schlamm mit der Schippe hoch gereicht. Der Letzte hat den
Schlamm, der so zäh war, dass er nicht von der Schippe wollte, oben am Rande abgelegt. Manchmal waren 10 Mann nötig um
den Höhenunterschied zu überwinden. Das Wachpersonal schoss über unsere Köpfe hinweg und rief: „schnell arbeiten”. Bei
der großen Hitze war das ein Ding der Unmöglichkeit, zumal es nichts zu Trinken gab. Auf dem Heimweg haben wir im Walde
Heilkräuter gesammelt, die man in der Küche getrocknet und als Tee zubereitet hat, den wir am nächsten tag zur Arbeit
mitnahmen, um unseren Durst zu stillen.
Unser Aufseher hatte einen Stock, an dem sich noch kurz abgeschnittene Äste befanden. Wer seiner Meinung nach, nicht
ordentlich gearbeitet hat, bekam gleich Schläge auf den Rücken. Die weißen Aufseher wurden irgendwann durch Neger
ersetzt, die uns bedeutend besser behandelt haben. Wenn irgendetwas schief ging, haben sie nichts gesagt, nur gelacht.
In den übrig gebliebenen Wassertümpeln hatten sich noch einige Aale versteckt, die wir zu fangen versuchten, was uns
auch manchmal gelang. Wir mussten ihnen das Genick brechen, damit sie uns nicht entwischen konnten. Wenn die Franzosen
bemerkten das wir Aale hatten, wurden sie uns abgenommen. Gelang es uns aber, sie ins Lager zu bringen, dann haben wir
uns eine köstliche Malzeit zubereitet.
Um sicherzustellen dass niemand geflüchtet ist, wurden wir, wenn wir abends ins Lager zurückkamen, zuerst gezählt.
Diese Zählung wurde mehrmals wiederholt, weil die Wachmannschaften sich immer wieder verzählt haben. Als einer von uns
hin ging, ihnen sagte dass alle da sind, wollten sie es nicht glauben und haben uns vor dem stehen lassen, bis es ihnen
irgendwann einfiel. uns doch das Tor zuöffnen. Einmal, als wir von der Arbeit zurückgekehrt waren, standen wir bis 23
Uhr neben der Flagge, weil uns niemand das Tor geöffnet hat. Als wir dann doch irgendwie ins Lager kamen haben wir
festgestellt, dass das ganze Wachpersonal betrunken war und niemand im Stande uns das Tor zu öffnen.
Eines Tages waren wir wieder abends zur Parole angetreten, als ein älterer Herr mit seinem Hund, am Stacheldraht
entlang, spazieren ging. Weil der Hund, unterm Stacheldraht hindurch, zu uns kam, hat ihn einer geschnappt, ihm das
Genick gebrochen und unter seiner Jacke versteckt. Der Franzose hat nach seinem Hund gerufen und gepfiffen, aber alles
vergebens, der Hund war nicht aufzufinden. Die Kameraden haben ihm gleich das Fell über die Ohren gezogen, das Fleisch
gekocht und das Fell in die Latrine geworfen. Das Fleisch wurde umgehend verspeist.
Als wir am nächsten Tag von der Arbeit zurückkehrten, war im Lager der Teufel los. Wir mussten sofort antreten und
wurden gefragt, wo der Hund geblieben ist, der Gestern Abend, mit seinem Herrchen, am Zaun entlang spazieren ging. Als
sich niemand dazu bekannte, mussten wir weiterhin stehen bleiben, während die Wachmannschaften von Baracke zu Baracke
gingen und alles durchsuchten. In einer Latrine hat man dann das Fell gefunden, was uns ein furchtbares „Donnerwetter”
einbrachte und in den nächsten Tagen, nach der Arbeit, unter dem Kommando eines Oberfeldwebels, eine Stunde
nachexerzieren.
In Südfrankreich regnet es den ganzen Sommer nicht; die Bauern haben da keine Scheunen und das Getreide wir nur in
Schobern aufgestellt und dann umgehend gedroschen. Vom Oktober bis Dezember regnete es fasst jeden Tag in Strömen.
Gesät wird nur im Frühjahr und im Herbst, weil im Sommer alles vertrocknet. Es wird viel Wein angebaut und die
Steckrübe wächst den ganzen Winter. Neben den Weinreben wurde aus Schieferplatten ein Zaun aufgestellt, um dem Wein
einen optimalen Standort zu sichern. Die Bauernwagen hatten nur zwei Räder und waren nur mit einem Pferd bespannt, das
die ganze Balance des Wagens zu halten hatte. Trotzdem haben sie soviel aufgeladen wie wir auf einen Leiterwagen. Viele
Kameraden wurden den Bauern zur Arbeit ausgeliehen. Wenn ein Bauer einen Arbeiter gebraucht hat und es wurde gefragt,
wer sich in der Landwirtschaft auskennt, da haben sich alle gemeldet. Der Bauer konnte sich dann aussuchen, wen er
mitnehmen wollte.
Wenn wir durch die Stadt zur Arbeit gingen, haben verschiedene Leute Fallobst in die Abfalleimer gelegt. Wenn das von
den Kameraden bemerkt wurde, schwenkten viele aus der Reihe, um sich etwas mit zunehmen, was von den Wachmannschaften
nicht gern gesehen wurde. Viele Kriegsgefangene hatten keine Schuhe mehr, sie haben die Füße nur mit Lumpen bewickelt.
Eines Tages kamen Kameraden aus Norwegen, die nach Deutschland entlassen werden sollten. Mann hat sie jedoch ins Lager
gesteckt und zur Arbeit eingeteilt. In Norwegen hatten sie Kleider und Stoffe eingekauft, hatten volle Seesäcke und
sogar Karren auf 2 Rädern, weil sie ja in die Heimat entlassen werden sollten. Als wir morgens zur Arbeit rausgeführt
wurden standen sie schon vor dem Lager. Wir haben ihnen zugerufen, dass sie uns etwas abgeben sollen, weil ihnen ja
sowieso alles abgenommen wird, aber sie haben uns nur ausgelacht. Als sie ins Lager Kamen mussten sie ihr Gepäck
ablegen, wurden dann wo anders hingeführt und haben es danach nie wieder gesehen.
Durch die vielen Läuse, Flöhe und Wanzen die wie im Lager hatten, kam es bei verschieden Kameraden, an den
Einstichstellen, zu eiternden Entzündungen. Um dem vorzubeugen hat man uns mit einem Pulver, das in Frankreich
hergestellt wurde, aber bei den Parasiten keine Wirkung zeigte, eingesprüht. Erst bei der Anwendung eines Mittels
amerikanischer Herkunft, war alles über Nacht verschwunden.
Der Sonntag war arbeitsfrei. Dann kam ein katholischer, französischer Pfarrer, eskortiert von 3 Mann, mit
aufgepflanztem Seitengewehr ins Lager und hat Gottesdienst gehalten. Einen evangelischen Pfarrer gab es nicht, nur
einen Baptisten Prediger. Der wurde würdevoll eingekleidet, bekam ein großes Kreuz und hat jeden Sonntag in einer
extra dafür hergerichteten Baracke Gottesdienst gehalten. Wer Theologie studiert hatte und sich meldete, wurde zu
einem Seminar geschickt und konnte sein Studium fortsetzen. Glasbläser durften das Lager auch verlassen und ihrem
erlernten Beruf wieder arbeiten.
Wer sich freiwillig, für 5 Jahre, zum Dienst in der Fremdenlegion verpflichtet hat, das waren etliche unter uns, wurde
neu eingekleidet, bekam gutes Essen und Rauchwaren soviel er wollte. Nach einem Jahr wurden, nach und nach, die
Kranken und Körperbehinderten in die Sowjetische Besatzungszone entlassen. Eine Entlassung von Kriegsgefangenen, die
in den Westzonen oder jenseits von Oder und Neise zu Hause waren, war nicht vorgesehen. Die Österreicher wurden alle,
unabhängig von ihrem Gesundheitszustand entlassen.
Ich habe Briefe nach Hause geschrieben, aber die kamen nur bis Allenstein und wurden wieder zurück geschickt. Als eine
Kommission des Roten Kreuzes aus der Schweiz unser Lager besichtigt hat, haben wir uns beschwert, das wir als
Sanitätsdienstgrade, zur Arbeit gehen müssen. Daraufhin erging ein Befehl: Wer einen vom Roten Kreuz, ausgestellten
Ausweis besitzt, gehört einem internationalen Verband an und braucht nicht zu Arbeit gehen. Aus unserem Lager hatten
sich 20 Mann gemeldet, die daraufhin Freigang, in Begleitung von zwei französischen Wachsoldaten erhielten. Als wir
gefragt wurden wo wir hin wollen, entschlossen wir uns, einen Soldatenfriedhof, auf dem unsere verstorbenen Kameraden
beerdigt waren, zu besuchen.
Da der Untergrund in dieser Gegend aus Felsen bestand, wurden die Gräben, in denen die Toten in selbst gezimmerten
Kisten nebeneinander gestellt wurden, mit Hilfe von Dynamit ausgehoben. Ein Leichenwagen, mit einem Pferd bespannt,
das mit einer schwarzen Decke abgedeckt war, wurde von einem Kutscher in angemessener Kleidung, gefahren. Der Wagen
konnte gleichzeitig 4 Kisten transportieren. Wenn wir von der Arbeit kommend, dem Leichenwagen begegneten, wurde
gehalten und mit einer Schweigeminute der Toten gedacht, bis der Wagen vorbei war. Die Zivilbevölkerung verharrte auch
im Schweigen, mit abgenommener Kopfbedeckung.
Ein Kamerad, der in Krottorf, Kreis Oschersleben, bei Magdeburg, zuhause war, sagte bei seiner Entlassung zu mir:
Sollte ich das Glück haben, meine Entlassungspapiere zu erhalten ohne eine Bleibe vorzuweisen, dann soll ich Krottorf
als Heimatadresse angeben. Auf der Krankenstube habe ich angegeben, dass sich noch ein Schrapnellsplitter, aus dem
Ersten Weltkrieg, in meiner Kreuzbeingegend befindet, er zwar verkapselt ist, aber immer noch Beschwerden verursacht.
Daraufhin wurde ich zur Entlassung vornotiert. Als bekannt wurde das ein Rückkehrertransport in die sowjetische
Besatzungszone zusammengestellt wird, habe ich mich sofort gemeldet und wurde für ein Entlassungslager in Angoleme
vorgesehen. War das eine Freude, als uns mitgeteilt wurde, wann der Rücktransport stattfindet.
In unserem Lager waren noch 2 Kameraden aus dem Kreis Ortelsburg: Ein Gustav Lumma aus Leynau und ein Alfred Moritz
aus Groß Schöndamerau. Sie mussten noch zurückbleiben und haben mir den Auftrag erteil, die Angehörigen in der Heimat
zu grüßen und ihnen die Anschrift mitzuteilen. Als wir im Entlassungslager ankamen, fragte man uns nach unserer
Heimatanschrift. Dann wurden die Entlassungspapiere angefertigt. Es wurde uns auch ein Barscheck, für die in Frankreich
geleistete Arbeit ausgehändigt, den wir bei jeder Kasse in Deutschland einlösen könnten. Ich habe ihn bis zum heutigen
Tage nicht einlösen können, obwohl ich irgendwann in der Zeitung gelesen habe, das Verrechnungschecks die den aus
französischer Kriegsgefangenschaft Entlassenen, ausgehändigt wurden, einzulösen sind.
Wir kamen zuerst nach Saar Elbe, dann in die Nähe der Zonengrenze zu Thüringen. Hier mussten wir 2 Tage warten, weil
aus der sowjetischen Besatzungszone keine Eisenbahnwagen bereitgestellt wurden. Angesichts dessen, das der Russe beim
letzten Transport die aus Frankreich kommenden Wagen kassiert und nicht mehr herausgeben wollte, bestand der Franzose
jetzt darauf, seine Wagen sofort wieder mitzunehmen. Als der sehnsüchtig erwartete Zug endlich eintraf, durften wir
umsteigen und kamen, immer noch hinter Stacheldraht, nach Erfurt. Von dort weiter ins Quarantänelager nach Prätsch an
der Elbe.
Unter Androhung von Strafe war es verboten das Lager zu verlassen, doch der Hunger zwang uns dazu, in den umliegenden
Dörfern um Lebensmittel zu betteln. Man drohte uns damit, dass Zuwiderhandlungen, mit einer 14-tägigen Verlängerung der
Quarantäne geahndet werden. Der Roggen war schon reif und wir haben, auf den umliegenden Feldern, die Ähren abgerissen,
das Korn, zwischen 2 Steinen zu Mehl zerrieben, um daraus eine Suppe zu kochen, denn von dem was unsere Lagerküche uns
bieten konnte, war es nicht möglich zu überleben. Als der Eigentümer bemerkte wer seine Roggenähren entwendet hat, kam
er ins Lager, gerade zu dem Zeitpunkt als wir mit dem Mahlen beschäftigt waren. Der Lagerkommandant, bei dem er sich
beschwerte, drohte uns zu bestrafen, wenn wir unsere „Rauzüge” nicht unmittelbar einstellen würden. Wir sagten ihm er
solle uns heimfahren lassen, da wir doch lange genug hinter Stacheldraht gesessen hätten.
Endlich wieder in Freiheit
14 Tage nach unserer Ankunft wurden uns Entlassungspapiere ausgehändigt, sowie auch Fahrscheine
zum den, von uns angegeben Heimatorten. So kam ich nach Krottof, Kreis Oschersleben, zu meinem ehemaligen
Kriegskameraden, bei dem ich einen Tag geblieben bin. Er hatte mir schon eine Stelle bei einem Bauern besorgt, der 70
Jahre alt und kinderlos war. Zum Hof, den er mit seiner Ehefrau bewirtschaftet hat, gehörten 36 Morgen Land, 2 Ochsen
und 3 Kühe. Das Ackerland bestand aus 17 Parzellen und sicherte mir einen Arbeitsplatz.
Jetzt, da ich ein Dach überm Kopf und genug zu essen hatte, fing ich an nach dem Verbleib meiner Familie zu forschen.
Bei meinem letzten Heimaturlaub hatte ich mit meiner Frau verabredet; falls wir uns in den Kriegswirren verlieren
sollten, unsere Kontaktadresse, die meiner Quartiersleute in Burscheid, Kreis Opladen, sein sollte. Ich habe zuerst
nach Rohmanen geschrieben, aber leider keine Antwort erhalten. Dann habe ich nach Burscheid geschrieben, und siehe, -
bei denen lag schon eine Anfrage meiner Frau vor, die nach mir gefragt, und ihre jetzige Anschrift hinterlassen hatte.
Ich habe dem Bauern erzählt dass meine Frau sich zurzeit, auf einem Gut, in Alt Steinhorst, im Kreis Rostock, befindet.
Er war sofort bereit uns ein Zimmer zur Verfügung zu stellen, wenn ich meine Frau nach Krottorf rüberholen wollte. Das
habe ich Ihr mitgeteilt und sie war sofort bereit ihren Wohnsitz nach Krottorf zu verlegen, denn sie wohnte dort in
einem kleinen Stübchen unterm Dach.
Im Herbst, als die Feldarbeit so ziemlich erledigt war, bin ich nach Alt Steinhorst gefahren, um meine Frau und meinen
Sohn Kurt, sowie meinen Sohn Manfred, den ich noch nicht kannte, weil er erst nach der Flucht, am 31. Januar, in Groß
Lüssewitz, geboren wurde, nach Krottorf zu holen. Meine Frau hatte schon Holz für den Winter besorgt und vom Gut, auf
dem sie im Sommer gearbeitet hatte, Mehl und Kartoffeln bekommen. Wir haben das Mehl und andere Habseligkeiten in
Kisten verpackt. Das Holz haben wir einem Bauern gegeben, der uns und unser Gepäck, mit seinem Pferdewagen, zum 14
Kilometer entfernten Bahnhof, nach Ribnitz gebracht hat. Wir sind auch gut in Krottorf angekommen, aber als wir am
nächsten Tag, unsere Kisten vom Bahnhof abholen wollten, haben wir zwar die Kisten vorgefunden, doch der gesamte Inhalt
wurde während der Bahnfahrt entwendet. Die Bahnstation in Krottorf hat die Vorkommnisse zur Kenntnis genommen und
protokolliert, aber unsere Sachen haben wir nie wieder gesehen und mussten wieder bei Null anfangen.
Im Winter musste ich auf der Genossenschaft, unentgeltlich, für die Russen Weizen einsacken. Ich hatte versucht eine
Arbeit als Zimmermann zu bekommen, doch auf dem Arbeitsamt wurde mir gesagt, ich bin Ladwirt und muss auf der
Landwirtschaft arbeiten. Da in den ersten Nachkriegsjahren, auch in der sowjetisch besetzten Zone Arbeitsplätze knapp
waren, mussten auch solche, die einen anderen Beruf erlernt hatten, jede zumutbare Arbeit annehmen. Aus der Heimat
erhielt ich einen Brief, von meiner dort noch lebenden Mutter. Sie schrieb das sie mich noch einmal sehen wollte und
ich sollte doch wieder zurück kommen; Unser Hof wäre nicht von Polen besetzt und sie wäre ganz alleine, weil der Vater
nach dem Durchzug der Front von den Russen erschlagen wurde. Daraufhin habe ich dem polnischen Konsulat in Magdeburg
mitgeteilt, dass ich in Rohmanen eine Landwirtschaft besitze, und um eine Einreisegenehmigung gebeten.
Nach 2 Monaten erhielt ich eine Postkarte, mit der Mitteilung, ich sollte mich persönlich beim Konsulat vorstellen.
Nach Aufnahme meiner Personalien, wurde mir gesagt, das ich benachrichtigt werde wenn mein Antrag genehmigt wird. Ende
Juli 1947 erhielten wir die Einreisegenehmigung nach Ostpreußen, das jetzt unter polnischer Verwaltung stand. Wir
mussten zuerst zum polnischen Konsulat in Berlin-Lichterfelde, wo wir umgeben von einer Trümmerlandschaft, gewartet
haben, bis alle Untersuchungen und Formalitäten erledigt waren.
“ Wieder zurück in Ostpreußen.”
Der schwere Wiederaufbau nach dem Kriege
Dann fuhren wir über Frankfurt/Oder, Posen, Thorn, Allenstein, nach Ortelsburg, wo wir am 2. August 1947 ankamen. Mit
einem zweirädrigen Karren, den ich mir von einem noch in Ortelsburg lebenden Bekanten ausgeliehen hatte und meinem
Sohn Manfred im Kinderwagen fuhren wir nach Rohmanen. Meine Mutter war inzwischen verstorben und auf dem Hof war nur
meine, inzwischen aus Russischer Gefangenschaft wiedergekehrte Schwester, Frieda Pelkowski.

Es war alles ausgeplündert; kein Vieh, keine Maschinen und der ganze Hof mit kniehohem Graß überwachsen. Nur schmale
Trampelpfade, vom Haus zum Holzschuppen und zum Klo, durchkreuzten das satte Grün. Ich habe das Gras auf dem Hof mit
einer Sense, die ich noch gefunden habe, abgemäht, damit der Hof nicht so verwahrlost aussah. Am nächsten Tag habe ich
mich bei der Polizei in Ortelsburg angemeldet, wo ich auch ein Startgeld von 100 Zloty erhielt und Gepäckstücke, die
ich in Krottorf aufgegeben, am Bahnhof abgeholt. Es hat mich sehr gewundert das, das Gepäck überhaupt angekommen ist.
Da man von der Landwirtschaft nicht Leben konnte, habe ich mich in den nächsten Tagen, bei der jetzt polnischen Bahn,
um Arbeit beworben und wurde auch angenommen. Wenn wir unseren Monatslohn bekamen, saß immer einer am Tisch, der von
uns 100 Zloty für den Wiederaufbau von Warschau verlangte. Wenn ich dran war, riefen die Anderen, ich hätte Warschau
zerstört und müsste deshalb 200 Zloty abgeben. Nach 3 Jahren kam eine Verfügung, die besagte, dass wer länger als 1
Jahr bei der Bahn beschäftigt ist, angestellt werden muss. Um diese Bestimmung zu umgehen hat man mich entlassen und
eine Woche später wieder eingestellt.
Als ich vor Ablauf des nächsten Jahres, aus dem gleichen Grunde wieder entlassen wurde, habe ich mich bei der
Stadtverwaltung in Ortelsburg(jetzt Szczytno)beworben, wo ich zuerst im Gaswerk als Heizer und später auf Baustellen
als Zimmermann gearbeitet habe. Wir haben durch den Krieg beschädigte Häuser repariert, in den ehemals touristischen
Zentren einige Ausbesserungen an den Einrichtungen durchgeführt, eine Ziegelei wieder in Betrieb gesetzt und andere
anfallende Arbeiten verrichtet. Im Dach des Rathausturmes war während der Kämpfe eine Granate eingeschlagen, die, die
Dachlatten und die Verschalung zerstört hatte. Da wir, unter schwersten Bedingungen, den Schaden repariert haben,
wurde uns eine Höhenzulage versprochen, die wir aber nicht bekommen haben.
Aus Verärgerung darüber habe ich bei der Stadtverwaltung gekündigt und bei einer Wiederaufbaufirma unter der Leitung
von Bauingenieur Laskowski wieder angefangen, wo ich bis 1954, als Zimmermann beschäftigt war. Ab da habe ich mich
nur um meinen Hof gekümmert, der wegen meiner Arbeitsstellen, gezwungenermaßen, sehr vernachlässigt wurde. Als wir
1947 zurückkamen, brachten wir unseren Sohn Manfred noch im Kinderwagen. Den hat meine Frau zum Markt gebracht,
verkauft, und dafür eine Ziege erworben, die dank guter Pflege, uns täglich mit 4 Liter Milch versorgte. Das war der
erste Baustein zum Wiederaufbau, unserer durch den Krieg zerstörten, und danach ausgeplünderten Landwirtschaft.
Während meiner Arbeit bei der Bahn haben wir uns eine Kuh gekauft, die nach einem halben Jahr, wegen nicht bezahlter
Grundsteuer, vom Gerichtsvollzieher gepfändet wurde. Man hat uns die Kuh weggenommen und bei einem Arbeiter, der in
der Ernst-Mey-Straße in Ortelsburg wohnte und sie wegen nicht vorhandener Futtermittel, nur mit Kartoffelkraut
gefüttert hat, untergestellt. Als ich bei der Bahn meinen Monatslohn bekommen habe, bin ich zur Gmina gegangen, habe
eine Rate angezahlt und durfte dann die Kuh wieder mit nach Hause nehmen. Durch die schlechte Ernährung war die Kuh
stark abgemagert und lieferte nur die Hälfte der ursprünglichen Milchleistung.
Später habe ich ein Pferd auf Abzahlung bekommen, das 140.000 alte Zloty gekostet hat. Die Stute war schwach und unser
Feld sehr hügelig, so dass man nur bergab pflügen konnte, was sehr beschwerlich war, bergauf ging es immer im Leerlauf.
Später habe ich die schweren Böden mit dem Traktor umpflügen, und in den letzten Jahren auch mit dem Binder mähen
lassen. Von der Stute habe ich 2 schöne Fohlen gezogen; ein davon habe ich bei der Ausreise in die Bundesrepublik
mitgebracht und bei der Viehverwertungs-Genossenschaft in Göttingen verkauft. In den ersten Nachkriegsjahren als noch
wenig Land bestellt wurde, breiteten sich auf den nicht beackerten Flächen, Wildkräuter aus. Disteln und andere
Schnellwachsende, erreichten manchmal eine Höhe von 2 Meter, besonders auf den schweren Böden.
Es hat viel Schweiß gekostet ehe man den Acker soweit hatte, das er auch befriedigende Erträge abwarf. Die
Währungsreform von 1950, hat unser weiniges Geld das wir schon gespart hatten, wieder vernichtet. Ich hatte 2 Pferde,
1 Fohlen, 2 Kühe und Schweine, als ich wieder aufgefordert wurde nicht bezahlte Grundsteuern nachzuzahlen. Als ich
nicht bezahlen konnte, hat der Vollziehungsbeamte, ein Fohlen, eine Kuh und ein Schwein gepfändet. Es gelang mir jedoch
nach längeren Verhandlungen, ohne größere Verluste, alles zu regeln. Später kam eine Verfügung, die besagte; wenn
jemand auf seinem Hof nur eine Kuh und ein Pferd hatte, durften sie nicht gepfändet werden. Einige haben ihr Inventar
dieser Verfügung angepasst und dadurch die Zahlung von Grundsteuer umgangen.

Wer seine Steuern pünktlich bezahlt und sein Kontingent an landwirtschaftlichen Produkten fristgerecht abgeliefert hat,
der konnte seine, darüber hinaus erwirtschafteten Produkte zu marktgerechten Preisen verkaufen. Für eine hochtragende
Sterke, mindestens 400 kg schwer, die auf ein staatliches Gut verkauft wurde, konnte man bis zu 12000 Zloty bekommen.
Unsere Böden waren kalkarm, doch durch den Einsatz von Kalk und Kunstdünger konnte man den Ertrag erheblich steigern.
Kalk und Kunstdünger konnte man bei der Genossenschaft(GS) bestellen, der dann auch direkt auf den Hof geliefert wurde.
Kalk wurde geliefert und gleich auf dem Feld ausgestreut. In den 1960ger Jahren waren alle Ackerflächen der Rohmaner
Felder bestellt.
Die nach dem Krieg zurückgebliebenen deutschen Bauernfamilien, aber auch die Polen, die während des Krieges beim Bauern
in Deutschland gearbeitet haben, versuchten mit teils bescheidenen, oder auch zusammen gesuchten, landwirtschaftlichen
Geräten, die bäuerlichen Betriebe aufrecht zu erhalten. Nach den schweren Anfängen in den ersten Nachkriegsjahren
erzielten sie schließlich einen beachtlichen Erfolg, der sich in wogenden Kornfeldern, sowie in grünen Wiesen auf
denen gut genährtes Vieh weidete, widerspiegelte.
Ein schwerer Einschnitt in meinem Leben.
Am 11. Mai 1956 verstarb nach langer schwerer Krankheit, meine liebe Ehefrau Marta Rattay,
geborene Brosch. Ein Jahr zuvor war schon mein Schwiegervater Gottlib Brosch verstorben. Die schweren Bedingungen
unter denen wir nach Kriegende leben mussten, haben ihrer bereits angegriffenen Gesundheit sehr zugesetzt. Sie
verstarb mit 44 Jahren und hinterließ in unserer Familie eine große Lücke, die nicht mehr zu Überbrücken war. Wir
haben sie unter großer Anteilnahme der noch verbliebenen deutschen Bevölkerung zu Grabe getragen und auf dem Rohmaner
Friedhof beigesetzt. Die Arbeit die sie sonst verrichtet hatte fiel jetzt auf mich und meine Söhne zurück. Meine
Schwester Frieda Pelkowski half auch wo sie nur konnte. Wir waren auf die Unterstützung durch Nachbarn und Freunde
angewiesen, die uns immer wenn es nötig war, tatkräftig unterstützt haben. Im laufe der Zeit haben wir wieder zum
Alltag zurück gefunden, haben sie noch etliche Jahre auf dem Friedhof besuchen können, bis wir, bedingt durch unsere
Ausreise uns endgültig von ihr trennen mussten.
Der endgültige Abschied von Ostpreußen
Ab 1956 begannen, durch die Vermittlung des Deutschen Roten Kreuzes, die ersten Ausreisen in die
Bundesrepublik Deutschland. Zuerst waren es Kinder die zu ihren Eltern ausreisen durften, Familien deren Väter aus der
Kriegsgefangenschaft in den Westen Deutschlands entlassen wurden und andere durch den Krieg getrennte
Familienangehörige. Ab 1960 erhöhte sich die Zahl der Ausreisewilligen aus dem polnisch besetzten Ostpreußen. Es setzte
sich die Überzeugung durch, dass unsere Angestammte Heimat, uns für die Zukunft keine Perspektive mehr bieten konnte.
Meistens wurden die Anträge, die wir an die Passabteilung in Allenstein stellen mussten, um einen Ausreisepass zu
bekommen, negativ beschieden. Nach mehrmaligen Versuchen gelang es dann doch, diese begehrte Ausreiseberechtigung in
Empfang zu nehmen. Die Enttäuschung der Zurückgebliebenen war groß, wenn wieder mal Verwandte oder Nachbarn, den Weg
in Richtung Bahnhof einschlugen.
Um einen Reisepass zu beantragen, musste man zuerst eine Einladung von Verwandten aus der Bundesrepublik vorlegen, in
der, diese sich verpflichten mussten, für Unterkunft und Verpflegung der Eingeladenen zu sorgen. Diese Einladung
musste durch ein Amt in der Bundesrepublik beglaubigt werden. Außerdem mussten die Kosten für die Bahnfahrt, ab
polnischer Grenze, bis zum Zielort, beim polnischen Reisebüro ORBIS, in Warschau, in DM eingezahlt werden.
Unseren ersten Ausreiseantrag haben wir 1964, bei der Kommandantur der polnischen Miliz in Allenstein eingereicht, der
nach einer gewissen Zeitspanne, ohne eine uns verständliche Begründung zu nennen, abgelehnt wurde. Gegen diese
Ablehnung wurde ein Widerspruch zugelassen, den wir sofort einreichten. Nach einer weiteren Zeitspanne erhielten wir
wieder eine Ablehnung, gegen die kein Widerspruch mehr zulässig war. Wer seine Ausreiseabsicht nicht aufgeben wollte,
musste einen neuen Antrag stellen. Es gab Familien die schon 10 Mal einen Ausreiseantrag gestellt hatten und immer
wieder abgewiesen wurden. Da meine Söhne, nicht die Absicht hatten in Rohmanen zu bleiben und ich nach 2 Weltkriegen,
an denen ich teilgenommen, die schwere Arbeit auf der Landwirtschaft, nicht aus eigener Kraft schaffen würde, haben wir
1966 wieder einen Antrag gestellt, der prompt abgelehnt wurde. Der Widerspruch auf diese Ablehnung wurde auch negativ
beantwortet, so dass wir 1968 wieder einen Antrag eingereicht haben.
Weil das Passamt in Allenstein lange nichts von sich hören ließ, hegten wir schon die Hoffnung das es jetzt klappen
würde und waren sehr enttäuscht als wieder eine Absage kam. In der Zwischenzeit sind viele Nachbarn und Bekannte aus
Rohmanen, sowie aus der näheren Umgebung, ausgereist und das Häuflein der noch verbliebenen Deutschen, wurde immer
kleiner. Die Motivation, die uns in früheren Jahren, über so manche schwierige Lage hinweg geholfen hat, ist einer
hoffnungslosen Resignation gewichen. Man war davon überzeugt, dass unser Leben, in unser Angestammten Heimat, keine
Zukunftsperspektive mehr haben konnte und wenn wir keine Ausreisegenehmigung bekommen, wir eines Tages die letzten
Deutschen in der ganzen Umgebung sein werden.
Die Ausreise-Heimat ade
Wir hatten die Hoffnung schon aufgegeben, als am 30. April 1969, der Briefträger unseren Hof
betrat und mir einen Brief überreichte, in dem uns das Passamt in Allenstein mitteilte, dass unsere Ausreise in die
Bundesrepublik Deutschland, genehmigt worden ist. Wir müssten, nach Aushändigung der Reisepapiere, den Geltungsbereich
der Volksrepublik Polen, innerhalb von 3 Monaten verlassen. Wir waren zuerst geschockt, über den Hinweis, das wir
unsere Heimat in 3 Monaten verlassen müssen, aber dann stellte sich die Zukunftsperspektive wieder ein und wir gingen,
wie von einem schweren Ballast befreit und gut gelaunt unser weiteren Tätigkeit nach.
Als der Briefträger unseren Hof betrat, waren ich und mein Sohn Kurt gerade dabei eine Fuhre Mist zu laden. Wir hatten
den Wagen gerade halb geladen und haben nach der frohen Kunde nicht mehr weiter gemacht, sondern die Pferde vorgespannt
und den Mist aufs Feld gefahren, damit wir den Wagen für alle Fälle frei hatten. Das war die letzte Tätigkeit für
unsere Landwirtschaft in Ostpreußen.
Die Nachricht von unserer Ausreise verbreitete sich, ohne dass wir darüber gesprochen haben, wie ein Lauffeuer.
Alsbald kamen Leute aus dem Dorf, die sich für das Vieh und für diverse Landwirtschaftliche Geräte interessierten.
Etliche wollten bestimmte Sachen sofort kaufen, andere haben nur zurücklegen lassen und wollten später kommen und
bezahlen, haben es aber dann doch nicht genommen.

Wenn man eine Landwirtschaft hatte, konnte man 2 Pferde, 2 Rinder, 3 Schweine, 5 Schafe und 10 Hühner, in einem
geschlossenen Viehwaggon, in die Bundesrepublik mitnehmen. Jeden Tag war man unterwegs, von einer Behörde zur Andern.
Die Aushändigung der Reisepapiere erfolgte nur nach Vorlage bestimmter Bescheinigungen: Es mussten alle Steuern bezahlt
sein, das Kontingent landwirtschaftlicher Erzeugnisse musste abgeliefert sein, je eine Bescheinigung vom Katasteramt
und vom Notar musste vorgelegt werden, das man dem polnischen Staat das Grundstück abgetreten hat. Die Gebühren für
die notarielle Beglaubigung mussten wir selbst bezahlen. Wenn man alle Bescheinigungen beisammen hatte, bekam man bei
der Kreisverwaltung eine Gesamtbescheinigung. Mit dieser Bescheinigung konnte man nach Allenstein, zur
Polizeikommandantur fahren, wo man nach dem schriftlichen Verzicht auf die polnische Staatsangehörigkeit, einen
Reisepass ausgehändigt bekam, der den Inhaber zum Grenzübertritt berechtigte, aber nicht zur Wiedereinreise.
Wir haben 2 Pferde, eine Sterke, einen Ochsen, 5 Schafe, 2 Schweine und 10 Hühner mitgenommen. Über die Schutzimpfung
der Rinder musste man eine, vom Kreistierarzt beglaubigte Bescheinigung vorweisen. Ich habe 5 Schafsböcke gekauft, die
ich in der Zwischenzeit, hinter der Scheune, zum Weiden angekettet hatte. Einer von denen hat sich losgerissen und
seinen Nachbarn getötet. Das Fleisch konnten wir noch verkaufen, mussten aber dafür einen anderen Schafsbock kaufen.
Innerhalb von 3 Monaten mussten wir alles regeln und zwei Tage vor der Abfahrt einen Eisenbahnwagen, bei der
Eisenbahndirektion in Allenstein bestellen. Reservierungen bei den polnischen Behörden waren meist immer mit
Schmiergeld verbunden, weil man sonst nie sicher sein konnte dass diese Vereinbarungen auch eingehalten werden. Schon
2 Wochen vor unserer Abfahrt, gab es in Ortelsburg keine alkoholischen Getränke zu kaufen. Meine Söhne mussten mit dem
Motorrad die umliegenden Dörfer abfahren, damit wir für die Reise einen Vorrat anlegen konnten; denn Wodka war zu der
Zeit, in Polen, wie eine zweite Währung.
Am 25. Juli haben wir zusammen, mit meinem Neffen Siegfried Brosch, unseren sonstigen Hausrat, der in Kisten verpackt
war, in einen Eisenbahnwagen, auf dem Allensteiner Bahnhof verladen. Alles musste zuerst durch den Zoll, wo die
Federbetten gewogen wurden und über das erlaubte hinausgehende Kissen, verzollt werden mussten. Dasselbe galt auch für
Fleisch und Räucherwaren.
Am 26. Juli, unserem Verladetag, kam der Eisenbahnwagen aus Allenstein, erst um 11 Uhr auf dem Ortelsburger Bahnhof an.
Die Rinder hatten wir zu Fuß, zum Bahnhof gebracht; Schweine, Schafe und Hühner auf dem Pferdewagen. Im Eisenbahnwagen
mussten, mit Hilfe von Brettern und Bohlen, Boxen für die verschiedenen Tiere erstellt werden. Jedes Pferd und jedes
Rind in eine Bucht. Die Schafe zwischen die Pferde, die Schweine zwischen die Rinder und die Hühner in einem Käfig,
unter der Decke über den Rindern. Die Hühner hatten unterwegs Eier gelegt, somit hatten wir jeden Tag frische
Verpflegung. Bei der Fahrt im Viehwagen, begleitete mich mein Sohn Manfred. Als die Lokomotive nahte, um den Wagen
abzuholen, wurden noch schnell die restlichen Sachen hinein geworfen und so mache Abschiedsträne rollte dann die Wange
hinab.
Unsere Nachbarn, Deutsche und Polen, halfen uns beim Verladen des lebendigen Inventars. Jetzt erinnerte ich mich
plötzlich, an die oft auch schönen, Ereignisse der letzten 22 Jahre. Einer Zeit, in der das Zusammenleben von
Deutschen und Polen, von Jahr zu Jahr, besser wurde. Man half sich beim einbringen der Getreideernte, beim Dreschen
des Getreides, bei der Kartoffelernte und bei anderen Arbeiten, wo viele Menschen zupacken mussten. Es war eine
Dorfgemeinschaft, in schweren Zeiten geboren; jeder half jedem wenn Hilfe nötig war. Es wurde mir plötzlich bewusst,
das jetzt ein Lebensabschnitt zu Ende ging, zu dem ich nicht mehr zurückkehren konnte. Unsere Existenzgrundlage war
jetzt ein Eisenbahnwagen auf einem Schienenstrang, dessen Ende irgendwo in weiter Ferne lag. Obwohl, von langer Hand
vorbereitet, war dieser Moment voller Wehmut.
Doch als der Zug sich plötzlich, in Bewegung setzte, war ich sofort wieder in der Gegenwart. Menschen, mit denen man
Jahrzehnte lang, in gutem Einvernehmen zusammen gelebt hat, blieben plötzlich am Bahnsteig zurück und die Entfernung
zwischen ihnen und mir vergrößerte sich mit jeder Sekunde, bis sie letztendlich aus meinem Blickfeld verschwanden.
Es war ein heißer Julitag, als wir unsere Reise gen Westen antraten. Für die Schweine, die besonders unter der Hitze
zu leiden hatten, haben wir 10 Flaschen Essig mitgenommen und sie von Zeit zu Zeit besprenkelt, damit sie besser atmen
konnten. Für die anderen Tiere war reichlich Heu und Hafer vorhanden. Eine großes Fas und zwei Milchkannen waren mit
Wasser gefüllt, die wir auf den an der Strecke liegenden Bahnstationen, bei Bedarf wieder nachgefüllt haben.
Da der Kreistierarzt nicht in seinem Büro war, konnten wir die Impfbescheinigung für das Vieh, nicht rechtzeitig
herbeischaffen. Der Zug setzte sich in Bewegung und die Bescheinigung war immer noch nicht da. Als die Bescheinigung
dann eingetroffen, wir aber schon unterwegs waren, ist mein Sohn Kurt mit dem Motorrad hinterher gefahren und hat uns
in Passenheim, wo der Zug noch andere Wagen angehängt bekam, die Impfbescheinigung übergeben. Wir waren sehr froh das
er es noch geschafft hat, denn in solch einer Situation fühlt man sich sicherer wenn man alle Bescheinigungen bei sich
hat. Auf der Rückfahrt, mit dem Motorrad hatte er noch eine Panne, musste das Motorrad stehen lassen und per Anhalter
nach Hause fahren. Am nächsten Tag kam er mit Siegfried Deptolla, der das Motorrad wieder flott machte und brachte es
wieder nach Rohmanen zurück.
Die Fahrt mit dem Viehwagen, gen Westen
Von Ortelsburg bis Allenstein(45 km) hat unser Zug 4 Stunden gebraucht, weil auf jedem Bahnhof
gehalten wurde, um neue Wagen anzuhängen. Nachdem wir in Allenstein angekommen waren, kam ein Rangierer und fragte
nach unserem Ziel. Als wir ihm mitteilten, das wir in die Bundesrepublik Deutschland wollen, sagte er nur: „In 10
Minuten fährt ein Zug los. Wenn ich von euch 500 Zloty und einen Liter Wodka bekomme, werde euch sofort anhängen,
andernfalls kommt ihr auf ein Nebengleis und müsst dann auf den nächsten Zug warten. Es blieb uns nichts anderes übrig
als seiner Forderung nachzukommen, denn über derartige Erpressungen hat man bereits von Anderen, die vor uns ausgereist
sind, gehört. Wir wurden auch sofort angehängt und fuhren dann die ganze Nacht, an Osterode, und Thorn vorbei bis
Gnesen. Dort wurde wieder rangiert.
Von einer Anhöhe wurden die einzelnen Wagen auf verschiedene Gleise verteilt und zu neuen Zügen zusammengestellt. Der
Aufprall der ungebremsten Wagen erzeugte eine derartige Erschütterung, dass manche Bretter an den Boxen geborsten waren.
Von Gnesen ging es dann in einem Zuge durch bis zur Grenzstation Reppen(Rzepin). Dort mussten wir zum Zollamt, wo
unsere Ausfuhrpapiere durch die Zollbeamten, und durch einen Tierarzt geprüft wurden. Bis Reppen(Rzepin) haben wir für
den Eisenbahnwagen 900 Zloty bezahlt; hier mussten wir noch einmal 650 Zloty bezahlen. Bei der Wagenkontrolle erklärte
uns ein Bahnbeamter das unser Wagen, sich nicht für den internationalen Transport eignet und wir deshalb den Inhalt in
einen Anderen umladen müssen, der irgendwann, auf dem Nebengleis bereitgestellt wird. Nach langer Verhandlung, sowie
einer Zulage von 500 Zloty und einem Liter Wodka haben wir ihn davon überzeugt, das der Wagen sich doch für die
Weiterfahrt eignet.
In der Nacht war Schichtwechsel, der unseren Wagen wieder abgehängt hat, weil er angeblich von der Reichsbahn der DDR,
wegen technischer Mängel nicht weiterbefördert würde. Wir mussten unsere Verhandlung vom Vorabend wiederholen, die mit
der Zusage endete, dass wir am frühen Morgen, über die Grenze auf DDR Gebiet, gebracht werden. Um 5 Uhr morgens kam
eine Lokomotive, die uns den letzten Abschnitt bis über die Grenze bringen sollte. Als der Zug hat noch einmal anhielt,
kamen polnische Grenzbeamte und Soldaten in den Wagen. Sie durchsuchten ihn und fragten, ob wir noch polnisches Geld
oder einen Grundbuchauszug bei uns hätten. Wir zeigten ihnen 800 Zloty, die sie uns, nach Ausstellung einer Quittung
über 500 Zloty, abnahmen. Die Grundbuchauszüge habe ich, im Stroh versteckt, dem Ochsen vor die Füße gelegt. Falls
jemand da suchen sollte, hätte ich gesagt, das das Tier bösartig veranlagt ist, und ich für seine Sicherheit nicht
garantieren könnte, deshalb sollte er vorsichtig sein.
Als die Grenzkontrolle den Zug verlassen hatte, setzte sich die Lokomotive wieder in Bewegung und überquerte nach
kurzer Zeit die Oderbrücke. Auf einer eingezäunten Fläche, jenseits der Grenze, hat man uns abgestellt hat und die
Lokomotive fuhr zurück auf polnisches Gebiet. Vor und hinter uns waren die Tore verschlossen. Auf den Wachtürmen,
links und Rechts von uns, standen Posten mit einem Gewehr im Anschlag. Vier Grenzbeamte der DDR, jeder mit einer
Leiter in der Hand, sowie ein Schäferhund, kamen zu unserem Wagen. Sie öffneten die Schiebetüre, stellten die Leiter
davor und ließen den Hund in den Wagen springen, der nur etwas herum schnupperte und wieder heraussprang. 2 Beamte
haben dann anschließend, die Papiere kontrolliert und das Inventar gezählt.
Nach einiger Zeit wurden wir an einen Güterzug der Reichsbahn angehängt und fuhren von Frankfurt an der Oder, vorbei
an Berlin, Ellingen und Nordhausen, über die Grenze zur Bundesrepublik bis Herzberg. Hier hat ein Zollbeamter der
Bundesrepublik, die Formalitäten erledigt und ein Tierarzt die Pferde, Rinder und Schweine gründlich untersucht. Ich
musste ihnen die Mäuler aufhalten und die Füße hochheben. Danach hat uns die Lokomotive zu einer Wasserzapfstelle
gebracht, wo wir die Tiere tränken und unsere Behälter mit Wasser auffüllen konnten. Anschließen fuhren wir über
Northeim nach Göttingen, zur Viehverwertungsgenossenschaft, die zuvor von unserer Ankunft in Kenntnis gesetzt wurde.
Der Ochse, die Sterke und die Schweine wurden, in Göttingen zum Schlachthof gebracht; die Pferde kamen nach Hannover
und die Schafsböcke nach Kassel. Wir waren mit dem Viehtransport 5 Tage unterwegs; hatten so manche Klippe umschifft
und Schwierigkeiten gemeistert, die im normalen Leben nicht vorkommen.
Wir wurden mit einem PKW, ins Durchgangslager Friedland bei Göttingen gefahren, wo mein Sohn Kurt, meine Schwester
Frieda Pelkowski und Siegfried Brosch mit Familie, die am 30 Juli, um 14 Uhr, von Warschau mit dem Zug abgefahren, und
hier am 31. Juli in den Morgenstunden eingetroffen sind, schon auf uns gewartet haben. In Friedland hat man uns mit
Familie Siegfried Brosch in einem Raum untergebracht, wir wurden registriert und erhielten 20 DM Überbrückungsgeld,
pro Person. Da wir erst am Freitag in Friedland eingetroffen sind, mussten wir hier über das Wochenende bleiben,
obwohl die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der Regel nur 3 bis 4 Tage beträgt.
Um einen Antrag für die Ausreise stellen zu können, brauchten wir eine Einladung von in der Bundesrepublik lebenden
Verwandten. Diese Einladung hat uns mein Bruder, Ernst Rattay, aus Ingelheim am Rhein zugeschickt. Ingelheim liegt im
Bundesland Rheinland-Pfalz. Das Geld für die Bahnfahrt, hat uns, Frieda Schellin, geb. Nickel, aus Duisburg, die
Tochter unseres Nachbarn, überwiesen. In Friedland wurden wir registriert. Im Registrierschein, war als unser
nächster Aufenthaltsort in der Bundesrepublik, das Durchgangslager Osthofen bei Worms, das alle Aussiedler für
Rheinland-Pfalz aufnehmen musste, eingetragen. Die Eintragung erfolgte deshalb, weil der Ort aus dem uns unsere
Einladung zugeschickt wurde, sich auch in Rheinland-Pfalz befand.
Da ich nach dem Polenfeldzug, als Soldat, ein Jahr im Kreis Opladen, im Rheinland gewesen bin, wäre ich sehr gerne in
diese Gegend gezogen, denn die Erinnerung an die schönen Tage die ich dort verlebt habe war in mir immer noch wach.
Ich versuchte die Eintragung in unseren Regiestierscheinen ändern zu lassen, was nach einigen, vielleicht auch
berechtigten Einwänden, am 4. August, vom Beauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen, genehmigt wurde. Anstelle von
Rheinlad-Pfalz stand da jetzt Nordrhein-Westfalen und am 7. August, fuhren wir, noch mit anderen Aussiedlern, ins
Durchgangslager Unna-Massen, am östlichen Rande des Ruhrgebietes gelegen. Hier wurden wir in einem Zimmer untergebracht
und konnten unser Essen in einer Gemeinschaftsküche zubereiten.
Am 8. August wurden wir in Unna-Massen, als Bürger der Bundesrepublik Deutschland registriert, erhielten
Einhundert DM Begrüßungsgeld, den Vertriebenen Ausweis -A -und 4 Wochen später den Bundespersonalausweis. In
Unna-Massen haben wir mehr als 4 Monate verbracht, weil mein Sohn Kurt, wegen fehlender Berufsausbildung, in Unna, an
einem Grundlehrgang für Metallarbeiter teilgenommen hat, der vom Arbeitsamt finanziert wurde. Am 11 Dezember 1969 sind
wir endlich an unserem vorläufigen Wohnsitz, im Durchgangswohnheim, an der Elisabethstraße 13, in Velbert angekommen.
Ab dem 5. Januar 1970 konnten meine Söhne, in der Zahnradfabrik Reining, in Velbert ihrer geregelten Arbeit nachgehen.
Von Bau- und Sparverein in Velbert wurde uns am 20. Juni 1970, unsere erste Wohnung zugewiesen.
Velbert im Februar 1972
gezeichnet: Gustav Rattay
Die älteste Familie in Rohmanen war die Familie Friedrich Biella. Wie ich mich noch erinnern kann war sein Vater
Gemeindevorsteher. Nach seinem Tode hat das Amt sein Sohn Friedrich übernommen bis er 1914 als Unteroffizier in den
ersten Weltkrieg einrücken musste. Friedrich Biella hat aktiv bei der Garde in Berlin gedient. Bei den Wahlen und bei
der Abstimmung 1920 hat er sich sehr für den Erhalt des Deutschtums eingesetzt. Er hat auch im Jahr 1896, die
Freiwillige Feuerwehr in Rohmanen ins Leben gerufen und war zugleich ihr erster Brandmeister. Bei der Genossenschaft
und bei der Darlehenskasse war er im Vorstand. Dadurch war es ihm möglich die Rohmaner Bauern mit Krediten und
Kunstdüngern zu versorgen. Die Söhne Fritz und Wilhelm hat er aufs Gymnasium nach Ortelsburg geschickt und studieren
lassen. Bei Bauernversammlungen hat uns Fritz Biella Vorträge gehalten.
Eine weitere Familie war die des Gasthofbesitzers Friedrich Trzaska. Der Hof von Friedrich Trzaska war der älteste in
Rohmanen. Wenn die Bauern aus weiter gelegenen Dörfern, vom Wochenmarkt nach Hause fuhren, hielten sie oft an der
Gaswirtschaft an. Die Pferde, sowie die auf dem Markt eingekauften Rinder wurden dann, an einem vor dem Haus
angebrachten Querbalken festgebunden und die Besitzer machten es sich in der Gaststube gemütlich. Zwei große
Kastanienbäume standen zu beiden Seiten der Eingangstreppe und weiter rechts war ein großes Fenster, in dem, die im
Geschäft vorrätigen Artikel, ausgestellt waren; besonders zur Weihnachtszeit. Die Kinder drückten sich an der Scheibe
die Nase platt, um die vielen schönen Sachen, die sich die meisten Dorfbewohner nicht leisten konnten, wenigstens aus
der Nähe zu bestaunen.
In der Gaststube wurde Korn, sowie auch guter Bärenfang ausgeschenkt, und wenn es den Gästen gut geschmeckt hat, haben
sie es lange ausgehalten, so das für eine weitere Rast, in einem der nächsten Dörfer keine Zeit mehr übrig blieb. Die
alten Bauern erzählten auch; das es in ganz Ortelsburg, keinen so guten Schnupftabak gab, wie im Gasthof Trzaska. Zu
diesem Grundstück gehörte einst auch der Rohmaner See. Weil dafür keine Steuern gezahlt wurden hat sich der Besitzer
von Gut Frenzken den See angeeignet.
Als Königsberg zur Festung ausgebaut wurde, haben viele Männer dort Arbeit gefunden. Zu dieser Zeit war an eine
Beschäftigung im Kohlenbergbau, in Westfalen, noch nicht zu denken. Weil auch noch keine Eisenbahnlinie vorhanden war,
mussten sie den weiten Weg zu Fuß zurücklegen. Nachdem sie den ganzen Tag marschiert sind, haben sie in der Nacht ein
Feuer angezündet, eine Malzeit zubereitet und in der Nähe des Feuers, das sie vor wilden Tieren schützen sollte,
übernachtet. Die Reise nach Königsberg hat eine ganze Woche gedauert. Sie wurden dort zum Aufschütten der
Festungswälle eingesetzt.
Das Jahr 1914 wurde zum Schicksalsjahr, für Ostpreußen und seine Bevölkerung. Nach Abschluß der Volksschule im Jahr
1912, habe ich in den Wintermonaten einen Fortbildungslehrgang für die Landwirtschaft besucht, den Hauptlehrer Aaron,
der aus Olschienen nach Rohmanen versetzt wurde, für uns organisiert hatte. Da im Dorf 2 Trompeten vorhanden waren,
hatte er uns nahe gelegt eine Kapelle zu gründen, dann könnten wir ja die Soldaten, die aus dem Krieg heimkehren
würden mit Musik empfangen. Zum Abschluss konnte man sich ein Buch oder ein Obstbäumchen wünschen. Eine Woche vor dem
Einmarsch der Russen, haben wir noch mit einem Breitdrescher, der durch ein Rosswerk dass von 6 Pferden angetrieben
wurde 110 Zentner Roggen gedroschen. Der Lehrer Malayka hat sich 1914 freiwillig zum Militär gemeldet. 1915 hat er uns
als Offiziersanwärter besucht. Im Frühjahr 1916 wurde mein Jahrgang gemustert und im Herbst 1916 wurden wir eingezogen.
Ausbruch des Ersten Weltkrieges
Am 2. August 1914 wurde die Allgemeine Mobilmachung ausgerufen. Alle wehrfähigen Männer folgten
dem Ruf des Kaisers und eilten zu den zuständigen Wehrmeldeämtern um die Grenzen des Vaterlandes zu schützen. Wir als
Grenzbewohner bekamen das Meiste zu spüren. Alle Häuser, Scheunen und Ställe waren mit Soldaten und ihrem Tross belegt.
Die Einen gingen, die Anderen kamen. Die Kosaken hatten bei Muschaken und Radzinen die Grenze überschritten. Der
Flüchtlingsstrom hatte sich von der Grenze her angestaut. Die Russen haben überall geplündert. Die Trosse mussten sich
zurückziehen und haben dazu vorwiegend die Feldwege benutzt. Die Pferde waren erschöpft. In einer Nacht kam der
Gemeindevorsteher mit einem deutschen Offizier auf unseren Hof. Mein Vater und der Nachbar Wilhelm Dorka mussten mit
ihren Pferden aushelfen. Sie waren 2 Tage unterwegs, bis zu einem Gut in Kleeberg bei Allenstein. Als sie dann wieder
nach Hause kamen waren die Russen schon am Rohmaner Friedhof. In der Zwischenzeit hatten wir schon den Leiterwagen mit
Mehl, Rauchfleisch und Betten beladen.
Der überwiegende Teil der Rohmaner war schon losgefahren. Der Hauptlehrer Müller kam noch mit dem Fahrrad vorbei und
sagte es wäre höchste Zeit das wir wegkämen weil die Russen schon Ortelsburg besetzt hätten und im Anmarsch auf
Rohmanen wären. Wir sind auf eine Anhöhe gestiegen und haben die Staubwolken beobachtet, aber wir dachten es wäre
deutsches Militär.
Auf der Flucht vor den Russen
Kurz vor Sonnenuntergang haben wir die Pferde vor den fertig gepackten Wagen gespannt und sind
sofort losgefahren. Mein Bruder und ich nahmen 4 Milchkühe und die beste Sterke mit und gingen hinterher. Schweine,
Kälber und Geflügel haben wir aus den Ställen getrieben. Wir waren die ganze Nacht unterwegs und sind bis Rheinswein
gekommen. Da hatten wir einen Onkel wohnen, bei dem haben wir den ganzen Tag verbracht.
Unterwegs haben wir einen Mann getroffen, der erzählte uns dass die Russen bei Groß Jerutten einen Personenzug
überrumpelt haben. Sie hatten aus Eisenbahnschwellen eine Sperre auf den Schienen errichtet und somit den Zug zum
Anhalten gezwungen. Die Russen haben den Zug mit Artillerie beschossen. Als die Soldaten und Zivilisten den Zug
verlassen wollten kamen die Kosaken zu Pferde und haben ein Massaker angerichtet. Nur wer sich am Boden davon
schleichen konnte hat überlebt. Die Russen wurden durch einen Verräter darüber informiert das auf diesem Gleis ein
Zug unterwegs war und waren darauf vorbereitet. Unserem Informanten ist es auch gelungen dem Massaker zu entkommen.
Ein Kosake hatte ihm im beim vorbeireiten mit dem Säbel ein Ohr abgehauen und ihn dadurch zu Boden geschlagen. Es ist
ihm danach gelungen ins Gebüsch zu schleichen. Sein Kopf war schon verbunden als wir ihn trafen. Später wurde an der
Stelle des Überfalls ein Gedächtnisstein errichtet.
Im Morgengrauen sah man viele Kosaken über die Felder reiten. Wir sind dann später wieder weiter in Richtung
Jellinowen gefahren. Unser Vater ist mit dem Pferdewagen die Landstraße entlang gefahren. Wir mit dem Vieh sind
entlang einer tiefen Schlucht durch den Wald bis zum Babanter See gegangen. Wir hatten schon vorher versucht die
Schlucht zu verlassen aber wegen der steilen Hänge ist es uns leider nicht gelungen. Am See angekommen fanden wir drei
große Schober mit Getreide vor. Von einem dieser Schober haben uns zwei Kosaken mit einem Fernglas beobachtet. Sie
schwangen sich auf ihre Pferde und kamen uns entgegen geritten, dann hielten sie uns ihre Lanzen vor die Brust und
versuchten uns auszufragen. Wir haben leider nichts verstanden und fingen an zu weinen. Plötzlich pfiff der
Patrollienführer auf einer Trillerpfeife und die Kosaken kehrten zu ihrem Ausgangspunkt zurück.
Als wir dann weiter am See entlang gingen sahen wir von weitem drei Gehöfte. In der Nähe einer dieser Höfe hatte unser
Vater den Pferdewagen im Gestrüpp abgestellt. Die vorrückenden Schützenlinien der russischen Infanterie hatten ihn
jedoch entdeckt. Sie haben den Wagen durchwühlt und den Sack mit Rauchfleisch mitgenommen. Andere Flüchtlingswagen die
in diesem Gebüsch Schutz gesucht haben sind nicht besser davon gekommen. Wir haben das Vieh auf einen der Höfe
getrieben und am Zaun festgebunden. Dann haben wir mit Hilfe einer Leiter den Heuboden erklommen und uns dort versteckt.
Als die Kosaken auf dem Hof erschienen verlangten sie Brot und Milch. Die Frauen mussten zuerst essen und trinken,
danach haben es die Russen auch getan, sie fürchteten sich davor, dass man sie vergiften könnte. Später kam dann die
russische Infanterie und hat Haus, Scheune und Schuppen durchsucht. Die Falltüre zum Heuboden ließ sich nur nach oben
hin öffnen. Wir hatten die Türe von oben mit schweren Gegenständen beschwert, aber die Russen versuchten mit aller
Gewalt auf den Heuboden zukommen. Als die Frauen das sahen, sagten sie zu den Russen, da oben würden sich ihre Kinder
versteckt halten. Die Russen forderten nun, die Kinder sollten sofort den Heuboden verlassen. Die Mütter riefen nun
nach ihren Kindern die dann auch tatsächlich den Heuboden verließen. Als wir das sahen, haben wir uns am Giebel tief
im Heu vergraben. Drei Russen kamen nun rauf und stocherten mit ihren Bajonetten im Heu herum. Glücklicherweise kamen
sie nicht in unsere Nähe. Als die Russen den Heuboden verließen haben wir befürchtet sie würden ihn in Brand setzen.
Wahrscheinlich taten sie deshalb nicht weil so viele russische Soldaten auf dem Hof waren. Einige Zeit später
erschienen russische Offiziere auf dem Hof, mit einem Auto. Sie sagten, sie hätten das Land erobert und wir hätten ab
sofort dem russischen Zaren zu gehorchen. Wir wurden angewiwsen nach Hause fahren und unbesorgt unsere Ernte
einzubringen. Sie haben uns auch eine Bescheinigung ausgestellt, damit uns auf dem Heimweg niemand die Pferde und
das Vieh wegnehmen würde.
Erst am nächsten Morgen, als die Front weiter vorgerückt war, beschlossen wir die Heimreise anzutreten. Die Straßen
waren mit vorrückenden russischen Truppen blockiert. Manchmal mussten wir stundenlang am Wegesrand warten bis die
Soldaten mit ihrem Tross vorbeigezogen waren. Unterwegs wollten sie unser Vieh zum Schlachten wegnehmen, aber die
Bescheinigung hat uns davor bewahrt. Die Eisenbahnbrücke vor Neu-Keykuth wurde von Kavallerie bewacht. Die wollten uns
nicht drüber lassen und hielten uns bis zum frühen Morgen fest. Zurück in Rohmanen angekommen, konnten wir unser Haus
nicht betreten weil der Hof und alles rundherum ein großes Militärlager war.
Wir sind dann in Richtung Seelonken gefahren, bis Abbau Brosch. Auf dem Hof angekommen haben wir zuerst Grünfutter für
die Pferde vom Feld geholt und anschließend Mittag für uns selbst gekocht. Die Nacht haben wir erstmal auf dem Hof
verbracht. Am nächsten Morgen wagten wir es ins Dorf zu gehen um die Lage zu erkunden. Die Russen waren schon wieder
weiter gezogen, aber Haus und Hof waren in einem schrecklichen Zustand. Wir sind dann gegen Abend wieder nach Hause
zurückgekehrt.
Am 23. August 1914 waren die Russen bei uns eingebrochen, bis sie am 28. August von den Deutschen zurückgeschlagen
wurden. Dann fuhren sie wieder zurück, drei Wagen nebeneinander. Ortelsburg brannte lichterloh. Ein Wagen mit Mehl war
uns gegenüber in den Straßengraben gekippt, aber wir haben nichts davon genommen, weil man ja nicht wusste ob man die
Nacht überleben würde. Wir saßen die ganze Zeit im Keller. Am nächsten Morgen zog dann russische Kavallerie und
Infanterie durch unser Dorf. Die Kavallerie ritt orientierungslos hin und her. Die Infanterie hat den ganzen
Vormittag 1,5 Meter tiefe Schützengräben ausgehoben. Um 11 Uhr kamen aus Richtung Eichtal 3 deutsche Spähwagen nicht
ahnend dass die nördliche Hälfte des Dorfes noch von Russen besetzt war. Wir haben zu diesem Zeitpunkt auf dem
Dachboden Weizen eingesackt und hatten aus diesem Grunde einen weiten Rundblick.
Um 11 Uhr kamen aus Richtung Eichtal drei deutsche Spähwagen angefahren. Als wir die deutschen Soldaten erkannt hatten,
haben wir sie durch Handzeichen gewarnt weiter nach Norden vorzustoßen. Die Kosaken hatten sich auf den Häuserdächern
positioniert und in Richtung Norden nach deutschen Truppen Ausschau gehalten. Die Deutschen sprangen von den Spähwagen
und fingen an die nichts ahnenden Russen zu beschießen. Als die sich ihrer gefährlichen Lage bewusst wurden verließen
sie ihre Aussichtsposten und bestiegen ihre Pferde. Mit Peitschenhieben versuchten sie, die sich in panikartiger Flucht
befindliche Infanterie dazu zu Bewegen, die Deutschen anzugreifen. Zwei Spähwagen wendeten sofort, der Dritte konnte
nicht mehr umkehren. Es gelang allen, bis auf den Fahrer des dritten Wagens die Flucht. Die Russen nahmen ihn sofort
unter Beschuss, doch es gelang ihm über unseren Hof zu entkommen. Auf der rückwärtigen Seite schlug er sich quer durch
die Gärten bis zum Gehöft von Friedrich Sakowski durch. Der versteckte ihn im Keller und versorgte ihn anschließend
mit Zivilkleidung.
Als die Russen den Soldaten auf unseren Hof laufen sahen nahmen sie sofort die Verfolgung auf. Sie durchstöberten auch
die Nachbarhäuser und trieben die Bewohner auf der Straße zusammen. An der Spritzenwagenremise richteten sie einen
Sammelpunkt ein. Unter dem Vorwand es würde hier eine Schlacht stattfinden, versuchten die Russen die Zivilbevölkerung
aus dem Dorf zu drängen. Alle die dem Aufruf gefolgt sind und an unserer Sammelstelle vorbeikamen wurden unserem Haufen
hinzugefügt. Unter ihnen befand sich auch der deutsche Soldat in Zivilkleidung. Er hatte einen Sack über die Schulter
geschlagen in dem sich ein Brot befand, an der anderen Hand führte er eine Kuh am Strick. Als unser Haufen schon aus
etwa 50 Leuten bestand setzten uns die Russen mit Marschrichtung Seelonken in Bewegung. Wir Jungen versuchten in einem
unbeaufsichtigten Moment wegzulaufen, doch die Begleitmanschaft prügelte uns mit Gewehrkolben wieder in Reihe und Glied.
Unterwegs gelang es dem Soldaten mit der Kuh unbemerkt zu entkommen. Er kehrte unbehelligt ins Dorf zurück und lieferte
die Kuh wieder dort ab wo er sie entführt hatte.
Uns haben die Russen an Seelonken vorbei zum Sylvensee getrieben. Wenn sie von vorbeiziehenden russischen Offizieren
gefragt wurden weshalb wir unterwegs wären, sagten sie denen wir hätten deutsche Soldaten versteckt und wollten das
Versteck nicht verraten. Als wir am See vorbei waren begann die deutsche Artillerie aus Richtung Ortelsburg zu
schießen. Unweit von uns explodierten Granaten und richten ein großes Chaos unter Freund und Feind an. Es hieß dann
rette sich wer kann. Die Russen verließen uns in Richtung Waldpuschsee und wir kehrten orientierungslos nach Seelonken
zurück. Nach Rohmanen konnten wir nicht zurück weil die deutsche Artillerie aus Richtung Eichtal anfing unser Dorf zu
beschießen. Schließlich sind wir auf dem Abbau Brosch untergekommen. Ein durch Granatsplitter schwer verletzter Russe
suchte dort auch Zuflucht. er versucht sich mit einem Messer das Leben zu nehmen. es gelang den Frauen ihn davon
abzubringen, weil sonst bei einem etwaigen erscheinen von russischen Soldaten der Verdacht auf uns gefallen wäre.
Später erschienen tatsächlich Kosaken die ihn dann mitgenommen haben. Ihnen folgten in 50 Meter Entfernung Deutsche
Ulanen, die hinter den Russen in einem in der Nähe liegenden Wäldchen verschwanden.
Nachdem die Russen Rohmanen besetzt hatten, versteckten sie sich vorwiegend in mit Stroh gedeckten Gebäuden. Durch
Schießscharten, die sie im Strohdach anlegten, schossen sie auf die deutschen Kampfverbände, die sie wieder vertreiben
wollten. Um die Angreifer zu entlasten, wunde das Dorf von deutscher Seite unter Beschuss genommen. Durch die
Geschosse der deutschen Artillerie entstanden in Rohmanen viele Brände. Die mit Stroh gedeckten Gebäude fielen zuerst
in Schutt und Asche. Unser Vater hatte uns ins Dorf geschickt, damit wir das Vieh im Stall von der Kette losbinden
sollten. Am Dorfrand kamen uns schon deutsche Ulanen und Husaren entgegen. Rohmanen brannte an mehreren Stellen. Unser
Hof war noch unversehrt, nur die Zäune standen schon in Flammen. Wir haben das Vieh los gebunden und anschließend
versucht die Brandherde rund herum zu löschen. Es gelang uns die Flammen von unserem Hof fernzuhalten und auch bei
unserem Nachbarn einzugreifen. In vielen Scheunen und Ställen hatten sich noch viele versprengte Russen versteckt. Die
wurden anschließend von deutschen Soldaten eingesammelt und in Gefangenenlager abgeführt. Am nächste Tag haben wir dann
zerbrochene Gewehre und Munition in Körbe gesammelt und im Dorfteich versenkt.
Am 29. August haben die Russen Rohmanen verlassen, doch schon am 30. August sind sie wieder zurückgekehrt. Hauptlehrer
Müller wurde mit seinem Sohn und Karl Deptolla auf Fahrrädern fahrend von einer russischen Patrouille aufgegriffen.
Sie wurden von den Russen der Spionage verdächtigt weil der Lehrer Müller ein Fernglas bei sich trug. Der Sohn hatte
eine Gymnasiastenmütze und eine Landkarte bei sich. Sie wurden in Richtung Lehmanen abgeführt. Auf einer Anhöhe des
Grundstücks von Ernst Chittka befand sich eine nicht mehr betriebstaugliche Windmühle. Dort soll ein russisches
Kriegsgericht sie zum Tode verurteilt haben. Nach der Hinrichtung wurden sie in der Nähe der Windmühle verscharrt.
Später wurden sie wieder ausgegraben, in Särge gelegt und auf dem Rohmaner Friedhof beigesetzt. Die Ehefrau von Lehrer
Müller hat die Gräber nach dem 1. Weltkrieg mit einem schmiedeeisernen Zaun umrandet.
Die Kämpfe um Rohmanen haben viele Menschenopfer gekostet. Bei uns hinter der Scheune lagen 2 tote Russen und ein
Verwundeter. Die Toten haben wir in einer Kartoffelmiete vergraben. Alle anderen Gefallenen wurden auch gleich an der
Stelle an der sie zu Tode kamen verscharrt und mit einem Kreuz gekennzeichnet. Für die im Raum Rohmanen gefallenen
Russen wurde nach dem Krieg hinterm Dorf, in Richtung Ortelsburg, auf einer Anhöhe ein Heldenfriedhof angelegt. Dort
liegen 20 Soldaten und 1 Offizier. In der Mitte befindet sich ein Trauerbaum und Birken säumen den Zugang von der
Landstraße her. Der Lehrer Dorka hat nach dem Kriege, mit seinen Schülern immer die Gräber gepflegt.
Meine Einberufung zum Militär

Bis zu meinem 17. Lebensjahr habe ich meinem Vater in der Landwirtschaft geholfen. Im Frühjahr
1916 wurde unser Jahrgang gemustert. Im Herbst 1916 erhielten Gustav Spektor, Johann Resonek und ich einen
Einberufungsbescheid. Wir mussten uns in Allenstein im Kaisergarten melden. Dort wurden Rekruten aus mehreren
Landkreisen zusammen gezogen und danach verschiedenen Ausbildungszentren zugeteilt. Wir Rohmaner kamen zum 18.
Infanterie-Regiment nach Osterode. Ein Unteroffizier mit einer Gruppe Musketiere haben uns von Allenstein abgeholt.
Als wir in der Kaserne ankamen haben wir sofort Mittagessen in Blechnäpfen bekommen. Untergebracht wurden wir im
Dachgeschoß der Kaserne. Es waren keine Betten vorhanden, nur Strohsäcke lagen auf dem Boden.
Als dann einige Tage später ausgebildete Kompanien an die Front ausrückten durften wir in einen anderen Block umziehen.
Wir wurden der Größe nach aufgestellt, in Korporalschaften eingeteilt und dann von Kopf bis Fuß eingekleidet. Die
Ausgehuniformen hatten blanke Knöpfe dazu einen Schako mit blanker Spitze. Im neuen Block hatten wir 2stöckige Betten.
Unsere Zivilbekleidung mussten wir in einen Karton verpacken und nach Hause schicken. Dann erst begann das eigentliche
Kasernenleben. Die Kaserne durfte niemand ohne Erlaubnis verlassen, nur in Begleitung eines Unteroffiziers. In der
Kaserne war eine Kantine in der man alles kaufen konnte was in der Kaserne gebraucht wurde.
Am nächsten Tag kam unser Kompanieführer, im Range eines Hauptmanns, zu Pferde angeritten. Er begrüßte uns mit;
Guten Morgen Kameraden, wir antworteten ihm mit; Guten Morgen Herr Hauptmann. Er hat dann die Front abgeschritten und
jeder musste sich mit seinem Namen vorstellen. Um 5 Uhr wurde geweckt, 6 Uhr Kaffee holen, 7-8 Uhr Unterricht, 8-11
Uhr exerzieren auf dem Kasernenhof. Um 11.30 blies der Trompeter zur Mittagspause. Die erste Zeit war noch alles
ziemlich gemütlich aber dann wurde es von Tag zu Tag strenger. Um 10 Uhr abends war Zapfenstreich, dann ging der
Unteroffizier vom Dienst von Stube zu Stube, der Stubenälteste musste die Anwesenheit aller Rekruten melden; zum
Beispiel: Stube 56 belegt mit 14 Mann, alle zu Haus. Wir mussten in 2 Reihen antreten, mit Drillichanzug bekleidet
und in Pantoffeln, ein tadelloses Aussehen präsentieren. Der Diensthabende Unteroffizier prüfte ob alle
vorschriftsmäßig angezogen, gewaschen, gekämmt und ob alle Knöpfe an der Jacke geschlossen waren. Als er bei einem
Rekruten einen offenen Knopf erspähte, hat er uns gefragt, ob jemand ein Taschenmesser bei sich hat.
Wir ahnten nicht Gutes, darum haben wir uns ganz still verhalten und nichts gesagt. Da sagte der U.v.D. plötzlich:
”Wenn niemand von euch ein Messer bei sich hat, dann habe ich ein”. Er zog sein Messer aus der Tasche und fing an, bei
dem Rekruten die Knöpfe abzuschneiden. Als die Knöpfe zu Boden purzelten, brachen wir in lautes Gelächter aus. Das hat
ihn so in Rage gebracht, das unser unwürdiges Benehmen, zuerst mit einem „Donnerwetter” bestraft wurde. Dann schrie
er: ”In den Korridor marsch, marsch, die Treppen runter bis auf den Hof”. Als wir unten angekommen waren hieß es
wieder; "Zurück auf die Stube in der 3. Etage”. Jemand hat mir bei dem Durcheinander, von hinten in den Pantoffel
getreten, so das er auseinander gerissen wurde. Ich bin dann nur mit einem Pantoffel und einem Socken die Treppen rauf
und runter gelaufen. So wurden wir 3-mal hinunter und wieder hinauf gejagt.
Danach ließ er uns wieder antreten und hat mit einer Taschenlampe unter den Betten geleuchtet. Plötzlich schrie er
wieder los: "Das nennt ihr Fegen? wenn ihr mit dem Besen nicht fegen könnt, dann mühst ihr das mit eueren Bäuchen tun.
Marsch, marsch unter die Betten” . Als wir schon alle am Schlafen waren, kam der U.v.D. wieder und hat nachgesehen ob
alle Schränke abgeschlossen waren. Ein Kamerad hatte seinen Schlüssel verloren, deshalb hat er das Schoß nur so
eingehängt. Als der U.v.D. das bemerkte hat er die Türe aufgerissen, die ganzen Sachen aus dem Schrank, quer durch die
Stube verteilt und war dann endlich gegangen.
Die Anziehsachen mussten, fein sauber gefaltet, auf dem Stuhl liegen; da drauf die Socken und die Pantoffeln unter dem
Stuhl. Die Stühle mussten in einer Reihe ausgerichtet sein; die Hosenträger im Schrank einschlossen und der Brustbeutel
mit Geld auf dem Hals tragen werden. Morgens wurden wir geweckt und kamen zuerst in den Waschraum. Jeder musste seinen
entblößten Oberkörper mit kaltem Wasser abreiben. Da draußen strenger Frost herrschte war es im Waschraum auch sehr
kalt, so das manche ihr Hemd anbehielten. Der UvD hat dann bei seinem Kontrollgang alle Verweigerer aufgeschrieben
und ihnen befohlen in 30 Minuten mit einem Besen in der Hand auf der Schreibstube zu erscheinen. Einige mussten den
Kasernenhof fegen, andere die zugefrorenen Latrinen enteisen und reinigen. Während unserer Ausbildungszeit durften wir
die Kaserne nicht verlassen. Wenn man Stuben- oder Frühdienst hatte, blieb keine Zeit zum Frühstücken.
Nach 6 Wochen wurden wir in der Grollmann Kaserne vereidigt. Die Regimentskapelle spielte "Heil dir im Siegerkranz",
danach folgten 3 Strophen des Deutschlandliedes. Vor der Vereidigung wurden die Rekruten gefragt wer keine deutsche
Staatsangehörigkeit besitzt. Es sind dann Luxemburger und auch noch welche aus anderen Ländern hervorgetreten. Sie
wurden gefragt ob sie die deutsche Staatsangehörigkeit annehmen wollen. Die das abgelehnt haben wurden auf die
Schreibstube gerufen und sofort aus dem Militärdienst entlassen. Nach der Vereidigung erfolgte ein Kirchgang, danach
konnte man einen Stadturlaub beantragen. Nach dem Mittagessen mussten alle, die einen Urlaubschein beantragt hatten
vor der Kaserne antreten. Der Hauptfeldwebel prüfte dann ob an der Uniform alle Knöpfe blank geputzt waren, die Stiefel
glänzten und der Rekrut auch vorschriftsmäßig grüßen konnte. Wer diese Anforderungen nicht erfüllen konnte musste
seinen Urlaubschein wieder abgeben und zurück auf sein Zimmer gehen.
Wenn man die Kaserne für eine gewisse Zeit verlassen wollte, mussten zuerst der Korporal, dann der Hauptfeldwebel und
letzt endlich der Hauptmann, seine Zustimmung erteilen. Es wurde geprüft; ob die Ausgeh-Uniform sitzt, alle Knöpfe
blank geputzt sind und der Helm so blank ist das man sich darin spiegeln kann. Unser Hauptmann war in Zivil,
Bürgermeister von Osterode. Er war sehr stolz wenn er seine Kompanie, in Parade Uniform und mit einem fröhlichen Lied
auf den Lippen, durch seine Stadt führen durfte.
Als wir eines Tages zum etwa 6 Kilometer entfernten Schießstand marschieren sollten, war es sehr kalt und glatt. Der
Hauptmann ritt durch das große Tor, wir aber sind durch das kleine Tor gegangen und haben eine steil bergab führende
Abkürzung gewählt. Die Zug- und Gruppenführer gingen voraus und wir im Gänsemarsch hinterher. Ein Kamerad hat sich auf
den Gewehrkolben gesetzt und ist darauf den Berg hinunter gerutscht. Als die Anderen das sahen haben sie es ihm
nachgemacht und hatten einen Riesenspaß. Da kam der Hauptmann plötzlich im Galopp angeritten; ließ alles anhalten und
hat zuerst die Zugführer ausgeschimpft, dann anschließend die ganze Kompanie. Er sagte: „Wie könnt ihr es wagen, so
mit eueren Gewehren umgehen. Ein Gewehr soll man wie seine Braut behandeln und nicht wie einen Straßenbesen”. Zur
Strafe mussten wir, links und rechts der Straße, in zwei Reihen antreten und durch den verschneiten Straßengraben
robben. Die Herrn Zug- und Gruppenführer durften die Straße benutzen und erteilten uns nur Befehle, wie: hinlegen,
nach rechts schwenken, nach links schwenken, einzeln vorarbeiten und sammeln. Als wir dann abgekämpft, in Linien zu
2 Glieder angetreten waren, ging es mit Gesang zum Schießstand.
Auf dem Schießstand angekommen, erhielten wir zuerst eine praktische Unterweisung, für den Gebrauch von Schusswaffen.
Wir mussten solange mit einem nicht geladenen Gewehr üben, bis wir unserem Vorgesetzten beweisen konnten, dass wir
alles im Griff haben. Daraufhin wurden jedem 10 Patronen zugeteilt, so das er unter der Aufsicht eines Unteroffiziers
mit den Schießübungen beginnen konnte. Der Unteroffizier hat die Position der Einschüsse, auf der Scheibe, in einem
Buch eingetragen und nach Beendigung der Übung dem Hauptmann Bericht erstattet, ob der Schütze seine Aufgabe erfüllt
hat oder nicht. Nach dem Schießen wurden die Gewehre zu Pyramiden zusammengestellt. Diejenigen die ihre Aufgabe nicht
erfüllt haben, mussten rund um die Zielscheibe, die Bleikugeln aufsammeln.
Seit unserer Einberufung hatten wir noch keinen Heimaturlaub. Urlaub bekamen nur die, die ihren Heimatort zu Fuß
erreichen konnten. Wegen der vielen Truppentransporte die täglich von Ost nach West unterwegs waren durften wir die
Eisenbahn nicht benutzen. Einmal wurde uns gesagt; wenn jemand gut schießen kann der bekommt Heimaturlaub, aber auch
das war nur ein leeres Versprechen.
Kaisers Wilhelms Geburtstag
Der beste Tag war des Kaisers Geburtstag. Am 27. Januar mussten alle in der Grollmann Kaserne
antreten, der Battalions-Kommandeur beendete seine Laudatio mit den Worten: Seine Majestät, unser Kaiser und König
Wilhelm II, erlebe hoch, hoch, hoch. Dann spielte die Regimentskapelle: Heil dir im Siegerkranz, Herrscher des
Vaterlands, Heil Kaiser dir. Danach folgten 3 Strophen des Deutschlandliedes und anschließend fand ein Gottesdienst
statt. Anschließend gab es ein vorzügliches Mittagessen, Schweinebraten, ein Stück Wurst auf die Faust und Biermarken,
die man in der Kantine gegen gutes Bier einlösen konnte, danach Urlaub bis zum Wecken, ohne Urlaubschein. Mein Vater
und die Mutter eines Kameraden waren schon morgens angekommen, konnten uns aber nicht finden, wurden von einer Kaserne
in die andere geschickt. Erst als wir mit Musik, von der Kirche zurück zur Kaserne marschiert sind habe ich sie
zufällig entdeckt. Als sie mich auch erkannt haben, sind sie nachgekommen. Da war die Freude groß: Der Vater hatte
einen großen Koffer auf einem Krückstock über die Schulter getragen. Ich ging gleich zur Wache und habe sie angemeldet,
sie sind dann bis zum Abend geblieben. Es war einer der schönsten Tage in der Grollmann-Kaserne in Osterode.
Alle 10 Tage bekamen wir Sold. Vor der Auszahlung mussten wir antreten, jeder wurde gefragt ob noch Restgeld vom
letzten Sold vorhanden war. Dann bekam jeder 3,30 Mark, davon musste man noch Sidol für das Koppelschloss und
Schuhkreme für die Stiefel kaufen. Wer geraucht hat und nichts von zu Hause bekam war schlimm dran. Beim Militär bekam
man nicht nur die Ausbildung an der Waffe beigebracht, man lernte auch putzen, nähen, Strümpfe stopfen und vieles
Andere. Man bekam einen beschädigten Strumpf, der musste aufgeribbelt werden, mit der Wolle konnte man dann andere
Strümpfe stopfen oder Kleidungsstücke mit Namen kennzeichnen. wer das nicht konnte, der musste seinen Kameraden
Zigaretten oder Geld geben die das dann für ihn erledigten.
Verschiedene Kameraden gingen nach dem Dienst noch in die Stadt. Um 21:45 Uhr wurde zum Zapfenstreich geblasen, dann
musste man schnell zurück in die Kaserne, weil um 22:00 Uhr der Wachhabende von Bett zu Bett ging und prüfte ob auch
alle anwesend waren. Zwei mal pro Woche fanden Gewaltmärsche statt, mit vollem Gepäck im Tornister. Am Ende der
Marschkolonne fuhr dann ein Pferdewagen, wenn der Feldarzt bei jemandem einen Erschöpfungszustand feststellte, der
durfte dann aufsitzen. Am Sonnabend wurden auf dem großen Exerzierplatz Felddienstübungen durchgeführt, es befand sich
dort ein großer Hügel, den wir immer wieder erstürmen mussten. Am Nachmittag war Revierreinigen angesagt, wir mussten
dann die Tische schrubben, auf einen Tisch wurde Sand mit etwas Wasser gestreut, der nächste Tisch wurde mit der den
Beinen nach oben drauf gelegt und solange hin und her geschoben bis beide sauber waren. Mit den Stühlen geschah das
Gleiche. Dann wurde der Fußboden in der Stube geschrubbt, die Schränke abgewaschen, Staub geputzt, zuletzt kamen Flur
und Treppe dran.
Für die Arbeit war eine Stunde angesetzt, wenn jemand zu früh fertig war erregte er den Argwohn des Diensthabenden
Korporals, der prüfte dann alles genau, fand natürlich immer etwas das nicht seinen Erwartungen entsprach. Der
Übereifrige musste dann Nacharbeiten bis die Stunde um war. Eine Stunde war für Gewehr reinigen und Unterricht an der
Waffe vorgesehen.
Im Februar wurden wir neu eingekleidet; Schnürschuhe, Koppel, alles gelbes Leder mussten wir mit Lederschwärze
behandeln. 2 Wolldecken, Uniform und Helm in feldgrau, da brauchten wir die Knöpfe nicht mehr zu putzen. Die neuen
Gewehre mussten zuerst eingeschossen werden. Es wurden 90 scharfe Patronen und Marschverpflegung ausgegeben, danach
mussten wir mit vollem Gepäck zum Appell antreten. Man konnte kaum gerade stehen, weil der Tornister einen in die Knie
zwang. Der Major, der die Aufstellung besichtigte rief >Brust raus<, dann informierte er uns dass wir ins
Feldrekrutendepot und in Feindesland kommen. Urlaub bekam niemand. Ich habe ein Telegramm nach Hause geschickt, mit
der Nachricht dass wir bald abrücken werden. Einen Tag vor dem ausrücken hat mich meine Mutter noch besucht, sie hat
mir vieles mitgebracht. Alles konnte ich nicht mitnehmen, weil es nicht gestattet war anderes Gepäck bei sich zu haben
als dem Soldaten zustand.
Abmarsch zum Fronteinsatz
Am nächsten Tag hat uns die Regimentskapelle mit Musik zum Bahnhof gebracht. Von Osterode ging
es über Thorn, Posen,
Annaberg, Warschau, Brestlitowsk ins Pruschana-Lager. Das war eine russische Artillerie-Kaserne, in der 2 deutsche,
3 österreichische Bataillone und eine Offiziersschule untergebracht waren. Ein Bataillon das waren wir 18 und 19
jährige, die Anderen waren Männer bis 45 Jahre. Als wir in Osterode abfuhren lag Schnee, in Annaberg/Schlesien waren
die Kühe auf der Weide und im Pruschana-Lager lag der Schnee wieder einen Meter hoch. Drei Kilometer vor unserem vor
unserem Lager war die Bahnfahrt zu Ende. Mit den schweren Tornistern waren viele überfordert, wir mussten immer wieder
warten bis alle nachkamen. Unsere Unterkünfte das waren Baracken die den Russen als Pferdeställe gedient hatten. In
jeder Baracke wurde eine Kompanie mit Schreibstube untergebracht, die nur durch ein Zelt abgegrenzt war.
Wir haben aus Brettern Doppelbetten hergestellt, in jeder Baracke war ein Ziegelofen. Unsere neuen Uniformen und die
scharfe Munition mussten wir abgeben und bekamen dafür alte Bekleidung, sowie Ecksezierpatronen. Hier ging es wieder
Kasernenmäßig zu, das jüngere Bataillon bekam besseres Essen, doppelte Portionen und nach dem Essen 2 Stunden Bettruhe.
Wenn jemand die Bettruhe nicht einhielt und dabei erwischt wurde wusste zur Strafe Holz hacken oder Schnee schaufeln.
Zwei Wochen war Frost bis minus 40 Grad, da hatten wir keinen Unterricht im Freien, alle Aktivitäten fanden in der
Baracke statt, die nur mit nassem Holz beheizt wurde und dem entsprechend war auch die Temperatur im Inneren. Um
Brennmaterial für die Küche zu besorgen mussten wir ins nächste Dorf gehen und von zerfallenen Häusern Holz holen.
Als endlich das Tauwetter einsetzte verwandelte sich die Gegend um Baranowitschi in ein unüberwindbares Sumpfgelände.
Wir wurden mit anderen Einheiten die aus Frankreich zu uns verlegt wurden, zusammengelegt. Wenn jemand nachweisen
konnte dass er Landwirt ist und mehr als 100 Morgen Ackerland besitzt, konnte er einen Urlaub zur Frühjahrsbestellung
beantragen. Ein Gottlieb Piotrowski aus Plohsen hat seinen Urlaub bewilligt bekommen und durfte für 14 Tage nach Hause.
Wenn von der unweit entfernten Front Kanonendonner zuhören war und Alarm ausgerufen wurde, dachten wir es geht los.
Obwohl wir als Reserve aufgestellt waren mussten wir allzeit einsatzbereit sein. Wir haben auch Bunker und Stollen
gebaut, Schützengräben ausgeworfen und mit scharfen Handgranaten exerziert.
Als Gottlieb Piotrowski nach 2 Wochen zurückkam waren wir schon in Alarmbereitschaft und sind dann auch 2 Tage später
ausgerückt. Kamerad Piotrowski hatte mir noch ein großes Paket von zu Hause mitgebracht.
Italien hat Deutschland und Österreich den Krieg erklärt.
Zuerst sind drei Bataillone Österreicher ausgerückt, dann die Deutschen hinterher. Bis zum
Bahnhof Linowa wurden wir von einer Musikkapelle begleitet, dann ging es per Eisenbahn ab nach Baranowitsche. Dort
wurden wir der, an der Westfront aufgeriebenen, 15ten Reserve Division zugeteilt. Es wurde uns gesagt das Kameraden
aus der Heimat gleichen Gruppen zugeordnet werden können. Ich hatte einen Freund aus meinem Dorf, Gustav Spektor,
einen aus Groß Schöndamrau, Wilhelm Lukas und einen aus Ortelsburg, Karl Schlensack, wir kamen zu zusammen in eine
Kompanie. Zuerst waren wir in einem Kinosaal einquartiert, haben jeden Tag Schützengräben ausgehoben und Feldübungen
gemacht. Es war ein sumpfiges Gelände, so dass die Soldaten wegen den vielen Mücken, Netze auf den Köpfen tragen
mussten. Nach einem Gewitter wurde es plötzlich unerträglich. Die Mücken hatten meinen Freund so zerstochen dass sein
Gesicht dermaßen angeschwollen war und ich ihn gar nicht wieder erkannt habe.
Von Baranowitsche wurden wir wieder auf die Eisenbahn verladen, die uns mit unbekanntem Ziel Richtung Osten fuhr.
Nachdem wir unterwegs einmal zum Essenfassen gehalten haben, kamen wir in der Nacht in Krakau an. In der nächsten
Nacht befanden wir uns schon in den Karpaten, wo wir die Hügelketten zu Fuß überqueren mussten, die Fahrzeuge fuhren
um die Berge herum und wir mussten manchmal 2 Stunden warten bis sie uns wieder eingeholt hatten. So ging es immer
weiter bis wir auf einen Berg kamen wo wir Zelte aufgebaut und Biwak bezogen haben. Dort stießen wir auf türkische
Einheiten die auf Mauleseln Munition und Verpflegung über die Berge transportiert haben. Die Esel hatten ein Gestell
auf dem Rücken, auf jeder Seite eine Fass mit Wasser oder Kisten mit Proviant. Ihre Artillerie wurde von 6 Mauleseln
gezogen, während die Offiziere, ohne Sattel, ohne Zaumzeug, nur mit einem Hanfseil ausgerüstet, daher kamen.
Die Mannschaften marschierten wie es jeder für richtig hielt, mit aufgekrempelten Ärmeln, das Gewehr über den Tornister
gelegt, wie die Wilddiebe. Im Gegensatz dazu herrschte bei uns strenge Disziplin, wen jemand aus der Reihe ging kam
sofort der Kompanieführer angeritten, hat uns angeschrieen, uns klar gemacht dass wir keine Türken seien und nur auf
höheren Befehl etwas an der Marschordnung ändern dürften, wer dagegen verstoße, müsste mit einem 3tägigen Arrest
rechnen. Wir haben hinter der der Front Gewaltmärsche durchgeführt die dem Feind große Truppenaufmärsche vortäuschen
sollten.
Wir lagen in einem Buchenwald in Bereitschaft. Überläufer berichteten dass auf russischer Seite eine Großoffensive
vorbereitet wird. In einer Nacht wurde plötzlich Alarm geschlagen, der Russe war zu einem Angriff mit Gasgranaten
übergegangen. Wir lagen unter Zelten und hatten die Gasmasken gar nicht bei uns, sondern nur etwas abseits liegen. In
der Dunkelheit hat mach einer keine Gasmaske mehr gefunden. Es war ein fürchterliches Durcheinander. Dabei war es
unsere Pflicht die Maske immer an dem Tragriemen über dem Hals zu tragen, mit halb geöffnetem Deckel. Uns hat es zum
Glück nicht so stark betroffen weil wir auf einer Anhöhe lagen und die Gaswolken sich im Tal verteilten. Wir wurden in
höchste Alarmbereitschaft versetzt weil der Russe die österreichische Front durchbrochen hatte.
Eigentlich sollten wir noch an einer Gulaschkanone Essen fassen, aber es blieb uns dazu keine Zeit mehr. Der
Kompanieführer befahl uns die Zelte abzubrechen, auf den Tornister aufzurollen und in fünf Minuten marschbereit zu
sein. Die Kanoniere befanden sich schon in der Batteriestellung, luden die Granaten, die sofort abgefeuert wurden. Der
Battalions-Kommandeur versammelte die Kompanieführer und erteilte ihnen die Angriffsbefehle. Derweil sollten wir in
einem Eichenwal der schon mit Granattrichter übersät war, Deckung suchen. Bald hatten wir die Verbindung zu unserem
Batteriestab verloren. Wir warfen unsere Tornister auf einen Haufen, schwärmten unverzüglich, nur mit Sturmgepäck
ausgerüstet, 4 Handgranaten im Brotbeutel, zum Angriff aus. Wir robbten uns einzeln voran. Weil der Russe unsere
Stellungen schon überrannt hatte war jeder auf sich selbst angewiesen. Mann hörte kein Kommando mehr weil der Russe
inzwischen den Rückzug angetreten hatte, um sich auf einer Bergspitze zu verschanzen, von der er uns mit
Flachbahngeschützen beschoss. Irgendwann befanden wir uns in einem Schützengraben, wo ein Leutnant und 17 Mann aus
unserer Division die Stellung hielten. Unter Androhung von Gewalt befahl er uns den Graben sofort zu verlassen und am
Gegenangriff teilzunehmen. Wir sprangen über den Stacheldraht, duckten uns aber sofort im nächsten Graben damit das
mörderische Maschinengewehrfeuer uns nicht hinwegfegte.
Dort blieben wir bis zum Eintritt der Dunkelheit liegen. Wir konnten unsere Waffen nicht mehr einsetzen weil der Sand
die Gewehrschlösser blockiert hatte. Als es Nacht wurde herrschte ein gespenstische Stille. Wir krochen aus dem
Schützengraben und lauschten nach irgendeinem Lebenszeichen von anderen Kameraden. Dann hörten wir irgendwelche Laute
die wir nicht genau zuordnen konnten. Sie kamen aus einem Holzbunker ganz in der Nähe. Wir näherten uns ganz
vorsichtig, als plötzlich eine Schar österreichischer Soldaten herausstürmte. An unseren Stahlhelmen erkannten sie
dass wir Deutsche sind. Bald danach trafen wir auch auf 69 deutsche Soldaten die zu unserer Division gehörten. Dann
kam ein Hauptmann der uns mit Vorwürfen überschüttete, wir seien Feiglinge, wir hätten uns von unserer Einheit entfernt.
Wir haben ihm den Vorgang geschildert, aber ließ nicht mit sich reden und sagte nur dass wir bestraft werden und nichts
zu essen bekommen. Wir wurden einer Maschinengewehr Einheit zugeteilt welche die vorderste Stellung verteidigen
musste. Wir hatten einen Stollen mit 2 Ausgängen.
Die Russen haben bemerkt das sich etwas bewegte und haben uns unverzüglich mit Artilleriefeuer belegt. Schon die
dritte Granate war ein Volltreffer. Vier Kameraden waren sofort tot, ich bekam mit einem Stollenbrett in den Rücken
der sofort blau und grün angelaufen war. Ich schaute nach oben, alles war verschüttet. Ich wusste nicht das da noch
ein Ausgang war, doch die Kameraden die hier in Stellung waren haben mir geholfen das Freie zu erreichen. Ich habe
mich am nächsten Tag krank gemeldet, dachte 2 Tage Schonung zu bekommen, aber der Sanitäter hat mir nur den Rücken mit
Spiritus eingerieben und mich wieder, zurück zu unserer Kompanie geschickt. Sie bestand nur noch aus 3 Gruppen, die in
einem Stollen, der in einen Berg gehauen war, Stellung bezogen hatten. Wir konnten uns hier wenigstens waschen, an
einer Quelle die aus dem Felsen sprudelte. Wir waren nicht mehr einsatzfähig und mussten durch andere Truppenteile
verstärkt werden.
Beim Essen holen musste man auch das Gewehr bei sich haben, es wurde erzählt dass hier der braune Bär herumwandert.
Ich habe keinen gesehen, nur das die Toten ausgescharrt wurden und verstümmelt herumlagen. Nach einigen Wochen haben
die Deutschen eine Gegenoffensive gestartet, von den Bergen herunter, über den Fluss Zlota Lipa, bis zu einer Stadt
die Brzezany hieß. 2 Tage später wurden wir auch eingesetzt, bei großer Hitze ging es in Dauermärschen vorwärts, man
durfte aus den Flüssen kein Wasser trinken, weil es mit Petroleum verseucht war. Nur wenn es dunkel wurde machten wir
halt, dann mussten wir Gräben ausheben um vor Überraschungen sicher zu sein.
Links von uns war Tarnopol und rechts Rumänien. Wenn es nach einer Ruhepause wieder losging dann war es am schlimmsten,
man ging wie auf Nägel, weil die Füße die Strapazen nicht so ohne weiteres wegsteckten. Im Dorf wurde niemals Rast
gemacht, denn da waren immer Brunnen, zu denen alle hinstürmten. Später wurden Melder vorausgeschickt, die von den
Dorfbewohnern Wasser in Eimern am Weg raussetzen ließen, damit die Soldaten Ihren Durst löschen konnten. Ein Soldat hat
gleich den ganzen Eimer mitgenommen und ihn dann als er leer war, irgendwo am Wegrand stehen lassen. Der Kompanieführer
kam angeritten, hat ihn ausgeschimpft und gedroht, ihn mit 3 Tagen Arrest zu bestrafen. Wir gehörten zur Südarmee
welche von Graf Bothmer befehligt wurde.
Die Stellungen waren schlecht ausgebaut, abends mussten wir, von der 2 Kilometer hinter der Front liegenden Feldküche,
Essen und andren Proviant holen. Ich war der Jüngste der Gruppe, musste immer 9 Kochgeschirre tragen, Brot und Post
habe ich in 2 Sandsäcke, die ich über der Schulter hängen hatte, verstaut. Wenn wir unterwegs waren wurde der
Laufgraben immer beschossen. Einmal schlug eine Granate am Schützengrabenrand ein und hat mich halb verschütte, die
Kochgeschirre aus den Händen gerissen, so dass ich ohne Verpflegung im vorderen Graben ankam. Nach drei Wochen sollten
wir abgelöst werden Es hat jeden Tag geregnet, wir haben unsere Mäntel angezogen und uns mit Zelten bedeckt. Nach dem
wir abgelöst wurden kamen wir in ein Dorf dass von Juden bewohnt war. Die Bewohner waren froh dass wir keine Kosaken
waren, mit denen hatten sie vor ein par Tagen schon schlechte Erfahrung gemacht, die hatten ihnen beim Abzug Vieh und
Pferde weggenommen.
Der Boden war sehr fruchtbar, es wurden Hanf, Weizen, Hafer, Mais, Bohnen, Roggen und Kartoffeln angebaut. Die
Bewohner waren gerade mit der Ernte beschäftigt. Die Häuser waren nur aus Holz und Stroh erbaut. Die Leute lebten in
sehr ärmlichen Verhältnissen. Ich hatte mir in unserer Kantine für 20 Pfennig ein Taschenmesser gekauft, das hat mir
ein Bauer für 6 Eier und 2 Pfund Brot abgekauft, daraus hat er sich dann ein Rasiermesser geschliffen. Wenn unser
Versorgungstross auf denn holperigen Wegen nicht nachkam, haben im Dorf auch Verpflegung eingekauft. Die Leute hatten
Angst dass wir nicht bezahlen werden, doch wir bekamen meistens pünktlich unseren Wehrsold ausgezahlt und konnten uns
so manches genehmigen. Um unser Marschgepäck zu erleichtern haben wir so manches aus dem Tornister weg geworfen.
Unweit eines Dorfes wurde halt gemacht, wir sollten Zelte aufschlagen, doch niemand hatte mehr Zeltstöcke im Tornister,
alles war unterwegs liegen geblieben. Der Zugführer befahl uns ins Dorf zugehen und Stöcke zu besorgen. In einer
Scheune stießen wir auf eine Hühnerschar, mit den Stöcken haben wir einige Hühner erlegt, in einem Hanffeld gerupft
und dann im Eiltempo zurück zu unserer Truppe. Als wir ankamen war die Kompanie schon marschbereit, es gleich weiter,
mit dem Huhn im Tornister. Bei der nächsten Rast haben wir die Hühner ausgenommen und Holz besorgt um sie zu kochen,
doch wir mussten schnell wieder weiter marschieren und erst nach 2 Tagen konnten wir uns mit den Hühnern befassen,
leider waren die so alt das sie nicht gar wurden. Das Fleisch mussten wir wegwerfen, nur die Suppe konnten wir noch
gebrauchen.
Meine Verwundung am Pruth.
Wir befanden uns 8 km vor der russischen Grenze. Der Kompanieführer hatte uns informiert das
wir hier zum Einsatz kommen. Wir bekamen noch ein Mittagessen aus der Gulaschkanone, konnten unsere Feldflaschen mit
Tee, der mit Rum angereichert war, auffüllen, Munition und Handgranaten in Empfang nehmen und dann ging es zum Einsatz.
Um 3 Uhr begann das ganze Bataillon auszuschwärmen, sofort hat uns der Russen entdeckt und begann uns mit Artillerie
zu beschießen, je weiter wir vorrückten desto heftiger.
Bis zu einem Eisenbahndamm hatten wir gute Deckung, doch wir sollten den dahinter fließenden Fluss überqueren. Doch
plötzlich explodierte über meinem Kopf eine Schrapnellkugel, der Stahlhelm wurde mir vom Kopf gerissen, Tornister und
Koppel flogen auch weg, ich lag auf der Erde und wusste gar nicht was passiert war. Plötzlich fing Blut aus der
Kreuzbeingegend zu rieseln, aus dem rechten Oberschenkel auch. Gleich nebenan war ein Granattrichter, dort habe ich
Schutz gesucht. In der rechten Rockecke hatte man immer ein großes Verbandspäckchen, das habe ich herausgenommen und
auf die Wunde gedrückt, doch das Blut floss mir bis in den Stiefel. Links und rechts von mir schlugen Granaten ein,
dicke Erdbrocken und Schlamm fielen auf mich herab, doch in meinem Erdloch war ich vor Maschinengewehrsalven geschützt.
Der ganze Rücken war angeschwollen und ich konnte mich überhaupt nicht bewegen.
Die Deutschen mussten die Stellung den Russen überlassen, einer hatte mich entdeckt, da ich aber so blutverschmiert da
lag, hat er bestimmt gemeint ich wäre nicht mehr am leben und ist weitergegangen. Nach zwei Stunden habe ich gehört
das die Russen sich wieder zurückzogen, danach herrschte eine gespenstische Stille. Als es dunkel wurde kamen deutsche
Sanitäter mit Spürhunden und haben die Verwundeten aufgesammelt. Ich wurde auf eine Trage gelegt, lag gebeugt und
konnte mich nicht rühren weil der blutverschmierte Rücken völlig verkrustet war. Ein Pferdegespann konnte nur vier
Tragen befördern, die Fahrt über Ackerfurchen war eine Tortur, ich habe nicht geglaubt das ich es überleben werde. In
einer Dorfkirche wurden wir dann ausgeladen und zu den etwa 50 Verwundeten gelegt die da schon lagen.
Mich haben sie zu den Bauchschüssen gelegt, weil ich einen Nervenschock hatte und am ganzen Körper gezittert habe. Zu
trinken bekam ich nichts, nur einen feuchten Lappen in den Mund. Ich sollte gleich operiert werden, aber es kamen
immer mehr Verwundete, so bekam ich nur eine Tetanusspritze, wurde verbunden und für den Weitertransport ins Hinterland
vorbereitet. Im Morgengrauen wurden wir auf Lastautos verladen, die aus auf ein Landgut brachten, wo wir in einem
Pferdestall untergebracht wurden. Die Fahrer fuhren so schnell über die Granatlöcher, das wir vor Schmerzen geschrieen
haben. Wir baten sie langsamer zu fahren, aber die bekamen es in ihrem Führerhaus nicht mit, erst alt ein Verwundeter,
der einen Krückstock bei sich hatte von hinten die Scheibe einschlug wurde die Fahrt erträglich. Lastautos, die
Munition und Verpflegung an die Front transportiert hatten, brachten in den nächsten Tagen immer wieder Verwundete
ins Hinterland. Die Deutschen hatten an diesem Fronabschnitt hohe Verluste zu beklagen. Wir können von Glück reden
dass wir dem Höllenfeuer überhaupt entkommen sind.
Wir wurden mit Lastautos, die ein Feldlazarett uns geschickt hatte, bis nach Lemberg befördert. da wurden wir gewaschen,
rasiert und frisch verbunden. Auf einem Nebengleis stand ein Lazarettzug, in dem wurden wir anschließend in frisch
bezogenen Betten untergebracht. Der Zug brachte uns über Annaberg nach Freiburg in Sachsen, eine Stunde hinter Dresden.
Hier wurden wir auf Tragen gebettet und mit einem Möbelwagen in ein Reservelazarett transportiert.
Im Heimatlazarett.
Als ich am nächsten Tag aufwachte und das schöne Bett sah in dem ich lag, dachte ich dass ich
im Himmel bin. Ich dankte meinem Herrgott das er mich bis zu diesem Ort begleitet hat. Am Nachmittag kamen Schulkinder
mit Geschenken und haben uns schöne Lieder vorgesungen. Anhand von Röntgenaufnahmen wurde in den nächsten Tagen
festgestellt dass bei mir ein Schrapnellsplitter an der Wirbelsäule in die Kreuzbeingegend eingedrungen war. Ich wurde
jeden Tag in Salzwasser gebadet und bekam wieder volle Verpflegung, da mein Magen zum Glück nicht verletzt war. Auf
dem Transport bekam ich nur Suppe und bei Bedarf einen feuchten Lappen auf die Lippen. Ich bin von 62 auf 43 Kilogramm
abgemagert, gehen konnte ich wegen dem Nervenschock den ich bei der Verwundung erlitten hatte auch noch nicht. Die
Wunde am rechten Oberschenkel war nur ein Streifschuss und wurde mit einem Schutzverband versorgt.
In den nächsten Tagen habe ich einen Brief nach Hause geschrieben und mitgeteilt wo ich mich zurzeit befinde. Meine
Eltern schickten mir ein Paket mit Lebensmitteln, jetzt konnte ich essen was ich wollte. Das Essen im Lazarett war
nicht besonders, jeden Tag nur Kohlblätter. Der weg zu den Toiletten führte durch einen Gemüsegarten. Die gehfähigen
Kameraden haben den ganzen Kohlrabi aufgegessen, so dass schließlich Wachposten aufgestellt werden mussten. Sechs
Wochen lang konnte ich mich nur auf allen Vieren fortbewegen, denn sobald ich mich aufrichtete wurde es mir
schwindelig und ich musste zurück ins Bett.
Als ich wieder bei Kräften war habe ich meinen Eltern mitgeteilt das ich mich in ein Lazarett in ihrer Nähe verlegen
lassen will. Der Chefarzt hatte mir zugesichert, wenn die Möglichkeit besteht in Ortelsburg unterzukommen, wird er dem
zustimmen. Meine Mutter hat daraufhin, in Ortelsburg, beim Lazarettinspektor Zantopf nachgefragt und er hat angedeutet
das sie mich aufnehmen können. Daraufhin bekam ich die Krankenpapiere und einen Fahrschein nach Ortelsburg. Da ich als
Soldat nie Heimaturlaub hatte, beschloss ich zuerst meine Eltern zu besuchen. Ich fühlte mich noch sehr schwach, habe
nach jedem Kilometer Rast gemacht, aber letztendlich war ich wieder daheim bei meinen Eltern. Die Wiedersehensfreude
war sehr groß. Ich bin am 30 Juli verwundet worden und am gleichen Tag wurde mein ältester Bruder beerdigt. Er bekam
den Splitter einer Gasgranate ins rechte Bein und ist an einer Blutvergiftung verstorben.
Am nächsten Tag brachte mich mein Vater ins Garnisonslazarett nach Ortelsburg. Ich wurde jeden Tag gebadet und massiert,
weil die Rückenhaut am Knochen angewachsen war konnte ich mich nicht schmerzfrei bücken. In Ortelsburg verbrachte ich
noch sechs Wochen, bis Ende Oktober, da wurde es schon ziemlich kalt und in unserer Barackenunterkunft ziemlich
ungemütlich. Kohlen und anderes Brennmaterial lagen im Hof auf Halde, aber es war verboten zu heizen. Kameraden die in
der Nähe zu Hause waren konnten Sonntagsurlaub beantragen.
Einer von ihnen brachte von zuhause Brennholz mit und entzündete damit im Ofen ein wärmendes Feuer, andere holten vom
Hof Kohlen, so dass der Ofen in kurzer Zeit glühend heiß wurde und die Gefahr bestand das die Betten Feuer fangen
würden. Wir hatten die Betten schon weg gerückt, da kam der Feldwebel herein und fragte wer das Feuer im Ofen
angezündet hat, doch niemand fühlte sich angesprochen. Der Feldwebel hatte den Vorfall dem Stabsarzt gemeldet, als der
am nächsten Morgen zur Visite kam, war seine erste Frage: ”Wer hat gestern Abend das Feuer im Ofen angezündet”. Als
sich niemand meldete, schrie er uns an: ”Morgen wird alles entlassen, zum Ersatzbatallion, in Diez an der Lahn! Wer
gehen kann, sofort zur Schreibstube, Krankenpapiere und Fahrscheine abholen”. Er erinnerte uns noch daran am nächsten
Tag pünktlich am Bahnhof zu sein, weil eine Verspätung unangenehme Folgen für uns haben würde. Das war das Ende der
schönen Erholungsphase. Ich blieb noch eine Nacht zu Hause und bin dann am nächsten Tag von dort zum Bahnhof gegangen.
Wieder Kriegsverwendungsfähig.
Als wir am nächsten Tag in Diez angekommen waren, wurde ich gefragt ob ich aus dem Heimaturlaub
käme, als ich das verneinte wurden mir 2 Tage genehmigt und 14 Tage Genesungsurlaub dazu. Wieder zurück im
Ersatzbatallion bestand unsere Tätigkeit aus Wache schieben und Kartoffel schälen. Nach einem Monat wurden wir von
einem Generalarzt untersucht, er hat mich für nicht einsatzfähig befunden weil ich noch den Steckschuss im Rücken
hatte und das linke Bein 10 Zentimeter dünner war. Jetzt fing das Kasernenleben wieder von vorne an. Wachdienst,
Gewehr laden, sichern, Ehrenbezeugung, Einzelmarsch und Appell. Wer nicht weit nach Hause hatte bekam zu Weihnachten
Urlaub. Ich hatte zu Heiligabend und Silvester Torwache, denn nach Ostpreußen wurde niemand beurlaubt.
Nach Neujahr 1918 wurden wir neu eingekleidet und kamen nach Köln zur Baukompanie. Mit Musik wurden wir zum Bahnhof
gebracht. In Köln wurden wir noch mit Soldaten die von andern Truppenteilen dorthin verlegt wurden in einem großen
Kinosaal, im Stadtteil Edengarten untergebracht. Wir brauchten keinen Dienst zu machen und konnten zu Heilige Drei
Könige den Gottesdienst im Dom besuchen. Kameraden die aus irgendwelchen Gründen im Arrest saßen wurden gefragt ob sie
auch am Gottesdienst teilnehmen möchten, dann würde ihnen die Strafe erlassen. Fast alle haben dem zugestimmt. Einige
Tage später wurden wir wieder auf einen Transportzug verladen, der uns über Herbestal, Antwerpen nach Brügge in Belgien
brachte. Hier mussten wir den Zug kurzfristig verlassen und einen Luftschutzkeller aufsuchen, weil Fliegeralarm
gemeldet wurde. Danach ging es wieder weiter nach Turut, Kortemark, Hauseme, Kautremollen, Zaren, Zarenlinde. Dort
wurden wir in verschiedene Gruppen aufgeteilt und einer Pionierkompanie auf dem Pionierpark Struwendorf zugewiesen.
Wir haben hinter Klerken Bunker für schwere Maschinengewehre gebaut. Unsere Arbeit konnten wir nur bei Nebel verrichten,
denn bei Sonnenschein waren wir sofort dem Beschuss der feindlichen Artillerie ausgesetzt. eine Kleinbahn die Munition
und Stacheldraht an die Front brachte war dem Beschuss besonders ausgesetzt. Die Gleise, von schweren Geschossen
zerfetzt, mussten immer wieder hergerichtet werden, damit der Nachschub aufrechterhalten werden konnte. Später haben
wir am Kemelberg bei Armentier, eine Brücke über die Lys gebaut. Um in dem Sumpfgelände einen Untergrund dafür zu
schaffen, mussten wir 10 bis 12 Meter lange Pfähle in den Boden rammen. Ein Feldwebel gab immer den Befehl: „Hoch den
Bär, noch viel mehr, dass man sieht, wie er zieht, denn dieser Pfahl, glatt wie ein Aal, durch Fels und Stein, durch
Wasser und Sand, fürs Vaterland”. Jedes mal mussten wir den Bär an Schnüren hochziehen und dann wieder herunterlassen.
Wenn es manchmal, trotz vieler Mühe nicht mehr weiter ging wurde der Pfahl auf eine bestimmte Länge abgeschnitten.
Nach Fertigstellung der Brücke kamen wir in die Siegfriedstellung bei Kambrei, zum Bau eines Bataillons-Gefechtstandes.
Da der Boden kreidehaltig war, mussten wir die großen Stücke von Hand zu Hand reichen, den Schutt haben wir dann mit
Sandsäcken aus der Baugrube gehoben und mit Ästen getarnt, damit der Stand nicht von feindlichen Fliegern entdeckt
werden konnte. Alle acht Stunden wechselte die Arbeitsgruppe. Wir mussten von der Baustelle durch das Gelände robben,
denn aufrecht gehend war man dem Beschuss der feindlichen Scharfschützen ausgesetzt, die von einem Fesselballon aus
informiert wurden der über den feindlichen Linien stand.
Der Wechsel war mit einem großen Risiko verbunden, und wurde wenn Möglich bei Dunkelheit vollzogen. Um vor
Überraschungen sicher zu sein haben wir spanische Reiter (Stacheldrahtverhaue) gebaut und vor die ersten Gräben
gestellt, die dann oft in der Nacht von den Franzosen geklaut, und dann vor ihren eigenen Linien wieder aufbaut wurden.
Wir hatten aus Bohlen eine Brücke auf Rädern gebaut, die dann in den Graben geschoben wurde, damit die Artillerie und
andere Fahrzeuge über die Schützengräben kamen. Weil um vier Uhr morgens der Beschuss mit Gasgranaten begann, mussten
wir Gasmasken aufsetzen, danach haben feindliche Flieger unsere Munitionskolonne bombardiert und total aufgerieben.
Es wurde auch eine Marinedivision eingesetzt, die bis dahin dem Küstenschutz gedient hatte und jetzt ihren ersten
Einsatz hatte.
Wir sind zuerst ein ganzes Stück in Richtung Amiens vorangekommen, doch dann blieb unser Angriff in den zuvor von
Engländern besetzten Stellungen, stecken. Da die Engländer ihre Stellungen fluchtartig verlassen hatten, fiel ihr
ganzer Proviant in unsere Hände; Schokolade, Weißbrot, Flaschenwein. Die erste Nacht haben wir in einem runden Zelt
verbracht, weil ich mir durch den starken Wind, der da herrschte eine Angina zugezogen hatte, die mit hohem Fieber
verbunden war, konnte ich die vielen Köstlichkeiten überhaupt nicht genießen.
An eine ärztliche Versorgung war überhaupt nicht zu denken, denn es mussten zuerst die vielen Granatlöcher eingeebnet
werden damit die vielen Fahrzeuge und Geschütze wieder weiter fahren konnten. Auch eine Bahnlinie musste repariert
werden, damit die großen Geschütze in Stellung gebracht werden konnten, dabei wurden auch die vielen Kriegsgefangenen,
die bei dieser Offensive gemacht wurden, eingesetzt. Als die Offensive dann schließlich scheiterte, wurden wir an die
Somme verlegt. Da habe ich die Ortelsburger Jäger, die aus Italien an die Westfront verlegt wurden, zum ersten Mal im
Einsatz gesehen.
Unser nächster Einsatzort waren dann Stellungen hinter Laon. Hier wurden die Vorbereitungen zu einer neuen Offensive
getroffen. Feindliche Flieger versuchten uns Tag und Nacht daran zu hindern die Aufmarschwege instand zu halten. Als
die Offensive dann endlich losging, hatten wir die Order eine Brücke über die Oise mit Bohlen und Balken zu verstärken.
Gleich am Anfang der Offensive mussten wir Gasmasken anlegen, um für alle Fälle gewappnet zu sein. Nur die Artillerie
und Kraftfahrzeuge durften die Landstraße benutzen, die Infanterie ging immer im Straßengraben und wurde von einer
Seite von Kopf bis Fuß mit Dreck bespritzt. Die Franzosen und Engländer haben hier schon Panzer eingesetzt, die von
Truppen aus den Kolonien gefahren wurden. Die Australier gingen mit umgekrempelten Ärmeln hinter den Panzern her.
Die letzte Offensive des Ersten Weltkrieges.
Zum Jahresende 1917 hatten noch 153 deutsche 175 alliierten Divisionen gegenübergestanden.
Zur Vorbereitung der Offensive ließ Ludendorff 39 Divisionen aus dem Osten und aus Italien heranziehen. Er ließ
spezielle Angriffsdivisionen formieren, die durch intensive Ausbildung auf den beabsichtigten, schnellen Vormarsch
vorbereitet wurden. 6608 Geschütze, 3500 Minenwerfer und 1070 Flugzeuge wurden hinter dem vorgesehenen
Angriffsabschnitt konzentriert. Den Ausbildungsbefehlen Ludendorffs, die bis zu den Kompanieführern herab verteilt
wurden, konnte man entnehmen, dass der Versuch, den Krieg mit einem mächtigen Schlag zu entscheiden schon in der
nächsten Zeit gewagt werden sollte. Wir übten die fast vergessenen Formen des Schützengefechts und des
Bewegungskrieges, auch wurde eifrig mit Gewehr und Maschinengewehr geschossen. Wir hegten keinen Zweifel daran, dass
der große Plan gelingen würde.
Den ganzen Winter 1917/18 über plante der Generalquartiermeister Ludendorff die deutsche Offensive. Zwar hatten die
Vereinigten Staaten von Amerika dem Deutschen Reich am 6. April 1917 den Krieg erklärt, aber vor dem Sommer des
Jahres 1918 war mit dem Auftreten von US-Truppen in relevanter Größenordnung nicht zu rechnen. Der deutschen Führung
blieb nur ein schmales Zeitfenster, um die Niederlage und den zu erwartenden Diktatfrieden abzuwenden. Ypern,
Armentieres, Arras, Cambrai oder Verdun wurden ernsthaft als Schauplätze erwogen. Ludendorf entschied sich für einen
Angriff zwischen Cambrai und La Fere – genau an der Nahtstelle zwischen der Französischen Armee und dem britischen
Expeditionscorps.
Der Fluss Somme bildete die Grenze zwischen Franzosen und Briten. Die Briten – nicht die Franzosen – sollten das Ziel
des Vorstoßes werden. Ihre Stellungen waren nur 130 Kilometer von der Kanalküste entfernt. Beim erreichen der
Sommemündung wäre die gesamte britische Armee eingeschlossen gewesen, denn hinter ihnen lag die Straße von Dover.
Am 21. März 1918 begann die letzte entscheidende Offensive des deutschen Westheeres im Ersten Weltkrieg. Der
Angriffsstreifen war 75 Kilometer breit. Dort hatte Ludendorff 43 Angriffsdivisionen konzentriert, dahinter 30
weitere Reservedivisionen, ihnen standen lediglich 26 britische Divisionen gegenüber. „Michael“ – so der Deckname der
„Kaiserschlacht“ – lief dank Ludendorffs akribischer Vorbereitung gut an. Der britische Oberbefehlshaber General
Douglas Haig erkannte die Chance, welche die Deutschen in dieser Situation hatten. Wollten die Deutschen diese Chance
nutzen, mussten sie darauf verzichten die Somme zu überschreiten, wo sie auf die französischen Reserven treffen und
sich von der Küste entfernen würden. Genau diesen Fehler begingen jedoch die Deutschen.
Am dritten Tag überschritt der linke Flügel mit der 18. Armee die Somme. Ludendorf stellte die Taktik über die
Strategie, wie er das bei Tannenberg und der Schlacht an den Masurischen Seen auch schon getan hatte. Ludendorffs
Befehl an die 18. Armee vom Abend des 22. März 1918 lautete: „Jetzt gilt es den Sieg auszunutzen, den Feind nicht zum
Stehen kommen zu lassen, Somme und Crozat-Kanal zu überschreiten, bevor feindliche Verstärkungen wirksam werden“.
Was Haig befürchtet hatte, trat nicht ein. Die deutsche Offensive Lief weiter Richtung Süden und lief sich schließlich
tot. Am 31 März war Ludendorff zu der Erkenntnis gekommen, dass „Michael“ gescheitert war. Am 5. April wurde die
Einstellung der Offensive befohlen. Im Hochsommer waren die US-Truppen in Frankreich angekommen und gingen mit den
Franzosen zum Angriff vor. Nur mühsam konnten Hindenburg und Ludendorf den Zusammenhalt der Front waren. Am 24. Oktober
1918 forderte US-Präsident Woodrow Wilson die bedingungslose Kapitulation, am 11.Nuvember Wurde der Waffenstillstand
von Compiegne unterzeichnet.
Zusammenbruch der Westfront und Waffenstillstand .
Als die Offensive dann letztendlich gescheitert war, wurden wir auf Eisenbahnwaggon verladen, in
eine Stellung vor Verdun gebracht und der siebenten bayerischen Division zugeteilt. Als wir ausgeladen wurden nahm der
Franzose den Bahnhof unter Beschuss. Eine Granate traf einen Waggon der mit Seifenpulver beladen war, so dass der ganze
Bahnhof aussah als wäre gerade Neuschnee gefallen. Wir gingen auf die Suche nach Kartoffeln. Als ich mit einem Sack,
vollbeladen die Böschung runter ging um zur Feldküche zu gelangen, schlug unweit von mir eine Granate ein und riss mir
den Sack vom Rücken. Ich bin mit dem Schrecken davon gekommen, mir war nichts passiert.
Der Bahnhof war menschenleer, nur ein par Kaninchen liefen verschreckt durch die Gegend und einigen Kameraden gelang
es welche einzufangen. Am nächsten Tag gelang es uns endlich die Feldküche zu erreichen. Als wir gerade beim Essen
fassen waren, schlug unweit eine Granate ein so dass Pflastersteine das Dach durchschlugen und wir das Weite suchen
mussten. und wir wieder nichts zu Essen bekamen. Ein Friseur aus unserer Kompanie fuhr immer ins Hinterland um uns
mit Proviant zu versorgen. Als er 14 Tage vor dem Zusammenbruch wieder mal zurückkam erzählte er uns schon das der
Krieg nicht mehr lange dauern würde, weil Kaiser Wilhelm mit Frack und Zylinder bekleidet, Deutschland verlassen und
ins Ausland gehen würde. In unserer Einheit hatten wir auch einen Juden der glaubte dass er sich alles erlauben darf.
Eines Morgens ging er in die Küche, als er keinen Koch vorfand stieg er auf die Gulaschkanone und hob den Deckel vom
Kessel in dem der Kaffee kochte an. Der kochende Kaffee verbrühte seine Füße so sehr das er sofort ins Lazarett musste,
für ihn war der Krieg somit zuende. Es kam noch ein Erlass, das Kameraden die 2 Jahre aktiv gedient hatten und
Gefreiter waren sofort zum Sergeanten befördert wurden. Für den 11. November 1918 war ein Waffenstillstand vereinbart
und ab 11 Uhr sollte nicht mehr geschossen werden. Wir hatten unsere Kopfkissen aufgetrennt und eine Kissenschlacht
veranstaltet, um auf diese Art und Weise unserer Freude Ausdruck zu verleihen. Als die Federn durch die Luft flogen
brachen wir in Tränen aus.
In jeder Kompanie wurde ein Soldatenrat gewählt, der aus drei Mann bestand. Wenn der Kompanieführer jemanden bestrafen
wollte, musste er erst den Soldatenrat fragen, der die Strafe befürworten, aber auch ablehnen konnte. Die Offiziere
durften keine Achselstücke mehr tragen, was für sie einer Degradierung gleich kam. Wir waren in einem Dorf
einquartiert und morgens zum Appell angetreten, als einer vom Soldatenrat sich stockbesoffen vor den auf dem Pferd
sitzenden Kompanieführer stellte und schrie: „Alles hört auf mein Kommando”. Der Kompaniechef war wie vom Blitz
getroffen, ihm versagte die Stimme. Wir sahen ein das dies nicht so weiter gehen kann und wählten einen neuen
Soldatenrat. Unser Rückzug begann bei Konflanz, einer Vorfestung von Metz und führte uns zunächst über die
luxemburgische Grenze, wo wir in einem Ort einquartiert wurden. Als wir für die Küche Holz aus dem Wald holen gingen,
entschieden wir uns eine Eiche abzusägen, ohne uns dessen bewusst zu sein, in welchem Forst wir uns befanden. Als wir
beim fällen waren fielen plötzlich Schüsse, die wir auch sofort erwiderten, bis uns ein Elsässer der sich in unserer
Kompanie befand aufklärte: „Kameraden, wir befinden uns hier auf Luxemburgischem Hoheitsgebiet”.
Wir sind dann weiter durch das Fürstentum Birkenfeld marschiert, wo das Städtchen Merzig für uns geflaggt hatte. Das
Elsass haben wir auch noch kurz gestreift. Wo wir bei einem Bauern, der uns kein Stroh für das Nachtlager geben wollte,
einquartiert wurden. Daraufhin gingen wir in die Scheune und haben uns selbst was besorgt. Wir haben dann noch erfahren,
sie hätten ein Schwein geschlachtet und warteten auf den Einzug der Franzosen. Als wir uns 1917, an der Ostfront, in
den in Karpaten, im Einsatz befanden, waren unter uns auch viele Elsässer. Sie durften ihre Heimatpost nicht in
französischer Sprache schreiben, mussten ihre Briefe offen auf der Schreibstube abgeben, wo sie zuerst kontrolliert
und dann abgeschickt wurden. Als ich in einer Nacht, mit einem Elsässer auf einem Vorposten Wache schieben musste,
wollte er mich überreden zum Russen überzulaufen. Als ich darauf nicht eingehen wollte verschwand er plötzlich in der
Dunkelheit und ich habe ihn nie wieder gesehen.
Wir sind dann weiter Richtung Worms und Ludwighafen gezogen, dort wurden wir bei einem Mühlenbesitzer einquartiert,
ein Unteroffizier und vier Mann. Obwohl wir verlaust und verdreckt waren bestand die Müllerin darauf das wir in ihren
Betten übernachteten. „Wenn alles durch ist”, sagte sie, „werde ich alles gründlich reinigen”. Der Müller brachte uns
eine Gießkanne voll Wein und sagte wir sollen es uns Schmecken lassen. Wir haben reichlich davon Gebrauch gemacht, so
dass ich gar nicht weiß wie ich ins Bett kam. Das war meine Erinnerung an die Pfalz. Manchmal waren wir auch 2 Tage im
Quartier.
Vor dem Weitemarsch wurde uns immer gesagt welche Truppe die Vorhut und welche Truppe die Nachhut übernehmen sollte.
Die Nachhut hielt immer Verbindung zu den nachrückenden Franzosen und man muss staunen wie alles reibungslos, ohne
Zwischenfälle von statten ging, was wir in erster Linie dem General-Feldmarschall Paul von Hindenburg zu verdanken
haben, der den Rückzug an der Westfront koordiniert hat.
In Köln angekommen, erhielten wir im Volkshaus unsere Entlassungspapiere, Eisenbahnfahrscheine, Reisepässe,
unterschrieben von Oberstleutnant Mann. Wir mussten Köln umgehend verlassen, weil schon am nächsten Tag die
französischen Besatzungstruppen in einmarschieren sollten. Wir fuhren mit einem Zug der bis Allenstein fuhr, dort
wurden unsere Papiere vom Soldatenrat kontrolliert. Die jüngren Jahrgänge wurden festgehalten, zu neuen Einheiten
zusammengestellt und zur Sicherung der Ostgrenze gegen die Bolschewisten abkommandiert. Ich hatte gesagt das ich noch
einen Schrapnellsplitter in der Kreuzbeingegend habe und durfte daraufhin nach Hause fahren.
Kaum in Ortelsburg angekommen fiel ich wieder dem Soldatenrat in die Hände. Sie haben alles durchsucht, haben mir mein
Seitengewehr und eine Decke abgenommen, aber ich durfte weiter und bin dann kurz vor Weihnachten 1918 auf dem
elterlichen Hof angekommen. Schon auf dem Hof habe ich meine Kleider vom Leib gerissen, weil vor Läusen und anderem
Ungeziefer nicht mehr aushalten konnte und mich erst gründlich gewaschen bevor ich das elterliche Haus betreten habe.
Die Freude über das Wiedersehen war sehr groß.
“ Unser Leben zwischen den beiden Weltkriegen.”
Endlich wieder zurück in der Heimat
Rohmanen war durch die Kampfhandlungen 1914/15 zu einem drittel zerstört worden, aber schon
wieder im Aufbau. Die Firma Grzella aus Ortelsburg hatte die Bauarbeiten übernommen. Unter der Aufsicht von Polier
Karl Kontor wurden die Dachstühle errichtet. Ich habe mich, nach kurzer Erholungspause, auch als Zimmermanngehilfe am
Wiederaufbau beteiligt. Die Firma Grzella hat das Material geliefert und auch unsere Löhne gezahlt. Wegen meinem
Steckschuss bin ich dem VDK beigetreten und habe mit dessen Hilfe eine Rente beantragt die mir auch bewilligt wurde.
Nach vier Jahren wurde ich nach Allenstein zur Nachuntersuchung vorgeladen. Die ärztliche Untersuchung hatte ergeben,
das Geschoß sei verkapselt, und nur das linke Bein etwas in Mitleidenschaft gezogen. Daraufhin wurde die Rentenzahlung
eingestellt.
Der Stellmacher Adam Ornowski war im Krieg als Sanitäter eingesetzt und hatte auf Grund seiner Erfahrungen,
 Beziehungen zum medizinischen Dienst in Ortelsburg aufgebaut. Es wurden dort Lehrgänge in Erster Hilfe angeboten,
die von Prof. Dr. Kutz geleitet wurden. Adam Ornowski hat dafür gesorgt das einige junge Männer aus Rohmanen daran
teilnehmen konnten. Adam Ornowski, August Linka, Emil Rosowski, Johann Dembek, Emil Baschek und ich sind dann dem
Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes beigetreten und mussten jeden Sonntag am Lehrgang teilnehmen. Unser
Gruppenführer war Kreisobersekretär Albrecht, Landrat von Poser, als unser Ehrenvorsitzender, hat viel zu unserer
finanziellen Unterstützung beigetragen und hat dafür gesorgt dass die Bereitschaft eingekleidet wurde.
Beziehungen zum medizinischen Dienst in Ortelsburg aufgebaut. Es wurden dort Lehrgänge in Erster Hilfe angeboten,
die von Prof. Dr. Kutz geleitet wurden. Adam Ornowski hat dafür gesorgt das einige junge Männer aus Rohmanen daran
teilnehmen konnten. Adam Ornowski, August Linka, Emil Rosowski, Johann Dembek, Emil Baschek und ich sind dann dem
Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes beigetreten und mussten jeden Sonntag am Lehrgang teilnehmen. Unser
Gruppenführer war Kreisobersekretär Albrecht, Landrat von Poser, als unser Ehrenvorsitzender, hat viel zu unserer
finanziellen Unterstützung beigetragen und hat dafür gesorgt dass die Bereitschaft eingekleidet wurde.
In jedem Dorf wurde eine Unfallstelle eingerichtet, mit einem Verbandskasten und mit Verbandsmaterial für die erste
Hilfe ausgerüstet. Die Unfallstelle in Rohmanen, die am Haus von der Straßenseite, durch eine Tafel mit einem roten
Kreuz gekennzeichnet war, hatte ich zu verantworten. An Sonntagen wurden wir an Badestellen und bei Fußballspielen
eingesetzt, haben viele Übungen bei Waldbränden durchgeführt und auch Ausflüge nach Rudzany am Niedersee gemacht. Bei
der Einweihung des Tannenbergdenkmals in der Nähe von Hohenstein kamen wir an Straßenkreuzungen zum Einsatz.
Rohmanen hatte auch eine freiwillige Feuerwehr. Bis zum ersten Weltkrieg hat Friedrich Biella als Brandmeister das
Kommando gehabt. Er war aktiver Unteroffizier, hatte gute Führungsqualitäten und die Männer, die allesamt aus dem
aktiven Militärdienst stammten hatten zu ihm ein großes Vertrauen. Nach dem Krieg wollten diese Männer,
(Friedrich Nickel, Friedrich Willam, Julius Wittkowski, Jakob Janowski, Johann Gloddek, Gustav Bednarz), nicht mehr
weitermachen. Friedrich Biella, der inzwischen zum Gemeindevorsteher gewählt wurde, hat sich dann auf einer
Gemeinderatsitzung vorgeschlagen, für die Freiwillige Feuerwehr jüngere Kräfte anzuwerben.
Zum Brandmeister hat er Herrn Wilhelm Pilath vorgeschlagen. Der wurde dann nach Königsberg zur Fortbildung geschickt.
Der Feuerwehr gehörten nun folgende Personen an: Wilhelm Pilath(Brandmeister), August Linka(Stellvertreter), Gustav
Deptolla, Julius Matzey, Johann Dembek, Willy Willam, Gustav Rattay. Der Kreisbrandmeister war Heinrich Thalmann aus
Ortelsburg, sein Stellvertreter war Kreisobersekretär Salzmann. Der Bezirks-Kommissar bei der Ostpreußischen
Feuersozität War Herr Ernst Trzaska. Er hat dafür gesorgt das die Wehr uniformiert und mit Löschgeräten ausgerüstet
wurde. Da die alten Schläuche schon sehr marode waren, wurden sie durch moderne ersetzt, deren Kupplungen auch mit der
Motorspritze übereinstimmten.
Ernst Trzaska hat bei der Feuersozität und beim Landratsamt Finanzmittel beantragt und auch genehmigt bekommen. Der
Schneidermeister Wilhelm Baran wurde beauftragt Tuch und Drillichanzüge nach Maas zu schneidern. Er hat uns
Stoffmuster vorgelegt aus denen wir wählen sollten. Feuerwehrhelme haben wir auch bekommen. Die Gemeinde musste
Finanzmittel bereitstellen, einen Prozentsatz vom Gemeindebudget. Im Brandfall mussten für den Spritzenwagen Pferde
zur Verfügung stehen, von Willy Willam, Gustav Rattay, Julius Matzey und Gustav Dorka, weil sie in der Nähe des
Spritzenhauses wohnten. Am Spritzenhaus wurde ein großer Baum mit Querleisten aufgestellt, wo nach jedem Brand oder
einer größeren Übung die Schläuche zum trocknen aufgehängt wurden.
Der Kreisbrandmeister hat mindestens 2-3-mal im Jahr die Wehren besichtigt. Das ganze Dorf war dann auf den Beinen,
die Bauern mit Pferden, und andere Dorfbewohner mit Eimern und Spaten, wurden dann in verschiedene Gruppen eingeteilt.
Erst hat die Wehr sämtliche Aufstellungen am Gerät geübt; Grundstellung Fahrstellung und Marschstellung. Dann wurde
ein Brand angekündigt, die Feuerwehr mit der Spritze an den Brunnen, die Gruppen dort wohin sie beordert wurden, die
Bauern brachten mit den Wasserkiwen Wasser aus dem Brunnen zum Brandort. Wenn das Wasser im Brunnen alle wurde hat
man den Saugkorb in die Kiewen gelegt und dort Wasser entnommen. Die Wassergruppe ging mit Eimern zum Dorfteich, holte
Wasser und füllte damit die leeren Kiewen.
Der Löschtrupp ging mit Feuerhaken und Löschpatschen auf die umliegenden Gehöfte und versuchte das vermeintliche Feuer
von ihnen fernzuhalten. Nach dem Alarm wurde wieder am Spritzenhaus angetreten. Die Gruppenführer mussten angeben ob
ihre Gruppe auch vollständig erschienen war, denn Übungen wurden nur vor, oder nach der Feldarbeit durchgeführt, so
dass niemand eine Entschuldigung vorbringen konnte. Wer ohne begründete Entschuldigung nicht anwesend war erhielt eine
Verwarnung. Der Kreisbrandmeister erklärte dann welche Handgriffe den Vorschriften entsprachen und welche nicht. Die
Schläuche wurden noch schnell zum Trocknen aufgehängt. Anschließend gingen wir alle in den Gasthof Trzaska, haben über
vorhandene Mängel diskutiert, Verbesserungsvorschläge unterbreitet und zwischendurch den Durst gelöscht. Der
Kreisbrandmeister ist dann, nach einer kurzen Verabschiedung, ins nächste Dorf gefahren, weil er an einem Tag mehrere
Feuerwehren betreuen musste.
Der Rohmaner Dorffriedhof

Einen Kilometer vom Ende des Dorfes entfernt, auf der rechten Seite der Landstraße in Richtung
Ortelsburg, befand sich der Rohmaner Dorffriedhof. Wann dieser Friedhof angelegt wurde entzieht sich meiner Kenntnis.
Nach Aussagen älterer Dorfbewohner soll davor auch schon eine Ruhestätte vorhanden gewesen sein, und
zwar auf der linken Straßenseite gegenüber dem jetzigen Friedhof. An dieser Stelle befand sich bis in die
Nachkriegszeit ein kleiner Brunnen, aus dem die Dorfbewohner, das Wasser zum begießen der Grabbepflanzung auf den
Gräbern ihrer verstorbenen Angehörigen holten. Der Friedhof war in einer Hanglage angelegt, wahrscheinlich weil diese
Parzelle für eine landwirtschaftliche Nutzung nicht geeignet war. Um das Gräberfeld vor herumstreunenden Tieren oder
von der Weide entlaufenen Kühen zu schützen, hat man das ganze Gelände mit einem Holzzaun umgeben. Der Zugang befand
sich von der Straßenseite. Unter einem Torbogen hindurch wurden die Verstorbenen zu Grabe getragen. Die Gräber der
einzelnen Familien waren nebeneinander angelegt, mache, wie zum Beispiel die der Familie Trzaska, sogar mit einem
schmiedeeisernen Zaun eingefasst.
Nach dem 2. Weltkrieg verfiel der Friedhof immer mehr. Die nötigen Finanzmittel für die Pflege der Einfriedung konnten
von den restlichen noch verbliebenen Deutschen nicht mehr aufgebracht werden. An den gepflegten Gräbern konnte man noch
erkennen dass es Verwandte von noch in Rohmanen wohnenden Deutschen waren, oder von bereits im Westen Deutschlands
lebenden, die ihre noch in Rohmanen wohnenden Nachbarn damit beauftragt hatten. Die übrigen Gräber wurden von Jahr zu
Jahr immer mehr von Wildkräutern überwuchert und schließlich auch von Sträuchern und schnell wachsenden Bäumen.
In den späteren Jahren konnte man nicht mehr erkennen dass dort vor Jahren Tote zur letzten Ruhe gebettet wurden. Die
Natur holte sich das ganze Gelände zurück und nur unter großen Schwierigkeiten konnten Besucher aus dem Westen das
Friedhofsgelände noch betreten.
Das Gasthaus Trzaska

Nach dem ersten Weltkrieg hat der Gastwirt Friedrich Trzaska neben dem Gasthof einen großen Saal
für Festlichkeiten und Vereinsfeiern gebaut, in dem schon mal Feuerwehrfeste veranstaltet wurden. Ernst Trzaska war
Feuerkommissar bei der Ostpreußischen Feuersozität. Erich Trzaska war Vollziehungsbeamter beim Amtsgericht in
Ortelsburg. Unser Feuerkommissar war uns beim organisieren der Veranstaltungen sehr behilflich, hat uns den Saal, die
Musik und die Theaterstücke besorgt und die Feuerwehren aus den Nachbardörfern eingeladen.
Zu Manöverzeiten, vor dem 2. Weltkrieg und dann auch während des Krieges, waren im Gasthof Soldaten, meist im Range
eines Offiziers, einquartiert. Fräulein Mariechen Trzaska hat die Poststelle im Dorf betreut. Nachdem ich 1939 zum
Militär eingezogen wurde, hat sie, nach einer Schulung im Ortelsburger Krankenhaus, auch die Unfallmeldestelle
übernommen. Nach dem Krieg, pflegte sie mit vielen Bekannten, die bereits in der Bundesrepublik wohnten, einen regen
Briefwechsel. Auf dem Rohmaner Friedhof hat sie viele Gräber, im Auftrag von Angehörigen, die auf Grund ihrer
Abwesenheit, dazu nicht mehr in der Lage waren, gepflegt. Der Bauunternehmer Kurnitzki aus Ortelsburg, äußerte die
Bitte, sie möchte ihm doch ein Blatt vom Rosenstrauch, der auf dem Grab seiner Eltern steht, in den Brief legen. Als
sie uns den Brief vorgelesen hat, waren wir zu Tränen Gerührt. Sie hat als Letzte aus ihrer Familie, bis zu ihrem Tod
im Jahre 1960, in Rohmanen, im Gebäude der Gastwirtschaft gewohnt und ist auf dem Rohmaner Friedhof beerdigt worden.
Fleisch und Wurstwaren Karl Pelkowski
Im Jahr 1931 hat der Fleischermeister Karl Pelkowski, aus Grammen, direkt neben unserem Hof ein
Anwesen gekauft und dort eine Fleischerei eingerichtet. Er war mit meiner Schwester Frieda, verheiratet. Am Anfang hat
er die Schweine noch auf seinem Hof geschlachtet, später dann im Ortelsburger Schlachthof. Jede Woche fuhr er 2-mal,
mit dem Pferdewagen(Einspänner), nach Ortelsburg zum Wochenmarkt, wo er seine Fleisch und Wurstwaren zu Verkauf anbot.
Am Tag davor, wenn er die Wurst gekocht hat, kamen viele Rohmaner mit Kannen oder anderen Gefäßen, wegen der guten
Wurstsuppe, die er umsonst unter die Leute verteilte. Als Karl Pelkowski, Ende August 1939 zum Militär eingezogen
wurde, hat seine Frau das Pferd verkauft und den Beitrieb stillgelegt. Am Haus hing, immer noch die Tafel mit der
Aufschrift: Karl Pelkowski, Fleisch und Wurstwaren. Ein Witzbold hat irgendwann darunter geschrieben; „Fleisch und
Wurst waren einmal”, drauf hin hat Frau Pelkowski die Tafel entfernen lassen. Karl Pelkowski ist im Mai 1946 in
französischer Gefangenschaft verstorben. Seine Ehefrau Frieda, verstarb an ihrem 85. Geburtstag in Mettmann bei
Düsseldorf.
Die steinreichen Rohmaner Felder
Die letzte Eiszeit hat bei der Schmelze, auf der Rohmaner Feldgemarkung viele Steine und
Granitblöcke zurück gelassen. Überirdisch, aber besonders unter der Erde, gab es viele kleine, aber auch große Steine,
die, den Bauern, beim Pflügen und anderen Feldarbeiten sehr viel Schweiß, abverlangten. In einer Kiesgrube, auf dem
Feld des Bauern August Radek, lag ein Granitblock, von schätzungsweise 100 cbm. Vor etwa 80 Jahren, als man für diese
Steine noch keine Verwendung hatte, griffen die Bauern zu einer „List”. Weil er sonst nicht pflügen konnte, hat mancher
seinem Nachbarn, die Steine in der Nacht auf dessen Feld abgeladen. Als diese Tätigkeit unter Strafe gestellt wurde,
hat man die Steine in Schluchten gekippt und mit Mutterboden zugeschüttet. In späteren Jahren kam diese jedoch beim
pflügen wieder an die Oberfläche. Dann hat man aber schon Steine für den Straßenbau gebraucht und konnte sie so zu Geld
machen. Besonders im Raum südlich von Ortelsburg, bis zur polnischen Grenze, wo Steine eine Rarität waren, kamen sie
jetzt zum Einsatz. Auch beim Bau von Häusern, besonders für die Fundamente, wurden sie eingesetzt, weil auf diese
Weise viel Ziegeln eingespart wurden. Die Firma Gribienski aus Ortelsburg hat die großen Steine mit Dynamit gesprengt
und auf diese Weise die weitere Verarbeitung erleichtert.
Die Steine welche beim Pflügen aus dem Boden geholt wurden, hat man am Feldrand auf große Haufen zusammen getragen.
Wenn die Feldarbeit beendet war, sowie auch in den Wintermonaten, waren wir jeden Tag mit Steinen unterwegs. Wir sind
vorwiegend am Abend los gefahren, weil unter der schweren Last die Wagenachsen so heiß wurden und die Gefahr bestand,
das durch die Dehnung, die Räder blockiert würden. Bei einer Fahrt konnte man bis zu 24 Reichsmark verdienen, wogegen
1 Zentner Roggen für 8 bis 9 Reichsmark zu haben war. Ich bin selbst, mit dem Pferdewagen bis Fürstenwalde, Radostowen,
Luka, Altkirchen, Höhenwerder, ja sogar bis Friedrichshof gefahren.
In Rohmanen wurden auch rote Ziegeln gebrannt. Viele Häuser wurden, mit Ziegeln erbaut, die nur wenige 100 Meter von
der Baustelle entfernt hergestellt wurden. Der Lehn wurde auf den Feldern in der näheren Umgebung entnommen, dann von
Ochsen solange getreten, bis er so geschmeidig war, das er sich in Formen einstreichen ließ. Wenn die Ziegel in der
Form trocken war, wurde sie entnommen und in einem Brennofen gestapelt. Um einen Ofen richtig anzufeuern, brauchte man
12 Raummeter Holz, das im Zeitraum von ein par Tagen verheizt wurde. Der Fischer Karl Glitza hatte schon eine
Knetmaschine, die von einem Pferd angetrieben wurde, das mit verbundenen Augen, den ganzen Tag in die Runde ging.
Im Dorf waren auch vier Kalköfen, in denen so genannte Kalksteine, die sich an gewissen Stellen, im Erdboden befanden,
gebrannt wurden. Nach dem Brennen wurden die Steine mit Wasser abgelöscht und die daraus entstandne Masse diente, nach
dem Beimischen einer gewissen Menge Sand, dann als Bindemittel beim Häuserbau. Das Gerichtsgebäude und das
Lehrerseminar in Ortelsburg wurden mit Kalk, aus dem Rohmaner Brennöfen erbaut. Auch zum Bau einer Eisenbahnbrücke, auf
der, der Zug, den Sawitzfluß, von Ortelsburg nach Allenstein überquerte, hat mein Großvater, mit einem Ochsengespann,
Kalk gefahren.
Hinter der Scheune, beim Bauern Johann Dembek hat man Tonerde gefördert, aus der man mit Hilfe einer Formerscheibe,
die von einem Arbeiter mit Muskelkraft(Fußbetrieb) angetrieben wurde, schöne Krüge, Schalen und Vasen geformt hat.
Die Töpferware wurde, nachdem sie trocken genug war, auch in einem Ofen gebrannt, anschließend mit einer Lasur
überzogen und wieder gebrannt. Es wurden auch Kacheln zum Bau von Kachelöfen hergestellt, die mit verschiedenen
Ornamenten versehen, die Wohnstuben unserer Vorfahren schmückten. So haben unsere Großväter ihr Leben gemeistert und
nach und nach, unsere Dörfer aus der Rückständigkeit in die Neuzeit geführt.
Das gesellschaftliche Leben nach dem 1. Weltkrieg

Als der Lehrer Alfred Dorka, ein Frontkämpfer des Ersten Weltkrieges und ein Sportsmann, als
zweite Lehrkraft an der Rohmaner Schule angestellt wurde, hat er die Sitten und Gebräuche aus früherer Zeit wieder zum
Leben erweckt. Zuerst hat er die Jugend zusammen gerufen, einen Jugendverein und einen Fußballclub, gegründet. Zum
Vorsitzenden des Fußballclubs wurde Johann Gloddek berufen, der ihn auch geleitet hat. Bauer Wilhelm Spittka, der am
Rohmaner See wohnte, stellte Land für einen Sportplatz unentgeltlich zur Verfügung. Lehrer Alfred Dorka hat am
Rohmaner See eine Badestelle ausgesucht und ein Sprungbrett bauen lassen. An jedem Sonnabend im Sommer, bevor die
Sonne unterging, versammelte sich die gestammte Jugend des Dorfes an der Badestelle am See. Es wurde gebadet,
Heimatlieder gesungen, gespielt, im Fackelschein eines großen Biwakfeuers, bis in die späte Nacht hinein. Der Fischer
Karl Glitza hat uns Kähne zur Verfügung gestellt, mit denen wir auf den See hinausgepaddelt sind, dabei hatten wir viel
Spaß, was wiederum den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft gefördert hat. Ich habe mit meiner Mandoline den Gesang von
Volks- und Heimatliedern begleitet.
Der Rohmaner See liegt in einem Tal, dessen Hänge zu beiden Seiten mit Kiefern und Tannen bewaldet sind. Wenn man
gesungen oder Musiziert hat, hallte es von den Hängen zurück. Die Ufer waren mit Kalmus und Schilf bewachsen, was für
die Fischaufzucht von Vorteil war. Wenn man an einem sonnigen, windstillen Tag, am Seeufer spazieren ging, traf man
oft auf Flachstellen, an denen sich die Fischbrut im Sonnenlicht wärmte, wie ein Mückenschwarm. Im See befanden sich
folgende Fische: Karpfen, Hechte, Schleie, Barsche Plötze, Rotaugen, Aale und Krebse. Am Sonntagmorgen brachten viele
Rohmaner ihre Pferde zum See um sie zu baden.
Es wurden dort, unter der Aufsicht von Lehrer Dorka, auch viele Jugendfeste mit Theatervorführungen veranstaltet, zu
denen er selbst die Vorlagen organisiert hat. Der am See wohnende Bauer Johann Nadrowski, hat uns ein Scheunentor, als
Tanzboden zur Verfügung gestellt. Der Zimmermann Wilhelm Wittek hat uns eine Windmühle gebaut, die am auf dem Boden
liegenden Scheunentor aufgestellt wurde, dazu kamen Noch Tannen und Fichten, die das Ganze wie ein Bühnenbild
erscheinen ließen. Es wunden viele Bühnenstücke aufgeführt, unter anderen >Alte Weiber werden jung gemahlen<. Dazu bot
die Windmühle die entsprechende Kulisse.
Nach der Vorführung wurde der Boden aufgeräumt, um dann als Tanzdiele zur Verfügung zu stehen. Der Gastwirt Trzaska
hatte Tische und Bänke aufgestellt, Speisen und Getränke angeboten, so dass sich die die Veranstaltung bis in die
späte Nacht hinein zog. Es waren auch Leute aus Ortelsburg und anderen Nachbardörfern dabei. Im Winter hat Lehrer
Dorka eine Kreisrodelbahn eingerichtet, die von Zeit zu Zeit mit Wasser besprengt wurde, um die Gleitfähigkeit zu
verbessern. Von einer Anhöhe ging hinunter bis auf den halben See, was für alle ein großes Vergnügen war. Es kamen
Lehrer mit Schulklassen aus der näheren Umgebung um hier zu Rodeln.
Als Herr Lehrer Jobski als Hauptlehrer nach Rohmanen kam hat er mit dem Bürgermeister und der Gemeindeverwaltung
beschlossen, in der Nähe des Dorfes, auf einem zur Schule gehörenden Grundstück, einen Sportplatz anzulegen. Dafür
wurde gleich hinter den Gärten, 6 Morgen Ackerland abgetrennt, und nach Feierabend hat Lehrer Dorka mit den
Jugendlichen eingeebnet und gleich nebenan einen Graben für Schützenstand und Kugelfang ausgehoben. Am Sonntagvormittag
wurde Fußball gespielt und um 15:00 Uhr war Kleinkalieberschießen angesagt. Es musste auch ein kleiner Beitrag erhoben
werden, um Munition kaufen zu können. Eine Büchse konnten wir aus beim Kleinkalieberverein in Ortelsburg ausleihen.
Nach Hitlers Machtergreifung
Als Adolf Hitler an die Macht kam wurde die SA gegründet. Der Bürgermeister Michael Kownatzki
wurde zum Gruppenführer ernannt und folgende Männer haben sich freiwillig gemeldet: Wilhelm Matzey, Johann Gloddek,
Gustav Nadrowski, August Buttler, Karl Baran, Emil Nickel, Wilhelm Jaschinski, Emil Bork, Ernst Rattay und Gustav Bach.
Bei Versammlungen war die SA in Uniform angetreten um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Wer versucht hat Unruhe zu
stiften, egal aus welchem Grunde, wurde aufgefordert den Saal zu verlassen, andernfalls wurde er mit Gewalt entfernt.
Herr Lehrer Jobski wurde zum politischen Leiter ernannt, seine Frau hat die NS-Frauenschaft gegründet, Lehrer Dorka
die HJ, und so bekam die Dorfgemeinschaft, nach und nach ein anderes Gesicht. Der Sportplatz und der Schützenstand
wurden jetzt mehr als früher in den Mittelpunkt gestellt. Nach der Feldarbeit hat der Bürgermeister Fuhrwerke bestellt
und den Sportplatz noch besser herrichten lassen.
Der Bauer Wilhelm Both wurde zum Ortsbauernführer ernannt, mit der Aufgabe alles Land für den Anbau von Getreide und
Futtermittel bereitzustellen, oder wenn das nicht möglich war mit Wald aufzuforsten. Durch den Einsatz von Kunstdüngern
sollten größere Erträge aus dem Boden geholt werden, um den Viehbestand zu vergrößern und mehr Milch und Butter zu
produzieren. Deutschland sollte im Stande sein sich selbst zu selbst zu ernähren, ohne auf Importe angewiesen zu sein.
Frau Jobski hat, innerhalb der der NS-Frauenschaft, mit Hilfe von Fachkräften aus Ortelsburg, Lehrgänge veranstaltet,
auf denen man Backen und Nähen lernte. Auf den Bauernhöfen befand sich auch immer mehr Rassegeflügel, das eine erhöhte
Produktion von Eiern und Geflügelfleisch sicherstellen sollte.
Die Rohmaner Bauern hatten, außer in der Landwirtschaft, noch andere Verdienstmöglichkeiten in der Kreisstadt. In
Ortelsburg wurden vier Sägewerke betrieben, die mit Langholz aus dem Walde versorgt werden mussten. Wir haben eine
Kiefer von über 8 Festmeter angefahren, der wir zuerst 6 Meter Spitze abschneiden mussten, um diese Last überhaupt
auf den Wagen zu bekommen. Sechs Pferde musste angespannt werden um den Wagen zur befestigten Straße zu bringen.
Fichten und Tannen wuchsen bis zu einer Länge von 30 Metern. Auch beim Transport von Ziegel, von der Ziegelei zum
Bahnhof, konnte man gutes Geld verdienen.
Im Jahr 1934 wurde Rohmanen an das überregionale Stromnetz angeschlossen und schaffte auf diese Weise den Sprung von
der Petroleumlampe zur Glühbirne. Neben dem Grundstück von Karl Pietzonka wurde ein Transformatorhäuschen errichtet,
in dem der ankommende Strom von einer Hochspannung auf eine Verbrauchsspannung transformiert wurde. Es gab schon eine
Überlandleitung, die aus Richtung Ortelsburg kommend, quer über die Felder, in Richtung Neu Keykuth weiter ging.
Durch eine Zwischenspanne wurde der Transformator, mit der Hauptleitung auf Kownatzkis Feld verbunden.
Ein Stromanschluss konnte die Arbeit im Haus und Hof auf vielfältige Weise erleichtern, doch nur die besser gestellten
Bauern, sowie noch manche Pensionäre, die ein festes Einkommen hatten, konnten sich dass leisten. Weil nur wenige an
der Elektrifizierung teilnahmen, war ein Stromanschluss mit hohen Kosten verbunden. Nur Gustav Pietzonka, Gasthof
Trzaska, Friedrich Nickel, die Schule und Wilhelm Both, wurden in der ersten Phase erfasst.
Im Jahr 1952 wurde von den polnischen Behörden die zweite Stufe der Elektrifizierung eingeleitet, in der alle im Dorf
stehen Gebäude erfasst wurden. Am Anfang wurden nur Leitungen für Lichtstrom gelegt und auch nur 3 Lichtstellen pro
Haushalt bewilligt. Doch im nachfolgenden Zeitraum wurden dann, wenn Material vorhanden war, weitere Lichtpunkte
angelegt. 1952, am zweiten Wochenende im Advent, wurden dann die Leitungen geschaltet und alle waren von der
plötzlichen Helligkeit sehr begeistert. Wenn man Glühbirnen auswechseln wollte musste man am Anfang weite Wege
zurücklegen, um welche zu bekommen. In den 60ger Jahren wurden dann immer mehr Starkstromleitungen gelegt, weil die
Bauern elektrische Geräte kaufen konnten. Ende der 60ger wurden auch die Abbauten an das Stromnetz angeschlossen.
Das Urnengrab auf unserem Feld
Auf unserem Feld, in Richtung Seelonken, bin ich oft beim pflügen gegen Steine gestoßen, manchmal
rissen sogar die Stränge am Pferdegeschirr. Eines Tages nahm ich einen Spaten, Brechstange und einen langen Baum, um
der Sache auf den Grund zu gehen. Als ich eine Menge Sand ausgehoben hatte stieß ich auf eine steile, aus Steinen
errichtete Wand, die ich auch mit dem Baum nicht aus der Fassung bringen konnte. Ich habe den ganzen Vormittag gegraben,
konnte jedoch nicht unter die Steine kommen. Einige Tage später hatten wir in der Schule eine Bauernversammlung, da
habe ich Herrn Biella und Herrn Lehrer Dorka von meinem Fund berichtet. Am nächsten Morgen kam der Lehrer Dorka mit der
ganzen Schulklasse, mit Spaten und Sieben ausgerüstet auf unser Feld und fingen an die ausgehobene Erde zu sieben.
Lehrer Dorka benachrichtigte daraufhin den Leiter des Ortelsburger Heimatmuseums, der am nächsten Morgen vorbei kam um
sich die Fundstelle genau anzusehen. Er beauftragte ihn 4 Mann zu besorgen, um die Steine ringsum frei zu schaufeln.
Zwischen den Steinen durften wir die Erde nur mit Esslöffeln ausheben. Als es plötzlich zu regnen anfing hat Lehrer
Dorka die Brauerei Daum, in Ortelsburg angerufen, die uns über der Fundstelle ein Zelt errichtet haben, damit wir
ungestört weiterarbeiten konnten. Wir fanden 8 flache und 8 hohe Urnen zu beiden Seiten am Körper. Die Urnen wurden in
Gipsbinden eingewickelt und ins Heimatmuseum nach Ortelsburg gebracht, wo sie durch einen Fachmann, der extra aus einem
Königsberger Museum angereist war. Nach Reinigung der Urnen hat er festgestellt, das die Grabstätte etwa 2000 Jahre vor
Christi Geburt angelegt wurde und ein Doppelgrab war, in dem ein Toter liegend und einer in Hochstellung beigesetzt
wurde.
Die Nachricht von der Fundstelle verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Es erschienen viele Schaulustige, ganze
Schulklassen aus der Umgebung, mit Autos und zu Fuß. Durch die vielen Menschen wurden die bestellten Ackerflächen auf
unserem Feld sehr in Mitleidenschaft gezogen, eine Entschädigung haben wir nicht erhalten. Das Grab wurde vor dem
Heimatmuseum in Ortelsburg wieder so aufgebaut wie man es auf unserem Feld vorgefunden hat. Für den Transport der
Steine wurde ich entlohnt. Die Urnen hat das Königsberger Museum an sich genommen und wollte sie nicht wieder hergeben,
weil die solch einen Fund noch nicht in ihrer Sammlung hatten.
Sonnenwendfeuer
Am 24 Juni fand eine Sonnenwendfeier statt. Ein Brauch der an die alten Germanen erinnern sollte.
Der Lehrer Dorka hat den Bürgermeister beauftragt 2 Fuhrwerke in den Wald zu schicken, die Holz und alten Reisig holen
und auf dem großen Schulberg abladen sollten. Das Straßenbauamt hat uns Teertonnen zur Verfügung gestellt. Die ganze
Dorfgemeinschaft wurde eingeladen, am Abend, nach der Feldarbeit, an der Sonnenwendfeier teilzunehmen. Lehrer Dorka
hielt zuerst eine Ansprache, in der er anschaulich erklärte wie unsere Vorfahren in grauer Vorzeit gefeiert haben.
Nach dem offiziellen Teil wurden das Holz und die Teertonnen angezündet, es wurden Heimatlieder gesungen, wie: Wild
flutet der See, drauf schaukelt der Schiffer den schwankenden Kahn, Schaum wälzt er wie Schnee, von grausiger Mitte
zum Ufer heran, wild fluten die Wellen auf Vaterlands See, wie schön, oh trag mich auf Spiegel zu Hügel, Masovias See.
Masovia Land, mein Heimatland, Masovia es lebe mein Vaterland.
Lehrer Alfred Dorka und sein Wirken für Rohmanen.

Friedrich Biella hatte auf seinem Feld einen Granitstein mit einer geraden Seite, den haben wir
mit viel Schweiß an den Dorfteich transportiert und auf einer Erhöhung abgelegt. Der Stein sollte zum Denkmahl für die
Gefallenen des Ersten Weltkrieges umgestaltet werden. Da zu Wenige daran ein Interesse zeigten, wurde diese Idee fallen
gelassen und der Stein irgendwann ins Wasser gerollt. Der Lehrer Dorka war viele Jahre in Rohmanen tätig, dort hat er
später seine ehemalige Schülerin, Lotte Biella geheiratet. Er hat sich sehr für die Entwicklung des Dorfes interessiert,
war bei jeder Gemeindeversammlung anwesend und hat auf Schwachstellen hingewiesen die den Fortschritt behinderten.
Gemeinsam mit den Schülern hat er den Ehrenfriedhof für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges gepflegt, an der
Wegegablung nach Eichtal und zu Ehren des Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg eine Eiche gepflanzt.
Zum Advent hat Lehrer Dorka mit der Jugend einen Adventstern, in verschiedenen Farben gebastelt.
Der Stern wurde auf einer 2 Meter langen Stange befestigt, in der Mitte wurde ein Wachslicht angezündet, am Stern
wurde eine Schnur angebracht, wenn man daran zog rollte der Stern hin und her. Am ersten Wochenende im Advent
versammelten sich jung und alt, um den Stern durch das Dorf zu tragen. Alle schlossen sich dem vorausgehenden
Sternträger an, der den Stern durch die Hauptstraße und die angrenzenden Wege trug. Dieser Sternmarsch wurde an den
folgenden Adventwochenenden wiederholt.
Am ersten Weihnachtfeiertag wurde um 4:00 Uhr morgens ein Frühgottesdienst gehalten. Zuerst hat der Pfarrer eine
Andacht gehalten, dann haben die Kinder ein Krippenspiel aufgeführt und die Gemeinde hat schöne Weihnachtslieder
gesungen. Der Gastwirt Trzaska hat uns den Saal zur Verfügung gestellt. Wir hatten eine Posaunen- u. eine
Gitarrengruppe. Unter der Leitung von Herrn Willi Doormann spielten: Gottlieb Brosch, Fritz Ollech,
Gustav Rattay(Sopran), Wilhelm Pilath, Gustav Brosch(Alt), Fritz Both(Tenor) und Fritz Brosch(Bass).
In der Gitarrengruppe wirkten mit: Martha Ollech, Hedwig Ollech, Martha Lekzik, Martha Michalick und Auguste Lekzick.
Willy Doormann hat sie auf der Geige begleitet.
Kurz vor Ausbruch des 2. Weltkrieges
Bei der Aufstellung des Grenzschutzes(Regiment Buchholz), hat er als Hauptfeldwebel die
Gruppenführerkurse überwacht und selbst die fähigsten Männer dafür vorgeschlagen. Das Ausbildungspersonal hat das
Jäger-Battalion gestellt. Wir kamen zuerst ins Stadion(Waldheim), wurden da eingekleidet und dann ging es gleich
kasernenmäßig zu, theoretisch und praktisch. Jeder musste vor die Front treten und nachweisen ob er im Stande ist,
Befehle zu erteilen. Abends wurden Filme vorgeführt die uns zeigen sollten wie eine Gruppe sich im Gelände entfalten
muss. Die Exerziervorschriften hatten sich, im Verhältnis zu Kaiser Wilhelms Zeiten, etwas geändert. Damals bestand
eine Gruppe aus 8 Mann und einem Unteroffizier, jetzt aus 10 Schützen, 3 für das leichte Maschinengewehr und einem
Unteroffizier(13 Mann). Nach der Schulung folgte eine Abschlussprüfung, danach ein gemütliches Beisammensein. Aus
Rohmanen haben folgende Männer die Prüfung bestanden: Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy, Gustav Rattay und
Gustav Deptolla. Unsere Uniformen waren alle zu klein und es gab viel zu lachen bei der Anprobe.
Die erste Übung habe ich mit Emil Rosowski, in Lenzinen gemacht. Der Gutsbesitzer Marzinzick hat seine Scheune als
Unterkunft zur Verfügung gestellt. Er war im Range eines Hauptfeldwebels. In seinem haus war die Schreibstube
untergebracht, die er selbst verwaltete. Ein Lastauto hatte Uniformen aus der Kaserne in Ortelsburg geholt, jeder
musste eine Uniform anlegen und dann wurde solange getauscht bis alle eine passende gefunden hatten. An den Namen des
Kompanieführers kann ich mich nicht mehr erinnern. 1935 wurden wir zu einer Übung in die Dragonerkaserne nach Lyk
einberufen. Die Gruppenführer, Zugführer, und Kompanieführer die schon Frontberührung im dem Ersten Weltkrieg hatten,
mussten eine Woche früher anreisen. Die Übungen waren auf 6 Wochen angelegt. Die meisten der einberufenen waren noch
nie mit dem Wehrdienst in Berührung gekommen. Jeder Gruppenführer bekam 13 Mann zugeteilt.
Unser Zugführer war Leutnant Neumann, Kompanieführer Oberleutnant Rutschko, Battalions-Kommandeur Major Gröning
(Regiment Buchholz). Hier ging es wieder Kasernenmäßig voran. Das Bataillon wurde hier vereidigt. Jeden zweiten
Sonntag durften unsere Frauen uns besuchen. Ein Jahr später wurden wir wieder zu einer Übung einberufen, auf den
Truppenübungsplatz nach Arys. Jeder Gruppenführer hatte den Auftrag die Gruppe zu entfalten, und auf bewegliche
Figuren zu schießen. Diese Übung musste später mit scharfer Munition wiederholt werden. Jedes Maschinengewehr bekam
50 Schuss, jeder Schütze 20 Schuss zugeteilt. Nach dem Abschießen wurden die Treffer gezählt und dem Kommandierenden
Bericht erstattet. In einiger Entfernung spaziert ein Storch umher, der gar nicht bemerkt hatte dass geschossen wurde,
was bei den Kameraden ein großes Gelächter hervorrief.
Nach der Übung wurde uns gesagt das jeder Gruppenführer eine arische Abstammung nachweisen sollte. Ich konnte in den
Rheinsweiner Kirchenbüchern meine Vorfahren aus Gellen, bis zum Jahr 1732 zurück, nachweisen und wurde zum
Unteroffizier befördert. Aus unserem Dorf wurden auch, Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy und Gustav Deptolla
befördert. Zwischendurch mussten wir schon mal in die Radfahrer-Kaserne nach Ortelsburg, Gewehre empfangen und im
Gelände üben. Am 31 Juli 1939 wurde mir von einem Soldaten ein Schreiben übereicht, das mich aufforderte, am 1. August
um 6:00 Uhr, bei der 3. Kompanie, des 2. Infanterieregiments zu erscheinen.
Um 5:30 hat mich meine Schwester in die Kaserne gebracht. Auf der Schreibstube erklärte mir der Hauptfeldwebel,
dass mir ab sofort der Dienstgrad eines Sanitäters zugewiesen wird, ich mich in der Kammer einzukleiden hätte und mir
in der Handwerkerstube die entsprechenden Schulterklappen annähen lassen sollte. Die aktiven Sanitäter wurden den
Feldlazaretten zugewiesen und wir kamen an ihre Stelle. Unser Bataillon wurde nach Schodmak zum Bunker bauen und
Stacheldraht verlegen eingeteilt. Wir zogen in Begleitung einer Musikkapelle bis zur Kreuzung am Krankenhaus, dann
weiter zu unserem Bestimmungsort, gefolgt von einer Gulaschkanone die in den nächsten Tagen für unsere Verpflegung
sorgen sollte.
Am 14 August haben wir die Jägerkaserne, begleitet von einer Musikkapelle endgültig verlassen und zogen zuerst durch
Ortelsburg, dann über Lehmanen ins Feldmanöver, hinter Rohmanen. Dort entfaltete sich das Bataillon im Gelände, die
Verwundetensammelstelle wurde auf dem Hof des Bauern Friedrich Neumann eingerichtet. Gegen Abend wurde zu Sammeln
geblasen und Biwak bezogen, wobei unsere 3.Kompanie, in einem kleinen Wallt, in der Nähe von Otto Nickels Gehöft
Stellung bezogen hatte. Die 2. und 4. Kompanie hatte sich in der Nähe vom Abbau Pallasch niedergelassen. Die Frau
Nickel hat am Abend ein Mädel in Dorf geschickt um meiner Frau Bescheid zu sagen, wo wir uns zurzeit befinden. Meine
Frau ist dann noch gekommen um sich von mir zu verabschieden, weil wir am nächsten Morgen um 3:00 Uhr Zelte abbrechen
und um 4:00 Uhr in Richtung Kaspersguth marschieren sollten.
Wir sind dann über Achodden, Seelonken, Lehmanen, Ortelsburg, bis nach Grammen und Schützendorf marschiert, wo wir an
einem See Biwak bezogen haben. Es wurde immer gesagt, wir kommen zum Tannenberg-Denkmal bei Hohenstein, wo ein Reichs
Kriegervereinsfest stattfinden sollte. Es wurden auch schon Vorkommandos aufgestellt, doch dann kamen wir nach Orlau
und Lahna-Mühle, da wo die Alle entspringt haben wir 2 Tage biwakiert. Unser Kompanieführer hat uns nach Waplitz auf
den Soldatenfriedhof des Ersten Weltkrieges geführt und uns erklärt wie das Jägerbataillon sich 1914 hier entfaltet
hat und aufgerieben wurde. Dann mussten wir in der Nähe von Gut Koslau über einen Fluss und bezogen in einem Waldstück,
vorbereitete Stellungen in der Nähe der polnischen Grenze. Herr und Frau Thalmann haben uns jeden Tag, bis zur Grenze,
mit Brötchen und Getränken versorgt. Es wurde scharfe Munition ausgegeben, weil wir am nächsten Morgen um 4:00 Uhr die
polnische Grenze überschreiten sollten.
Am nächsten Morgen um 10 Minuten vor 4:00 Uhr kam der Befehl; scharfe Munition abgeben, alles zurück in ein 6 Kilometer
entferntes Dorf, wo wir auch einquartiert wurden. Das alles geschah’ eine Woche vor dem 1. September 1939. Es wurde
gesagt dass der Führer dem polnischen Präsidenten Rid-Szmigly, ein Ultimatum gestellt hat und es wahrscheinlich nicht
zum Krieg mit Polen kommt. Genau nach 5 Tagen kehrten wir wieder in die gleichen Stellungen zurück, es wurde wieder
scharfe Munition ausgegeben und am nächsten Morgen um 4:00 Uhr überschritten wir die polnische Grenze.
“Der 2. Weltkrieg.”
Der erste Einsatz in Polen
Wir kamen zuerst in ein Dorf in dem sich nur alte Menschen befanden. Auf unsere Frage wo denn die Bewohner wären sagte
man uns dass alle geflohen sind, weil erzählt wurde, die Deutschen würden alle Polen misshandeln und verstümmeln. Ich
habe ihnen daraufhin gesagt dass uns, unter Androhung von Strafe verboten wurde, einem Zivilisten etwas anzutun. Das
Vieh, die Schweine und Hunde des Dorfes liefen frei herum und die Soldaten fingen an auf die Hunde zu schießen, bis
gesagt wurde es seien Meldehunde im Dienste der Deutschen Wehrmacht und dieser Unfug der eigenen Truppe schaden würde,
weil etwaige Querschläger eigene Kameraden verletzen könnten. Wir gingen weiter auf polnischer Seite entlang der Grenze,
bis wir am Nachmittag die ersten Vorposten der Festung Mlawa erreichten, da befanden wir uns plötzlich im Feuerhagel
polnischer Festungsflack.
Am nächsten Morgen hatte ich schon 3 Verwundete und wusste nicht wo sich eine Verwundeten Sammelstelle befindet. Ich
suchte den Bataillonsgefechtstand auf der sich auf einer Anhöhe befand. Ich habe unseren Oberstabsarzt gefragt wo denn
die Verwundetensammelstelle wäre. Er rief beim Tross an, wo er die Auskunft erhielt, das sich vor dem Dorf ein Bunker
befindet in dem man die Verwundeten sammeln sollte, die dann von Sanitätsautos abgeholt würden, weil das Dorf unter
Artilleriebeschuss stand. Am Sonnabend haben unsere Flieger die Bunkerstellungen bombardiert, konnten aber, trotz guter
Treffer nicht viel ausrichten, die Bunker wurden nur etwas angekratzt.
Der Beschuss unserer vordersten Linien ging mit unverminderter Heftigkeit weiter. Am Sonntag verkündete eine große
Staubwolke die Ankunft unserer Panzer, doch sie kamen nur bis zur Panzersperre und mussten wieder abdrehen ohne den
Polen einen schaden zuzufügen. Ein Panzer bekam einen Volltreffer, der Fahrer konnte noch umkehren. Er blutete am Kopf
und der Schütze war so eingeklemmt, das wir ihn nur mit einem Seil unter den Armen, durch die Luke nach oben ziehen
konnten. Ob er seine Verwundung überlebt hat ist mir nicht bekannt, denn in der Nacht wurden Panzergeschütze nach
vorne in Stellung gebracht, die direkt in die Schießscharten der Bunker geschossen und so die Verteidiger vertrieben
haben. Daraufhin sind wir weiter vorgerückt. Auf einer Wiese war ein tiefer Graben ausgehoben und mit Ästen getarnt,
da war ein Panzer hinein gefahren, so dass nur das Hinterteil herausragte und er sich nicht aus eigner Kraft befreien
konnte. In der Luft waren Flieger die Brandbomben abwarfen, ich habe mich auf den Boden geworfen weil ich dachte die
würden explodieren, aber sie zischten nur, so das Stoppeln und Graß rings herum in Brand gerieten.
Bei den Kampfhandlungen gab es mehrere Verwundete, denen ich gerade Verbände anlegen wollte, als unser Hauptmann zur
Trillerpfeife griff um mir klar zu machen, dass ich ihm folgen sollte. Die Polen fingen an zu schreien, ich sollte
sie ins Lazarett bringen denn hier im Wald würde sie niemand finden. Ich setzte mich aufs Fahrrad und folgte unserem
Kompanieführer, der mir sagte ich soll immer bei der kämpfenden Truppe bleiben, denn hinter der Front sind die
Sanitätsabteilungen, die werden die Verwundeten schon versorgen. Der Vormarsch dauerte bis in die späte Nacht. Auf
einem Gehöft, das nach allen Seiten durch Feldwachen abgesichert wurde, machten wir endlich Rast. Wir haben
Getreidegarben auf dem Hof ausgebreitet und uns zur Ruhe gelegt, als plötzlich um Mitternacht Leuchtraketen den Himmel
erhellten und Maschinengewehrfeuer uns aus dem Schlaf schreckte. Ein par polnische Soldaten hatten das Feuer eröffnet,
aber sich kurz darauf ergeben.
Die Narew-Überquerung
Als es hell wurde ging der Vormarsch weiter. Es wurde uns untersagt Tagebuch zu führen, darum
weiß ich nicht wie die Orte hießen, durch die wir marschiert sind. Als wir durch ein sumpfiges Gelände vor drangen
stand auf einer Anhöhe am Horizont, die polnische Artillerie, die uns sofort unter Beschuss nahm. Unser Hauptmann war
der Meinung dass wir schon in der Nähe des Flusses Narew sein müssten, als aus den Sträuchern ein mit Schlauchboten
beladenes Lastauto auftauchte. Wir wurden aufgefordert mit je 6 Mann ein Schlauchboot zu nehmen, an einem Aggregat
der daneben stand mit Luft zu füllen und zu Wasser zu lassen. In einer Stunde war das ganze Bataillon über die Narew,
wo der Vormarsch fortgesetzt wurde. In einem Dorf überraschte uns die polnische Kavallerie und fing sofort mit
Maschinengewehren zu schießen an. Da kam der Befehl: Alles wieder zurück. Es ging noch schneller als auf der Hinfahrt.
Wir sind erst einige Kilometer am Fluss entlang gegangen und haben dann zum zweiten Mal rüber gesetzt.
Die Gehöfte im Dorf standen alle in Brand. Auf einem waren viele Bienestöcke. 2 Kameraden wollten den Stöcken Waben
entnehmen, doch die Bienen durch das Feuer aufgeschreckt, überfielen sie sofort und stachen derart zu das sie nicht
mehr wieder zu erkennen waren. Ich habe die Einstichstellen mit Salmiak betupft, mehr konnte ich nicht tun. Wir mussten
auf unserem Vormarsch durch einen Wald der in Flammen stand, so dass man kaum atmen konnte. Es ging weiter in Richtung
Minsk und Warschau, wo schon die Sowjetische Armee durchgegangen war, die Pferde und Vieh von einem Gut mitgenommen
hatten. In einem Wald stießen wir unverhofft auf ein Kloster, in dem wir einige Gefangene machten. Dann trafen wir auf
eine gute Straße die nach Grochow ging.
Als wir dort einmarschierten wurden wir aus den oberen Stockwerken beschossen, so dass wir, um uns zu schützen, nur an
den Hauswänden entlang gehen konnten. Wir haben jedes Haus nach Feinden durchsucht. Vor einem Haus stand ein Hund der
niemanden reinlassen wollte, solange bis ihn eine Kugel traf. Die polnische Artillerie feuerte von Warschau aus, um
unseren Vormarsch zu stoppen. Wir hatten uns gerade eingegraben als plötzlich deutsche Flieger am Himmel erschienen,
die unsere Stellungen mit Bomben bewarfen und dabei viel Unheil anrichteten. Wir haben sofort Fliegertücher
ausgebreitet und Leuchtraketen abgeschossen. Da ich in dem Graben, den ich kurz zuvor ausgehoben hatte, sofort in
Deckung gegangen bin ist mir zum Glück nichts passiert. Unter den anderen Kameraden gab es viele Verwundete, so dass
ich nicht wusste wem ich zuerst helfen sollte.
Der Oberstabsarzt hat mich sofort tatkräftig unterstützt, so das bald alle Verwundeten versorgt waren, außer einem,
dem ein Bombensplitter den Arm abgerissen hat. Ich habe im 3 große Verbandspäckchen auf die Wunde gelegt, doch die
Blutung ließ sich trotzdem nicht stoppen, so dass er eine Stunde später auf der Krankensammelstelle verstarb. Wir
haben danach in einem Tomatenfeld einen Graben ausgehoben und eine neue Abwehrstellung bezogen. Die Gruppe Schwarz
bekam den Auftrag nach etwaigen versprengten polnischen Verbänden Ausschau zu halten, als sie unerwartet aus einer
Häuserreihe mit Maschinengewehrsalven überschüttet wurden. Der Gruppenführer und noch ein Soldat wurden dabei tödlich
verwundet. Danach wurde noch ein weiter Stoßtrupp, unter der Führung von Leutnant Briskorn, der sich dazu freiwillig
gemeldet hatte, hinaus geschickt um den Gruppenführer und den anderen Toten zu bergen.
Bei diesem Unternehmen, das erfolglos ausging, weil die Toten schon verscharrt waren, durchschlug eine Kugel den
Stahlhelm von Leutnant Briskorn, der auch sofort tot war. Alle Toten wurden später, an der Kirchenmauer in Grochow, in
Särgen beigesetzt: Hauptmann Schönwald sagte, das sie nach dem Kriege auf den Heldenfriedhof nach Ortelsburg überführt
werden. Drei Tage lagen wir bei Grochow in Stellungen, waren dem polnischen Maschinengewehrfeuer sowie den Bomben
deutscher Flugzeuge ausgesetzt. In der Nacht musste ich zu einem Verwundeten in die vorderste Linie und habe den
Rückweg nicht mehr finden können, als plötzlich Gewehrfeuer aufflammte habe ich in den Ruinen Schutz gesucht. Erst im
Morgengrauen konnte ich mich wieder orientieren und zu meinem Unterstand zurückfinden.
Warschau wurde tagelang bombardiert und stand auch unter Artilleriebeschuss. Aus dunklen Rauchwolken kamen oft ganze
Bündel von Papier angeflogen. Die Verwundeten kamen oft auf Krücken zu unserem Unterstand, ich habe sie dann zur
Krankensammelstelle hingeführt. Wir haben auch polnische Zivilpersonen betreut, die während der Kampfhandlungen
verwundet wurden. Als einmal 2 Jungen vorbeiliefen hat einer ihnen nachgerufen sie sollten seiner Frau Bescheid sagen,
er wäre auf der Krankensammelstelle an der Kirche. Als wir dort ankamen war seine Frau, mit einem Kind auf dem Arm,
schon da.
Nach der Kapitulation von Warschau, gingen wir über Sokolow zum Bug und haben dort Quartier bezogen. Der Russe hatte
sich bereits hinter den Fluss zurückgezogen, hatte alles Vieh und Pferde mitgenommen. Dort erreichte mich ein Telegramm
von zu Hause, dass meine Tochter gestorben ist. Es sprach sich auch herum dass verschiedene Heimaturlaub bekommen haben,
ich durfte auch für 14 Tage heim. Wir fuhren mit Lastautos nach Allenstein in die neue Reiterkaserne, zum
Ersatzbatallion, da haben wir unsere Gewehre und Munition abgeben, dann durften wir, jeder in seinen Heimatort
weiterfahren.
Als wir unsere Quartiere am Bug verlassen haben war sehr viel Schnee gefallen. Hier in Ortelsburg fanden wir die
gleiche Wetterlage vor, aber nach 3 Tagen war alles wieder weggetaut und wir konnten die Kartoffelernte, die durch den
frühen Wintereinbruch gestoppt wurde, zu Ende bringen. Ein Tag bevor ich zu Hause angekommen bin wurde die Tochter
beerdigt. Nach 14 Tagen mussten wir uns in Allenstein melden, Gewehre empfangen und wieder zurück zur Division an den
Bug 150 Kilometer hinter Warschau. Die elfte Division, zu der wir auch gehörten sollte in den Westen Deutschlands
verlegt werden und war schon unterwegs zur Verladestation Skiernewice 50 Kilometer vor Warschau.
Mein Dienst als Sanitätsunteroffizier
Unser Bataillon kam in das Städtchen Burscheid, im Kreis Opladen, wo wir in Privatquartieren
untergebracht wurden. Nach 3 Monaten, im Januar 1940, wurden wir nach Solingen verlegt, wo wir bis zum
Frankreichfeldzug stationiert waren. Wir mussten an Feldübungen teilnehmen, wie andere die in Kasernen untergebracht
waren. Während dieser Zeit musste jeder seine Zähne in Ordnung bringen lassen. Jeden Tag fuhren 20 Mann in die
Cäzilienstraße nach Köln, zur Zahnklinik. Im Rheinland wurde unsere Division neu aufgestellt. Ausfälle durch den
Polenfeldzug wurden durch neue Soldaten ergänzt. Ich kam nun zum Ersatzbatallion, war der Älteste in der ganzen
Kompanie. Als der Frankreichfeldzug losging wurde unser Ersatzbatallion mit den noch vorhandenen Verwundeten, in die
neue Reiterkaserne, nach Allenstein verlegt.
Meine Frau hat, mit Unterstützung der Bauernschaft, einen Antrag gestellt, daraufhin wurde ich zur Frühjahrsbestellung,
beurlaubt und später bis auf weiteres vom Militärdienst freigestellt. Als der Russlandfeldzug losging wurde ich von der
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg, für 14 Tage einberufen. Ich war seit 1922, Mitglied der freiwilligen
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg und habe jedes Jahr an Übungen teilgenommen. Jede Bereitschaft musste etliche Leute
stellen. Von Rohmanen wurden Emil Rosowski, Johann Dembek, und ich, zur Krankensammelstelle Wirballen, in Litauen,
abkommandiert. Dorthin kamen Lazarettzüge aus Russland mit der Breitspurbahn. Die Verwundeten wurden frisch verbunden
und auf Waggon mit Normalspur verladen und nach Deutschland gebracht.
Als die 14 Tage vergangen waren wollten wir wieder nach Haus zurück, doch man wollte uns nicht entlassen. Stattdessen
wurden wir dem Wehrkreisamt Königsberg zugeteilt, neu eingekleidet und zur Aushilfe ins Lazarett nach Gumbinnen
abkommandiert. Mehr als ein Jahr war ich in den Urlauber-Baracken, habe dort Krankenstube betreut. Später, bis zum
Dezember 1944, war ich im Reserve-Lazarett 4, in Königsberg tätig. Dort habe ich auch die Luftangriffe der Engländer,
vom 25 bis 26. August 1944 miterlebt.
Wir sollten gerade einen Lazarettzug in Rotenstein entladen, als plötzlich die Sirenen ertönten - Fliegeralarm. Im
gleichen Moment waren die ersten Flugzeuge auch schon da, zuerst warfen sie „Tannenbäume” und danach Foßforkanister ab.
Die Omnibusse standen schon zur Abfahrt bereit als es losging. Wir haben die Verwundeten schnell in den
Luftschutzkeller getragen, haben die Betten von den Fenstern weggerückt damit die Verwundeten nicht von den
Glasssplittern verletzt wurden. Im Kasernenhof brannten die Fosforkanister lichterloh. Unsere Unterkunft, die sich in
einer Baracke befand ist völlig abgebrannt, mit dem Wenigen was wir unser Eigen nannten. Am nächsten Tag wurden wir neu
eingekleidet und am 29. bis 30. kamen die englischen Bomber wieder, sie setzten genau da ihr Zerstörungswerk fort wo
sie vor 3 Tagen aufgehört hatten.
Anfang Dezember 1944 musste ich mich nach Stablack melden und musste dann zur Sanitätsabteilung 1, nach Gernau, das
liegt zwischen Lodz und Warschau. Vormittags hatten wir Felddienstübungen und nachmittags theoretischen Unterricht.
Jeden Tag wurden Gruppen zusammengestellt und zu anderen Einheiten abkommandiert. Ich kam zu einer Panzerabteilung, wo
wir an einem Morgen plötzlich auf dem Kasernenhof antreten mussten und zu unserer Überraschung mit der Nachricht
konfrontiert wurden, dass der Russe an mehreren Frontabschnitten durchgebrochen war. Wir bekamen sofort einen
Marschbefehl in Richtung Lodz, wo das Stadtbild noch intakt war, selbst die Straßenbahnen fuhren noch. In der Nacht
haben russische Flugzeuge die Stadt bombardiert. Die Kaserne in der wir untergebracht waren hatte keine
Luftschutzkeller, aber zum Glück blieben wir von Bombentreffern verschont. Am nächsten morgen bot sich uns ein Bild der
Verwüstung. Die entgleisten Straßenbahnwagen, sowie andere Fahrzeuge blockierten die Straßen. Die Älteren unter uns
bekamen Fahrscheine für einen Transportzug, der bereit hinter Lodz abfahrbereit, unter Dampf stehen sollte. Als
russische Panzer in den Straßen auftauchten, verbrannte die Schreibstube unsere Wehrpässe und andere wichtige
Dokumente. Wir liefen zu der Station auf der unser Transportzug bereitstehen sollte, aber da war kein Zug mehr zu sehen
und wir setzten unseren Rückzug zu Fuß fort.
Der Rückzug und Zusammenbruch der Ostfront
In Dobroschin, einer Stadt in Polen, wurde gerade ein Lazarettzug verladen, doch wir kamen nicht
mehr zum Einsatz, weil die russische Infanterie uns schon auf den Fersen war. Es ging weiter über den Fluss Bober,
Sagan, bis nach Glogau an der Oder. Dort wurden wir der 29. motorisierten Sanitätskompanie zugeteilt. Im
Garnisonslazarett wurden noch Operationen durchgeführt. Unsere Division hatte ihr eigenes Feldlazarett, so dass wir den
Befehl zu Weiterfahrt erhielten und noch unbeschadet die Oderbrücke passieren konnten, denn Glogau wurde zur Festung
erklärt. Wir haben 2 Pferdewagen organisiert und mit Verbänden, sowie medizinischen Instrumenten beladen. So kamen wir
bis nach Lübbenau im Spreewald, wo wir in einem Schloss, in zuvor ein Museum war, unser Lazarett untergebracht haben.
Weil die Amerikaner Cottbus bombardiert hatten, wurden die Verwundeten zu uns nach Lübbenau gebracht. Hier haben wir
Tag und Nacht gearbeitet, um die vielen Verwundeten, aus den schweren Kämpfen bei Grünberg und Sagan zu versorgen. Die
Soldaten von der Abwehrfront kamen schon mit abgestorbenen Armen oder Beinen bei uns an, weil in vorderster Linie keine
Frontlazarette mehr vorhanden waren; es mussten viele Amputationen durchgeführt werden. Als für unsere Pferde kein Heu
mehr vorhanden war, schickte mich unser Hauptfeldwebel, zu einem Bauern in den Spreewald, mit dem Auftrag, Futter zu
besorgen. Mit noch zwei Mann fuhren mit zwei Kähnen, zuerst den Hauptstrom entlang und dann in einen Nebenarm; da haben
wir die Boote beladen und brachten das Heu nach Lübbenau.
Als wir uns bei unser Einheit zurück melden wollten, war alles schon marschbereit. Ich bin schnell in einen Bus
eingestiegen der sofort losfuhr, weil russische Verbände schon in sichtweite waren. Russische Flugzeuge kreisten über
den Dächern und nahmen, mit ihren Bordwaffen jeden unter Beschuss, der sich irgendwo blicken ließ. Wir konnten nur
durch den Wald, oder in der Nacht vorwärts kommen, denn wenn ein Auto auf der Landstraße fuhr, war alsbald ein Flugzeug
hinter ihm her und schoss es in Brand. Als wir nach Tagen am Ufer der Elbe ankamen, war bereits eine Ponton-Brücke
erstellt worden, welche die zerstörte Brücke ersetzen sollte.
Durch die vielen Fahrzeuge waren in den Sand tiefe Spuren gefahren, so dass andere Fahrzeuge unsere Busse ins
Schlepptau nehmen mussten, weil wir mit eigener Kraft nicht mehr weiterkamen. Beiderseits der Trasse standen
Flüchtlingswagen, in der der Hoffnung die Brücke passieren zu können, doch SS-Polizei verhinderte das die Gespanne den
militärischen Rückzug zum Stillstand brachten. Es gelang uns die Elbe zu überqueren, um in einem Waldstück Schutz vor
feindlichen Fliegern zu suchen.
Als wir unsere Busse und Autos gut getarnt hatten, hat unser Bataillonschef die anwesenden Parteigrößen zu sich
gerufen und ihnen erklärt das wir eine Einheit des Roten Kreuzes sind und nach internationalem Recht keine Waffen
besitzen dürfen. Nach langer, erregter Diskussion wurde beschlossen einen Graben auszuheben und alles im Sand zu
verscharren. Als wir dann weiter, durch die Dörfer fuhren, sahen wir schon viele weiße Bettlaken, als Zeichen der
Kapitulation, aus den Fenstern hängen. Es wurde uns erzählt dass der Bürgermeister von der SS erschossen wurde, weil
er die Bevölkerung zu diesem Schritt ermutigt hatte. Jetzt waren hinter uns die Russen und vor uns schon die Amerikaner.
Amerikanische Panzer fuhren umher und schossen wild durch die Gegend, ohne ein Ziel anzuvisieren. Niemand wollte sich
dem Russen ergeben, doch der Weg der zu den Amerikanern führte, war durch abgesägte Bäume blockiert. Wir sind schnell
in das nächste Dorf gegangen, haben uns Sägen und Äxte besorgt, die Bäume durchgesägt und in den Straßengraben
geworfen.
“ Nach dem Ende des 2. Weltkrieges.”
In amerikanische Kriegsgefangenschaft
Dann fuhren wir unter internationaler Flagge an eine Mulde Brücke, vor der zwei amerikanische Soldaten, mit Zigarren,
zur Hälfte im Mund, standen. Sie rauchten und kauten gleichzeitig. Wir mussten auf einen freien Platz fahren, alle
aussteigen und rechts wieder antreten. Wäschebeutel und Tornister mussten wir abstellen; danach wurden wir nach Waffen
durchsucht, Wertsachen, Uhren und Messer wurden uns gleich abgenommen. Als wir anschließend an unserem Gepäck
vorbeigingen durfte niemand was mitnehmen. Als ich gebückt, nach meinem Wäschebeutel greifen wollte, in dem sich noch
3 Konservendosen und ein Brot befanden, bekam ich einen Fußtritt ins Gesicht, so dass mir ein Zahn ausgeschlagen wurde.
Wir wurden dann in einem Garten zusammen getrieben und gefragt ob jemand bei der SS gedient hat. Nachdem wir in Reihe
und Glied angetreten waren, mussten wir den Oberkörper freimachen und die Arme anheben. Es wurde nach SS-Zeichen
gesucht, die gewöhnlich unter dem Oberarm eintätowiert waren. Nachdem wir Grimma bei Leipzig, wo wir in amerikanische
Gefangenschaft geraten waren, verlassen hatten, mussten wir durch ganz Thüringen bis Hersfeld, an der Grenze zu Hessen,
marschieren. In Hersfeld wurden wir auf große Lastautos verladen, die von farbigen Soldaten gefahren wurden. Man hat
uns mit Stöcken hinauf getrieben, solange bis das Auto so voll war das man kaum stehen konnte. Die Soldaten fuhren, für
diese Straßenverhältnisse, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Wenn die Straße eine scharfe Kurve hatte, flogen
wir alle übereinander und mussten erst mit viel Kraftanstrengung auf die Beine kommen um diese Fahrt zu überstehen.
Da die Straßenränder in dieser Gegend mit Obstbäumen bepflanzt sind und deren Äste sehr niedrig hängen, hätten die
uns die Köpfe abgerissen, wenn wir uns nicht ständig geduckt hätten. Unsere Fahrt endete in Bad Kreuznach, in der Pfalz,
wo wir in ein Lager, in dem sich später 130.000 Mann und 6 Generäle befanden, eingepfercht wurden. Die Unterkunft der
Generäle befand sich unter einem Zelt, alle anderen mussten die Zeit unter freiem Himmel zubringen. Die Offiziere, die
Unteroffiziere, die Mannschaften; wurden in getrennten Camps untergebracht. Die Mannschaften wurden auch zur Arbeit
abkommandiert und konnten bei dieser Gelegenheit, Brot, Brötchen oder Zigarettenstummel organisieren, wogegen die
Offiziere und Unteroffiziere ihr Camp überhaupt nicht verlassen durften.
Die ersten Tage gab es kein Wasser und kein Brot, so dass die Kameraden vor Erschöpfung umfielen. Später standen wir
manchmal den ganzen Tag nach Wasser an, das von den, uns bewachenden Negern mit großen Wassertanks angefahren wurde. Am
dritten Tag bekamen wir mittags und abends etwas zu Essen; Brot bekamen wir erst nach zwei Wochen, nach dem aus der
Umgebung herbeigeholte Handwerker, Backöfen gebaut hatten. In den verschiedenen Gemeinden, die in den uns umgebenden
Weinbergen lagen, mussten sich alle Männer beim Bürgermeister melden. Als sie dann erschienen waren, wurden sie auf
bereitstehende Lastautos getrieben und zu uns ins Lager gebracht. Sie waren ohne Kopfbedeckung und ohne wärmere
Bekleidung angekommen, weil ihnen gesagt wurde, dass ihr Aufenthalt im Lager nur von kurzer Dauer sein würde. Man hat
uns, falls noch vorhanden, Decken und Mäntel abgenommen, mit der Begründung, sie würden für Kranke und Verwundete
gebraucht. Jeden Tag starben mehr als 200 Mann, die wir sofort in ein Zelt tragen mussten. In der Nacht wurden die
Toten dann mit unbekanntem Ziel, weggefahren.
Viele haben ihren Verstand verloren uns irrten im ganzen Camp ziellos umher. Als Latrinen wurden Gräben ausgehoben, in
die verschiedene Kameraden, bei der Verrichtung ihrer Notdurft, vor Schwäche hineingefallen sind und nicht mehr wieder
heraus kamen. Aus den Pfählen die, die jungen Obstbäume stützten, haben wir Krankentragen gebaut um unsere Kameraden,
bei Bedarf, zur Krankensammelstelle zu tragen. Es war in diesem Frühjahr auch sehr kalt, doch unsere Erdlöcher, die wir
zum Schutz vor Kälte und Wind, nur mit leeren Konservendosen ausgehoben hatten, durften nicht tiefer als 20 Zentimeter
sein. Nach jedem Regenguss mussten wir das Wasser ausschöpfen. Nach einem Gewitter, standen wir wiedermal, total
durchnässt in unserem Camp, als unerwartet am Horizont die Sonne hervortrat. Einer unserer Kameraden hatte noch eine
Trompete gerettet und fing, von dem Anblick völlig überwältigt, zu spielen an: "Es geht alles vorüber, es geht alles
vorbei, nach jedem Dezember, folgt wieder ein Mai". Daraufhin hob sich die Stimmung der tiefbetrübten Kriegsgefangenen,
so das Heimatlieder durch das ganze Camp erklangen, obwohl wir in den nassen Kleider herumgehen mussten, bis sie am
Körper trocken wurden.
In französischer Kriegsgefangenschaft
Nach etwa einem Monat, haben uns die Amerikaner, den Franzosen, zum Arbeitseinsatz, ausgeliefert.
Etwa 4 Kilometer von Bad Kreuznach entfernt, stand auf freier Strecke, ein Zug mit offenen Kohlenloren, auf den wir
verladen wurden. In jeden Waggon, wurde pro Person eine Tafel Schokolade und ein Päcken Zwieback rein geworfen, doch
viele Kameraden fanden nur leere Päckchen vor, weil die schon zuvor von der französischen Wachmannschaft geplündert
wurden. Wir haben uns darüber beschwert, doch die haben uns nur ausgelacht. Nachdem wir zunächst bei Mainz über den
Rhein fuhren, endete unsere Fahrt bei Paris in einem großen Zeltlager. Dort wurden wir auf andere Züge verladen, die uns
nach Südfrankreich, in ein Barackenlager, bei Mazarei, brachten.
Auf einer Zwischenstation hat man uns unter einer Pumpe, die Lokomotiven mit Wasser versorgt, abgestellt, den Kran
aufgedreht und uns anschließend ausgelacht, die Kinder Haben uns mit Steinen beworfen. Ein Wachmann kam in unseren
Waggon gekommen, hat unser Gepäck durchsucht, wenn er Tabak oder Zigaretten gefunden hat, nahm er sie mit. Die Kameraden
waren darüber so empört, dass sie vorhatten, ihn nachts unter den Waggon zu werfen. Wir haben sie gebeten dass zu
unterlassen, weil man uns in diesem Falle, alle erschießen würde.
Als wir ins Lager kamen wurden wir zuerst gezählt, dann mussten wir unser Gepäck stehen lassen und beiseite treten.
Wenn man bei der Nachkontrolle noch was in den Taschen fand, wurde das auch entwendet, selbst Esslöffel. Wir wurden
dann in drei Baracken, ohne Toiletten, eingeschlossen. Die Kameraden haben ihre Bedürfnisse in Kochgeschirre erledigt
und durch ein kleines Fenster, das sich fast unter der Decke befand, hinausgeworfen. Andere Fenster ließen sich nicht
öffnen, weil sie mit Stacheldraht zu geflochten waren. Als die Kameraden die Kochgeschirre auskippten, haben die
Wachposten geschossen und die Fenster zertrümmert. Sie waren der Meinung dass wir ausbrechen wollten. Es herrschte eine
große Hitze, in den überfüllten Baracken sind wir fast erstickt. Am nächsten Tag haben wir uns über fehlende Toilettem
beschwert, da haben sie Heringsfässer durch die Hälfte geschnitten und an der Ausgangstür hingestellt. Um bei den
überfüllten Räumen dort hinzukommen, musste man über die Köpfe der Anderen steigen. Viele hatten Fieber und Durchfall
und mussten in die Krankenstube eingeliefert werden, wo sie kurz darauf verstarben.
Besonders Raucher litten sehr an der Unterernährung, bekamen Wasser in den Beinen und waren die Ersten die verstarben.
Nach der Registrierung wurden wir auf andere Baracken verteilt. Die Zivilbevölkerung kam in die Räume und begann uns
auszuplündern. Wer noch gute Schuhe besaß musste sie ausziehen und bekam dafür die kaputten des Plünderers. Eine Woche
lang mussten wir diesen Zustand ertragen, erst als die Kameraden sich beschwerten, wurde am Eingang eine Tafel am
Eingang angebracht, dass die Zivilbevölkerung das Lager nicht betreten darf. Bis auf einige, wenige Ausnahmen wurde
diese Anweisung befolgt.
Als wir im Lager ankamen, war der französische Lagerkommandant, ein ehemaliger Kriegsgefangener, der bei einem Bauern
in Deutschland gearbeitet hatte. Dieser Bauer war jetzt als Kriegsgefangener in seinem Lager. Als er ihn erkannte, hat
er ihn gleich zum Küchendienst eingeteilt und mit dem nächsten Krankentransport nach Hause fahren lassen. Zu Mittag
bekamen wir nur gekochte Haferkörner, da schwamm alles oben, später war man dann auf Gerste umgestiegen. Als viele
daran gestorben waren, weil sie diese „Rohkost”, die nur ein Kuhmagen verträgt, nicht gegessen haben, hat man die
Körner durch eine Schrotmühle laufen lassen. Dann hat man uns Steckrüben gekocht; wir bekamen 250 Gramm Weißbrot,
etwas Quark und ein viertel Liter Magermilch. Später, als wir schon arbeiten mussten, hat man in unserem Essen einen
Kuhkopf mitgekocht, das hat dann bedeutend besser geschmeckt.
Bevor wir morgens zur Arbeit gingen, mussten wir zu Flaggenparade und abends, nach der Rückkehr, haben wir die Flagge
wieder eingeholt. Wir haben einen Kanal gereinigt, dessen Sohle 2 Meter dick mit Schlamm bedeckt war. Zuerst wurde das
Wasser abgelassen, dann haben wir, einer dem andern, den Schlamm mit der Schippe hoch gereicht. Der Letzte hat den
Schlamm, der so zäh war, dass er nicht von der Schippe wollte, oben am Rande abgelegt. Manchmal waren 10 Mann nötig um
den Höhenunterschied zu überwinden. Das Wachpersonal schoss über unsere Köpfe hinweg und rief: „schnell arbeiten”. Bei
der großen Hitze war das ein Ding der Unmöglichkeit, zumal es nichts zu Trinken gab. Auf dem Heimweg haben wir im Walde
Heilkräuter gesammelt, die man in der Küche getrocknet und als Tee zubereitet hat, den wir am nächsten tag zur Arbeit
mitnahmen, um unseren Durst zu stillen.
Unser Aufseher hatte einen Stock, an dem sich noch kurz abgeschnittene Äste befanden. Wer seiner Meinung nach, nicht
ordentlich gearbeitet hat, bekam gleich Schläge auf den Rücken. Die weißen Aufseher wurden irgendwann durch Neger
ersetzt, die uns bedeutend besser behandelt haben. Wenn irgendetwas schief ging, haben sie nichts gesagt, nur gelacht.
In den übrig gebliebenen Wassertümpeln hatten sich noch einige Aale versteckt, die wir zu fangen versuchten, was uns
auch manchmal gelang. Wir mussten ihnen das Genick brechen, damit sie uns nicht entwischen konnten. Wenn die Franzosen
bemerkten das wir Aale hatten, wurden sie uns abgenommen. Gelang es uns aber, sie ins Lager zu bringen, dann haben wir
uns eine köstliche Malzeit zubereitet.
Um sicherzustellen dass niemand geflüchtet ist, wurden wir, wenn wir abends ins Lager zurückkamen, zuerst gezählt.
Diese Zählung wurde mehrmals wiederholt, weil die Wachmannschaften sich immer wieder verzählt haben. Als einer von uns
hin ging, ihnen sagte dass alle da sind, wollten sie es nicht glauben und haben uns vor dem stehen lassen, bis es ihnen
irgendwann einfiel. uns doch das Tor zuöffnen. Einmal, als wir von der Arbeit zurückgekehrt waren, standen wir bis 23
Uhr neben der Flagge, weil uns niemand das Tor geöffnet hat. Als wir dann doch irgendwie ins Lager kamen haben wir
festgestellt, dass das ganze Wachpersonal betrunken war und niemand im Stande uns das Tor zu öffnen.
Eines Tages waren wir wieder abends zur Parole angetreten, als ein älterer Herr mit seinem Hund, am Stacheldraht
entlang, spazieren ging. Weil der Hund, unterm Stacheldraht hindurch, zu uns kam, hat ihn einer geschnappt, ihm das
Genick gebrochen und unter seiner Jacke versteckt. Der Franzose hat nach seinem Hund gerufen und gepfiffen, aber alles
vergebens, der Hund war nicht aufzufinden. Die Kameraden haben ihm gleich das Fell über die Ohren gezogen, das Fleisch
gekocht und das Fell in die Latrine geworfen. Das Fleisch wurde umgehend verspeist.
Als wir am nächsten Tag von der Arbeit zurückkehrten, war im Lager der Teufel los. Wir mussten sofort antreten und
wurden gefragt, wo der Hund geblieben ist, der Gestern Abend, mit seinem Herrchen, am Zaun entlang spazieren ging. Als
sich niemand dazu bekannte, mussten wir weiterhin stehen bleiben, während die Wachmannschaften von Baracke zu Baracke
gingen und alles durchsuchten. In einer Latrine hat man dann das Fell gefunden, was uns ein furchtbares „Donnerwetter”
einbrachte und in den nächsten Tagen, nach der Arbeit, unter dem Kommando eines Oberfeldwebels, eine Stunde
nachexerzieren.
In Südfrankreich regnet es den ganzen Sommer nicht; die Bauern haben da keine Scheunen und das Getreide wir nur in
Schobern aufgestellt und dann umgehend gedroschen. Vom Oktober bis Dezember regnete es fasst jeden Tag in Strömen.
Gesät wird nur im Frühjahr und im Herbst, weil im Sommer alles vertrocknet. Es wird viel Wein angebaut und die
Steckrübe wächst den ganzen Winter. Neben den Weinreben wurde aus Schieferplatten ein Zaun aufgestellt, um dem Wein
einen optimalen Standort zu sichern. Die Bauernwagen hatten nur zwei Räder und waren nur mit einem Pferd bespannt, das
die ganze Balance des Wagens zu halten hatte. Trotzdem haben sie soviel aufgeladen wie wir auf einen Leiterwagen. Viele
Kameraden wurden den Bauern zur Arbeit ausgeliehen. Wenn ein Bauer einen Arbeiter gebraucht hat und es wurde gefragt,
wer sich in der Landwirtschaft auskennt, da haben sich alle gemeldet. Der Bauer konnte sich dann aussuchen, wen er
mitnehmen wollte.
Wenn wir durch die Stadt zur Arbeit gingen, haben verschiedene Leute Fallobst in die Abfalleimer gelegt. Wenn das von
den Kameraden bemerkt wurde, schwenkten viele aus der Reihe, um sich etwas mit zunehmen, was von den Wachmannschaften
nicht gern gesehen wurde. Viele Kriegsgefangene hatten keine Schuhe mehr, sie haben die Füße nur mit Lumpen bewickelt.
Eines Tages kamen Kameraden aus Norwegen, die nach Deutschland entlassen werden sollten. Mann hat sie jedoch ins Lager
gesteckt und zur Arbeit eingeteilt. In Norwegen hatten sie Kleider und Stoffe eingekauft, hatten volle Seesäcke und
sogar Karren auf 2 Rädern, weil sie ja in die Heimat entlassen werden sollten. Als wir morgens zur Arbeit rausgeführt
wurden standen sie schon vor dem Lager. Wir haben ihnen zugerufen, dass sie uns etwas abgeben sollen, weil ihnen ja
sowieso alles abgenommen wird, aber sie haben uns nur ausgelacht. Als sie ins Lager Kamen mussten sie ihr Gepäck
ablegen, wurden dann wo anders hingeführt und haben es danach nie wieder gesehen.
Durch die vielen Läuse, Flöhe und Wanzen die wie im Lager hatten, kam es bei verschieden Kameraden, an den
Einstichstellen, zu eiternden Entzündungen. Um dem vorzubeugen hat man uns mit einem Pulver, das in Frankreich
hergestellt wurde, aber bei den Parasiten keine Wirkung zeigte, eingesprüht. Erst bei der Anwendung eines Mittels
amerikanischer Herkunft, war alles über Nacht verschwunden.
Der Sonntag war arbeitsfrei. Dann kam ein katholischer, französischer Pfarrer, eskortiert von 3 Mann, mit
aufgepflanztem Seitengewehr ins Lager und hat Gottesdienst gehalten. Einen evangelischen Pfarrer gab es nicht, nur
einen Baptisten Prediger. Der wurde würdevoll eingekleidet, bekam ein großes Kreuz und hat jeden Sonntag in einer
extra dafür hergerichteten Baracke Gottesdienst gehalten. Wer Theologie studiert hatte und sich meldete, wurde zu
einem Seminar geschickt und konnte sein Studium fortsetzen. Glasbläser durften das Lager auch verlassen und ihrem
erlernten Beruf wieder arbeiten.
Wer sich freiwillig, für 5 Jahre, zum Dienst in der Fremdenlegion verpflichtet hat, das waren etliche unter uns, wurde
neu eingekleidet, bekam gutes Essen und Rauchwaren soviel er wollte. Nach einem Jahr wurden, nach und nach, die
Kranken und Körperbehinderten in die Sowjetische Besatzungszone entlassen. Eine Entlassung von Kriegsgefangenen, die
in den Westzonen oder jenseits von Oder und Neise zu Hause waren, war nicht vorgesehen. Die Österreicher wurden alle,
unabhängig von ihrem Gesundheitszustand entlassen.
Ich habe Briefe nach Hause geschrieben, aber die kamen nur bis Allenstein und wurden wieder zurück geschickt. Als eine
Kommission des Roten Kreuzes aus der Schweiz unser Lager besichtigt hat, haben wir uns beschwert, das wir als
Sanitätsdienstgrade, zur Arbeit gehen müssen. Daraufhin erging ein Befehl: Wer einen vom Roten Kreuz, ausgestellten
Ausweis besitzt, gehört einem internationalen Verband an und braucht nicht zu Arbeit gehen. Aus unserem Lager hatten
sich 20 Mann gemeldet, die daraufhin Freigang, in Begleitung von zwei französischen Wachsoldaten erhielten. Als wir
gefragt wurden wo wir hin wollen, entschlossen wir uns, einen Soldatenfriedhof, auf dem unsere verstorbenen Kameraden
beerdigt waren, zu besuchen.
Da der Untergrund in dieser Gegend aus Felsen bestand, wurden die Gräben, in denen die Toten in selbst gezimmerten
Kisten nebeneinander gestellt wurden, mit Hilfe von Dynamit ausgehoben. Ein Leichenwagen, mit einem Pferd bespannt,
das mit einer schwarzen Decke abgedeckt war, wurde von einem Kutscher in angemessener Kleidung, gefahren. Der Wagen
konnte gleichzeitig 4 Kisten transportieren. Wenn wir von der Arbeit kommend, dem Leichenwagen begegneten, wurde
gehalten und mit einer Schweigeminute der Toten gedacht, bis der Wagen vorbei war. Die Zivilbevölkerung verharrte auch
im Schweigen, mit abgenommener Kopfbedeckung.
Ein Kamerad, der in Krottorf, Kreis Oschersleben, bei Magdeburg, zuhause war, sagte bei seiner Entlassung zu mir:
Sollte ich das Glück haben, meine Entlassungspapiere zu erhalten ohne eine Bleibe vorzuweisen, dann soll ich Krottorf
als Heimatadresse angeben. Auf der Krankenstube habe ich angegeben, dass sich noch ein Schrapnellsplitter, aus dem
Ersten Weltkrieg, in meiner Kreuzbeingegend befindet, er zwar verkapselt ist, aber immer noch Beschwerden verursacht.
Daraufhin wurde ich zur Entlassung vornotiert. Als bekannt wurde das ein Rückkehrertransport in die sowjetische
Besatzungszone zusammengestellt wird, habe ich mich sofort gemeldet und wurde für ein Entlassungslager in Angoleme
vorgesehen. War das eine Freude, als uns mitgeteilt wurde, wann der Rücktransport stattfindet.
In unserem Lager waren noch 2 Kameraden aus dem Kreis Ortelsburg: Ein Gustav Lumma aus Leynau und ein Alfred Moritz
aus Groß Schöndamerau. Sie mussten noch zurückbleiben und haben mir den Auftrag erteil, die Angehörigen in der Heimat
zu grüßen und ihnen die Anschrift mitzuteilen. Als wir im Entlassungslager ankamen, fragte man uns nach unserer
Heimatanschrift. Dann wurden die Entlassungspapiere angefertigt. Es wurde uns auch ein Barscheck, für die in Frankreich
geleistete Arbeit ausgehändigt, den wir bei jeder Kasse in Deutschland einlösen könnten. Ich habe ihn bis zum heutigen
Tage nicht einlösen können, obwohl ich irgendwann in der Zeitung gelesen habe, das Verrechnungschecks die den aus
französischer Kriegsgefangenschaft Entlassenen, ausgehändigt wurden, einzulösen sind.
Wir kamen zuerst nach Saar Elbe, dann in die Nähe der Zonengrenze zu Thüringen. Hier mussten wir 2 Tage warten, weil
aus der sowjetischen Besatzungszone keine Eisenbahnwagen bereitgestellt wurden. Angesichts dessen, das der Russe beim
letzten Transport die aus Frankreich kommenden Wagen kassiert und nicht mehr herausgeben wollte, bestand der Franzose
jetzt darauf, seine Wagen sofort wieder mitzunehmen. Als der sehnsüchtig erwartete Zug endlich eintraf, durften wir
umsteigen und kamen, immer noch hinter Stacheldraht, nach Erfurt. Von dort weiter ins Quarantänelager nach Prätsch an
der Elbe.
Unter Androhung von Strafe war es verboten das Lager zu verlassen, doch der Hunger zwang uns dazu, in den umliegenden
Dörfern um Lebensmittel zu betteln. Man drohte uns damit, dass Zuwiderhandlungen, mit einer 14-tägigen Verlängerung der
Quarantäne geahndet werden. Der Roggen war schon reif und wir haben, auf den umliegenden Feldern, die Ähren abgerissen,
das Korn, zwischen 2 Steinen zu Mehl zerrieben, um daraus eine Suppe zu kochen, denn von dem was unsere Lagerküche uns
bieten konnte, war es nicht möglich zu überleben. Als der Eigentümer bemerkte wer seine Roggenähren entwendet hat, kam
er ins Lager, gerade zu dem Zeitpunkt als wir mit dem Mahlen beschäftigt waren. Der Lagerkommandant, bei dem er sich
beschwerte, drohte uns zu bestrafen, wenn wir unsere „Rauzüge” nicht unmittelbar einstellen würden. Wir sagten ihm er
solle uns heimfahren lassen, da wir doch lange genug hinter Stacheldraht gesessen hätten.
Endlich wieder in Freiheit
14 Tage nach unserer Ankunft wurden uns Entlassungspapiere ausgehändigt, sowie auch Fahrscheine
zum den, von uns angegeben Heimatorten. So kam ich nach Krottof, Kreis Oschersleben, zu meinem ehemaligen
Kriegskameraden, bei dem ich einen Tag geblieben bin. Er hatte mir schon eine Stelle bei einem Bauern besorgt, der 70
Jahre alt und kinderlos war. Zum Hof, den er mit seiner Ehefrau bewirtschaftet hat, gehörten 36 Morgen Land, 2 Ochsen
und 3 Kühe. Das Ackerland bestand aus 17 Parzellen und sicherte mir einen Arbeitsplatz.
Jetzt, da ich ein Dach überm Kopf und genug zu essen hatte, fing ich an nach dem Verbleib meiner Familie zu forschen.
Bei meinem letzten Heimaturlaub hatte ich mit meiner Frau verabredet; falls wir uns in den Kriegswirren verlieren
sollten, unsere Kontaktadresse, die meiner Quartiersleute in Burscheid, Kreis Opladen, sein sollte. Ich habe zuerst
nach Rohmanen geschrieben, aber leider keine Antwort erhalten. Dann habe ich nach Burscheid geschrieben, und siehe, -
bei denen lag schon eine Anfrage meiner Frau vor, die nach mir gefragt, und ihre jetzige Anschrift hinterlassen hatte.
Ich habe dem Bauern erzählt dass meine Frau sich zurzeit, auf einem Gut, in Alt Steinhorst, im Kreis Rostock, befindet.
Er war sofort bereit uns ein Zimmer zur Verfügung zu stellen, wenn ich meine Frau nach Krottorf rüberholen wollte. Das
habe ich Ihr mitgeteilt und sie war sofort bereit ihren Wohnsitz nach Krottorf zu verlegen, denn sie wohnte dort in
einem kleinen Stübchen unterm Dach.
Im Herbst, als die Feldarbeit so ziemlich erledigt war, bin ich nach Alt Steinhorst gefahren, um meine Frau und meinen
Sohn Kurt, sowie meinen Sohn Manfred, den ich noch nicht kannte, weil er erst nach der Flucht, am 31. Januar, in Groß
Lüssewitz, geboren wurde, nach Krottorf zu holen. Meine Frau hatte schon Holz für den Winter besorgt und vom Gut, auf
dem sie im Sommer gearbeitet hatte, Mehl und Kartoffeln bekommen. Wir haben das Mehl und andere Habseligkeiten in
Kisten verpackt. Das Holz haben wir einem Bauern gegeben, der uns und unser Gepäck, mit seinem Pferdewagen, zum 14
Kilometer entfernten Bahnhof, nach Ribnitz gebracht hat. Wir sind auch gut in Krottorf angekommen, aber als wir am
nächsten Tag, unsere Kisten vom Bahnhof abholen wollten, haben wir zwar die Kisten vorgefunden, doch der gesamte Inhalt
wurde während der Bahnfahrt entwendet. Die Bahnstation in Krottorf hat die Vorkommnisse zur Kenntnis genommen und
protokolliert, aber unsere Sachen haben wir nie wieder gesehen und mussten wieder bei Null anfangen.
Im Winter musste ich auf der Genossenschaft, unentgeltlich, für die Russen Weizen einsacken. Ich hatte versucht eine
Arbeit als Zimmermann zu bekommen, doch auf dem Arbeitsamt wurde mir gesagt, ich bin Ladwirt und muss auf der
Landwirtschaft arbeiten. Da in den ersten Nachkriegsjahren, auch in der sowjetisch besetzten Zone Arbeitsplätze knapp
waren, mussten auch solche, die einen anderen Beruf erlernt hatten, jede zumutbare Arbeit annehmen. Aus der Heimat
erhielt ich einen Brief, von meiner dort noch lebenden Mutter. Sie schrieb das sie mich noch einmal sehen wollte und
ich sollte doch wieder zurück kommen; Unser Hof wäre nicht von Polen besetzt und sie wäre ganz alleine, weil der Vater
nach dem Durchzug der Front von den Russen erschlagen wurde. Daraufhin habe ich dem polnischen Konsulat in Magdeburg
mitgeteilt, dass ich in Rohmanen eine Landwirtschaft besitze, und um eine Einreisegenehmigung gebeten.
Nach 2 Monaten erhielt ich eine Postkarte, mit der Mitteilung, ich sollte mich persönlich beim Konsulat vorstellen.
Nach Aufnahme meiner Personalien, wurde mir gesagt, das ich benachrichtigt werde wenn mein Antrag genehmigt wird. Ende
Juli 1947 erhielten wir die Einreisegenehmigung nach Ostpreußen, das jetzt unter polnischer Verwaltung stand. Wir
mussten zuerst zum polnischen Konsulat in Berlin-Lichterfelde, wo wir umgeben von einer Trümmerlandschaft, gewartet
haben, bis alle Untersuchungen und Formalitäten erledigt waren.
“ Wieder zurück in Ostpreußen.”
Der schwere Wiederaufbau nach dem Kriege
Dann fuhren wir über Frankfurt/Oder, Posen, Thorn, Allenstein, nach Ortelsburg, wo wir am 2. August 1947 ankamen. Mit
einem zweirädrigen Karren, den ich mir von einem noch in Ortelsburg lebenden Bekanten ausgeliehen hatte und meinem
Sohn Manfred im Kinderwagen fuhren wir nach Rohmanen. Meine Mutter war inzwischen verstorben und auf dem Hof war nur
meine, inzwischen aus Russischer Gefangenschaft wiedergekehrte Schwester, Frieda Pelkowski.

Es war alles ausgeplündert; kein Vieh, keine Maschinen und der ganze Hof mit kniehohem Graß überwachsen. Nur schmale
Trampelpfade, vom Haus zum Holzschuppen und zum Klo, durchkreuzten das satte Grün. Ich habe das Gras auf dem Hof mit
einer Sense, die ich noch gefunden habe, abgemäht, damit der Hof nicht so verwahrlost aussah. Am nächsten Tag habe ich
mich bei der Polizei in Ortelsburg angemeldet, wo ich auch ein Startgeld von 100 Zloty erhielt und Gepäckstücke, die
ich in Krottorf aufgegeben, am Bahnhof abgeholt. Es hat mich sehr gewundert das, das Gepäck überhaupt angekommen ist.
Da man von der Landwirtschaft nicht Leben konnte, habe ich mich in den nächsten Tagen, bei der jetzt polnischen Bahn,
um Arbeit beworben und wurde auch angenommen. Wenn wir unseren Monatslohn bekamen, saß immer einer am Tisch, der von
uns 100 Zloty für den Wiederaufbau von Warschau verlangte. Wenn ich dran war, riefen die Anderen, ich hätte Warschau
zerstört und müsste deshalb 200 Zloty abgeben. Nach 3 Jahren kam eine Verfügung, die besagte, dass wer länger als 1
Jahr bei der Bahn beschäftigt ist, angestellt werden muss. Um diese Bestimmung zu umgehen hat man mich entlassen und
eine Woche später wieder eingestellt.
Als ich vor Ablauf des nächsten Jahres, aus dem gleichen Grunde wieder entlassen wurde, habe ich mich bei der
Stadtverwaltung in Ortelsburg(jetzt Szczytno)beworben, wo ich zuerst im Gaswerk als Heizer und später auf Baustellen
als Zimmermann gearbeitet habe. Wir haben durch den Krieg beschädigte Häuser repariert, in den ehemals touristischen
Zentren einige Ausbesserungen an den Einrichtungen durchgeführt, eine Ziegelei wieder in Betrieb gesetzt und andere
anfallende Arbeiten verrichtet. Im Dach des Rathausturmes war während der Kämpfe eine Granate eingeschlagen, die, die
Dachlatten und die Verschalung zerstört hatte. Da wir, unter schwersten Bedingungen, den Schaden repariert haben,
wurde uns eine Höhenzulage versprochen, die wir aber nicht bekommen haben.
Aus Verärgerung darüber habe ich bei der Stadtverwaltung gekündigt und bei einer Wiederaufbaufirma unter der Leitung
von Bauingenieur Laskowski wieder angefangen, wo ich bis 1954, als Zimmermann beschäftigt war. Ab da habe ich mich
nur um meinen Hof gekümmert, der wegen meiner Arbeitsstellen, gezwungenermaßen, sehr vernachlässigt wurde. Als wir
1947 zurückkamen, brachten wir unseren Sohn Manfred noch im Kinderwagen. Den hat meine Frau zum Markt gebracht,
verkauft, und dafür eine Ziege erworben, die dank guter Pflege, uns täglich mit 4 Liter Milch versorgte. Das war der
erste Baustein zum Wiederaufbau, unserer durch den Krieg zerstörten, und danach ausgeplünderten Landwirtschaft.
Während meiner Arbeit bei der Bahn haben wir uns eine Kuh gekauft, die nach einem halben Jahr, wegen nicht bezahlter
Grundsteuer, vom Gerichtsvollzieher gepfändet wurde. Man hat uns die Kuh weggenommen und bei einem Arbeiter, der in
der Ernst-Mey-Straße in Ortelsburg wohnte und sie wegen nicht vorhandener Futtermittel, nur mit Kartoffelkraut
gefüttert hat, untergestellt. Als ich bei der Bahn meinen Monatslohn bekommen habe, bin ich zur Gmina gegangen, habe
eine Rate angezahlt und durfte dann die Kuh wieder mit nach Hause nehmen. Durch die schlechte Ernährung war die Kuh
stark abgemagert und lieferte nur die Hälfte der ursprünglichen Milchleistung.
Später habe ich ein Pferd auf Abzahlung bekommen, das 140.000 alte Zloty gekostet hat. Die Stute war schwach und unser
Feld sehr hügelig, so dass man nur bergab pflügen konnte, was sehr beschwerlich war, bergauf ging es immer im Leerlauf.
Später habe ich die schweren Böden mit dem Traktor umpflügen, und in den letzten Jahren auch mit dem Binder mähen
lassen. Von der Stute habe ich 2 schöne Fohlen gezogen; ein davon habe ich bei der Ausreise in die Bundesrepublik
mitgebracht und bei der Viehverwertungs-Genossenschaft in Göttingen verkauft. In den ersten Nachkriegsjahren als noch
wenig Land bestellt wurde, breiteten sich auf den nicht beackerten Flächen, Wildkräuter aus. Disteln und andere
Schnellwachsende, erreichten manchmal eine Höhe von 2 Meter, besonders auf den schweren Böden.
Es hat viel Schweiß gekostet ehe man den Acker soweit hatte, das er auch befriedigende Erträge abwarf. Die
Währungsreform von 1950, hat unser weiniges Geld das wir schon gespart hatten, wieder vernichtet. Ich hatte 2 Pferde,
1 Fohlen, 2 Kühe und Schweine, als ich wieder aufgefordert wurde nicht bezahlte Grundsteuern nachzuzahlen. Als ich
nicht bezahlen konnte, hat der Vollziehungsbeamte, ein Fohlen, eine Kuh und ein Schwein gepfändet. Es gelang mir jedoch
nach längeren Verhandlungen, ohne größere Verluste, alles zu regeln. Später kam eine Verfügung, die besagte; wenn
jemand auf seinem Hof nur eine Kuh und ein Pferd hatte, durften sie nicht gepfändet werden. Einige haben ihr Inventar
dieser Verfügung angepasst und dadurch die Zahlung von Grundsteuer umgangen.

Wer seine Steuern pünktlich bezahlt und sein Kontingent an landwirtschaftlichen Produkten fristgerecht abgeliefert hat,
der konnte seine, darüber hinaus erwirtschafteten Produkte zu marktgerechten Preisen verkaufen. Für eine hochtragende
Sterke, mindestens 400 kg schwer, die auf ein staatliches Gut verkauft wurde, konnte man bis zu 12000 Zloty bekommen.
Unsere Böden waren kalkarm, doch durch den Einsatz von Kalk und Kunstdünger konnte man den Ertrag erheblich steigern.
Kalk und Kunstdünger konnte man bei der Genossenschaft(GS) bestellen, der dann auch direkt auf den Hof geliefert wurde.
Kalk wurde geliefert und gleich auf dem Feld ausgestreut. In den 1960ger Jahren waren alle Ackerflächen der Rohmaner
Felder bestellt.
Die nach dem Krieg zurückgebliebenen deutschen Bauernfamilien, aber auch die Polen, die während des Krieges beim Bauern
in Deutschland gearbeitet haben, versuchten mit teils bescheidenen, oder auch zusammen gesuchten, landwirtschaftlichen
Geräten, die bäuerlichen Betriebe aufrecht zu erhalten. Nach den schweren Anfängen in den ersten Nachkriegsjahren
erzielten sie schließlich einen beachtlichen Erfolg, der sich in wogenden Kornfeldern, sowie in grünen Wiesen auf
denen gut genährtes Vieh weidete, widerspiegelte.
Ein schwerer Einschnitt in meinem Leben.
Am 11. Mai 1956 verstarb nach langer schwerer Krankheit, meine liebe Ehefrau Marta Rattay,
geborene Brosch. Ein Jahr zuvor war schon mein Schwiegervater Gottlib Brosch verstorben. Die schweren Bedingungen
unter denen wir nach Kriegende leben mussten, haben ihrer bereits angegriffenen Gesundheit sehr zugesetzt. Sie
verstarb mit 44 Jahren und hinterließ in unserer Familie eine große Lücke, die nicht mehr zu Überbrücken war. Wir
haben sie unter großer Anteilnahme der noch verbliebenen deutschen Bevölkerung zu Grabe getragen und auf dem Rohmaner
Friedhof beigesetzt. Die Arbeit die sie sonst verrichtet hatte fiel jetzt auf mich und meine Söhne zurück. Meine
Schwester Frieda Pelkowski half auch wo sie nur konnte. Wir waren auf die Unterstützung durch Nachbarn und Freunde
angewiesen, die uns immer wenn es nötig war, tatkräftig unterstützt haben. Im laufe der Zeit haben wir wieder zum
Alltag zurück gefunden, haben sie noch etliche Jahre auf dem Friedhof besuchen können, bis wir, bedingt durch unsere
Ausreise uns endgültig von ihr trennen mussten.
Der endgültige Abschied von Ostpreußen
Ab 1956 begannen, durch die Vermittlung des Deutschen Roten Kreuzes, die ersten Ausreisen in die
Bundesrepublik Deutschland. Zuerst waren es Kinder die zu ihren Eltern ausreisen durften, Familien deren Väter aus der
Kriegsgefangenschaft in den Westen Deutschlands entlassen wurden und andere durch den Krieg getrennte
Familienangehörige. Ab 1960 erhöhte sich die Zahl der Ausreisewilligen aus dem polnisch besetzten Ostpreußen. Es setzte
sich die Überzeugung durch, dass unsere Angestammte Heimat, uns für die Zukunft keine Perspektive mehr bieten konnte.
Meistens wurden die Anträge, die wir an die Passabteilung in Allenstein stellen mussten, um einen Ausreisepass zu
bekommen, negativ beschieden. Nach mehrmaligen Versuchen gelang es dann doch, diese begehrte Ausreiseberechtigung in
Empfang zu nehmen. Die Enttäuschung der Zurückgebliebenen war groß, wenn wieder mal Verwandte oder Nachbarn, den Weg
in Richtung Bahnhof einschlugen.
Um einen Reisepass zu beantragen, musste man zuerst eine Einladung von Verwandten aus der Bundesrepublik vorlegen, in
der, diese sich verpflichten mussten, für Unterkunft und Verpflegung der Eingeladenen zu sorgen. Diese Einladung
musste durch ein Amt in der Bundesrepublik beglaubigt werden. Außerdem mussten die Kosten für die Bahnfahrt, ab
polnischer Grenze, bis zum Zielort, beim polnischen Reisebüro ORBIS, in Warschau, in DM eingezahlt werden.
Unseren ersten Ausreiseantrag haben wir 1964, bei der Kommandantur der polnischen Miliz in Allenstein eingereicht, der
nach einer gewissen Zeitspanne, ohne eine uns verständliche Begründung zu nennen, abgelehnt wurde. Gegen diese
Ablehnung wurde ein Widerspruch zugelassen, den wir sofort einreichten. Nach einer weiteren Zeitspanne erhielten wir
wieder eine Ablehnung, gegen die kein Widerspruch mehr zulässig war. Wer seine Ausreiseabsicht nicht aufgeben wollte,
musste einen neuen Antrag stellen. Es gab Familien die schon 10 Mal einen Ausreiseantrag gestellt hatten und immer
wieder abgewiesen wurden. Da meine Söhne, nicht die Absicht hatten in Rohmanen zu bleiben und ich nach 2 Weltkriegen,
an denen ich teilgenommen, die schwere Arbeit auf der Landwirtschaft, nicht aus eigener Kraft schaffen würde, haben wir
1966 wieder einen Antrag gestellt, der prompt abgelehnt wurde. Der Widerspruch auf diese Ablehnung wurde auch negativ
beantwortet, so dass wir 1968 wieder einen Antrag eingereicht haben.
Weil das Passamt in Allenstein lange nichts von sich hören ließ, hegten wir schon die Hoffnung das es jetzt klappen
würde und waren sehr enttäuscht als wieder eine Absage kam. In der Zwischenzeit sind viele Nachbarn und Bekannte aus
Rohmanen, sowie aus der näheren Umgebung, ausgereist und das Häuflein der noch verbliebenen Deutschen, wurde immer
kleiner. Die Motivation, die uns in früheren Jahren, über so manche schwierige Lage hinweg geholfen hat, ist einer
hoffnungslosen Resignation gewichen. Man war davon überzeugt, dass unser Leben, in unser Angestammten Heimat, keine
Zukunftsperspektive mehr haben konnte und wenn wir keine Ausreisegenehmigung bekommen, wir eines Tages die letzten
Deutschen in der ganzen Umgebung sein werden.
Die Ausreise-Heimat ade
Wir hatten die Hoffnung schon aufgegeben, als am 30. April 1969, der Briefträger unseren Hof
betrat und mir einen Brief überreichte, in dem uns das Passamt in Allenstein mitteilte, dass unsere Ausreise in die
Bundesrepublik Deutschland, genehmigt worden ist. Wir müssten, nach Aushändigung der Reisepapiere, den Geltungsbereich
der Volksrepublik Polen, innerhalb von 3 Monaten verlassen. Wir waren zuerst geschockt, über den Hinweis, das wir
unsere Heimat in 3 Monaten verlassen müssen, aber dann stellte sich die Zukunftsperspektive wieder ein und wir gingen,
wie von einem schweren Ballast befreit und gut gelaunt unser weiteren Tätigkeit nach.
Als der Briefträger unseren Hof betrat, waren ich und mein Sohn Kurt gerade dabei eine Fuhre Mist zu laden. Wir hatten
den Wagen gerade halb geladen und haben nach der frohen Kunde nicht mehr weiter gemacht, sondern die Pferde vorgespannt
und den Mist aufs Feld gefahren, damit wir den Wagen für alle Fälle frei hatten. Das war die letzte Tätigkeit für
unsere Landwirtschaft in Ostpreußen.
Die Nachricht von unserer Ausreise verbreitete sich, ohne dass wir darüber gesprochen haben, wie ein Lauffeuer.
Alsbald kamen Leute aus dem Dorf, die sich für das Vieh und für diverse Landwirtschaftliche Geräte interessierten.
Etliche wollten bestimmte Sachen sofort kaufen, andere haben nur zurücklegen lassen und wollten später kommen und
bezahlen, haben es aber dann doch nicht genommen.

Wenn man eine Landwirtschaft hatte, konnte man 2 Pferde, 2 Rinder, 3 Schweine, 5 Schafe und 10 Hühner, in einem
geschlossenen Viehwaggon, in die Bundesrepublik mitnehmen. Jeden Tag war man unterwegs, von einer Behörde zur Andern.
Die Aushändigung der Reisepapiere erfolgte nur nach Vorlage bestimmter Bescheinigungen: Es mussten alle Steuern bezahlt
sein, das Kontingent landwirtschaftlicher Erzeugnisse musste abgeliefert sein, je eine Bescheinigung vom Katasteramt
und vom Notar musste vorgelegt werden, das man dem polnischen Staat das Grundstück abgetreten hat. Die Gebühren für
die notarielle Beglaubigung mussten wir selbst bezahlen. Wenn man alle Bescheinigungen beisammen hatte, bekam man bei
der Kreisverwaltung eine Gesamtbescheinigung. Mit dieser Bescheinigung konnte man nach Allenstein, zur
Polizeikommandantur fahren, wo man nach dem schriftlichen Verzicht auf die polnische Staatsangehörigkeit, einen
Reisepass ausgehändigt bekam, der den Inhaber zum Grenzübertritt berechtigte, aber nicht zur Wiedereinreise.
Wir haben 2 Pferde, eine Sterke, einen Ochsen, 5 Schafe, 2 Schweine und 10 Hühner mitgenommen. Über die Schutzimpfung
der Rinder musste man eine, vom Kreistierarzt beglaubigte Bescheinigung vorweisen. Ich habe 5 Schafsböcke gekauft, die
ich in der Zwischenzeit, hinter der Scheune, zum Weiden angekettet hatte. Einer von denen hat sich losgerissen und
seinen Nachbarn getötet. Das Fleisch konnten wir noch verkaufen, mussten aber dafür einen anderen Schafsbock kaufen.
Innerhalb von 3 Monaten mussten wir alles regeln und zwei Tage vor der Abfahrt einen Eisenbahnwagen, bei der
Eisenbahndirektion in Allenstein bestellen. Reservierungen bei den polnischen Behörden waren meist immer mit
Schmiergeld verbunden, weil man sonst nie sicher sein konnte dass diese Vereinbarungen auch eingehalten werden. Schon
2 Wochen vor unserer Abfahrt, gab es in Ortelsburg keine alkoholischen Getränke zu kaufen. Meine Söhne mussten mit dem
Motorrad die umliegenden Dörfer abfahren, damit wir für die Reise einen Vorrat anlegen konnten; denn Wodka war zu der
Zeit, in Polen, wie eine zweite Währung.
Am 25. Juli haben wir zusammen, mit meinem Neffen Siegfried Brosch, unseren sonstigen Hausrat, der in Kisten verpackt
war, in einen Eisenbahnwagen, auf dem Allensteiner Bahnhof verladen. Alles musste zuerst durch den Zoll, wo die
Federbetten gewogen wurden und über das erlaubte hinausgehende Kissen, verzollt werden mussten. Dasselbe galt auch für
Fleisch und Räucherwaren.
Am 26. Juli, unserem Verladetag, kam der Eisenbahnwagen aus Allenstein, erst um 11 Uhr auf dem Ortelsburger Bahnhof an.
Die Rinder hatten wir zu Fuß, zum Bahnhof gebracht; Schweine, Schafe und Hühner auf dem Pferdewagen. Im Eisenbahnwagen
mussten, mit Hilfe von Brettern und Bohlen, Boxen für die verschiedenen Tiere erstellt werden. Jedes Pferd und jedes
Rind in eine Bucht. Die Schafe zwischen die Pferde, die Schweine zwischen die Rinder und die Hühner in einem Käfig,
unter der Decke über den Rindern. Die Hühner hatten unterwegs Eier gelegt, somit hatten wir jeden Tag frische
Verpflegung. Bei der Fahrt im Viehwagen, begleitete mich mein Sohn Manfred. Als die Lokomotive nahte, um den Wagen
abzuholen, wurden noch schnell die restlichen Sachen hinein geworfen und so mache Abschiedsträne rollte dann die Wange
hinab.
Unsere Nachbarn, Deutsche und Polen, halfen uns beim Verladen des lebendigen Inventars. Jetzt erinnerte ich mich
plötzlich, an die oft auch schönen, Ereignisse der letzten 22 Jahre. Einer Zeit, in der das Zusammenleben von
Deutschen und Polen, von Jahr zu Jahr, besser wurde. Man half sich beim einbringen der Getreideernte, beim Dreschen
des Getreides, bei der Kartoffelernte und bei anderen Arbeiten, wo viele Menschen zupacken mussten. Es war eine
Dorfgemeinschaft, in schweren Zeiten geboren; jeder half jedem wenn Hilfe nötig war. Es wurde mir plötzlich bewusst,
das jetzt ein Lebensabschnitt zu Ende ging, zu dem ich nicht mehr zurückkehren konnte. Unsere Existenzgrundlage war
jetzt ein Eisenbahnwagen auf einem Schienenstrang, dessen Ende irgendwo in weiter Ferne lag. Obwohl, von langer Hand
vorbereitet, war dieser Moment voller Wehmut.
Doch als der Zug sich plötzlich, in Bewegung setzte, war ich sofort wieder in der Gegenwart. Menschen, mit denen man
Jahrzehnte lang, in gutem Einvernehmen zusammen gelebt hat, blieben plötzlich am Bahnsteig zurück und die Entfernung
zwischen ihnen und mir vergrößerte sich mit jeder Sekunde, bis sie letztendlich aus meinem Blickfeld verschwanden.
Es war ein heißer Julitag, als wir unsere Reise gen Westen antraten. Für die Schweine, die besonders unter der Hitze
zu leiden hatten, haben wir 10 Flaschen Essig mitgenommen und sie von Zeit zu Zeit besprenkelt, damit sie besser atmen
konnten. Für die anderen Tiere war reichlich Heu und Hafer vorhanden. Eine großes Fas und zwei Milchkannen waren mit
Wasser gefüllt, die wir auf den an der Strecke liegenden Bahnstationen, bei Bedarf wieder nachgefüllt haben.
Da der Kreistierarzt nicht in seinem Büro war, konnten wir die Impfbescheinigung für das Vieh, nicht rechtzeitig
herbeischaffen. Der Zug setzte sich in Bewegung und die Bescheinigung war immer noch nicht da. Als die Bescheinigung
dann eingetroffen, wir aber schon unterwegs waren, ist mein Sohn Kurt mit dem Motorrad hinterher gefahren und hat uns
in Passenheim, wo der Zug noch andere Wagen angehängt bekam, die Impfbescheinigung übergeben. Wir waren sehr froh das
er es noch geschafft hat, denn in solch einer Situation fühlt man sich sicherer wenn man alle Bescheinigungen bei sich
hat. Auf der Rückfahrt, mit dem Motorrad hatte er noch eine Panne, musste das Motorrad stehen lassen und per Anhalter
nach Hause fahren. Am nächsten Tag kam er mit Siegfried Deptolla, der das Motorrad wieder flott machte und brachte es
wieder nach Rohmanen zurück.
Die Fahrt mit dem Viehwagen, gen Westen
Von Ortelsburg bis Allenstein(45 km) hat unser Zug 4 Stunden gebraucht, weil auf jedem Bahnhof
gehalten wurde, um neue Wagen anzuhängen. Nachdem wir in Allenstein angekommen waren, kam ein Rangierer und fragte
nach unserem Ziel. Als wir ihm mitteilten, das wir in die Bundesrepublik Deutschland wollen, sagte er nur: „In 10
Minuten fährt ein Zug los. Wenn ich von euch 500 Zloty und einen Liter Wodka bekomme, werde euch sofort anhängen,
andernfalls kommt ihr auf ein Nebengleis und müsst dann auf den nächsten Zug warten. Es blieb uns nichts anderes übrig
als seiner Forderung nachzukommen, denn über derartige Erpressungen hat man bereits von Anderen, die vor uns ausgereist
sind, gehört. Wir wurden auch sofort angehängt und fuhren dann die ganze Nacht, an Osterode, und Thorn vorbei bis
Gnesen. Dort wurde wieder rangiert.
Von einer Anhöhe wurden die einzelnen Wagen auf verschiedene Gleise verteilt und zu neuen Zügen zusammengestellt. Der
Aufprall der ungebremsten Wagen erzeugte eine derartige Erschütterung, dass manche Bretter an den Boxen geborsten waren.
Von Gnesen ging es dann in einem Zuge durch bis zur Grenzstation Reppen(Rzepin). Dort mussten wir zum Zollamt, wo
unsere Ausfuhrpapiere durch die Zollbeamten, und durch einen Tierarzt geprüft wurden. Bis Reppen(Rzepin) haben wir für
den Eisenbahnwagen 900 Zloty bezahlt; hier mussten wir noch einmal 650 Zloty bezahlen. Bei der Wagenkontrolle erklärte
uns ein Bahnbeamter das unser Wagen, sich nicht für den internationalen Transport eignet und wir deshalb den Inhalt in
einen Anderen umladen müssen, der irgendwann, auf dem Nebengleis bereitgestellt wird. Nach langer Verhandlung, sowie
einer Zulage von 500 Zloty und einem Liter Wodka haben wir ihn davon überzeugt, das der Wagen sich doch für die
Weiterfahrt eignet.
In der Nacht war Schichtwechsel, der unseren Wagen wieder abgehängt hat, weil er angeblich von der Reichsbahn der DDR,
wegen technischer Mängel nicht weiterbefördert würde. Wir mussten unsere Verhandlung vom Vorabend wiederholen, die mit
der Zusage endete, dass wir am frühen Morgen, über die Grenze auf DDR Gebiet, gebracht werden. Um 5 Uhr morgens kam
eine Lokomotive, die uns den letzten Abschnitt bis über die Grenze bringen sollte. Als der Zug hat noch einmal anhielt,
kamen polnische Grenzbeamte und Soldaten in den Wagen. Sie durchsuchten ihn und fragten, ob wir noch polnisches Geld
oder einen Grundbuchauszug bei uns hätten. Wir zeigten ihnen 800 Zloty, die sie uns, nach Ausstellung einer Quittung
über 500 Zloty, abnahmen. Die Grundbuchauszüge habe ich, im Stroh versteckt, dem Ochsen vor die Füße gelegt. Falls
jemand da suchen sollte, hätte ich gesagt, das das Tier bösartig veranlagt ist, und ich für seine Sicherheit nicht
garantieren könnte, deshalb sollte er vorsichtig sein.
Als die Grenzkontrolle den Zug verlassen hatte, setzte sich die Lokomotive wieder in Bewegung und überquerte nach
kurzer Zeit die Oderbrücke. Auf einer eingezäunten Fläche, jenseits der Grenze, hat man uns abgestellt hat und die
Lokomotive fuhr zurück auf polnisches Gebiet. Vor und hinter uns waren die Tore verschlossen. Auf den Wachtürmen,
links und Rechts von uns, standen Posten mit einem Gewehr im Anschlag. Vier Grenzbeamte der DDR, jeder mit einer
Leiter in der Hand, sowie ein Schäferhund, kamen zu unserem Wagen. Sie öffneten die Schiebetüre, stellten die Leiter
davor und ließen den Hund in den Wagen springen, der nur etwas herum schnupperte und wieder heraussprang. 2 Beamte
haben dann anschließend, die Papiere kontrolliert und das Inventar gezählt.
Nach einiger Zeit wurden wir an einen Güterzug der Reichsbahn angehängt und fuhren von Frankfurt an der Oder, vorbei
an Berlin, Ellingen und Nordhausen, über die Grenze zur Bundesrepublik bis Herzberg. Hier hat ein Zollbeamter der
Bundesrepublik, die Formalitäten erledigt und ein Tierarzt die Pferde, Rinder und Schweine gründlich untersucht. Ich
musste ihnen die Mäuler aufhalten und die Füße hochheben. Danach hat uns die Lokomotive zu einer Wasserzapfstelle
gebracht, wo wir die Tiere tränken und unsere Behälter mit Wasser auffüllen konnten. Anschließen fuhren wir über
Northeim nach Göttingen, zur Viehverwertungsgenossenschaft, die zuvor von unserer Ankunft in Kenntnis gesetzt wurde.
Der Ochse, die Sterke und die Schweine wurden, in Göttingen zum Schlachthof gebracht; die Pferde kamen nach Hannover
und die Schafsböcke nach Kassel. Wir waren mit dem Viehtransport 5 Tage unterwegs; hatten so manche Klippe umschifft
und Schwierigkeiten gemeistert, die im normalen Leben nicht vorkommen.
Wir wurden mit einem PKW, ins Durchgangslager Friedland bei Göttingen gefahren, wo mein Sohn Kurt, meine Schwester
Frieda Pelkowski und Siegfried Brosch mit Familie, die am 30 Juli, um 14 Uhr, von Warschau mit dem Zug abgefahren, und
hier am 31. Juli in den Morgenstunden eingetroffen sind, schon auf uns gewartet haben. In Friedland hat man uns mit
Familie Siegfried Brosch in einem Raum untergebracht, wir wurden registriert und erhielten 20 DM Überbrückungsgeld,
pro Person. Da wir erst am Freitag in Friedland eingetroffen sind, mussten wir hier über das Wochenende bleiben,
obwohl die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der Regel nur 3 bis 4 Tage beträgt.
Um einen Antrag für die Ausreise stellen zu können, brauchten wir eine Einladung von in der Bundesrepublik lebenden
Verwandten. Diese Einladung hat uns mein Bruder, Ernst Rattay, aus Ingelheim am Rhein zugeschickt. Ingelheim liegt im
Bundesland Rheinland-Pfalz. Das Geld für die Bahnfahrt, hat uns, Frieda Schellin, geb. Nickel, aus Duisburg, die
Tochter unseres Nachbarn, überwiesen. In Friedland wurden wir registriert. Im Registrierschein, war als unser
nächster Aufenthaltsort in der Bundesrepublik, das Durchgangslager Osthofen bei Worms, das alle Aussiedler für
Rheinland-Pfalz aufnehmen musste, eingetragen. Die Eintragung erfolgte deshalb, weil der Ort aus dem uns unsere
Einladung zugeschickt wurde, sich auch in Rheinland-Pfalz befand.
Da ich nach dem Polenfeldzug, als Soldat, ein Jahr im Kreis Opladen, im Rheinland gewesen bin, wäre ich sehr gerne in
diese Gegend gezogen, denn die Erinnerung an die schönen Tage die ich dort verlebt habe war in mir immer noch wach.
Ich versuchte die Eintragung in unseren Regiestierscheinen ändern zu lassen, was nach einigen, vielleicht auch
berechtigten Einwänden, am 4. August, vom Beauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen, genehmigt wurde. Anstelle von
Rheinlad-Pfalz stand da jetzt Nordrhein-Westfalen und am 7. August, fuhren wir, noch mit anderen Aussiedlern, ins
Durchgangslager Unna-Massen, am östlichen Rande des Ruhrgebietes gelegen. Hier wurden wir in einem Zimmer untergebracht
und konnten unser Essen in einer Gemeinschaftsküche zubereiten.
Am 8. August wurden wir in Unna-Massen, als Bürger der Bundesrepublik Deutschland registriert, erhielten
Einhundert DM Begrüßungsgeld, den Vertriebenen Ausweis -A -und 4 Wochen später den Bundespersonalausweis. In
Unna-Massen haben wir mehr als 4 Monate verbracht, weil mein Sohn Kurt, wegen fehlender Berufsausbildung, in Unna, an
einem Grundlehrgang für Metallarbeiter teilgenommen hat, der vom Arbeitsamt finanziert wurde. Am 11 Dezember 1969 sind
wir endlich an unserem vorläufigen Wohnsitz, im Durchgangswohnheim, an der Elisabethstraße 13, in Velbert angekommen.
Ab dem 5. Januar 1970 konnten meine Söhne, in der Zahnradfabrik Reining, in Velbert ihrer geregelten Arbeit nachgehen.
Von Bau- und Sparverein in Velbert wurde uns am 20. Juni 1970, unsere erste Wohnung zugewiesen.
Velbert im Februar 1972
gezeichnet: Gustav Rattay
In der Gaststube wurde Korn, sowie auch guter Bärenfang ausgeschenkt, und wenn es den Gästen gut geschmeckt hat, haben
sie es lange ausgehalten, so das für eine weitere Rast, in einem der nächsten Dörfer keine Zeit mehr übrig blieb. Die
alten Bauern erzählten auch; das es in ganz Ortelsburg, keinen so guten Schnupftabak gab, wie im Gasthof Trzaska. Zu
diesem Grundstück gehörte einst auch der Rohmaner See. Weil dafür keine Steuern gezahlt wurden hat sich der Besitzer
von Gut Frenzken den See angeeignet.
Als Königsberg zur Festung ausgebaut wurde, haben viele Männer dort Arbeit gefunden. Zu dieser Zeit war an eine
Beschäftigung im Kohlenbergbau, in Westfalen, noch nicht zu denken. Weil auch noch keine Eisenbahnlinie vorhanden war,
mussten sie den weiten Weg zu Fuß zurücklegen. Nachdem sie den ganzen Tag marschiert sind, haben sie in der Nacht ein
Feuer angezündet, eine Malzeit zubereitet und in der Nähe des Feuers, das sie vor wilden Tieren schützen sollte,
übernachtet. Die Reise nach Königsberg hat eine ganze Woche gedauert. Sie wurden dort zum Aufschütten der
Festungswälle eingesetzt.
Das Jahr 1914 wurde zum Schicksalsjahr, für Ostpreußen und seine Bevölkerung. Nach Abschluß der Volksschule im Jahr
1912, habe ich in den Wintermonaten einen Fortbildungslehrgang für die Landwirtschaft besucht, den Hauptlehrer Aaron,
der aus Olschienen nach Rohmanen versetzt wurde, für uns organisiert hatte. Da im Dorf 2 Trompeten vorhanden waren,
hatte er uns nahe gelegt eine Kapelle zu gründen, dann könnten wir ja die Soldaten, die aus dem Krieg heimkehren
würden mit Musik empfangen. Zum Abschluss konnte man sich ein Buch oder ein Obstbäumchen wünschen. Eine Woche vor dem
Einmarsch der Russen, haben wir noch mit einem Breitdrescher, der durch ein Rosswerk dass von 6 Pferden angetrieben
wurde 110 Zentner Roggen gedroschen. Der Lehrer Malayka hat sich 1914 freiwillig zum Militär gemeldet. 1915 hat er uns
als Offiziersanwärter besucht. Im Frühjahr 1916 wurde mein Jahrgang gemustert und im Herbst 1916 wurden wir eingezogen.
Ausbruch des Ersten Weltkrieges
Am 2. August 1914 wurde die Allgemeine Mobilmachung ausgerufen. Alle wehrfähigen Männer folgten
dem Ruf des Kaisers und eilten zu den zuständigen Wehrmeldeämtern um die Grenzen des Vaterlandes zu schützen. Wir als
Grenzbewohner bekamen das Meiste zu spüren. Alle Häuser, Scheunen und Ställe waren mit Soldaten und ihrem Tross belegt.
Die Einen gingen, die Anderen kamen. Die Kosaken hatten bei Muschaken und Radzinen die Grenze überschritten. Der
Flüchtlingsstrom hatte sich von der Grenze her angestaut. Die Russen haben überall geplündert. Die Trosse mussten sich
zurückziehen und haben dazu vorwiegend die Feldwege benutzt. Die Pferde waren erschöpft. In einer Nacht kam der
Gemeindevorsteher mit einem deutschen Offizier auf unseren Hof. Mein Vater und der Nachbar Wilhelm Dorka mussten mit
ihren Pferden aushelfen. Sie waren 2 Tage unterwegs, bis zu einem Gut in Kleeberg bei Allenstein. Als sie dann wieder
nach Hause kamen waren die Russen schon am Rohmaner Friedhof. In der Zwischenzeit hatten wir schon den Leiterwagen mit
Mehl, Rauchfleisch und Betten beladen.
Der überwiegende Teil der Rohmaner war schon losgefahren. Der Hauptlehrer Müller kam noch mit dem Fahrrad vorbei und
sagte es wäre höchste Zeit das wir wegkämen weil die Russen schon Ortelsburg besetzt hätten und im Anmarsch auf
Rohmanen wären. Wir sind auf eine Anhöhe gestiegen und haben die Staubwolken beobachtet, aber wir dachten es wäre
deutsches Militär.
Auf der Flucht vor den Russen
Kurz vor Sonnenuntergang haben wir die Pferde vor den fertig gepackten Wagen gespannt und sind
sofort losgefahren. Mein Bruder und ich nahmen 4 Milchkühe und die beste Sterke mit und gingen hinterher. Schweine,
Kälber und Geflügel haben wir aus den Ställen getrieben. Wir waren die ganze Nacht unterwegs und sind bis Rheinswein
gekommen. Da hatten wir einen Onkel wohnen, bei dem haben wir den ganzen Tag verbracht.
Unterwegs haben wir einen Mann getroffen, der erzählte uns dass die Russen bei Groß Jerutten einen Personenzug
überrumpelt haben. Sie hatten aus Eisenbahnschwellen eine Sperre auf den Schienen errichtet und somit den Zug zum
Anhalten gezwungen. Die Russen haben den Zug mit Artillerie beschossen. Als die Soldaten und Zivilisten den Zug
verlassen wollten kamen die Kosaken zu Pferde und haben ein Massaker angerichtet. Nur wer sich am Boden davon
schleichen konnte hat überlebt. Die Russen wurden durch einen Verräter darüber informiert das auf diesem Gleis ein
Zug unterwegs war und waren darauf vorbereitet. Unserem Informanten ist es auch gelungen dem Massaker zu entkommen.
Ein Kosake hatte ihm im beim vorbeireiten mit dem Säbel ein Ohr abgehauen und ihn dadurch zu Boden geschlagen. Es ist
ihm danach gelungen ins Gebüsch zu schleichen. Sein Kopf war schon verbunden als wir ihn trafen. Später wurde an der
Stelle des Überfalls ein Gedächtnisstein errichtet.
Im Morgengrauen sah man viele Kosaken über die Felder reiten. Wir sind dann später wieder weiter in Richtung
Jellinowen gefahren. Unser Vater ist mit dem Pferdewagen die Landstraße entlang gefahren. Wir mit dem Vieh sind
entlang einer tiefen Schlucht durch den Wald bis zum Babanter See gegangen. Wir hatten schon vorher versucht die
Schlucht zu verlassen aber wegen der steilen Hänge ist es uns leider nicht gelungen. Am See angekommen fanden wir drei
große Schober mit Getreide vor. Von einem dieser Schober haben uns zwei Kosaken mit einem Fernglas beobachtet. Sie
schwangen sich auf ihre Pferde und kamen uns entgegen geritten, dann hielten sie uns ihre Lanzen vor die Brust und
versuchten uns auszufragen. Wir haben leider nichts verstanden und fingen an zu weinen. Plötzlich pfiff der
Patrollienführer auf einer Trillerpfeife und die Kosaken kehrten zu ihrem Ausgangspunkt zurück.
Als wir dann weiter am See entlang gingen sahen wir von weitem drei Gehöfte. In der Nähe einer dieser Höfe hatte unser
Vater den Pferdewagen im Gestrüpp abgestellt. Die vorrückenden Schützenlinien der russischen Infanterie hatten ihn
jedoch entdeckt. Sie haben den Wagen durchwühlt und den Sack mit Rauchfleisch mitgenommen. Andere Flüchtlingswagen die
in diesem Gebüsch Schutz gesucht haben sind nicht besser davon gekommen. Wir haben das Vieh auf einen der Höfe
getrieben und am Zaun festgebunden. Dann haben wir mit Hilfe einer Leiter den Heuboden erklommen und uns dort versteckt.
Als die Kosaken auf dem Hof erschienen verlangten sie Brot und Milch. Die Frauen mussten zuerst essen und trinken,
danach haben es die Russen auch getan, sie fürchteten sich davor, dass man sie vergiften könnte. Später kam dann die
russische Infanterie und hat Haus, Scheune und Schuppen durchsucht. Die Falltüre zum Heuboden ließ sich nur nach oben
hin öffnen. Wir hatten die Türe von oben mit schweren Gegenständen beschwert, aber die Russen versuchten mit aller
Gewalt auf den Heuboden zukommen. Als die Frauen das sahen, sagten sie zu den Russen, da oben würden sich ihre Kinder
versteckt halten. Die Russen forderten nun, die Kinder sollten sofort den Heuboden verlassen. Die Mütter riefen nun
nach ihren Kindern die dann auch tatsächlich den Heuboden verließen. Als wir das sahen, haben wir uns am Giebel tief
im Heu vergraben. Drei Russen kamen nun rauf und stocherten mit ihren Bajonetten im Heu herum. Glücklicherweise kamen
sie nicht in unsere Nähe. Als die Russen den Heuboden verließen haben wir befürchtet sie würden ihn in Brand setzen.
Wahrscheinlich taten sie deshalb nicht weil so viele russische Soldaten auf dem Hof waren. Einige Zeit später
erschienen russische Offiziere auf dem Hof, mit einem Auto. Sie sagten, sie hätten das Land erobert und wir hätten ab
sofort dem russischen Zaren zu gehorchen. Wir wurden angewiwsen nach Hause fahren und unbesorgt unsere Ernte
einzubringen. Sie haben uns auch eine Bescheinigung ausgestellt, damit uns auf dem Heimweg niemand die Pferde und
das Vieh wegnehmen würde.
Erst am nächsten Morgen, als die Front weiter vorgerückt war, beschlossen wir die Heimreise anzutreten. Die Straßen
waren mit vorrückenden russischen Truppen blockiert. Manchmal mussten wir stundenlang am Wegesrand warten bis die
Soldaten mit ihrem Tross vorbeigezogen waren. Unterwegs wollten sie unser Vieh zum Schlachten wegnehmen, aber die
Bescheinigung hat uns davor bewahrt. Die Eisenbahnbrücke vor Neu-Keykuth wurde von Kavallerie bewacht. Die wollten uns
nicht drüber lassen und hielten uns bis zum frühen Morgen fest. Zurück in Rohmanen angekommen, konnten wir unser Haus
nicht betreten weil der Hof und alles rundherum ein großes Militärlager war.
Wir sind dann in Richtung Seelonken gefahren, bis Abbau Brosch. Auf dem Hof angekommen haben wir zuerst Grünfutter für
die Pferde vom Feld geholt und anschließend Mittag für uns selbst gekocht. Die Nacht haben wir erstmal auf dem Hof
verbracht. Am nächsten Morgen wagten wir es ins Dorf zu gehen um die Lage zu erkunden. Die Russen waren schon wieder
weiter gezogen, aber Haus und Hof waren in einem schrecklichen Zustand. Wir sind dann gegen Abend wieder nach Hause
zurückgekehrt.
Am 23. August 1914 waren die Russen bei uns eingebrochen, bis sie am 28. August von den Deutschen zurückgeschlagen
wurden. Dann fuhren sie wieder zurück, drei Wagen nebeneinander. Ortelsburg brannte lichterloh. Ein Wagen mit Mehl war
uns gegenüber in den Straßengraben gekippt, aber wir haben nichts davon genommen, weil man ja nicht wusste ob man die
Nacht überleben würde. Wir saßen die ganze Zeit im Keller. Am nächsten Morgen zog dann russische Kavallerie und
Infanterie durch unser Dorf. Die Kavallerie ritt orientierungslos hin und her. Die Infanterie hat den ganzen
Vormittag 1,5 Meter tiefe Schützengräben ausgehoben. Um 11 Uhr kamen aus Richtung Eichtal 3 deutsche Spähwagen nicht
ahnend dass die nördliche Hälfte des Dorfes noch von Russen besetzt war. Wir haben zu diesem Zeitpunkt auf dem
Dachboden Weizen eingesackt und hatten aus diesem Grunde einen weiten Rundblick.
Um 11 Uhr kamen aus Richtung Eichtal drei deutsche Spähwagen angefahren. Als wir die deutschen Soldaten erkannt hatten,
haben wir sie durch Handzeichen gewarnt weiter nach Norden vorzustoßen. Die Kosaken hatten sich auf den Häuserdächern
positioniert und in Richtung Norden nach deutschen Truppen Ausschau gehalten. Die Deutschen sprangen von den Spähwagen
und fingen an die nichts ahnenden Russen zu beschießen. Als die sich ihrer gefährlichen Lage bewusst wurden verließen
sie ihre Aussichtsposten und bestiegen ihre Pferde. Mit Peitschenhieben versuchten sie, die sich in panikartiger Flucht
befindliche Infanterie dazu zu Bewegen, die Deutschen anzugreifen. Zwei Spähwagen wendeten sofort, der Dritte konnte
nicht mehr umkehren. Es gelang allen, bis auf den Fahrer des dritten Wagens die Flucht. Die Russen nahmen ihn sofort
unter Beschuss, doch es gelang ihm über unseren Hof zu entkommen. Auf der rückwärtigen Seite schlug er sich quer durch
die Gärten bis zum Gehöft von Friedrich Sakowski durch. Der versteckte ihn im Keller und versorgte ihn anschließend
mit Zivilkleidung.
Als die Russen den Soldaten auf unseren Hof laufen sahen nahmen sie sofort die Verfolgung auf. Sie durchstöberten auch
die Nachbarhäuser und trieben die Bewohner auf der Straße zusammen. An der Spritzenwagenremise richteten sie einen
Sammelpunkt ein. Unter dem Vorwand es würde hier eine Schlacht stattfinden, versuchten die Russen die Zivilbevölkerung
aus dem Dorf zu drängen. Alle die dem Aufruf gefolgt sind und an unserer Sammelstelle vorbeikamen wurden unserem Haufen
hinzugefügt. Unter ihnen befand sich auch der deutsche Soldat in Zivilkleidung. Er hatte einen Sack über die Schulter
geschlagen in dem sich ein Brot befand, an der anderen Hand führte er eine Kuh am Strick. Als unser Haufen schon aus
etwa 50 Leuten bestand setzten uns die Russen mit Marschrichtung Seelonken in Bewegung. Wir Jungen versuchten in einem
unbeaufsichtigten Moment wegzulaufen, doch die Begleitmanschaft prügelte uns mit Gewehrkolben wieder in Reihe und Glied.
Unterwegs gelang es dem Soldaten mit der Kuh unbemerkt zu entkommen. Er kehrte unbehelligt ins Dorf zurück und lieferte
die Kuh wieder dort ab wo er sie entführt hatte.
Uns haben die Russen an Seelonken vorbei zum Sylvensee getrieben. Wenn sie von vorbeiziehenden russischen Offizieren
gefragt wurden weshalb wir unterwegs wären, sagten sie denen wir hätten deutsche Soldaten versteckt und wollten das
Versteck nicht verraten. Als wir am See vorbei waren begann die deutsche Artillerie aus Richtung Ortelsburg zu
schießen. Unweit von uns explodierten Granaten und richten ein großes Chaos unter Freund und Feind an. Es hieß dann
rette sich wer kann. Die Russen verließen uns in Richtung Waldpuschsee und wir kehrten orientierungslos nach Seelonken
zurück. Nach Rohmanen konnten wir nicht zurück weil die deutsche Artillerie aus Richtung Eichtal anfing unser Dorf zu
beschießen. Schließlich sind wir auf dem Abbau Brosch untergekommen. Ein durch Granatsplitter schwer verletzter Russe
suchte dort auch Zuflucht. er versucht sich mit einem Messer das Leben zu nehmen. es gelang den Frauen ihn davon
abzubringen, weil sonst bei einem etwaigen erscheinen von russischen Soldaten der Verdacht auf uns gefallen wäre.
Später erschienen tatsächlich Kosaken die ihn dann mitgenommen haben. Ihnen folgten in 50 Meter Entfernung Deutsche
Ulanen, die hinter den Russen in einem in der Nähe liegenden Wäldchen verschwanden.
Nachdem die Russen Rohmanen besetzt hatten, versteckten sie sich vorwiegend in mit Stroh gedeckten Gebäuden. Durch
Schießscharten, die sie im Strohdach anlegten, schossen sie auf die deutschen Kampfverbände, die sie wieder vertreiben
wollten. Um die Angreifer zu entlasten, wunde das Dorf von deutscher Seite unter Beschuss genommen. Durch die
Geschosse der deutschen Artillerie entstanden in Rohmanen viele Brände. Die mit Stroh gedeckten Gebäude fielen zuerst
in Schutt und Asche. Unser Vater hatte uns ins Dorf geschickt, damit wir das Vieh im Stall von der Kette losbinden
sollten. Am Dorfrand kamen uns schon deutsche Ulanen und Husaren entgegen. Rohmanen brannte an mehreren Stellen. Unser
Hof war noch unversehrt, nur die Zäune standen schon in Flammen. Wir haben das Vieh los gebunden und anschließend
versucht die Brandherde rund herum zu löschen. Es gelang uns die Flammen von unserem Hof fernzuhalten und auch bei
unserem Nachbarn einzugreifen. In vielen Scheunen und Ställen hatten sich noch viele versprengte Russen versteckt. Die
wurden anschließend von deutschen Soldaten eingesammelt und in Gefangenenlager abgeführt. Am nächste Tag haben wir dann
zerbrochene Gewehre und Munition in Körbe gesammelt und im Dorfteich versenkt.
Am 29. August haben die Russen Rohmanen verlassen, doch schon am 30. August sind sie wieder zurückgekehrt. Hauptlehrer
Müller wurde mit seinem Sohn und Karl Deptolla auf Fahrrädern fahrend von einer russischen Patrouille aufgegriffen.
Sie wurden von den Russen der Spionage verdächtigt weil der Lehrer Müller ein Fernglas bei sich trug. Der Sohn hatte
eine Gymnasiastenmütze und eine Landkarte bei sich. Sie wurden in Richtung Lehmanen abgeführt. Auf einer Anhöhe des
Grundstücks von Ernst Chittka befand sich eine nicht mehr betriebstaugliche Windmühle. Dort soll ein russisches
Kriegsgericht sie zum Tode verurteilt haben. Nach der Hinrichtung wurden sie in der Nähe der Windmühle verscharrt.
Später wurden sie wieder ausgegraben, in Särge gelegt und auf dem Rohmaner Friedhof beigesetzt. Die Ehefrau von Lehrer
Müller hat die Gräber nach dem 1. Weltkrieg mit einem schmiedeeisernen Zaun umrandet.
Die Kämpfe um Rohmanen haben viele Menschenopfer gekostet. Bei uns hinter der Scheune lagen 2 tote Russen und ein
Verwundeter. Die Toten haben wir in einer Kartoffelmiete vergraben. Alle anderen Gefallenen wurden auch gleich an der
Stelle an der sie zu Tode kamen verscharrt und mit einem Kreuz gekennzeichnet. Für die im Raum Rohmanen gefallenen
Russen wurde nach dem Krieg hinterm Dorf, in Richtung Ortelsburg, auf einer Anhöhe ein Heldenfriedhof angelegt. Dort
liegen 20 Soldaten und 1 Offizier. In der Mitte befindet sich ein Trauerbaum und Birken säumen den Zugang von der
Landstraße her. Der Lehrer Dorka hat nach dem Kriege, mit seinen Schülern immer die Gräber gepflegt.
Meine Einberufung zum Militär

Bis zu meinem 17. Lebensjahr habe ich meinem Vater in der Landwirtschaft geholfen. Im Frühjahr
1916 wurde unser Jahrgang gemustert. Im Herbst 1916 erhielten Gustav Spektor, Johann Resonek und ich einen
Einberufungsbescheid. Wir mussten uns in Allenstein im Kaisergarten melden. Dort wurden Rekruten aus mehreren
Landkreisen zusammen gezogen und danach verschiedenen Ausbildungszentren zugeteilt. Wir Rohmaner kamen zum 18.
Infanterie-Regiment nach Osterode. Ein Unteroffizier mit einer Gruppe Musketiere haben uns von Allenstein abgeholt.
Als wir in der Kaserne ankamen haben wir sofort Mittagessen in Blechnäpfen bekommen. Untergebracht wurden wir im
Dachgeschoß der Kaserne. Es waren keine Betten vorhanden, nur Strohsäcke lagen auf dem Boden.
Als dann einige Tage später ausgebildete Kompanien an die Front ausrückten durften wir in einen anderen Block umziehen.
Wir wurden der Größe nach aufgestellt, in Korporalschaften eingeteilt und dann von Kopf bis Fuß eingekleidet. Die
Ausgehuniformen hatten blanke Knöpfe dazu einen Schako mit blanker Spitze. Im neuen Block hatten wir 2stöckige Betten.
Unsere Zivilbekleidung mussten wir in einen Karton verpacken und nach Hause schicken. Dann erst begann das eigentliche
Kasernenleben. Die Kaserne durfte niemand ohne Erlaubnis verlassen, nur in Begleitung eines Unteroffiziers. In der
Kaserne war eine Kantine in der man alles kaufen konnte was in der Kaserne gebraucht wurde.
Am nächsten Tag kam unser Kompanieführer, im Range eines Hauptmanns, zu Pferde angeritten. Er begrüßte uns mit;
Guten Morgen Kameraden, wir antworteten ihm mit; Guten Morgen Herr Hauptmann. Er hat dann die Front abgeschritten und
jeder musste sich mit seinem Namen vorstellen. Um 5 Uhr wurde geweckt, 6 Uhr Kaffee holen, 7-8 Uhr Unterricht, 8-11
Uhr exerzieren auf dem Kasernenhof. Um 11.30 blies der Trompeter zur Mittagspause. Die erste Zeit war noch alles
ziemlich gemütlich aber dann wurde es von Tag zu Tag strenger. Um 10 Uhr abends war Zapfenstreich, dann ging der
Unteroffizier vom Dienst von Stube zu Stube, der Stubenälteste musste die Anwesenheit aller Rekruten melden; zum
Beispiel: Stube 56 belegt mit 14 Mann, alle zu Haus. Wir mussten in 2 Reihen antreten, mit Drillichanzug bekleidet
und in Pantoffeln, ein tadelloses Aussehen präsentieren. Der Diensthabende Unteroffizier prüfte ob alle
vorschriftsmäßig angezogen, gewaschen, gekämmt und ob alle Knöpfe an der Jacke geschlossen waren. Als er bei einem
Rekruten einen offenen Knopf erspähte, hat er uns gefragt, ob jemand ein Taschenmesser bei sich hat.
Wir ahnten nicht Gutes, darum haben wir uns ganz still verhalten und nichts gesagt. Da sagte der U.v.D. plötzlich:
”Wenn niemand von euch ein Messer bei sich hat, dann habe ich ein”. Er zog sein Messer aus der Tasche und fing an, bei
dem Rekruten die Knöpfe abzuschneiden. Als die Knöpfe zu Boden purzelten, brachen wir in lautes Gelächter aus. Das hat
ihn so in Rage gebracht, das unser unwürdiges Benehmen, zuerst mit einem „Donnerwetter” bestraft wurde. Dann schrie
er: ”In den Korridor marsch, marsch, die Treppen runter bis auf den Hof”. Als wir unten angekommen waren hieß es
wieder; "Zurück auf die Stube in der 3. Etage”. Jemand hat mir bei dem Durcheinander, von hinten in den Pantoffel
getreten, so das er auseinander gerissen wurde. Ich bin dann nur mit einem Pantoffel und einem Socken die Treppen rauf
und runter gelaufen. So wurden wir 3-mal hinunter und wieder hinauf gejagt.
Danach ließ er uns wieder antreten und hat mit einer Taschenlampe unter den Betten geleuchtet. Plötzlich schrie er
wieder los: "Das nennt ihr Fegen? wenn ihr mit dem Besen nicht fegen könnt, dann mühst ihr das mit eueren Bäuchen tun.
Marsch, marsch unter die Betten” . Als wir schon alle am Schlafen waren, kam der U.v.D. wieder und hat nachgesehen ob
alle Schränke abgeschlossen waren. Ein Kamerad hatte seinen Schlüssel verloren, deshalb hat er das Schoß nur so
eingehängt. Als der U.v.D. das bemerkte hat er die Türe aufgerissen, die ganzen Sachen aus dem Schrank, quer durch die
Stube verteilt und war dann endlich gegangen.
Die Anziehsachen mussten, fein sauber gefaltet, auf dem Stuhl liegen; da drauf die Socken und die Pantoffeln unter dem
Stuhl. Die Stühle mussten in einer Reihe ausgerichtet sein; die Hosenträger im Schrank einschlossen und der Brustbeutel
mit Geld auf dem Hals tragen werden. Morgens wurden wir geweckt und kamen zuerst in den Waschraum. Jeder musste seinen
entblößten Oberkörper mit kaltem Wasser abreiben. Da draußen strenger Frost herrschte war es im Waschraum auch sehr
kalt, so das manche ihr Hemd anbehielten. Der UvD hat dann bei seinem Kontrollgang alle Verweigerer aufgeschrieben
und ihnen befohlen in 30 Minuten mit einem Besen in der Hand auf der Schreibstube zu erscheinen. Einige mussten den
Kasernenhof fegen, andere die zugefrorenen Latrinen enteisen und reinigen. Während unserer Ausbildungszeit durften wir
die Kaserne nicht verlassen. Wenn man Stuben- oder Frühdienst hatte, blieb keine Zeit zum Frühstücken.
Nach 6 Wochen wurden wir in der Grollmann Kaserne vereidigt. Die Regimentskapelle spielte "Heil dir im Siegerkranz",
danach folgten 3 Strophen des Deutschlandliedes. Vor der Vereidigung wurden die Rekruten gefragt wer keine deutsche
Staatsangehörigkeit besitzt. Es sind dann Luxemburger und auch noch welche aus anderen Ländern hervorgetreten. Sie
wurden gefragt ob sie die deutsche Staatsangehörigkeit annehmen wollen. Die das abgelehnt haben wurden auf die
Schreibstube gerufen und sofort aus dem Militärdienst entlassen. Nach der Vereidigung erfolgte ein Kirchgang, danach
konnte man einen Stadturlaub beantragen. Nach dem Mittagessen mussten alle, die einen Urlaubschein beantragt hatten
vor der Kaserne antreten. Der Hauptfeldwebel prüfte dann ob an der Uniform alle Knöpfe blank geputzt waren, die Stiefel
glänzten und der Rekrut auch vorschriftsmäßig grüßen konnte. Wer diese Anforderungen nicht erfüllen konnte musste
seinen Urlaubschein wieder abgeben und zurück auf sein Zimmer gehen.
Wenn man die Kaserne für eine gewisse Zeit verlassen wollte, mussten zuerst der Korporal, dann der Hauptfeldwebel und
letzt endlich der Hauptmann, seine Zustimmung erteilen. Es wurde geprüft; ob die Ausgeh-Uniform sitzt, alle Knöpfe
blank geputzt sind und der Helm so blank ist das man sich darin spiegeln kann. Unser Hauptmann war in Zivil,
Bürgermeister von Osterode. Er war sehr stolz wenn er seine Kompanie, in Parade Uniform und mit einem fröhlichen Lied
auf den Lippen, durch seine Stadt führen durfte.
Als wir eines Tages zum etwa 6 Kilometer entfernten Schießstand marschieren sollten, war es sehr kalt und glatt. Der
Hauptmann ritt durch das große Tor, wir aber sind durch das kleine Tor gegangen und haben eine steil bergab führende
Abkürzung gewählt. Die Zug- und Gruppenführer gingen voraus und wir im Gänsemarsch hinterher. Ein Kamerad hat sich auf
den Gewehrkolben gesetzt und ist darauf den Berg hinunter gerutscht. Als die Anderen das sahen haben sie es ihm
nachgemacht und hatten einen Riesenspaß. Da kam der Hauptmann plötzlich im Galopp angeritten; ließ alles anhalten und
hat zuerst die Zugführer ausgeschimpft, dann anschließend die ganze Kompanie. Er sagte: „Wie könnt ihr es wagen, so
mit eueren Gewehren umgehen. Ein Gewehr soll man wie seine Braut behandeln und nicht wie einen Straßenbesen”. Zur
Strafe mussten wir, links und rechts der Straße, in zwei Reihen antreten und durch den verschneiten Straßengraben
robben. Die Herrn Zug- und Gruppenführer durften die Straße benutzen und erteilten uns nur Befehle, wie: hinlegen,
nach rechts schwenken, nach links schwenken, einzeln vorarbeiten und sammeln. Als wir dann abgekämpft, in Linien zu
2 Glieder angetreten waren, ging es mit Gesang zum Schießstand.
Auf dem Schießstand angekommen, erhielten wir zuerst eine praktische Unterweisung, für den Gebrauch von Schusswaffen.
Wir mussten solange mit einem nicht geladenen Gewehr üben, bis wir unserem Vorgesetzten beweisen konnten, dass wir
alles im Griff haben. Daraufhin wurden jedem 10 Patronen zugeteilt, so das er unter der Aufsicht eines Unteroffiziers
mit den Schießübungen beginnen konnte. Der Unteroffizier hat die Position der Einschüsse, auf der Scheibe, in einem
Buch eingetragen und nach Beendigung der Übung dem Hauptmann Bericht erstattet, ob der Schütze seine Aufgabe erfüllt
hat oder nicht. Nach dem Schießen wurden die Gewehre zu Pyramiden zusammengestellt. Diejenigen die ihre Aufgabe nicht
erfüllt haben, mussten rund um die Zielscheibe, die Bleikugeln aufsammeln.
Seit unserer Einberufung hatten wir noch keinen Heimaturlaub. Urlaub bekamen nur die, die ihren Heimatort zu Fuß
erreichen konnten. Wegen der vielen Truppentransporte die täglich von Ost nach West unterwegs waren durften wir die
Eisenbahn nicht benutzen. Einmal wurde uns gesagt; wenn jemand gut schießen kann der bekommt Heimaturlaub, aber auch
das war nur ein leeres Versprechen.
Kaisers Wilhelms Geburtstag
Der beste Tag war des Kaisers Geburtstag. Am 27. Januar mussten alle in der Grollmann Kaserne
antreten, der Battalions-Kommandeur beendete seine Laudatio mit den Worten: Seine Majestät, unser Kaiser und König
Wilhelm II, erlebe hoch, hoch, hoch. Dann spielte die Regimentskapelle: Heil dir im Siegerkranz, Herrscher des
Vaterlands, Heil Kaiser dir. Danach folgten 3 Strophen des Deutschlandliedes und anschließend fand ein Gottesdienst
statt. Anschließend gab es ein vorzügliches Mittagessen, Schweinebraten, ein Stück Wurst auf die Faust und Biermarken,
die man in der Kantine gegen gutes Bier einlösen konnte, danach Urlaub bis zum Wecken, ohne Urlaubschein. Mein Vater
und die Mutter eines Kameraden waren schon morgens angekommen, konnten uns aber nicht finden, wurden von einer Kaserne
in die andere geschickt. Erst als wir mit Musik, von der Kirche zurück zur Kaserne marschiert sind habe ich sie
zufällig entdeckt. Als sie mich auch erkannt haben, sind sie nachgekommen. Da war die Freude groß: Der Vater hatte
einen großen Koffer auf einem Krückstock über die Schulter getragen. Ich ging gleich zur Wache und habe sie angemeldet,
sie sind dann bis zum Abend geblieben. Es war einer der schönsten Tage in der Grollmann-Kaserne in Osterode.
Alle 10 Tage bekamen wir Sold. Vor der Auszahlung mussten wir antreten, jeder wurde gefragt ob noch Restgeld vom
letzten Sold vorhanden war. Dann bekam jeder 3,30 Mark, davon musste man noch Sidol für das Koppelschloss und
Schuhkreme für die Stiefel kaufen. Wer geraucht hat und nichts von zu Hause bekam war schlimm dran. Beim Militär bekam
man nicht nur die Ausbildung an der Waffe beigebracht, man lernte auch putzen, nähen, Strümpfe stopfen und vieles
Andere. Man bekam einen beschädigten Strumpf, der musste aufgeribbelt werden, mit der Wolle konnte man dann andere
Strümpfe stopfen oder Kleidungsstücke mit Namen kennzeichnen. wer das nicht konnte, der musste seinen Kameraden
Zigaretten oder Geld geben die das dann für ihn erledigten.
Verschiedene Kameraden gingen nach dem Dienst noch in die Stadt. Um 21:45 Uhr wurde zum Zapfenstreich geblasen, dann
musste man schnell zurück in die Kaserne, weil um 22:00 Uhr der Wachhabende von Bett zu Bett ging und prüfte ob auch
alle anwesend waren. Zwei mal pro Woche fanden Gewaltmärsche statt, mit vollem Gepäck im Tornister. Am Ende der
Marschkolonne fuhr dann ein Pferdewagen, wenn der Feldarzt bei jemandem einen Erschöpfungszustand feststellte, der
durfte dann aufsitzen. Am Sonnabend wurden auf dem großen Exerzierplatz Felddienstübungen durchgeführt, es befand sich
dort ein großer Hügel, den wir immer wieder erstürmen mussten. Am Nachmittag war Revierreinigen angesagt, wir mussten
dann die Tische schrubben, auf einen Tisch wurde Sand mit etwas Wasser gestreut, der nächste Tisch wurde mit der den
Beinen nach oben drauf gelegt und solange hin und her geschoben bis beide sauber waren. Mit den Stühlen geschah das
Gleiche. Dann wurde der Fußboden in der Stube geschrubbt, die Schränke abgewaschen, Staub geputzt, zuletzt kamen Flur
und Treppe dran.
Für die Arbeit war eine Stunde angesetzt, wenn jemand zu früh fertig war erregte er den Argwohn des Diensthabenden
Korporals, der prüfte dann alles genau, fand natürlich immer etwas das nicht seinen Erwartungen entsprach. Der
Übereifrige musste dann Nacharbeiten bis die Stunde um war. Eine Stunde war für Gewehr reinigen und Unterricht an der
Waffe vorgesehen.
Im Februar wurden wir neu eingekleidet; Schnürschuhe, Koppel, alles gelbes Leder mussten wir mit Lederschwärze
behandeln. 2 Wolldecken, Uniform und Helm in feldgrau, da brauchten wir die Knöpfe nicht mehr zu putzen. Die neuen
Gewehre mussten zuerst eingeschossen werden. Es wurden 90 scharfe Patronen und Marschverpflegung ausgegeben, danach
mussten wir mit vollem Gepäck zum Appell antreten. Man konnte kaum gerade stehen, weil der Tornister einen in die Knie
zwang. Der Major, der die Aufstellung besichtigte rief >Brust raus<, dann informierte er uns dass wir ins
Feldrekrutendepot und in Feindesland kommen. Urlaub bekam niemand. Ich habe ein Telegramm nach Hause geschickt, mit
der Nachricht dass wir bald abrücken werden. Einen Tag vor dem ausrücken hat mich meine Mutter noch besucht, sie hat
mir vieles mitgebracht. Alles konnte ich nicht mitnehmen, weil es nicht gestattet war anderes Gepäck bei sich zu haben
als dem Soldaten zustand.
Abmarsch zum Fronteinsatz
Am nächsten Tag hat uns die Regimentskapelle mit Musik zum Bahnhof gebracht. Von Osterode ging
es über Thorn, Posen,
Annaberg, Warschau, Brestlitowsk ins Pruschana-Lager. Das war eine russische Artillerie-Kaserne, in der 2 deutsche,
3 österreichische Bataillone und eine Offiziersschule untergebracht waren. Ein Bataillon das waren wir 18 und 19
jährige, die Anderen waren Männer bis 45 Jahre. Als wir in Osterode abfuhren lag Schnee, in Annaberg/Schlesien waren
die Kühe auf der Weide und im Pruschana-Lager lag der Schnee wieder einen Meter hoch. Drei Kilometer vor unserem vor
unserem Lager war die Bahnfahrt zu Ende. Mit den schweren Tornistern waren viele überfordert, wir mussten immer wieder
warten bis alle nachkamen. Unsere Unterkünfte das waren Baracken die den Russen als Pferdeställe gedient hatten. In
jeder Baracke wurde eine Kompanie mit Schreibstube untergebracht, die nur durch ein Zelt abgegrenzt war.
Wir haben aus Brettern Doppelbetten hergestellt, in jeder Baracke war ein Ziegelofen. Unsere neuen Uniformen und die
scharfe Munition mussten wir abgeben und bekamen dafür alte Bekleidung, sowie Ecksezierpatronen. Hier ging es wieder
Kasernenmäßig zu, das jüngere Bataillon bekam besseres Essen, doppelte Portionen und nach dem Essen 2 Stunden Bettruhe.
Wenn jemand die Bettruhe nicht einhielt und dabei erwischt wurde wusste zur Strafe Holz hacken oder Schnee schaufeln.
Zwei Wochen war Frost bis minus 40 Grad, da hatten wir keinen Unterricht im Freien, alle Aktivitäten fanden in der
Baracke statt, die nur mit nassem Holz beheizt wurde und dem entsprechend war auch die Temperatur im Inneren. Um
Brennmaterial für die Küche zu besorgen mussten wir ins nächste Dorf gehen und von zerfallenen Häusern Holz holen.
Als endlich das Tauwetter einsetzte verwandelte sich die Gegend um Baranowitschi in ein unüberwindbares Sumpfgelände.
Wir wurden mit anderen Einheiten die aus Frankreich zu uns verlegt wurden, zusammengelegt. Wenn jemand nachweisen
konnte dass er Landwirt ist und mehr als 100 Morgen Ackerland besitzt, konnte er einen Urlaub zur Frühjahrsbestellung
beantragen. Ein Gottlieb Piotrowski aus Plohsen hat seinen Urlaub bewilligt bekommen und durfte für 14 Tage nach Hause.
Wenn von der unweit entfernten Front Kanonendonner zuhören war und Alarm ausgerufen wurde, dachten wir es geht los.
Obwohl wir als Reserve aufgestellt waren mussten wir allzeit einsatzbereit sein. Wir haben auch Bunker und Stollen
gebaut, Schützengräben ausgeworfen und mit scharfen Handgranaten exerziert.
Als Gottlieb Piotrowski nach 2 Wochen zurückkam waren wir schon in Alarmbereitschaft und sind dann auch 2 Tage später
ausgerückt. Kamerad Piotrowski hatte mir noch ein großes Paket von zu Hause mitgebracht.
Italien hat Deutschland und Österreich den Krieg erklärt.
Zuerst sind drei Bataillone Österreicher ausgerückt, dann die Deutschen hinterher. Bis zum
Bahnhof Linowa wurden wir von einer Musikkapelle begleitet, dann ging es per Eisenbahn ab nach Baranowitsche. Dort
wurden wir der, an der Westfront aufgeriebenen, 15ten Reserve Division zugeteilt. Es wurde uns gesagt das Kameraden
aus der Heimat gleichen Gruppen zugeordnet werden können. Ich hatte einen Freund aus meinem Dorf, Gustav Spektor,
einen aus Groß Schöndamrau, Wilhelm Lukas und einen aus Ortelsburg, Karl Schlensack, wir kamen zu zusammen in eine
Kompanie. Zuerst waren wir in einem Kinosaal einquartiert, haben jeden Tag Schützengräben ausgehoben und Feldübungen
gemacht. Es war ein sumpfiges Gelände, so dass die Soldaten wegen den vielen Mücken, Netze auf den Köpfen tragen
mussten. Nach einem Gewitter wurde es plötzlich unerträglich. Die Mücken hatten meinen Freund so zerstochen dass sein
Gesicht dermaßen angeschwollen war und ich ihn gar nicht wieder erkannt habe.
Von Baranowitsche wurden wir wieder auf die Eisenbahn verladen, die uns mit unbekanntem Ziel Richtung Osten fuhr.
Nachdem wir unterwegs einmal zum Essenfassen gehalten haben, kamen wir in der Nacht in Krakau an. In der nächsten
Nacht befanden wir uns schon in den Karpaten, wo wir die Hügelketten zu Fuß überqueren mussten, die Fahrzeuge fuhren
um die Berge herum und wir mussten manchmal 2 Stunden warten bis sie uns wieder eingeholt hatten. So ging es immer
weiter bis wir auf einen Berg kamen wo wir Zelte aufgebaut und Biwak bezogen haben. Dort stießen wir auf türkische
Einheiten die auf Mauleseln Munition und Verpflegung über die Berge transportiert haben. Die Esel hatten ein Gestell
auf dem Rücken, auf jeder Seite eine Fass mit Wasser oder Kisten mit Proviant. Ihre Artillerie wurde von 6 Mauleseln
gezogen, während die Offiziere, ohne Sattel, ohne Zaumzeug, nur mit einem Hanfseil ausgerüstet, daher kamen.
Die Mannschaften marschierten wie es jeder für richtig hielt, mit aufgekrempelten Ärmeln, das Gewehr über den Tornister
gelegt, wie die Wilddiebe. Im Gegensatz dazu herrschte bei uns strenge Disziplin, wen jemand aus der Reihe ging kam
sofort der Kompanieführer angeritten, hat uns angeschrieen, uns klar gemacht dass wir keine Türken seien und nur auf
höheren Befehl etwas an der Marschordnung ändern dürften, wer dagegen verstoße, müsste mit einem 3tägigen Arrest
rechnen. Wir haben hinter der der Front Gewaltmärsche durchgeführt die dem Feind große Truppenaufmärsche vortäuschen
sollten.
Wir lagen in einem Buchenwald in Bereitschaft. Überläufer berichteten dass auf russischer Seite eine Großoffensive
vorbereitet wird. In einer Nacht wurde plötzlich Alarm geschlagen, der Russe war zu einem Angriff mit Gasgranaten
übergegangen. Wir lagen unter Zelten und hatten die Gasmasken gar nicht bei uns, sondern nur etwas abseits liegen. In
der Dunkelheit hat mach einer keine Gasmaske mehr gefunden. Es war ein fürchterliches Durcheinander. Dabei war es
unsere Pflicht die Maske immer an dem Tragriemen über dem Hals zu tragen, mit halb geöffnetem Deckel. Uns hat es zum
Glück nicht so stark betroffen weil wir auf einer Anhöhe lagen und die Gaswolken sich im Tal verteilten. Wir wurden in
höchste Alarmbereitschaft versetzt weil der Russe die österreichische Front durchbrochen hatte.
Eigentlich sollten wir noch an einer Gulaschkanone Essen fassen, aber es blieb uns dazu keine Zeit mehr. Der
Kompanieführer befahl uns die Zelte abzubrechen, auf den Tornister aufzurollen und in fünf Minuten marschbereit zu
sein. Die Kanoniere befanden sich schon in der Batteriestellung, luden die Granaten, die sofort abgefeuert wurden. Der
Battalions-Kommandeur versammelte die Kompanieführer und erteilte ihnen die Angriffsbefehle. Derweil sollten wir in
einem Eichenwal der schon mit Granattrichter übersät war, Deckung suchen. Bald hatten wir die Verbindung zu unserem
Batteriestab verloren. Wir warfen unsere Tornister auf einen Haufen, schwärmten unverzüglich, nur mit Sturmgepäck
ausgerüstet, 4 Handgranaten im Brotbeutel, zum Angriff aus. Wir robbten uns einzeln voran. Weil der Russe unsere
Stellungen schon überrannt hatte war jeder auf sich selbst angewiesen. Mann hörte kein Kommando mehr weil der Russe
inzwischen den Rückzug angetreten hatte, um sich auf einer Bergspitze zu verschanzen, von der er uns mit
Flachbahngeschützen beschoss. Irgendwann befanden wir uns in einem Schützengraben, wo ein Leutnant und 17 Mann aus
unserer Division die Stellung hielten. Unter Androhung von Gewalt befahl er uns den Graben sofort zu verlassen und am
Gegenangriff teilzunehmen. Wir sprangen über den Stacheldraht, duckten uns aber sofort im nächsten Graben damit das
mörderische Maschinengewehrfeuer uns nicht hinwegfegte.
Dort blieben wir bis zum Eintritt der Dunkelheit liegen. Wir konnten unsere Waffen nicht mehr einsetzen weil der Sand
die Gewehrschlösser blockiert hatte. Als es Nacht wurde herrschte ein gespenstische Stille. Wir krochen aus dem
Schützengraben und lauschten nach irgendeinem Lebenszeichen von anderen Kameraden. Dann hörten wir irgendwelche Laute
die wir nicht genau zuordnen konnten. Sie kamen aus einem Holzbunker ganz in der Nähe. Wir näherten uns ganz
vorsichtig, als plötzlich eine Schar österreichischer Soldaten herausstürmte. An unseren Stahlhelmen erkannten sie
dass wir Deutsche sind. Bald danach trafen wir auch auf 69 deutsche Soldaten die zu unserer Division gehörten. Dann
kam ein Hauptmann der uns mit Vorwürfen überschüttete, wir seien Feiglinge, wir hätten uns von unserer Einheit entfernt.
Wir haben ihm den Vorgang geschildert, aber ließ nicht mit sich reden und sagte nur dass wir bestraft werden und nichts
zu essen bekommen. Wir wurden einer Maschinengewehr Einheit zugeteilt welche die vorderste Stellung verteidigen
musste. Wir hatten einen Stollen mit 2 Ausgängen.
Die Russen haben bemerkt das sich etwas bewegte und haben uns unverzüglich mit Artilleriefeuer belegt. Schon die
dritte Granate war ein Volltreffer. Vier Kameraden waren sofort tot, ich bekam mit einem Stollenbrett in den Rücken
der sofort blau und grün angelaufen war. Ich schaute nach oben, alles war verschüttet. Ich wusste nicht das da noch
ein Ausgang war, doch die Kameraden die hier in Stellung waren haben mir geholfen das Freie zu erreichen. Ich habe
mich am nächsten Tag krank gemeldet, dachte 2 Tage Schonung zu bekommen, aber der Sanitäter hat mir nur den Rücken mit
Spiritus eingerieben und mich wieder, zurück zu unserer Kompanie geschickt. Sie bestand nur noch aus 3 Gruppen, die in
einem Stollen, der in einen Berg gehauen war, Stellung bezogen hatten. Wir konnten uns hier wenigstens waschen, an
einer Quelle die aus dem Felsen sprudelte. Wir waren nicht mehr einsatzfähig und mussten durch andere Truppenteile
verstärkt werden.
Beim Essen holen musste man auch das Gewehr bei sich haben, es wurde erzählt dass hier der braune Bär herumwandert.
Ich habe keinen gesehen, nur das die Toten ausgescharrt wurden und verstümmelt herumlagen. Nach einigen Wochen haben
die Deutschen eine Gegenoffensive gestartet, von den Bergen herunter, über den Fluss Zlota Lipa, bis zu einer Stadt
die Brzezany hieß. 2 Tage später wurden wir auch eingesetzt, bei großer Hitze ging es in Dauermärschen vorwärts, man
durfte aus den Flüssen kein Wasser trinken, weil es mit Petroleum verseucht war. Nur wenn es dunkel wurde machten wir
halt, dann mussten wir Gräben ausheben um vor Überraschungen sicher zu sein.
Links von uns war Tarnopol und rechts Rumänien. Wenn es nach einer Ruhepause wieder losging dann war es am schlimmsten,
man ging wie auf Nägel, weil die Füße die Strapazen nicht so ohne weiteres wegsteckten. Im Dorf wurde niemals Rast
gemacht, denn da waren immer Brunnen, zu denen alle hinstürmten. Später wurden Melder vorausgeschickt, die von den
Dorfbewohnern Wasser in Eimern am Weg raussetzen ließen, damit die Soldaten Ihren Durst löschen konnten. Ein Soldat hat
gleich den ganzen Eimer mitgenommen und ihn dann als er leer war, irgendwo am Wegrand stehen lassen. Der Kompanieführer
kam angeritten, hat ihn ausgeschimpft und gedroht, ihn mit 3 Tagen Arrest zu bestrafen. Wir gehörten zur Südarmee
welche von Graf Bothmer befehligt wurde.
Die Stellungen waren schlecht ausgebaut, abends mussten wir, von der 2 Kilometer hinter der Front liegenden Feldküche,
Essen und andren Proviant holen. Ich war der Jüngste der Gruppe, musste immer 9 Kochgeschirre tragen, Brot und Post
habe ich in 2 Sandsäcke, die ich über der Schulter hängen hatte, verstaut. Wenn wir unterwegs waren wurde der
Laufgraben immer beschossen. Einmal schlug eine Granate am Schützengrabenrand ein und hat mich halb verschütte, die
Kochgeschirre aus den Händen gerissen, so dass ich ohne Verpflegung im vorderen Graben ankam. Nach drei Wochen sollten
wir abgelöst werden Es hat jeden Tag geregnet, wir haben unsere Mäntel angezogen und uns mit Zelten bedeckt. Nach dem
wir abgelöst wurden kamen wir in ein Dorf dass von Juden bewohnt war. Die Bewohner waren froh dass wir keine Kosaken
waren, mit denen hatten sie vor ein par Tagen schon schlechte Erfahrung gemacht, die hatten ihnen beim Abzug Vieh und
Pferde weggenommen.
Der Boden war sehr fruchtbar, es wurden Hanf, Weizen, Hafer, Mais, Bohnen, Roggen und Kartoffeln angebaut. Die
Bewohner waren gerade mit der Ernte beschäftigt. Die Häuser waren nur aus Holz und Stroh erbaut. Die Leute lebten in
sehr ärmlichen Verhältnissen. Ich hatte mir in unserer Kantine für 20 Pfennig ein Taschenmesser gekauft, das hat mir
ein Bauer für 6 Eier und 2 Pfund Brot abgekauft, daraus hat er sich dann ein Rasiermesser geschliffen. Wenn unser
Versorgungstross auf denn holperigen Wegen nicht nachkam, haben im Dorf auch Verpflegung eingekauft. Die Leute hatten
Angst dass wir nicht bezahlen werden, doch wir bekamen meistens pünktlich unseren Wehrsold ausgezahlt und konnten uns
so manches genehmigen. Um unser Marschgepäck zu erleichtern haben wir so manches aus dem Tornister weg geworfen.
Unweit eines Dorfes wurde halt gemacht, wir sollten Zelte aufschlagen, doch niemand hatte mehr Zeltstöcke im Tornister,
alles war unterwegs liegen geblieben. Der Zugführer befahl uns ins Dorf zugehen und Stöcke zu besorgen. In einer
Scheune stießen wir auf eine Hühnerschar, mit den Stöcken haben wir einige Hühner erlegt, in einem Hanffeld gerupft
und dann im Eiltempo zurück zu unserer Truppe. Als wir ankamen war die Kompanie schon marschbereit, es gleich weiter,
mit dem Huhn im Tornister. Bei der nächsten Rast haben wir die Hühner ausgenommen und Holz besorgt um sie zu kochen,
doch wir mussten schnell wieder weiter marschieren und erst nach 2 Tagen konnten wir uns mit den Hühnern befassen,
leider waren die so alt das sie nicht gar wurden. Das Fleisch mussten wir wegwerfen, nur die Suppe konnten wir noch
gebrauchen.
Meine Verwundung am Pruth.
Wir befanden uns 8 km vor der russischen Grenze. Der Kompanieführer hatte uns informiert das
wir hier zum Einsatz kommen. Wir bekamen noch ein Mittagessen aus der Gulaschkanone, konnten unsere Feldflaschen mit
Tee, der mit Rum angereichert war, auffüllen, Munition und Handgranaten in Empfang nehmen und dann ging es zum Einsatz.
Um 3 Uhr begann das ganze Bataillon auszuschwärmen, sofort hat uns der Russen entdeckt und begann uns mit Artillerie
zu beschießen, je weiter wir vorrückten desto heftiger.
Bis zu einem Eisenbahndamm hatten wir gute Deckung, doch wir sollten den dahinter fließenden Fluss überqueren. Doch
plötzlich explodierte über meinem Kopf eine Schrapnellkugel, der Stahlhelm wurde mir vom Kopf gerissen, Tornister und
Koppel flogen auch weg, ich lag auf der Erde und wusste gar nicht was passiert war. Plötzlich fing Blut aus der
Kreuzbeingegend zu rieseln, aus dem rechten Oberschenkel auch. Gleich nebenan war ein Granattrichter, dort habe ich
Schutz gesucht. In der rechten Rockecke hatte man immer ein großes Verbandspäckchen, das habe ich herausgenommen und
auf die Wunde gedrückt, doch das Blut floss mir bis in den Stiefel. Links und rechts von mir schlugen Granaten ein,
dicke Erdbrocken und Schlamm fielen auf mich herab, doch in meinem Erdloch war ich vor Maschinengewehrsalven geschützt.
Der ganze Rücken war angeschwollen und ich konnte mich überhaupt nicht bewegen.
Die Deutschen mussten die Stellung den Russen überlassen, einer hatte mich entdeckt, da ich aber so blutverschmiert da
lag, hat er bestimmt gemeint ich wäre nicht mehr am leben und ist weitergegangen. Nach zwei Stunden habe ich gehört
das die Russen sich wieder zurückzogen, danach herrschte eine gespenstische Stille. Als es dunkel wurde kamen deutsche
Sanitäter mit Spürhunden und haben die Verwundeten aufgesammelt. Ich wurde auf eine Trage gelegt, lag gebeugt und
konnte mich nicht rühren weil der blutverschmierte Rücken völlig verkrustet war. Ein Pferdegespann konnte nur vier
Tragen befördern, die Fahrt über Ackerfurchen war eine Tortur, ich habe nicht geglaubt das ich es überleben werde. In
einer Dorfkirche wurden wir dann ausgeladen und zu den etwa 50 Verwundeten gelegt die da schon lagen.
Mich haben sie zu den Bauchschüssen gelegt, weil ich einen Nervenschock hatte und am ganzen Körper gezittert habe. Zu
trinken bekam ich nichts, nur einen feuchten Lappen in den Mund. Ich sollte gleich operiert werden, aber es kamen
immer mehr Verwundete, so bekam ich nur eine Tetanusspritze, wurde verbunden und für den Weitertransport ins Hinterland
vorbereitet. Im Morgengrauen wurden wir auf Lastautos verladen, die aus auf ein Landgut brachten, wo wir in einem
Pferdestall untergebracht wurden. Die Fahrer fuhren so schnell über die Granatlöcher, das wir vor Schmerzen geschrieen
haben. Wir baten sie langsamer zu fahren, aber die bekamen es in ihrem Führerhaus nicht mit, erst alt ein Verwundeter,
der einen Krückstock bei sich hatte von hinten die Scheibe einschlug wurde die Fahrt erträglich. Lastautos, die
Munition und Verpflegung an die Front transportiert hatten, brachten in den nächsten Tagen immer wieder Verwundete
ins Hinterland. Die Deutschen hatten an diesem Fronabschnitt hohe Verluste zu beklagen. Wir können von Glück reden
dass wir dem Höllenfeuer überhaupt entkommen sind.
Wir wurden mit Lastautos, die ein Feldlazarett uns geschickt hatte, bis nach Lemberg befördert. da wurden wir gewaschen,
rasiert und frisch verbunden. Auf einem Nebengleis stand ein Lazarettzug, in dem wurden wir anschließend in frisch
bezogenen Betten untergebracht. Der Zug brachte uns über Annaberg nach Freiburg in Sachsen, eine Stunde hinter Dresden.
Hier wurden wir auf Tragen gebettet und mit einem Möbelwagen in ein Reservelazarett transportiert.
Im Heimatlazarett.
Als ich am nächsten Tag aufwachte und das schöne Bett sah in dem ich lag, dachte ich dass ich
im Himmel bin. Ich dankte meinem Herrgott das er mich bis zu diesem Ort begleitet hat. Am Nachmittag kamen Schulkinder
mit Geschenken und haben uns schöne Lieder vorgesungen. Anhand von Röntgenaufnahmen wurde in den nächsten Tagen
festgestellt dass bei mir ein Schrapnellsplitter an der Wirbelsäule in die Kreuzbeingegend eingedrungen war. Ich wurde
jeden Tag in Salzwasser gebadet und bekam wieder volle Verpflegung, da mein Magen zum Glück nicht verletzt war. Auf
dem Transport bekam ich nur Suppe und bei Bedarf einen feuchten Lappen auf die Lippen. Ich bin von 62 auf 43 Kilogramm
abgemagert, gehen konnte ich wegen dem Nervenschock den ich bei der Verwundung erlitten hatte auch noch nicht. Die
Wunde am rechten Oberschenkel war nur ein Streifschuss und wurde mit einem Schutzverband versorgt.
In den nächsten Tagen habe ich einen Brief nach Hause geschrieben und mitgeteilt wo ich mich zurzeit befinde. Meine
Eltern schickten mir ein Paket mit Lebensmitteln, jetzt konnte ich essen was ich wollte. Das Essen im Lazarett war
nicht besonders, jeden Tag nur Kohlblätter. Der weg zu den Toiletten führte durch einen Gemüsegarten. Die gehfähigen
Kameraden haben den ganzen Kohlrabi aufgegessen, so dass schließlich Wachposten aufgestellt werden mussten. Sechs
Wochen lang konnte ich mich nur auf allen Vieren fortbewegen, denn sobald ich mich aufrichtete wurde es mir
schwindelig und ich musste zurück ins Bett.
Als ich wieder bei Kräften war habe ich meinen Eltern mitgeteilt das ich mich in ein Lazarett in ihrer Nähe verlegen
lassen will. Der Chefarzt hatte mir zugesichert, wenn die Möglichkeit besteht in Ortelsburg unterzukommen, wird er dem
zustimmen. Meine Mutter hat daraufhin, in Ortelsburg, beim Lazarettinspektor Zantopf nachgefragt und er hat angedeutet
das sie mich aufnehmen können. Daraufhin bekam ich die Krankenpapiere und einen Fahrschein nach Ortelsburg. Da ich als
Soldat nie Heimaturlaub hatte, beschloss ich zuerst meine Eltern zu besuchen. Ich fühlte mich noch sehr schwach, habe
nach jedem Kilometer Rast gemacht, aber letztendlich war ich wieder daheim bei meinen Eltern. Die Wiedersehensfreude
war sehr groß. Ich bin am 30 Juli verwundet worden und am gleichen Tag wurde mein ältester Bruder beerdigt. Er bekam
den Splitter einer Gasgranate ins rechte Bein und ist an einer Blutvergiftung verstorben.
Am nächsten Tag brachte mich mein Vater ins Garnisonslazarett nach Ortelsburg. Ich wurde jeden Tag gebadet und massiert,
weil die Rückenhaut am Knochen angewachsen war konnte ich mich nicht schmerzfrei bücken. In Ortelsburg verbrachte ich
noch sechs Wochen, bis Ende Oktober, da wurde es schon ziemlich kalt und in unserer Barackenunterkunft ziemlich
ungemütlich. Kohlen und anderes Brennmaterial lagen im Hof auf Halde, aber es war verboten zu heizen. Kameraden die in
der Nähe zu Hause waren konnten Sonntagsurlaub beantragen.
Einer von ihnen brachte von zuhause Brennholz mit und entzündete damit im Ofen ein wärmendes Feuer, andere holten vom
Hof Kohlen, so dass der Ofen in kurzer Zeit glühend heiß wurde und die Gefahr bestand das die Betten Feuer fangen
würden. Wir hatten die Betten schon weg gerückt, da kam der Feldwebel herein und fragte wer das Feuer im Ofen
angezündet hat, doch niemand fühlte sich angesprochen. Der Feldwebel hatte den Vorfall dem Stabsarzt gemeldet, als der
am nächsten Morgen zur Visite kam, war seine erste Frage: ”Wer hat gestern Abend das Feuer im Ofen angezündet”. Als
sich niemand meldete, schrie er uns an: ”Morgen wird alles entlassen, zum Ersatzbatallion, in Diez an der Lahn! Wer
gehen kann, sofort zur Schreibstube, Krankenpapiere und Fahrscheine abholen”. Er erinnerte uns noch daran am nächsten
Tag pünktlich am Bahnhof zu sein, weil eine Verspätung unangenehme Folgen für uns haben würde. Das war das Ende der
schönen Erholungsphase. Ich blieb noch eine Nacht zu Hause und bin dann am nächsten Tag von dort zum Bahnhof gegangen.
Wieder Kriegsverwendungsfähig.
Als wir am nächsten Tag in Diez angekommen waren, wurde ich gefragt ob ich aus dem Heimaturlaub
käme, als ich das verneinte wurden mir 2 Tage genehmigt und 14 Tage Genesungsurlaub dazu. Wieder zurück im
Ersatzbatallion bestand unsere Tätigkeit aus Wache schieben und Kartoffel schälen. Nach einem Monat wurden wir von
einem Generalarzt untersucht, er hat mich für nicht einsatzfähig befunden weil ich noch den Steckschuss im Rücken
hatte und das linke Bein 10 Zentimeter dünner war. Jetzt fing das Kasernenleben wieder von vorne an. Wachdienst,
Gewehr laden, sichern, Ehrenbezeugung, Einzelmarsch und Appell. Wer nicht weit nach Hause hatte bekam zu Weihnachten
Urlaub. Ich hatte zu Heiligabend und Silvester Torwache, denn nach Ostpreußen wurde niemand beurlaubt.
Nach Neujahr 1918 wurden wir neu eingekleidet und kamen nach Köln zur Baukompanie. Mit Musik wurden wir zum Bahnhof
gebracht. In Köln wurden wir noch mit Soldaten die von andern Truppenteilen dorthin verlegt wurden in einem großen
Kinosaal, im Stadtteil Edengarten untergebracht. Wir brauchten keinen Dienst zu machen und konnten zu Heilige Drei
Könige den Gottesdienst im Dom besuchen. Kameraden die aus irgendwelchen Gründen im Arrest saßen wurden gefragt ob sie
auch am Gottesdienst teilnehmen möchten, dann würde ihnen die Strafe erlassen. Fast alle haben dem zugestimmt. Einige
Tage später wurden wir wieder auf einen Transportzug verladen, der uns über Herbestal, Antwerpen nach Brügge in Belgien
brachte. Hier mussten wir den Zug kurzfristig verlassen und einen Luftschutzkeller aufsuchen, weil Fliegeralarm
gemeldet wurde. Danach ging es wieder weiter nach Turut, Kortemark, Hauseme, Kautremollen, Zaren, Zarenlinde. Dort
wurden wir in verschiedene Gruppen aufgeteilt und einer Pionierkompanie auf dem Pionierpark Struwendorf zugewiesen.
Wir haben hinter Klerken Bunker für schwere Maschinengewehre gebaut. Unsere Arbeit konnten wir nur bei Nebel verrichten,
denn bei Sonnenschein waren wir sofort dem Beschuss der feindlichen Artillerie ausgesetzt. eine Kleinbahn die Munition
und Stacheldraht an die Front brachte war dem Beschuss besonders ausgesetzt. Die Gleise, von schweren Geschossen
zerfetzt, mussten immer wieder hergerichtet werden, damit der Nachschub aufrechterhalten werden konnte. Später haben
wir am Kemelberg bei Armentier, eine Brücke über die Lys gebaut. Um in dem Sumpfgelände einen Untergrund dafür zu
schaffen, mussten wir 10 bis 12 Meter lange Pfähle in den Boden rammen. Ein Feldwebel gab immer den Befehl: „Hoch den
Bär, noch viel mehr, dass man sieht, wie er zieht, denn dieser Pfahl, glatt wie ein Aal, durch Fels und Stein, durch
Wasser und Sand, fürs Vaterland”. Jedes mal mussten wir den Bär an Schnüren hochziehen und dann wieder herunterlassen.
Wenn es manchmal, trotz vieler Mühe nicht mehr weiter ging wurde der Pfahl auf eine bestimmte Länge abgeschnitten.
Nach Fertigstellung der Brücke kamen wir in die Siegfriedstellung bei Kambrei, zum Bau eines Bataillons-Gefechtstandes.
Da der Boden kreidehaltig war, mussten wir die großen Stücke von Hand zu Hand reichen, den Schutt haben wir dann mit
Sandsäcken aus der Baugrube gehoben und mit Ästen getarnt, damit der Stand nicht von feindlichen Fliegern entdeckt
werden konnte. Alle acht Stunden wechselte die Arbeitsgruppe. Wir mussten von der Baustelle durch das Gelände robben,
denn aufrecht gehend war man dem Beschuss der feindlichen Scharfschützen ausgesetzt, die von einem Fesselballon aus
informiert wurden der über den feindlichen Linien stand.
Der Wechsel war mit einem großen Risiko verbunden, und wurde wenn Möglich bei Dunkelheit vollzogen. Um vor
Überraschungen sicher zu sein haben wir spanische Reiter (Stacheldrahtverhaue) gebaut und vor die ersten Gräben
gestellt, die dann oft in der Nacht von den Franzosen geklaut, und dann vor ihren eigenen Linien wieder aufbaut wurden.
Wir hatten aus Bohlen eine Brücke auf Rädern gebaut, die dann in den Graben geschoben wurde, damit die Artillerie und
andere Fahrzeuge über die Schützengräben kamen. Weil um vier Uhr morgens der Beschuss mit Gasgranaten begann, mussten
wir Gasmasken aufsetzen, danach haben feindliche Flieger unsere Munitionskolonne bombardiert und total aufgerieben.
Es wurde auch eine Marinedivision eingesetzt, die bis dahin dem Küstenschutz gedient hatte und jetzt ihren ersten
Einsatz hatte.
Wir sind zuerst ein ganzes Stück in Richtung Amiens vorangekommen, doch dann blieb unser Angriff in den zuvor von
Engländern besetzten Stellungen, stecken. Da die Engländer ihre Stellungen fluchtartig verlassen hatten, fiel ihr
ganzer Proviant in unsere Hände; Schokolade, Weißbrot, Flaschenwein. Die erste Nacht haben wir in einem runden Zelt
verbracht, weil ich mir durch den starken Wind, der da herrschte eine Angina zugezogen hatte, die mit hohem Fieber
verbunden war, konnte ich die vielen Köstlichkeiten überhaupt nicht genießen.
An eine ärztliche Versorgung war überhaupt nicht zu denken, denn es mussten zuerst die vielen Granatlöcher eingeebnet
werden damit die vielen Fahrzeuge und Geschütze wieder weiter fahren konnten. Auch eine Bahnlinie musste repariert
werden, damit die großen Geschütze in Stellung gebracht werden konnten, dabei wurden auch die vielen Kriegsgefangenen,
die bei dieser Offensive gemacht wurden, eingesetzt. Als die Offensive dann schließlich scheiterte, wurden wir an die
Somme verlegt. Da habe ich die Ortelsburger Jäger, die aus Italien an die Westfront verlegt wurden, zum ersten Mal im
Einsatz gesehen.
Unser nächster Einsatzort waren dann Stellungen hinter Laon. Hier wurden die Vorbereitungen zu einer neuen Offensive
getroffen. Feindliche Flieger versuchten uns Tag und Nacht daran zu hindern die Aufmarschwege instand zu halten. Als
die Offensive dann endlich losging, hatten wir die Order eine Brücke über die Oise mit Bohlen und Balken zu verstärken.
Gleich am Anfang der Offensive mussten wir Gasmasken anlegen, um für alle Fälle gewappnet zu sein. Nur die Artillerie
und Kraftfahrzeuge durften die Landstraße benutzen, die Infanterie ging immer im Straßengraben und wurde von einer
Seite von Kopf bis Fuß mit Dreck bespritzt. Die Franzosen und Engländer haben hier schon Panzer eingesetzt, die von
Truppen aus den Kolonien gefahren wurden. Die Australier gingen mit umgekrempelten Ärmeln hinter den Panzern her.
Die letzte Offensive des Ersten Weltkrieges.
Zum Jahresende 1917 hatten noch 153 deutsche 175 alliierten Divisionen gegenübergestanden.
Zur Vorbereitung der Offensive ließ Ludendorff 39 Divisionen aus dem Osten und aus Italien heranziehen. Er ließ
spezielle Angriffsdivisionen formieren, die durch intensive Ausbildung auf den beabsichtigten, schnellen Vormarsch
vorbereitet wurden. 6608 Geschütze, 3500 Minenwerfer und 1070 Flugzeuge wurden hinter dem vorgesehenen
Angriffsabschnitt konzentriert. Den Ausbildungsbefehlen Ludendorffs, die bis zu den Kompanieführern herab verteilt
wurden, konnte man entnehmen, dass der Versuch, den Krieg mit einem mächtigen Schlag zu entscheiden schon in der
nächsten Zeit gewagt werden sollte. Wir übten die fast vergessenen Formen des Schützengefechts und des
Bewegungskrieges, auch wurde eifrig mit Gewehr und Maschinengewehr geschossen. Wir hegten keinen Zweifel daran, dass
der große Plan gelingen würde.
Den ganzen Winter 1917/18 über plante der Generalquartiermeister Ludendorff die deutsche Offensive. Zwar hatten die
Vereinigten Staaten von Amerika dem Deutschen Reich am 6. April 1917 den Krieg erklärt, aber vor dem Sommer des
Jahres 1918 war mit dem Auftreten von US-Truppen in relevanter Größenordnung nicht zu rechnen. Der deutschen Führung
blieb nur ein schmales Zeitfenster, um die Niederlage und den zu erwartenden Diktatfrieden abzuwenden. Ypern,
Armentieres, Arras, Cambrai oder Verdun wurden ernsthaft als Schauplätze erwogen. Ludendorf entschied sich für einen
Angriff zwischen Cambrai und La Fere – genau an der Nahtstelle zwischen der Französischen Armee und dem britischen
Expeditionscorps.
Der Fluss Somme bildete die Grenze zwischen Franzosen und Briten. Die Briten – nicht die Franzosen – sollten das Ziel
des Vorstoßes werden. Ihre Stellungen waren nur 130 Kilometer von der Kanalküste entfernt. Beim erreichen der
Sommemündung wäre die gesamte britische Armee eingeschlossen gewesen, denn hinter ihnen lag die Straße von Dover.
Am 21. März 1918 begann die letzte entscheidende Offensive des deutschen Westheeres im Ersten Weltkrieg. Der
Angriffsstreifen war 75 Kilometer breit. Dort hatte Ludendorff 43 Angriffsdivisionen konzentriert, dahinter 30
weitere Reservedivisionen, ihnen standen lediglich 26 britische Divisionen gegenüber. „Michael“ – so der Deckname der
„Kaiserschlacht“ – lief dank Ludendorffs akribischer Vorbereitung gut an. Der britische Oberbefehlshaber General
Douglas Haig erkannte die Chance, welche die Deutschen in dieser Situation hatten. Wollten die Deutschen diese Chance
nutzen, mussten sie darauf verzichten die Somme zu überschreiten, wo sie auf die französischen Reserven treffen und
sich von der Küste entfernen würden. Genau diesen Fehler begingen jedoch die Deutschen.
Am dritten Tag überschritt der linke Flügel mit der 18. Armee die Somme. Ludendorf stellte die Taktik über die
Strategie, wie er das bei Tannenberg und der Schlacht an den Masurischen Seen auch schon getan hatte. Ludendorffs
Befehl an die 18. Armee vom Abend des 22. März 1918 lautete: „Jetzt gilt es den Sieg auszunutzen, den Feind nicht zum
Stehen kommen zu lassen, Somme und Crozat-Kanal zu überschreiten, bevor feindliche Verstärkungen wirksam werden“.
Was Haig befürchtet hatte, trat nicht ein. Die deutsche Offensive Lief weiter Richtung Süden und lief sich schließlich
tot. Am 31 März war Ludendorff zu der Erkenntnis gekommen, dass „Michael“ gescheitert war. Am 5. April wurde die
Einstellung der Offensive befohlen. Im Hochsommer waren die US-Truppen in Frankreich angekommen und gingen mit den
Franzosen zum Angriff vor. Nur mühsam konnten Hindenburg und Ludendorf den Zusammenhalt der Front waren. Am 24. Oktober
1918 forderte US-Präsident Woodrow Wilson die bedingungslose Kapitulation, am 11.Nuvember Wurde der Waffenstillstand
von Compiegne unterzeichnet.
Zusammenbruch der Westfront und Waffenstillstand .
Als die Offensive dann letztendlich gescheitert war, wurden wir auf Eisenbahnwaggon verladen, in
eine Stellung vor Verdun gebracht und der siebenten bayerischen Division zugeteilt. Als wir ausgeladen wurden nahm der
Franzose den Bahnhof unter Beschuss. Eine Granate traf einen Waggon der mit Seifenpulver beladen war, so dass der ganze
Bahnhof aussah als wäre gerade Neuschnee gefallen. Wir gingen auf die Suche nach Kartoffeln. Als ich mit einem Sack,
vollbeladen die Böschung runter ging um zur Feldküche zu gelangen, schlug unweit von mir eine Granate ein und riss mir
den Sack vom Rücken. Ich bin mit dem Schrecken davon gekommen, mir war nichts passiert.
Der Bahnhof war menschenleer, nur ein par Kaninchen liefen verschreckt durch die Gegend und einigen Kameraden gelang
es welche einzufangen. Am nächsten Tag gelang es uns endlich die Feldküche zu erreichen. Als wir gerade beim Essen
fassen waren, schlug unweit eine Granate ein so dass Pflastersteine das Dach durchschlugen und wir das Weite suchen
mussten. und wir wieder nichts zu Essen bekamen. Ein Friseur aus unserer Kompanie fuhr immer ins Hinterland um uns
mit Proviant zu versorgen. Als er 14 Tage vor dem Zusammenbruch wieder mal zurückkam erzählte er uns schon das der
Krieg nicht mehr lange dauern würde, weil Kaiser Wilhelm mit Frack und Zylinder bekleidet, Deutschland verlassen und
ins Ausland gehen würde. In unserer Einheit hatten wir auch einen Juden der glaubte dass er sich alles erlauben darf.
Eines Morgens ging er in die Küche, als er keinen Koch vorfand stieg er auf die Gulaschkanone und hob den Deckel vom
Kessel in dem der Kaffee kochte an. Der kochende Kaffee verbrühte seine Füße so sehr das er sofort ins Lazarett musste,
für ihn war der Krieg somit zuende. Es kam noch ein Erlass, das Kameraden die 2 Jahre aktiv gedient hatten und
Gefreiter waren sofort zum Sergeanten befördert wurden. Für den 11. November 1918 war ein Waffenstillstand vereinbart
und ab 11 Uhr sollte nicht mehr geschossen werden. Wir hatten unsere Kopfkissen aufgetrennt und eine Kissenschlacht
veranstaltet, um auf diese Art und Weise unserer Freude Ausdruck zu verleihen. Als die Federn durch die Luft flogen
brachen wir in Tränen aus.
In jeder Kompanie wurde ein Soldatenrat gewählt, der aus drei Mann bestand. Wenn der Kompanieführer jemanden bestrafen
wollte, musste er erst den Soldatenrat fragen, der die Strafe befürworten, aber auch ablehnen konnte. Die Offiziere
durften keine Achselstücke mehr tragen, was für sie einer Degradierung gleich kam. Wir waren in einem Dorf
einquartiert und morgens zum Appell angetreten, als einer vom Soldatenrat sich stockbesoffen vor den auf dem Pferd
sitzenden Kompanieführer stellte und schrie: „Alles hört auf mein Kommando”. Der Kompaniechef war wie vom Blitz
getroffen, ihm versagte die Stimme. Wir sahen ein das dies nicht so weiter gehen kann und wählten einen neuen
Soldatenrat. Unser Rückzug begann bei Konflanz, einer Vorfestung von Metz und führte uns zunächst über die
luxemburgische Grenze, wo wir in einem Ort einquartiert wurden. Als wir für die Küche Holz aus dem Wald holen gingen,
entschieden wir uns eine Eiche abzusägen, ohne uns dessen bewusst zu sein, in welchem Forst wir uns befanden. Als wir
beim fällen waren fielen plötzlich Schüsse, die wir auch sofort erwiderten, bis uns ein Elsässer der sich in unserer
Kompanie befand aufklärte: „Kameraden, wir befinden uns hier auf Luxemburgischem Hoheitsgebiet”.
Wir sind dann weiter durch das Fürstentum Birkenfeld marschiert, wo das Städtchen Merzig für uns geflaggt hatte. Das
Elsass haben wir auch noch kurz gestreift. Wo wir bei einem Bauern, der uns kein Stroh für das Nachtlager geben wollte,
einquartiert wurden. Daraufhin gingen wir in die Scheune und haben uns selbst was besorgt. Wir haben dann noch erfahren,
sie hätten ein Schwein geschlachtet und warteten auf den Einzug der Franzosen. Als wir uns 1917, an der Ostfront, in
den in Karpaten, im Einsatz befanden, waren unter uns auch viele Elsässer. Sie durften ihre Heimatpost nicht in
französischer Sprache schreiben, mussten ihre Briefe offen auf der Schreibstube abgeben, wo sie zuerst kontrolliert
und dann abgeschickt wurden. Als ich in einer Nacht, mit einem Elsässer auf einem Vorposten Wache schieben musste,
wollte er mich überreden zum Russen überzulaufen. Als ich darauf nicht eingehen wollte verschwand er plötzlich in der
Dunkelheit und ich habe ihn nie wieder gesehen.
Wir sind dann weiter Richtung Worms und Ludwighafen gezogen, dort wurden wir bei einem Mühlenbesitzer einquartiert,
ein Unteroffizier und vier Mann. Obwohl wir verlaust und verdreckt waren bestand die Müllerin darauf das wir in ihren
Betten übernachteten. „Wenn alles durch ist”, sagte sie, „werde ich alles gründlich reinigen”. Der Müller brachte uns
eine Gießkanne voll Wein und sagte wir sollen es uns Schmecken lassen. Wir haben reichlich davon Gebrauch gemacht, so
dass ich gar nicht weiß wie ich ins Bett kam. Das war meine Erinnerung an die Pfalz. Manchmal waren wir auch 2 Tage im
Quartier.
Vor dem Weitemarsch wurde uns immer gesagt welche Truppe die Vorhut und welche Truppe die Nachhut übernehmen sollte.
Die Nachhut hielt immer Verbindung zu den nachrückenden Franzosen und man muss staunen wie alles reibungslos, ohne
Zwischenfälle von statten ging, was wir in erster Linie dem General-Feldmarschall Paul von Hindenburg zu verdanken
haben, der den Rückzug an der Westfront koordiniert hat.
In Köln angekommen, erhielten wir im Volkshaus unsere Entlassungspapiere, Eisenbahnfahrscheine, Reisepässe,
unterschrieben von Oberstleutnant Mann. Wir mussten Köln umgehend verlassen, weil schon am nächsten Tag die
französischen Besatzungstruppen in einmarschieren sollten. Wir fuhren mit einem Zug der bis Allenstein fuhr, dort
wurden unsere Papiere vom Soldatenrat kontrolliert. Die jüngren Jahrgänge wurden festgehalten, zu neuen Einheiten
zusammengestellt und zur Sicherung der Ostgrenze gegen die Bolschewisten abkommandiert. Ich hatte gesagt das ich noch
einen Schrapnellsplitter in der Kreuzbeingegend habe und durfte daraufhin nach Hause fahren.
Kaum in Ortelsburg angekommen fiel ich wieder dem Soldatenrat in die Hände. Sie haben alles durchsucht, haben mir mein
Seitengewehr und eine Decke abgenommen, aber ich durfte weiter und bin dann kurz vor Weihnachten 1918 auf dem
elterlichen Hof angekommen. Schon auf dem Hof habe ich meine Kleider vom Leib gerissen, weil vor Läusen und anderem
Ungeziefer nicht mehr aushalten konnte und mich erst gründlich gewaschen bevor ich das elterliche Haus betreten habe.
Die Freude über das Wiedersehen war sehr groß.
“ Unser Leben zwischen den beiden Weltkriegen.”
Endlich wieder zurück in der Heimat
Rohmanen war durch die Kampfhandlungen 1914/15 zu einem drittel zerstört worden, aber schon
wieder im Aufbau. Die Firma Grzella aus Ortelsburg hatte die Bauarbeiten übernommen. Unter der Aufsicht von Polier
Karl Kontor wurden die Dachstühle errichtet. Ich habe mich, nach kurzer Erholungspause, auch als Zimmermanngehilfe am
Wiederaufbau beteiligt. Die Firma Grzella hat das Material geliefert und auch unsere Löhne gezahlt. Wegen meinem
Steckschuss bin ich dem VDK beigetreten und habe mit dessen Hilfe eine Rente beantragt die mir auch bewilligt wurde.
Nach vier Jahren wurde ich nach Allenstein zur Nachuntersuchung vorgeladen. Die ärztliche Untersuchung hatte ergeben,
das Geschoß sei verkapselt, und nur das linke Bein etwas in Mitleidenschaft gezogen. Daraufhin wurde die Rentenzahlung
eingestellt.
Der Stellmacher Adam Ornowski war im Krieg als Sanitäter eingesetzt und hatte auf Grund seiner Erfahrungen,
 Beziehungen zum medizinischen Dienst in Ortelsburg aufgebaut. Es wurden dort Lehrgänge in Erster Hilfe angeboten,
die von Prof. Dr. Kutz geleitet wurden. Adam Ornowski hat dafür gesorgt das einige junge Männer aus Rohmanen daran
teilnehmen konnten. Adam Ornowski, August Linka, Emil Rosowski, Johann Dembek, Emil Baschek und ich sind dann dem
Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes beigetreten und mussten jeden Sonntag am Lehrgang teilnehmen. Unser
Gruppenführer war Kreisobersekretär Albrecht, Landrat von Poser, als unser Ehrenvorsitzender, hat viel zu unserer
finanziellen Unterstützung beigetragen und hat dafür gesorgt dass die Bereitschaft eingekleidet wurde.
Beziehungen zum medizinischen Dienst in Ortelsburg aufgebaut. Es wurden dort Lehrgänge in Erster Hilfe angeboten,
die von Prof. Dr. Kutz geleitet wurden. Adam Ornowski hat dafür gesorgt das einige junge Männer aus Rohmanen daran
teilnehmen konnten. Adam Ornowski, August Linka, Emil Rosowski, Johann Dembek, Emil Baschek und ich sind dann dem
Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes beigetreten und mussten jeden Sonntag am Lehrgang teilnehmen. Unser
Gruppenführer war Kreisobersekretär Albrecht, Landrat von Poser, als unser Ehrenvorsitzender, hat viel zu unserer
finanziellen Unterstützung beigetragen und hat dafür gesorgt dass die Bereitschaft eingekleidet wurde.
In jedem Dorf wurde eine Unfallstelle eingerichtet, mit einem Verbandskasten und mit Verbandsmaterial für die erste
Hilfe ausgerüstet. Die Unfallstelle in Rohmanen, die am Haus von der Straßenseite, durch eine Tafel mit einem roten
Kreuz gekennzeichnet war, hatte ich zu verantworten. An Sonntagen wurden wir an Badestellen und bei Fußballspielen
eingesetzt, haben viele Übungen bei Waldbränden durchgeführt und auch Ausflüge nach Rudzany am Niedersee gemacht. Bei
der Einweihung des Tannenbergdenkmals in der Nähe von Hohenstein kamen wir an Straßenkreuzungen zum Einsatz.
Rohmanen hatte auch eine freiwillige Feuerwehr. Bis zum ersten Weltkrieg hat Friedrich Biella als Brandmeister das
Kommando gehabt. Er war aktiver Unteroffizier, hatte gute Führungsqualitäten und die Männer, die allesamt aus dem
aktiven Militärdienst stammten hatten zu ihm ein großes Vertrauen. Nach dem Krieg wollten diese Männer,
(Friedrich Nickel, Friedrich Willam, Julius Wittkowski, Jakob Janowski, Johann Gloddek, Gustav Bednarz), nicht mehr
weitermachen. Friedrich Biella, der inzwischen zum Gemeindevorsteher gewählt wurde, hat sich dann auf einer
Gemeinderatsitzung vorgeschlagen, für die Freiwillige Feuerwehr jüngere Kräfte anzuwerben.
Zum Brandmeister hat er Herrn Wilhelm Pilath vorgeschlagen. Der wurde dann nach Königsberg zur Fortbildung geschickt.
Der Feuerwehr gehörten nun folgende Personen an: Wilhelm Pilath(Brandmeister), August Linka(Stellvertreter), Gustav
Deptolla, Julius Matzey, Johann Dembek, Willy Willam, Gustav Rattay. Der Kreisbrandmeister war Heinrich Thalmann aus
Ortelsburg, sein Stellvertreter war Kreisobersekretär Salzmann. Der Bezirks-Kommissar bei der Ostpreußischen
Feuersozität War Herr Ernst Trzaska. Er hat dafür gesorgt das die Wehr uniformiert und mit Löschgeräten ausgerüstet
wurde. Da die alten Schläuche schon sehr marode waren, wurden sie durch moderne ersetzt, deren Kupplungen auch mit der
Motorspritze übereinstimmten.
Ernst Trzaska hat bei der Feuersozität und beim Landratsamt Finanzmittel beantragt und auch genehmigt bekommen. Der
Schneidermeister Wilhelm Baran wurde beauftragt Tuch und Drillichanzüge nach Maas zu schneidern. Er hat uns
Stoffmuster vorgelegt aus denen wir wählen sollten. Feuerwehrhelme haben wir auch bekommen. Die Gemeinde musste
Finanzmittel bereitstellen, einen Prozentsatz vom Gemeindebudget. Im Brandfall mussten für den Spritzenwagen Pferde
zur Verfügung stehen, von Willy Willam, Gustav Rattay, Julius Matzey und Gustav Dorka, weil sie in der Nähe des
Spritzenhauses wohnten. Am Spritzenhaus wurde ein großer Baum mit Querleisten aufgestellt, wo nach jedem Brand oder
einer größeren Übung die Schläuche zum trocknen aufgehängt wurden.
Der Kreisbrandmeister hat mindestens 2-3-mal im Jahr die Wehren besichtigt. Das ganze Dorf war dann auf den Beinen,
die Bauern mit Pferden, und andere Dorfbewohner mit Eimern und Spaten, wurden dann in verschiedene Gruppen eingeteilt.
Erst hat die Wehr sämtliche Aufstellungen am Gerät geübt; Grundstellung Fahrstellung und Marschstellung. Dann wurde
ein Brand angekündigt, die Feuerwehr mit der Spritze an den Brunnen, die Gruppen dort wohin sie beordert wurden, die
Bauern brachten mit den Wasserkiwen Wasser aus dem Brunnen zum Brandort. Wenn das Wasser im Brunnen alle wurde hat
man den Saugkorb in die Kiewen gelegt und dort Wasser entnommen. Die Wassergruppe ging mit Eimern zum Dorfteich, holte
Wasser und füllte damit die leeren Kiewen.
Der Löschtrupp ging mit Feuerhaken und Löschpatschen auf die umliegenden Gehöfte und versuchte das vermeintliche Feuer
von ihnen fernzuhalten. Nach dem Alarm wurde wieder am Spritzenhaus angetreten. Die Gruppenführer mussten angeben ob
ihre Gruppe auch vollständig erschienen war, denn Übungen wurden nur vor, oder nach der Feldarbeit durchgeführt, so
dass niemand eine Entschuldigung vorbringen konnte. Wer ohne begründete Entschuldigung nicht anwesend war erhielt eine
Verwarnung. Der Kreisbrandmeister erklärte dann welche Handgriffe den Vorschriften entsprachen und welche nicht. Die
Schläuche wurden noch schnell zum Trocknen aufgehängt. Anschließend gingen wir alle in den Gasthof Trzaska, haben über
vorhandene Mängel diskutiert, Verbesserungsvorschläge unterbreitet und zwischendurch den Durst gelöscht. Der
Kreisbrandmeister ist dann, nach einer kurzen Verabschiedung, ins nächste Dorf gefahren, weil er an einem Tag mehrere
Feuerwehren betreuen musste.
Der Rohmaner Dorffriedhof

Einen Kilometer vom Ende des Dorfes entfernt, auf der rechten Seite der Landstraße in Richtung
Ortelsburg, befand sich der Rohmaner Dorffriedhof. Wann dieser Friedhof angelegt wurde entzieht sich meiner Kenntnis.
Nach Aussagen älterer Dorfbewohner soll davor auch schon eine Ruhestätte vorhanden gewesen sein, und
zwar auf der linken Straßenseite gegenüber dem jetzigen Friedhof. An dieser Stelle befand sich bis in die
Nachkriegszeit ein kleiner Brunnen, aus dem die Dorfbewohner, das Wasser zum begießen der Grabbepflanzung auf den
Gräbern ihrer verstorbenen Angehörigen holten. Der Friedhof war in einer Hanglage angelegt, wahrscheinlich weil diese
Parzelle für eine landwirtschaftliche Nutzung nicht geeignet war. Um das Gräberfeld vor herumstreunenden Tieren oder
von der Weide entlaufenen Kühen zu schützen, hat man das ganze Gelände mit einem Holzzaun umgeben. Der Zugang befand
sich von der Straßenseite. Unter einem Torbogen hindurch wurden die Verstorbenen zu Grabe getragen. Die Gräber der
einzelnen Familien waren nebeneinander angelegt, mache, wie zum Beispiel die der Familie Trzaska, sogar mit einem
schmiedeeisernen Zaun eingefasst.
Nach dem 2. Weltkrieg verfiel der Friedhof immer mehr. Die nötigen Finanzmittel für die Pflege der Einfriedung konnten
von den restlichen noch verbliebenen Deutschen nicht mehr aufgebracht werden. An den gepflegten Gräbern konnte man noch
erkennen dass es Verwandte von noch in Rohmanen wohnenden Deutschen waren, oder von bereits im Westen Deutschlands
lebenden, die ihre noch in Rohmanen wohnenden Nachbarn damit beauftragt hatten. Die übrigen Gräber wurden von Jahr zu
Jahr immer mehr von Wildkräutern überwuchert und schließlich auch von Sträuchern und schnell wachsenden Bäumen.
In den späteren Jahren konnte man nicht mehr erkennen dass dort vor Jahren Tote zur letzten Ruhe gebettet wurden. Die
Natur holte sich das ganze Gelände zurück und nur unter großen Schwierigkeiten konnten Besucher aus dem Westen das
Friedhofsgelände noch betreten.
Das Gasthaus Trzaska

Nach dem ersten Weltkrieg hat der Gastwirt Friedrich Trzaska neben dem Gasthof einen großen Saal
für Festlichkeiten und Vereinsfeiern gebaut, in dem schon mal Feuerwehrfeste veranstaltet wurden. Ernst Trzaska war
Feuerkommissar bei der Ostpreußischen Feuersozität. Erich Trzaska war Vollziehungsbeamter beim Amtsgericht in
Ortelsburg. Unser Feuerkommissar war uns beim organisieren der Veranstaltungen sehr behilflich, hat uns den Saal, die
Musik und die Theaterstücke besorgt und die Feuerwehren aus den Nachbardörfern eingeladen.
Zu Manöverzeiten, vor dem 2. Weltkrieg und dann auch während des Krieges, waren im Gasthof Soldaten, meist im Range
eines Offiziers, einquartiert. Fräulein Mariechen Trzaska hat die Poststelle im Dorf betreut. Nachdem ich 1939 zum
Militär eingezogen wurde, hat sie, nach einer Schulung im Ortelsburger Krankenhaus, auch die Unfallmeldestelle
übernommen. Nach dem Krieg, pflegte sie mit vielen Bekannten, die bereits in der Bundesrepublik wohnten, einen regen
Briefwechsel. Auf dem Rohmaner Friedhof hat sie viele Gräber, im Auftrag von Angehörigen, die auf Grund ihrer
Abwesenheit, dazu nicht mehr in der Lage waren, gepflegt. Der Bauunternehmer Kurnitzki aus Ortelsburg, äußerte die
Bitte, sie möchte ihm doch ein Blatt vom Rosenstrauch, der auf dem Grab seiner Eltern steht, in den Brief legen. Als
sie uns den Brief vorgelesen hat, waren wir zu Tränen Gerührt. Sie hat als Letzte aus ihrer Familie, bis zu ihrem Tod
im Jahre 1960, in Rohmanen, im Gebäude der Gastwirtschaft gewohnt und ist auf dem Rohmaner Friedhof beerdigt worden.
Fleisch und Wurstwaren Karl Pelkowski
Im Jahr 1931 hat der Fleischermeister Karl Pelkowski, aus Grammen, direkt neben unserem Hof ein
Anwesen gekauft und dort eine Fleischerei eingerichtet. Er war mit meiner Schwester Frieda, verheiratet. Am Anfang hat
er die Schweine noch auf seinem Hof geschlachtet, später dann im Ortelsburger Schlachthof. Jede Woche fuhr er 2-mal,
mit dem Pferdewagen(Einspänner), nach Ortelsburg zum Wochenmarkt, wo er seine Fleisch und Wurstwaren zu Verkauf anbot.
Am Tag davor, wenn er die Wurst gekocht hat, kamen viele Rohmaner mit Kannen oder anderen Gefäßen, wegen der guten
Wurstsuppe, die er umsonst unter die Leute verteilte. Als Karl Pelkowski, Ende August 1939 zum Militär eingezogen
wurde, hat seine Frau das Pferd verkauft und den Beitrieb stillgelegt. Am Haus hing, immer noch die Tafel mit der
Aufschrift: Karl Pelkowski, Fleisch und Wurstwaren. Ein Witzbold hat irgendwann darunter geschrieben; „Fleisch und
Wurst waren einmal”, drauf hin hat Frau Pelkowski die Tafel entfernen lassen. Karl Pelkowski ist im Mai 1946 in
französischer Gefangenschaft verstorben. Seine Ehefrau Frieda, verstarb an ihrem 85. Geburtstag in Mettmann bei
Düsseldorf.
Die steinreichen Rohmaner Felder
Die letzte Eiszeit hat bei der Schmelze, auf der Rohmaner Feldgemarkung viele Steine und
Granitblöcke zurück gelassen. Überirdisch, aber besonders unter der Erde, gab es viele kleine, aber auch große Steine,
die, den Bauern, beim Pflügen und anderen Feldarbeiten sehr viel Schweiß, abverlangten. In einer Kiesgrube, auf dem
Feld des Bauern August Radek, lag ein Granitblock, von schätzungsweise 100 cbm. Vor etwa 80 Jahren, als man für diese
Steine noch keine Verwendung hatte, griffen die Bauern zu einer „List”. Weil er sonst nicht pflügen konnte, hat mancher
seinem Nachbarn, die Steine in der Nacht auf dessen Feld abgeladen. Als diese Tätigkeit unter Strafe gestellt wurde,
hat man die Steine in Schluchten gekippt und mit Mutterboden zugeschüttet. In späteren Jahren kam diese jedoch beim
pflügen wieder an die Oberfläche. Dann hat man aber schon Steine für den Straßenbau gebraucht und konnte sie so zu Geld
machen. Besonders im Raum südlich von Ortelsburg, bis zur polnischen Grenze, wo Steine eine Rarität waren, kamen sie
jetzt zum Einsatz. Auch beim Bau von Häusern, besonders für die Fundamente, wurden sie eingesetzt, weil auf diese
Weise viel Ziegeln eingespart wurden. Die Firma Gribienski aus Ortelsburg hat die großen Steine mit Dynamit gesprengt
und auf diese Weise die weitere Verarbeitung erleichtert.
Die Steine welche beim Pflügen aus dem Boden geholt wurden, hat man am Feldrand auf große Haufen zusammen getragen.
Wenn die Feldarbeit beendet war, sowie auch in den Wintermonaten, waren wir jeden Tag mit Steinen unterwegs. Wir sind
vorwiegend am Abend los gefahren, weil unter der schweren Last die Wagenachsen so heiß wurden und die Gefahr bestand,
das durch die Dehnung, die Räder blockiert würden. Bei einer Fahrt konnte man bis zu 24 Reichsmark verdienen, wogegen
1 Zentner Roggen für 8 bis 9 Reichsmark zu haben war. Ich bin selbst, mit dem Pferdewagen bis Fürstenwalde, Radostowen,
Luka, Altkirchen, Höhenwerder, ja sogar bis Friedrichshof gefahren.
In Rohmanen wurden auch rote Ziegeln gebrannt. Viele Häuser wurden, mit Ziegeln erbaut, die nur wenige 100 Meter von
der Baustelle entfernt hergestellt wurden. Der Lehn wurde auf den Feldern in der näheren Umgebung entnommen, dann von
Ochsen solange getreten, bis er so geschmeidig war, das er sich in Formen einstreichen ließ. Wenn die Ziegel in der
Form trocken war, wurde sie entnommen und in einem Brennofen gestapelt. Um einen Ofen richtig anzufeuern, brauchte man
12 Raummeter Holz, das im Zeitraum von ein par Tagen verheizt wurde. Der Fischer Karl Glitza hatte schon eine
Knetmaschine, die von einem Pferd angetrieben wurde, das mit verbundenen Augen, den ganzen Tag in die Runde ging.
Im Dorf waren auch vier Kalköfen, in denen so genannte Kalksteine, die sich an gewissen Stellen, im Erdboden befanden,
gebrannt wurden. Nach dem Brennen wurden die Steine mit Wasser abgelöscht und die daraus entstandne Masse diente, nach
dem Beimischen einer gewissen Menge Sand, dann als Bindemittel beim Häuserbau. Das Gerichtsgebäude und das
Lehrerseminar in Ortelsburg wurden mit Kalk, aus dem Rohmaner Brennöfen erbaut. Auch zum Bau einer Eisenbahnbrücke, auf
der, der Zug, den Sawitzfluß, von Ortelsburg nach Allenstein überquerte, hat mein Großvater, mit einem Ochsengespann,
Kalk gefahren.
Hinter der Scheune, beim Bauern Johann Dembek hat man Tonerde gefördert, aus der man mit Hilfe einer Formerscheibe,
die von einem Arbeiter mit Muskelkraft(Fußbetrieb) angetrieben wurde, schöne Krüge, Schalen und Vasen geformt hat.
Die Töpferware wurde, nachdem sie trocken genug war, auch in einem Ofen gebrannt, anschließend mit einer Lasur
überzogen und wieder gebrannt. Es wurden auch Kacheln zum Bau von Kachelöfen hergestellt, die mit verschiedenen
Ornamenten versehen, die Wohnstuben unserer Vorfahren schmückten. So haben unsere Großväter ihr Leben gemeistert und
nach und nach, unsere Dörfer aus der Rückständigkeit in die Neuzeit geführt.
Das gesellschaftliche Leben nach dem 1. Weltkrieg

Als der Lehrer Alfred Dorka, ein Frontkämpfer des Ersten Weltkrieges und ein Sportsmann, als
zweite Lehrkraft an der Rohmaner Schule angestellt wurde, hat er die Sitten und Gebräuche aus früherer Zeit wieder zum
Leben erweckt. Zuerst hat er die Jugend zusammen gerufen, einen Jugendverein und einen Fußballclub, gegründet. Zum
Vorsitzenden des Fußballclubs wurde Johann Gloddek berufen, der ihn auch geleitet hat. Bauer Wilhelm Spittka, der am
Rohmaner See wohnte, stellte Land für einen Sportplatz unentgeltlich zur Verfügung. Lehrer Alfred Dorka hat am
Rohmaner See eine Badestelle ausgesucht und ein Sprungbrett bauen lassen. An jedem Sonnabend im Sommer, bevor die
Sonne unterging, versammelte sich die gestammte Jugend des Dorfes an der Badestelle am See. Es wurde gebadet,
Heimatlieder gesungen, gespielt, im Fackelschein eines großen Biwakfeuers, bis in die späte Nacht hinein. Der Fischer
Karl Glitza hat uns Kähne zur Verfügung gestellt, mit denen wir auf den See hinausgepaddelt sind, dabei hatten wir viel
Spaß, was wiederum den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft gefördert hat. Ich habe mit meiner Mandoline den Gesang von
Volks- und Heimatliedern begleitet.
Der Rohmaner See liegt in einem Tal, dessen Hänge zu beiden Seiten mit Kiefern und Tannen bewaldet sind. Wenn man
gesungen oder Musiziert hat, hallte es von den Hängen zurück. Die Ufer waren mit Kalmus und Schilf bewachsen, was für
die Fischaufzucht von Vorteil war. Wenn man an einem sonnigen, windstillen Tag, am Seeufer spazieren ging, traf man
oft auf Flachstellen, an denen sich die Fischbrut im Sonnenlicht wärmte, wie ein Mückenschwarm. Im See befanden sich
folgende Fische: Karpfen, Hechte, Schleie, Barsche Plötze, Rotaugen, Aale und Krebse. Am Sonntagmorgen brachten viele
Rohmaner ihre Pferde zum See um sie zu baden.
Es wurden dort, unter der Aufsicht von Lehrer Dorka, auch viele Jugendfeste mit Theatervorführungen veranstaltet, zu
denen er selbst die Vorlagen organisiert hat. Der am See wohnende Bauer Johann Nadrowski, hat uns ein Scheunentor, als
Tanzboden zur Verfügung gestellt. Der Zimmermann Wilhelm Wittek hat uns eine Windmühle gebaut, die am auf dem Boden
liegenden Scheunentor aufgestellt wurde, dazu kamen Noch Tannen und Fichten, die das Ganze wie ein Bühnenbild
erscheinen ließen. Es wunden viele Bühnenstücke aufgeführt, unter anderen >Alte Weiber werden jung gemahlen<. Dazu bot
die Windmühle die entsprechende Kulisse.
Nach der Vorführung wurde der Boden aufgeräumt, um dann als Tanzdiele zur Verfügung zu stehen. Der Gastwirt Trzaska
hatte Tische und Bänke aufgestellt, Speisen und Getränke angeboten, so dass sich die die Veranstaltung bis in die
späte Nacht hinein zog. Es waren auch Leute aus Ortelsburg und anderen Nachbardörfern dabei. Im Winter hat Lehrer
Dorka eine Kreisrodelbahn eingerichtet, die von Zeit zu Zeit mit Wasser besprengt wurde, um die Gleitfähigkeit zu
verbessern. Von einer Anhöhe ging hinunter bis auf den halben See, was für alle ein großes Vergnügen war. Es kamen
Lehrer mit Schulklassen aus der näheren Umgebung um hier zu Rodeln.
Als Herr Lehrer Jobski als Hauptlehrer nach Rohmanen kam hat er mit dem Bürgermeister und der Gemeindeverwaltung
beschlossen, in der Nähe des Dorfes, auf einem zur Schule gehörenden Grundstück, einen Sportplatz anzulegen. Dafür
wurde gleich hinter den Gärten, 6 Morgen Ackerland abgetrennt, und nach Feierabend hat Lehrer Dorka mit den
Jugendlichen eingeebnet und gleich nebenan einen Graben für Schützenstand und Kugelfang ausgehoben. Am Sonntagvormittag
wurde Fußball gespielt und um 15:00 Uhr war Kleinkalieberschießen angesagt. Es musste auch ein kleiner Beitrag erhoben
werden, um Munition kaufen zu können. Eine Büchse konnten wir aus beim Kleinkalieberverein in Ortelsburg ausleihen.
Nach Hitlers Machtergreifung
Als Adolf Hitler an die Macht kam wurde die SA gegründet. Der Bürgermeister Michael Kownatzki
wurde zum Gruppenführer ernannt und folgende Männer haben sich freiwillig gemeldet: Wilhelm Matzey, Johann Gloddek,
Gustav Nadrowski, August Buttler, Karl Baran, Emil Nickel, Wilhelm Jaschinski, Emil Bork, Ernst Rattay und Gustav Bach.
Bei Versammlungen war die SA in Uniform angetreten um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Wer versucht hat Unruhe zu
stiften, egal aus welchem Grunde, wurde aufgefordert den Saal zu verlassen, andernfalls wurde er mit Gewalt entfernt.
Herr Lehrer Jobski wurde zum politischen Leiter ernannt, seine Frau hat die NS-Frauenschaft gegründet, Lehrer Dorka
die HJ, und so bekam die Dorfgemeinschaft, nach und nach ein anderes Gesicht. Der Sportplatz und der Schützenstand
wurden jetzt mehr als früher in den Mittelpunkt gestellt. Nach der Feldarbeit hat der Bürgermeister Fuhrwerke bestellt
und den Sportplatz noch besser herrichten lassen.
Der Bauer Wilhelm Both wurde zum Ortsbauernführer ernannt, mit der Aufgabe alles Land für den Anbau von Getreide und
Futtermittel bereitzustellen, oder wenn das nicht möglich war mit Wald aufzuforsten. Durch den Einsatz von Kunstdüngern
sollten größere Erträge aus dem Boden geholt werden, um den Viehbestand zu vergrößern und mehr Milch und Butter zu
produzieren. Deutschland sollte im Stande sein sich selbst zu selbst zu ernähren, ohne auf Importe angewiesen zu sein.
Frau Jobski hat, innerhalb der der NS-Frauenschaft, mit Hilfe von Fachkräften aus Ortelsburg, Lehrgänge veranstaltet,
auf denen man Backen und Nähen lernte. Auf den Bauernhöfen befand sich auch immer mehr Rassegeflügel, das eine erhöhte
Produktion von Eiern und Geflügelfleisch sicherstellen sollte.
Die Rohmaner Bauern hatten, außer in der Landwirtschaft, noch andere Verdienstmöglichkeiten in der Kreisstadt. In
Ortelsburg wurden vier Sägewerke betrieben, die mit Langholz aus dem Walde versorgt werden mussten. Wir haben eine
Kiefer von über 8 Festmeter angefahren, der wir zuerst 6 Meter Spitze abschneiden mussten, um diese Last überhaupt
auf den Wagen zu bekommen. Sechs Pferde musste angespannt werden um den Wagen zur befestigten Straße zu bringen.
Fichten und Tannen wuchsen bis zu einer Länge von 30 Metern. Auch beim Transport von Ziegel, von der Ziegelei zum
Bahnhof, konnte man gutes Geld verdienen.
Im Jahr 1934 wurde Rohmanen an das überregionale Stromnetz angeschlossen und schaffte auf diese Weise den Sprung von
der Petroleumlampe zur Glühbirne. Neben dem Grundstück von Karl Pietzonka wurde ein Transformatorhäuschen errichtet,
in dem der ankommende Strom von einer Hochspannung auf eine Verbrauchsspannung transformiert wurde. Es gab schon eine
Überlandleitung, die aus Richtung Ortelsburg kommend, quer über die Felder, in Richtung Neu Keykuth weiter ging.
Durch eine Zwischenspanne wurde der Transformator, mit der Hauptleitung auf Kownatzkis Feld verbunden.
Ein Stromanschluss konnte die Arbeit im Haus und Hof auf vielfältige Weise erleichtern, doch nur die besser gestellten
Bauern, sowie noch manche Pensionäre, die ein festes Einkommen hatten, konnten sich dass leisten. Weil nur wenige an
der Elektrifizierung teilnahmen, war ein Stromanschluss mit hohen Kosten verbunden. Nur Gustav Pietzonka, Gasthof
Trzaska, Friedrich Nickel, die Schule und Wilhelm Both, wurden in der ersten Phase erfasst.
Im Jahr 1952 wurde von den polnischen Behörden die zweite Stufe der Elektrifizierung eingeleitet, in der alle im Dorf
stehen Gebäude erfasst wurden. Am Anfang wurden nur Leitungen für Lichtstrom gelegt und auch nur 3 Lichtstellen pro
Haushalt bewilligt. Doch im nachfolgenden Zeitraum wurden dann, wenn Material vorhanden war, weitere Lichtpunkte
angelegt. 1952, am zweiten Wochenende im Advent, wurden dann die Leitungen geschaltet und alle waren von der
plötzlichen Helligkeit sehr begeistert. Wenn man Glühbirnen auswechseln wollte musste man am Anfang weite Wege
zurücklegen, um welche zu bekommen. In den 60ger Jahren wurden dann immer mehr Starkstromleitungen gelegt, weil die
Bauern elektrische Geräte kaufen konnten. Ende der 60ger wurden auch die Abbauten an das Stromnetz angeschlossen.
Das Urnengrab auf unserem Feld
Auf unserem Feld, in Richtung Seelonken, bin ich oft beim pflügen gegen Steine gestoßen, manchmal
rissen sogar die Stränge am Pferdegeschirr. Eines Tages nahm ich einen Spaten, Brechstange und einen langen Baum, um
der Sache auf den Grund zu gehen. Als ich eine Menge Sand ausgehoben hatte stieß ich auf eine steile, aus Steinen
errichtete Wand, die ich auch mit dem Baum nicht aus der Fassung bringen konnte. Ich habe den ganzen Vormittag gegraben,
konnte jedoch nicht unter die Steine kommen. Einige Tage später hatten wir in der Schule eine Bauernversammlung, da
habe ich Herrn Biella und Herrn Lehrer Dorka von meinem Fund berichtet. Am nächsten Morgen kam der Lehrer Dorka mit der
ganzen Schulklasse, mit Spaten und Sieben ausgerüstet auf unser Feld und fingen an die ausgehobene Erde zu sieben.
Lehrer Dorka benachrichtigte daraufhin den Leiter des Ortelsburger Heimatmuseums, der am nächsten Morgen vorbei kam um
sich die Fundstelle genau anzusehen. Er beauftragte ihn 4 Mann zu besorgen, um die Steine ringsum frei zu schaufeln.
Zwischen den Steinen durften wir die Erde nur mit Esslöffeln ausheben. Als es plötzlich zu regnen anfing hat Lehrer
Dorka die Brauerei Daum, in Ortelsburg angerufen, die uns über der Fundstelle ein Zelt errichtet haben, damit wir
ungestört weiterarbeiten konnten. Wir fanden 8 flache und 8 hohe Urnen zu beiden Seiten am Körper. Die Urnen wurden in
Gipsbinden eingewickelt und ins Heimatmuseum nach Ortelsburg gebracht, wo sie durch einen Fachmann, der extra aus einem
Königsberger Museum angereist war. Nach Reinigung der Urnen hat er festgestellt, das die Grabstätte etwa 2000 Jahre vor
Christi Geburt angelegt wurde und ein Doppelgrab war, in dem ein Toter liegend und einer in Hochstellung beigesetzt
wurde.
Die Nachricht von der Fundstelle verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Es erschienen viele Schaulustige, ganze
Schulklassen aus der Umgebung, mit Autos und zu Fuß. Durch die vielen Menschen wurden die bestellten Ackerflächen auf
unserem Feld sehr in Mitleidenschaft gezogen, eine Entschädigung haben wir nicht erhalten. Das Grab wurde vor dem
Heimatmuseum in Ortelsburg wieder so aufgebaut wie man es auf unserem Feld vorgefunden hat. Für den Transport der
Steine wurde ich entlohnt. Die Urnen hat das Königsberger Museum an sich genommen und wollte sie nicht wieder hergeben,
weil die solch einen Fund noch nicht in ihrer Sammlung hatten.
Sonnenwendfeuer
Am 24 Juni fand eine Sonnenwendfeier statt. Ein Brauch der an die alten Germanen erinnern sollte.
Der Lehrer Dorka hat den Bürgermeister beauftragt 2 Fuhrwerke in den Wald zu schicken, die Holz und alten Reisig holen
und auf dem großen Schulberg abladen sollten. Das Straßenbauamt hat uns Teertonnen zur Verfügung gestellt. Die ganze
Dorfgemeinschaft wurde eingeladen, am Abend, nach der Feldarbeit, an der Sonnenwendfeier teilzunehmen. Lehrer Dorka
hielt zuerst eine Ansprache, in der er anschaulich erklärte wie unsere Vorfahren in grauer Vorzeit gefeiert haben.
Nach dem offiziellen Teil wurden das Holz und die Teertonnen angezündet, es wurden Heimatlieder gesungen, wie: Wild
flutet der See, drauf schaukelt der Schiffer den schwankenden Kahn, Schaum wälzt er wie Schnee, von grausiger Mitte
zum Ufer heran, wild fluten die Wellen auf Vaterlands See, wie schön, oh trag mich auf Spiegel zu Hügel, Masovias See.
Masovia Land, mein Heimatland, Masovia es lebe mein Vaterland.
Lehrer Alfred Dorka und sein Wirken für Rohmanen.

Friedrich Biella hatte auf seinem Feld einen Granitstein mit einer geraden Seite, den haben wir
mit viel Schweiß an den Dorfteich transportiert und auf einer Erhöhung abgelegt. Der Stein sollte zum Denkmahl für die
Gefallenen des Ersten Weltkrieges umgestaltet werden. Da zu Wenige daran ein Interesse zeigten, wurde diese Idee fallen
gelassen und der Stein irgendwann ins Wasser gerollt. Der Lehrer Dorka war viele Jahre in Rohmanen tätig, dort hat er
später seine ehemalige Schülerin, Lotte Biella geheiratet. Er hat sich sehr für die Entwicklung des Dorfes interessiert,
war bei jeder Gemeindeversammlung anwesend und hat auf Schwachstellen hingewiesen die den Fortschritt behinderten.
Gemeinsam mit den Schülern hat er den Ehrenfriedhof für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges gepflegt, an der
Wegegablung nach Eichtal und zu Ehren des Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg eine Eiche gepflanzt.
Zum Advent hat Lehrer Dorka mit der Jugend einen Adventstern, in verschiedenen Farben gebastelt.
Der Stern wurde auf einer 2 Meter langen Stange befestigt, in der Mitte wurde ein Wachslicht angezündet, am Stern
wurde eine Schnur angebracht, wenn man daran zog rollte der Stern hin und her. Am ersten Wochenende im Advent
versammelten sich jung und alt, um den Stern durch das Dorf zu tragen. Alle schlossen sich dem vorausgehenden
Sternträger an, der den Stern durch die Hauptstraße und die angrenzenden Wege trug. Dieser Sternmarsch wurde an den
folgenden Adventwochenenden wiederholt.
Am ersten Weihnachtfeiertag wurde um 4:00 Uhr morgens ein Frühgottesdienst gehalten. Zuerst hat der Pfarrer eine
Andacht gehalten, dann haben die Kinder ein Krippenspiel aufgeführt und die Gemeinde hat schöne Weihnachtslieder
gesungen. Der Gastwirt Trzaska hat uns den Saal zur Verfügung gestellt. Wir hatten eine Posaunen- u. eine
Gitarrengruppe. Unter der Leitung von Herrn Willi Doormann spielten: Gottlieb Brosch, Fritz Ollech,
Gustav Rattay(Sopran), Wilhelm Pilath, Gustav Brosch(Alt), Fritz Both(Tenor) und Fritz Brosch(Bass).
In der Gitarrengruppe wirkten mit: Martha Ollech, Hedwig Ollech, Martha Lekzik, Martha Michalick und Auguste Lekzick.
Willy Doormann hat sie auf der Geige begleitet.
Kurz vor Ausbruch des 2. Weltkrieges
Bei der Aufstellung des Grenzschutzes(Regiment Buchholz), hat er als Hauptfeldwebel die
Gruppenführerkurse überwacht und selbst die fähigsten Männer dafür vorgeschlagen. Das Ausbildungspersonal hat das
Jäger-Battalion gestellt. Wir kamen zuerst ins Stadion(Waldheim), wurden da eingekleidet und dann ging es gleich
kasernenmäßig zu, theoretisch und praktisch. Jeder musste vor die Front treten und nachweisen ob er im Stande ist,
Befehle zu erteilen. Abends wurden Filme vorgeführt die uns zeigen sollten wie eine Gruppe sich im Gelände entfalten
muss. Die Exerziervorschriften hatten sich, im Verhältnis zu Kaiser Wilhelms Zeiten, etwas geändert. Damals bestand
eine Gruppe aus 8 Mann und einem Unteroffizier, jetzt aus 10 Schützen, 3 für das leichte Maschinengewehr und einem
Unteroffizier(13 Mann). Nach der Schulung folgte eine Abschlussprüfung, danach ein gemütliches Beisammensein. Aus
Rohmanen haben folgende Männer die Prüfung bestanden: Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy, Gustav Rattay und
Gustav Deptolla. Unsere Uniformen waren alle zu klein und es gab viel zu lachen bei der Anprobe.
Die erste Übung habe ich mit Emil Rosowski, in Lenzinen gemacht. Der Gutsbesitzer Marzinzick hat seine Scheune als
Unterkunft zur Verfügung gestellt. Er war im Range eines Hauptfeldwebels. In seinem haus war die Schreibstube
untergebracht, die er selbst verwaltete. Ein Lastauto hatte Uniformen aus der Kaserne in Ortelsburg geholt, jeder
musste eine Uniform anlegen und dann wurde solange getauscht bis alle eine passende gefunden hatten. An den Namen des
Kompanieführers kann ich mich nicht mehr erinnern. 1935 wurden wir zu einer Übung in die Dragonerkaserne nach Lyk
einberufen. Die Gruppenführer, Zugführer, und Kompanieführer die schon Frontberührung im dem Ersten Weltkrieg hatten,
mussten eine Woche früher anreisen. Die Übungen waren auf 6 Wochen angelegt. Die meisten der einberufenen waren noch
nie mit dem Wehrdienst in Berührung gekommen. Jeder Gruppenführer bekam 13 Mann zugeteilt.
Unser Zugführer war Leutnant Neumann, Kompanieführer Oberleutnant Rutschko, Battalions-Kommandeur Major Gröning
(Regiment Buchholz). Hier ging es wieder Kasernenmäßig voran. Das Bataillon wurde hier vereidigt. Jeden zweiten
Sonntag durften unsere Frauen uns besuchen. Ein Jahr später wurden wir wieder zu einer Übung einberufen, auf den
Truppenübungsplatz nach Arys. Jeder Gruppenführer hatte den Auftrag die Gruppe zu entfalten, und auf bewegliche
Figuren zu schießen. Diese Übung musste später mit scharfer Munition wiederholt werden. Jedes Maschinengewehr bekam
50 Schuss, jeder Schütze 20 Schuss zugeteilt. Nach dem Abschießen wurden die Treffer gezählt und dem Kommandierenden
Bericht erstattet. In einiger Entfernung spaziert ein Storch umher, der gar nicht bemerkt hatte dass geschossen wurde,
was bei den Kameraden ein großes Gelächter hervorrief.
Nach der Übung wurde uns gesagt das jeder Gruppenführer eine arische Abstammung nachweisen sollte. Ich konnte in den
Rheinsweiner Kirchenbüchern meine Vorfahren aus Gellen, bis zum Jahr 1732 zurück, nachweisen und wurde zum
Unteroffizier befördert. Aus unserem Dorf wurden auch, Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy und Gustav Deptolla
befördert. Zwischendurch mussten wir schon mal in die Radfahrer-Kaserne nach Ortelsburg, Gewehre empfangen und im
Gelände üben. Am 31 Juli 1939 wurde mir von einem Soldaten ein Schreiben übereicht, das mich aufforderte, am 1. August
um 6:00 Uhr, bei der 3. Kompanie, des 2. Infanterieregiments zu erscheinen.
Um 5:30 hat mich meine Schwester in die Kaserne gebracht. Auf der Schreibstube erklärte mir der Hauptfeldwebel,
dass mir ab sofort der Dienstgrad eines Sanitäters zugewiesen wird, ich mich in der Kammer einzukleiden hätte und mir
in der Handwerkerstube die entsprechenden Schulterklappen annähen lassen sollte. Die aktiven Sanitäter wurden den
Feldlazaretten zugewiesen und wir kamen an ihre Stelle. Unser Bataillon wurde nach Schodmak zum Bunker bauen und
Stacheldraht verlegen eingeteilt. Wir zogen in Begleitung einer Musikkapelle bis zur Kreuzung am Krankenhaus, dann
weiter zu unserem Bestimmungsort, gefolgt von einer Gulaschkanone die in den nächsten Tagen für unsere Verpflegung
sorgen sollte.
Am 14 August haben wir die Jägerkaserne, begleitet von einer Musikkapelle endgültig verlassen und zogen zuerst durch
Ortelsburg, dann über Lehmanen ins Feldmanöver, hinter Rohmanen. Dort entfaltete sich das Bataillon im Gelände, die
Verwundetensammelstelle wurde auf dem Hof des Bauern Friedrich Neumann eingerichtet. Gegen Abend wurde zu Sammeln
geblasen und Biwak bezogen, wobei unsere 3.Kompanie, in einem kleinen Wallt, in der Nähe von Otto Nickels Gehöft
Stellung bezogen hatte. Die 2. und 4. Kompanie hatte sich in der Nähe vom Abbau Pallasch niedergelassen. Die Frau
Nickel hat am Abend ein Mädel in Dorf geschickt um meiner Frau Bescheid zu sagen, wo wir uns zurzeit befinden. Meine
Frau ist dann noch gekommen um sich von mir zu verabschieden, weil wir am nächsten Morgen um 3:00 Uhr Zelte abbrechen
und um 4:00 Uhr in Richtung Kaspersguth marschieren sollten.
Wir sind dann über Achodden, Seelonken, Lehmanen, Ortelsburg, bis nach Grammen und Schützendorf marschiert, wo wir an
einem See Biwak bezogen haben. Es wurde immer gesagt, wir kommen zum Tannenberg-Denkmal bei Hohenstein, wo ein Reichs
Kriegervereinsfest stattfinden sollte. Es wurden auch schon Vorkommandos aufgestellt, doch dann kamen wir nach Orlau
und Lahna-Mühle, da wo die Alle entspringt haben wir 2 Tage biwakiert. Unser Kompanieführer hat uns nach Waplitz auf
den Soldatenfriedhof des Ersten Weltkrieges geführt und uns erklärt wie das Jägerbataillon sich 1914 hier entfaltet
hat und aufgerieben wurde. Dann mussten wir in der Nähe von Gut Koslau über einen Fluss und bezogen in einem Waldstück,
vorbereitete Stellungen in der Nähe der polnischen Grenze. Herr und Frau Thalmann haben uns jeden Tag, bis zur Grenze,
mit Brötchen und Getränken versorgt. Es wurde scharfe Munition ausgegeben, weil wir am nächsten Morgen um 4:00 Uhr die
polnische Grenze überschreiten sollten.
Am nächsten Morgen um 10 Minuten vor 4:00 Uhr kam der Befehl; scharfe Munition abgeben, alles zurück in ein 6 Kilometer
entferntes Dorf, wo wir auch einquartiert wurden. Das alles geschah’ eine Woche vor dem 1. September 1939. Es wurde
gesagt dass der Führer dem polnischen Präsidenten Rid-Szmigly, ein Ultimatum gestellt hat und es wahrscheinlich nicht
zum Krieg mit Polen kommt. Genau nach 5 Tagen kehrten wir wieder in die gleichen Stellungen zurück, es wurde wieder
scharfe Munition ausgegeben und am nächsten Morgen um 4:00 Uhr überschritten wir die polnische Grenze.
“Der 2. Weltkrieg.”
Der erste Einsatz in Polen
Wir kamen zuerst in ein Dorf in dem sich nur alte Menschen befanden. Auf unsere Frage wo denn die Bewohner wären sagte
man uns dass alle geflohen sind, weil erzählt wurde, die Deutschen würden alle Polen misshandeln und verstümmeln. Ich
habe ihnen daraufhin gesagt dass uns, unter Androhung von Strafe verboten wurde, einem Zivilisten etwas anzutun. Das
Vieh, die Schweine und Hunde des Dorfes liefen frei herum und die Soldaten fingen an auf die Hunde zu schießen, bis
gesagt wurde es seien Meldehunde im Dienste der Deutschen Wehrmacht und dieser Unfug der eigenen Truppe schaden würde,
weil etwaige Querschläger eigene Kameraden verletzen könnten. Wir gingen weiter auf polnischer Seite entlang der Grenze,
bis wir am Nachmittag die ersten Vorposten der Festung Mlawa erreichten, da befanden wir uns plötzlich im Feuerhagel
polnischer Festungsflack.
Am nächsten Morgen hatte ich schon 3 Verwundete und wusste nicht wo sich eine Verwundeten Sammelstelle befindet. Ich
suchte den Bataillonsgefechtstand auf der sich auf einer Anhöhe befand. Ich habe unseren Oberstabsarzt gefragt wo denn
die Verwundetensammelstelle wäre. Er rief beim Tross an, wo er die Auskunft erhielt, das sich vor dem Dorf ein Bunker
befindet in dem man die Verwundeten sammeln sollte, die dann von Sanitätsautos abgeholt würden, weil das Dorf unter
Artilleriebeschuss stand. Am Sonnabend haben unsere Flieger die Bunkerstellungen bombardiert, konnten aber, trotz guter
Treffer nicht viel ausrichten, die Bunker wurden nur etwas angekratzt.
Der Beschuss unserer vordersten Linien ging mit unverminderter Heftigkeit weiter. Am Sonntag verkündete eine große
Staubwolke die Ankunft unserer Panzer, doch sie kamen nur bis zur Panzersperre und mussten wieder abdrehen ohne den
Polen einen schaden zuzufügen. Ein Panzer bekam einen Volltreffer, der Fahrer konnte noch umkehren. Er blutete am Kopf
und der Schütze war so eingeklemmt, das wir ihn nur mit einem Seil unter den Armen, durch die Luke nach oben ziehen
konnten. Ob er seine Verwundung überlebt hat ist mir nicht bekannt, denn in der Nacht wurden Panzergeschütze nach
vorne in Stellung gebracht, die direkt in die Schießscharten der Bunker geschossen und so die Verteidiger vertrieben
haben. Daraufhin sind wir weiter vorgerückt. Auf einer Wiese war ein tiefer Graben ausgehoben und mit Ästen getarnt,
da war ein Panzer hinein gefahren, so dass nur das Hinterteil herausragte und er sich nicht aus eigner Kraft befreien
konnte. In der Luft waren Flieger die Brandbomben abwarfen, ich habe mich auf den Boden geworfen weil ich dachte die
würden explodieren, aber sie zischten nur, so das Stoppeln und Graß rings herum in Brand gerieten.
Bei den Kampfhandlungen gab es mehrere Verwundete, denen ich gerade Verbände anlegen wollte, als unser Hauptmann zur
Trillerpfeife griff um mir klar zu machen, dass ich ihm folgen sollte. Die Polen fingen an zu schreien, ich sollte
sie ins Lazarett bringen denn hier im Wald würde sie niemand finden. Ich setzte mich aufs Fahrrad und folgte unserem
Kompanieführer, der mir sagte ich soll immer bei der kämpfenden Truppe bleiben, denn hinter der Front sind die
Sanitätsabteilungen, die werden die Verwundeten schon versorgen. Der Vormarsch dauerte bis in die späte Nacht. Auf
einem Gehöft, das nach allen Seiten durch Feldwachen abgesichert wurde, machten wir endlich Rast. Wir haben
Getreidegarben auf dem Hof ausgebreitet und uns zur Ruhe gelegt, als plötzlich um Mitternacht Leuchtraketen den Himmel
erhellten und Maschinengewehrfeuer uns aus dem Schlaf schreckte. Ein par polnische Soldaten hatten das Feuer eröffnet,
aber sich kurz darauf ergeben.
Die Narew-Überquerung
Als es hell wurde ging der Vormarsch weiter. Es wurde uns untersagt Tagebuch zu führen, darum
weiß ich nicht wie die Orte hießen, durch die wir marschiert sind. Als wir durch ein sumpfiges Gelände vor drangen
stand auf einer Anhöhe am Horizont, die polnische Artillerie, die uns sofort unter Beschuss nahm. Unser Hauptmann war
der Meinung dass wir schon in der Nähe des Flusses Narew sein müssten, als aus den Sträuchern ein mit Schlauchboten
beladenes Lastauto auftauchte. Wir wurden aufgefordert mit je 6 Mann ein Schlauchboot zu nehmen, an einem Aggregat
der daneben stand mit Luft zu füllen und zu Wasser zu lassen. In einer Stunde war das ganze Bataillon über die Narew,
wo der Vormarsch fortgesetzt wurde. In einem Dorf überraschte uns die polnische Kavallerie und fing sofort mit
Maschinengewehren zu schießen an. Da kam der Befehl: Alles wieder zurück. Es ging noch schneller als auf der Hinfahrt.
Wir sind erst einige Kilometer am Fluss entlang gegangen und haben dann zum zweiten Mal rüber gesetzt.
Die Gehöfte im Dorf standen alle in Brand. Auf einem waren viele Bienestöcke. 2 Kameraden wollten den Stöcken Waben
entnehmen, doch die Bienen durch das Feuer aufgeschreckt, überfielen sie sofort und stachen derart zu das sie nicht
mehr wieder zu erkennen waren. Ich habe die Einstichstellen mit Salmiak betupft, mehr konnte ich nicht tun. Wir mussten
auf unserem Vormarsch durch einen Wald der in Flammen stand, so dass man kaum atmen konnte. Es ging weiter in Richtung
Minsk und Warschau, wo schon die Sowjetische Armee durchgegangen war, die Pferde und Vieh von einem Gut mitgenommen
hatten. In einem Wald stießen wir unverhofft auf ein Kloster, in dem wir einige Gefangene machten. Dann trafen wir auf
eine gute Straße die nach Grochow ging.
Als wir dort einmarschierten wurden wir aus den oberen Stockwerken beschossen, so dass wir, um uns zu schützen, nur an
den Hauswänden entlang gehen konnten. Wir haben jedes Haus nach Feinden durchsucht. Vor einem Haus stand ein Hund der
niemanden reinlassen wollte, solange bis ihn eine Kugel traf. Die polnische Artillerie feuerte von Warschau aus, um
unseren Vormarsch zu stoppen. Wir hatten uns gerade eingegraben als plötzlich deutsche Flieger am Himmel erschienen,
die unsere Stellungen mit Bomben bewarfen und dabei viel Unheil anrichteten. Wir haben sofort Fliegertücher
ausgebreitet und Leuchtraketen abgeschossen. Da ich in dem Graben, den ich kurz zuvor ausgehoben hatte, sofort in
Deckung gegangen bin ist mir zum Glück nichts passiert. Unter den anderen Kameraden gab es viele Verwundete, so dass
ich nicht wusste wem ich zuerst helfen sollte.
Der Oberstabsarzt hat mich sofort tatkräftig unterstützt, so das bald alle Verwundeten versorgt waren, außer einem,
dem ein Bombensplitter den Arm abgerissen hat. Ich habe im 3 große Verbandspäckchen auf die Wunde gelegt, doch die
Blutung ließ sich trotzdem nicht stoppen, so dass er eine Stunde später auf der Krankensammelstelle verstarb. Wir
haben danach in einem Tomatenfeld einen Graben ausgehoben und eine neue Abwehrstellung bezogen. Die Gruppe Schwarz
bekam den Auftrag nach etwaigen versprengten polnischen Verbänden Ausschau zu halten, als sie unerwartet aus einer
Häuserreihe mit Maschinengewehrsalven überschüttet wurden. Der Gruppenführer und noch ein Soldat wurden dabei tödlich
verwundet. Danach wurde noch ein weiter Stoßtrupp, unter der Führung von Leutnant Briskorn, der sich dazu freiwillig
gemeldet hatte, hinaus geschickt um den Gruppenführer und den anderen Toten zu bergen.
Bei diesem Unternehmen, das erfolglos ausging, weil die Toten schon verscharrt waren, durchschlug eine Kugel den
Stahlhelm von Leutnant Briskorn, der auch sofort tot war. Alle Toten wurden später, an der Kirchenmauer in Grochow, in
Särgen beigesetzt: Hauptmann Schönwald sagte, das sie nach dem Kriege auf den Heldenfriedhof nach Ortelsburg überführt
werden. Drei Tage lagen wir bei Grochow in Stellungen, waren dem polnischen Maschinengewehrfeuer sowie den Bomben
deutscher Flugzeuge ausgesetzt. In der Nacht musste ich zu einem Verwundeten in die vorderste Linie und habe den
Rückweg nicht mehr finden können, als plötzlich Gewehrfeuer aufflammte habe ich in den Ruinen Schutz gesucht. Erst im
Morgengrauen konnte ich mich wieder orientieren und zu meinem Unterstand zurückfinden.
Warschau wurde tagelang bombardiert und stand auch unter Artilleriebeschuss. Aus dunklen Rauchwolken kamen oft ganze
Bündel von Papier angeflogen. Die Verwundeten kamen oft auf Krücken zu unserem Unterstand, ich habe sie dann zur
Krankensammelstelle hingeführt. Wir haben auch polnische Zivilpersonen betreut, die während der Kampfhandlungen
verwundet wurden. Als einmal 2 Jungen vorbeiliefen hat einer ihnen nachgerufen sie sollten seiner Frau Bescheid sagen,
er wäre auf der Krankensammelstelle an der Kirche. Als wir dort ankamen war seine Frau, mit einem Kind auf dem Arm,
schon da.
Nach der Kapitulation von Warschau, gingen wir über Sokolow zum Bug und haben dort Quartier bezogen. Der Russe hatte
sich bereits hinter den Fluss zurückgezogen, hatte alles Vieh und Pferde mitgenommen. Dort erreichte mich ein Telegramm
von zu Hause, dass meine Tochter gestorben ist. Es sprach sich auch herum dass verschiedene Heimaturlaub bekommen haben,
ich durfte auch für 14 Tage heim. Wir fuhren mit Lastautos nach Allenstein in die neue Reiterkaserne, zum
Ersatzbatallion, da haben wir unsere Gewehre und Munition abgeben, dann durften wir, jeder in seinen Heimatort
weiterfahren.
Als wir unsere Quartiere am Bug verlassen haben war sehr viel Schnee gefallen. Hier in Ortelsburg fanden wir die
gleiche Wetterlage vor, aber nach 3 Tagen war alles wieder weggetaut und wir konnten die Kartoffelernte, die durch den
frühen Wintereinbruch gestoppt wurde, zu Ende bringen. Ein Tag bevor ich zu Hause angekommen bin wurde die Tochter
beerdigt. Nach 14 Tagen mussten wir uns in Allenstein melden, Gewehre empfangen und wieder zurück zur Division an den
Bug 150 Kilometer hinter Warschau. Die elfte Division, zu der wir auch gehörten sollte in den Westen Deutschlands
verlegt werden und war schon unterwegs zur Verladestation Skiernewice 50 Kilometer vor Warschau.
Mein Dienst als Sanitätsunteroffizier
Unser Bataillon kam in das Städtchen Burscheid, im Kreis Opladen, wo wir in Privatquartieren
untergebracht wurden. Nach 3 Monaten, im Januar 1940, wurden wir nach Solingen verlegt, wo wir bis zum
Frankreichfeldzug stationiert waren. Wir mussten an Feldübungen teilnehmen, wie andere die in Kasernen untergebracht
waren. Während dieser Zeit musste jeder seine Zähne in Ordnung bringen lassen. Jeden Tag fuhren 20 Mann in die
Cäzilienstraße nach Köln, zur Zahnklinik. Im Rheinland wurde unsere Division neu aufgestellt. Ausfälle durch den
Polenfeldzug wurden durch neue Soldaten ergänzt. Ich kam nun zum Ersatzbatallion, war der Älteste in der ganzen
Kompanie. Als der Frankreichfeldzug losging wurde unser Ersatzbatallion mit den noch vorhandenen Verwundeten, in die
neue Reiterkaserne, nach Allenstein verlegt.
Meine Frau hat, mit Unterstützung der Bauernschaft, einen Antrag gestellt, daraufhin wurde ich zur Frühjahrsbestellung,
beurlaubt und später bis auf weiteres vom Militärdienst freigestellt. Als der Russlandfeldzug losging wurde ich von der
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg, für 14 Tage einberufen. Ich war seit 1922, Mitglied der freiwilligen
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg und habe jedes Jahr an Übungen teilgenommen. Jede Bereitschaft musste etliche Leute
stellen. Von Rohmanen wurden Emil Rosowski, Johann Dembek, und ich, zur Krankensammelstelle Wirballen, in Litauen,
abkommandiert. Dorthin kamen Lazarettzüge aus Russland mit der Breitspurbahn. Die Verwundeten wurden frisch verbunden
und auf Waggon mit Normalspur verladen und nach Deutschland gebracht.
Als die 14 Tage vergangen waren wollten wir wieder nach Haus zurück, doch man wollte uns nicht entlassen. Stattdessen
wurden wir dem Wehrkreisamt Königsberg zugeteilt, neu eingekleidet und zur Aushilfe ins Lazarett nach Gumbinnen
abkommandiert. Mehr als ein Jahr war ich in den Urlauber-Baracken, habe dort Krankenstube betreut. Später, bis zum
Dezember 1944, war ich im Reserve-Lazarett 4, in Königsberg tätig. Dort habe ich auch die Luftangriffe der Engländer,
vom 25 bis 26. August 1944 miterlebt.
Wir sollten gerade einen Lazarettzug in Rotenstein entladen, als plötzlich die Sirenen ertönten - Fliegeralarm. Im
gleichen Moment waren die ersten Flugzeuge auch schon da, zuerst warfen sie „Tannenbäume” und danach Foßforkanister ab.
Die Omnibusse standen schon zur Abfahrt bereit als es losging. Wir haben die Verwundeten schnell in den
Luftschutzkeller getragen, haben die Betten von den Fenstern weggerückt damit die Verwundeten nicht von den
Glasssplittern verletzt wurden. Im Kasernenhof brannten die Fosforkanister lichterloh. Unsere Unterkunft, die sich in
einer Baracke befand ist völlig abgebrannt, mit dem Wenigen was wir unser Eigen nannten. Am nächsten Tag wurden wir neu
eingekleidet und am 29. bis 30. kamen die englischen Bomber wieder, sie setzten genau da ihr Zerstörungswerk fort wo
sie vor 3 Tagen aufgehört hatten.
Anfang Dezember 1944 musste ich mich nach Stablack melden und musste dann zur Sanitätsabteilung 1, nach Gernau, das
liegt zwischen Lodz und Warschau. Vormittags hatten wir Felddienstübungen und nachmittags theoretischen Unterricht.
Jeden Tag wurden Gruppen zusammengestellt und zu anderen Einheiten abkommandiert. Ich kam zu einer Panzerabteilung, wo
wir an einem Morgen plötzlich auf dem Kasernenhof antreten mussten und zu unserer Überraschung mit der Nachricht
konfrontiert wurden, dass der Russe an mehreren Frontabschnitten durchgebrochen war. Wir bekamen sofort einen
Marschbefehl in Richtung Lodz, wo das Stadtbild noch intakt war, selbst die Straßenbahnen fuhren noch. In der Nacht
haben russische Flugzeuge die Stadt bombardiert. Die Kaserne in der wir untergebracht waren hatte keine
Luftschutzkeller, aber zum Glück blieben wir von Bombentreffern verschont. Am nächsten morgen bot sich uns ein Bild der
Verwüstung. Die entgleisten Straßenbahnwagen, sowie andere Fahrzeuge blockierten die Straßen. Die Älteren unter uns
bekamen Fahrscheine für einen Transportzug, der bereit hinter Lodz abfahrbereit, unter Dampf stehen sollte. Als
russische Panzer in den Straßen auftauchten, verbrannte die Schreibstube unsere Wehrpässe und andere wichtige
Dokumente. Wir liefen zu der Station auf der unser Transportzug bereitstehen sollte, aber da war kein Zug mehr zu sehen
und wir setzten unseren Rückzug zu Fuß fort.
Der Rückzug und Zusammenbruch der Ostfront
In Dobroschin, einer Stadt in Polen, wurde gerade ein Lazarettzug verladen, doch wir kamen nicht
mehr zum Einsatz, weil die russische Infanterie uns schon auf den Fersen war. Es ging weiter über den Fluss Bober,
Sagan, bis nach Glogau an der Oder. Dort wurden wir der 29. motorisierten Sanitätskompanie zugeteilt. Im
Garnisonslazarett wurden noch Operationen durchgeführt. Unsere Division hatte ihr eigenes Feldlazarett, so dass wir den
Befehl zu Weiterfahrt erhielten und noch unbeschadet die Oderbrücke passieren konnten, denn Glogau wurde zur Festung
erklärt. Wir haben 2 Pferdewagen organisiert und mit Verbänden, sowie medizinischen Instrumenten beladen. So kamen wir
bis nach Lübbenau im Spreewald, wo wir in einem Schloss, in zuvor ein Museum war, unser Lazarett untergebracht haben.
Weil die Amerikaner Cottbus bombardiert hatten, wurden die Verwundeten zu uns nach Lübbenau gebracht. Hier haben wir
Tag und Nacht gearbeitet, um die vielen Verwundeten, aus den schweren Kämpfen bei Grünberg und Sagan zu versorgen. Die
Soldaten von der Abwehrfront kamen schon mit abgestorbenen Armen oder Beinen bei uns an, weil in vorderster Linie keine
Frontlazarette mehr vorhanden waren; es mussten viele Amputationen durchgeführt werden. Als für unsere Pferde kein Heu
mehr vorhanden war, schickte mich unser Hauptfeldwebel, zu einem Bauern in den Spreewald, mit dem Auftrag, Futter zu
besorgen. Mit noch zwei Mann fuhren mit zwei Kähnen, zuerst den Hauptstrom entlang und dann in einen Nebenarm; da haben
wir die Boote beladen und brachten das Heu nach Lübbenau.
Als wir uns bei unser Einheit zurück melden wollten, war alles schon marschbereit. Ich bin schnell in einen Bus
eingestiegen der sofort losfuhr, weil russische Verbände schon in sichtweite waren. Russische Flugzeuge kreisten über
den Dächern und nahmen, mit ihren Bordwaffen jeden unter Beschuss, der sich irgendwo blicken ließ. Wir konnten nur
durch den Wald, oder in der Nacht vorwärts kommen, denn wenn ein Auto auf der Landstraße fuhr, war alsbald ein Flugzeug
hinter ihm her und schoss es in Brand. Als wir nach Tagen am Ufer der Elbe ankamen, war bereits eine Ponton-Brücke
erstellt worden, welche die zerstörte Brücke ersetzen sollte.
Durch die vielen Fahrzeuge waren in den Sand tiefe Spuren gefahren, so dass andere Fahrzeuge unsere Busse ins
Schlepptau nehmen mussten, weil wir mit eigener Kraft nicht mehr weiterkamen. Beiderseits der Trasse standen
Flüchtlingswagen, in der der Hoffnung die Brücke passieren zu können, doch SS-Polizei verhinderte das die Gespanne den
militärischen Rückzug zum Stillstand brachten. Es gelang uns die Elbe zu überqueren, um in einem Waldstück Schutz vor
feindlichen Fliegern zu suchen.
Als wir unsere Busse und Autos gut getarnt hatten, hat unser Bataillonschef die anwesenden Parteigrößen zu sich
gerufen und ihnen erklärt das wir eine Einheit des Roten Kreuzes sind und nach internationalem Recht keine Waffen
besitzen dürfen. Nach langer, erregter Diskussion wurde beschlossen einen Graben auszuheben und alles im Sand zu
verscharren. Als wir dann weiter, durch die Dörfer fuhren, sahen wir schon viele weiße Bettlaken, als Zeichen der
Kapitulation, aus den Fenstern hängen. Es wurde uns erzählt dass der Bürgermeister von der SS erschossen wurde, weil
er die Bevölkerung zu diesem Schritt ermutigt hatte. Jetzt waren hinter uns die Russen und vor uns schon die Amerikaner.
Amerikanische Panzer fuhren umher und schossen wild durch die Gegend, ohne ein Ziel anzuvisieren. Niemand wollte sich
dem Russen ergeben, doch der Weg der zu den Amerikanern führte, war durch abgesägte Bäume blockiert. Wir sind schnell
in das nächste Dorf gegangen, haben uns Sägen und Äxte besorgt, die Bäume durchgesägt und in den Straßengraben
geworfen.
“ Nach dem Ende des 2. Weltkrieges.”
In amerikanische Kriegsgefangenschaft
Dann fuhren wir unter internationaler Flagge an eine Mulde Brücke, vor der zwei amerikanische Soldaten, mit Zigarren,
zur Hälfte im Mund, standen. Sie rauchten und kauten gleichzeitig. Wir mussten auf einen freien Platz fahren, alle
aussteigen und rechts wieder antreten. Wäschebeutel und Tornister mussten wir abstellen; danach wurden wir nach Waffen
durchsucht, Wertsachen, Uhren und Messer wurden uns gleich abgenommen. Als wir anschließend an unserem Gepäck
vorbeigingen durfte niemand was mitnehmen. Als ich gebückt, nach meinem Wäschebeutel greifen wollte, in dem sich noch
3 Konservendosen und ein Brot befanden, bekam ich einen Fußtritt ins Gesicht, so dass mir ein Zahn ausgeschlagen wurde.
Wir wurden dann in einem Garten zusammen getrieben und gefragt ob jemand bei der SS gedient hat. Nachdem wir in Reihe
und Glied angetreten waren, mussten wir den Oberkörper freimachen und die Arme anheben. Es wurde nach SS-Zeichen
gesucht, die gewöhnlich unter dem Oberarm eintätowiert waren. Nachdem wir Grimma bei Leipzig, wo wir in amerikanische
Gefangenschaft geraten waren, verlassen hatten, mussten wir durch ganz Thüringen bis Hersfeld, an der Grenze zu Hessen,
marschieren. In Hersfeld wurden wir auf große Lastautos verladen, die von farbigen Soldaten gefahren wurden. Man hat
uns mit Stöcken hinauf getrieben, solange bis das Auto so voll war das man kaum stehen konnte. Die Soldaten fuhren, für
diese Straßenverhältnisse, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Wenn die Straße eine scharfe Kurve hatte, flogen
wir alle übereinander und mussten erst mit viel Kraftanstrengung auf die Beine kommen um diese Fahrt zu überstehen.
Da die Straßenränder in dieser Gegend mit Obstbäumen bepflanzt sind und deren Äste sehr niedrig hängen, hätten die
uns die Köpfe abgerissen, wenn wir uns nicht ständig geduckt hätten. Unsere Fahrt endete in Bad Kreuznach, in der Pfalz,
wo wir in ein Lager, in dem sich später 130.000 Mann und 6 Generäle befanden, eingepfercht wurden. Die Unterkunft der
Generäle befand sich unter einem Zelt, alle anderen mussten die Zeit unter freiem Himmel zubringen. Die Offiziere, die
Unteroffiziere, die Mannschaften; wurden in getrennten Camps untergebracht. Die Mannschaften wurden auch zur Arbeit
abkommandiert und konnten bei dieser Gelegenheit, Brot, Brötchen oder Zigarettenstummel organisieren, wogegen die
Offiziere und Unteroffiziere ihr Camp überhaupt nicht verlassen durften.
Die ersten Tage gab es kein Wasser und kein Brot, so dass die Kameraden vor Erschöpfung umfielen. Später standen wir
manchmal den ganzen Tag nach Wasser an, das von den, uns bewachenden Negern mit großen Wassertanks angefahren wurde. Am
dritten Tag bekamen wir mittags und abends etwas zu Essen; Brot bekamen wir erst nach zwei Wochen, nach dem aus der
Umgebung herbeigeholte Handwerker, Backöfen gebaut hatten. In den verschiedenen Gemeinden, die in den uns umgebenden
Weinbergen lagen, mussten sich alle Männer beim Bürgermeister melden. Als sie dann erschienen waren, wurden sie auf
bereitstehende Lastautos getrieben und zu uns ins Lager gebracht. Sie waren ohne Kopfbedeckung und ohne wärmere
Bekleidung angekommen, weil ihnen gesagt wurde, dass ihr Aufenthalt im Lager nur von kurzer Dauer sein würde. Man hat
uns, falls noch vorhanden, Decken und Mäntel abgenommen, mit der Begründung, sie würden für Kranke und Verwundete
gebraucht. Jeden Tag starben mehr als 200 Mann, die wir sofort in ein Zelt tragen mussten. In der Nacht wurden die
Toten dann mit unbekanntem Ziel, weggefahren.
Viele haben ihren Verstand verloren uns irrten im ganzen Camp ziellos umher. Als Latrinen wurden Gräben ausgehoben, in
die verschiedene Kameraden, bei der Verrichtung ihrer Notdurft, vor Schwäche hineingefallen sind und nicht mehr wieder
heraus kamen. Aus den Pfählen die, die jungen Obstbäume stützten, haben wir Krankentragen gebaut um unsere Kameraden,
bei Bedarf, zur Krankensammelstelle zu tragen. Es war in diesem Frühjahr auch sehr kalt, doch unsere Erdlöcher, die wir
zum Schutz vor Kälte und Wind, nur mit leeren Konservendosen ausgehoben hatten, durften nicht tiefer als 20 Zentimeter
sein. Nach jedem Regenguss mussten wir das Wasser ausschöpfen. Nach einem Gewitter, standen wir wiedermal, total
durchnässt in unserem Camp, als unerwartet am Horizont die Sonne hervortrat. Einer unserer Kameraden hatte noch eine
Trompete gerettet und fing, von dem Anblick völlig überwältigt, zu spielen an: "Es geht alles vorüber, es geht alles
vorbei, nach jedem Dezember, folgt wieder ein Mai". Daraufhin hob sich die Stimmung der tiefbetrübten Kriegsgefangenen,
so das Heimatlieder durch das ganze Camp erklangen, obwohl wir in den nassen Kleider herumgehen mussten, bis sie am
Körper trocken wurden.
In französischer Kriegsgefangenschaft
Nach etwa einem Monat, haben uns die Amerikaner, den Franzosen, zum Arbeitseinsatz, ausgeliefert.
Etwa 4 Kilometer von Bad Kreuznach entfernt, stand auf freier Strecke, ein Zug mit offenen Kohlenloren, auf den wir
verladen wurden. In jeden Waggon, wurde pro Person eine Tafel Schokolade und ein Päcken Zwieback rein geworfen, doch
viele Kameraden fanden nur leere Päckchen vor, weil die schon zuvor von der französischen Wachmannschaft geplündert
wurden. Wir haben uns darüber beschwert, doch die haben uns nur ausgelacht. Nachdem wir zunächst bei Mainz über den
Rhein fuhren, endete unsere Fahrt bei Paris in einem großen Zeltlager. Dort wurden wir auf andere Züge verladen, die uns
nach Südfrankreich, in ein Barackenlager, bei Mazarei, brachten.
Auf einer Zwischenstation hat man uns unter einer Pumpe, die Lokomotiven mit Wasser versorgt, abgestellt, den Kran
aufgedreht und uns anschließend ausgelacht, die Kinder Haben uns mit Steinen beworfen. Ein Wachmann kam in unseren
Waggon gekommen, hat unser Gepäck durchsucht, wenn er Tabak oder Zigaretten gefunden hat, nahm er sie mit. Die Kameraden
waren darüber so empört, dass sie vorhatten, ihn nachts unter den Waggon zu werfen. Wir haben sie gebeten dass zu
unterlassen, weil man uns in diesem Falle, alle erschießen würde.
Als wir ins Lager kamen wurden wir zuerst gezählt, dann mussten wir unser Gepäck stehen lassen und beiseite treten.
Wenn man bei der Nachkontrolle noch was in den Taschen fand, wurde das auch entwendet, selbst Esslöffel. Wir wurden
dann in drei Baracken, ohne Toiletten, eingeschlossen. Die Kameraden haben ihre Bedürfnisse in Kochgeschirre erledigt
und durch ein kleines Fenster, das sich fast unter der Decke befand, hinausgeworfen. Andere Fenster ließen sich nicht
öffnen, weil sie mit Stacheldraht zu geflochten waren. Als die Kameraden die Kochgeschirre auskippten, haben die
Wachposten geschossen und die Fenster zertrümmert. Sie waren der Meinung dass wir ausbrechen wollten. Es herrschte eine
große Hitze, in den überfüllten Baracken sind wir fast erstickt. Am nächsten Tag haben wir uns über fehlende Toilettem
beschwert, da haben sie Heringsfässer durch die Hälfte geschnitten und an der Ausgangstür hingestellt. Um bei den
überfüllten Räumen dort hinzukommen, musste man über die Köpfe der Anderen steigen. Viele hatten Fieber und Durchfall
und mussten in die Krankenstube eingeliefert werden, wo sie kurz darauf verstarben.
Besonders Raucher litten sehr an der Unterernährung, bekamen Wasser in den Beinen und waren die Ersten die verstarben.
Nach der Registrierung wurden wir auf andere Baracken verteilt. Die Zivilbevölkerung kam in die Räume und begann uns
auszuplündern. Wer noch gute Schuhe besaß musste sie ausziehen und bekam dafür die kaputten des Plünderers. Eine Woche
lang mussten wir diesen Zustand ertragen, erst als die Kameraden sich beschwerten, wurde am Eingang eine Tafel am
Eingang angebracht, dass die Zivilbevölkerung das Lager nicht betreten darf. Bis auf einige, wenige Ausnahmen wurde
diese Anweisung befolgt.
Als wir im Lager ankamen, war der französische Lagerkommandant, ein ehemaliger Kriegsgefangener, der bei einem Bauern
in Deutschland gearbeitet hatte. Dieser Bauer war jetzt als Kriegsgefangener in seinem Lager. Als er ihn erkannte, hat
er ihn gleich zum Küchendienst eingeteilt und mit dem nächsten Krankentransport nach Hause fahren lassen. Zu Mittag
bekamen wir nur gekochte Haferkörner, da schwamm alles oben, später war man dann auf Gerste umgestiegen. Als viele
daran gestorben waren, weil sie diese „Rohkost”, die nur ein Kuhmagen verträgt, nicht gegessen haben, hat man die
Körner durch eine Schrotmühle laufen lassen. Dann hat man uns Steckrüben gekocht; wir bekamen 250 Gramm Weißbrot,
etwas Quark und ein viertel Liter Magermilch. Später, als wir schon arbeiten mussten, hat man in unserem Essen einen
Kuhkopf mitgekocht, das hat dann bedeutend besser geschmeckt.
Bevor wir morgens zur Arbeit gingen, mussten wir zu Flaggenparade und abends, nach der Rückkehr, haben wir die Flagge
wieder eingeholt. Wir haben einen Kanal gereinigt, dessen Sohle 2 Meter dick mit Schlamm bedeckt war. Zuerst wurde das
Wasser abgelassen, dann haben wir, einer dem andern, den Schlamm mit der Schippe hoch gereicht. Der Letzte hat den
Schlamm, der so zäh war, dass er nicht von der Schippe wollte, oben am Rande abgelegt. Manchmal waren 10 Mann nötig um
den Höhenunterschied zu überwinden. Das Wachpersonal schoss über unsere Köpfe hinweg und rief: „schnell arbeiten”. Bei
der großen Hitze war das ein Ding der Unmöglichkeit, zumal es nichts zu Trinken gab. Auf dem Heimweg haben wir im Walde
Heilkräuter gesammelt, die man in der Küche getrocknet und als Tee zubereitet hat, den wir am nächsten tag zur Arbeit
mitnahmen, um unseren Durst zu stillen.
Unser Aufseher hatte einen Stock, an dem sich noch kurz abgeschnittene Äste befanden. Wer seiner Meinung nach, nicht
ordentlich gearbeitet hat, bekam gleich Schläge auf den Rücken. Die weißen Aufseher wurden irgendwann durch Neger
ersetzt, die uns bedeutend besser behandelt haben. Wenn irgendetwas schief ging, haben sie nichts gesagt, nur gelacht.
In den übrig gebliebenen Wassertümpeln hatten sich noch einige Aale versteckt, die wir zu fangen versuchten, was uns
auch manchmal gelang. Wir mussten ihnen das Genick brechen, damit sie uns nicht entwischen konnten. Wenn die Franzosen
bemerkten das wir Aale hatten, wurden sie uns abgenommen. Gelang es uns aber, sie ins Lager zu bringen, dann haben wir
uns eine köstliche Malzeit zubereitet.
Um sicherzustellen dass niemand geflüchtet ist, wurden wir, wenn wir abends ins Lager zurückkamen, zuerst gezählt.
Diese Zählung wurde mehrmals wiederholt, weil die Wachmannschaften sich immer wieder verzählt haben. Als einer von uns
hin ging, ihnen sagte dass alle da sind, wollten sie es nicht glauben und haben uns vor dem stehen lassen, bis es ihnen
irgendwann einfiel. uns doch das Tor zuöffnen. Einmal, als wir von der Arbeit zurückgekehrt waren, standen wir bis 23
Uhr neben der Flagge, weil uns niemand das Tor geöffnet hat. Als wir dann doch irgendwie ins Lager kamen haben wir
festgestellt, dass das ganze Wachpersonal betrunken war und niemand im Stande uns das Tor zu öffnen.
Eines Tages waren wir wieder abends zur Parole angetreten, als ein älterer Herr mit seinem Hund, am Stacheldraht
entlang, spazieren ging. Weil der Hund, unterm Stacheldraht hindurch, zu uns kam, hat ihn einer geschnappt, ihm das
Genick gebrochen und unter seiner Jacke versteckt. Der Franzose hat nach seinem Hund gerufen und gepfiffen, aber alles
vergebens, der Hund war nicht aufzufinden. Die Kameraden haben ihm gleich das Fell über die Ohren gezogen, das Fleisch
gekocht und das Fell in die Latrine geworfen. Das Fleisch wurde umgehend verspeist.
Als wir am nächsten Tag von der Arbeit zurückkehrten, war im Lager der Teufel los. Wir mussten sofort antreten und
wurden gefragt, wo der Hund geblieben ist, der Gestern Abend, mit seinem Herrchen, am Zaun entlang spazieren ging. Als
sich niemand dazu bekannte, mussten wir weiterhin stehen bleiben, während die Wachmannschaften von Baracke zu Baracke
gingen und alles durchsuchten. In einer Latrine hat man dann das Fell gefunden, was uns ein furchtbares „Donnerwetter”
einbrachte und in den nächsten Tagen, nach der Arbeit, unter dem Kommando eines Oberfeldwebels, eine Stunde
nachexerzieren.
In Südfrankreich regnet es den ganzen Sommer nicht; die Bauern haben da keine Scheunen und das Getreide wir nur in
Schobern aufgestellt und dann umgehend gedroschen. Vom Oktober bis Dezember regnete es fasst jeden Tag in Strömen.
Gesät wird nur im Frühjahr und im Herbst, weil im Sommer alles vertrocknet. Es wird viel Wein angebaut und die
Steckrübe wächst den ganzen Winter. Neben den Weinreben wurde aus Schieferplatten ein Zaun aufgestellt, um dem Wein
einen optimalen Standort zu sichern. Die Bauernwagen hatten nur zwei Räder und waren nur mit einem Pferd bespannt, das
die ganze Balance des Wagens zu halten hatte. Trotzdem haben sie soviel aufgeladen wie wir auf einen Leiterwagen. Viele
Kameraden wurden den Bauern zur Arbeit ausgeliehen. Wenn ein Bauer einen Arbeiter gebraucht hat und es wurde gefragt,
wer sich in der Landwirtschaft auskennt, da haben sich alle gemeldet. Der Bauer konnte sich dann aussuchen, wen er
mitnehmen wollte.
Wenn wir durch die Stadt zur Arbeit gingen, haben verschiedene Leute Fallobst in die Abfalleimer gelegt. Wenn das von
den Kameraden bemerkt wurde, schwenkten viele aus der Reihe, um sich etwas mit zunehmen, was von den Wachmannschaften
nicht gern gesehen wurde. Viele Kriegsgefangene hatten keine Schuhe mehr, sie haben die Füße nur mit Lumpen bewickelt.
Eines Tages kamen Kameraden aus Norwegen, die nach Deutschland entlassen werden sollten. Mann hat sie jedoch ins Lager
gesteckt und zur Arbeit eingeteilt. In Norwegen hatten sie Kleider und Stoffe eingekauft, hatten volle Seesäcke und
sogar Karren auf 2 Rädern, weil sie ja in die Heimat entlassen werden sollten. Als wir morgens zur Arbeit rausgeführt
wurden standen sie schon vor dem Lager. Wir haben ihnen zugerufen, dass sie uns etwas abgeben sollen, weil ihnen ja
sowieso alles abgenommen wird, aber sie haben uns nur ausgelacht. Als sie ins Lager Kamen mussten sie ihr Gepäck
ablegen, wurden dann wo anders hingeführt und haben es danach nie wieder gesehen.
Durch die vielen Läuse, Flöhe und Wanzen die wie im Lager hatten, kam es bei verschieden Kameraden, an den
Einstichstellen, zu eiternden Entzündungen. Um dem vorzubeugen hat man uns mit einem Pulver, das in Frankreich
hergestellt wurde, aber bei den Parasiten keine Wirkung zeigte, eingesprüht. Erst bei der Anwendung eines Mittels
amerikanischer Herkunft, war alles über Nacht verschwunden.
Der Sonntag war arbeitsfrei. Dann kam ein katholischer, französischer Pfarrer, eskortiert von 3 Mann, mit
aufgepflanztem Seitengewehr ins Lager und hat Gottesdienst gehalten. Einen evangelischen Pfarrer gab es nicht, nur
einen Baptisten Prediger. Der wurde würdevoll eingekleidet, bekam ein großes Kreuz und hat jeden Sonntag in einer
extra dafür hergerichteten Baracke Gottesdienst gehalten. Wer Theologie studiert hatte und sich meldete, wurde zu
einem Seminar geschickt und konnte sein Studium fortsetzen. Glasbläser durften das Lager auch verlassen und ihrem
erlernten Beruf wieder arbeiten.
Wer sich freiwillig, für 5 Jahre, zum Dienst in der Fremdenlegion verpflichtet hat, das waren etliche unter uns, wurde
neu eingekleidet, bekam gutes Essen und Rauchwaren soviel er wollte. Nach einem Jahr wurden, nach und nach, die
Kranken und Körperbehinderten in die Sowjetische Besatzungszone entlassen. Eine Entlassung von Kriegsgefangenen, die
in den Westzonen oder jenseits von Oder und Neise zu Hause waren, war nicht vorgesehen. Die Österreicher wurden alle,
unabhängig von ihrem Gesundheitszustand entlassen.
Ich habe Briefe nach Hause geschrieben, aber die kamen nur bis Allenstein und wurden wieder zurück geschickt. Als eine
Kommission des Roten Kreuzes aus der Schweiz unser Lager besichtigt hat, haben wir uns beschwert, das wir als
Sanitätsdienstgrade, zur Arbeit gehen müssen. Daraufhin erging ein Befehl: Wer einen vom Roten Kreuz, ausgestellten
Ausweis besitzt, gehört einem internationalen Verband an und braucht nicht zu Arbeit gehen. Aus unserem Lager hatten
sich 20 Mann gemeldet, die daraufhin Freigang, in Begleitung von zwei französischen Wachsoldaten erhielten. Als wir
gefragt wurden wo wir hin wollen, entschlossen wir uns, einen Soldatenfriedhof, auf dem unsere verstorbenen Kameraden
beerdigt waren, zu besuchen.
Da der Untergrund in dieser Gegend aus Felsen bestand, wurden die Gräben, in denen die Toten in selbst gezimmerten
Kisten nebeneinander gestellt wurden, mit Hilfe von Dynamit ausgehoben. Ein Leichenwagen, mit einem Pferd bespannt,
das mit einer schwarzen Decke abgedeckt war, wurde von einem Kutscher in angemessener Kleidung, gefahren. Der Wagen
konnte gleichzeitig 4 Kisten transportieren. Wenn wir von der Arbeit kommend, dem Leichenwagen begegneten, wurde
gehalten und mit einer Schweigeminute der Toten gedacht, bis der Wagen vorbei war. Die Zivilbevölkerung verharrte auch
im Schweigen, mit abgenommener Kopfbedeckung.
Ein Kamerad, der in Krottorf, Kreis Oschersleben, bei Magdeburg, zuhause war, sagte bei seiner Entlassung zu mir:
Sollte ich das Glück haben, meine Entlassungspapiere zu erhalten ohne eine Bleibe vorzuweisen, dann soll ich Krottorf
als Heimatadresse angeben. Auf der Krankenstube habe ich angegeben, dass sich noch ein Schrapnellsplitter, aus dem
Ersten Weltkrieg, in meiner Kreuzbeingegend befindet, er zwar verkapselt ist, aber immer noch Beschwerden verursacht.
Daraufhin wurde ich zur Entlassung vornotiert. Als bekannt wurde das ein Rückkehrertransport in die sowjetische
Besatzungszone zusammengestellt wird, habe ich mich sofort gemeldet und wurde für ein Entlassungslager in Angoleme
vorgesehen. War das eine Freude, als uns mitgeteilt wurde, wann der Rücktransport stattfindet.
In unserem Lager waren noch 2 Kameraden aus dem Kreis Ortelsburg: Ein Gustav Lumma aus Leynau und ein Alfred Moritz
aus Groß Schöndamerau. Sie mussten noch zurückbleiben und haben mir den Auftrag erteil, die Angehörigen in der Heimat
zu grüßen und ihnen die Anschrift mitzuteilen. Als wir im Entlassungslager ankamen, fragte man uns nach unserer
Heimatanschrift. Dann wurden die Entlassungspapiere angefertigt. Es wurde uns auch ein Barscheck, für die in Frankreich
geleistete Arbeit ausgehändigt, den wir bei jeder Kasse in Deutschland einlösen könnten. Ich habe ihn bis zum heutigen
Tage nicht einlösen können, obwohl ich irgendwann in der Zeitung gelesen habe, das Verrechnungschecks die den aus
französischer Kriegsgefangenschaft Entlassenen, ausgehändigt wurden, einzulösen sind.
Wir kamen zuerst nach Saar Elbe, dann in die Nähe der Zonengrenze zu Thüringen. Hier mussten wir 2 Tage warten, weil
aus der sowjetischen Besatzungszone keine Eisenbahnwagen bereitgestellt wurden. Angesichts dessen, das der Russe beim
letzten Transport die aus Frankreich kommenden Wagen kassiert und nicht mehr herausgeben wollte, bestand der Franzose
jetzt darauf, seine Wagen sofort wieder mitzunehmen. Als der sehnsüchtig erwartete Zug endlich eintraf, durften wir
umsteigen und kamen, immer noch hinter Stacheldraht, nach Erfurt. Von dort weiter ins Quarantänelager nach Prätsch an
der Elbe.
Unter Androhung von Strafe war es verboten das Lager zu verlassen, doch der Hunger zwang uns dazu, in den umliegenden
Dörfern um Lebensmittel zu betteln. Man drohte uns damit, dass Zuwiderhandlungen, mit einer 14-tägigen Verlängerung der
Quarantäne geahndet werden. Der Roggen war schon reif und wir haben, auf den umliegenden Feldern, die Ähren abgerissen,
das Korn, zwischen 2 Steinen zu Mehl zerrieben, um daraus eine Suppe zu kochen, denn von dem was unsere Lagerküche uns
bieten konnte, war es nicht möglich zu überleben. Als der Eigentümer bemerkte wer seine Roggenähren entwendet hat, kam
er ins Lager, gerade zu dem Zeitpunkt als wir mit dem Mahlen beschäftigt waren. Der Lagerkommandant, bei dem er sich
beschwerte, drohte uns zu bestrafen, wenn wir unsere „Rauzüge” nicht unmittelbar einstellen würden. Wir sagten ihm er
solle uns heimfahren lassen, da wir doch lange genug hinter Stacheldraht gesessen hätten.
Endlich wieder in Freiheit
14 Tage nach unserer Ankunft wurden uns Entlassungspapiere ausgehändigt, sowie auch Fahrscheine
zum den, von uns angegeben Heimatorten. So kam ich nach Krottof, Kreis Oschersleben, zu meinem ehemaligen
Kriegskameraden, bei dem ich einen Tag geblieben bin. Er hatte mir schon eine Stelle bei einem Bauern besorgt, der 70
Jahre alt und kinderlos war. Zum Hof, den er mit seiner Ehefrau bewirtschaftet hat, gehörten 36 Morgen Land, 2 Ochsen
und 3 Kühe. Das Ackerland bestand aus 17 Parzellen und sicherte mir einen Arbeitsplatz.
Jetzt, da ich ein Dach überm Kopf und genug zu essen hatte, fing ich an nach dem Verbleib meiner Familie zu forschen.
Bei meinem letzten Heimaturlaub hatte ich mit meiner Frau verabredet; falls wir uns in den Kriegswirren verlieren
sollten, unsere Kontaktadresse, die meiner Quartiersleute in Burscheid, Kreis Opladen, sein sollte. Ich habe zuerst
nach Rohmanen geschrieben, aber leider keine Antwort erhalten. Dann habe ich nach Burscheid geschrieben, und siehe, -
bei denen lag schon eine Anfrage meiner Frau vor, die nach mir gefragt, und ihre jetzige Anschrift hinterlassen hatte.
Ich habe dem Bauern erzählt dass meine Frau sich zurzeit, auf einem Gut, in Alt Steinhorst, im Kreis Rostock, befindet.
Er war sofort bereit uns ein Zimmer zur Verfügung zu stellen, wenn ich meine Frau nach Krottorf rüberholen wollte. Das
habe ich Ihr mitgeteilt und sie war sofort bereit ihren Wohnsitz nach Krottorf zu verlegen, denn sie wohnte dort in
einem kleinen Stübchen unterm Dach.
Im Herbst, als die Feldarbeit so ziemlich erledigt war, bin ich nach Alt Steinhorst gefahren, um meine Frau und meinen
Sohn Kurt, sowie meinen Sohn Manfred, den ich noch nicht kannte, weil er erst nach der Flucht, am 31. Januar, in Groß
Lüssewitz, geboren wurde, nach Krottorf zu holen. Meine Frau hatte schon Holz für den Winter besorgt und vom Gut, auf
dem sie im Sommer gearbeitet hatte, Mehl und Kartoffeln bekommen. Wir haben das Mehl und andere Habseligkeiten in
Kisten verpackt. Das Holz haben wir einem Bauern gegeben, der uns und unser Gepäck, mit seinem Pferdewagen, zum 14
Kilometer entfernten Bahnhof, nach Ribnitz gebracht hat. Wir sind auch gut in Krottorf angekommen, aber als wir am
nächsten Tag, unsere Kisten vom Bahnhof abholen wollten, haben wir zwar die Kisten vorgefunden, doch der gesamte Inhalt
wurde während der Bahnfahrt entwendet. Die Bahnstation in Krottorf hat die Vorkommnisse zur Kenntnis genommen und
protokolliert, aber unsere Sachen haben wir nie wieder gesehen und mussten wieder bei Null anfangen.
Im Winter musste ich auf der Genossenschaft, unentgeltlich, für die Russen Weizen einsacken. Ich hatte versucht eine
Arbeit als Zimmermann zu bekommen, doch auf dem Arbeitsamt wurde mir gesagt, ich bin Ladwirt und muss auf der
Landwirtschaft arbeiten. Da in den ersten Nachkriegsjahren, auch in der sowjetisch besetzten Zone Arbeitsplätze knapp
waren, mussten auch solche, die einen anderen Beruf erlernt hatten, jede zumutbare Arbeit annehmen. Aus der Heimat
erhielt ich einen Brief, von meiner dort noch lebenden Mutter. Sie schrieb das sie mich noch einmal sehen wollte und
ich sollte doch wieder zurück kommen; Unser Hof wäre nicht von Polen besetzt und sie wäre ganz alleine, weil der Vater
nach dem Durchzug der Front von den Russen erschlagen wurde. Daraufhin habe ich dem polnischen Konsulat in Magdeburg
mitgeteilt, dass ich in Rohmanen eine Landwirtschaft besitze, und um eine Einreisegenehmigung gebeten.
Nach 2 Monaten erhielt ich eine Postkarte, mit der Mitteilung, ich sollte mich persönlich beim Konsulat vorstellen.
Nach Aufnahme meiner Personalien, wurde mir gesagt, das ich benachrichtigt werde wenn mein Antrag genehmigt wird. Ende
Juli 1947 erhielten wir die Einreisegenehmigung nach Ostpreußen, das jetzt unter polnischer Verwaltung stand. Wir
mussten zuerst zum polnischen Konsulat in Berlin-Lichterfelde, wo wir umgeben von einer Trümmerlandschaft, gewartet
haben, bis alle Untersuchungen und Formalitäten erledigt waren.
“ Wieder zurück in Ostpreußen.”
Der schwere Wiederaufbau nach dem Kriege
Dann fuhren wir über Frankfurt/Oder, Posen, Thorn, Allenstein, nach Ortelsburg, wo wir am 2. August 1947 ankamen. Mit
einem zweirädrigen Karren, den ich mir von einem noch in Ortelsburg lebenden Bekanten ausgeliehen hatte und meinem
Sohn Manfred im Kinderwagen fuhren wir nach Rohmanen. Meine Mutter war inzwischen verstorben und auf dem Hof war nur
meine, inzwischen aus Russischer Gefangenschaft wiedergekehrte Schwester, Frieda Pelkowski.

Es war alles ausgeplündert; kein Vieh, keine Maschinen und der ganze Hof mit kniehohem Graß überwachsen. Nur schmale
Trampelpfade, vom Haus zum Holzschuppen und zum Klo, durchkreuzten das satte Grün. Ich habe das Gras auf dem Hof mit
einer Sense, die ich noch gefunden habe, abgemäht, damit der Hof nicht so verwahrlost aussah. Am nächsten Tag habe ich
mich bei der Polizei in Ortelsburg angemeldet, wo ich auch ein Startgeld von 100 Zloty erhielt und Gepäckstücke, die
ich in Krottorf aufgegeben, am Bahnhof abgeholt. Es hat mich sehr gewundert das, das Gepäck überhaupt angekommen ist.
Da man von der Landwirtschaft nicht Leben konnte, habe ich mich in den nächsten Tagen, bei der jetzt polnischen Bahn,
um Arbeit beworben und wurde auch angenommen. Wenn wir unseren Monatslohn bekamen, saß immer einer am Tisch, der von
uns 100 Zloty für den Wiederaufbau von Warschau verlangte. Wenn ich dran war, riefen die Anderen, ich hätte Warschau
zerstört und müsste deshalb 200 Zloty abgeben. Nach 3 Jahren kam eine Verfügung, die besagte, dass wer länger als 1
Jahr bei der Bahn beschäftigt ist, angestellt werden muss. Um diese Bestimmung zu umgehen hat man mich entlassen und
eine Woche später wieder eingestellt.
Als ich vor Ablauf des nächsten Jahres, aus dem gleichen Grunde wieder entlassen wurde, habe ich mich bei der
Stadtverwaltung in Ortelsburg(jetzt Szczytno)beworben, wo ich zuerst im Gaswerk als Heizer und später auf Baustellen
als Zimmermann gearbeitet habe. Wir haben durch den Krieg beschädigte Häuser repariert, in den ehemals touristischen
Zentren einige Ausbesserungen an den Einrichtungen durchgeführt, eine Ziegelei wieder in Betrieb gesetzt und andere
anfallende Arbeiten verrichtet. Im Dach des Rathausturmes war während der Kämpfe eine Granate eingeschlagen, die, die
Dachlatten und die Verschalung zerstört hatte. Da wir, unter schwersten Bedingungen, den Schaden repariert haben,
wurde uns eine Höhenzulage versprochen, die wir aber nicht bekommen haben.
Aus Verärgerung darüber habe ich bei der Stadtverwaltung gekündigt und bei einer Wiederaufbaufirma unter der Leitung
von Bauingenieur Laskowski wieder angefangen, wo ich bis 1954, als Zimmermann beschäftigt war. Ab da habe ich mich
nur um meinen Hof gekümmert, der wegen meiner Arbeitsstellen, gezwungenermaßen, sehr vernachlässigt wurde. Als wir
1947 zurückkamen, brachten wir unseren Sohn Manfred noch im Kinderwagen. Den hat meine Frau zum Markt gebracht,
verkauft, und dafür eine Ziege erworben, die dank guter Pflege, uns täglich mit 4 Liter Milch versorgte. Das war der
erste Baustein zum Wiederaufbau, unserer durch den Krieg zerstörten, und danach ausgeplünderten Landwirtschaft.
Während meiner Arbeit bei der Bahn haben wir uns eine Kuh gekauft, die nach einem halben Jahr, wegen nicht bezahlter
Grundsteuer, vom Gerichtsvollzieher gepfändet wurde. Man hat uns die Kuh weggenommen und bei einem Arbeiter, der in
der Ernst-Mey-Straße in Ortelsburg wohnte und sie wegen nicht vorhandener Futtermittel, nur mit Kartoffelkraut
gefüttert hat, untergestellt. Als ich bei der Bahn meinen Monatslohn bekommen habe, bin ich zur Gmina gegangen, habe
eine Rate angezahlt und durfte dann die Kuh wieder mit nach Hause nehmen. Durch die schlechte Ernährung war die Kuh
stark abgemagert und lieferte nur die Hälfte der ursprünglichen Milchleistung.
Später habe ich ein Pferd auf Abzahlung bekommen, das 140.000 alte Zloty gekostet hat. Die Stute war schwach und unser
Feld sehr hügelig, so dass man nur bergab pflügen konnte, was sehr beschwerlich war, bergauf ging es immer im Leerlauf.
Später habe ich die schweren Böden mit dem Traktor umpflügen, und in den letzten Jahren auch mit dem Binder mähen
lassen. Von der Stute habe ich 2 schöne Fohlen gezogen; ein davon habe ich bei der Ausreise in die Bundesrepublik
mitgebracht und bei der Viehverwertungs-Genossenschaft in Göttingen verkauft. In den ersten Nachkriegsjahren als noch
wenig Land bestellt wurde, breiteten sich auf den nicht beackerten Flächen, Wildkräuter aus. Disteln und andere
Schnellwachsende, erreichten manchmal eine Höhe von 2 Meter, besonders auf den schweren Böden.
Es hat viel Schweiß gekostet ehe man den Acker soweit hatte, das er auch befriedigende Erträge abwarf. Die
Währungsreform von 1950, hat unser weiniges Geld das wir schon gespart hatten, wieder vernichtet. Ich hatte 2 Pferde,
1 Fohlen, 2 Kühe und Schweine, als ich wieder aufgefordert wurde nicht bezahlte Grundsteuern nachzuzahlen. Als ich
nicht bezahlen konnte, hat der Vollziehungsbeamte, ein Fohlen, eine Kuh und ein Schwein gepfändet. Es gelang mir jedoch
nach längeren Verhandlungen, ohne größere Verluste, alles zu regeln. Später kam eine Verfügung, die besagte; wenn
jemand auf seinem Hof nur eine Kuh und ein Pferd hatte, durften sie nicht gepfändet werden. Einige haben ihr Inventar
dieser Verfügung angepasst und dadurch die Zahlung von Grundsteuer umgangen.

Wer seine Steuern pünktlich bezahlt und sein Kontingent an landwirtschaftlichen Produkten fristgerecht abgeliefert hat,
der konnte seine, darüber hinaus erwirtschafteten Produkte zu marktgerechten Preisen verkaufen. Für eine hochtragende
Sterke, mindestens 400 kg schwer, die auf ein staatliches Gut verkauft wurde, konnte man bis zu 12000 Zloty bekommen.
Unsere Böden waren kalkarm, doch durch den Einsatz von Kalk und Kunstdünger konnte man den Ertrag erheblich steigern.
Kalk und Kunstdünger konnte man bei der Genossenschaft(GS) bestellen, der dann auch direkt auf den Hof geliefert wurde.
Kalk wurde geliefert und gleich auf dem Feld ausgestreut. In den 1960ger Jahren waren alle Ackerflächen der Rohmaner
Felder bestellt.
Die nach dem Krieg zurückgebliebenen deutschen Bauernfamilien, aber auch die Polen, die während des Krieges beim Bauern
in Deutschland gearbeitet haben, versuchten mit teils bescheidenen, oder auch zusammen gesuchten, landwirtschaftlichen
Geräten, die bäuerlichen Betriebe aufrecht zu erhalten. Nach den schweren Anfängen in den ersten Nachkriegsjahren
erzielten sie schließlich einen beachtlichen Erfolg, der sich in wogenden Kornfeldern, sowie in grünen Wiesen auf
denen gut genährtes Vieh weidete, widerspiegelte.
Ein schwerer Einschnitt in meinem Leben.
Am 11. Mai 1956 verstarb nach langer schwerer Krankheit, meine liebe Ehefrau Marta Rattay,
geborene Brosch. Ein Jahr zuvor war schon mein Schwiegervater Gottlib Brosch verstorben. Die schweren Bedingungen
unter denen wir nach Kriegende leben mussten, haben ihrer bereits angegriffenen Gesundheit sehr zugesetzt. Sie
verstarb mit 44 Jahren und hinterließ in unserer Familie eine große Lücke, die nicht mehr zu Überbrücken war. Wir
haben sie unter großer Anteilnahme der noch verbliebenen deutschen Bevölkerung zu Grabe getragen und auf dem Rohmaner
Friedhof beigesetzt. Die Arbeit die sie sonst verrichtet hatte fiel jetzt auf mich und meine Söhne zurück. Meine
Schwester Frieda Pelkowski half auch wo sie nur konnte. Wir waren auf die Unterstützung durch Nachbarn und Freunde
angewiesen, die uns immer wenn es nötig war, tatkräftig unterstützt haben. Im laufe der Zeit haben wir wieder zum
Alltag zurück gefunden, haben sie noch etliche Jahre auf dem Friedhof besuchen können, bis wir, bedingt durch unsere
Ausreise uns endgültig von ihr trennen mussten.
Der endgültige Abschied von Ostpreußen
Ab 1956 begannen, durch die Vermittlung des Deutschen Roten Kreuzes, die ersten Ausreisen in die
Bundesrepublik Deutschland. Zuerst waren es Kinder die zu ihren Eltern ausreisen durften, Familien deren Väter aus der
Kriegsgefangenschaft in den Westen Deutschlands entlassen wurden und andere durch den Krieg getrennte
Familienangehörige. Ab 1960 erhöhte sich die Zahl der Ausreisewilligen aus dem polnisch besetzten Ostpreußen. Es setzte
sich die Überzeugung durch, dass unsere Angestammte Heimat, uns für die Zukunft keine Perspektive mehr bieten konnte.
Meistens wurden die Anträge, die wir an die Passabteilung in Allenstein stellen mussten, um einen Ausreisepass zu
bekommen, negativ beschieden. Nach mehrmaligen Versuchen gelang es dann doch, diese begehrte Ausreiseberechtigung in
Empfang zu nehmen. Die Enttäuschung der Zurückgebliebenen war groß, wenn wieder mal Verwandte oder Nachbarn, den Weg
in Richtung Bahnhof einschlugen.
Um einen Reisepass zu beantragen, musste man zuerst eine Einladung von Verwandten aus der Bundesrepublik vorlegen, in
der, diese sich verpflichten mussten, für Unterkunft und Verpflegung der Eingeladenen zu sorgen. Diese Einladung
musste durch ein Amt in der Bundesrepublik beglaubigt werden. Außerdem mussten die Kosten für die Bahnfahrt, ab
polnischer Grenze, bis zum Zielort, beim polnischen Reisebüro ORBIS, in Warschau, in DM eingezahlt werden.
Unseren ersten Ausreiseantrag haben wir 1964, bei der Kommandantur der polnischen Miliz in Allenstein eingereicht, der
nach einer gewissen Zeitspanne, ohne eine uns verständliche Begründung zu nennen, abgelehnt wurde. Gegen diese
Ablehnung wurde ein Widerspruch zugelassen, den wir sofort einreichten. Nach einer weiteren Zeitspanne erhielten wir
wieder eine Ablehnung, gegen die kein Widerspruch mehr zulässig war. Wer seine Ausreiseabsicht nicht aufgeben wollte,
musste einen neuen Antrag stellen. Es gab Familien die schon 10 Mal einen Ausreiseantrag gestellt hatten und immer
wieder abgewiesen wurden. Da meine Söhne, nicht die Absicht hatten in Rohmanen zu bleiben und ich nach 2 Weltkriegen,
an denen ich teilgenommen, die schwere Arbeit auf der Landwirtschaft, nicht aus eigener Kraft schaffen würde, haben wir
1966 wieder einen Antrag gestellt, der prompt abgelehnt wurde. Der Widerspruch auf diese Ablehnung wurde auch negativ
beantwortet, so dass wir 1968 wieder einen Antrag eingereicht haben.
Weil das Passamt in Allenstein lange nichts von sich hören ließ, hegten wir schon die Hoffnung das es jetzt klappen
würde und waren sehr enttäuscht als wieder eine Absage kam. In der Zwischenzeit sind viele Nachbarn und Bekannte aus
Rohmanen, sowie aus der näheren Umgebung, ausgereist und das Häuflein der noch verbliebenen Deutschen, wurde immer
kleiner. Die Motivation, die uns in früheren Jahren, über so manche schwierige Lage hinweg geholfen hat, ist einer
hoffnungslosen Resignation gewichen. Man war davon überzeugt, dass unser Leben, in unser Angestammten Heimat, keine
Zukunftsperspektive mehr haben konnte und wenn wir keine Ausreisegenehmigung bekommen, wir eines Tages die letzten
Deutschen in der ganzen Umgebung sein werden.
Die Ausreise-Heimat ade
Wir hatten die Hoffnung schon aufgegeben, als am 30. April 1969, der Briefträger unseren Hof
betrat und mir einen Brief überreichte, in dem uns das Passamt in Allenstein mitteilte, dass unsere Ausreise in die
Bundesrepublik Deutschland, genehmigt worden ist. Wir müssten, nach Aushändigung der Reisepapiere, den Geltungsbereich
der Volksrepublik Polen, innerhalb von 3 Monaten verlassen. Wir waren zuerst geschockt, über den Hinweis, das wir
unsere Heimat in 3 Monaten verlassen müssen, aber dann stellte sich die Zukunftsperspektive wieder ein und wir gingen,
wie von einem schweren Ballast befreit und gut gelaunt unser weiteren Tätigkeit nach.
Als der Briefträger unseren Hof betrat, waren ich und mein Sohn Kurt gerade dabei eine Fuhre Mist zu laden. Wir hatten
den Wagen gerade halb geladen und haben nach der frohen Kunde nicht mehr weiter gemacht, sondern die Pferde vorgespannt
und den Mist aufs Feld gefahren, damit wir den Wagen für alle Fälle frei hatten. Das war die letzte Tätigkeit für
unsere Landwirtschaft in Ostpreußen.
Die Nachricht von unserer Ausreise verbreitete sich, ohne dass wir darüber gesprochen haben, wie ein Lauffeuer.
Alsbald kamen Leute aus dem Dorf, die sich für das Vieh und für diverse Landwirtschaftliche Geräte interessierten.
Etliche wollten bestimmte Sachen sofort kaufen, andere haben nur zurücklegen lassen und wollten später kommen und
bezahlen, haben es aber dann doch nicht genommen.

Wenn man eine Landwirtschaft hatte, konnte man 2 Pferde, 2 Rinder, 3 Schweine, 5 Schafe und 10 Hühner, in einem
geschlossenen Viehwaggon, in die Bundesrepublik mitnehmen. Jeden Tag war man unterwegs, von einer Behörde zur Andern.
Die Aushändigung der Reisepapiere erfolgte nur nach Vorlage bestimmter Bescheinigungen: Es mussten alle Steuern bezahlt
sein, das Kontingent landwirtschaftlicher Erzeugnisse musste abgeliefert sein, je eine Bescheinigung vom Katasteramt
und vom Notar musste vorgelegt werden, das man dem polnischen Staat das Grundstück abgetreten hat. Die Gebühren für
die notarielle Beglaubigung mussten wir selbst bezahlen. Wenn man alle Bescheinigungen beisammen hatte, bekam man bei
der Kreisverwaltung eine Gesamtbescheinigung. Mit dieser Bescheinigung konnte man nach Allenstein, zur
Polizeikommandantur fahren, wo man nach dem schriftlichen Verzicht auf die polnische Staatsangehörigkeit, einen
Reisepass ausgehändigt bekam, der den Inhaber zum Grenzübertritt berechtigte, aber nicht zur Wiedereinreise.
Wir haben 2 Pferde, eine Sterke, einen Ochsen, 5 Schafe, 2 Schweine und 10 Hühner mitgenommen. Über die Schutzimpfung
der Rinder musste man eine, vom Kreistierarzt beglaubigte Bescheinigung vorweisen. Ich habe 5 Schafsböcke gekauft, die
ich in der Zwischenzeit, hinter der Scheune, zum Weiden angekettet hatte. Einer von denen hat sich losgerissen und
seinen Nachbarn getötet. Das Fleisch konnten wir noch verkaufen, mussten aber dafür einen anderen Schafsbock kaufen.
Innerhalb von 3 Monaten mussten wir alles regeln und zwei Tage vor der Abfahrt einen Eisenbahnwagen, bei der
Eisenbahndirektion in Allenstein bestellen. Reservierungen bei den polnischen Behörden waren meist immer mit
Schmiergeld verbunden, weil man sonst nie sicher sein konnte dass diese Vereinbarungen auch eingehalten werden. Schon
2 Wochen vor unserer Abfahrt, gab es in Ortelsburg keine alkoholischen Getränke zu kaufen. Meine Söhne mussten mit dem
Motorrad die umliegenden Dörfer abfahren, damit wir für die Reise einen Vorrat anlegen konnten; denn Wodka war zu der
Zeit, in Polen, wie eine zweite Währung.
Am 25. Juli haben wir zusammen, mit meinem Neffen Siegfried Brosch, unseren sonstigen Hausrat, der in Kisten verpackt
war, in einen Eisenbahnwagen, auf dem Allensteiner Bahnhof verladen. Alles musste zuerst durch den Zoll, wo die
Federbetten gewogen wurden und über das erlaubte hinausgehende Kissen, verzollt werden mussten. Dasselbe galt auch für
Fleisch und Räucherwaren.
Am 26. Juli, unserem Verladetag, kam der Eisenbahnwagen aus Allenstein, erst um 11 Uhr auf dem Ortelsburger Bahnhof an.
Die Rinder hatten wir zu Fuß, zum Bahnhof gebracht; Schweine, Schafe und Hühner auf dem Pferdewagen. Im Eisenbahnwagen
mussten, mit Hilfe von Brettern und Bohlen, Boxen für die verschiedenen Tiere erstellt werden. Jedes Pferd und jedes
Rind in eine Bucht. Die Schafe zwischen die Pferde, die Schweine zwischen die Rinder und die Hühner in einem Käfig,
unter der Decke über den Rindern. Die Hühner hatten unterwegs Eier gelegt, somit hatten wir jeden Tag frische
Verpflegung. Bei der Fahrt im Viehwagen, begleitete mich mein Sohn Manfred. Als die Lokomotive nahte, um den Wagen
abzuholen, wurden noch schnell die restlichen Sachen hinein geworfen und so mache Abschiedsträne rollte dann die Wange
hinab.
Unsere Nachbarn, Deutsche und Polen, halfen uns beim Verladen des lebendigen Inventars. Jetzt erinnerte ich mich
plötzlich, an die oft auch schönen, Ereignisse der letzten 22 Jahre. Einer Zeit, in der das Zusammenleben von
Deutschen und Polen, von Jahr zu Jahr, besser wurde. Man half sich beim einbringen der Getreideernte, beim Dreschen
des Getreides, bei der Kartoffelernte und bei anderen Arbeiten, wo viele Menschen zupacken mussten. Es war eine
Dorfgemeinschaft, in schweren Zeiten geboren; jeder half jedem wenn Hilfe nötig war. Es wurde mir plötzlich bewusst,
das jetzt ein Lebensabschnitt zu Ende ging, zu dem ich nicht mehr zurückkehren konnte. Unsere Existenzgrundlage war
jetzt ein Eisenbahnwagen auf einem Schienenstrang, dessen Ende irgendwo in weiter Ferne lag. Obwohl, von langer Hand
vorbereitet, war dieser Moment voller Wehmut.
Doch als der Zug sich plötzlich, in Bewegung setzte, war ich sofort wieder in der Gegenwart. Menschen, mit denen man
Jahrzehnte lang, in gutem Einvernehmen zusammen gelebt hat, blieben plötzlich am Bahnsteig zurück und die Entfernung
zwischen ihnen und mir vergrößerte sich mit jeder Sekunde, bis sie letztendlich aus meinem Blickfeld verschwanden.
Es war ein heißer Julitag, als wir unsere Reise gen Westen antraten. Für die Schweine, die besonders unter der Hitze
zu leiden hatten, haben wir 10 Flaschen Essig mitgenommen und sie von Zeit zu Zeit besprenkelt, damit sie besser atmen
konnten. Für die anderen Tiere war reichlich Heu und Hafer vorhanden. Eine großes Fas und zwei Milchkannen waren mit
Wasser gefüllt, die wir auf den an der Strecke liegenden Bahnstationen, bei Bedarf wieder nachgefüllt haben.
Da der Kreistierarzt nicht in seinem Büro war, konnten wir die Impfbescheinigung für das Vieh, nicht rechtzeitig
herbeischaffen. Der Zug setzte sich in Bewegung und die Bescheinigung war immer noch nicht da. Als die Bescheinigung
dann eingetroffen, wir aber schon unterwegs waren, ist mein Sohn Kurt mit dem Motorrad hinterher gefahren und hat uns
in Passenheim, wo der Zug noch andere Wagen angehängt bekam, die Impfbescheinigung übergeben. Wir waren sehr froh das
er es noch geschafft hat, denn in solch einer Situation fühlt man sich sicherer wenn man alle Bescheinigungen bei sich
hat. Auf der Rückfahrt, mit dem Motorrad hatte er noch eine Panne, musste das Motorrad stehen lassen und per Anhalter
nach Hause fahren. Am nächsten Tag kam er mit Siegfried Deptolla, der das Motorrad wieder flott machte und brachte es
wieder nach Rohmanen zurück.
Die Fahrt mit dem Viehwagen, gen Westen
Von Ortelsburg bis Allenstein(45 km) hat unser Zug 4 Stunden gebraucht, weil auf jedem Bahnhof
gehalten wurde, um neue Wagen anzuhängen. Nachdem wir in Allenstein angekommen waren, kam ein Rangierer und fragte
nach unserem Ziel. Als wir ihm mitteilten, das wir in die Bundesrepublik Deutschland wollen, sagte er nur: „In 10
Minuten fährt ein Zug los. Wenn ich von euch 500 Zloty und einen Liter Wodka bekomme, werde euch sofort anhängen,
andernfalls kommt ihr auf ein Nebengleis und müsst dann auf den nächsten Zug warten. Es blieb uns nichts anderes übrig
als seiner Forderung nachzukommen, denn über derartige Erpressungen hat man bereits von Anderen, die vor uns ausgereist
sind, gehört. Wir wurden auch sofort angehängt und fuhren dann die ganze Nacht, an Osterode, und Thorn vorbei bis
Gnesen. Dort wurde wieder rangiert.
Von einer Anhöhe wurden die einzelnen Wagen auf verschiedene Gleise verteilt und zu neuen Zügen zusammengestellt. Der
Aufprall der ungebremsten Wagen erzeugte eine derartige Erschütterung, dass manche Bretter an den Boxen geborsten waren.
Von Gnesen ging es dann in einem Zuge durch bis zur Grenzstation Reppen(Rzepin). Dort mussten wir zum Zollamt, wo
unsere Ausfuhrpapiere durch die Zollbeamten, und durch einen Tierarzt geprüft wurden. Bis Reppen(Rzepin) haben wir für
den Eisenbahnwagen 900 Zloty bezahlt; hier mussten wir noch einmal 650 Zloty bezahlen. Bei der Wagenkontrolle erklärte
uns ein Bahnbeamter das unser Wagen, sich nicht für den internationalen Transport eignet und wir deshalb den Inhalt in
einen Anderen umladen müssen, der irgendwann, auf dem Nebengleis bereitgestellt wird. Nach langer Verhandlung, sowie
einer Zulage von 500 Zloty und einem Liter Wodka haben wir ihn davon überzeugt, das der Wagen sich doch für die
Weiterfahrt eignet.
In der Nacht war Schichtwechsel, der unseren Wagen wieder abgehängt hat, weil er angeblich von der Reichsbahn der DDR,
wegen technischer Mängel nicht weiterbefördert würde. Wir mussten unsere Verhandlung vom Vorabend wiederholen, die mit
der Zusage endete, dass wir am frühen Morgen, über die Grenze auf DDR Gebiet, gebracht werden. Um 5 Uhr morgens kam
eine Lokomotive, die uns den letzten Abschnitt bis über die Grenze bringen sollte. Als der Zug hat noch einmal anhielt,
kamen polnische Grenzbeamte und Soldaten in den Wagen. Sie durchsuchten ihn und fragten, ob wir noch polnisches Geld
oder einen Grundbuchauszug bei uns hätten. Wir zeigten ihnen 800 Zloty, die sie uns, nach Ausstellung einer Quittung
über 500 Zloty, abnahmen. Die Grundbuchauszüge habe ich, im Stroh versteckt, dem Ochsen vor die Füße gelegt. Falls
jemand da suchen sollte, hätte ich gesagt, das das Tier bösartig veranlagt ist, und ich für seine Sicherheit nicht
garantieren könnte, deshalb sollte er vorsichtig sein.
Als die Grenzkontrolle den Zug verlassen hatte, setzte sich die Lokomotive wieder in Bewegung und überquerte nach
kurzer Zeit die Oderbrücke. Auf einer eingezäunten Fläche, jenseits der Grenze, hat man uns abgestellt hat und die
Lokomotive fuhr zurück auf polnisches Gebiet. Vor und hinter uns waren die Tore verschlossen. Auf den Wachtürmen,
links und Rechts von uns, standen Posten mit einem Gewehr im Anschlag. Vier Grenzbeamte der DDR, jeder mit einer
Leiter in der Hand, sowie ein Schäferhund, kamen zu unserem Wagen. Sie öffneten die Schiebetüre, stellten die Leiter
davor und ließen den Hund in den Wagen springen, der nur etwas herum schnupperte und wieder heraussprang. 2 Beamte
haben dann anschließend, die Papiere kontrolliert und das Inventar gezählt.
Nach einiger Zeit wurden wir an einen Güterzug der Reichsbahn angehängt und fuhren von Frankfurt an der Oder, vorbei
an Berlin, Ellingen und Nordhausen, über die Grenze zur Bundesrepublik bis Herzberg. Hier hat ein Zollbeamter der
Bundesrepublik, die Formalitäten erledigt und ein Tierarzt die Pferde, Rinder und Schweine gründlich untersucht. Ich
musste ihnen die Mäuler aufhalten und die Füße hochheben. Danach hat uns die Lokomotive zu einer Wasserzapfstelle
gebracht, wo wir die Tiere tränken und unsere Behälter mit Wasser auffüllen konnten. Anschließen fuhren wir über
Northeim nach Göttingen, zur Viehverwertungsgenossenschaft, die zuvor von unserer Ankunft in Kenntnis gesetzt wurde.
Der Ochse, die Sterke und die Schweine wurden, in Göttingen zum Schlachthof gebracht; die Pferde kamen nach Hannover
und die Schafsböcke nach Kassel. Wir waren mit dem Viehtransport 5 Tage unterwegs; hatten so manche Klippe umschifft
und Schwierigkeiten gemeistert, die im normalen Leben nicht vorkommen.
Wir wurden mit einem PKW, ins Durchgangslager Friedland bei Göttingen gefahren, wo mein Sohn Kurt, meine Schwester
Frieda Pelkowski und Siegfried Brosch mit Familie, die am 30 Juli, um 14 Uhr, von Warschau mit dem Zug abgefahren, und
hier am 31. Juli in den Morgenstunden eingetroffen sind, schon auf uns gewartet haben. In Friedland hat man uns mit
Familie Siegfried Brosch in einem Raum untergebracht, wir wurden registriert und erhielten 20 DM Überbrückungsgeld,
pro Person. Da wir erst am Freitag in Friedland eingetroffen sind, mussten wir hier über das Wochenende bleiben,
obwohl die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der Regel nur 3 bis 4 Tage beträgt.
Um einen Antrag für die Ausreise stellen zu können, brauchten wir eine Einladung von in der Bundesrepublik lebenden
Verwandten. Diese Einladung hat uns mein Bruder, Ernst Rattay, aus Ingelheim am Rhein zugeschickt. Ingelheim liegt im
Bundesland Rheinland-Pfalz. Das Geld für die Bahnfahrt, hat uns, Frieda Schellin, geb. Nickel, aus Duisburg, die
Tochter unseres Nachbarn, überwiesen. In Friedland wurden wir registriert. Im Registrierschein, war als unser
nächster Aufenthaltsort in der Bundesrepublik, das Durchgangslager Osthofen bei Worms, das alle Aussiedler für
Rheinland-Pfalz aufnehmen musste, eingetragen. Die Eintragung erfolgte deshalb, weil der Ort aus dem uns unsere
Einladung zugeschickt wurde, sich auch in Rheinland-Pfalz befand.
Da ich nach dem Polenfeldzug, als Soldat, ein Jahr im Kreis Opladen, im Rheinland gewesen bin, wäre ich sehr gerne in
diese Gegend gezogen, denn die Erinnerung an die schönen Tage die ich dort verlebt habe war in mir immer noch wach.
Ich versuchte die Eintragung in unseren Regiestierscheinen ändern zu lassen, was nach einigen, vielleicht auch
berechtigten Einwänden, am 4. August, vom Beauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen, genehmigt wurde. Anstelle von
Rheinlad-Pfalz stand da jetzt Nordrhein-Westfalen und am 7. August, fuhren wir, noch mit anderen Aussiedlern, ins
Durchgangslager Unna-Massen, am östlichen Rande des Ruhrgebietes gelegen. Hier wurden wir in einem Zimmer untergebracht
und konnten unser Essen in einer Gemeinschaftsküche zubereiten.
Am 8. August wurden wir in Unna-Massen, als Bürger der Bundesrepublik Deutschland registriert, erhielten
Einhundert DM Begrüßungsgeld, den Vertriebenen Ausweis -A -und 4 Wochen später den Bundespersonalausweis. In
Unna-Massen haben wir mehr als 4 Monate verbracht, weil mein Sohn Kurt, wegen fehlender Berufsausbildung, in Unna, an
einem Grundlehrgang für Metallarbeiter teilgenommen hat, der vom Arbeitsamt finanziert wurde. Am 11 Dezember 1969 sind
wir endlich an unserem vorläufigen Wohnsitz, im Durchgangswohnheim, an der Elisabethstraße 13, in Velbert angekommen.
Ab dem 5. Januar 1970 konnten meine Söhne, in der Zahnradfabrik Reining, in Velbert ihrer geregelten Arbeit nachgehen.
Von Bau- und Sparverein in Velbert wurde uns am 20. Juni 1970, unsere erste Wohnung zugewiesen.
Velbert im Februar 1972
gezeichnet: Gustav Rattay
Das Jahr 1914 wurde zum Schicksalsjahr, für Ostpreußen und seine Bevölkerung. Nach Abschluß der Volksschule im Jahr
1912, habe ich in den Wintermonaten einen Fortbildungslehrgang für die Landwirtschaft besucht, den Hauptlehrer Aaron,
der aus Olschienen nach Rohmanen versetzt wurde, für uns organisiert hatte. Da im Dorf 2 Trompeten vorhanden waren,
hatte er uns nahe gelegt eine Kapelle zu gründen, dann könnten wir ja die Soldaten, die aus dem Krieg heimkehren
würden mit Musik empfangen. Zum Abschluss konnte man sich ein Buch oder ein Obstbäumchen wünschen. Eine Woche vor dem
Einmarsch der Russen, haben wir noch mit einem Breitdrescher, der durch ein Rosswerk dass von 6 Pferden angetrieben
wurde 110 Zentner Roggen gedroschen. Der Lehrer Malayka hat sich 1914 freiwillig zum Militär gemeldet. 1915 hat er uns
als Offiziersanwärter besucht. Im Frühjahr 1916 wurde mein Jahrgang gemustert und im Herbst 1916 wurden wir eingezogen.
Ausbruch des Ersten Weltkrieges
Am 2. August 1914 wurde die Allgemeine Mobilmachung ausgerufen. Alle wehrfähigen Männer folgten
dem Ruf des Kaisers und eilten zu den zuständigen Wehrmeldeämtern um die Grenzen des Vaterlandes zu schützen. Wir als
Grenzbewohner bekamen das Meiste zu spüren. Alle Häuser, Scheunen und Ställe waren mit Soldaten und ihrem Tross belegt.
Die Einen gingen, die Anderen kamen. Die Kosaken hatten bei Muschaken und Radzinen die Grenze überschritten. Der
Flüchtlingsstrom hatte sich von der Grenze her angestaut. Die Russen haben überall geplündert. Die Trosse mussten sich
zurückziehen und haben dazu vorwiegend die Feldwege benutzt. Die Pferde waren erschöpft. In einer Nacht kam der
Gemeindevorsteher mit einem deutschen Offizier auf unseren Hof. Mein Vater und der Nachbar Wilhelm Dorka mussten mit
ihren Pferden aushelfen. Sie waren 2 Tage unterwegs, bis zu einem Gut in Kleeberg bei Allenstein. Als sie dann wieder
nach Hause kamen waren die Russen schon am Rohmaner Friedhof. In der Zwischenzeit hatten wir schon den Leiterwagen mit
Mehl, Rauchfleisch und Betten beladen.
Der überwiegende Teil der Rohmaner war schon losgefahren. Der Hauptlehrer Müller kam noch mit dem Fahrrad vorbei und
sagte es wäre höchste Zeit das wir wegkämen weil die Russen schon Ortelsburg besetzt hätten und im Anmarsch auf
Rohmanen wären. Wir sind auf eine Anhöhe gestiegen und haben die Staubwolken beobachtet, aber wir dachten es wäre
deutsches Militär.
Auf der Flucht vor den Russen
Kurz vor Sonnenuntergang haben wir die Pferde vor den fertig gepackten Wagen gespannt und sind
sofort losgefahren. Mein Bruder und ich nahmen 4 Milchkühe und die beste Sterke mit und gingen hinterher. Schweine,
Kälber und Geflügel haben wir aus den Ställen getrieben. Wir waren die ganze Nacht unterwegs und sind bis Rheinswein
gekommen. Da hatten wir einen Onkel wohnen, bei dem haben wir den ganzen Tag verbracht.
Unterwegs haben wir einen Mann getroffen, der erzählte uns dass die Russen bei Groß Jerutten einen Personenzug
überrumpelt haben. Sie hatten aus Eisenbahnschwellen eine Sperre auf den Schienen errichtet und somit den Zug zum
Anhalten gezwungen. Die Russen haben den Zug mit Artillerie beschossen. Als die Soldaten und Zivilisten den Zug
verlassen wollten kamen die Kosaken zu Pferde und haben ein Massaker angerichtet. Nur wer sich am Boden davon
schleichen konnte hat überlebt. Die Russen wurden durch einen Verräter darüber informiert das auf diesem Gleis ein
Zug unterwegs war und waren darauf vorbereitet. Unserem Informanten ist es auch gelungen dem Massaker zu entkommen.
Ein Kosake hatte ihm im beim vorbeireiten mit dem Säbel ein Ohr abgehauen und ihn dadurch zu Boden geschlagen. Es ist
ihm danach gelungen ins Gebüsch zu schleichen. Sein Kopf war schon verbunden als wir ihn trafen. Später wurde an der
Stelle des Überfalls ein Gedächtnisstein errichtet.
Im Morgengrauen sah man viele Kosaken über die Felder reiten. Wir sind dann später wieder weiter in Richtung
Jellinowen gefahren. Unser Vater ist mit dem Pferdewagen die Landstraße entlang gefahren. Wir mit dem Vieh sind
entlang einer tiefen Schlucht durch den Wald bis zum Babanter See gegangen. Wir hatten schon vorher versucht die
Schlucht zu verlassen aber wegen der steilen Hänge ist es uns leider nicht gelungen. Am See angekommen fanden wir drei
große Schober mit Getreide vor. Von einem dieser Schober haben uns zwei Kosaken mit einem Fernglas beobachtet. Sie
schwangen sich auf ihre Pferde und kamen uns entgegen geritten, dann hielten sie uns ihre Lanzen vor die Brust und
versuchten uns auszufragen. Wir haben leider nichts verstanden und fingen an zu weinen. Plötzlich pfiff der
Patrollienführer auf einer Trillerpfeife und die Kosaken kehrten zu ihrem Ausgangspunkt zurück.
Als wir dann weiter am See entlang gingen sahen wir von weitem drei Gehöfte. In der Nähe einer dieser Höfe hatte unser
Vater den Pferdewagen im Gestrüpp abgestellt. Die vorrückenden Schützenlinien der russischen Infanterie hatten ihn
jedoch entdeckt. Sie haben den Wagen durchwühlt und den Sack mit Rauchfleisch mitgenommen. Andere Flüchtlingswagen die
in diesem Gebüsch Schutz gesucht haben sind nicht besser davon gekommen. Wir haben das Vieh auf einen der Höfe
getrieben und am Zaun festgebunden. Dann haben wir mit Hilfe einer Leiter den Heuboden erklommen und uns dort versteckt.
Als die Kosaken auf dem Hof erschienen verlangten sie Brot und Milch. Die Frauen mussten zuerst essen und trinken,
danach haben es die Russen auch getan, sie fürchteten sich davor, dass man sie vergiften könnte. Später kam dann die
russische Infanterie und hat Haus, Scheune und Schuppen durchsucht. Die Falltüre zum Heuboden ließ sich nur nach oben
hin öffnen. Wir hatten die Türe von oben mit schweren Gegenständen beschwert, aber die Russen versuchten mit aller
Gewalt auf den Heuboden zukommen. Als die Frauen das sahen, sagten sie zu den Russen, da oben würden sich ihre Kinder
versteckt halten. Die Russen forderten nun, die Kinder sollten sofort den Heuboden verlassen. Die Mütter riefen nun
nach ihren Kindern die dann auch tatsächlich den Heuboden verließen. Als wir das sahen, haben wir uns am Giebel tief
im Heu vergraben. Drei Russen kamen nun rauf und stocherten mit ihren Bajonetten im Heu herum. Glücklicherweise kamen
sie nicht in unsere Nähe. Als die Russen den Heuboden verließen haben wir befürchtet sie würden ihn in Brand setzen.
Wahrscheinlich taten sie deshalb nicht weil so viele russische Soldaten auf dem Hof waren. Einige Zeit später
erschienen russische Offiziere auf dem Hof, mit einem Auto. Sie sagten, sie hätten das Land erobert und wir hätten ab
sofort dem russischen Zaren zu gehorchen. Wir wurden angewiwsen nach Hause fahren und unbesorgt unsere Ernte
einzubringen. Sie haben uns auch eine Bescheinigung ausgestellt, damit uns auf dem Heimweg niemand die Pferde und
das Vieh wegnehmen würde.
Erst am nächsten Morgen, als die Front weiter vorgerückt war, beschlossen wir die Heimreise anzutreten. Die Straßen
waren mit vorrückenden russischen Truppen blockiert. Manchmal mussten wir stundenlang am Wegesrand warten bis die
Soldaten mit ihrem Tross vorbeigezogen waren. Unterwegs wollten sie unser Vieh zum Schlachten wegnehmen, aber die
Bescheinigung hat uns davor bewahrt. Die Eisenbahnbrücke vor Neu-Keykuth wurde von Kavallerie bewacht. Die wollten uns
nicht drüber lassen und hielten uns bis zum frühen Morgen fest. Zurück in Rohmanen angekommen, konnten wir unser Haus
nicht betreten weil der Hof und alles rundherum ein großes Militärlager war.
Wir sind dann in Richtung Seelonken gefahren, bis Abbau Brosch. Auf dem Hof angekommen haben wir zuerst Grünfutter für
die Pferde vom Feld geholt und anschließend Mittag für uns selbst gekocht. Die Nacht haben wir erstmal auf dem Hof
verbracht. Am nächsten Morgen wagten wir es ins Dorf zu gehen um die Lage zu erkunden. Die Russen waren schon wieder
weiter gezogen, aber Haus und Hof waren in einem schrecklichen Zustand. Wir sind dann gegen Abend wieder nach Hause
zurückgekehrt.
Am 23. August 1914 waren die Russen bei uns eingebrochen, bis sie am 28. August von den Deutschen zurückgeschlagen
wurden. Dann fuhren sie wieder zurück, drei Wagen nebeneinander. Ortelsburg brannte lichterloh. Ein Wagen mit Mehl war
uns gegenüber in den Straßengraben gekippt, aber wir haben nichts davon genommen, weil man ja nicht wusste ob man die
Nacht überleben würde. Wir saßen die ganze Zeit im Keller. Am nächsten Morgen zog dann russische Kavallerie und
Infanterie durch unser Dorf. Die Kavallerie ritt orientierungslos hin und her. Die Infanterie hat den ganzen
Vormittag 1,5 Meter tiefe Schützengräben ausgehoben. Um 11 Uhr kamen aus Richtung Eichtal 3 deutsche Spähwagen nicht
ahnend dass die nördliche Hälfte des Dorfes noch von Russen besetzt war. Wir haben zu diesem Zeitpunkt auf dem
Dachboden Weizen eingesackt und hatten aus diesem Grunde einen weiten Rundblick.
Um 11 Uhr kamen aus Richtung Eichtal drei deutsche Spähwagen angefahren. Als wir die deutschen Soldaten erkannt hatten,
haben wir sie durch Handzeichen gewarnt weiter nach Norden vorzustoßen. Die Kosaken hatten sich auf den Häuserdächern
positioniert und in Richtung Norden nach deutschen Truppen Ausschau gehalten. Die Deutschen sprangen von den Spähwagen
und fingen an die nichts ahnenden Russen zu beschießen. Als die sich ihrer gefährlichen Lage bewusst wurden verließen
sie ihre Aussichtsposten und bestiegen ihre Pferde. Mit Peitschenhieben versuchten sie, die sich in panikartiger Flucht
befindliche Infanterie dazu zu Bewegen, die Deutschen anzugreifen. Zwei Spähwagen wendeten sofort, der Dritte konnte
nicht mehr umkehren. Es gelang allen, bis auf den Fahrer des dritten Wagens die Flucht. Die Russen nahmen ihn sofort
unter Beschuss, doch es gelang ihm über unseren Hof zu entkommen. Auf der rückwärtigen Seite schlug er sich quer durch
die Gärten bis zum Gehöft von Friedrich Sakowski durch. Der versteckte ihn im Keller und versorgte ihn anschließend
mit Zivilkleidung.
Als die Russen den Soldaten auf unseren Hof laufen sahen nahmen sie sofort die Verfolgung auf. Sie durchstöberten auch
die Nachbarhäuser und trieben die Bewohner auf der Straße zusammen. An der Spritzenwagenremise richteten sie einen
Sammelpunkt ein. Unter dem Vorwand es würde hier eine Schlacht stattfinden, versuchten die Russen die Zivilbevölkerung
aus dem Dorf zu drängen. Alle die dem Aufruf gefolgt sind und an unserer Sammelstelle vorbeikamen wurden unserem Haufen
hinzugefügt. Unter ihnen befand sich auch der deutsche Soldat in Zivilkleidung. Er hatte einen Sack über die Schulter
geschlagen in dem sich ein Brot befand, an der anderen Hand führte er eine Kuh am Strick. Als unser Haufen schon aus
etwa 50 Leuten bestand setzten uns die Russen mit Marschrichtung Seelonken in Bewegung. Wir Jungen versuchten in einem
unbeaufsichtigten Moment wegzulaufen, doch die Begleitmanschaft prügelte uns mit Gewehrkolben wieder in Reihe und Glied.
Unterwegs gelang es dem Soldaten mit der Kuh unbemerkt zu entkommen. Er kehrte unbehelligt ins Dorf zurück und lieferte
die Kuh wieder dort ab wo er sie entführt hatte.
Uns haben die Russen an Seelonken vorbei zum Sylvensee getrieben. Wenn sie von vorbeiziehenden russischen Offizieren
gefragt wurden weshalb wir unterwegs wären, sagten sie denen wir hätten deutsche Soldaten versteckt und wollten das
Versteck nicht verraten. Als wir am See vorbei waren begann die deutsche Artillerie aus Richtung Ortelsburg zu
schießen. Unweit von uns explodierten Granaten und richten ein großes Chaos unter Freund und Feind an. Es hieß dann
rette sich wer kann. Die Russen verließen uns in Richtung Waldpuschsee und wir kehrten orientierungslos nach Seelonken
zurück. Nach Rohmanen konnten wir nicht zurück weil die deutsche Artillerie aus Richtung Eichtal anfing unser Dorf zu
beschießen. Schließlich sind wir auf dem Abbau Brosch untergekommen. Ein durch Granatsplitter schwer verletzter Russe
suchte dort auch Zuflucht. er versucht sich mit einem Messer das Leben zu nehmen. es gelang den Frauen ihn davon
abzubringen, weil sonst bei einem etwaigen erscheinen von russischen Soldaten der Verdacht auf uns gefallen wäre.
Später erschienen tatsächlich Kosaken die ihn dann mitgenommen haben. Ihnen folgten in 50 Meter Entfernung Deutsche
Ulanen, die hinter den Russen in einem in der Nähe liegenden Wäldchen verschwanden.
Nachdem die Russen Rohmanen besetzt hatten, versteckten sie sich vorwiegend in mit Stroh gedeckten Gebäuden. Durch
Schießscharten, die sie im Strohdach anlegten, schossen sie auf die deutschen Kampfverbände, die sie wieder vertreiben
wollten. Um die Angreifer zu entlasten, wunde das Dorf von deutscher Seite unter Beschuss genommen. Durch die
Geschosse der deutschen Artillerie entstanden in Rohmanen viele Brände. Die mit Stroh gedeckten Gebäude fielen zuerst
in Schutt und Asche. Unser Vater hatte uns ins Dorf geschickt, damit wir das Vieh im Stall von der Kette losbinden
sollten. Am Dorfrand kamen uns schon deutsche Ulanen und Husaren entgegen. Rohmanen brannte an mehreren Stellen. Unser
Hof war noch unversehrt, nur die Zäune standen schon in Flammen. Wir haben das Vieh los gebunden und anschließend
versucht die Brandherde rund herum zu löschen. Es gelang uns die Flammen von unserem Hof fernzuhalten und auch bei
unserem Nachbarn einzugreifen. In vielen Scheunen und Ställen hatten sich noch viele versprengte Russen versteckt. Die
wurden anschließend von deutschen Soldaten eingesammelt und in Gefangenenlager abgeführt. Am nächste Tag haben wir dann
zerbrochene Gewehre und Munition in Körbe gesammelt und im Dorfteich versenkt.
Am 29. August haben die Russen Rohmanen verlassen, doch schon am 30. August sind sie wieder zurückgekehrt. Hauptlehrer
Müller wurde mit seinem Sohn und Karl Deptolla auf Fahrrädern fahrend von einer russischen Patrouille aufgegriffen.
Sie wurden von den Russen der Spionage verdächtigt weil der Lehrer Müller ein Fernglas bei sich trug. Der Sohn hatte
eine Gymnasiastenmütze und eine Landkarte bei sich. Sie wurden in Richtung Lehmanen abgeführt. Auf einer Anhöhe des
Grundstücks von Ernst Chittka befand sich eine nicht mehr betriebstaugliche Windmühle. Dort soll ein russisches
Kriegsgericht sie zum Tode verurteilt haben. Nach der Hinrichtung wurden sie in der Nähe der Windmühle verscharrt.
Später wurden sie wieder ausgegraben, in Särge gelegt und auf dem Rohmaner Friedhof beigesetzt. Die Ehefrau von Lehrer
Müller hat die Gräber nach dem 1. Weltkrieg mit einem schmiedeeisernen Zaun umrandet.
Die Kämpfe um Rohmanen haben viele Menschenopfer gekostet. Bei uns hinter der Scheune lagen 2 tote Russen und ein
Verwundeter. Die Toten haben wir in einer Kartoffelmiete vergraben. Alle anderen Gefallenen wurden auch gleich an der
Stelle an der sie zu Tode kamen verscharrt und mit einem Kreuz gekennzeichnet. Für die im Raum Rohmanen gefallenen
Russen wurde nach dem Krieg hinterm Dorf, in Richtung Ortelsburg, auf einer Anhöhe ein Heldenfriedhof angelegt. Dort
liegen 20 Soldaten und 1 Offizier. In der Mitte befindet sich ein Trauerbaum und Birken säumen den Zugang von der
Landstraße her. Der Lehrer Dorka hat nach dem Kriege, mit seinen Schülern immer die Gräber gepflegt.
Meine Einberufung zum Militär

Bis zu meinem 17. Lebensjahr habe ich meinem Vater in der Landwirtschaft geholfen. Im Frühjahr
1916 wurde unser Jahrgang gemustert. Im Herbst 1916 erhielten Gustav Spektor, Johann Resonek und ich einen
Einberufungsbescheid. Wir mussten uns in Allenstein im Kaisergarten melden. Dort wurden Rekruten aus mehreren
Landkreisen zusammen gezogen und danach verschiedenen Ausbildungszentren zugeteilt. Wir Rohmaner kamen zum 18.
Infanterie-Regiment nach Osterode. Ein Unteroffizier mit einer Gruppe Musketiere haben uns von Allenstein abgeholt.
Als wir in der Kaserne ankamen haben wir sofort Mittagessen in Blechnäpfen bekommen. Untergebracht wurden wir im
Dachgeschoß der Kaserne. Es waren keine Betten vorhanden, nur Strohsäcke lagen auf dem Boden.
Als dann einige Tage später ausgebildete Kompanien an die Front ausrückten durften wir in einen anderen Block umziehen.
Wir wurden der Größe nach aufgestellt, in Korporalschaften eingeteilt und dann von Kopf bis Fuß eingekleidet. Die
Ausgehuniformen hatten blanke Knöpfe dazu einen Schako mit blanker Spitze. Im neuen Block hatten wir 2stöckige Betten.
Unsere Zivilbekleidung mussten wir in einen Karton verpacken und nach Hause schicken. Dann erst begann das eigentliche
Kasernenleben. Die Kaserne durfte niemand ohne Erlaubnis verlassen, nur in Begleitung eines Unteroffiziers. In der
Kaserne war eine Kantine in der man alles kaufen konnte was in der Kaserne gebraucht wurde.
Am nächsten Tag kam unser Kompanieführer, im Range eines Hauptmanns, zu Pferde angeritten. Er begrüßte uns mit;
Guten Morgen Kameraden, wir antworteten ihm mit; Guten Morgen Herr Hauptmann. Er hat dann die Front abgeschritten und
jeder musste sich mit seinem Namen vorstellen. Um 5 Uhr wurde geweckt, 6 Uhr Kaffee holen, 7-8 Uhr Unterricht, 8-11
Uhr exerzieren auf dem Kasernenhof. Um 11.30 blies der Trompeter zur Mittagspause. Die erste Zeit war noch alles
ziemlich gemütlich aber dann wurde es von Tag zu Tag strenger. Um 10 Uhr abends war Zapfenstreich, dann ging der
Unteroffizier vom Dienst von Stube zu Stube, der Stubenälteste musste die Anwesenheit aller Rekruten melden; zum
Beispiel: Stube 56 belegt mit 14 Mann, alle zu Haus. Wir mussten in 2 Reihen antreten, mit Drillichanzug bekleidet
und in Pantoffeln, ein tadelloses Aussehen präsentieren. Der Diensthabende Unteroffizier prüfte ob alle
vorschriftsmäßig angezogen, gewaschen, gekämmt und ob alle Knöpfe an der Jacke geschlossen waren. Als er bei einem
Rekruten einen offenen Knopf erspähte, hat er uns gefragt, ob jemand ein Taschenmesser bei sich hat.
Wir ahnten nicht Gutes, darum haben wir uns ganz still verhalten und nichts gesagt. Da sagte der U.v.D. plötzlich:
”Wenn niemand von euch ein Messer bei sich hat, dann habe ich ein”. Er zog sein Messer aus der Tasche und fing an, bei
dem Rekruten die Knöpfe abzuschneiden. Als die Knöpfe zu Boden purzelten, brachen wir in lautes Gelächter aus. Das hat
ihn so in Rage gebracht, das unser unwürdiges Benehmen, zuerst mit einem „Donnerwetter” bestraft wurde. Dann schrie
er: ”In den Korridor marsch, marsch, die Treppen runter bis auf den Hof”. Als wir unten angekommen waren hieß es
wieder; "Zurück auf die Stube in der 3. Etage”. Jemand hat mir bei dem Durcheinander, von hinten in den Pantoffel
getreten, so das er auseinander gerissen wurde. Ich bin dann nur mit einem Pantoffel und einem Socken die Treppen rauf
und runter gelaufen. So wurden wir 3-mal hinunter und wieder hinauf gejagt.
Danach ließ er uns wieder antreten und hat mit einer Taschenlampe unter den Betten geleuchtet. Plötzlich schrie er
wieder los: "Das nennt ihr Fegen? wenn ihr mit dem Besen nicht fegen könnt, dann mühst ihr das mit eueren Bäuchen tun.
Marsch, marsch unter die Betten” . Als wir schon alle am Schlafen waren, kam der U.v.D. wieder und hat nachgesehen ob
alle Schränke abgeschlossen waren. Ein Kamerad hatte seinen Schlüssel verloren, deshalb hat er das Schoß nur so
eingehängt. Als der U.v.D. das bemerkte hat er die Türe aufgerissen, die ganzen Sachen aus dem Schrank, quer durch die
Stube verteilt und war dann endlich gegangen.
Die Anziehsachen mussten, fein sauber gefaltet, auf dem Stuhl liegen; da drauf die Socken und die Pantoffeln unter dem
Stuhl. Die Stühle mussten in einer Reihe ausgerichtet sein; die Hosenträger im Schrank einschlossen und der Brustbeutel
mit Geld auf dem Hals tragen werden. Morgens wurden wir geweckt und kamen zuerst in den Waschraum. Jeder musste seinen
entblößten Oberkörper mit kaltem Wasser abreiben. Da draußen strenger Frost herrschte war es im Waschraum auch sehr
kalt, so das manche ihr Hemd anbehielten. Der UvD hat dann bei seinem Kontrollgang alle Verweigerer aufgeschrieben
und ihnen befohlen in 30 Minuten mit einem Besen in der Hand auf der Schreibstube zu erscheinen. Einige mussten den
Kasernenhof fegen, andere die zugefrorenen Latrinen enteisen und reinigen. Während unserer Ausbildungszeit durften wir
die Kaserne nicht verlassen. Wenn man Stuben- oder Frühdienst hatte, blieb keine Zeit zum Frühstücken.
Nach 6 Wochen wurden wir in der Grollmann Kaserne vereidigt. Die Regimentskapelle spielte "Heil dir im Siegerkranz",
danach folgten 3 Strophen des Deutschlandliedes. Vor der Vereidigung wurden die Rekruten gefragt wer keine deutsche
Staatsangehörigkeit besitzt. Es sind dann Luxemburger und auch noch welche aus anderen Ländern hervorgetreten. Sie
wurden gefragt ob sie die deutsche Staatsangehörigkeit annehmen wollen. Die das abgelehnt haben wurden auf die
Schreibstube gerufen und sofort aus dem Militärdienst entlassen. Nach der Vereidigung erfolgte ein Kirchgang, danach
konnte man einen Stadturlaub beantragen. Nach dem Mittagessen mussten alle, die einen Urlaubschein beantragt hatten
vor der Kaserne antreten. Der Hauptfeldwebel prüfte dann ob an der Uniform alle Knöpfe blank geputzt waren, die Stiefel
glänzten und der Rekrut auch vorschriftsmäßig grüßen konnte. Wer diese Anforderungen nicht erfüllen konnte musste
seinen Urlaubschein wieder abgeben und zurück auf sein Zimmer gehen.
Wenn man die Kaserne für eine gewisse Zeit verlassen wollte, mussten zuerst der Korporal, dann der Hauptfeldwebel und
letzt endlich der Hauptmann, seine Zustimmung erteilen. Es wurde geprüft; ob die Ausgeh-Uniform sitzt, alle Knöpfe
blank geputzt sind und der Helm so blank ist das man sich darin spiegeln kann. Unser Hauptmann war in Zivil,
Bürgermeister von Osterode. Er war sehr stolz wenn er seine Kompanie, in Parade Uniform und mit einem fröhlichen Lied
auf den Lippen, durch seine Stadt führen durfte.
Als wir eines Tages zum etwa 6 Kilometer entfernten Schießstand marschieren sollten, war es sehr kalt und glatt. Der
Hauptmann ritt durch das große Tor, wir aber sind durch das kleine Tor gegangen und haben eine steil bergab führende
Abkürzung gewählt. Die Zug- und Gruppenführer gingen voraus und wir im Gänsemarsch hinterher. Ein Kamerad hat sich auf
den Gewehrkolben gesetzt und ist darauf den Berg hinunter gerutscht. Als die Anderen das sahen haben sie es ihm
nachgemacht und hatten einen Riesenspaß. Da kam der Hauptmann plötzlich im Galopp angeritten; ließ alles anhalten und
hat zuerst die Zugführer ausgeschimpft, dann anschließend die ganze Kompanie. Er sagte: „Wie könnt ihr es wagen, so
mit eueren Gewehren umgehen. Ein Gewehr soll man wie seine Braut behandeln und nicht wie einen Straßenbesen”. Zur
Strafe mussten wir, links und rechts der Straße, in zwei Reihen antreten und durch den verschneiten Straßengraben
robben. Die Herrn Zug- und Gruppenführer durften die Straße benutzen und erteilten uns nur Befehle, wie: hinlegen,
nach rechts schwenken, nach links schwenken, einzeln vorarbeiten und sammeln. Als wir dann abgekämpft, in Linien zu
2 Glieder angetreten waren, ging es mit Gesang zum Schießstand.
Auf dem Schießstand angekommen, erhielten wir zuerst eine praktische Unterweisung, für den Gebrauch von Schusswaffen.
Wir mussten solange mit einem nicht geladenen Gewehr üben, bis wir unserem Vorgesetzten beweisen konnten, dass wir
alles im Griff haben. Daraufhin wurden jedem 10 Patronen zugeteilt, so das er unter der Aufsicht eines Unteroffiziers
mit den Schießübungen beginnen konnte. Der Unteroffizier hat die Position der Einschüsse, auf der Scheibe, in einem
Buch eingetragen und nach Beendigung der Übung dem Hauptmann Bericht erstattet, ob der Schütze seine Aufgabe erfüllt
hat oder nicht. Nach dem Schießen wurden die Gewehre zu Pyramiden zusammengestellt. Diejenigen die ihre Aufgabe nicht
erfüllt haben, mussten rund um die Zielscheibe, die Bleikugeln aufsammeln.
Seit unserer Einberufung hatten wir noch keinen Heimaturlaub. Urlaub bekamen nur die, die ihren Heimatort zu Fuß
erreichen konnten. Wegen der vielen Truppentransporte die täglich von Ost nach West unterwegs waren durften wir die
Eisenbahn nicht benutzen. Einmal wurde uns gesagt; wenn jemand gut schießen kann der bekommt Heimaturlaub, aber auch
das war nur ein leeres Versprechen.
Kaisers Wilhelms Geburtstag
Der beste Tag war des Kaisers Geburtstag. Am 27. Januar mussten alle in der Grollmann Kaserne
antreten, der Battalions-Kommandeur beendete seine Laudatio mit den Worten: Seine Majestät, unser Kaiser und König
Wilhelm II, erlebe hoch, hoch, hoch. Dann spielte die Regimentskapelle: Heil dir im Siegerkranz, Herrscher des
Vaterlands, Heil Kaiser dir. Danach folgten 3 Strophen des Deutschlandliedes und anschließend fand ein Gottesdienst
statt. Anschließend gab es ein vorzügliches Mittagessen, Schweinebraten, ein Stück Wurst auf die Faust und Biermarken,
die man in der Kantine gegen gutes Bier einlösen konnte, danach Urlaub bis zum Wecken, ohne Urlaubschein. Mein Vater
und die Mutter eines Kameraden waren schon morgens angekommen, konnten uns aber nicht finden, wurden von einer Kaserne
in die andere geschickt. Erst als wir mit Musik, von der Kirche zurück zur Kaserne marschiert sind habe ich sie
zufällig entdeckt. Als sie mich auch erkannt haben, sind sie nachgekommen. Da war die Freude groß: Der Vater hatte
einen großen Koffer auf einem Krückstock über die Schulter getragen. Ich ging gleich zur Wache und habe sie angemeldet,
sie sind dann bis zum Abend geblieben. Es war einer der schönsten Tage in der Grollmann-Kaserne in Osterode.
Alle 10 Tage bekamen wir Sold. Vor der Auszahlung mussten wir antreten, jeder wurde gefragt ob noch Restgeld vom
letzten Sold vorhanden war. Dann bekam jeder 3,30 Mark, davon musste man noch Sidol für das Koppelschloss und
Schuhkreme für die Stiefel kaufen. Wer geraucht hat und nichts von zu Hause bekam war schlimm dran. Beim Militär bekam
man nicht nur die Ausbildung an der Waffe beigebracht, man lernte auch putzen, nähen, Strümpfe stopfen und vieles
Andere. Man bekam einen beschädigten Strumpf, der musste aufgeribbelt werden, mit der Wolle konnte man dann andere
Strümpfe stopfen oder Kleidungsstücke mit Namen kennzeichnen. wer das nicht konnte, der musste seinen Kameraden
Zigaretten oder Geld geben die das dann für ihn erledigten.
Verschiedene Kameraden gingen nach dem Dienst noch in die Stadt. Um 21:45 Uhr wurde zum Zapfenstreich geblasen, dann
musste man schnell zurück in die Kaserne, weil um 22:00 Uhr der Wachhabende von Bett zu Bett ging und prüfte ob auch
alle anwesend waren. Zwei mal pro Woche fanden Gewaltmärsche statt, mit vollem Gepäck im Tornister. Am Ende der
Marschkolonne fuhr dann ein Pferdewagen, wenn der Feldarzt bei jemandem einen Erschöpfungszustand feststellte, der
durfte dann aufsitzen. Am Sonnabend wurden auf dem großen Exerzierplatz Felddienstübungen durchgeführt, es befand sich
dort ein großer Hügel, den wir immer wieder erstürmen mussten. Am Nachmittag war Revierreinigen angesagt, wir mussten
dann die Tische schrubben, auf einen Tisch wurde Sand mit etwas Wasser gestreut, der nächste Tisch wurde mit der den
Beinen nach oben drauf gelegt und solange hin und her geschoben bis beide sauber waren. Mit den Stühlen geschah das
Gleiche. Dann wurde der Fußboden in der Stube geschrubbt, die Schränke abgewaschen, Staub geputzt, zuletzt kamen Flur
und Treppe dran.
Für die Arbeit war eine Stunde angesetzt, wenn jemand zu früh fertig war erregte er den Argwohn des Diensthabenden
Korporals, der prüfte dann alles genau, fand natürlich immer etwas das nicht seinen Erwartungen entsprach. Der
Übereifrige musste dann Nacharbeiten bis die Stunde um war. Eine Stunde war für Gewehr reinigen und Unterricht an der
Waffe vorgesehen.
Im Februar wurden wir neu eingekleidet; Schnürschuhe, Koppel, alles gelbes Leder mussten wir mit Lederschwärze
behandeln. 2 Wolldecken, Uniform und Helm in feldgrau, da brauchten wir die Knöpfe nicht mehr zu putzen. Die neuen
Gewehre mussten zuerst eingeschossen werden. Es wurden 90 scharfe Patronen und Marschverpflegung ausgegeben, danach
mussten wir mit vollem Gepäck zum Appell antreten. Man konnte kaum gerade stehen, weil der Tornister einen in die Knie
zwang. Der Major, der die Aufstellung besichtigte rief >Brust raus<, dann informierte er uns dass wir ins
Feldrekrutendepot und in Feindesland kommen. Urlaub bekam niemand. Ich habe ein Telegramm nach Hause geschickt, mit
der Nachricht dass wir bald abrücken werden. Einen Tag vor dem ausrücken hat mich meine Mutter noch besucht, sie hat
mir vieles mitgebracht. Alles konnte ich nicht mitnehmen, weil es nicht gestattet war anderes Gepäck bei sich zu haben
als dem Soldaten zustand.
Abmarsch zum Fronteinsatz
Am nächsten Tag hat uns die Regimentskapelle mit Musik zum Bahnhof gebracht. Von Osterode ging
es über Thorn, Posen,
Annaberg, Warschau, Brestlitowsk ins Pruschana-Lager. Das war eine russische Artillerie-Kaserne, in der 2 deutsche,
3 österreichische Bataillone und eine Offiziersschule untergebracht waren. Ein Bataillon das waren wir 18 und 19
jährige, die Anderen waren Männer bis 45 Jahre. Als wir in Osterode abfuhren lag Schnee, in Annaberg/Schlesien waren
die Kühe auf der Weide und im Pruschana-Lager lag der Schnee wieder einen Meter hoch. Drei Kilometer vor unserem vor
unserem Lager war die Bahnfahrt zu Ende. Mit den schweren Tornistern waren viele überfordert, wir mussten immer wieder
warten bis alle nachkamen. Unsere Unterkünfte das waren Baracken die den Russen als Pferdeställe gedient hatten. In
jeder Baracke wurde eine Kompanie mit Schreibstube untergebracht, die nur durch ein Zelt abgegrenzt war.
Wir haben aus Brettern Doppelbetten hergestellt, in jeder Baracke war ein Ziegelofen. Unsere neuen Uniformen und die
scharfe Munition mussten wir abgeben und bekamen dafür alte Bekleidung, sowie Ecksezierpatronen. Hier ging es wieder
Kasernenmäßig zu, das jüngere Bataillon bekam besseres Essen, doppelte Portionen und nach dem Essen 2 Stunden Bettruhe.
Wenn jemand die Bettruhe nicht einhielt und dabei erwischt wurde wusste zur Strafe Holz hacken oder Schnee schaufeln.
Zwei Wochen war Frost bis minus 40 Grad, da hatten wir keinen Unterricht im Freien, alle Aktivitäten fanden in der
Baracke statt, die nur mit nassem Holz beheizt wurde und dem entsprechend war auch die Temperatur im Inneren. Um
Brennmaterial für die Küche zu besorgen mussten wir ins nächste Dorf gehen und von zerfallenen Häusern Holz holen.
Als endlich das Tauwetter einsetzte verwandelte sich die Gegend um Baranowitschi in ein unüberwindbares Sumpfgelände.
Wir wurden mit anderen Einheiten die aus Frankreich zu uns verlegt wurden, zusammengelegt. Wenn jemand nachweisen
konnte dass er Landwirt ist und mehr als 100 Morgen Ackerland besitzt, konnte er einen Urlaub zur Frühjahrsbestellung
beantragen. Ein Gottlieb Piotrowski aus Plohsen hat seinen Urlaub bewilligt bekommen und durfte für 14 Tage nach Hause.
Wenn von der unweit entfernten Front Kanonendonner zuhören war und Alarm ausgerufen wurde, dachten wir es geht los.
Obwohl wir als Reserve aufgestellt waren mussten wir allzeit einsatzbereit sein. Wir haben auch Bunker und Stollen
gebaut, Schützengräben ausgeworfen und mit scharfen Handgranaten exerziert.
Als Gottlieb Piotrowski nach 2 Wochen zurückkam waren wir schon in Alarmbereitschaft und sind dann auch 2 Tage später
ausgerückt. Kamerad Piotrowski hatte mir noch ein großes Paket von zu Hause mitgebracht.
Italien hat Deutschland und Österreich den Krieg erklärt.
Zuerst sind drei Bataillone Österreicher ausgerückt, dann die Deutschen hinterher. Bis zum
Bahnhof Linowa wurden wir von einer Musikkapelle begleitet, dann ging es per Eisenbahn ab nach Baranowitsche. Dort
wurden wir der, an der Westfront aufgeriebenen, 15ten Reserve Division zugeteilt. Es wurde uns gesagt das Kameraden
aus der Heimat gleichen Gruppen zugeordnet werden können. Ich hatte einen Freund aus meinem Dorf, Gustav Spektor,
einen aus Groß Schöndamrau, Wilhelm Lukas und einen aus Ortelsburg, Karl Schlensack, wir kamen zu zusammen in eine
Kompanie. Zuerst waren wir in einem Kinosaal einquartiert, haben jeden Tag Schützengräben ausgehoben und Feldübungen
gemacht. Es war ein sumpfiges Gelände, so dass die Soldaten wegen den vielen Mücken, Netze auf den Köpfen tragen
mussten. Nach einem Gewitter wurde es plötzlich unerträglich. Die Mücken hatten meinen Freund so zerstochen dass sein
Gesicht dermaßen angeschwollen war und ich ihn gar nicht wieder erkannt habe.
Von Baranowitsche wurden wir wieder auf die Eisenbahn verladen, die uns mit unbekanntem Ziel Richtung Osten fuhr.
Nachdem wir unterwegs einmal zum Essenfassen gehalten haben, kamen wir in der Nacht in Krakau an. In der nächsten
Nacht befanden wir uns schon in den Karpaten, wo wir die Hügelketten zu Fuß überqueren mussten, die Fahrzeuge fuhren
um die Berge herum und wir mussten manchmal 2 Stunden warten bis sie uns wieder eingeholt hatten. So ging es immer
weiter bis wir auf einen Berg kamen wo wir Zelte aufgebaut und Biwak bezogen haben. Dort stießen wir auf türkische
Einheiten die auf Mauleseln Munition und Verpflegung über die Berge transportiert haben. Die Esel hatten ein Gestell
auf dem Rücken, auf jeder Seite eine Fass mit Wasser oder Kisten mit Proviant. Ihre Artillerie wurde von 6 Mauleseln
gezogen, während die Offiziere, ohne Sattel, ohne Zaumzeug, nur mit einem Hanfseil ausgerüstet, daher kamen.
Die Mannschaften marschierten wie es jeder für richtig hielt, mit aufgekrempelten Ärmeln, das Gewehr über den Tornister
gelegt, wie die Wilddiebe. Im Gegensatz dazu herrschte bei uns strenge Disziplin, wen jemand aus der Reihe ging kam
sofort der Kompanieführer angeritten, hat uns angeschrieen, uns klar gemacht dass wir keine Türken seien und nur auf
höheren Befehl etwas an der Marschordnung ändern dürften, wer dagegen verstoße, müsste mit einem 3tägigen Arrest
rechnen. Wir haben hinter der der Front Gewaltmärsche durchgeführt die dem Feind große Truppenaufmärsche vortäuschen
sollten.
Wir lagen in einem Buchenwald in Bereitschaft. Überläufer berichteten dass auf russischer Seite eine Großoffensive
vorbereitet wird. In einer Nacht wurde plötzlich Alarm geschlagen, der Russe war zu einem Angriff mit Gasgranaten
übergegangen. Wir lagen unter Zelten und hatten die Gasmasken gar nicht bei uns, sondern nur etwas abseits liegen. In
der Dunkelheit hat mach einer keine Gasmaske mehr gefunden. Es war ein fürchterliches Durcheinander. Dabei war es
unsere Pflicht die Maske immer an dem Tragriemen über dem Hals zu tragen, mit halb geöffnetem Deckel. Uns hat es zum
Glück nicht so stark betroffen weil wir auf einer Anhöhe lagen und die Gaswolken sich im Tal verteilten. Wir wurden in
höchste Alarmbereitschaft versetzt weil der Russe die österreichische Front durchbrochen hatte.
Eigentlich sollten wir noch an einer Gulaschkanone Essen fassen, aber es blieb uns dazu keine Zeit mehr. Der
Kompanieführer befahl uns die Zelte abzubrechen, auf den Tornister aufzurollen und in fünf Minuten marschbereit zu
sein. Die Kanoniere befanden sich schon in der Batteriestellung, luden die Granaten, die sofort abgefeuert wurden. Der
Battalions-Kommandeur versammelte die Kompanieführer und erteilte ihnen die Angriffsbefehle. Derweil sollten wir in
einem Eichenwal der schon mit Granattrichter übersät war, Deckung suchen. Bald hatten wir die Verbindung zu unserem
Batteriestab verloren. Wir warfen unsere Tornister auf einen Haufen, schwärmten unverzüglich, nur mit Sturmgepäck
ausgerüstet, 4 Handgranaten im Brotbeutel, zum Angriff aus. Wir robbten uns einzeln voran. Weil der Russe unsere
Stellungen schon überrannt hatte war jeder auf sich selbst angewiesen. Mann hörte kein Kommando mehr weil der Russe
inzwischen den Rückzug angetreten hatte, um sich auf einer Bergspitze zu verschanzen, von der er uns mit
Flachbahngeschützen beschoss. Irgendwann befanden wir uns in einem Schützengraben, wo ein Leutnant und 17 Mann aus
unserer Division die Stellung hielten. Unter Androhung von Gewalt befahl er uns den Graben sofort zu verlassen und am
Gegenangriff teilzunehmen. Wir sprangen über den Stacheldraht, duckten uns aber sofort im nächsten Graben damit das
mörderische Maschinengewehrfeuer uns nicht hinwegfegte.
Dort blieben wir bis zum Eintritt der Dunkelheit liegen. Wir konnten unsere Waffen nicht mehr einsetzen weil der Sand
die Gewehrschlösser blockiert hatte. Als es Nacht wurde herrschte ein gespenstische Stille. Wir krochen aus dem
Schützengraben und lauschten nach irgendeinem Lebenszeichen von anderen Kameraden. Dann hörten wir irgendwelche Laute
die wir nicht genau zuordnen konnten. Sie kamen aus einem Holzbunker ganz in der Nähe. Wir näherten uns ganz
vorsichtig, als plötzlich eine Schar österreichischer Soldaten herausstürmte. An unseren Stahlhelmen erkannten sie
dass wir Deutsche sind. Bald danach trafen wir auch auf 69 deutsche Soldaten die zu unserer Division gehörten. Dann
kam ein Hauptmann der uns mit Vorwürfen überschüttete, wir seien Feiglinge, wir hätten uns von unserer Einheit entfernt.
Wir haben ihm den Vorgang geschildert, aber ließ nicht mit sich reden und sagte nur dass wir bestraft werden und nichts
zu essen bekommen. Wir wurden einer Maschinengewehr Einheit zugeteilt welche die vorderste Stellung verteidigen
musste. Wir hatten einen Stollen mit 2 Ausgängen.
Die Russen haben bemerkt das sich etwas bewegte und haben uns unverzüglich mit Artilleriefeuer belegt. Schon die
dritte Granate war ein Volltreffer. Vier Kameraden waren sofort tot, ich bekam mit einem Stollenbrett in den Rücken
der sofort blau und grün angelaufen war. Ich schaute nach oben, alles war verschüttet. Ich wusste nicht das da noch
ein Ausgang war, doch die Kameraden die hier in Stellung waren haben mir geholfen das Freie zu erreichen. Ich habe
mich am nächsten Tag krank gemeldet, dachte 2 Tage Schonung zu bekommen, aber der Sanitäter hat mir nur den Rücken mit
Spiritus eingerieben und mich wieder, zurück zu unserer Kompanie geschickt. Sie bestand nur noch aus 3 Gruppen, die in
einem Stollen, der in einen Berg gehauen war, Stellung bezogen hatten. Wir konnten uns hier wenigstens waschen, an
einer Quelle die aus dem Felsen sprudelte. Wir waren nicht mehr einsatzfähig und mussten durch andere Truppenteile
verstärkt werden.
Beim Essen holen musste man auch das Gewehr bei sich haben, es wurde erzählt dass hier der braune Bär herumwandert.
Ich habe keinen gesehen, nur das die Toten ausgescharrt wurden und verstümmelt herumlagen. Nach einigen Wochen haben
die Deutschen eine Gegenoffensive gestartet, von den Bergen herunter, über den Fluss Zlota Lipa, bis zu einer Stadt
die Brzezany hieß. 2 Tage später wurden wir auch eingesetzt, bei großer Hitze ging es in Dauermärschen vorwärts, man
durfte aus den Flüssen kein Wasser trinken, weil es mit Petroleum verseucht war. Nur wenn es dunkel wurde machten wir
halt, dann mussten wir Gräben ausheben um vor Überraschungen sicher zu sein.
Links von uns war Tarnopol und rechts Rumänien. Wenn es nach einer Ruhepause wieder losging dann war es am schlimmsten,
man ging wie auf Nägel, weil die Füße die Strapazen nicht so ohne weiteres wegsteckten. Im Dorf wurde niemals Rast
gemacht, denn da waren immer Brunnen, zu denen alle hinstürmten. Später wurden Melder vorausgeschickt, die von den
Dorfbewohnern Wasser in Eimern am Weg raussetzen ließen, damit die Soldaten Ihren Durst löschen konnten. Ein Soldat hat
gleich den ganzen Eimer mitgenommen und ihn dann als er leer war, irgendwo am Wegrand stehen lassen. Der Kompanieführer
kam angeritten, hat ihn ausgeschimpft und gedroht, ihn mit 3 Tagen Arrest zu bestrafen. Wir gehörten zur Südarmee
welche von Graf Bothmer befehligt wurde.
Die Stellungen waren schlecht ausgebaut, abends mussten wir, von der 2 Kilometer hinter der Front liegenden Feldküche,
Essen und andren Proviant holen. Ich war der Jüngste der Gruppe, musste immer 9 Kochgeschirre tragen, Brot und Post
habe ich in 2 Sandsäcke, die ich über der Schulter hängen hatte, verstaut. Wenn wir unterwegs waren wurde der
Laufgraben immer beschossen. Einmal schlug eine Granate am Schützengrabenrand ein und hat mich halb verschütte, die
Kochgeschirre aus den Händen gerissen, so dass ich ohne Verpflegung im vorderen Graben ankam. Nach drei Wochen sollten
wir abgelöst werden Es hat jeden Tag geregnet, wir haben unsere Mäntel angezogen und uns mit Zelten bedeckt. Nach dem
wir abgelöst wurden kamen wir in ein Dorf dass von Juden bewohnt war. Die Bewohner waren froh dass wir keine Kosaken
waren, mit denen hatten sie vor ein par Tagen schon schlechte Erfahrung gemacht, die hatten ihnen beim Abzug Vieh und
Pferde weggenommen.
Der Boden war sehr fruchtbar, es wurden Hanf, Weizen, Hafer, Mais, Bohnen, Roggen und Kartoffeln angebaut. Die
Bewohner waren gerade mit der Ernte beschäftigt. Die Häuser waren nur aus Holz und Stroh erbaut. Die Leute lebten in
sehr ärmlichen Verhältnissen. Ich hatte mir in unserer Kantine für 20 Pfennig ein Taschenmesser gekauft, das hat mir
ein Bauer für 6 Eier und 2 Pfund Brot abgekauft, daraus hat er sich dann ein Rasiermesser geschliffen. Wenn unser
Versorgungstross auf denn holperigen Wegen nicht nachkam, haben im Dorf auch Verpflegung eingekauft. Die Leute hatten
Angst dass wir nicht bezahlen werden, doch wir bekamen meistens pünktlich unseren Wehrsold ausgezahlt und konnten uns
so manches genehmigen. Um unser Marschgepäck zu erleichtern haben wir so manches aus dem Tornister weg geworfen.
Unweit eines Dorfes wurde halt gemacht, wir sollten Zelte aufschlagen, doch niemand hatte mehr Zeltstöcke im Tornister,
alles war unterwegs liegen geblieben. Der Zugführer befahl uns ins Dorf zugehen und Stöcke zu besorgen. In einer
Scheune stießen wir auf eine Hühnerschar, mit den Stöcken haben wir einige Hühner erlegt, in einem Hanffeld gerupft
und dann im Eiltempo zurück zu unserer Truppe. Als wir ankamen war die Kompanie schon marschbereit, es gleich weiter,
mit dem Huhn im Tornister. Bei der nächsten Rast haben wir die Hühner ausgenommen und Holz besorgt um sie zu kochen,
doch wir mussten schnell wieder weiter marschieren und erst nach 2 Tagen konnten wir uns mit den Hühnern befassen,
leider waren die so alt das sie nicht gar wurden. Das Fleisch mussten wir wegwerfen, nur die Suppe konnten wir noch
gebrauchen.
Meine Verwundung am Pruth.
Wir befanden uns 8 km vor der russischen Grenze. Der Kompanieführer hatte uns informiert das
wir hier zum Einsatz kommen. Wir bekamen noch ein Mittagessen aus der Gulaschkanone, konnten unsere Feldflaschen mit
Tee, der mit Rum angereichert war, auffüllen, Munition und Handgranaten in Empfang nehmen und dann ging es zum Einsatz.
Um 3 Uhr begann das ganze Bataillon auszuschwärmen, sofort hat uns der Russen entdeckt und begann uns mit Artillerie
zu beschießen, je weiter wir vorrückten desto heftiger.
Bis zu einem Eisenbahndamm hatten wir gute Deckung, doch wir sollten den dahinter fließenden Fluss überqueren. Doch
plötzlich explodierte über meinem Kopf eine Schrapnellkugel, der Stahlhelm wurde mir vom Kopf gerissen, Tornister und
Koppel flogen auch weg, ich lag auf der Erde und wusste gar nicht was passiert war. Plötzlich fing Blut aus der
Kreuzbeingegend zu rieseln, aus dem rechten Oberschenkel auch. Gleich nebenan war ein Granattrichter, dort habe ich
Schutz gesucht. In der rechten Rockecke hatte man immer ein großes Verbandspäckchen, das habe ich herausgenommen und
auf die Wunde gedrückt, doch das Blut floss mir bis in den Stiefel. Links und rechts von mir schlugen Granaten ein,
dicke Erdbrocken und Schlamm fielen auf mich herab, doch in meinem Erdloch war ich vor Maschinengewehrsalven geschützt.
Der ganze Rücken war angeschwollen und ich konnte mich überhaupt nicht bewegen.
Die Deutschen mussten die Stellung den Russen überlassen, einer hatte mich entdeckt, da ich aber so blutverschmiert da
lag, hat er bestimmt gemeint ich wäre nicht mehr am leben und ist weitergegangen. Nach zwei Stunden habe ich gehört
das die Russen sich wieder zurückzogen, danach herrschte eine gespenstische Stille. Als es dunkel wurde kamen deutsche
Sanitäter mit Spürhunden und haben die Verwundeten aufgesammelt. Ich wurde auf eine Trage gelegt, lag gebeugt und
konnte mich nicht rühren weil der blutverschmierte Rücken völlig verkrustet war. Ein Pferdegespann konnte nur vier
Tragen befördern, die Fahrt über Ackerfurchen war eine Tortur, ich habe nicht geglaubt das ich es überleben werde. In
einer Dorfkirche wurden wir dann ausgeladen und zu den etwa 50 Verwundeten gelegt die da schon lagen.
Mich haben sie zu den Bauchschüssen gelegt, weil ich einen Nervenschock hatte und am ganzen Körper gezittert habe. Zu
trinken bekam ich nichts, nur einen feuchten Lappen in den Mund. Ich sollte gleich operiert werden, aber es kamen
immer mehr Verwundete, so bekam ich nur eine Tetanusspritze, wurde verbunden und für den Weitertransport ins Hinterland
vorbereitet. Im Morgengrauen wurden wir auf Lastautos verladen, die aus auf ein Landgut brachten, wo wir in einem
Pferdestall untergebracht wurden. Die Fahrer fuhren so schnell über die Granatlöcher, das wir vor Schmerzen geschrieen
haben. Wir baten sie langsamer zu fahren, aber die bekamen es in ihrem Führerhaus nicht mit, erst alt ein Verwundeter,
der einen Krückstock bei sich hatte von hinten die Scheibe einschlug wurde die Fahrt erträglich. Lastautos, die
Munition und Verpflegung an die Front transportiert hatten, brachten in den nächsten Tagen immer wieder Verwundete
ins Hinterland. Die Deutschen hatten an diesem Fronabschnitt hohe Verluste zu beklagen. Wir können von Glück reden
dass wir dem Höllenfeuer überhaupt entkommen sind.
Wir wurden mit Lastautos, die ein Feldlazarett uns geschickt hatte, bis nach Lemberg befördert. da wurden wir gewaschen,
rasiert und frisch verbunden. Auf einem Nebengleis stand ein Lazarettzug, in dem wurden wir anschließend in frisch
bezogenen Betten untergebracht. Der Zug brachte uns über Annaberg nach Freiburg in Sachsen, eine Stunde hinter Dresden.
Hier wurden wir auf Tragen gebettet und mit einem Möbelwagen in ein Reservelazarett transportiert.
Im Heimatlazarett.
Als ich am nächsten Tag aufwachte und das schöne Bett sah in dem ich lag, dachte ich dass ich
im Himmel bin. Ich dankte meinem Herrgott das er mich bis zu diesem Ort begleitet hat. Am Nachmittag kamen Schulkinder
mit Geschenken und haben uns schöne Lieder vorgesungen. Anhand von Röntgenaufnahmen wurde in den nächsten Tagen
festgestellt dass bei mir ein Schrapnellsplitter an der Wirbelsäule in die Kreuzbeingegend eingedrungen war. Ich wurde
jeden Tag in Salzwasser gebadet und bekam wieder volle Verpflegung, da mein Magen zum Glück nicht verletzt war. Auf
dem Transport bekam ich nur Suppe und bei Bedarf einen feuchten Lappen auf die Lippen. Ich bin von 62 auf 43 Kilogramm
abgemagert, gehen konnte ich wegen dem Nervenschock den ich bei der Verwundung erlitten hatte auch noch nicht. Die
Wunde am rechten Oberschenkel war nur ein Streifschuss und wurde mit einem Schutzverband versorgt.
In den nächsten Tagen habe ich einen Brief nach Hause geschrieben und mitgeteilt wo ich mich zurzeit befinde. Meine
Eltern schickten mir ein Paket mit Lebensmitteln, jetzt konnte ich essen was ich wollte. Das Essen im Lazarett war
nicht besonders, jeden Tag nur Kohlblätter. Der weg zu den Toiletten führte durch einen Gemüsegarten. Die gehfähigen
Kameraden haben den ganzen Kohlrabi aufgegessen, so dass schließlich Wachposten aufgestellt werden mussten. Sechs
Wochen lang konnte ich mich nur auf allen Vieren fortbewegen, denn sobald ich mich aufrichtete wurde es mir
schwindelig und ich musste zurück ins Bett.
Als ich wieder bei Kräften war habe ich meinen Eltern mitgeteilt das ich mich in ein Lazarett in ihrer Nähe verlegen
lassen will. Der Chefarzt hatte mir zugesichert, wenn die Möglichkeit besteht in Ortelsburg unterzukommen, wird er dem
zustimmen. Meine Mutter hat daraufhin, in Ortelsburg, beim Lazarettinspektor Zantopf nachgefragt und er hat angedeutet
das sie mich aufnehmen können. Daraufhin bekam ich die Krankenpapiere und einen Fahrschein nach Ortelsburg. Da ich als
Soldat nie Heimaturlaub hatte, beschloss ich zuerst meine Eltern zu besuchen. Ich fühlte mich noch sehr schwach, habe
nach jedem Kilometer Rast gemacht, aber letztendlich war ich wieder daheim bei meinen Eltern. Die Wiedersehensfreude
war sehr groß. Ich bin am 30 Juli verwundet worden und am gleichen Tag wurde mein ältester Bruder beerdigt. Er bekam
den Splitter einer Gasgranate ins rechte Bein und ist an einer Blutvergiftung verstorben.
Am nächsten Tag brachte mich mein Vater ins Garnisonslazarett nach Ortelsburg. Ich wurde jeden Tag gebadet und massiert,
weil die Rückenhaut am Knochen angewachsen war konnte ich mich nicht schmerzfrei bücken. In Ortelsburg verbrachte ich
noch sechs Wochen, bis Ende Oktober, da wurde es schon ziemlich kalt und in unserer Barackenunterkunft ziemlich
ungemütlich. Kohlen und anderes Brennmaterial lagen im Hof auf Halde, aber es war verboten zu heizen. Kameraden die in
der Nähe zu Hause waren konnten Sonntagsurlaub beantragen.
Einer von ihnen brachte von zuhause Brennholz mit und entzündete damit im Ofen ein wärmendes Feuer, andere holten vom
Hof Kohlen, so dass der Ofen in kurzer Zeit glühend heiß wurde und die Gefahr bestand das die Betten Feuer fangen
würden. Wir hatten die Betten schon weg gerückt, da kam der Feldwebel herein und fragte wer das Feuer im Ofen
angezündet hat, doch niemand fühlte sich angesprochen. Der Feldwebel hatte den Vorfall dem Stabsarzt gemeldet, als der
am nächsten Morgen zur Visite kam, war seine erste Frage: ”Wer hat gestern Abend das Feuer im Ofen angezündet”. Als
sich niemand meldete, schrie er uns an: ”Morgen wird alles entlassen, zum Ersatzbatallion, in Diez an der Lahn! Wer
gehen kann, sofort zur Schreibstube, Krankenpapiere und Fahrscheine abholen”. Er erinnerte uns noch daran am nächsten
Tag pünktlich am Bahnhof zu sein, weil eine Verspätung unangenehme Folgen für uns haben würde. Das war das Ende der
schönen Erholungsphase. Ich blieb noch eine Nacht zu Hause und bin dann am nächsten Tag von dort zum Bahnhof gegangen.
Wieder Kriegsverwendungsfähig.
Als wir am nächsten Tag in Diez angekommen waren, wurde ich gefragt ob ich aus dem Heimaturlaub
käme, als ich das verneinte wurden mir 2 Tage genehmigt und 14 Tage Genesungsurlaub dazu. Wieder zurück im
Ersatzbatallion bestand unsere Tätigkeit aus Wache schieben und Kartoffel schälen. Nach einem Monat wurden wir von
einem Generalarzt untersucht, er hat mich für nicht einsatzfähig befunden weil ich noch den Steckschuss im Rücken
hatte und das linke Bein 10 Zentimeter dünner war. Jetzt fing das Kasernenleben wieder von vorne an. Wachdienst,
Gewehr laden, sichern, Ehrenbezeugung, Einzelmarsch und Appell. Wer nicht weit nach Hause hatte bekam zu Weihnachten
Urlaub. Ich hatte zu Heiligabend und Silvester Torwache, denn nach Ostpreußen wurde niemand beurlaubt.
Nach Neujahr 1918 wurden wir neu eingekleidet und kamen nach Köln zur Baukompanie. Mit Musik wurden wir zum Bahnhof
gebracht. In Köln wurden wir noch mit Soldaten die von andern Truppenteilen dorthin verlegt wurden in einem großen
Kinosaal, im Stadtteil Edengarten untergebracht. Wir brauchten keinen Dienst zu machen und konnten zu Heilige Drei
Könige den Gottesdienst im Dom besuchen. Kameraden die aus irgendwelchen Gründen im Arrest saßen wurden gefragt ob sie
auch am Gottesdienst teilnehmen möchten, dann würde ihnen die Strafe erlassen. Fast alle haben dem zugestimmt. Einige
Tage später wurden wir wieder auf einen Transportzug verladen, der uns über Herbestal, Antwerpen nach Brügge in Belgien
brachte. Hier mussten wir den Zug kurzfristig verlassen und einen Luftschutzkeller aufsuchen, weil Fliegeralarm
gemeldet wurde. Danach ging es wieder weiter nach Turut, Kortemark, Hauseme, Kautremollen, Zaren, Zarenlinde. Dort
wurden wir in verschiedene Gruppen aufgeteilt und einer Pionierkompanie auf dem Pionierpark Struwendorf zugewiesen.
Wir haben hinter Klerken Bunker für schwere Maschinengewehre gebaut. Unsere Arbeit konnten wir nur bei Nebel verrichten,
denn bei Sonnenschein waren wir sofort dem Beschuss der feindlichen Artillerie ausgesetzt. eine Kleinbahn die Munition
und Stacheldraht an die Front brachte war dem Beschuss besonders ausgesetzt. Die Gleise, von schweren Geschossen
zerfetzt, mussten immer wieder hergerichtet werden, damit der Nachschub aufrechterhalten werden konnte. Später haben
wir am Kemelberg bei Armentier, eine Brücke über die Lys gebaut. Um in dem Sumpfgelände einen Untergrund dafür zu
schaffen, mussten wir 10 bis 12 Meter lange Pfähle in den Boden rammen. Ein Feldwebel gab immer den Befehl: „Hoch den
Bär, noch viel mehr, dass man sieht, wie er zieht, denn dieser Pfahl, glatt wie ein Aal, durch Fels und Stein, durch
Wasser und Sand, fürs Vaterland”. Jedes mal mussten wir den Bär an Schnüren hochziehen und dann wieder herunterlassen.
Wenn es manchmal, trotz vieler Mühe nicht mehr weiter ging wurde der Pfahl auf eine bestimmte Länge abgeschnitten.
Nach Fertigstellung der Brücke kamen wir in die Siegfriedstellung bei Kambrei, zum Bau eines Bataillons-Gefechtstandes.
Da der Boden kreidehaltig war, mussten wir die großen Stücke von Hand zu Hand reichen, den Schutt haben wir dann mit
Sandsäcken aus der Baugrube gehoben und mit Ästen getarnt, damit der Stand nicht von feindlichen Fliegern entdeckt
werden konnte. Alle acht Stunden wechselte die Arbeitsgruppe. Wir mussten von der Baustelle durch das Gelände robben,
denn aufrecht gehend war man dem Beschuss der feindlichen Scharfschützen ausgesetzt, die von einem Fesselballon aus
informiert wurden der über den feindlichen Linien stand.
Der Wechsel war mit einem großen Risiko verbunden, und wurde wenn Möglich bei Dunkelheit vollzogen. Um vor
Überraschungen sicher zu sein haben wir spanische Reiter (Stacheldrahtverhaue) gebaut und vor die ersten Gräben
gestellt, die dann oft in der Nacht von den Franzosen geklaut, und dann vor ihren eigenen Linien wieder aufbaut wurden.
Wir hatten aus Bohlen eine Brücke auf Rädern gebaut, die dann in den Graben geschoben wurde, damit die Artillerie und
andere Fahrzeuge über die Schützengräben kamen. Weil um vier Uhr morgens der Beschuss mit Gasgranaten begann, mussten
wir Gasmasken aufsetzen, danach haben feindliche Flieger unsere Munitionskolonne bombardiert und total aufgerieben.
Es wurde auch eine Marinedivision eingesetzt, die bis dahin dem Küstenschutz gedient hatte und jetzt ihren ersten
Einsatz hatte.
Wir sind zuerst ein ganzes Stück in Richtung Amiens vorangekommen, doch dann blieb unser Angriff in den zuvor von
Engländern besetzten Stellungen, stecken. Da die Engländer ihre Stellungen fluchtartig verlassen hatten, fiel ihr
ganzer Proviant in unsere Hände; Schokolade, Weißbrot, Flaschenwein. Die erste Nacht haben wir in einem runden Zelt
verbracht, weil ich mir durch den starken Wind, der da herrschte eine Angina zugezogen hatte, die mit hohem Fieber
verbunden war, konnte ich die vielen Köstlichkeiten überhaupt nicht genießen.
An eine ärztliche Versorgung war überhaupt nicht zu denken, denn es mussten zuerst die vielen Granatlöcher eingeebnet
werden damit die vielen Fahrzeuge und Geschütze wieder weiter fahren konnten. Auch eine Bahnlinie musste repariert
werden, damit die großen Geschütze in Stellung gebracht werden konnten, dabei wurden auch die vielen Kriegsgefangenen,
die bei dieser Offensive gemacht wurden, eingesetzt. Als die Offensive dann schließlich scheiterte, wurden wir an die
Somme verlegt. Da habe ich die Ortelsburger Jäger, die aus Italien an die Westfront verlegt wurden, zum ersten Mal im
Einsatz gesehen.
Unser nächster Einsatzort waren dann Stellungen hinter Laon. Hier wurden die Vorbereitungen zu einer neuen Offensive
getroffen. Feindliche Flieger versuchten uns Tag und Nacht daran zu hindern die Aufmarschwege instand zu halten. Als
die Offensive dann endlich losging, hatten wir die Order eine Brücke über die Oise mit Bohlen und Balken zu verstärken.
Gleich am Anfang der Offensive mussten wir Gasmasken anlegen, um für alle Fälle gewappnet zu sein. Nur die Artillerie
und Kraftfahrzeuge durften die Landstraße benutzen, die Infanterie ging immer im Straßengraben und wurde von einer
Seite von Kopf bis Fuß mit Dreck bespritzt. Die Franzosen und Engländer haben hier schon Panzer eingesetzt, die von
Truppen aus den Kolonien gefahren wurden. Die Australier gingen mit umgekrempelten Ärmeln hinter den Panzern her.
Die letzte Offensive des Ersten Weltkrieges.
Zum Jahresende 1917 hatten noch 153 deutsche 175 alliierten Divisionen gegenübergestanden.
Zur Vorbereitung der Offensive ließ Ludendorff 39 Divisionen aus dem Osten und aus Italien heranziehen. Er ließ
spezielle Angriffsdivisionen formieren, die durch intensive Ausbildung auf den beabsichtigten, schnellen Vormarsch
vorbereitet wurden. 6608 Geschütze, 3500 Minenwerfer und 1070 Flugzeuge wurden hinter dem vorgesehenen
Angriffsabschnitt konzentriert. Den Ausbildungsbefehlen Ludendorffs, die bis zu den Kompanieführern herab verteilt
wurden, konnte man entnehmen, dass der Versuch, den Krieg mit einem mächtigen Schlag zu entscheiden schon in der
nächsten Zeit gewagt werden sollte. Wir übten die fast vergessenen Formen des Schützengefechts und des
Bewegungskrieges, auch wurde eifrig mit Gewehr und Maschinengewehr geschossen. Wir hegten keinen Zweifel daran, dass
der große Plan gelingen würde.
Den ganzen Winter 1917/18 über plante der Generalquartiermeister Ludendorff die deutsche Offensive. Zwar hatten die
Vereinigten Staaten von Amerika dem Deutschen Reich am 6. April 1917 den Krieg erklärt, aber vor dem Sommer des
Jahres 1918 war mit dem Auftreten von US-Truppen in relevanter Größenordnung nicht zu rechnen. Der deutschen Führung
blieb nur ein schmales Zeitfenster, um die Niederlage und den zu erwartenden Diktatfrieden abzuwenden. Ypern,
Armentieres, Arras, Cambrai oder Verdun wurden ernsthaft als Schauplätze erwogen. Ludendorf entschied sich für einen
Angriff zwischen Cambrai und La Fere – genau an der Nahtstelle zwischen der Französischen Armee und dem britischen
Expeditionscorps.
Der Fluss Somme bildete die Grenze zwischen Franzosen und Briten. Die Briten – nicht die Franzosen – sollten das Ziel
des Vorstoßes werden. Ihre Stellungen waren nur 130 Kilometer von der Kanalküste entfernt. Beim erreichen der
Sommemündung wäre die gesamte britische Armee eingeschlossen gewesen, denn hinter ihnen lag die Straße von Dover.
Am 21. März 1918 begann die letzte entscheidende Offensive des deutschen Westheeres im Ersten Weltkrieg. Der
Angriffsstreifen war 75 Kilometer breit. Dort hatte Ludendorff 43 Angriffsdivisionen konzentriert, dahinter 30
weitere Reservedivisionen, ihnen standen lediglich 26 britische Divisionen gegenüber. „Michael“ – so der Deckname der
„Kaiserschlacht“ – lief dank Ludendorffs akribischer Vorbereitung gut an. Der britische Oberbefehlshaber General
Douglas Haig erkannte die Chance, welche die Deutschen in dieser Situation hatten. Wollten die Deutschen diese Chance
nutzen, mussten sie darauf verzichten die Somme zu überschreiten, wo sie auf die französischen Reserven treffen und
sich von der Küste entfernen würden. Genau diesen Fehler begingen jedoch die Deutschen.
Am dritten Tag überschritt der linke Flügel mit der 18. Armee die Somme. Ludendorf stellte die Taktik über die
Strategie, wie er das bei Tannenberg und der Schlacht an den Masurischen Seen auch schon getan hatte. Ludendorffs
Befehl an die 18. Armee vom Abend des 22. März 1918 lautete: „Jetzt gilt es den Sieg auszunutzen, den Feind nicht zum
Stehen kommen zu lassen, Somme und Crozat-Kanal zu überschreiten, bevor feindliche Verstärkungen wirksam werden“.
Was Haig befürchtet hatte, trat nicht ein. Die deutsche Offensive Lief weiter Richtung Süden und lief sich schließlich
tot. Am 31 März war Ludendorff zu der Erkenntnis gekommen, dass „Michael“ gescheitert war. Am 5. April wurde die
Einstellung der Offensive befohlen. Im Hochsommer waren die US-Truppen in Frankreich angekommen und gingen mit den
Franzosen zum Angriff vor. Nur mühsam konnten Hindenburg und Ludendorf den Zusammenhalt der Front waren. Am 24. Oktober
1918 forderte US-Präsident Woodrow Wilson die bedingungslose Kapitulation, am 11.Nuvember Wurde der Waffenstillstand
von Compiegne unterzeichnet.
Zusammenbruch der Westfront und Waffenstillstand .
Als die Offensive dann letztendlich gescheitert war, wurden wir auf Eisenbahnwaggon verladen, in
eine Stellung vor Verdun gebracht und der siebenten bayerischen Division zugeteilt. Als wir ausgeladen wurden nahm der
Franzose den Bahnhof unter Beschuss. Eine Granate traf einen Waggon der mit Seifenpulver beladen war, so dass der ganze
Bahnhof aussah als wäre gerade Neuschnee gefallen. Wir gingen auf die Suche nach Kartoffeln. Als ich mit einem Sack,
vollbeladen die Böschung runter ging um zur Feldküche zu gelangen, schlug unweit von mir eine Granate ein und riss mir
den Sack vom Rücken. Ich bin mit dem Schrecken davon gekommen, mir war nichts passiert.
Der Bahnhof war menschenleer, nur ein par Kaninchen liefen verschreckt durch die Gegend und einigen Kameraden gelang
es welche einzufangen. Am nächsten Tag gelang es uns endlich die Feldküche zu erreichen. Als wir gerade beim Essen
fassen waren, schlug unweit eine Granate ein so dass Pflastersteine das Dach durchschlugen und wir das Weite suchen
mussten. und wir wieder nichts zu Essen bekamen. Ein Friseur aus unserer Kompanie fuhr immer ins Hinterland um uns
mit Proviant zu versorgen. Als er 14 Tage vor dem Zusammenbruch wieder mal zurückkam erzählte er uns schon das der
Krieg nicht mehr lange dauern würde, weil Kaiser Wilhelm mit Frack und Zylinder bekleidet, Deutschland verlassen und
ins Ausland gehen würde. In unserer Einheit hatten wir auch einen Juden der glaubte dass er sich alles erlauben darf.
Eines Morgens ging er in die Küche, als er keinen Koch vorfand stieg er auf die Gulaschkanone und hob den Deckel vom
Kessel in dem der Kaffee kochte an. Der kochende Kaffee verbrühte seine Füße so sehr das er sofort ins Lazarett musste,
für ihn war der Krieg somit zuende. Es kam noch ein Erlass, das Kameraden die 2 Jahre aktiv gedient hatten und
Gefreiter waren sofort zum Sergeanten befördert wurden. Für den 11. November 1918 war ein Waffenstillstand vereinbart
und ab 11 Uhr sollte nicht mehr geschossen werden. Wir hatten unsere Kopfkissen aufgetrennt und eine Kissenschlacht
veranstaltet, um auf diese Art und Weise unserer Freude Ausdruck zu verleihen. Als die Federn durch die Luft flogen
brachen wir in Tränen aus.
In jeder Kompanie wurde ein Soldatenrat gewählt, der aus drei Mann bestand. Wenn der Kompanieführer jemanden bestrafen
wollte, musste er erst den Soldatenrat fragen, der die Strafe befürworten, aber auch ablehnen konnte. Die Offiziere
durften keine Achselstücke mehr tragen, was für sie einer Degradierung gleich kam. Wir waren in einem Dorf
einquartiert und morgens zum Appell angetreten, als einer vom Soldatenrat sich stockbesoffen vor den auf dem Pferd
sitzenden Kompanieführer stellte und schrie: „Alles hört auf mein Kommando”. Der Kompaniechef war wie vom Blitz
getroffen, ihm versagte die Stimme. Wir sahen ein das dies nicht so weiter gehen kann und wählten einen neuen
Soldatenrat. Unser Rückzug begann bei Konflanz, einer Vorfestung von Metz und führte uns zunächst über die
luxemburgische Grenze, wo wir in einem Ort einquartiert wurden. Als wir für die Küche Holz aus dem Wald holen gingen,
entschieden wir uns eine Eiche abzusägen, ohne uns dessen bewusst zu sein, in welchem Forst wir uns befanden. Als wir
beim fällen waren fielen plötzlich Schüsse, die wir auch sofort erwiderten, bis uns ein Elsässer der sich in unserer
Kompanie befand aufklärte: „Kameraden, wir befinden uns hier auf Luxemburgischem Hoheitsgebiet”.
Wir sind dann weiter durch das Fürstentum Birkenfeld marschiert, wo das Städtchen Merzig für uns geflaggt hatte. Das
Elsass haben wir auch noch kurz gestreift. Wo wir bei einem Bauern, der uns kein Stroh für das Nachtlager geben wollte,
einquartiert wurden. Daraufhin gingen wir in die Scheune und haben uns selbst was besorgt. Wir haben dann noch erfahren,
sie hätten ein Schwein geschlachtet und warteten auf den Einzug der Franzosen. Als wir uns 1917, an der Ostfront, in
den in Karpaten, im Einsatz befanden, waren unter uns auch viele Elsässer. Sie durften ihre Heimatpost nicht in
französischer Sprache schreiben, mussten ihre Briefe offen auf der Schreibstube abgeben, wo sie zuerst kontrolliert
und dann abgeschickt wurden. Als ich in einer Nacht, mit einem Elsässer auf einem Vorposten Wache schieben musste,
wollte er mich überreden zum Russen überzulaufen. Als ich darauf nicht eingehen wollte verschwand er plötzlich in der
Dunkelheit und ich habe ihn nie wieder gesehen.
Wir sind dann weiter Richtung Worms und Ludwighafen gezogen, dort wurden wir bei einem Mühlenbesitzer einquartiert,
ein Unteroffizier und vier Mann. Obwohl wir verlaust und verdreckt waren bestand die Müllerin darauf das wir in ihren
Betten übernachteten. „Wenn alles durch ist”, sagte sie, „werde ich alles gründlich reinigen”. Der Müller brachte uns
eine Gießkanne voll Wein und sagte wir sollen es uns Schmecken lassen. Wir haben reichlich davon Gebrauch gemacht, so
dass ich gar nicht weiß wie ich ins Bett kam. Das war meine Erinnerung an die Pfalz. Manchmal waren wir auch 2 Tage im
Quartier.
Vor dem Weitemarsch wurde uns immer gesagt welche Truppe die Vorhut und welche Truppe die Nachhut übernehmen sollte.
Die Nachhut hielt immer Verbindung zu den nachrückenden Franzosen und man muss staunen wie alles reibungslos, ohne
Zwischenfälle von statten ging, was wir in erster Linie dem General-Feldmarschall Paul von Hindenburg zu verdanken
haben, der den Rückzug an der Westfront koordiniert hat.
In Köln angekommen, erhielten wir im Volkshaus unsere Entlassungspapiere, Eisenbahnfahrscheine, Reisepässe,
unterschrieben von Oberstleutnant Mann. Wir mussten Köln umgehend verlassen, weil schon am nächsten Tag die
französischen Besatzungstruppen in einmarschieren sollten. Wir fuhren mit einem Zug der bis Allenstein fuhr, dort
wurden unsere Papiere vom Soldatenrat kontrolliert. Die jüngren Jahrgänge wurden festgehalten, zu neuen Einheiten
zusammengestellt und zur Sicherung der Ostgrenze gegen die Bolschewisten abkommandiert. Ich hatte gesagt das ich noch
einen Schrapnellsplitter in der Kreuzbeingegend habe und durfte daraufhin nach Hause fahren.
Kaum in Ortelsburg angekommen fiel ich wieder dem Soldatenrat in die Hände. Sie haben alles durchsucht, haben mir mein
Seitengewehr und eine Decke abgenommen, aber ich durfte weiter und bin dann kurz vor Weihnachten 1918 auf dem
elterlichen Hof angekommen. Schon auf dem Hof habe ich meine Kleider vom Leib gerissen, weil vor Läusen und anderem
Ungeziefer nicht mehr aushalten konnte und mich erst gründlich gewaschen bevor ich das elterliche Haus betreten habe.
Die Freude über das Wiedersehen war sehr groß.
“ Unser Leben zwischen den beiden Weltkriegen.”
Endlich wieder zurück in der Heimat
Rohmanen war durch die Kampfhandlungen 1914/15 zu einem drittel zerstört worden, aber schon
wieder im Aufbau. Die Firma Grzella aus Ortelsburg hatte die Bauarbeiten übernommen. Unter der Aufsicht von Polier
Karl Kontor wurden die Dachstühle errichtet. Ich habe mich, nach kurzer Erholungspause, auch als Zimmermanngehilfe am
Wiederaufbau beteiligt. Die Firma Grzella hat das Material geliefert und auch unsere Löhne gezahlt. Wegen meinem
Steckschuss bin ich dem VDK beigetreten und habe mit dessen Hilfe eine Rente beantragt die mir auch bewilligt wurde.
Nach vier Jahren wurde ich nach Allenstein zur Nachuntersuchung vorgeladen. Die ärztliche Untersuchung hatte ergeben,
das Geschoß sei verkapselt, und nur das linke Bein etwas in Mitleidenschaft gezogen. Daraufhin wurde die Rentenzahlung
eingestellt.
Der Stellmacher Adam Ornowski war im Krieg als Sanitäter eingesetzt und hatte auf Grund seiner Erfahrungen,
 Beziehungen zum medizinischen Dienst in Ortelsburg aufgebaut. Es wurden dort Lehrgänge in Erster Hilfe angeboten,
die von Prof. Dr. Kutz geleitet wurden. Adam Ornowski hat dafür gesorgt das einige junge Männer aus Rohmanen daran
teilnehmen konnten. Adam Ornowski, August Linka, Emil Rosowski, Johann Dembek, Emil Baschek und ich sind dann dem
Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes beigetreten und mussten jeden Sonntag am Lehrgang teilnehmen. Unser
Gruppenführer war Kreisobersekretär Albrecht, Landrat von Poser, als unser Ehrenvorsitzender, hat viel zu unserer
finanziellen Unterstützung beigetragen und hat dafür gesorgt dass die Bereitschaft eingekleidet wurde.
Beziehungen zum medizinischen Dienst in Ortelsburg aufgebaut. Es wurden dort Lehrgänge in Erster Hilfe angeboten,
die von Prof. Dr. Kutz geleitet wurden. Adam Ornowski hat dafür gesorgt das einige junge Männer aus Rohmanen daran
teilnehmen konnten. Adam Ornowski, August Linka, Emil Rosowski, Johann Dembek, Emil Baschek und ich sind dann dem
Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes beigetreten und mussten jeden Sonntag am Lehrgang teilnehmen. Unser
Gruppenführer war Kreisobersekretär Albrecht, Landrat von Poser, als unser Ehrenvorsitzender, hat viel zu unserer
finanziellen Unterstützung beigetragen und hat dafür gesorgt dass die Bereitschaft eingekleidet wurde.
In jedem Dorf wurde eine Unfallstelle eingerichtet, mit einem Verbandskasten und mit Verbandsmaterial für die erste
Hilfe ausgerüstet. Die Unfallstelle in Rohmanen, die am Haus von der Straßenseite, durch eine Tafel mit einem roten
Kreuz gekennzeichnet war, hatte ich zu verantworten. An Sonntagen wurden wir an Badestellen und bei Fußballspielen
eingesetzt, haben viele Übungen bei Waldbränden durchgeführt und auch Ausflüge nach Rudzany am Niedersee gemacht. Bei
der Einweihung des Tannenbergdenkmals in der Nähe von Hohenstein kamen wir an Straßenkreuzungen zum Einsatz.
Rohmanen hatte auch eine freiwillige Feuerwehr. Bis zum ersten Weltkrieg hat Friedrich Biella als Brandmeister das
Kommando gehabt. Er war aktiver Unteroffizier, hatte gute Führungsqualitäten und die Männer, die allesamt aus dem
aktiven Militärdienst stammten hatten zu ihm ein großes Vertrauen. Nach dem Krieg wollten diese Männer,
(Friedrich Nickel, Friedrich Willam, Julius Wittkowski, Jakob Janowski, Johann Gloddek, Gustav Bednarz), nicht mehr
weitermachen. Friedrich Biella, der inzwischen zum Gemeindevorsteher gewählt wurde, hat sich dann auf einer
Gemeinderatsitzung vorgeschlagen, für die Freiwillige Feuerwehr jüngere Kräfte anzuwerben.
Zum Brandmeister hat er Herrn Wilhelm Pilath vorgeschlagen. Der wurde dann nach Königsberg zur Fortbildung geschickt.
Der Feuerwehr gehörten nun folgende Personen an: Wilhelm Pilath(Brandmeister), August Linka(Stellvertreter), Gustav
Deptolla, Julius Matzey, Johann Dembek, Willy Willam, Gustav Rattay. Der Kreisbrandmeister war Heinrich Thalmann aus
Ortelsburg, sein Stellvertreter war Kreisobersekretär Salzmann. Der Bezirks-Kommissar bei der Ostpreußischen
Feuersozität War Herr Ernst Trzaska. Er hat dafür gesorgt das die Wehr uniformiert und mit Löschgeräten ausgerüstet
wurde. Da die alten Schläuche schon sehr marode waren, wurden sie durch moderne ersetzt, deren Kupplungen auch mit der
Motorspritze übereinstimmten.
Ernst Trzaska hat bei der Feuersozität und beim Landratsamt Finanzmittel beantragt und auch genehmigt bekommen. Der
Schneidermeister Wilhelm Baran wurde beauftragt Tuch und Drillichanzüge nach Maas zu schneidern. Er hat uns
Stoffmuster vorgelegt aus denen wir wählen sollten. Feuerwehrhelme haben wir auch bekommen. Die Gemeinde musste
Finanzmittel bereitstellen, einen Prozentsatz vom Gemeindebudget. Im Brandfall mussten für den Spritzenwagen Pferde
zur Verfügung stehen, von Willy Willam, Gustav Rattay, Julius Matzey und Gustav Dorka, weil sie in der Nähe des
Spritzenhauses wohnten. Am Spritzenhaus wurde ein großer Baum mit Querleisten aufgestellt, wo nach jedem Brand oder
einer größeren Übung die Schläuche zum trocknen aufgehängt wurden.
Der Kreisbrandmeister hat mindestens 2-3-mal im Jahr die Wehren besichtigt. Das ganze Dorf war dann auf den Beinen,
die Bauern mit Pferden, und andere Dorfbewohner mit Eimern und Spaten, wurden dann in verschiedene Gruppen eingeteilt.
Erst hat die Wehr sämtliche Aufstellungen am Gerät geübt; Grundstellung Fahrstellung und Marschstellung. Dann wurde
ein Brand angekündigt, die Feuerwehr mit der Spritze an den Brunnen, die Gruppen dort wohin sie beordert wurden, die
Bauern brachten mit den Wasserkiwen Wasser aus dem Brunnen zum Brandort. Wenn das Wasser im Brunnen alle wurde hat
man den Saugkorb in die Kiewen gelegt und dort Wasser entnommen. Die Wassergruppe ging mit Eimern zum Dorfteich, holte
Wasser und füllte damit die leeren Kiewen.
Der Löschtrupp ging mit Feuerhaken und Löschpatschen auf die umliegenden Gehöfte und versuchte das vermeintliche Feuer
von ihnen fernzuhalten. Nach dem Alarm wurde wieder am Spritzenhaus angetreten. Die Gruppenführer mussten angeben ob
ihre Gruppe auch vollständig erschienen war, denn Übungen wurden nur vor, oder nach der Feldarbeit durchgeführt, so
dass niemand eine Entschuldigung vorbringen konnte. Wer ohne begründete Entschuldigung nicht anwesend war erhielt eine
Verwarnung. Der Kreisbrandmeister erklärte dann welche Handgriffe den Vorschriften entsprachen und welche nicht. Die
Schläuche wurden noch schnell zum Trocknen aufgehängt. Anschließend gingen wir alle in den Gasthof Trzaska, haben über
vorhandene Mängel diskutiert, Verbesserungsvorschläge unterbreitet und zwischendurch den Durst gelöscht. Der
Kreisbrandmeister ist dann, nach einer kurzen Verabschiedung, ins nächste Dorf gefahren, weil er an einem Tag mehrere
Feuerwehren betreuen musste.
Der Rohmaner Dorffriedhof

Einen Kilometer vom Ende des Dorfes entfernt, auf der rechten Seite der Landstraße in Richtung
Ortelsburg, befand sich der Rohmaner Dorffriedhof. Wann dieser Friedhof angelegt wurde entzieht sich meiner Kenntnis.
Nach Aussagen älterer Dorfbewohner soll davor auch schon eine Ruhestätte vorhanden gewesen sein, und
zwar auf der linken Straßenseite gegenüber dem jetzigen Friedhof. An dieser Stelle befand sich bis in die
Nachkriegszeit ein kleiner Brunnen, aus dem die Dorfbewohner, das Wasser zum begießen der Grabbepflanzung auf den
Gräbern ihrer verstorbenen Angehörigen holten. Der Friedhof war in einer Hanglage angelegt, wahrscheinlich weil diese
Parzelle für eine landwirtschaftliche Nutzung nicht geeignet war. Um das Gräberfeld vor herumstreunenden Tieren oder
von der Weide entlaufenen Kühen zu schützen, hat man das ganze Gelände mit einem Holzzaun umgeben. Der Zugang befand
sich von der Straßenseite. Unter einem Torbogen hindurch wurden die Verstorbenen zu Grabe getragen. Die Gräber der
einzelnen Familien waren nebeneinander angelegt, mache, wie zum Beispiel die der Familie Trzaska, sogar mit einem
schmiedeeisernen Zaun eingefasst.
Nach dem 2. Weltkrieg verfiel der Friedhof immer mehr. Die nötigen Finanzmittel für die Pflege der Einfriedung konnten
von den restlichen noch verbliebenen Deutschen nicht mehr aufgebracht werden. An den gepflegten Gräbern konnte man noch
erkennen dass es Verwandte von noch in Rohmanen wohnenden Deutschen waren, oder von bereits im Westen Deutschlands
lebenden, die ihre noch in Rohmanen wohnenden Nachbarn damit beauftragt hatten. Die übrigen Gräber wurden von Jahr zu
Jahr immer mehr von Wildkräutern überwuchert und schließlich auch von Sträuchern und schnell wachsenden Bäumen.
In den späteren Jahren konnte man nicht mehr erkennen dass dort vor Jahren Tote zur letzten Ruhe gebettet wurden. Die
Natur holte sich das ganze Gelände zurück und nur unter großen Schwierigkeiten konnten Besucher aus dem Westen das
Friedhofsgelände noch betreten.
Das Gasthaus Trzaska

Nach dem ersten Weltkrieg hat der Gastwirt Friedrich Trzaska neben dem Gasthof einen großen Saal
für Festlichkeiten und Vereinsfeiern gebaut, in dem schon mal Feuerwehrfeste veranstaltet wurden. Ernst Trzaska war
Feuerkommissar bei der Ostpreußischen Feuersozität. Erich Trzaska war Vollziehungsbeamter beim Amtsgericht in
Ortelsburg. Unser Feuerkommissar war uns beim organisieren der Veranstaltungen sehr behilflich, hat uns den Saal, die
Musik und die Theaterstücke besorgt und die Feuerwehren aus den Nachbardörfern eingeladen.
Zu Manöverzeiten, vor dem 2. Weltkrieg und dann auch während des Krieges, waren im Gasthof Soldaten, meist im Range
eines Offiziers, einquartiert. Fräulein Mariechen Trzaska hat die Poststelle im Dorf betreut. Nachdem ich 1939 zum
Militär eingezogen wurde, hat sie, nach einer Schulung im Ortelsburger Krankenhaus, auch die Unfallmeldestelle
übernommen. Nach dem Krieg, pflegte sie mit vielen Bekannten, die bereits in der Bundesrepublik wohnten, einen regen
Briefwechsel. Auf dem Rohmaner Friedhof hat sie viele Gräber, im Auftrag von Angehörigen, die auf Grund ihrer
Abwesenheit, dazu nicht mehr in der Lage waren, gepflegt. Der Bauunternehmer Kurnitzki aus Ortelsburg, äußerte die
Bitte, sie möchte ihm doch ein Blatt vom Rosenstrauch, der auf dem Grab seiner Eltern steht, in den Brief legen. Als
sie uns den Brief vorgelesen hat, waren wir zu Tränen Gerührt. Sie hat als Letzte aus ihrer Familie, bis zu ihrem Tod
im Jahre 1960, in Rohmanen, im Gebäude der Gastwirtschaft gewohnt und ist auf dem Rohmaner Friedhof beerdigt worden.
Fleisch und Wurstwaren Karl Pelkowski
Im Jahr 1931 hat der Fleischermeister Karl Pelkowski, aus Grammen, direkt neben unserem Hof ein
Anwesen gekauft und dort eine Fleischerei eingerichtet. Er war mit meiner Schwester Frieda, verheiratet. Am Anfang hat
er die Schweine noch auf seinem Hof geschlachtet, später dann im Ortelsburger Schlachthof. Jede Woche fuhr er 2-mal,
mit dem Pferdewagen(Einspänner), nach Ortelsburg zum Wochenmarkt, wo er seine Fleisch und Wurstwaren zu Verkauf anbot.
Am Tag davor, wenn er die Wurst gekocht hat, kamen viele Rohmaner mit Kannen oder anderen Gefäßen, wegen der guten
Wurstsuppe, die er umsonst unter die Leute verteilte. Als Karl Pelkowski, Ende August 1939 zum Militär eingezogen
wurde, hat seine Frau das Pferd verkauft und den Beitrieb stillgelegt. Am Haus hing, immer noch die Tafel mit der
Aufschrift: Karl Pelkowski, Fleisch und Wurstwaren. Ein Witzbold hat irgendwann darunter geschrieben; „Fleisch und
Wurst waren einmal”, drauf hin hat Frau Pelkowski die Tafel entfernen lassen. Karl Pelkowski ist im Mai 1946 in
französischer Gefangenschaft verstorben. Seine Ehefrau Frieda, verstarb an ihrem 85. Geburtstag in Mettmann bei
Düsseldorf.
Die steinreichen Rohmaner Felder
Die letzte Eiszeit hat bei der Schmelze, auf der Rohmaner Feldgemarkung viele Steine und
Granitblöcke zurück gelassen. Überirdisch, aber besonders unter der Erde, gab es viele kleine, aber auch große Steine,
die, den Bauern, beim Pflügen und anderen Feldarbeiten sehr viel Schweiß, abverlangten. In einer Kiesgrube, auf dem
Feld des Bauern August Radek, lag ein Granitblock, von schätzungsweise 100 cbm. Vor etwa 80 Jahren, als man für diese
Steine noch keine Verwendung hatte, griffen die Bauern zu einer „List”. Weil er sonst nicht pflügen konnte, hat mancher
seinem Nachbarn, die Steine in der Nacht auf dessen Feld abgeladen. Als diese Tätigkeit unter Strafe gestellt wurde,
hat man die Steine in Schluchten gekippt und mit Mutterboden zugeschüttet. In späteren Jahren kam diese jedoch beim
pflügen wieder an die Oberfläche. Dann hat man aber schon Steine für den Straßenbau gebraucht und konnte sie so zu Geld
machen. Besonders im Raum südlich von Ortelsburg, bis zur polnischen Grenze, wo Steine eine Rarität waren, kamen sie
jetzt zum Einsatz. Auch beim Bau von Häusern, besonders für die Fundamente, wurden sie eingesetzt, weil auf diese
Weise viel Ziegeln eingespart wurden. Die Firma Gribienski aus Ortelsburg hat die großen Steine mit Dynamit gesprengt
und auf diese Weise die weitere Verarbeitung erleichtert.
Die Steine welche beim Pflügen aus dem Boden geholt wurden, hat man am Feldrand auf große Haufen zusammen getragen.
Wenn die Feldarbeit beendet war, sowie auch in den Wintermonaten, waren wir jeden Tag mit Steinen unterwegs. Wir sind
vorwiegend am Abend los gefahren, weil unter der schweren Last die Wagenachsen so heiß wurden und die Gefahr bestand,
das durch die Dehnung, die Räder blockiert würden. Bei einer Fahrt konnte man bis zu 24 Reichsmark verdienen, wogegen
1 Zentner Roggen für 8 bis 9 Reichsmark zu haben war. Ich bin selbst, mit dem Pferdewagen bis Fürstenwalde, Radostowen,
Luka, Altkirchen, Höhenwerder, ja sogar bis Friedrichshof gefahren.
In Rohmanen wurden auch rote Ziegeln gebrannt. Viele Häuser wurden, mit Ziegeln erbaut, die nur wenige 100 Meter von
der Baustelle entfernt hergestellt wurden. Der Lehn wurde auf den Feldern in der näheren Umgebung entnommen, dann von
Ochsen solange getreten, bis er so geschmeidig war, das er sich in Formen einstreichen ließ. Wenn die Ziegel in der
Form trocken war, wurde sie entnommen und in einem Brennofen gestapelt. Um einen Ofen richtig anzufeuern, brauchte man
12 Raummeter Holz, das im Zeitraum von ein par Tagen verheizt wurde. Der Fischer Karl Glitza hatte schon eine
Knetmaschine, die von einem Pferd angetrieben wurde, das mit verbundenen Augen, den ganzen Tag in die Runde ging.
Im Dorf waren auch vier Kalköfen, in denen so genannte Kalksteine, die sich an gewissen Stellen, im Erdboden befanden,
gebrannt wurden. Nach dem Brennen wurden die Steine mit Wasser abgelöscht und die daraus entstandne Masse diente, nach
dem Beimischen einer gewissen Menge Sand, dann als Bindemittel beim Häuserbau. Das Gerichtsgebäude und das
Lehrerseminar in Ortelsburg wurden mit Kalk, aus dem Rohmaner Brennöfen erbaut. Auch zum Bau einer Eisenbahnbrücke, auf
der, der Zug, den Sawitzfluß, von Ortelsburg nach Allenstein überquerte, hat mein Großvater, mit einem Ochsengespann,
Kalk gefahren.
Hinter der Scheune, beim Bauern Johann Dembek hat man Tonerde gefördert, aus der man mit Hilfe einer Formerscheibe,
die von einem Arbeiter mit Muskelkraft(Fußbetrieb) angetrieben wurde, schöne Krüge, Schalen und Vasen geformt hat.
Die Töpferware wurde, nachdem sie trocken genug war, auch in einem Ofen gebrannt, anschließend mit einer Lasur
überzogen und wieder gebrannt. Es wurden auch Kacheln zum Bau von Kachelöfen hergestellt, die mit verschiedenen
Ornamenten versehen, die Wohnstuben unserer Vorfahren schmückten. So haben unsere Großväter ihr Leben gemeistert und
nach und nach, unsere Dörfer aus der Rückständigkeit in die Neuzeit geführt.
Das gesellschaftliche Leben nach dem 1. Weltkrieg

Als der Lehrer Alfred Dorka, ein Frontkämpfer des Ersten Weltkrieges und ein Sportsmann, als
zweite Lehrkraft an der Rohmaner Schule angestellt wurde, hat er die Sitten und Gebräuche aus früherer Zeit wieder zum
Leben erweckt. Zuerst hat er die Jugend zusammen gerufen, einen Jugendverein und einen Fußballclub, gegründet. Zum
Vorsitzenden des Fußballclubs wurde Johann Gloddek berufen, der ihn auch geleitet hat. Bauer Wilhelm Spittka, der am
Rohmaner See wohnte, stellte Land für einen Sportplatz unentgeltlich zur Verfügung. Lehrer Alfred Dorka hat am
Rohmaner See eine Badestelle ausgesucht und ein Sprungbrett bauen lassen. An jedem Sonnabend im Sommer, bevor die
Sonne unterging, versammelte sich die gestammte Jugend des Dorfes an der Badestelle am See. Es wurde gebadet,
Heimatlieder gesungen, gespielt, im Fackelschein eines großen Biwakfeuers, bis in die späte Nacht hinein. Der Fischer
Karl Glitza hat uns Kähne zur Verfügung gestellt, mit denen wir auf den See hinausgepaddelt sind, dabei hatten wir viel
Spaß, was wiederum den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft gefördert hat. Ich habe mit meiner Mandoline den Gesang von
Volks- und Heimatliedern begleitet.
Der Rohmaner See liegt in einem Tal, dessen Hänge zu beiden Seiten mit Kiefern und Tannen bewaldet sind. Wenn man
gesungen oder Musiziert hat, hallte es von den Hängen zurück. Die Ufer waren mit Kalmus und Schilf bewachsen, was für
die Fischaufzucht von Vorteil war. Wenn man an einem sonnigen, windstillen Tag, am Seeufer spazieren ging, traf man
oft auf Flachstellen, an denen sich die Fischbrut im Sonnenlicht wärmte, wie ein Mückenschwarm. Im See befanden sich
folgende Fische: Karpfen, Hechte, Schleie, Barsche Plötze, Rotaugen, Aale und Krebse. Am Sonntagmorgen brachten viele
Rohmaner ihre Pferde zum See um sie zu baden.
Es wurden dort, unter der Aufsicht von Lehrer Dorka, auch viele Jugendfeste mit Theatervorführungen veranstaltet, zu
denen er selbst die Vorlagen organisiert hat. Der am See wohnende Bauer Johann Nadrowski, hat uns ein Scheunentor, als
Tanzboden zur Verfügung gestellt. Der Zimmermann Wilhelm Wittek hat uns eine Windmühle gebaut, die am auf dem Boden
liegenden Scheunentor aufgestellt wurde, dazu kamen Noch Tannen und Fichten, die das Ganze wie ein Bühnenbild
erscheinen ließen. Es wunden viele Bühnenstücke aufgeführt, unter anderen >Alte Weiber werden jung gemahlen<. Dazu bot
die Windmühle die entsprechende Kulisse.
Nach der Vorführung wurde der Boden aufgeräumt, um dann als Tanzdiele zur Verfügung zu stehen. Der Gastwirt Trzaska
hatte Tische und Bänke aufgestellt, Speisen und Getränke angeboten, so dass sich die die Veranstaltung bis in die
späte Nacht hinein zog. Es waren auch Leute aus Ortelsburg und anderen Nachbardörfern dabei. Im Winter hat Lehrer
Dorka eine Kreisrodelbahn eingerichtet, die von Zeit zu Zeit mit Wasser besprengt wurde, um die Gleitfähigkeit zu
verbessern. Von einer Anhöhe ging hinunter bis auf den halben See, was für alle ein großes Vergnügen war. Es kamen
Lehrer mit Schulklassen aus der näheren Umgebung um hier zu Rodeln.
Als Herr Lehrer Jobski als Hauptlehrer nach Rohmanen kam hat er mit dem Bürgermeister und der Gemeindeverwaltung
beschlossen, in der Nähe des Dorfes, auf einem zur Schule gehörenden Grundstück, einen Sportplatz anzulegen. Dafür
wurde gleich hinter den Gärten, 6 Morgen Ackerland abgetrennt, und nach Feierabend hat Lehrer Dorka mit den
Jugendlichen eingeebnet und gleich nebenan einen Graben für Schützenstand und Kugelfang ausgehoben. Am Sonntagvormittag
wurde Fußball gespielt und um 15:00 Uhr war Kleinkalieberschießen angesagt. Es musste auch ein kleiner Beitrag erhoben
werden, um Munition kaufen zu können. Eine Büchse konnten wir aus beim Kleinkalieberverein in Ortelsburg ausleihen.
Nach Hitlers Machtergreifung
Als Adolf Hitler an die Macht kam wurde die SA gegründet. Der Bürgermeister Michael Kownatzki
wurde zum Gruppenführer ernannt und folgende Männer haben sich freiwillig gemeldet: Wilhelm Matzey, Johann Gloddek,
Gustav Nadrowski, August Buttler, Karl Baran, Emil Nickel, Wilhelm Jaschinski, Emil Bork, Ernst Rattay und Gustav Bach.
Bei Versammlungen war die SA in Uniform angetreten um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Wer versucht hat Unruhe zu
stiften, egal aus welchem Grunde, wurde aufgefordert den Saal zu verlassen, andernfalls wurde er mit Gewalt entfernt.
Herr Lehrer Jobski wurde zum politischen Leiter ernannt, seine Frau hat die NS-Frauenschaft gegründet, Lehrer Dorka
die HJ, und so bekam die Dorfgemeinschaft, nach und nach ein anderes Gesicht. Der Sportplatz und der Schützenstand
wurden jetzt mehr als früher in den Mittelpunkt gestellt. Nach der Feldarbeit hat der Bürgermeister Fuhrwerke bestellt
und den Sportplatz noch besser herrichten lassen.
Der Bauer Wilhelm Both wurde zum Ortsbauernführer ernannt, mit der Aufgabe alles Land für den Anbau von Getreide und
Futtermittel bereitzustellen, oder wenn das nicht möglich war mit Wald aufzuforsten. Durch den Einsatz von Kunstdüngern
sollten größere Erträge aus dem Boden geholt werden, um den Viehbestand zu vergrößern und mehr Milch und Butter zu
produzieren. Deutschland sollte im Stande sein sich selbst zu selbst zu ernähren, ohne auf Importe angewiesen zu sein.
Frau Jobski hat, innerhalb der der NS-Frauenschaft, mit Hilfe von Fachkräften aus Ortelsburg, Lehrgänge veranstaltet,
auf denen man Backen und Nähen lernte. Auf den Bauernhöfen befand sich auch immer mehr Rassegeflügel, das eine erhöhte
Produktion von Eiern und Geflügelfleisch sicherstellen sollte.
Die Rohmaner Bauern hatten, außer in der Landwirtschaft, noch andere Verdienstmöglichkeiten in der Kreisstadt. In
Ortelsburg wurden vier Sägewerke betrieben, die mit Langholz aus dem Walde versorgt werden mussten. Wir haben eine
Kiefer von über 8 Festmeter angefahren, der wir zuerst 6 Meter Spitze abschneiden mussten, um diese Last überhaupt
auf den Wagen zu bekommen. Sechs Pferde musste angespannt werden um den Wagen zur befestigten Straße zu bringen.
Fichten und Tannen wuchsen bis zu einer Länge von 30 Metern. Auch beim Transport von Ziegel, von der Ziegelei zum
Bahnhof, konnte man gutes Geld verdienen.
Im Jahr 1934 wurde Rohmanen an das überregionale Stromnetz angeschlossen und schaffte auf diese Weise den Sprung von
der Petroleumlampe zur Glühbirne. Neben dem Grundstück von Karl Pietzonka wurde ein Transformatorhäuschen errichtet,
in dem der ankommende Strom von einer Hochspannung auf eine Verbrauchsspannung transformiert wurde. Es gab schon eine
Überlandleitung, die aus Richtung Ortelsburg kommend, quer über die Felder, in Richtung Neu Keykuth weiter ging.
Durch eine Zwischenspanne wurde der Transformator, mit der Hauptleitung auf Kownatzkis Feld verbunden.
Ein Stromanschluss konnte die Arbeit im Haus und Hof auf vielfältige Weise erleichtern, doch nur die besser gestellten
Bauern, sowie noch manche Pensionäre, die ein festes Einkommen hatten, konnten sich dass leisten. Weil nur wenige an
der Elektrifizierung teilnahmen, war ein Stromanschluss mit hohen Kosten verbunden. Nur Gustav Pietzonka, Gasthof
Trzaska, Friedrich Nickel, die Schule und Wilhelm Both, wurden in der ersten Phase erfasst.
Im Jahr 1952 wurde von den polnischen Behörden die zweite Stufe der Elektrifizierung eingeleitet, in der alle im Dorf
stehen Gebäude erfasst wurden. Am Anfang wurden nur Leitungen für Lichtstrom gelegt und auch nur 3 Lichtstellen pro
Haushalt bewilligt. Doch im nachfolgenden Zeitraum wurden dann, wenn Material vorhanden war, weitere Lichtpunkte
angelegt. 1952, am zweiten Wochenende im Advent, wurden dann die Leitungen geschaltet und alle waren von der
plötzlichen Helligkeit sehr begeistert. Wenn man Glühbirnen auswechseln wollte musste man am Anfang weite Wege
zurücklegen, um welche zu bekommen. In den 60ger Jahren wurden dann immer mehr Starkstromleitungen gelegt, weil die
Bauern elektrische Geräte kaufen konnten. Ende der 60ger wurden auch die Abbauten an das Stromnetz angeschlossen.
Das Urnengrab auf unserem Feld
Auf unserem Feld, in Richtung Seelonken, bin ich oft beim pflügen gegen Steine gestoßen, manchmal
rissen sogar die Stränge am Pferdegeschirr. Eines Tages nahm ich einen Spaten, Brechstange und einen langen Baum, um
der Sache auf den Grund zu gehen. Als ich eine Menge Sand ausgehoben hatte stieß ich auf eine steile, aus Steinen
errichtete Wand, die ich auch mit dem Baum nicht aus der Fassung bringen konnte. Ich habe den ganzen Vormittag gegraben,
konnte jedoch nicht unter die Steine kommen. Einige Tage später hatten wir in der Schule eine Bauernversammlung, da
habe ich Herrn Biella und Herrn Lehrer Dorka von meinem Fund berichtet. Am nächsten Morgen kam der Lehrer Dorka mit der
ganzen Schulklasse, mit Spaten und Sieben ausgerüstet auf unser Feld und fingen an die ausgehobene Erde zu sieben.
Lehrer Dorka benachrichtigte daraufhin den Leiter des Ortelsburger Heimatmuseums, der am nächsten Morgen vorbei kam um
sich die Fundstelle genau anzusehen. Er beauftragte ihn 4 Mann zu besorgen, um die Steine ringsum frei zu schaufeln.
Zwischen den Steinen durften wir die Erde nur mit Esslöffeln ausheben. Als es plötzlich zu regnen anfing hat Lehrer
Dorka die Brauerei Daum, in Ortelsburg angerufen, die uns über der Fundstelle ein Zelt errichtet haben, damit wir
ungestört weiterarbeiten konnten. Wir fanden 8 flache und 8 hohe Urnen zu beiden Seiten am Körper. Die Urnen wurden in
Gipsbinden eingewickelt und ins Heimatmuseum nach Ortelsburg gebracht, wo sie durch einen Fachmann, der extra aus einem
Königsberger Museum angereist war. Nach Reinigung der Urnen hat er festgestellt, das die Grabstätte etwa 2000 Jahre vor
Christi Geburt angelegt wurde und ein Doppelgrab war, in dem ein Toter liegend und einer in Hochstellung beigesetzt
wurde.
Die Nachricht von der Fundstelle verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Es erschienen viele Schaulustige, ganze
Schulklassen aus der Umgebung, mit Autos und zu Fuß. Durch die vielen Menschen wurden die bestellten Ackerflächen auf
unserem Feld sehr in Mitleidenschaft gezogen, eine Entschädigung haben wir nicht erhalten. Das Grab wurde vor dem
Heimatmuseum in Ortelsburg wieder so aufgebaut wie man es auf unserem Feld vorgefunden hat. Für den Transport der
Steine wurde ich entlohnt. Die Urnen hat das Königsberger Museum an sich genommen und wollte sie nicht wieder hergeben,
weil die solch einen Fund noch nicht in ihrer Sammlung hatten.
Sonnenwendfeuer
Am 24 Juni fand eine Sonnenwendfeier statt. Ein Brauch der an die alten Germanen erinnern sollte.
Der Lehrer Dorka hat den Bürgermeister beauftragt 2 Fuhrwerke in den Wald zu schicken, die Holz und alten Reisig holen
und auf dem großen Schulberg abladen sollten. Das Straßenbauamt hat uns Teertonnen zur Verfügung gestellt. Die ganze
Dorfgemeinschaft wurde eingeladen, am Abend, nach der Feldarbeit, an der Sonnenwendfeier teilzunehmen. Lehrer Dorka
hielt zuerst eine Ansprache, in der er anschaulich erklärte wie unsere Vorfahren in grauer Vorzeit gefeiert haben.
Nach dem offiziellen Teil wurden das Holz und die Teertonnen angezündet, es wurden Heimatlieder gesungen, wie: Wild
flutet der See, drauf schaukelt der Schiffer den schwankenden Kahn, Schaum wälzt er wie Schnee, von grausiger Mitte
zum Ufer heran, wild fluten die Wellen auf Vaterlands See, wie schön, oh trag mich auf Spiegel zu Hügel, Masovias See.
Masovia Land, mein Heimatland, Masovia es lebe mein Vaterland.
Lehrer Alfred Dorka und sein Wirken für Rohmanen.

Friedrich Biella hatte auf seinem Feld einen Granitstein mit einer geraden Seite, den haben wir
mit viel Schweiß an den Dorfteich transportiert und auf einer Erhöhung abgelegt. Der Stein sollte zum Denkmahl für die
Gefallenen des Ersten Weltkrieges umgestaltet werden. Da zu Wenige daran ein Interesse zeigten, wurde diese Idee fallen
gelassen und der Stein irgendwann ins Wasser gerollt. Der Lehrer Dorka war viele Jahre in Rohmanen tätig, dort hat er
später seine ehemalige Schülerin, Lotte Biella geheiratet. Er hat sich sehr für die Entwicklung des Dorfes interessiert,
war bei jeder Gemeindeversammlung anwesend und hat auf Schwachstellen hingewiesen die den Fortschritt behinderten.
Gemeinsam mit den Schülern hat er den Ehrenfriedhof für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges gepflegt, an der
Wegegablung nach Eichtal und zu Ehren des Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg eine Eiche gepflanzt.
Zum Advent hat Lehrer Dorka mit der Jugend einen Adventstern, in verschiedenen Farben gebastelt.
Der Stern wurde auf einer 2 Meter langen Stange befestigt, in der Mitte wurde ein Wachslicht angezündet, am Stern
wurde eine Schnur angebracht, wenn man daran zog rollte der Stern hin und her. Am ersten Wochenende im Advent
versammelten sich jung und alt, um den Stern durch das Dorf zu tragen. Alle schlossen sich dem vorausgehenden
Sternträger an, der den Stern durch die Hauptstraße und die angrenzenden Wege trug. Dieser Sternmarsch wurde an den
folgenden Adventwochenenden wiederholt.
Am ersten Weihnachtfeiertag wurde um 4:00 Uhr morgens ein Frühgottesdienst gehalten. Zuerst hat der Pfarrer eine
Andacht gehalten, dann haben die Kinder ein Krippenspiel aufgeführt und die Gemeinde hat schöne Weihnachtslieder
gesungen. Der Gastwirt Trzaska hat uns den Saal zur Verfügung gestellt. Wir hatten eine Posaunen- u. eine
Gitarrengruppe. Unter der Leitung von Herrn Willi Doormann spielten: Gottlieb Brosch, Fritz Ollech,
Gustav Rattay(Sopran), Wilhelm Pilath, Gustav Brosch(Alt), Fritz Both(Tenor) und Fritz Brosch(Bass).
In der Gitarrengruppe wirkten mit: Martha Ollech, Hedwig Ollech, Martha Lekzik, Martha Michalick und Auguste Lekzick.
Willy Doormann hat sie auf der Geige begleitet.
Kurz vor Ausbruch des 2. Weltkrieges
Bei der Aufstellung des Grenzschutzes(Regiment Buchholz), hat er als Hauptfeldwebel die
Gruppenführerkurse überwacht und selbst die fähigsten Männer dafür vorgeschlagen. Das Ausbildungspersonal hat das
Jäger-Battalion gestellt. Wir kamen zuerst ins Stadion(Waldheim), wurden da eingekleidet und dann ging es gleich
kasernenmäßig zu, theoretisch und praktisch. Jeder musste vor die Front treten und nachweisen ob er im Stande ist,
Befehle zu erteilen. Abends wurden Filme vorgeführt die uns zeigen sollten wie eine Gruppe sich im Gelände entfalten
muss. Die Exerziervorschriften hatten sich, im Verhältnis zu Kaiser Wilhelms Zeiten, etwas geändert. Damals bestand
eine Gruppe aus 8 Mann und einem Unteroffizier, jetzt aus 10 Schützen, 3 für das leichte Maschinengewehr und einem
Unteroffizier(13 Mann). Nach der Schulung folgte eine Abschlussprüfung, danach ein gemütliches Beisammensein. Aus
Rohmanen haben folgende Männer die Prüfung bestanden: Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy, Gustav Rattay und
Gustav Deptolla. Unsere Uniformen waren alle zu klein und es gab viel zu lachen bei der Anprobe.
Die erste Übung habe ich mit Emil Rosowski, in Lenzinen gemacht. Der Gutsbesitzer Marzinzick hat seine Scheune als
Unterkunft zur Verfügung gestellt. Er war im Range eines Hauptfeldwebels. In seinem haus war die Schreibstube
untergebracht, die er selbst verwaltete. Ein Lastauto hatte Uniformen aus der Kaserne in Ortelsburg geholt, jeder
musste eine Uniform anlegen und dann wurde solange getauscht bis alle eine passende gefunden hatten. An den Namen des
Kompanieführers kann ich mich nicht mehr erinnern. 1935 wurden wir zu einer Übung in die Dragonerkaserne nach Lyk
einberufen. Die Gruppenführer, Zugführer, und Kompanieführer die schon Frontberührung im dem Ersten Weltkrieg hatten,
mussten eine Woche früher anreisen. Die Übungen waren auf 6 Wochen angelegt. Die meisten der einberufenen waren noch
nie mit dem Wehrdienst in Berührung gekommen. Jeder Gruppenführer bekam 13 Mann zugeteilt.
Unser Zugführer war Leutnant Neumann, Kompanieführer Oberleutnant Rutschko, Battalions-Kommandeur Major Gröning
(Regiment Buchholz). Hier ging es wieder Kasernenmäßig voran. Das Bataillon wurde hier vereidigt. Jeden zweiten
Sonntag durften unsere Frauen uns besuchen. Ein Jahr später wurden wir wieder zu einer Übung einberufen, auf den
Truppenübungsplatz nach Arys. Jeder Gruppenführer hatte den Auftrag die Gruppe zu entfalten, und auf bewegliche
Figuren zu schießen. Diese Übung musste später mit scharfer Munition wiederholt werden. Jedes Maschinengewehr bekam
50 Schuss, jeder Schütze 20 Schuss zugeteilt. Nach dem Abschießen wurden die Treffer gezählt und dem Kommandierenden
Bericht erstattet. In einiger Entfernung spaziert ein Storch umher, der gar nicht bemerkt hatte dass geschossen wurde,
was bei den Kameraden ein großes Gelächter hervorrief.
Nach der Übung wurde uns gesagt das jeder Gruppenführer eine arische Abstammung nachweisen sollte. Ich konnte in den
Rheinsweiner Kirchenbüchern meine Vorfahren aus Gellen, bis zum Jahr 1732 zurück, nachweisen und wurde zum
Unteroffizier befördert. Aus unserem Dorf wurden auch, Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy und Gustav Deptolla
befördert. Zwischendurch mussten wir schon mal in die Radfahrer-Kaserne nach Ortelsburg, Gewehre empfangen und im
Gelände üben. Am 31 Juli 1939 wurde mir von einem Soldaten ein Schreiben übereicht, das mich aufforderte, am 1. August
um 6:00 Uhr, bei der 3. Kompanie, des 2. Infanterieregiments zu erscheinen.
Um 5:30 hat mich meine Schwester in die Kaserne gebracht. Auf der Schreibstube erklärte mir der Hauptfeldwebel,
dass mir ab sofort der Dienstgrad eines Sanitäters zugewiesen wird, ich mich in der Kammer einzukleiden hätte und mir
in der Handwerkerstube die entsprechenden Schulterklappen annähen lassen sollte. Die aktiven Sanitäter wurden den
Feldlazaretten zugewiesen und wir kamen an ihre Stelle. Unser Bataillon wurde nach Schodmak zum Bunker bauen und
Stacheldraht verlegen eingeteilt. Wir zogen in Begleitung einer Musikkapelle bis zur Kreuzung am Krankenhaus, dann
weiter zu unserem Bestimmungsort, gefolgt von einer Gulaschkanone die in den nächsten Tagen für unsere Verpflegung
sorgen sollte.
Am 14 August haben wir die Jägerkaserne, begleitet von einer Musikkapelle endgültig verlassen und zogen zuerst durch
Ortelsburg, dann über Lehmanen ins Feldmanöver, hinter Rohmanen. Dort entfaltete sich das Bataillon im Gelände, die
Verwundetensammelstelle wurde auf dem Hof des Bauern Friedrich Neumann eingerichtet. Gegen Abend wurde zu Sammeln
geblasen und Biwak bezogen, wobei unsere 3.Kompanie, in einem kleinen Wallt, in der Nähe von Otto Nickels Gehöft
Stellung bezogen hatte. Die 2. und 4. Kompanie hatte sich in der Nähe vom Abbau Pallasch niedergelassen. Die Frau
Nickel hat am Abend ein Mädel in Dorf geschickt um meiner Frau Bescheid zu sagen, wo wir uns zurzeit befinden. Meine
Frau ist dann noch gekommen um sich von mir zu verabschieden, weil wir am nächsten Morgen um 3:00 Uhr Zelte abbrechen
und um 4:00 Uhr in Richtung Kaspersguth marschieren sollten.
Wir sind dann über Achodden, Seelonken, Lehmanen, Ortelsburg, bis nach Grammen und Schützendorf marschiert, wo wir an
einem See Biwak bezogen haben. Es wurde immer gesagt, wir kommen zum Tannenberg-Denkmal bei Hohenstein, wo ein Reichs
Kriegervereinsfest stattfinden sollte. Es wurden auch schon Vorkommandos aufgestellt, doch dann kamen wir nach Orlau
und Lahna-Mühle, da wo die Alle entspringt haben wir 2 Tage biwakiert. Unser Kompanieführer hat uns nach Waplitz auf
den Soldatenfriedhof des Ersten Weltkrieges geführt und uns erklärt wie das Jägerbataillon sich 1914 hier entfaltet
hat und aufgerieben wurde. Dann mussten wir in der Nähe von Gut Koslau über einen Fluss und bezogen in einem Waldstück,
vorbereitete Stellungen in der Nähe der polnischen Grenze. Herr und Frau Thalmann haben uns jeden Tag, bis zur Grenze,
mit Brötchen und Getränken versorgt. Es wurde scharfe Munition ausgegeben, weil wir am nächsten Morgen um 4:00 Uhr die
polnische Grenze überschreiten sollten.
Am nächsten Morgen um 10 Minuten vor 4:00 Uhr kam der Befehl; scharfe Munition abgeben, alles zurück in ein 6 Kilometer
entferntes Dorf, wo wir auch einquartiert wurden. Das alles geschah’ eine Woche vor dem 1. September 1939. Es wurde
gesagt dass der Führer dem polnischen Präsidenten Rid-Szmigly, ein Ultimatum gestellt hat und es wahrscheinlich nicht
zum Krieg mit Polen kommt. Genau nach 5 Tagen kehrten wir wieder in die gleichen Stellungen zurück, es wurde wieder
scharfe Munition ausgegeben und am nächsten Morgen um 4:00 Uhr überschritten wir die polnische Grenze.
“Der 2. Weltkrieg.”
Der erste Einsatz in Polen
Wir kamen zuerst in ein Dorf in dem sich nur alte Menschen befanden. Auf unsere Frage wo denn die Bewohner wären sagte
man uns dass alle geflohen sind, weil erzählt wurde, die Deutschen würden alle Polen misshandeln und verstümmeln. Ich
habe ihnen daraufhin gesagt dass uns, unter Androhung von Strafe verboten wurde, einem Zivilisten etwas anzutun. Das
Vieh, die Schweine und Hunde des Dorfes liefen frei herum und die Soldaten fingen an auf die Hunde zu schießen, bis
gesagt wurde es seien Meldehunde im Dienste der Deutschen Wehrmacht und dieser Unfug der eigenen Truppe schaden würde,
weil etwaige Querschläger eigene Kameraden verletzen könnten. Wir gingen weiter auf polnischer Seite entlang der Grenze,
bis wir am Nachmittag die ersten Vorposten der Festung Mlawa erreichten, da befanden wir uns plötzlich im Feuerhagel
polnischer Festungsflack.
Am nächsten Morgen hatte ich schon 3 Verwundete und wusste nicht wo sich eine Verwundeten Sammelstelle befindet. Ich
suchte den Bataillonsgefechtstand auf der sich auf einer Anhöhe befand. Ich habe unseren Oberstabsarzt gefragt wo denn
die Verwundetensammelstelle wäre. Er rief beim Tross an, wo er die Auskunft erhielt, das sich vor dem Dorf ein Bunker
befindet in dem man die Verwundeten sammeln sollte, die dann von Sanitätsautos abgeholt würden, weil das Dorf unter
Artilleriebeschuss stand. Am Sonnabend haben unsere Flieger die Bunkerstellungen bombardiert, konnten aber, trotz guter
Treffer nicht viel ausrichten, die Bunker wurden nur etwas angekratzt.
Der Beschuss unserer vordersten Linien ging mit unverminderter Heftigkeit weiter. Am Sonntag verkündete eine große
Staubwolke die Ankunft unserer Panzer, doch sie kamen nur bis zur Panzersperre und mussten wieder abdrehen ohne den
Polen einen schaden zuzufügen. Ein Panzer bekam einen Volltreffer, der Fahrer konnte noch umkehren. Er blutete am Kopf
und der Schütze war so eingeklemmt, das wir ihn nur mit einem Seil unter den Armen, durch die Luke nach oben ziehen
konnten. Ob er seine Verwundung überlebt hat ist mir nicht bekannt, denn in der Nacht wurden Panzergeschütze nach
vorne in Stellung gebracht, die direkt in die Schießscharten der Bunker geschossen und so die Verteidiger vertrieben
haben. Daraufhin sind wir weiter vorgerückt. Auf einer Wiese war ein tiefer Graben ausgehoben und mit Ästen getarnt,
da war ein Panzer hinein gefahren, so dass nur das Hinterteil herausragte und er sich nicht aus eigner Kraft befreien
konnte. In der Luft waren Flieger die Brandbomben abwarfen, ich habe mich auf den Boden geworfen weil ich dachte die
würden explodieren, aber sie zischten nur, so das Stoppeln und Graß rings herum in Brand gerieten.
Bei den Kampfhandlungen gab es mehrere Verwundete, denen ich gerade Verbände anlegen wollte, als unser Hauptmann zur
Trillerpfeife griff um mir klar zu machen, dass ich ihm folgen sollte. Die Polen fingen an zu schreien, ich sollte
sie ins Lazarett bringen denn hier im Wald würde sie niemand finden. Ich setzte mich aufs Fahrrad und folgte unserem
Kompanieführer, der mir sagte ich soll immer bei der kämpfenden Truppe bleiben, denn hinter der Front sind die
Sanitätsabteilungen, die werden die Verwundeten schon versorgen. Der Vormarsch dauerte bis in die späte Nacht. Auf
einem Gehöft, das nach allen Seiten durch Feldwachen abgesichert wurde, machten wir endlich Rast. Wir haben
Getreidegarben auf dem Hof ausgebreitet und uns zur Ruhe gelegt, als plötzlich um Mitternacht Leuchtraketen den Himmel
erhellten und Maschinengewehrfeuer uns aus dem Schlaf schreckte. Ein par polnische Soldaten hatten das Feuer eröffnet,
aber sich kurz darauf ergeben.
Die Narew-Überquerung
Als es hell wurde ging der Vormarsch weiter. Es wurde uns untersagt Tagebuch zu führen, darum
weiß ich nicht wie die Orte hießen, durch die wir marschiert sind. Als wir durch ein sumpfiges Gelände vor drangen
stand auf einer Anhöhe am Horizont, die polnische Artillerie, die uns sofort unter Beschuss nahm. Unser Hauptmann war
der Meinung dass wir schon in der Nähe des Flusses Narew sein müssten, als aus den Sträuchern ein mit Schlauchboten
beladenes Lastauto auftauchte. Wir wurden aufgefordert mit je 6 Mann ein Schlauchboot zu nehmen, an einem Aggregat
der daneben stand mit Luft zu füllen und zu Wasser zu lassen. In einer Stunde war das ganze Bataillon über die Narew,
wo der Vormarsch fortgesetzt wurde. In einem Dorf überraschte uns die polnische Kavallerie und fing sofort mit
Maschinengewehren zu schießen an. Da kam der Befehl: Alles wieder zurück. Es ging noch schneller als auf der Hinfahrt.
Wir sind erst einige Kilometer am Fluss entlang gegangen und haben dann zum zweiten Mal rüber gesetzt.
Die Gehöfte im Dorf standen alle in Brand. Auf einem waren viele Bienestöcke. 2 Kameraden wollten den Stöcken Waben
entnehmen, doch die Bienen durch das Feuer aufgeschreckt, überfielen sie sofort und stachen derart zu das sie nicht
mehr wieder zu erkennen waren. Ich habe die Einstichstellen mit Salmiak betupft, mehr konnte ich nicht tun. Wir mussten
auf unserem Vormarsch durch einen Wald der in Flammen stand, so dass man kaum atmen konnte. Es ging weiter in Richtung
Minsk und Warschau, wo schon die Sowjetische Armee durchgegangen war, die Pferde und Vieh von einem Gut mitgenommen
hatten. In einem Wald stießen wir unverhofft auf ein Kloster, in dem wir einige Gefangene machten. Dann trafen wir auf
eine gute Straße die nach Grochow ging.
Als wir dort einmarschierten wurden wir aus den oberen Stockwerken beschossen, so dass wir, um uns zu schützen, nur an
den Hauswänden entlang gehen konnten. Wir haben jedes Haus nach Feinden durchsucht. Vor einem Haus stand ein Hund der
niemanden reinlassen wollte, solange bis ihn eine Kugel traf. Die polnische Artillerie feuerte von Warschau aus, um
unseren Vormarsch zu stoppen. Wir hatten uns gerade eingegraben als plötzlich deutsche Flieger am Himmel erschienen,
die unsere Stellungen mit Bomben bewarfen und dabei viel Unheil anrichteten. Wir haben sofort Fliegertücher
ausgebreitet und Leuchtraketen abgeschossen. Da ich in dem Graben, den ich kurz zuvor ausgehoben hatte, sofort in
Deckung gegangen bin ist mir zum Glück nichts passiert. Unter den anderen Kameraden gab es viele Verwundete, so dass
ich nicht wusste wem ich zuerst helfen sollte.
Der Oberstabsarzt hat mich sofort tatkräftig unterstützt, so das bald alle Verwundeten versorgt waren, außer einem,
dem ein Bombensplitter den Arm abgerissen hat. Ich habe im 3 große Verbandspäckchen auf die Wunde gelegt, doch die
Blutung ließ sich trotzdem nicht stoppen, so dass er eine Stunde später auf der Krankensammelstelle verstarb. Wir
haben danach in einem Tomatenfeld einen Graben ausgehoben und eine neue Abwehrstellung bezogen. Die Gruppe Schwarz
bekam den Auftrag nach etwaigen versprengten polnischen Verbänden Ausschau zu halten, als sie unerwartet aus einer
Häuserreihe mit Maschinengewehrsalven überschüttet wurden. Der Gruppenführer und noch ein Soldat wurden dabei tödlich
verwundet. Danach wurde noch ein weiter Stoßtrupp, unter der Führung von Leutnant Briskorn, der sich dazu freiwillig
gemeldet hatte, hinaus geschickt um den Gruppenführer und den anderen Toten zu bergen.
Bei diesem Unternehmen, das erfolglos ausging, weil die Toten schon verscharrt waren, durchschlug eine Kugel den
Stahlhelm von Leutnant Briskorn, der auch sofort tot war. Alle Toten wurden später, an der Kirchenmauer in Grochow, in
Särgen beigesetzt: Hauptmann Schönwald sagte, das sie nach dem Kriege auf den Heldenfriedhof nach Ortelsburg überführt
werden. Drei Tage lagen wir bei Grochow in Stellungen, waren dem polnischen Maschinengewehrfeuer sowie den Bomben
deutscher Flugzeuge ausgesetzt. In der Nacht musste ich zu einem Verwundeten in die vorderste Linie und habe den
Rückweg nicht mehr finden können, als plötzlich Gewehrfeuer aufflammte habe ich in den Ruinen Schutz gesucht. Erst im
Morgengrauen konnte ich mich wieder orientieren und zu meinem Unterstand zurückfinden.
Warschau wurde tagelang bombardiert und stand auch unter Artilleriebeschuss. Aus dunklen Rauchwolken kamen oft ganze
Bündel von Papier angeflogen. Die Verwundeten kamen oft auf Krücken zu unserem Unterstand, ich habe sie dann zur
Krankensammelstelle hingeführt. Wir haben auch polnische Zivilpersonen betreut, die während der Kampfhandlungen
verwundet wurden. Als einmal 2 Jungen vorbeiliefen hat einer ihnen nachgerufen sie sollten seiner Frau Bescheid sagen,
er wäre auf der Krankensammelstelle an der Kirche. Als wir dort ankamen war seine Frau, mit einem Kind auf dem Arm,
schon da.
Nach der Kapitulation von Warschau, gingen wir über Sokolow zum Bug und haben dort Quartier bezogen. Der Russe hatte
sich bereits hinter den Fluss zurückgezogen, hatte alles Vieh und Pferde mitgenommen. Dort erreichte mich ein Telegramm
von zu Hause, dass meine Tochter gestorben ist. Es sprach sich auch herum dass verschiedene Heimaturlaub bekommen haben,
ich durfte auch für 14 Tage heim. Wir fuhren mit Lastautos nach Allenstein in die neue Reiterkaserne, zum
Ersatzbatallion, da haben wir unsere Gewehre und Munition abgeben, dann durften wir, jeder in seinen Heimatort
weiterfahren.
Als wir unsere Quartiere am Bug verlassen haben war sehr viel Schnee gefallen. Hier in Ortelsburg fanden wir die
gleiche Wetterlage vor, aber nach 3 Tagen war alles wieder weggetaut und wir konnten die Kartoffelernte, die durch den
frühen Wintereinbruch gestoppt wurde, zu Ende bringen. Ein Tag bevor ich zu Hause angekommen bin wurde die Tochter
beerdigt. Nach 14 Tagen mussten wir uns in Allenstein melden, Gewehre empfangen und wieder zurück zur Division an den
Bug 150 Kilometer hinter Warschau. Die elfte Division, zu der wir auch gehörten sollte in den Westen Deutschlands
verlegt werden und war schon unterwegs zur Verladestation Skiernewice 50 Kilometer vor Warschau.
Mein Dienst als Sanitätsunteroffizier
Unser Bataillon kam in das Städtchen Burscheid, im Kreis Opladen, wo wir in Privatquartieren
untergebracht wurden. Nach 3 Monaten, im Januar 1940, wurden wir nach Solingen verlegt, wo wir bis zum
Frankreichfeldzug stationiert waren. Wir mussten an Feldübungen teilnehmen, wie andere die in Kasernen untergebracht
waren. Während dieser Zeit musste jeder seine Zähne in Ordnung bringen lassen. Jeden Tag fuhren 20 Mann in die
Cäzilienstraße nach Köln, zur Zahnklinik. Im Rheinland wurde unsere Division neu aufgestellt. Ausfälle durch den
Polenfeldzug wurden durch neue Soldaten ergänzt. Ich kam nun zum Ersatzbatallion, war der Älteste in der ganzen
Kompanie. Als der Frankreichfeldzug losging wurde unser Ersatzbatallion mit den noch vorhandenen Verwundeten, in die
neue Reiterkaserne, nach Allenstein verlegt.
Meine Frau hat, mit Unterstützung der Bauernschaft, einen Antrag gestellt, daraufhin wurde ich zur Frühjahrsbestellung,
beurlaubt und später bis auf weiteres vom Militärdienst freigestellt. Als der Russlandfeldzug losging wurde ich von der
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg, für 14 Tage einberufen. Ich war seit 1922, Mitglied der freiwilligen
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg und habe jedes Jahr an Übungen teilgenommen. Jede Bereitschaft musste etliche Leute
stellen. Von Rohmanen wurden Emil Rosowski, Johann Dembek, und ich, zur Krankensammelstelle Wirballen, in Litauen,
abkommandiert. Dorthin kamen Lazarettzüge aus Russland mit der Breitspurbahn. Die Verwundeten wurden frisch verbunden
und auf Waggon mit Normalspur verladen und nach Deutschland gebracht.
Als die 14 Tage vergangen waren wollten wir wieder nach Haus zurück, doch man wollte uns nicht entlassen. Stattdessen
wurden wir dem Wehrkreisamt Königsberg zugeteilt, neu eingekleidet und zur Aushilfe ins Lazarett nach Gumbinnen
abkommandiert. Mehr als ein Jahr war ich in den Urlauber-Baracken, habe dort Krankenstube betreut. Später, bis zum
Dezember 1944, war ich im Reserve-Lazarett 4, in Königsberg tätig. Dort habe ich auch die Luftangriffe der Engländer,
vom 25 bis 26. August 1944 miterlebt.
Wir sollten gerade einen Lazarettzug in Rotenstein entladen, als plötzlich die Sirenen ertönten - Fliegeralarm. Im
gleichen Moment waren die ersten Flugzeuge auch schon da, zuerst warfen sie „Tannenbäume” und danach Foßforkanister ab.
Die Omnibusse standen schon zur Abfahrt bereit als es losging. Wir haben die Verwundeten schnell in den
Luftschutzkeller getragen, haben die Betten von den Fenstern weggerückt damit die Verwundeten nicht von den
Glasssplittern verletzt wurden. Im Kasernenhof brannten die Fosforkanister lichterloh. Unsere Unterkunft, die sich in
einer Baracke befand ist völlig abgebrannt, mit dem Wenigen was wir unser Eigen nannten. Am nächsten Tag wurden wir neu
eingekleidet und am 29. bis 30. kamen die englischen Bomber wieder, sie setzten genau da ihr Zerstörungswerk fort wo
sie vor 3 Tagen aufgehört hatten.
Anfang Dezember 1944 musste ich mich nach Stablack melden und musste dann zur Sanitätsabteilung 1, nach Gernau, das
liegt zwischen Lodz und Warschau. Vormittags hatten wir Felddienstübungen und nachmittags theoretischen Unterricht.
Jeden Tag wurden Gruppen zusammengestellt und zu anderen Einheiten abkommandiert. Ich kam zu einer Panzerabteilung, wo
wir an einem Morgen plötzlich auf dem Kasernenhof antreten mussten und zu unserer Überraschung mit der Nachricht
konfrontiert wurden, dass der Russe an mehreren Frontabschnitten durchgebrochen war. Wir bekamen sofort einen
Marschbefehl in Richtung Lodz, wo das Stadtbild noch intakt war, selbst die Straßenbahnen fuhren noch. In der Nacht
haben russische Flugzeuge die Stadt bombardiert. Die Kaserne in der wir untergebracht waren hatte keine
Luftschutzkeller, aber zum Glück blieben wir von Bombentreffern verschont. Am nächsten morgen bot sich uns ein Bild der
Verwüstung. Die entgleisten Straßenbahnwagen, sowie andere Fahrzeuge blockierten die Straßen. Die Älteren unter uns
bekamen Fahrscheine für einen Transportzug, der bereit hinter Lodz abfahrbereit, unter Dampf stehen sollte. Als
russische Panzer in den Straßen auftauchten, verbrannte die Schreibstube unsere Wehrpässe und andere wichtige
Dokumente. Wir liefen zu der Station auf der unser Transportzug bereitstehen sollte, aber da war kein Zug mehr zu sehen
und wir setzten unseren Rückzug zu Fuß fort.
Der Rückzug und Zusammenbruch der Ostfront
In Dobroschin, einer Stadt in Polen, wurde gerade ein Lazarettzug verladen, doch wir kamen nicht
mehr zum Einsatz, weil die russische Infanterie uns schon auf den Fersen war. Es ging weiter über den Fluss Bober,
Sagan, bis nach Glogau an der Oder. Dort wurden wir der 29. motorisierten Sanitätskompanie zugeteilt. Im
Garnisonslazarett wurden noch Operationen durchgeführt. Unsere Division hatte ihr eigenes Feldlazarett, so dass wir den
Befehl zu Weiterfahrt erhielten und noch unbeschadet die Oderbrücke passieren konnten, denn Glogau wurde zur Festung
erklärt. Wir haben 2 Pferdewagen organisiert und mit Verbänden, sowie medizinischen Instrumenten beladen. So kamen wir
bis nach Lübbenau im Spreewald, wo wir in einem Schloss, in zuvor ein Museum war, unser Lazarett untergebracht haben.
Weil die Amerikaner Cottbus bombardiert hatten, wurden die Verwundeten zu uns nach Lübbenau gebracht. Hier haben wir
Tag und Nacht gearbeitet, um die vielen Verwundeten, aus den schweren Kämpfen bei Grünberg und Sagan zu versorgen. Die
Soldaten von der Abwehrfront kamen schon mit abgestorbenen Armen oder Beinen bei uns an, weil in vorderster Linie keine
Frontlazarette mehr vorhanden waren; es mussten viele Amputationen durchgeführt werden. Als für unsere Pferde kein Heu
mehr vorhanden war, schickte mich unser Hauptfeldwebel, zu einem Bauern in den Spreewald, mit dem Auftrag, Futter zu
besorgen. Mit noch zwei Mann fuhren mit zwei Kähnen, zuerst den Hauptstrom entlang und dann in einen Nebenarm; da haben
wir die Boote beladen und brachten das Heu nach Lübbenau.
Als wir uns bei unser Einheit zurück melden wollten, war alles schon marschbereit. Ich bin schnell in einen Bus
eingestiegen der sofort losfuhr, weil russische Verbände schon in sichtweite waren. Russische Flugzeuge kreisten über
den Dächern und nahmen, mit ihren Bordwaffen jeden unter Beschuss, der sich irgendwo blicken ließ. Wir konnten nur
durch den Wald, oder in der Nacht vorwärts kommen, denn wenn ein Auto auf der Landstraße fuhr, war alsbald ein Flugzeug
hinter ihm her und schoss es in Brand. Als wir nach Tagen am Ufer der Elbe ankamen, war bereits eine Ponton-Brücke
erstellt worden, welche die zerstörte Brücke ersetzen sollte.
Durch die vielen Fahrzeuge waren in den Sand tiefe Spuren gefahren, so dass andere Fahrzeuge unsere Busse ins
Schlepptau nehmen mussten, weil wir mit eigener Kraft nicht mehr weiterkamen. Beiderseits der Trasse standen
Flüchtlingswagen, in der der Hoffnung die Brücke passieren zu können, doch SS-Polizei verhinderte das die Gespanne den
militärischen Rückzug zum Stillstand brachten. Es gelang uns die Elbe zu überqueren, um in einem Waldstück Schutz vor
feindlichen Fliegern zu suchen.
Als wir unsere Busse und Autos gut getarnt hatten, hat unser Bataillonschef die anwesenden Parteigrößen zu sich
gerufen und ihnen erklärt das wir eine Einheit des Roten Kreuzes sind und nach internationalem Recht keine Waffen
besitzen dürfen. Nach langer, erregter Diskussion wurde beschlossen einen Graben auszuheben und alles im Sand zu
verscharren. Als wir dann weiter, durch die Dörfer fuhren, sahen wir schon viele weiße Bettlaken, als Zeichen der
Kapitulation, aus den Fenstern hängen. Es wurde uns erzählt dass der Bürgermeister von der SS erschossen wurde, weil
er die Bevölkerung zu diesem Schritt ermutigt hatte. Jetzt waren hinter uns die Russen und vor uns schon die Amerikaner.
Amerikanische Panzer fuhren umher und schossen wild durch die Gegend, ohne ein Ziel anzuvisieren. Niemand wollte sich
dem Russen ergeben, doch der Weg der zu den Amerikanern führte, war durch abgesägte Bäume blockiert. Wir sind schnell
in das nächste Dorf gegangen, haben uns Sägen und Äxte besorgt, die Bäume durchgesägt und in den Straßengraben
geworfen.
“ Nach dem Ende des 2. Weltkrieges.”
In amerikanische Kriegsgefangenschaft
Dann fuhren wir unter internationaler Flagge an eine Mulde Brücke, vor der zwei amerikanische Soldaten, mit Zigarren,
zur Hälfte im Mund, standen. Sie rauchten und kauten gleichzeitig. Wir mussten auf einen freien Platz fahren, alle
aussteigen und rechts wieder antreten. Wäschebeutel und Tornister mussten wir abstellen; danach wurden wir nach Waffen
durchsucht, Wertsachen, Uhren und Messer wurden uns gleich abgenommen. Als wir anschließend an unserem Gepäck
vorbeigingen durfte niemand was mitnehmen. Als ich gebückt, nach meinem Wäschebeutel greifen wollte, in dem sich noch
3 Konservendosen und ein Brot befanden, bekam ich einen Fußtritt ins Gesicht, so dass mir ein Zahn ausgeschlagen wurde.
Wir wurden dann in einem Garten zusammen getrieben und gefragt ob jemand bei der SS gedient hat. Nachdem wir in Reihe
und Glied angetreten waren, mussten wir den Oberkörper freimachen und die Arme anheben. Es wurde nach SS-Zeichen
gesucht, die gewöhnlich unter dem Oberarm eintätowiert waren. Nachdem wir Grimma bei Leipzig, wo wir in amerikanische
Gefangenschaft geraten waren, verlassen hatten, mussten wir durch ganz Thüringen bis Hersfeld, an der Grenze zu Hessen,
marschieren. In Hersfeld wurden wir auf große Lastautos verladen, die von farbigen Soldaten gefahren wurden. Man hat
uns mit Stöcken hinauf getrieben, solange bis das Auto so voll war das man kaum stehen konnte. Die Soldaten fuhren, für
diese Straßenverhältnisse, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Wenn die Straße eine scharfe Kurve hatte, flogen
wir alle übereinander und mussten erst mit viel Kraftanstrengung auf die Beine kommen um diese Fahrt zu überstehen.
Da die Straßenränder in dieser Gegend mit Obstbäumen bepflanzt sind und deren Äste sehr niedrig hängen, hätten die
uns die Köpfe abgerissen, wenn wir uns nicht ständig geduckt hätten. Unsere Fahrt endete in Bad Kreuznach, in der Pfalz,
wo wir in ein Lager, in dem sich später 130.000 Mann und 6 Generäle befanden, eingepfercht wurden. Die Unterkunft der
Generäle befand sich unter einem Zelt, alle anderen mussten die Zeit unter freiem Himmel zubringen. Die Offiziere, die
Unteroffiziere, die Mannschaften; wurden in getrennten Camps untergebracht. Die Mannschaften wurden auch zur Arbeit
abkommandiert und konnten bei dieser Gelegenheit, Brot, Brötchen oder Zigarettenstummel organisieren, wogegen die
Offiziere und Unteroffiziere ihr Camp überhaupt nicht verlassen durften.
Die ersten Tage gab es kein Wasser und kein Brot, so dass die Kameraden vor Erschöpfung umfielen. Später standen wir
manchmal den ganzen Tag nach Wasser an, das von den, uns bewachenden Negern mit großen Wassertanks angefahren wurde. Am
dritten Tag bekamen wir mittags und abends etwas zu Essen; Brot bekamen wir erst nach zwei Wochen, nach dem aus der
Umgebung herbeigeholte Handwerker, Backöfen gebaut hatten. In den verschiedenen Gemeinden, die in den uns umgebenden
Weinbergen lagen, mussten sich alle Männer beim Bürgermeister melden. Als sie dann erschienen waren, wurden sie auf
bereitstehende Lastautos getrieben und zu uns ins Lager gebracht. Sie waren ohne Kopfbedeckung und ohne wärmere
Bekleidung angekommen, weil ihnen gesagt wurde, dass ihr Aufenthalt im Lager nur von kurzer Dauer sein würde. Man hat
uns, falls noch vorhanden, Decken und Mäntel abgenommen, mit der Begründung, sie würden für Kranke und Verwundete
gebraucht. Jeden Tag starben mehr als 200 Mann, die wir sofort in ein Zelt tragen mussten. In der Nacht wurden die
Toten dann mit unbekanntem Ziel, weggefahren.
Viele haben ihren Verstand verloren uns irrten im ganzen Camp ziellos umher. Als Latrinen wurden Gräben ausgehoben, in
die verschiedene Kameraden, bei der Verrichtung ihrer Notdurft, vor Schwäche hineingefallen sind und nicht mehr wieder
heraus kamen. Aus den Pfählen die, die jungen Obstbäume stützten, haben wir Krankentragen gebaut um unsere Kameraden,
bei Bedarf, zur Krankensammelstelle zu tragen. Es war in diesem Frühjahr auch sehr kalt, doch unsere Erdlöcher, die wir
zum Schutz vor Kälte und Wind, nur mit leeren Konservendosen ausgehoben hatten, durften nicht tiefer als 20 Zentimeter
sein. Nach jedem Regenguss mussten wir das Wasser ausschöpfen. Nach einem Gewitter, standen wir wiedermal, total
durchnässt in unserem Camp, als unerwartet am Horizont die Sonne hervortrat. Einer unserer Kameraden hatte noch eine
Trompete gerettet und fing, von dem Anblick völlig überwältigt, zu spielen an: "Es geht alles vorüber, es geht alles
vorbei, nach jedem Dezember, folgt wieder ein Mai". Daraufhin hob sich die Stimmung der tiefbetrübten Kriegsgefangenen,
so das Heimatlieder durch das ganze Camp erklangen, obwohl wir in den nassen Kleider herumgehen mussten, bis sie am
Körper trocken wurden.
In französischer Kriegsgefangenschaft
Nach etwa einem Monat, haben uns die Amerikaner, den Franzosen, zum Arbeitseinsatz, ausgeliefert.
Etwa 4 Kilometer von Bad Kreuznach entfernt, stand auf freier Strecke, ein Zug mit offenen Kohlenloren, auf den wir
verladen wurden. In jeden Waggon, wurde pro Person eine Tafel Schokolade und ein Päcken Zwieback rein geworfen, doch
viele Kameraden fanden nur leere Päckchen vor, weil die schon zuvor von der französischen Wachmannschaft geplündert
wurden. Wir haben uns darüber beschwert, doch die haben uns nur ausgelacht. Nachdem wir zunächst bei Mainz über den
Rhein fuhren, endete unsere Fahrt bei Paris in einem großen Zeltlager. Dort wurden wir auf andere Züge verladen, die uns
nach Südfrankreich, in ein Barackenlager, bei Mazarei, brachten.
Auf einer Zwischenstation hat man uns unter einer Pumpe, die Lokomotiven mit Wasser versorgt, abgestellt, den Kran
aufgedreht und uns anschließend ausgelacht, die Kinder Haben uns mit Steinen beworfen. Ein Wachmann kam in unseren
Waggon gekommen, hat unser Gepäck durchsucht, wenn er Tabak oder Zigaretten gefunden hat, nahm er sie mit. Die Kameraden
waren darüber so empört, dass sie vorhatten, ihn nachts unter den Waggon zu werfen. Wir haben sie gebeten dass zu
unterlassen, weil man uns in diesem Falle, alle erschießen würde.
Als wir ins Lager kamen wurden wir zuerst gezählt, dann mussten wir unser Gepäck stehen lassen und beiseite treten.
Wenn man bei der Nachkontrolle noch was in den Taschen fand, wurde das auch entwendet, selbst Esslöffel. Wir wurden
dann in drei Baracken, ohne Toiletten, eingeschlossen. Die Kameraden haben ihre Bedürfnisse in Kochgeschirre erledigt
und durch ein kleines Fenster, das sich fast unter der Decke befand, hinausgeworfen. Andere Fenster ließen sich nicht
öffnen, weil sie mit Stacheldraht zu geflochten waren. Als die Kameraden die Kochgeschirre auskippten, haben die
Wachposten geschossen und die Fenster zertrümmert. Sie waren der Meinung dass wir ausbrechen wollten. Es herrschte eine
große Hitze, in den überfüllten Baracken sind wir fast erstickt. Am nächsten Tag haben wir uns über fehlende Toilettem
beschwert, da haben sie Heringsfässer durch die Hälfte geschnitten und an der Ausgangstür hingestellt. Um bei den
überfüllten Räumen dort hinzukommen, musste man über die Köpfe der Anderen steigen. Viele hatten Fieber und Durchfall
und mussten in die Krankenstube eingeliefert werden, wo sie kurz darauf verstarben.
Besonders Raucher litten sehr an der Unterernährung, bekamen Wasser in den Beinen und waren die Ersten die verstarben.
Nach der Registrierung wurden wir auf andere Baracken verteilt. Die Zivilbevölkerung kam in die Räume und begann uns
auszuplündern. Wer noch gute Schuhe besaß musste sie ausziehen und bekam dafür die kaputten des Plünderers. Eine Woche
lang mussten wir diesen Zustand ertragen, erst als die Kameraden sich beschwerten, wurde am Eingang eine Tafel am
Eingang angebracht, dass die Zivilbevölkerung das Lager nicht betreten darf. Bis auf einige, wenige Ausnahmen wurde
diese Anweisung befolgt.
Als wir im Lager ankamen, war der französische Lagerkommandant, ein ehemaliger Kriegsgefangener, der bei einem Bauern
in Deutschland gearbeitet hatte. Dieser Bauer war jetzt als Kriegsgefangener in seinem Lager. Als er ihn erkannte, hat
er ihn gleich zum Küchendienst eingeteilt und mit dem nächsten Krankentransport nach Hause fahren lassen. Zu Mittag
bekamen wir nur gekochte Haferkörner, da schwamm alles oben, später war man dann auf Gerste umgestiegen. Als viele
daran gestorben waren, weil sie diese „Rohkost”, die nur ein Kuhmagen verträgt, nicht gegessen haben, hat man die
Körner durch eine Schrotmühle laufen lassen. Dann hat man uns Steckrüben gekocht; wir bekamen 250 Gramm Weißbrot,
etwas Quark und ein viertel Liter Magermilch. Später, als wir schon arbeiten mussten, hat man in unserem Essen einen
Kuhkopf mitgekocht, das hat dann bedeutend besser geschmeckt.
Bevor wir morgens zur Arbeit gingen, mussten wir zu Flaggenparade und abends, nach der Rückkehr, haben wir die Flagge
wieder eingeholt. Wir haben einen Kanal gereinigt, dessen Sohle 2 Meter dick mit Schlamm bedeckt war. Zuerst wurde das
Wasser abgelassen, dann haben wir, einer dem andern, den Schlamm mit der Schippe hoch gereicht. Der Letzte hat den
Schlamm, der so zäh war, dass er nicht von der Schippe wollte, oben am Rande abgelegt. Manchmal waren 10 Mann nötig um
den Höhenunterschied zu überwinden. Das Wachpersonal schoss über unsere Köpfe hinweg und rief: „schnell arbeiten”. Bei
der großen Hitze war das ein Ding der Unmöglichkeit, zumal es nichts zu Trinken gab. Auf dem Heimweg haben wir im Walde
Heilkräuter gesammelt, die man in der Küche getrocknet und als Tee zubereitet hat, den wir am nächsten tag zur Arbeit
mitnahmen, um unseren Durst zu stillen.
Unser Aufseher hatte einen Stock, an dem sich noch kurz abgeschnittene Äste befanden. Wer seiner Meinung nach, nicht
ordentlich gearbeitet hat, bekam gleich Schläge auf den Rücken. Die weißen Aufseher wurden irgendwann durch Neger
ersetzt, die uns bedeutend besser behandelt haben. Wenn irgendetwas schief ging, haben sie nichts gesagt, nur gelacht.
In den übrig gebliebenen Wassertümpeln hatten sich noch einige Aale versteckt, die wir zu fangen versuchten, was uns
auch manchmal gelang. Wir mussten ihnen das Genick brechen, damit sie uns nicht entwischen konnten. Wenn die Franzosen
bemerkten das wir Aale hatten, wurden sie uns abgenommen. Gelang es uns aber, sie ins Lager zu bringen, dann haben wir
uns eine köstliche Malzeit zubereitet.
Um sicherzustellen dass niemand geflüchtet ist, wurden wir, wenn wir abends ins Lager zurückkamen, zuerst gezählt.
Diese Zählung wurde mehrmals wiederholt, weil die Wachmannschaften sich immer wieder verzählt haben. Als einer von uns
hin ging, ihnen sagte dass alle da sind, wollten sie es nicht glauben und haben uns vor dem stehen lassen, bis es ihnen
irgendwann einfiel. uns doch das Tor zuöffnen. Einmal, als wir von der Arbeit zurückgekehrt waren, standen wir bis 23
Uhr neben der Flagge, weil uns niemand das Tor geöffnet hat. Als wir dann doch irgendwie ins Lager kamen haben wir
festgestellt, dass das ganze Wachpersonal betrunken war und niemand im Stande uns das Tor zu öffnen.
Eines Tages waren wir wieder abends zur Parole angetreten, als ein älterer Herr mit seinem Hund, am Stacheldraht
entlang, spazieren ging. Weil der Hund, unterm Stacheldraht hindurch, zu uns kam, hat ihn einer geschnappt, ihm das
Genick gebrochen und unter seiner Jacke versteckt. Der Franzose hat nach seinem Hund gerufen und gepfiffen, aber alles
vergebens, der Hund war nicht aufzufinden. Die Kameraden haben ihm gleich das Fell über die Ohren gezogen, das Fleisch
gekocht und das Fell in die Latrine geworfen. Das Fleisch wurde umgehend verspeist.
Als wir am nächsten Tag von der Arbeit zurückkehrten, war im Lager der Teufel los. Wir mussten sofort antreten und
wurden gefragt, wo der Hund geblieben ist, der Gestern Abend, mit seinem Herrchen, am Zaun entlang spazieren ging. Als
sich niemand dazu bekannte, mussten wir weiterhin stehen bleiben, während die Wachmannschaften von Baracke zu Baracke
gingen und alles durchsuchten. In einer Latrine hat man dann das Fell gefunden, was uns ein furchtbares „Donnerwetter”
einbrachte und in den nächsten Tagen, nach der Arbeit, unter dem Kommando eines Oberfeldwebels, eine Stunde
nachexerzieren.
In Südfrankreich regnet es den ganzen Sommer nicht; die Bauern haben da keine Scheunen und das Getreide wir nur in
Schobern aufgestellt und dann umgehend gedroschen. Vom Oktober bis Dezember regnete es fasst jeden Tag in Strömen.
Gesät wird nur im Frühjahr und im Herbst, weil im Sommer alles vertrocknet. Es wird viel Wein angebaut und die
Steckrübe wächst den ganzen Winter. Neben den Weinreben wurde aus Schieferplatten ein Zaun aufgestellt, um dem Wein
einen optimalen Standort zu sichern. Die Bauernwagen hatten nur zwei Räder und waren nur mit einem Pferd bespannt, das
die ganze Balance des Wagens zu halten hatte. Trotzdem haben sie soviel aufgeladen wie wir auf einen Leiterwagen. Viele
Kameraden wurden den Bauern zur Arbeit ausgeliehen. Wenn ein Bauer einen Arbeiter gebraucht hat und es wurde gefragt,
wer sich in der Landwirtschaft auskennt, da haben sich alle gemeldet. Der Bauer konnte sich dann aussuchen, wen er
mitnehmen wollte.
Wenn wir durch die Stadt zur Arbeit gingen, haben verschiedene Leute Fallobst in die Abfalleimer gelegt. Wenn das von
den Kameraden bemerkt wurde, schwenkten viele aus der Reihe, um sich etwas mit zunehmen, was von den Wachmannschaften
nicht gern gesehen wurde. Viele Kriegsgefangene hatten keine Schuhe mehr, sie haben die Füße nur mit Lumpen bewickelt.
Eines Tages kamen Kameraden aus Norwegen, die nach Deutschland entlassen werden sollten. Mann hat sie jedoch ins Lager
gesteckt und zur Arbeit eingeteilt. In Norwegen hatten sie Kleider und Stoffe eingekauft, hatten volle Seesäcke und
sogar Karren auf 2 Rädern, weil sie ja in die Heimat entlassen werden sollten. Als wir morgens zur Arbeit rausgeführt
wurden standen sie schon vor dem Lager. Wir haben ihnen zugerufen, dass sie uns etwas abgeben sollen, weil ihnen ja
sowieso alles abgenommen wird, aber sie haben uns nur ausgelacht. Als sie ins Lager Kamen mussten sie ihr Gepäck
ablegen, wurden dann wo anders hingeführt und haben es danach nie wieder gesehen.
Durch die vielen Läuse, Flöhe und Wanzen die wie im Lager hatten, kam es bei verschieden Kameraden, an den
Einstichstellen, zu eiternden Entzündungen. Um dem vorzubeugen hat man uns mit einem Pulver, das in Frankreich
hergestellt wurde, aber bei den Parasiten keine Wirkung zeigte, eingesprüht. Erst bei der Anwendung eines Mittels
amerikanischer Herkunft, war alles über Nacht verschwunden.
Der Sonntag war arbeitsfrei. Dann kam ein katholischer, französischer Pfarrer, eskortiert von 3 Mann, mit
aufgepflanztem Seitengewehr ins Lager und hat Gottesdienst gehalten. Einen evangelischen Pfarrer gab es nicht, nur
einen Baptisten Prediger. Der wurde würdevoll eingekleidet, bekam ein großes Kreuz und hat jeden Sonntag in einer
extra dafür hergerichteten Baracke Gottesdienst gehalten. Wer Theologie studiert hatte und sich meldete, wurde zu
einem Seminar geschickt und konnte sein Studium fortsetzen. Glasbläser durften das Lager auch verlassen und ihrem
erlernten Beruf wieder arbeiten.
Wer sich freiwillig, für 5 Jahre, zum Dienst in der Fremdenlegion verpflichtet hat, das waren etliche unter uns, wurde
neu eingekleidet, bekam gutes Essen und Rauchwaren soviel er wollte. Nach einem Jahr wurden, nach und nach, die
Kranken und Körperbehinderten in die Sowjetische Besatzungszone entlassen. Eine Entlassung von Kriegsgefangenen, die
in den Westzonen oder jenseits von Oder und Neise zu Hause waren, war nicht vorgesehen. Die Österreicher wurden alle,
unabhängig von ihrem Gesundheitszustand entlassen.
Ich habe Briefe nach Hause geschrieben, aber die kamen nur bis Allenstein und wurden wieder zurück geschickt. Als eine
Kommission des Roten Kreuzes aus der Schweiz unser Lager besichtigt hat, haben wir uns beschwert, das wir als
Sanitätsdienstgrade, zur Arbeit gehen müssen. Daraufhin erging ein Befehl: Wer einen vom Roten Kreuz, ausgestellten
Ausweis besitzt, gehört einem internationalen Verband an und braucht nicht zu Arbeit gehen. Aus unserem Lager hatten
sich 20 Mann gemeldet, die daraufhin Freigang, in Begleitung von zwei französischen Wachsoldaten erhielten. Als wir
gefragt wurden wo wir hin wollen, entschlossen wir uns, einen Soldatenfriedhof, auf dem unsere verstorbenen Kameraden
beerdigt waren, zu besuchen.
Da der Untergrund in dieser Gegend aus Felsen bestand, wurden die Gräben, in denen die Toten in selbst gezimmerten
Kisten nebeneinander gestellt wurden, mit Hilfe von Dynamit ausgehoben. Ein Leichenwagen, mit einem Pferd bespannt,
das mit einer schwarzen Decke abgedeckt war, wurde von einem Kutscher in angemessener Kleidung, gefahren. Der Wagen
konnte gleichzeitig 4 Kisten transportieren. Wenn wir von der Arbeit kommend, dem Leichenwagen begegneten, wurde
gehalten und mit einer Schweigeminute der Toten gedacht, bis der Wagen vorbei war. Die Zivilbevölkerung verharrte auch
im Schweigen, mit abgenommener Kopfbedeckung.
Ein Kamerad, der in Krottorf, Kreis Oschersleben, bei Magdeburg, zuhause war, sagte bei seiner Entlassung zu mir:
Sollte ich das Glück haben, meine Entlassungspapiere zu erhalten ohne eine Bleibe vorzuweisen, dann soll ich Krottorf
als Heimatadresse angeben. Auf der Krankenstube habe ich angegeben, dass sich noch ein Schrapnellsplitter, aus dem
Ersten Weltkrieg, in meiner Kreuzbeingegend befindet, er zwar verkapselt ist, aber immer noch Beschwerden verursacht.
Daraufhin wurde ich zur Entlassung vornotiert. Als bekannt wurde das ein Rückkehrertransport in die sowjetische
Besatzungszone zusammengestellt wird, habe ich mich sofort gemeldet und wurde für ein Entlassungslager in Angoleme
vorgesehen. War das eine Freude, als uns mitgeteilt wurde, wann der Rücktransport stattfindet.
In unserem Lager waren noch 2 Kameraden aus dem Kreis Ortelsburg: Ein Gustav Lumma aus Leynau und ein Alfred Moritz
aus Groß Schöndamerau. Sie mussten noch zurückbleiben und haben mir den Auftrag erteil, die Angehörigen in der Heimat
zu grüßen und ihnen die Anschrift mitzuteilen. Als wir im Entlassungslager ankamen, fragte man uns nach unserer
Heimatanschrift. Dann wurden die Entlassungspapiere angefertigt. Es wurde uns auch ein Barscheck, für die in Frankreich
geleistete Arbeit ausgehändigt, den wir bei jeder Kasse in Deutschland einlösen könnten. Ich habe ihn bis zum heutigen
Tage nicht einlösen können, obwohl ich irgendwann in der Zeitung gelesen habe, das Verrechnungschecks die den aus
französischer Kriegsgefangenschaft Entlassenen, ausgehändigt wurden, einzulösen sind.
Wir kamen zuerst nach Saar Elbe, dann in die Nähe der Zonengrenze zu Thüringen. Hier mussten wir 2 Tage warten, weil
aus der sowjetischen Besatzungszone keine Eisenbahnwagen bereitgestellt wurden. Angesichts dessen, das der Russe beim
letzten Transport die aus Frankreich kommenden Wagen kassiert und nicht mehr herausgeben wollte, bestand der Franzose
jetzt darauf, seine Wagen sofort wieder mitzunehmen. Als der sehnsüchtig erwartete Zug endlich eintraf, durften wir
umsteigen und kamen, immer noch hinter Stacheldraht, nach Erfurt. Von dort weiter ins Quarantänelager nach Prätsch an
der Elbe.
Unter Androhung von Strafe war es verboten das Lager zu verlassen, doch der Hunger zwang uns dazu, in den umliegenden
Dörfern um Lebensmittel zu betteln. Man drohte uns damit, dass Zuwiderhandlungen, mit einer 14-tägigen Verlängerung der
Quarantäne geahndet werden. Der Roggen war schon reif und wir haben, auf den umliegenden Feldern, die Ähren abgerissen,
das Korn, zwischen 2 Steinen zu Mehl zerrieben, um daraus eine Suppe zu kochen, denn von dem was unsere Lagerküche uns
bieten konnte, war es nicht möglich zu überleben. Als der Eigentümer bemerkte wer seine Roggenähren entwendet hat, kam
er ins Lager, gerade zu dem Zeitpunkt als wir mit dem Mahlen beschäftigt waren. Der Lagerkommandant, bei dem er sich
beschwerte, drohte uns zu bestrafen, wenn wir unsere „Rauzüge” nicht unmittelbar einstellen würden. Wir sagten ihm er
solle uns heimfahren lassen, da wir doch lange genug hinter Stacheldraht gesessen hätten.
Endlich wieder in Freiheit
14 Tage nach unserer Ankunft wurden uns Entlassungspapiere ausgehändigt, sowie auch Fahrscheine
zum den, von uns angegeben Heimatorten. So kam ich nach Krottof, Kreis Oschersleben, zu meinem ehemaligen
Kriegskameraden, bei dem ich einen Tag geblieben bin. Er hatte mir schon eine Stelle bei einem Bauern besorgt, der 70
Jahre alt und kinderlos war. Zum Hof, den er mit seiner Ehefrau bewirtschaftet hat, gehörten 36 Morgen Land, 2 Ochsen
und 3 Kühe. Das Ackerland bestand aus 17 Parzellen und sicherte mir einen Arbeitsplatz.
Jetzt, da ich ein Dach überm Kopf und genug zu essen hatte, fing ich an nach dem Verbleib meiner Familie zu forschen.
Bei meinem letzten Heimaturlaub hatte ich mit meiner Frau verabredet; falls wir uns in den Kriegswirren verlieren
sollten, unsere Kontaktadresse, die meiner Quartiersleute in Burscheid, Kreis Opladen, sein sollte. Ich habe zuerst
nach Rohmanen geschrieben, aber leider keine Antwort erhalten. Dann habe ich nach Burscheid geschrieben, und siehe, -
bei denen lag schon eine Anfrage meiner Frau vor, die nach mir gefragt, und ihre jetzige Anschrift hinterlassen hatte.
Ich habe dem Bauern erzählt dass meine Frau sich zurzeit, auf einem Gut, in Alt Steinhorst, im Kreis Rostock, befindet.
Er war sofort bereit uns ein Zimmer zur Verfügung zu stellen, wenn ich meine Frau nach Krottorf rüberholen wollte. Das
habe ich Ihr mitgeteilt und sie war sofort bereit ihren Wohnsitz nach Krottorf zu verlegen, denn sie wohnte dort in
einem kleinen Stübchen unterm Dach.
Im Herbst, als die Feldarbeit so ziemlich erledigt war, bin ich nach Alt Steinhorst gefahren, um meine Frau und meinen
Sohn Kurt, sowie meinen Sohn Manfred, den ich noch nicht kannte, weil er erst nach der Flucht, am 31. Januar, in Groß
Lüssewitz, geboren wurde, nach Krottorf zu holen. Meine Frau hatte schon Holz für den Winter besorgt und vom Gut, auf
dem sie im Sommer gearbeitet hatte, Mehl und Kartoffeln bekommen. Wir haben das Mehl und andere Habseligkeiten in
Kisten verpackt. Das Holz haben wir einem Bauern gegeben, der uns und unser Gepäck, mit seinem Pferdewagen, zum 14
Kilometer entfernten Bahnhof, nach Ribnitz gebracht hat. Wir sind auch gut in Krottorf angekommen, aber als wir am
nächsten Tag, unsere Kisten vom Bahnhof abholen wollten, haben wir zwar die Kisten vorgefunden, doch der gesamte Inhalt
wurde während der Bahnfahrt entwendet. Die Bahnstation in Krottorf hat die Vorkommnisse zur Kenntnis genommen und
protokolliert, aber unsere Sachen haben wir nie wieder gesehen und mussten wieder bei Null anfangen.
Im Winter musste ich auf der Genossenschaft, unentgeltlich, für die Russen Weizen einsacken. Ich hatte versucht eine
Arbeit als Zimmermann zu bekommen, doch auf dem Arbeitsamt wurde mir gesagt, ich bin Ladwirt und muss auf der
Landwirtschaft arbeiten. Da in den ersten Nachkriegsjahren, auch in der sowjetisch besetzten Zone Arbeitsplätze knapp
waren, mussten auch solche, die einen anderen Beruf erlernt hatten, jede zumutbare Arbeit annehmen. Aus der Heimat
erhielt ich einen Brief, von meiner dort noch lebenden Mutter. Sie schrieb das sie mich noch einmal sehen wollte und
ich sollte doch wieder zurück kommen; Unser Hof wäre nicht von Polen besetzt und sie wäre ganz alleine, weil der Vater
nach dem Durchzug der Front von den Russen erschlagen wurde. Daraufhin habe ich dem polnischen Konsulat in Magdeburg
mitgeteilt, dass ich in Rohmanen eine Landwirtschaft besitze, und um eine Einreisegenehmigung gebeten.
Nach 2 Monaten erhielt ich eine Postkarte, mit der Mitteilung, ich sollte mich persönlich beim Konsulat vorstellen.
Nach Aufnahme meiner Personalien, wurde mir gesagt, das ich benachrichtigt werde wenn mein Antrag genehmigt wird. Ende
Juli 1947 erhielten wir die Einreisegenehmigung nach Ostpreußen, das jetzt unter polnischer Verwaltung stand. Wir
mussten zuerst zum polnischen Konsulat in Berlin-Lichterfelde, wo wir umgeben von einer Trümmerlandschaft, gewartet
haben, bis alle Untersuchungen und Formalitäten erledigt waren.
“ Wieder zurück in Ostpreußen.”
Der schwere Wiederaufbau nach dem Kriege
Dann fuhren wir über Frankfurt/Oder, Posen, Thorn, Allenstein, nach Ortelsburg, wo wir am 2. August 1947 ankamen. Mit
einem zweirädrigen Karren, den ich mir von einem noch in Ortelsburg lebenden Bekanten ausgeliehen hatte und meinem
Sohn Manfred im Kinderwagen fuhren wir nach Rohmanen. Meine Mutter war inzwischen verstorben und auf dem Hof war nur
meine, inzwischen aus Russischer Gefangenschaft wiedergekehrte Schwester, Frieda Pelkowski.

Es war alles ausgeplündert; kein Vieh, keine Maschinen und der ganze Hof mit kniehohem Graß überwachsen. Nur schmale
Trampelpfade, vom Haus zum Holzschuppen und zum Klo, durchkreuzten das satte Grün. Ich habe das Gras auf dem Hof mit
einer Sense, die ich noch gefunden habe, abgemäht, damit der Hof nicht so verwahrlost aussah. Am nächsten Tag habe ich
mich bei der Polizei in Ortelsburg angemeldet, wo ich auch ein Startgeld von 100 Zloty erhielt und Gepäckstücke, die
ich in Krottorf aufgegeben, am Bahnhof abgeholt. Es hat mich sehr gewundert das, das Gepäck überhaupt angekommen ist.
Da man von der Landwirtschaft nicht Leben konnte, habe ich mich in den nächsten Tagen, bei der jetzt polnischen Bahn,
um Arbeit beworben und wurde auch angenommen. Wenn wir unseren Monatslohn bekamen, saß immer einer am Tisch, der von
uns 100 Zloty für den Wiederaufbau von Warschau verlangte. Wenn ich dran war, riefen die Anderen, ich hätte Warschau
zerstört und müsste deshalb 200 Zloty abgeben. Nach 3 Jahren kam eine Verfügung, die besagte, dass wer länger als 1
Jahr bei der Bahn beschäftigt ist, angestellt werden muss. Um diese Bestimmung zu umgehen hat man mich entlassen und
eine Woche später wieder eingestellt.
Als ich vor Ablauf des nächsten Jahres, aus dem gleichen Grunde wieder entlassen wurde, habe ich mich bei der
Stadtverwaltung in Ortelsburg(jetzt Szczytno)beworben, wo ich zuerst im Gaswerk als Heizer und später auf Baustellen
als Zimmermann gearbeitet habe. Wir haben durch den Krieg beschädigte Häuser repariert, in den ehemals touristischen
Zentren einige Ausbesserungen an den Einrichtungen durchgeführt, eine Ziegelei wieder in Betrieb gesetzt und andere
anfallende Arbeiten verrichtet. Im Dach des Rathausturmes war während der Kämpfe eine Granate eingeschlagen, die, die
Dachlatten und die Verschalung zerstört hatte. Da wir, unter schwersten Bedingungen, den Schaden repariert haben,
wurde uns eine Höhenzulage versprochen, die wir aber nicht bekommen haben.
Aus Verärgerung darüber habe ich bei der Stadtverwaltung gekündigt und bei einer Wiederaufbaufirma unter der Leitung
von Bauingenieur Laskowski wieder angefangen, wo ich bis 1954, als Zimmermann beschäftigt war. Ab da habe ich mich
nur um meinen Hof gekümmert, der wegen meiner Arbeitsstellen, gezwungenermaßen, sehr vernachlässigt wurde. Als wir
1947 zurückkamen, brachten wir unseren Sohn Manfred noch im Kinderwagen. Den hat meine Frau zum Markt gebracht,
verkauft, und dafür eine Ziege erworben, die dank guter Pflege, uns täglich mit 4 Liter Milch versorgte. Das war der
erste Baustein zum Wiederaufbau, unserer durch den Krieg zerstörten, und danach ausgeplünderten Landwirtschaft.
Während meiner Arbeit bei der Bahn haben wir uns eine Kuh gekauft, die nach einem halben Jahr, wegen nicht bezahlter
Grundsteuer, vom Gerichtsvollzieher gepfändet wurde. Man hat uns die Kuh weggenommen und bei einem Arbeiter, der in
der Ernst-Mey-Straße in Ortelsburg wohnte und sie wegen nicht vorhandener Futtermittel, nur mit Kartoffelkraut
gefüttert hat, untergestellt. Als ich bei der Bahn meinen Monatslohn bekommen habe, bin ich zur Gmina gegangen, habe
eine Rate angezahlt und durfte dann die Kuh wieder mit nach Hause nehmen. Durch die schlechte Ernährung war die Kuh
stark abgemagert und lieferte nur die Hälfte der ursprünglichen Milchleistung.
Später habe ich ein Pferd auf Abzahlung bekommen, das 140.000 alte Zloty gekostet hat. Die Stute war schwach und unser
Feld sehr hügelig, so dass man nur bergab pflügen konnte, was sehr beschwerlich war, bergauf ging es immer im Leerlauf.
Später habe ich die schweren Böden mit dem Traktor umpflügen, und in den letzten Jahren auch mit dem Binder mähen
lassen. Von der Stute habe ich 2 schöne Fohlen gezogen; ein davon habe ich bei der Ausreise in die Bundesrepublik
mitgebracht und bei der Viehverwertungs-Genossenschaft in Göttingen verkauft. In den ersten Nachkriegsjahren als noch
wenig Land bestellt wurde, breiteten sich auf den nicht beackerten Flächen, Wildkräuter aus. Disteln und andere
Schnellwachsende, erreichten manchmal eine Höhe von 2 Meter, besonders auf den schweren Böden.
Es hat viel Schweiß gekostet ehe man den Acker soweit hatte, das er auch befriedigende Erträge abwarf. Die
Währungsreform von 1950, hat unser weiniges Geld das wir schon gespart hatten, wieder vernichtet. Ich hatte 2 Pferde,
1 Fohlen, 2 Kühe und Schweine, als ich wieder aufgefordert wurde nicht bezahlte Grundsteuern nachzuzahlen. Als ich
nicht bezahlen konnte, hat der Vollziehungsbeamte, ein Fohlen, eine Kuh und ein Schwein gepfändet. Es gelang mir jedoch
nach längeren Verhandlungen, ohne größere Verluste, alles zu regeln. Später kam eine Verfügung, die besagte; wenn
jemand auf seinem Hof nur eine Kuh und ein Pferd hatte, durften sie nicht gepfändet werden. Einige haben ihr Inventar
dieser Verfügung angepasst und dadurch die Zahlung von Grundsteuer umgangen.

Wer seine Steuern pünktlich bezahlt und sein Kontingent an landwirtschaftlichen Produkten fristgerecht abgeliefert hat,
der konnte seine, darüber hinaus erwirtschafteten Produkte zu marktgerechten Preisen verkaufen. Für eine hochtragende
Sterke, mindestens 400 kg schwer, die auf ein staatliches Gut verkauft wurde, konnte man bis zu 12000 Zloty bekommen.
Unsere Böden waren kalkarm, doch durch den Einsatz von Kalk und Kunstdünger konnte man den Ertrag erheblich steigern.
Kalk und Kunstdünger konnte man bei der Genossenschaft(GS) bestellen, der dann auch direkt auf den Hof geliefert wurde.
Kalk wurde geliefert und gleich auf dem Feld ausgestreut. In den 1960ger Jahren waren alle Ackerflächen der Rohmaner
Felder bestellt.
Die nach dem Krieg zurückgebliebenen deutschen Bauernfamilien, aber auch die Polen, die während des Krieges beim Bauern
in Deutschland gearbeitet haben, versuchten mit teils bescheidenen, oder auch zusammen gesuchten, landwirtschaftlichen
Geräten, die bäuerlichen Betriebe aufrecht zu erhalten. Nach den schweren Anfängen in den ersten Nachkriegsjahren
erzielten sie schließlich einen beachtlichen Erfolg, der sich in wogenden Kornfeldern, sowie in grünen Wiesen auf
denen gut genährtes Vieh weidete, widerspiegelte.
Ein schwerer Einschnitt in meinem Leben.
Am 11. Mai 1956 verstarb nach langer schwerer Krankheit, meine liebe Ehefrau Marta Rattay,
geborene Brosch. Ein Jahr zuvor war schon mein Schwiegervater Gottlib Brosch verstorben. Die schweren Bedingungen
unter denen wir nach Kriegende leben mussten, haben ihrer bereits angegriffenen Gesundheit sehr zugesetzt. Sie
verstarb mit 44 Jahren und hinterließ in unserer Familie eine große Lücke, die nicht mehr zu Überbrücken war. Wir
haben sie unter großer Anteilnahme der noch verbliebenen deutschen Bevölkerung zu Grabe getragen und auf dem Rohmaner
Friedhof beigesetzt. Die Arbeit die sie sonst verrichtet hatte fiel jetzt auf mich und meine Söhne zurück. Meine
Schwester Frieda Pelkowski half auch wo sie nur konnte. Wir waren auf die Unterstützung durch Nachbarn und Freunde
angewiesen, die uns immer wenn es nötig war, tatkräftig unterstützt haben. Im laufe der Zeit haben wir wieder zum
Alltag zurück gefunden, haben sie noch etliche Jahre auf dem Friedhof besuchen können, bis wir, bedingt durch unsere
Ausreise uns endgültig von ihr trennen mussten.
Der endgültige Abschied von Ostpreußen
Ab 1956 begannen, durch die Vermittlung des Deutschen Roten Kreuzes, die ersten Ausreisen in die
Bundesrepublik Deutschland. Zuerst waren es Kinder die zu ihren Eltern ausreisen durften, Familien deren Väter aus der
Kriegsgefangenschaft in den Westen Deutschlands entlassen wurden und andere durch den Krieg getrennte
Familienangehörige. Ab 1960 erhöhte sich die Zahl der Ausreisewilligen aus dem polnisch besetzten Ostpreußen. Es setzte
sich die Überzeugung durch, dass unsere Angestammte Heimat, uns für die Zukunft keine Perspektive mehr bieten konnte.
Meistens wurden die Anträge, die wir an die Passabteilung in Allenstein stellen mussten, um einen Ausreisepass zu
bekommen, negativ beschieden. Nach mehrmaligen Versuchen gelang es dann doch, diese begehrte Ausreiseberechtigung in
Empfang zu nehmen. Die Enttäuschung der Zurückgebliebenen war groß, wenn wieder mal Verwandte oder Nachbarn, den Weg
in Richtung Bahnhof einschlugen.
Um einen Reisepass zu beantragen, musste man zuerst eine Einladung von Verwandten aus der Bundesrepublik vorlegen, in
der, diese sich verpflichten mussten, für Unterkunft und Verpflegung der Eingeladenen zu sorgen. Diese Einladung
musste durch ein Amt in der Bundesrepublik beglaubigt werden. Außerdem mussten die Kosten für die Bahnfahrt, ab
polnischer Grenze, bis zum Zielort, beim polnischen Reisebüro ORBIS, in Warschau, in DM eingezahlt werden.
Unseren ersten Ausreiseantrag haben wir 1964, bei der Kommandantur der polnischen Miliz in Allenstein eingereicht, der
nach einer gewissen Zeitspanne, ohne eine uns verständliche Begründung zu nennen, abgelehnt wurde. Gegen diese
Ablehnung wurde ein Widerspruch zugelassen, den wir sofort einreichten. Nach einer weiteren Zeitspanne erhielten wir
wieder eine Ablehnung, gegen die kein Widerspruch mehr zulässig war. Wer seine Ausreiseabsicht nicht aufgeben wollte,
musste einen neuen Antrag stellen. Es gab Familien die schon 10 Mal einen Ausreiseantrag gestellt hatten und immer
wieder abgewiesen wurden. Da meine Söhne, nicht die Absicht hatten in Rohmanen zu bleiben und ich nach 2 Weltkriegen,
an denen ich teilgenommen, die schwere Arbeit auf der Landwirtschaft, nicht aus eigener Kraft schaffen würde, haben wir
1966 wieder einen Antrag gestellt, der prompt abgelehnt wurde. Der Widerspruch auf diese Ablehnung wurde auch negativ
beantwortet, so dass wir 1968 wieder einen Antrag eingereicht haben.
Weil das Passamt in Allenstein lange nichts von sich hören ließ, hegten wir schon die Hoffnung das es jetzt klappen
würde und waren sehr enttäuscht als wieder eine Absage kam. In der Zwischenzeit sind viele Nachbarn und Bekannte aus
Rohmanen, sowie aus der näheren Umgebung, ausgereist und das Häuflein der noch verbliebenen Deutschen, wurde immer
kleiner. Die Motivation, die uns in früheren Jahren, über so manche schwierige Lage hinweg geholfen hat, ist einer
hoffnungslosen Resignation gewichen. Man war davon überzeugt, dass unser Leben, in unser Angestammten Heimat, keine
Zukunftsperspektive mehr haben konnte und wenn wir keine Ausreisegenehmigung bekommen, wir eines Tages die letzten
Deutschen in der ganzen Umgebung sein werden.
Die Ausreise-Heimat ade
Wir hatten die Hoffnung schon aufgegeben, als am 30. April 1969, der Briefträger unseren Hof
betrat und mir einen Brief überreichte, in dem uns das Passamt in Allenstein mitteilte, dass unsere Ausreise in die
Bundesrepublik Deutschland, genehmigt worden ist. Wir müssten, nach Aushändigung der Reisepapiere, den Geltungsbereich
der Volksrepublik Polen, innerhalb von 3 Monaten verlassen. Wir waren zuerst geschockt, über den Hinweis, das wir
unsere Heimat in 3 Monaten verlassen müssen, aber dann stellte sich die Zukunftsperspektive wieder ein und wir gingen,
wie von einem schweren Ballast befreit und gut gelaunt unser weiteren Tätigkeit nach.
Als der Briefträger unseren Hof betrat, waren ich und mein Sohn Kurt gerade dabei eine Fuhre Mist zu laden. Wir hatten
den Wagen gerade halb geladen und haben nach der frohen Kunde nicht mehr weiter gemacht, sondern die Pferde vorgespannt
und den Mist aufs Feld gefahren, damit wir den Wagen für alle Fälle frei hatten. Das war die letzte Tätigkeit für
unsere Landwirtschaft in Ostpreußen.
Die Nachricht von unserer Ausreise verbreitete sich, ohne dass wir darüber gesprochen haben, wie ein Lauffeuer.
Alsbald kamen Leute aus dem Dorf, die sich für das Vieh und für diverse Landwirtschaftliche Geräte interessierten.
Etliche wollten bestimmte Sachen sofort kaufen, andere haben nur zurücklegen lassen und wollten später kommen und
bezahlen, haben es aber dann doch nicht genommen.

Wenn man eine Landwirtschaft hatte, konnte man 2 Pferde, 2 Rinder, 3 Schweine, 5 Schafe und 10 Hühner, in einem
geschlossenen Viehwaggon, in die Bundesrepublik mitnehmen. Jeden Tag war man unterwegs, von einer Behörde zur Andern.
Die Aushändigung der Reisepapiere erfolgte nur nach Vorlage bestimmter Bescheinigungen: Es mussten alle Steuern bezahlt
sein, das Kontingent landwirtschaftlicher Erzeugnisse musste abgeliefert sein, je eine Bescheinigung vom Katasteramt
und vom Notar musste vorgelegt werden, das man dem polnischen Staat das Grundstück abgetreten hat. Die Gebühren für
die notarielle Beglaubigung mussten wir selbst bezahlen. Wenn man alle Bescheinigungen beisammen hatte, bekam man bei
der Kreisverwaltung eine Gesamtbescheinigung. Mit dieser Bescheinigung konnte man nach Allenstein, zur
Polizeikommandantur fahren, wo man nach dem schriftlichen Verzicht auf die polnische Staatsangehörigkeit, einen
Reisepass ausgehändigt bekam, der den Inhaber zum Grenzübertritt berechtigte, aber nicht zur Wiedereinreise.
Wir haben 2 Pferde, eine Sterke, einen Ochsen, 5 Schafe, 2 Schweine und 10 Hühner mitgenommen. Über die Schutzimpfung
der Rinder musste man eine, vom Kreistierarzt beglaubigte Bescheinigung vorweisen. Ich habe 5 Schafsböcke gekauft, die
ich in der Zwischenzeit, hinter der Scheune, zum Weiden angekettet hatte. Einer von denen hat sich losgerissen und
seinen Nachbarn getötet. Das Fleisch konnten wir noch verkaufen, mussten aber dafür einen anderen Schafsbock kaufen.
Innerhalb von 3 Monaten mussten wir alles regeln und zwei Tage vor der Abfahrt einen Eisenbahnwagen, bei der
Eisenbahndirektion in Allenstein bestellen. Reservierungen bei den polnischen Behörden waren meist immer mit
Schmiergeld verbunden, weil man sonst nie sicher sein konnte dass diese Vereinbarungen auch eingehalten werden. Schon
2 Wochen vor unserer Abfahrt, gab es in Ortelsburg keine alkoholischen Getränke zu kaufen. Meine Söhne mussten mit dem
Motorrad die umliegenden Dörfer abfahren, damit wir für die Reise einen Vorrat anlegen konnten; denn Wodka war zu der
Zeit, in Polen, wie eine zweite Währung.
Am 25. Juli haben wir zusammen, mit meinem Neffen Siegfried Brosch, unseren sonstigen Hausrat, der in Kisten verpackt
war, in einen Eisenbahnwagen, auf dem Allensteiner Bahnhof verladen. Alles musste zuerst durch den Zoll, wo die
Federbetten gewogen wurden und über das erlaubte hinausgehende Kissen, verzollt werden mussten. Dasselbe galt auch für
Fleisch und Räucherwaren.
Am 26. Juli, unserem Verladetag, kam der Eisenbahnwagen aus Allenstein, erst um 11 Uhr auf dem Ortelsburger Bahnhof an.
Die Rinder hatten wir zu Fuß, zum Bahnhof gebracht; Schweine, Schafe und Hühner auf dem Pferdewagen. Im Eisenbahnwagen
mussten, mit Hilfe von Brettern und Bohlen, Boxen für die verschiedenen Tiere erstellt werden. Jedes Pferd und jedes
Rind in eine Bucht. Die Schafe zwischen die Pferde, die Schweine zwischen die Rinder und die Hühner in einem Käfig,
unter der Decke über den Rindern. Die Hühner hatten unterwegs Eier gelegt, somit hatten wir jeden Tag frische
Verpflegung. Bei der Fahrt im Viehwagen, begleitete mich mein Sohn Manfred. Als die Lokomotive nahte, um den Wagen
abzuholen, wurden noch schnell die restlichen Sachen hinein geworfen und so mache Abschiedsträne rollte dann die Wange
hinab.
Unsere Nachbarn, Deutsche und Polen, halfen uns beim Verladen des lebendigen Inventars. Jetzt erinnerte ich mich
plötzlich, an die oft auch schönen, Ereignisse der letzten 22 Jahre. Einer Zeit, in der das Zusammenleben von
Deutschen und Polen, von Jahr zu Jahr, besser wurde. Man half sich beim einbringen der Getreideernte, beim Dreschen
des Getreides, bei der Kartoffelernte und bei anderen Arbeiten, wo viele Menschen zupacken mussten. Es war eine
Dorfgemeinschaft, in schweren Zeiten geboren; jeder half jedem wenn Hilfe nötig war. Es wurde mir plötzlich bewusst,
das jetzt ein Lebensabschnitt zu Ende ging, zu dem ich nicht mehr zurückkehren konnte. Unsere Existenzgrundlage war
jetzt ein Eisenbahnwagen auf einem Schienenstrang, dessen Ende irgendwo in weiter Ferne lag. Obwohl, von langer Hand
vorbereitet, war dieser Moment voller Wehmut.
Doch als der Zug sich plötzlich, in Bewegung setzte, war ich sofort wieder in der Gegenwart. Menschen, mit denen man
Jahrzehnte lang, in gutem Einvernehmen zusammen gelebt hat, blieben plötzlich am Bahnsteig zurück und die Entfernung
zwischen ihnen und mir vergrößerte sich mit jeder Sekunde, bis sie letztendlich aus meinem Blickfeld verschwanden.
Es war ein heißer Julitag, als wir unsere Reise gen Westen antraten. Für die Schweine, die besonders unter der Hitze
zu leiden hatten, haben wir 10 Flaschen Essig mitgenommen und sie von Zeit zu Zeit besprenkelt, damit sie besser atmen
konnten. Für die anderen Tiere war reichlich Heu und Hafer vorhanden. Eine großes Fas und zwei Milchkannen waren mit
Wasser gefüllt, die wir auf den an der Strecke liegenden Bahnstationen, bei Bedarf wieder nachgefüllt haben.
Da der Kreistierarzt nicht in seinem Büro war, konnten wir die Impfbescheinigung für das Vieh, nicht rechtzeitig
herbeischaffen. Der Zug setzte sich in Bewegung und die Bescheinigung war immer noch nicht da. Als die Bescheinigung
dann eingetroffen, wir aber schon unterwegs waren, ist mein Sohn Kurt mit dem Motorrad hinterher gefahren und hat uns
in Passenheim, wo der Zug noch andere Wagen angehängt bekam, die Impfbescheinigung übergeben. Wir waren sehr froh das
er es noch geschafft hat, denn in solch einer Situation fühlt man sich sicherer wenn man alle Bescheinigungen bei sich
hat. Auf der Rückfahrt, mit dem Motorrad hatte er noch eine Panne, musste das Motorrad stehen lassen und per Anhalter
nach Hause fahren. Am nächsten Tag kam er mit Siegfried Deptolla, der das Motorrad wieder flott machte und brachte es
wieder nach Rohmanen zurück.
Die Fahrt mit dem Viehwagen, gen Westen
Von Ortelsburg bis Allenstein(45 km) hat unser Zug 4 Stunden gebraucht, weil auf jedem Bahnhof
gehalten wurde, um neue Wagen anzuhängen. Nachdem wir in Allenstein angekommen waren, kam ein Rangierer und fragte
nach unserem Ziel. Als wir ihm mitteilten, das wir in die Bundesrepublik Deutschland wollen, sagte er nur: „In 10
Minuten fährt ein Zug los. Wenn ich von euch 500 Zloty und einen Liter Wodka bekomme, werde euch sofort anhängen,
andernfalls kommt ihr auf ein Nebengleis und müsst dann auf den nächsten Zug warten. Es blieb uns nichts anderes übrig
als seiner Forderung nachzukommen, denn über derartige Erpressungen hat man bereits von Anderen, die vor uns ausgereist
sind, gehört. Wir wurden auch sofort angehängt und fuhren dann die ganze Nacht, an Osterode, und Thorn vorbei bis
Gnesen. Dort wurde wieder rangiert.
Von einer Anhöhe wurden die einzelnen Wagen auf verschiedene Gleise verteilt und zu neuen Zügen zusammengestellt. Der
Aufprall der ungebremsten Wagen erzeugte eine derartige Erschütterung, dass manche Bretter an den Boxen geborsten waren.
Von Gnesen ging es dann in einem Zuge durch bis zur Grenzstation Reppen(Rzepin). Dort mussten wir zum Zollamt, wo
unsere Ausfuhrpapiere durch die Zollbeamten, und durch einen Tierarzt geprüft wurden. Bis Reppen(Rzepin) haben wir für
den Eisenbahnwagen 900 Zloty bezahlt; hier mussten wir noch einmal 650 Zloty bezahlen. Bei der Wagenkontrolle erklärte
uns ein Bahnbeamter das unser Wagen, sich nicht für den internationalen Transport eignet und wir deshalb den Inhalt in
einen Anderen umladen müssen, der irgendwann, auf dem Nebengleis bereitgestellt wird. Nach langer Verhandlung, sowie
einer Zulage von 500 Zloty und einem Liter Wodka haben wir ihn davon überzeugt, das der Wagen sich doch für die
Weiterfahrt eignet.
In der Nacht war Schichtwechsel, der unseren Wagen wieder abgehängt hat, weil er angeblich von der Reichsbahn der DDR,
wegen technischer Mängel nicht weiterbefördert würde. Wir mussten unsere Verhandlung vom Vorabend wiederholen, die mit
der Zusage endete, dass wir am frühen Morgen, über die Grenze auf DDR Gebiet, gebracht werden. Um 5 Uhr morgens kam
eine Lokomotive, die uns den letzten Abschnitt bis über die Grenze bringen sollte. Als der Zug hat noch einmal anhielt,
kamen polnische Grenzbeamte und Soldaten in den Wagen. Sie durchsuchten ihn und fragten, ob wir noch polnisches Geld
oder einen Grundbuchauszug bei uns hätten. Wir zeigten ihnen 800 Zloty, die sie uns, nach Ausstellung einer Quittung
über 500 Zloty, abnahmen. Die Grundbuchauszüge habe ich, im Stroh versteckt, dem Ochsen vor die Füße gelegt. Falls
jemand da suchen sollte, hätte ich gesagt, das das Tier bösartig veranlagt ist, und ich für seine Sicherheit nicht
garantieren könnte, deshalb sollte er vorsichtig sein.
Als die Grenzkontrolle den Zug verlassen hatte, setzte sich die Lokomotive wieder in Bewegung und überquerte nach
kurzer Zeit die Oderbrücke. Auf einer eingezäunten Fläche, jenseits der Grenze, hat man uns abgestellt hat und die
Lokomotive fuhr zurück auf polnisches Gebiet. Vor und hinter uns waren die Tore verschlossen. Auf den Wachtürmen,
links und Rechts von uns, standen Posten mit einem Gewehr im Anschlag. Vier Grenzbeamte der DDR, jeder mit einer
Leiter in der Hand, sowie ein Schäferhund, kamen zu unserem Wagen. Sie öffneten die Schiebetüre, stellten die Leiter
davor und ließen den Hund in den Wagen springen, der nur etwas herum schnupperte und wieder heraussprang. 2 Beamte
haben dann anschließend, die Papiere kontrolliert und das Inventar gezählt.
Nach einiger Zeit wurden wir an einen Güterzug der Reichsbahn angehängt und fuhren von Frankfurt an der Oder, vorbei
an Berlin, Ellingen und Nordhausen, über die Grenze zur Bundesrepublik bis Herzberg. Hier hat ein Zollbeamter der
Bundesrepublik, die Formalitäten erledigt und ein Tierarzt die Pferde, Rinder und Schweine gründlich untersucht. Ich
musste ihnen die Mäuler aufhalten und die Füße hochheben. Danach hat uns die Lokomotive zu einer Wasserzapfstelle
gebracht, wo wir die Tiere tränken und unsere Behälter mit Wasser auffüllen konnten. Anschließen fuhren wir über
Northeim nach Göttingen, zur Viehverwertungsgenossenschaft, die zuvor von unserer Ankunft in Kenntnis gesetzt wurde.
Der Ochse, die Sterke und die Schweine wurden, in Göttingen zum Schlachthof gebracht; die Pferde kamen nach Hannover
und die Schafsböcke nach Kassel. Wir waren mit dem Viehtransport 5 Tage unterwegs; hatten so manche Klippe umschifft
und Schwierigkeiten gemeistert, die im normalen Leben nicht vorkommen.
Wir wurden mit einem PKW, ins Durchgangslager Friedland bei Göttingen gefahren, wo mein Sohn Kurt, meine Schwester
Frieda Pelkowski und Siegfried Brosch mit Familie, die am 30 Juli, um 14 Uhr, von Warschau mit dem Zug abgefahren, und
hier am 31. Juli in den Morgenstunden eingetroffen sind, schon auf uns gewartet haben. In Friedland hat man uns mit
Familie Siegfried Brosch in einem Raum untergebracht, wir wurden registriert und erhielten 20 DM Überbrückungsgeld,
pro Person. Da wir erst am Freitag in Friedland eingetroffen sind, mussten wir hier über das Wochenende bleiben,
obwohl die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der Regel nur 3 bis 4 Tage beträgt.
Um einen Antrag für die Ausreise stellen zu können, brauchten wir eine Einladung von in der Bundesrepublik lebenden
Verwandten. Diese Einladung hat uns mein Bruder, Ernst Rattay, aus Ingelheim am Rhein zugeschickt. Ingelheim liegt im
Bundesland Rheinland-Pfalz. Das Geld für die Bahnfahrt, hat uns, Frieda Schellin, geb. Nickel, aus Duisburg, die
Tochter unseres Nachbarn, überwiesen. In Friedland wurden wir registriert. Im Registrierschein, war als unser
nächster Aufenthaltsort in der Bundesrepublik, das Durchgangslager Osthofen bei Worms, das alle Aussiedler für
Rheinland-Pfalz aufnehmen musste, eingetragen. Die Eintragung erfolgte deshalb, weil der Ort aus dem uns unsere
Einladung zugeschickt wurde, sich auch in Rheinland-Pfalz befand.
Da ich nach dem Polenfeldzug, als Soldat, ein Jahr im Kreis Opladen, im Rheinland gewesen bin, wäre ich sehr gerne in
diese Gegend gezogen, denn die Erinnerung an die schönen Tage die ich dort verlebt habe war in mir immer noch wach.
Ich versuchte die Eintragung in unseren Regiestierscheinen ändern zu lassen, was nach einigen, vielleicht auch
berechtigten Einwänden, am 4. August, vom Beauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen, genehmigt wurde. Anstelle von
Rheinlad-Pfalz stand da jetzt Nordrhein-Westfalen und am 7. August, fuhren wir, noch mit anderen Aussiedlern, ins
Durchgangslager Unna-Massen, am östlichen Rande des Ruhrgebietes gelegen. Hier wurden wir in einem Zimmer untergebracht
und konnten unser Essen in einer Gemeinschaftsküche zubereiten.
Am 8. August wurden wir in Unna-Massen, als Bürger der Bundesrepublik Deutschland registriert, erhielten
Einhundert DM Begrüßungsgeld, den Vertriebenen Ausweis -A -und 4 Wochen später den Bundespersonalausweis. In
Unna-Massen haben wir mehr als 4 Monate verbracht, weil mein Sohn Kurt, wegen fehlender Berufsausbildung, in Unna, an
einem Grundlehrgang für Metallarbeiter teilgenommen hat, der vom Arbeitsamt finanziert wurde. Am 11 Dezember 1969 sind
wir endlich an unserem vorläufigen Wohnsitz, im Durchgangswohnheim, an der Elisabethstraße 13, in Velbert angekommen.
Ab dem 5. Januar 1970 konnten meine Söhne, in der Zahnradfabrik Reining, in Velbert ihrer geregelten Arbeit nachgehen.
Von Bau- und Sparverein in Velbert wurde uns am 20. Juni 1970, unsere erste Wohnung zugewiesen.
Velbert im Februar 1972
gezeichnet: Gustav Rattay
Am 2. August 1914 wurde die Allgemeine Mobilmachung ausgerufen. Alle wehrfähigen Männer folgten
dem Ruf des Kaisers und eilten zu den zuständigen Wehrmeldeämtern um die Grenzen des Vaterlandes zu schützen. Wir als
Grenzbewohner bekamen das Meiste zu spüren. Alle Häuser, Scheunen und Ställe waren mit Soldaten und ihrem Tross belegt.
Die Einen gingen, die Anderen kamen. Die Kosaken hatten bei Muschaken und Radzinen die Grenze überschritten. Der
Flüchtlingsstrom hatte sich von der Grenze her angestaut. Die Russen haben überall geplündert. Die Trosse mussten sich
zurückziehen und haben dazu vorwiegend die Feldwege benutzt. Die Pferde waren erschöpft. In einer Nacht kam der
Gemeindevorsteher mit einem deutschen Offizier auf unseren Hof. Mein Vater und der Nachbar Wilhelm Dorka mussten mit
ihren Pferden aushelfen. Sie waren 2 Tage unterwegs, bis zu einem Gut in Kleeberg bei Allenstein. Als sie dann wieder
nach Hause kamen waren die Russen schon am Rohmaner Friedhof. In der Zwischenzeit hatten wir schon den Leiterwagen mit
Mehl, Rauchfleisch und Betten beladen.
Der überwiegende Teil der Rohmaner war schon losgefahren. Der Hauptlehrer Müller kam noch mit dem Fahrrad vorbei und
sagte es wäre höchste Zeit das wir wegkämen weil die Russen schon Ortelsburg besetzt hätten und im Anmarsch auf
Rohmanen wären. Wir sind auf eine Anhöhe gestiegen und haben die Staubwolken beobachtet, aber wir dachten es wäre
deutsches Militär.
Auf der Flucht vor den Russen
Kurz vor Sonnenuntergang haben wir die Pferde vor den fertig gepackten Wagen gespannt und sind
sofort losgefahren. Mein Bruder und ich nahmen 4 Milchkühe und die beste Sterke mit und gingen hinterher. Schweine,
Kälber und Geflügel haben wir aus den Ställen getrieben. Wir waren die ganze Nacht unterwegs und sind bis Rheinswein
gekommen. Da hatten wir einen Onkel wohnen, bei dem haben wir den ganzen Tag verbracht.
Unterwegs haben wir einen Mann getroffen, der erzählte uns dass die Russen bei Groß Jerutten einen Personenzug
überrumpelt haben. Sie hatten aus Eisenbahnschwellen eine Sperre auf den Schienen errichtet und somit den Zug zum
Anhalten gezwungen. Die Russen haben den Zug mit Artillerie beschossen. Als die Soldaten und Zivilisten den Zug
verlassen wollten kamen die Kosaken zu Pferde und haben ein Massaker angerichtet. Nur wer sich am Boden davon
schleichen konnte hat überlebt. Die Russen wurden durch einen Verräter darüber informiert das auf diesem Gleis ein
Zug unterwegs war und waren darauf vorbereitet. Unserem Informanten ist es auch gelungen dem Massaker zu entkommen.
Ein Kosake hatte ihm im beim vorbeireiten mit dem Säbel ein Ohr abgehauen und ihn dadurch zu Boden geschlagen. Es ist
ihm danach gelungen ins Gebüsch zu schleichen. Sein Kopf war schon verbunden als wir ihn trafen. Später wurde an der
Stelle des Überfalls ein Gedächtnisstein errichtet.
Im Morgengrauen sah man viele Kosaken über die Felder reiten. Wir sind dann später wieder weiter in Richtung
Jellinowen gefahren. Unser Vater ist mit dem Pferdewagen die Landstraße entlang gefahren. Wir mit dem Vieh sind
entlang einer tiefen Schlucht durch den Wald bis zum Babanter See gegangen. Wir hatten schon vorher versucht die
Schlucht zu verlassen aber wegen der steilen Hänge ist es uns leider nicht gelungen. Am See angekommen fanden wir drei
große Schober mit Getreide vor. Von einem dieser Schober haben uns zwei Kosaken mit einem Fernglas beobachtet. Sie
schwangen sich auf ihre Pferde und kamen uns entgegen geritten, dann hielten sie uns ihre Lanzen vor die Brust und
versuchten uns auszufragen. Wir haben leider nichts verstanden und fingen an zu weinen. Plötzlich pfiff der
Patrollienführer auf einer Trillerpfeife und die Kosaken kehrten zu ihrem Ausgangspunkt zurück.
Als wir dann weiter am See entlang gingen sahen wir von weitem drei Gehöfte. In der Nähe einer dieser Höfe hatte unser
Vater den Pferdewagen im Gestrüpp abgestellt. Die vorrückenden Schützenlinien der russischen Infanterie hatten ihn
jedoch entdeckt. Sie haben den Wagen durchwühlt und den Sack mit Rauchfleisch mitgenommen. Andere Flüchtlingswagen die
in diesem Gebüsch Schutz gesucht haben sind nicht besser davon gekommen. Wir haben das Vieh auf einen der Höfe
getrieben und am Zaun festgebunden. Dann haben wir mit Hilfe einer Leiter den Heuboden erklommen und uns dort versteckt.
Als die Kosaken auf dem Hof erschienen verlangten sie Brot und Milch. Die Frauen mussten zuerst essen und trinken,
danach haben es die Russen auch getan, sie fürchteten sich davor, dass man sie vergiften könnte. Später kam dann die
russische Infanterie und hat Haus, Scheune und Schuppen durchsucht. Die Falltüre zum Heuboden ließ sich nur nach oben
hin öffnen. Wir hatten die Türe von oben mit schweren Gegenständen beschwert, aber die Russen versuchten mit aller
Gewalt auf den Heuboden zukommen. Als die Frauen das sahen, sagten sie zu den Russen, da oben würden sich ihre Kinder
versteckt halten. Die Russen forderten nun, die Kinder sollten sofort den Heuboden verlassen. Die Mütter riefen nun
nach ihren Kindern die dann auch tatsächlich den Heuboden verließen. Als wir das sahen, haben wir uns am Giebel tief
im Heu vergraben. Drei Russen kamen nun rauf und stocherten mit ihren Bajonetten im Heu herum. Glücklicherweise kamen
sie nicht in unsere Nähe. Als die Russen den Heuboden verließen haben wir befürchtet sie würden ihn in Brand setzen.
Wahrscheinlich taten sie deshalb nicht weil so viele russische Soldaten auf dem Hof waren. Einige Zeit später
erschienen russische Offiziere auf dem Hof, mit einem Auto. Sie sagten, sie hätten das Land erobert und wir hätten ab
sofort dem russischen Zaren zu gehorchen. Wir wurden angewiwsen nach Hause fahren und unbesorgt unsere Ernte
einzubringen. Sie haben uns auch eine Bescheinigung ausgestellt, damit uns auf dem Heimweg niemand die Pferde und
das Vieh wegnehmen würde.
Erst am nächsten Morgen, als die Front weiter vorgerückt war, beschlossen wir die Heimreise anzutreten. Die Straßen
waren mit vorrückenden russischen Truppen blockiert. Manchmal mussten wir stundenlang am Wegesrand warten bis die
Soldaten mit ihrem Tross vorbeigezogen waren. Unterwegs wollten sie unser Vieh zum Schlachten wegnehmen, aber die
Bescheinigung hat uns davor bewahrt. Die Eisenbahnbrücke vor Neu-Keykuth wurde von Kavallerie bewacht. Die wollten uns
nicht drüber lassen und hielten uns bis zum frühen Morgen fest. Zurück in Rohmanen angekommen, konnten wir unser Haus
nicht betreten weil der Hof und alles rundherum ein großes Militärlager war.
Wir sind dann in Richtung Seelonken gefahren, bis Abbau Brosch. Auf dem Hof angekommen haben wir zuerst Grünfutter für
die Pferde vom Feld geholt und anschließend Mittag für uns selbst gekocht. Die Nacht haben wir erstmal auf dem Hof
verbracht. Am nächsten Morgen wagten wir es ins Dorf zu gehen um die Lage zu erkunden. Die Russen waren schon wieder
weiter gezogen, aber Haus und Hof waren in einem schrecklichen Zustand. Wir sind dann gegen Abend wieder nach Hause
zurückgekehrt.
Am 23. August 1914 waren die Russen bei uns eingebrochen, bis sie am 28. August von den Deutschen zurückgeschlagen
wurden. Dann fuhren sie wieder zurück, drei Wagen nebeneinander. Ortelsburg brannte lichterloh. Ein Wagen mit Mehl war
uns gegenüber in den Straßengraben gekippt, aber wir haben nichts davon genommen, weil man ja nicht wusste ob man die
Nacht überleben würde. Wir saßen die ganze Zeit im Keller. Am nächsten Morgen zog dann russische Kavallerie und
Infanterie durch unser Dorf. Die Kavallerie ritt orientierungslos hin und her. Die Infanterie hat den ganzen
Vormittag 1,5 Meter tiefe Schützengräben ausgehoben. Um 11 Uhr kamen aus Richtung Eichtal 3 deutsche Spähwagen nicht
ahnend dass die nördliche Hälfte des Dorfes noch von Russen besetzt war. Wir haben zu diesem Zeitpunkt auf dem
Dachboden Weizen eingesackt und hatten aus diesem Grunde einen weiten Rundblick.
Um 11 Uhr kamen aus Richtung Eichtal drei deutsche Spähwagen angefahren. Als wir die deutschen Soldaten erkannt hatten,
haben wir sie durch Handzeichen gewarnt weiter nach Norden vorzustoßen. Die Kosaken hatten sich auf den Häuserdächern
positioniert und in Richtung Norden nach deutschen Truppen Ausschau gehalten. Die Deutschen sprangen von den Spähwagen
und fingen an die nichts ahnenden Russen zu beschießen. Als die sich ihrer gefährlichen Lage bewusst wurden verließen
sie ihre Aussichtsposten und bestiegen ihre Pferde. Mit Peitschenhieben versuchten sie, die sich in panikartiger Flucht
befindliche Infanterie dazu zu Bewegen, die Deutschen anzugreifen. Zwei Spähwagen wendeten sofort, der Dritte konnte
nicht mehr umkehren. Es gelang allen, bis auf den Fahrer des dritten Wagens die Flucht. Die Russen nahmen ihn sofort
unter Beschuss, doch es gelang ihm über unseren Hof zu entkommen. Auf der rückwärtigen Seite schlug er sich quer durch
die Gärten bis zum Gehöft von Friedrich Sakowski durch. Der versteckte ihn im Keller und versorgte ihn anschließend
mit Zivilkleidung.
Als die Russen den Soldaten auf unseren Hof laufen sahen nahmen sie sofort die Verfolgung auf. Sie durchstöberten auch
die Nachbarhäuser und trieben die Bewohner auf der Straße zusammen. An der Spritzenwagenremise richteten sie einen
Sammelpunkt ein. Unter dem Vorwand es würde hier eine Schlacht stattfinden, versuchten die Russen die Zivilbevölkerung
aus dem Dorf zu drängen. Alle die dem Aufruf gefolgt sind und an unserer Sammelstelle vorbeikamen wurden unserem Haufen
hinzugefügt. Unter ihnen befand sich auch der deutsche Soldat in Zivilkleidung. Er hatte einen Sack über die Schulter
geschlagen in dem sich ein Brot befand, an der anderen Hand führte er eine Kuh am Strick. Als unser Haufen schon aus
etwa 50 Leuten bestand setzten uns die Russen mit Marschrichtung Seelonken in Bewegung. Wir Jungen versuchten in einem
unbeaufsichtigten Moment wegzulaufen, doch die Begleitmanschaft prügelte uns mit Gewehrkolben wieder in Reihe und Glied.
Unterwegs gelang es dem Soldaten mit der Kuh unbemerkt zu entkommen. Er kehrte unbehelligt ins Dorf zurück und lieferte
die Kuh wieder dort ab wo er sie entführt hatte.
Uns haben die Russen an Seelonken vorbei zum Sylvensee getrieben. Wenn sie von vorbeiziehenden russischen Offizieren
gefragt wurden weshalb wir unterwegs wären, sagten sie denen wir hätten deutsche Soldaten versteckt und wollten das
Versteck nicht verraten. Als wir am See vorbei waren begann die deutsche Artillerie aus Richtung Ortelsburg zu
schießen. Unweit von uns explodierten Granaten und richten ein großes Chaos unter Freund und Feind an. Es hieß dann
rette sich wer kann. Die Russen verließen uns in Richtung Waldpuschsee und wir kehrten orientierungslos nach Seelonken
zurück. Nach Rohmanen konnten wir nicht zurück weil die deutsche Artillerie aus Richtung Eichtal anfing unser Dorf zu
beschießen. Schließlich sind wir auf dem Abbau Brosch untergekommen. Ein durch Granatsplitter schwer verletzter Russe
suchte dort auch Zuflucht. er versucht sich mit einem Messer das Leben zu nehmen. es gelang den Frauen ihn davon
abzubringen, weil sonst bei einem etwaigen erscheinen von russischen Soldaten der Verdacht auf uns gefallen wäre.
Später erschienen tatsächlich Kosaken die ihn dann mitgenommen haben. Ihnen folgten in 50 Meter Entfernung Deutsche
Ulanen, die hinter den Russen in einem in der Nähe liegenden Wäldchen verschwanden.
Nachdem die Russen Rohmanen besetzt hatten, versteckten sie sich vorwiegend in mit Stroh gedeckten Gebäuden. Durch
Schießscharten, die sie im Strohdach anlegten, schossen sie auf die deutschen Kampfverbände, die sie wieder vertreiben
wollten. Um die Angreifer zu entlasten, wunde das Dorf von deutscher Seite unter Beschuss genommen. Durch die
Geschosse der deutschen Artillerie entstanden in Rohmanen viele Brände. Die mit Stroh gedeckten Gebäude fielen zuerst
in Schutt und Asche. Unser Vater hatte uns ins Dorf geschickt, damit wir das Vieh im Stall von der Kette losbinden
sollten. Am Dorfrand kamen uns schon deutsche Ulanen und Husaren entgegen. Rohmanen brannte an mehreren Stellen. Unser
Hof war noch unversehrt, nur die Zäune standen schon in Flammen. Wir haben das Vieh los gebunden und anschließend
versucht die Brandherde rund herum zu löschen. Es gelang uns die Flammen von unserem Hof fernzuhalten und auch bei
unserem Nachbarn einzugreifen. In vielen Scheunen und Ställen hatten sich noch viele versprengte Russen versteckt. Die
wurden anschließend von deutschen Soldaten eingesammelt und in Gefangenenlager abgeführt. Am nächste Tag haben wir dann
zerbrochene Gewehre und Munition in Körbe gesammelt und im Dorfteich versenkt.
Am 29. August haben die Russen Rohmanen verlassen, doch schon am 30. August sind sie wieder zurückgekehrt. Hauptlehrer
Müller wurde mit seinem Sohn und Karl Deptolla auf Fahrrädern fahrend von einer russischen Patrouille aufgegriffen.
Sie wurden von den Russen der Spionage verdächtigt weil der Lehrer Müller ein Fernglas bei sich trug. Der Sohn hatte
eine Gymnasiastenmütze und eine Landkarte bei sich. Sie wurden in Richtung Lehmanen abgeführt. Auf einer Anhöhe des
Grundstücks von Ernst Chittka befand sich eine nicht mehr betriebstaugliche Windmühle. Dort soll ein russisches
Kriegsgericht sie zum Tode verurteilt haben. Nach der Hinrichtung wurden sie in der Nähe der Windmühle verscharrt.
Später wurden sie wieder ausgegraben, in Särge gelegt und auf dem Rohmaner Friedhof beigesetzt. Die Ehefrau von Lehrer
Müller hat die Gräber nach dem 1. Weltkrieg mit einem schmiedeeisernen Zaun umrandet.
Die Kämpfe um Rohmanen haben viele Menschenopfer gekostet. Bei uns hinter der Scheune lagen 2 tote Russen und ein
Verwundeter. Die Toten haben wir in einer Kartoffelmiete vergraben. Alle anderen Gefallenen wurden auch gleich an der
Stelle an der sie zu Tode kamen verscharrt und mit einem Kreuz gekennzeichnet. Für die im Raum Rohmanen gefallenen
Russen wurde nach dem Krieg hinterm Dorf, in Richtung Ortelsburg, auf einer Anhöhe ein Heldenfriedhof angelegt. Dort
liegen 20 Soldaten und 1 Offizier. In der Mitte befindet sich ein Trauerbaum und Birken säumen den Zugang von der
Landstraße her. Der Lehrer Dorka hat nach dem Kriege, mit seinen Schülern immer die Gräber gepflegt.
Meine Einberufung zum Militär

Bis zu meinem 17. Lebensjahr habe ich meinem Vater in der Landwirtschaft geholfen. Im Frühjahr
1916 wurde unser Jahrgang gemustert. Im Herbst 1916 erhielten Gustav Spektor, Johann Resonek und ich einen
Einberufungsbescheid. Wir mussten uns in Allenstein im Kaisergarten melden. Dort wurden Rekruten aus mehreren
Landkreisen zusammen gezogen und danach verschiedenen Ausbildungszentren zugeteilt. Wir Rohmaner kamen zum 18.
Infanterie-Regiment nach Osterode. Ein Unteroffizier mit einer Gruppe Musketiere haben uns von Allenstein abgeholt.
Als wir in der Kaserne ankamen haben wir sofort Mittagessen in Blechnäpfen bekommen. Untergebracht wurden wir im
Dachgeschoß der Kaserne. Es waren keine Betten vorhanden, nur Strohsäcke lagen auf dem Boden.
Als dann einige Tage später ausgebildete Kompanien an die Front ausrückten durften wir in einen anderen Block umziehen.
Wir wurden der Größe nach aufgestellt, in Korporalschaften eingeteilt und dann von Kopf bis Fuß eingekleidet. Die
Ausgehuniformen hatten blanke Knöpfe dazu einen Schako mit blanker Spitze. Im neuen Block hatten wir 2stöckige Betten.
Unsere Zivilbekleidung mussten wir in einen Karton verpacken und nach Hause schicken. Dann erst begann das eigentliche
Kasernenleben. Die Kaserne durfte niemand ohne Erlaubnis verlassen, nur in Begleitung eines Unteroffiziers. In der
Kaserne war eine Kantine in der man alles kaufen konnte was in der Kaserne gebraucht wurde.
Am nächsten Tag kam unser Kompanieführer, im Range eines Hauptmanns, zu Pferde angeritten. Er begrüßte uns mit;
Guten Morgen Kameraden, wir antworteten ihm mit; Guten Morgen Herr Hauptmann. Er hat dann die Front abgeschritten und
jeder musste sich mit seinem Namen vorstellen. Um 5 Uhr wurde geweckt, 6 Uhr Kaffee holen, 7-8 Uhr Unterricht, 8-11
Uhr exerzieren auf dem Kasernenhof. Um 11.30 blies der Trompeter zur Mittagspause. Die erste Zeit war noch alles
ziemlich gemütlich aber dann wurde es von Tag zu Tag strenger. Um 10 Uhr abends war Zapfenstreich, dann ging der
Unteroffizier vom Dienst von Stube zu Stube, der Stubenälteste musste die Anwesenheit aller Rekruten melden; zum
Beispiel: Stube 56 belegt mit 14 Mann, alle zu Haus. Wir mussten in 2 Reihen antreten, mit Drillichanzug bekleidet
und in Pantoffeln, ein tadelloses Aussehen präsentieren. Der Diensthabende Unteroffizier prüfte ob alle
vorschriftsmäßig angezogen, gewaschen, gekämmt und ob alle Knöpfe an der Jacke geschlossen waren. Als er bei einem
Rekruten einen offenen Knopf erspähte, hat er uns gefragt, ob jemand ein Taschenmesser bei sich hat.
Wir ahnten nicht Gutes, darum haben wir uns ganz still verhalten und nichts gesagt. Da sagte der U.v.D. plötzlich:
”Wenn niemand von euch ein Messer bei sich hat, dann habe ich ein”. Er zog sein Messer aus der Tasche und fing an, bei
dem Rekruten die Knöpfe abzuschneiden. Als die Knöpfe zu Boden purzelten, brachen wir in lautes Gelächter aus. Das hat
ihn so in Rage gebracht, das unser unwürdiges Benehmen, zuerst mit einem „Donnerwetter” bestraft wurde. Dann schrie
er: ”In den Korridor marsch, marsch, die Treppen runter bis auf den Hof”. Als wir unten angekommen waren hieß es
wieder; "Zurück auf die Stube in der 3. Etage”. Jemand hat mir bei dem Durcheinander, von hinten in den Pantoffel
getreten, so das er auseinander gerissen wurde. Ich bin dann nur mit einem Pantoffel und einem Socken die Treppen rauf
und runter gelaufen. So wurden wir 3-mal hinunter und wieder hinauf gejagt.
Danach ließ er uns wieder antreten und hat mit einer Taschenlampe unter den Betten geleuchtet. Plötzlich schrie er
wieder los: "Das nennt ihr Fegen? wenn ihr mit dem Besen nicht fegen könnt, dann mühst ihr das mit eueren Bäuchen tun.
Marsch, marsch unter die Betten” . Als wir schon alle am Schlafen waren, kam der U.v.D. wieder und hat nachgesehen ob
alle Schränke abgeschlossen waren. Ein Kamerad hatte seinen Schlüssel verloren, deshalb hat er das Schoß nur so
eingehängt. Als der U.v.D. das bemerkte hat er die Türe aufgerissen, die ganzen Sachen aus dem Schrank, quer durch die
Stube verteilt und war dann endlich gegangen.
Die Anziehsachen mussten, fein sauber gefaltet, auf dem Stuhl liegen; da drauf die Socken und die Pantoffeln unter dem
Stuhl. Die Stühle mussten in einer Reihe ausgerichtet sein; die Hosenträger im Schrank einschlossen und der Brustbeutel
mit Geld auf dem Hals tragen werden. Morgens wurden wir geweckt und kamen zuerst in den Waschraum. Jeder musste seinen
entblößten Oberkörper mit kaltem Wasser abreiben. Da draußen strenger Frost herrschte war es im Waschraum auch sehr
kalt, so das manche ihr Hemd anbehielten. Der UvD hat dann bei seinem Kontrollgang alle Verweigerer aufgeschrieben
und ihnen befohlen in 30 Minuten mit einem Besen in der Hand auf der Schreibstube zu erscheinen. Einige mussten den
Kasernenhof fegen, andere die zugefrorenen Latrinen enteisen und reinigen. Während unserer Ausbildungszeit durften wir
die Kaserne nicht verlassen. Wenn man Stuben- oder Frühdienst hatte, blieb keine Zeit zum Frühstücken.
Nach 6 Wochen wurden wir in der Grollmann Kaserne vereidigt. Die Regimentskapelle spielte "Heil dir im Siegerkranz",
danach folgten 3 Strophen des Deutschlandliedes. Vor der Vereidigung wurden die Rekruten gefragt wer keine deutsche
Staatsangehörigkeit besitzt. Es sind dann Luxemburger und auch noch welche aus anderen Ländern hervorgetreten. Sie
wurden gefragt ob sie die deutsche Staatsangehörigkeit annehmen wollen. Die das abgelehnt haben wurden auf die
Schreibstube gerufen und sofort aus dem Militärdienst entlassen. Nach der Vereidigung erfolgte ein Kirchgang, danach
konnte man einen Stadturlaub beantragen. Nach dem Mittagessen mussten alle, die einen Urlaubschein beantragt hatten
vor der Kaserne antreten. Der Hauptfeldwebel prüfte dann ob an der Uniform alle Knöpfe blank geputzt waren, die Stiefel
glänzten und der Rekrut auch vorschriftsmäßig grüßen konnte. Wer diese Anforderungen nicht erfüllen konnte musste
seinen Urlaubschein wieder abgeben und zurück auf sein Zimmer gehen.
Wenn man die Kaserne für eine gewisse Zeit verlassen wollte, mussten zuerst der Korporal, dann der Hauptfeldwebel und
letzt endlich der Hauptmann, seine Zustimmung erteilen. Es wurde geprüft; ob die Ausgeh-Uniform sitzt, alle Knöpfe
blank geputzt sind und der Helm so blank ist das man sich darin spiegeln kann. Unser Hauptmann war in Zivil,
Bürgermeister von Osterode. Er war sehr stolz wenn er seine Kompanie, in Parade Uniform und mit einem fröhlichen Lied
auf den Lippen, durch seine Stadt führen durfte.
Als wir eines Tages zum etwa 6 Kilometer entfernten Schießstand marschieren sollten, war es sehr kalt und glatt. Der
Hauptmann ritt durch das große Tor, wir aber sind durch das kleine Tor gegangen und haben eine steil bergab führende
Abkürzung gewählt. Die Zug- und Gruppenführer gingen voraus und wir im Gänsemarsch hinterher. Ein Kamerad hat sich auf
den Gewehrkolben gesetzt und ist darauf den Berg hinunter gerutscht. Als die Anderen das sahen haben sie es ihm
nachgemacht und hatten einen Riesenspaß. Da kam der Hauptmann plötzlich im Galopp angeritten; ließ alles anhalten und
hat zuerst die Zugführer ausgeschimpft, dann anschließend die ganze Kompanie. Er sagte: „Wie könnt ihr es wagen, so
mit eueren Gewehren umgehen. Ein Gewehr soll man wie seine Braut behandeln und nicht wie einen Straßenbesen”. Zur
Strafe mussten wir, links und rechts der Straße, in zwei Reihen antreten und durch den verschneiten Straßengraben
robben. Die Herrn Zug- und Gruppenführer durften die Straße benutzen und erteilten uns nur Befehle, wie: hinlegen,
nach rechts schwenken, nach links schwenken, einzeln vorarbeiten und sammeln. Als wir dann abgekämpft, in Linien zu
2 Glieder angetreten waren, ging es mit Gesang zum Schießstand.
Auf dem Schießstand angekommen, erhielten wir zuerst eine praktische Unterweisung, für den Gebrauch von Schusswaffen.
Wir mussten solange mit einem nicht geladenen Gewehr üben, bis wir unserem Vorgesetzten beweisen konnten, dass wir
alles im Griff haben. Daraufhin wurden jedem 10 Patronen zugeteilt, so das er unter der Aufsicht eines Unteroffiziers
mit den Schießübungen beginnen konnte. Der Unteroffizier hat die Position der Einschüsse, auf der Scheibe, in einem
Buch eingetragen und nach Beendigung der Übung dem Hauptmann Bericht erstattet, ob der Schütze seine Aufgabe erfüllt
hat oder nicht. Nach dem Schießen wurden die Gewehre zu Pyramiden zusammengestellt. Diejenigen die ihre Aufgabe nicht
erfüllt haben, mussten rund um die Zielscheibe, die Bleikugeln aufsammeln.
Seit unserer Einberufung hatten wir noch keinen Heimaturlaub. Urlaub bekamen nur die, die ihren Heimatort zu Fuß
erreichen konnten. Wegen der vielen Truppentransporte die täglich von Ost nach West unterwegs waren durften wir die
Eisenbahn nicht benutzen. Einmal wurde uns gesagt; wenn jemand gut schießen kann der bekommt Heimaturlaub, aber auch
das war nur ein leeres Versprechen.
Kaisers Wilhelms Geburtstag
Der beste Tag war des Kaisers Geburtstag. Am 27. Januar mussten alle in der Grollmann Kaserne
antreten, der Battalions-Kommandeur beendete seine Laudatio mit den Worten: Seine Majestät, unser Kaiser und König
Wilhelm II, erlebe hoch, hoch, hoch. Dann spielte die Regimentskapelle: Heil dir im Siegerkranz, Herrscher des
Vaterlands, Heil Kaiser dir. Danach folgten 3 Strophen des Deutschlandliedes und anschließend fand ein Gottesdienst
statt. Anschließend gab es ein vorzügliches Mittagessen, Schweinebraten, ein Stück Wurst auf die Faust und Biermarken,
die man in der Kantine gegen gutes Bier einlösen konnte, danach Urlaub bis zum Wecken, ohne Urlaubschein. Mein Vater
und die Mutter eines Kameraden waren schon morgens angekommen, konnten uns aber nicht finden, wurden von einer Kaserne
in die andere geschickt. Erst als wir mit Musik, von der Kirche zurück zur Kaserne marschiert sind habe ich sie
zufällig entdeckt. Als sie mich auch erkannt haben, sind sie nachgekommen. Da war die Freude groß: Der Vater hatte
einen großen Koffer auf einem Krückstock über die Schulter getragen. Ich ging gleich zur Wache und habe sie angemeldet,
sie sind dann bis zum Abend geblieben. Es war einer der schönsten Tage in der Grollmann-Kaserne in Osterode.
Alle 10 Tage bekamen wir Sold. Vor der Auszahlung mussten wir antreten, jeder wurde gefragt ob noch Restgeld vom
letzten Sold vorhanden war. Dann bekam jeder 3,30 Mark, davon musste man noch Sidol für das Koppelschloss und
Schuhkreme für die Stiefel kaufen. Wer geraucht hat und nichts von zu Hause bekam war schlimm dran. Beim Militär bekam
man nicht nur die Ausbildung an der Waffe beigebracht, man lernte auch putzen, nähen, Strümpfe stopfen und vieles
Andere. Man bekam einen beschädigten Strumpf, der musste aufgeribbelt werden, mit der Wolle konnte man dann andere
Strümpfe stopfen oder Kleidungsstücke mit Namen kennzeichnen. wer das nicht konnte, der musste seinen Kameraden
Zigaretten oder Geld geben die das dann für ihn erledigten.
Verschiedene Kameraden gingen nach dem Dienst noch in die Stadt. Um 21:45 Uhr wurde zum Zapfenstreich geblasen, dann
musste man schnell zurück in die Kaserne, weil um 22:00 Uhr der Wachhabende von Bett zu Bett ging und prüfte ob auch
alle anwesend waren. Zwei mal pro Woche fanden Gewaltmärsche statt, mit vollem Gepäck im Tornister. Am Ende der
Marschkolonne fuhr dann ein Pferdewagen, wenn der Feldarzt bei jemandem einen Erschöpfungszustand feststellte, der
durfte dann aufsitzen. Am Sonnabend wurden auf dem großen Exerzierplatz Felddienstübungen durchgeführt, es befand sich
dort ein großer Hügel, den wir immer wieder erstürmen mussten. Am Nachmittag war Revierreinigen angesagt, wir mussten
dann die Tische schrubben, auf einen Tisch wurde Sand mit etwas Wasser gestreut, der nächste Tisch wurde mit der den
Beinen nach oben drauf gelegt und solange hin und her geschoben bis beide sauber waren. Mit den Stühlen geschah das
Gleiche. Dann wurde der Fußboden in der Stube geschrubbt, die Schränke abgewaschen, Staub geputzt, zuletzt kamen Flur
und Treppe dran.
Für die Arbeit war eine Stunde angesetzt, wenn jemand zu früh fertig war erregte er den Argwohn des Diensthabenden
Korporals, der prüfte dann alles genau, fand natürlich immer etwas das nicht seinen Erwartungen entsprach. Der
Übereifrige musste dann Nacharbeiten bis die Stunde um war. Eine Stunde war für Gewehr reinigen und Unterricht an der
Waffe vorgesehen.
Im Februar wurden wir neu eingekleidet; Schnürschuhe, Koppel, alles gelbes Leder mussten wir mit Lederschwärze
behandeln. 2 Wolldecken, Uniform und Helm in feldgrau, da brauchten wir die Knöpfe nicht mehr zu putzen. Die neuen
Gewehre mussten zuerst eingeschossen werden. Es wurden 90 scharfe Patronen und Marschverpflegung ausgegeben, danach
mussten wir mit vollem Gepäck zum Appell antreten. Man konnte kaum gerade stehen, weil der Tornister einen in die Knie
zwang. Der Major, der die Aufstellung besichtigte rief >Brust raus<, dann informierte er uns dass wir ins
Feldrekrutendepot und in Feindesland kommen. Urlaub bekam niemand. Ich habe ein Telegramm nach Hause geschickt, mit
der Nachricht dass wir bald abrücken werden. Einen Tag vor dem ausrücken hat mich meine Mutter noch besucht, sie hat
mir vieles mitgebracht. Alles konnte ich nicht mitnehmen, weil es nicht gestattet war anderes Gepäck bei sich zu haben
als dem Soldaten zustand.
Abmarsch zum Fronteinsatz
Am nächsten Tag hat uns die Regimentskapelle mit Musik zum Bahnhof gebracht. Von Osterode ging
es über Thorn, Posen,
Annaberg, Warschau, Brestlitowsk ins Pruschana-Lager. Das war eine russische Artillerie-Kaserne, in der 2 deutsche,
3 österreichische Bataillone und eine Offiziersschule untergebracht waren. Ein Bataillon das waren wir 18 und 19
jährige, die Anderen waren Männer bis 45 Jahre. Als wir in Osterode abfuhren lag Schnee, in Annaberg/Schlesien waren
die Kühe auf der Weide und im Pruschana-Lager lag der Schnee wieder einen Meter hoch. Drei Kilometer vor unserem vor
unserem Lager war die Bahnfahrt zu Ende. Mit den schweren Tornistern waren viele überfordert, wir mussten immer wieder
warten bis alle nachkamen. Unsere Unterkünfte das waren Baracken die den Russen als Pferdeställe gedient hatten. In
jeder Baracke wurde eine Kompanie mit Schreibstube untergebracht, die nur durch ein Zelt abgegrenzt war.
Wir haben aus Brettern Doppelbetten hergestellt, in jeder Baracke war ein Ziegelofen. Unsere neuen Uniformen und die
scharfe Munition mussten wir abgeben und bekamen dafür alte Bekleidung, sowie Ecksezierpatronen. Hier ging es wieder
Kasernenmäßig zu, das jüngere Bataillon bekam besseres Essen, doppelte Portionen und nach dem Essen 2 Stunden Bettruhe.
Wenn jemand die Bettruhe nicht einhielt und dabei erwischt wurde wusste zur Strafe Holz hacken oder Schnee schaufeln.
Zwei Wochen war Frost bis minus 40 Grad, da hatten wir keinen Unterricht im Freien, alle Aktivitäten fanden in der
Baracke statt, die nur mit nassem Holz beheizt wurde und dem entsprechend war auch die Temperatur im Inneren. Um
Brennmaterial für die Küche zu besorgen mussten wir ins nächste Dorf gehen und von zerfallenen Häusern Holz holen.
Als endlich das Tauwetter einsetzte verwandelte sich die Gegend um Baranowitschi in ein unüberwindbares Sumpfgelände.
Wir wurden mit anderen Einheiten die aus Frankreich zu uns verlegt wurden, zusammengelegt. Wenn jemand nachweisen
konnte dass er Landwirt ist und mehr als 100 Morgen Ackerland besitzt, konnte er einen Urlaub zur Frühjahrsbestellung
beantragen. Ein Gottlieb Piotrowski aus Plohsen hat seinen Urlaub bewilligt bekommen und durfte für 14 Tage nach Hause.
Wenn von der unweit entfernten Front Kanonendonner zuhören war und Alarm ausgerufen wurde, dachten wir es geht los.
Obwohl wir als Reserve aufgestellt waren mussten wir allzeit einsatzbereit sein. Wir haben auch Bunker und Stollen
gebaut, Schützengräben ausgeworfen und mit scharfen Handgranaten exerziert.
Als Gottlieb Piotrowski nach 2 Wochen zurückkam waren wir schon in Alarmbereitschaft und sind dann auch 2 Tage später
ausgerückt. Kamerad Piotrowski hatte mir noch ein großes Paket von zu Hause mitgebracht.
Italien hat Deutschland und Österreich den Krieg erklärt.
Zuerst sind drei Bataillone Österreicher ausgerückt, dann die Deutschen hinterher. Bis zum
Bahnhof Linowa wurden wir von einer Musikkapelle begleitet, dann ging es per Eisenbahn ab nach Baranowitsche. Dort
wurden wir der, an der Westfront aufgeriebenen, 15ten Reserve Division zugeteilt. Es wurde uns gesagt das Kameraden
aus der Heimat gleichen Gruppen zugeordnet werden können. Ich hatte einen Freund aus meinem Dorf, Gustav Spektor,
einen aus Groß Schöndamrau, Wilhelm Lukas und einen aus Ortelsburg, Karl Schlensack, wir kamen zu zusammen in eine
Kompanie. Zuerst waren wir in einem Kinosaal einquartiert, haben jeden Tag Schützengräben ausgehoben und Feldübungen
gemacht. Es war ein sumpfiges Gelände, so dass die Soldaten wegen den vielen Mücken, Netze auf den Köpfen tragen
mussten. Nach einem Gewitter wurde es plötzlich unerträglich. Die Mücken hatten meinen Freund so zerstochen dass sein
Gesicht dermaßen angeschwollen war und ich ihn gar nicht wieder erkannt habe.
Von Baranowitsche wurden wir wieder auf die Eisenbahn verladen, die uns mit unbekanntem Ziel Richtung Osten fuhr.
Nachdem wir unterwegs einmal zum Essenfassen gehalten haben, kamen wir in der Nacht in Krakau an. In der nächsten
Nacht befanden wir uns schon in den Karpaten, wo wir die Hügelketten zu Fuß überqueren mussten, die Fahrzeuge fuhren
um die Berge herum und wir mussten manchmal 2 Stunden warten bis sie uns wieder eingeholt hatten. So ging es immer
weiter bis wir auf einen Berg kamen wo wir Zelte aufgebaut und Biwak bezogen haben. Dort stießen wir auf türkische
Einheiten die auf Mauleseln Munition und Verpflegung über die Berge transportiert haben. Die Esel hatten ein Gestell
auf dem Rücken, auf jeder Seite eine Fass mit Wasser oder Kisten mit Proviant. Ihre Artillerie wurde von 6 Mauleseln
gezogen, während die Offiziere, ohne Sattel, ohne Zaumzeug, nur mit einem Hanfseil ausgerüstet, daher kamen.
Die Mannschaften marschierten wie es jeder für richtig hielt, mit aufgekrempelten Ärmeln, das Gewehr über den Tornister
gelegt, wie die Wilddiebe. Im Gegensatz dazu herrschte bei uns strenge Disziplin, wen jemand aus der Reihe ging kam
sofort der Kompanieführer angeritten, hat uns angeschrieen, uns klar gemacht dass wir keine Türken seien und nur auf
höheren Befehl etwas an der Marschordnung ändern dürften, wer dagegen verstoße, müsste mit einem 3tägigen Arrest
rechnen. Wir haben hinter der der Front Gewaltmärsche durchgeführt die dem Feind große Truppenaufmärsche vortäuschen
sollten.
Wir lagen in einem Buchenwald in Bereitschaft. Überläufer berichteten dass auf russischer Seite eine Großoffensive
vorbereitet wird. In einer Nacht wurde plötzlich Alarm geschlagen, der Russe war zu einem Angriff mit Gasgranaten
übergegangen. Wir lagen unter Zelten und hatten die Gasmasken gar nicht bei uns, sondern nur etwas abseits liegen. In
der Dunkelheit hat mach einer keine Gasmaske mehr gefunden. Es war ein fürchterliches Durcheinander. Dabei war es
unsere Pflicht die Maske immer an dem Tragriemen über dem Hals zu tragen, mit halb geöffnetem Deckel. Uns hat es zum
Glück nicht so stark betroffen weil wir auf einer Anhöhe lagen und die Gaswolken sich im Tal verteilten. Wir wurden in
höchste Alarmbereitschaft versetzt weil der Russe die österreichische Front durchbrochen hatte.
Eigentlich sollten wir noch an einer Gulaschkanone Essen fassen, aber es blieb uns dazu keine Zeit mehr. Der
Kompanieführer befahl uns die Zelte abzubrechen, auf den Tornister aufzurollen und in fünf Minuten marschbereit zu
sein. Die Kanoniere befanden sich schon in der Batteriestellung, luden die Granaten, die sofort abgefeuert wurden. Der
Battalions-Kommandeur versammelte die Kompanieführer und erteilte ihnen die Angriffsbefehle. Derweil sollten wir in
einem Eichenwal der schon mit Granattrichter übersät war, Deckung suchen. Bald hatten wir die Verbindung zu unserem
Batteriestab verloren. Wir warfen unsere Tornister auf einen Haufen, schwärmten unverzüglich, nur mit Sturmgepäck
ausgerüstet, 4 Handgranaten im Brotbeutel, zum Angriff aus. Wir robbten uns einzeln voran. Weil der Russe unsere
Stellungen schon überrannt hatte war jeder auf sich selbst angewiesen. Mann hörte kein Kommando mehr weil der Russe
inzwischen den Rückzug angetreten hatte, um sich auf einer Bergspitze zu verschanzen, von der er uns mit
Flachbahngeschützen beschoss. Irgendwann befanden wir uns in einem Schützengraben, wo ein Leutnant und 17 Mann aus
unserer Division die Stellung hielten. Unter Androhung von Gewalt befahl er uns den Graben sofort zu verlassen und am
Gegenangriff teilzunehmen. Wir sprangen über den Stacheldraht, duckten uns aber sofort im nächsten Graben damit das
mörderische Maschinengewehrfeuer uns nicht hinwegfegte.
Dort blieben wir bis zum Eintritt der Dunkelheit liegen. Wir konnten unsere Waffen nicht mehr einsetzen weil der Sand
die Gewehrschlösser blockiert hatte. Als es Nacht wurde herrschte ein gespenstische Stille. Wir krochen aus dem
Schützengraben und lauschten nach irgendeinem Lebenszeichen von anderen Kameraden. Dann hörten wir irgendwelche Laute
die wir nicht genau zuordnen konnten. Sie kamen aus einem Holzbunker ganz in der Nähe. Wir näherten uns ganz
vorsichtig, als plötzlich eine Schar österreichischer Soldaten herausstürmte. An unseren Stahlhelmen erkannten sie
dass wir Deutsche sind. Bald danach trafen wir auch auf 69 deutsche Soldaten die zu unserer Division gehörten. Dann
kam ein Hauptmann der uns mit Vorwürfen überschüttete, wir seien Feiglinge, wir hätten uns von unserer Einheit entfernt.
Wir haben ihm den Vorgang geschildert, aber ließ nicht mit sich reden und sagte nur dass wir bestraft werden und nichts
zu essen bekommen. Wir wurden einer Maschinengewehr Einheit zugeteilt welche die vorderste Stellung verteidigen
musste. Wir hatten einen Stollen mit 2 Ausgängen.
Die Russen haben bemerkt das sich etwas bewegte und haben uns unverzüglich mit Artilleriefeuer belegt. Schon die
dritte Granate war ein Volltreffer. Vier Kameraden waren sofort tot, ich bekam mit einem Stollenbrett in den Rücken
der sofort blau und grün angelaufen war. Ich schaute nach oben, alles war verschüttet. Ich wusste nicht das da noch
ein Ausgang war, doch die Kameraden die hier in Stellung waren haben mir geholfen das Freie zu erreichen. Ich habe
mich am nächsten Tag krank gemeldet, dachte 2 Tage Schonung zu bekommen, aber der Sanitäter hat mir nur den Rücken mit
Spiritus eingerieben und mich wieder, zurück zu unserer Kompanie geschickt. Sie bestand nur noch aus 3 Gruppen, die in
einem Stollen, der in einen Berg gehauen war, Stellung bezogen hatten. Wir konnten uns hier wenigstens waschen, an
einer Quelle die aus dem Felsen sprudelte. Wir waren nicht mehr einsatzfähig und mussten durch andere Truppenteile
verstärkt werden.
Beim Essen holen musste man auch das Gewehr bei sich haben, es wurde erzählt dass hier der braune Bär herumwandert.
Ich habe keinen gesehen, nur das die Toten ausgescharrt wurden und verstümmelt herumlagen. Nach einigen Wochen haben
die Deutschen eine Gegenoffensive gestartet, von den Bergen herunter, über den Fluss Zlota Lipa, bis zu einer Stadt
die Brzezany hieß. 2 Tage später wurden wir auch eingesetzt, bei großer Hitze ging es in Dauermärschen vorwärts, man
durfte aus den Flüssen kein Wasser trinken, weil es mit Petroleum verseucht war. Nur wenn es dunkel wurde machten wir
halt, dann mussten wir Gräben ausheben um vor Überraschungen sicher zu sein.
Links von uns war Tarnopol und rechts Rumänien. Wenn es nach einer Ruhepause wieder losging dann war es am schlimmsten,
man ging wie auf Nägel, weil die Füße die Strapazen nicht so ohne weiteres wegsteckten. Im Dorf wurde niemals Rast
gemacht, denn da waren immer Brunnen, zu denen alle hinstürmten. Später wurden Melder vorausgeschickt, die von den
Dorfbewohnern Wasser in Eimern am Weg raussetzen ließen, damit die Soldaten Ihren Durst löschen konnten. Ein Soldat hat
gleich den ganzen Eimer mitgenommen und ihn dann als er leer war, irgendwo am Wegrand stehen lassen. Der Kompanieführer
kam angeritten, hat ihn ausgeschimpft und gedroht, ihn mit 3 Tagen Arrest zu bestrafen. Wir gehörten zur Südarmee
welche von Graf Bothmer befehligt wurde.
Die Stellungen waren schlecht ausgebaut, abends mussten wir, von der 2 Kilometer hinter der Front liegenden Feldküche,
Essen und andren Proviant holen. Ich war der Jüngste der Gruppe, musste immer 9 Kochgeschirre tragen, Brot und Post
habe ich in 2 Sandsäcke, die ich über der Schulter hängen hatte, verstaut. Wenn wir unterwegs waren wurde der
Laufgraben immer beschossen. Einmal schlug eine Granate am Schützengrabenrand ein und hat mich halb verschütte, die
Kochgeschirre aus den Händen gerissen, so dass ich ohne Verpflegung im vorderen Graben ankam. Nach drei Wochen sollten
wir abgelöst werden Es hat jeden Tag geregnet, wir haben unsere Mäntel angezogen und uns mit Zelten bedeckt. Nach dem
wir abgelöst wurden kamen wir in ein Dorf dass von Juden bewohnt war. Die Bewohner waren froh dass wir keine Kosaken
waren, mit denen hatten sie vor ein par Tagen schon schlechte Erfahrung gemacht, die hatten ihnen beim Abzug Vieh und
Pferde weggenommen.
Der Boden war sehr fruchtbar, es wurden Hanf, Weizen, Hafer, Mais, Bohnen, Roggen und Kartoffeln angebaut. Die
Bewohner waren gerade mit der Ernte beschäftigt. Die Häuser waren nur aus Holz und Stroh erbaut. Die Leute lebten in
sehr ärmlichen Verhältnissen. Ich hatte mir in unserer Kantine für 20 Pfennig ein Taschenmesser gekauft, das hat mir
ein Bauer für 6 Eier und 2 Pfund Brot abgekauft, daraus hat er sich dann ein Rasiermesser geschliffen. Wenn unser
Versorgungstross auf denn holperigen Wegen nicht nachkam, haben im Dorf auch Verpflegung eingekauft. Die Leute hatten
Angst dass wir nicht bezahlen werden, doch wir bekamen meistens pünktlich unseren Wehrsold ausgezahlt und konnten uns
so manches genehmigen. Um unser Marschgepäck zu erleichtern haben wir so manches aus dem Tornister weg geworfen.
Unweit eines Dorfes wurde halt gemacht, wir sollten Zelte aufschlagen, doch niemand hatte mehr Zeltstöcke im Tornister,
alles war unterwegs liegen geblieben. Der Zugführer befahl uns ins Dorf zugehen und Stöcke zu besorgen. In einer
Scheune stießen wir auf eine Hühnerschar, mit den Stöcken haben wir einige Hühner erlegt, in einem Hanffeld gerupft
und dann im Eiltempo zurück zu unserer Truppe. Als wir ankamen war die Kompanie schon marschbereit, es gleich weiter,
mit dem Huhn im Tornister. Bei der nächsten Rast haben wir die Hühner ausgenommen und Holz besorgt um sie zu kochen,
doch wir mussten schnell wieder weiter marschieren und erst nach 2 Tagen konnten wir uns mit den Hühnern befassen,
leider waren die so alt das sie nicht gar wurden. Das Fleisch mussten wir wegwerfen, nur die Suppe konnten wir noch
gebrauchen.
Meine Verwundung am Pruth.
Wir befanden uns 8 km vor der russischen Grenze. Der Kompanieführer hatte uns informiert das
wir hier zum Einsatz kommen. Wir bekamen noch ein Mittagessen aus der Gulaschkanone, konnten unsere Feldflaschen mit
Tee, der mit Rum angereichert war, auffüllen, Munition und Handgranaten in Empfang nehmen und dann ging es zum Einsatz.
Um 3 Uhr begann das ganze Bataillon auszuschwärmen, sofort hat uns der Russen entdeckt und begann uns mit Artillerie
zu beschießen, je weiter wir vorrückten desto heftiger.
Bis zu einem Eisenbahndamm hatten wir gute Deckung, doch wir sollten den dahinter fließenden Fluss überqueren. Doch
plötzlich explodierte über meinem Kopf eine Schrapnellkugel, der Stahlhelm wurde mir vom Kopf gerissen, Tornister und
Koppel flogen auch weg, ich lag auf der Erde und wusste gar nicht was passiert war. Plötzlich fing Blut aus der
Kreuzbeingegend zu rieseln, aus dem rechten Oberschenkel auch. Gleich nebenan war ein Granattrichter, dort habe ich
Schutz gesucht. In der rechten Rockecke hatte man immer ein großes Verbandspäckchen, das habe ich herausgenommen und
auf die Wunde gedrückt, doch das Blut floss mir bis in den Stiefel. Links und rechts von mir schlugen Granaten ein,
dicke Erdbrocken und Schlamm fielen auf mich herab, doch in meinem Erdloch war ich vor Maschinengewehrsalven geschützt.
Der ganze Rücken war angeschwollen und ich konnte mich überhaupt nicht bewegen.
Die Deutschen mussten die Stellung den Russen überlassen, einer hatte mich entdeckt, da ich aber so blutverschmiert da
lag, hat er bestimmt gemeint ich wäre nicht mehr am leben und ist weitergegangen. Nach zwei Stunden habe ich gehört
das die Russen sich wieder zurückzogen, danach herrschte eine gespenstische Stille. Als es dunkel wurde kamen deutsche
Sanitäter mit Spürhunden und haben die Verwundeten aufgesammelt. Ich wurde auf eine Trage gelegt, lag gebeugt und
konnte mich nicht rühren weil der blutverschmierte Rücken völlig verkrustet war. Ein Pferdegespann konnte nur vier
Tragen befördern, die Fahrt über Ackerfurchen war eine Tortur, ich habe nicht geglaubt das ich es überleben werde. In
einer Dorfkirche wurden wir dann ausgeladen und zu den etwa 50 Verwundeten gelegt die da schon lagen.
Mich haben sie zu den Bauchschüssen gelegt, weil ich einen Nervenschock hatte und am ganzen Körper gezittert habe. Zu
trinken bekam ich nichts, nur einen feuchten Lappen in den Mund. Ich sollte gleich operiert werden, aber es kamen
immer mehr Verwundete, so bekam ich nur eine Tetanusspritze, wurde verbunden und für den Weitertransport ins Hinterland
vorbereitet. Im Morgengrauen wurden wir auf Lastautos verladen, die aus auf ein Landgut brachten, wo wir in einem
Pferdestall untergebracht wurden. Die Fahrer fuhren so schnell über die Granatlöcher, das wir vor Schmerzen geschrieen
haben. Wir baten sie langsamer zu fahren, aber die bekamen es in ihrem Führerhaus nicht mit, erst alt ein Verwundeter,
der einen Krückstock bei sich hatte von hinten die Scheibe einschlug wurde die Fahrt erträglich. Lastautos, die
Munition und Verpflegung an die Front transportiert hatten, brachten in den nächsten Tagen immer wieder Verwundete
ins Hinterland. Die Deutschen hatten an diesem Fronabschnitt hohe Verluste zu beklagen. Wir können von Glück reden
dass wir dem Höllenfeuer überhaupt entkommen sind.
Wir wurden mit Lastautos, die ein Feldlazarett uns geschickt hatte, bis nach Lemberg befördert. da wurden wir gewaschen,
rasiert und frisch verbunden. Auf einem Nebengleis stand ein Lazarettzug, in dem wurden wir anschließend in frisch
bezogenen Betten untergebracht. Der Zug brachte uns über Annaberg nach Freiburg in Sachsen, eine Stunde hinter Dresden.
Hier wurden wir auf Tragen gebettet und mit einem Möbelwagen in ein Reservelazarett transportiert.
Im Heimatlazarett.
Als ich am nächsten Tag aufwachte und das schöne Bett sah in dem ich lag, dachte ich dass ich
im Himmel bin. Ich dankte meinem Herrgott das er mich bis zu diesem Ort begleitet hat. Am Nachmittag kamen Schulkinder
mit Geschenken und haben uns schöne Lieder vorgesungen. Anhand von Röntgenaufnahmen wurde in den nächsten Tagen
festgestellt dass bei mir ein Schrapnellsplitter an der Wirbelsäule in die Kreuzbeingegend eingedrungen war. Ich wurde
jeden Tag in Salzwasser gebadet und bekam wieder volle Verpflegung, da mein Magen zum Glück nicht verletzt war. Auf
dem Transport bekam ich nur Suppe und bei Bedarf einen feuchten Lappen auf die Lippen. Ich bin von 62 auf 43 Kilogramm
abgemagert, gehen konnte ich wegen dem Nervenschock den ich bei der Verwundung erlitten hatte auch noch nicht. Die
Wunde am rechten Oberschenkel war nur ein Streifschuss und wurde mit einem Schutzverband versorgt.
In den nächsten Tagen habe ich einen Brief nach Hause geschrieben und mitgeteilt wo ich mich zurzeit befinde. Meine
Eltern schickten mir ein Paket mit Lebensmitteln, jetzt konnte ich essen was ich wollte. Das Essen im Lazarett war
nicht besonders, jeden Tag nur Kohlblätter. Der weg zu den Toiletten führte durch einen Gemüsegarten. Die gehfähigen
Kameraden haben den ganzen Kohlrabi aufgegessen, so dass schließlich Wachposten aufgestellt werden mussten. Sechs
Wochen lang konnte ich mich nur auf allen Vieren fortbewegen, denn sobald ich mich aufrichtete wurde es mir
schwindelig und ich musste zurück ins Bett.
Als ich wieder bei Kräften war habe ich meinen Eltern mitgeteilt das ich mich in ein Lazarett in ihrer Nähe verlegen
lassen will. Der Chefarzt hatte mir zugesichert, wenn die Möglichkeit besteht in Ortelsburg unterzukommen, wird er dem
zustimmen. Meine Mutter hat daraufhin, in Ortelsburg, beim Lazarettinspektor Zantopf nachgefragt und er hat angedeutet
das sie mich aufnehmen können. Daraufhin bekam ich die Krankenpapiere und einen Fahrschein nach Ortelsburg. Da ich als
Soldat nie Heimaturlaub hatte, beschloss ich zuerst meine Eltern zu besuchen. Ich fühlte mich noch sehr schwach, habe
nach jedem Kilometer Rast gemacht, aber letztendlich war ich wieder daheim bei meinen Eltern. Die Wiedersehensfreude
war sehr groß. Ich bin am 30 Juli verwundet worden und am gleichen Tag wurde mein ältester Bruder beerdigt. Er bekam
den Splitter einer Gasgranate ins rechte Bein und ist an einer Blutvergiftung verstorben.
Am nächsten Tag brachte mich mein Vater ins Garnisonslazarett nach Ortelsburg. Ich wurde jeden Tag gebadet und massiert,
weil die Rückenhaut am Knochen angewachsen war konnte ich mich nicht schmerzfrei bücken. In Ortelsburg verbrachte ich
noch sechs Wochen, bis Ende Oktober, da wurde es schon ziemlich kalt und in unserer Barackenunterkunft ziemlich
ungemütlich. Kohlen und anderes Brennmaterial lagen im Hof auf Halde, aber es war verboten zu heizen. Kameraden die in
der Nähe zu Hause waren konnten Sonntagsurlaub beantragen.
Einer von ihnen brachte von zuhause Brennholz mit und entzündete damit im Ofen ein wärmendes Feuer, andere holten vom
Hof Kohlen, so dass der Ofen in kurzer Zeit glühend heiß wurde und die Gefahr bestand das die Betten Feuer fangen
würden. Wir hatten die Betten schon weg gerückt, da kam der Feldwebel herein und fragte wer das Feuer im Ofen
angezündet hat, doch niemand fühlte sich angesprochen. Der Feldwebel hatte den Vorfall dem Stabsarzt gemeldet, als der
am nächsten Morgen zur Visite kam, war seine erste Frage: ”Wer hat gestern Abend das Feuer im Ofen angezündet”. Als
sich niemand meldete, schrie er uns an: ”Morgen wird alles entlassen, zum Ersatzbatallion, in Diez an der Lahn! Wer
gehen kann, sofort zur Schreibstube, Krankenpapiere und Fahrscheine abholen”. Er erinnerte uns noch daran am nächsten
Tag pünktlich am Bahnhof zu sein, weil eine Verspätung unangenehme Folgen für uns haben würde. Das war das Ende der
schönen Erholungsphase. Ich blieb noch eine Nacht zu Hause und bin dann am nächsten Tag von dort zum Bahnhof gegangen.
Wieder Kriegsverwendungsfähig.
Als wir am nächsten Tag in Diez angekommen waren, wurde ich gefragt ob ich aus dem Heimaturlaub
käme, als ich das verneinte wurden mir 2 Tage genehmigt und 14 Tage Genesungsurlaub dazu. Wieder zurück im
Ersatzbatallion bestand unsere Tätigkeit aus Wache schieben und Kartoffel schälen. Nach einem Monat wurden wir von
einem Generalarzt untersucht, er hat mich für nicht einsatzfähig befunden weil ich noch den Steckschuss im Rücken
hatte und das linke Bein 10 Zentimeter dünner war. Jetzt fing das Kasernenleben wieder von vorne an. Wachdienst,
Gewehr laden, sichern, Ehrenbezeugung, Einzelmarsch und Appell. Wer nicht weit nach Hause hatte bekam zu Weihnachten
Urlaub. Ich hatte zu Heiligabend und Silvester Torwache, denn nach Ostpreußen wurde niemand beurlaubt.
Nach Neujahr 1918 wurden wir neu eingekleidet und kamen nach Köln zur Baukompanie. Mit Musik wurden wir zum Bahnhof
gebracht. In Köln wurden wir noch mit Soldaten die von andern Truppenteilen dorthin verlegt wurden in einem großen
Kinosaal, im Stadtteil Edengarten untergebracht. Wir brauchten keinen Dienst zu machen und konnten zu Heilige Drei
Könige den Gottesdienst im Dom besuchen. Kameraden die aus irgendwelchen Gründen im Arrest saßen wurden gefragt ob sie
auch am Gottesdienst teilnehmen möchten, dann würde ihnen die Strafe erlassen. Fast alle haben dem zugestimmt. Einige
Tage später wurden wir wieder auf einen Transportzug verladen, der uns über Herbestal, Antwerpen nach Brügge in Belgien
brachte. Hier mussten wir den Zug kurzfristig verlassen und einen Luftschutzkeller aufsuchen, weil Fliegeralarm
gemeldet wurde. Danach ging es wieder weiter nach Turut, Kortemark, Hauseme, Kautremollen, Zaren, Zarenlinde. Dort
wurden wir in verschiedene Gruppen aufgeteilt und einer Pionierkompanie auf dem Pionierpark Struwendorf zugewiesen.
Wir haben hinter Klerken Bunker für schwere Maschinengewehre gebaut. Unsere Arbeit konnten wir nur bei Nebel verrichten,
denn bei Sonnenschein waren wir sofort dem Beschuss der feindlichen Artillerie ausgesetzt. eine Kleinbahn die Munition
und Stacheldraht an die Front brachte war dem Beschuss besonders ausgesetzt. Die Gleise, von schweren Geschossen
zerfetzt, mussten immer wieder hergerichtet werden, damit der Nachschub aufrechterhalten werden konnte. Später haben
wir am Kemelberg bei Armentier, eine Brücke über die Lys gebaut. Um in dem Sumpfgelände einen Untergrund dafür zu
schaffen, mussten wir 10 bis 12 Meter lange Pfähle in den Boden rammen. Ein Feldwebel gab immer den Befehl: „Hoch den
Bär, noch viel mehr, dass man sieht, wie er zieht, denn dieser Pfahl, glatt wie ein Aal, durch Fels und Stein, durch
Wasser und Sand, fürs Vaterland”. Jedes mal mussten wir den Bär an Schnüren hochziehen und dann wieder herunterlassen.
Wenn es manchmal, trotz vieler Mühe nicht mehr weiter ging wurde der Pfahl auf eine bestimmte Länge abgeschnitten.
Nach Fertigstellung der Brücke kamen wir in die Siegfriedstellung bei Kambrei, zum Bau eines Bataillons-Gefechtstandes.
Da der Boden kreidehaltig war, mussten wir die großen Stücke von Hand zu Hand reichen, den Schutt haben wir dann mit
Sandsäcken aus der Baugrube gehoben und mit Ästen getarnt, damit der Stand nicht von feindlichen Fliegern entdeckt
werden konnte. Alle acht Stunden wechselte die Arbeitsgruppe. Wir mussten von der Baustelle durch das Gelände robben,
denn aufrecht gehend war man dem Beschuss der feindlichen Scharfschützen ausgesetzt, die von einem Fesselballon aus
informiert wurden der über den feindlichen Linien stand.
Der Wechsel war mit einem großen Risiko verbunden, und wurde wenn Möglich bei Dunkelheit vollzogen. Um vor
Überraschungen sicher zu sein haben wir spanische Reiter (Stacheldrahtverhaue) gebaut und vor die ersten Gräben
gestellt, die dann oft in der Nacht von den Franzosen geklaut, und dann vor ihren eigenen Linien wieder aufbaut wurden.
Wir hatten aus Bohlen eine Brücke auf Rädern gebaut, die dann in den Graben geschoben wurde, damit die Artillerie und
andere Fahrzeuge über die Schützengräben kamen. Weil um vier Uhr morgens der Beschuss mit Gasgranaten begann, mussten
wir Gasmasken aufsetzen, danach haben feindliche Flieger unsere Munitionskolonne bombardiert und total aufgerieben.
Es wurde auch eine Marinedivision eingesetzt, die bis dahin dem Küstenschutz gedient hatte und jetzt ihren ersten
Einsatz hatte.
Wir sind zuerst ein ganzes Stück in Richtung Amiens vorangekommen, doch dann blieb unser Angriff in den zuvor von
Engländern besetzten Stellungen, stecken. Da die Engländer ihre Stellungen fluchtartig verlassen hatten, fiel ihr
ganzer Proviant in unsere Hände; Schokolade, Weißbrot, Flaschenwein. Die erste Nacht haben wir in einem runden Zelt
verbracht, weil ich mir durch den starken Wind, der da herrschte eine Angina zugezogen hatte, die mit hohem Fieber
verbunden war, konnte ich die vielen Köstlichkeiten überhaupt nicht genießen.
An eine ärztliche Versorgung war überhaupt nicht zu denken, denn es mussten zuerst die vielen Granatlöcher eingeebnet
werden damit die vielen Fahrzeuge und Geschütze wieder weiter fahren konnten. Auch eine Bahnlinie musste repariert
werden, damit die großen Geschütze in Stellung gebracht werden konnten, dabei wurden auch die vielen Kriegsgefangenen,
die bei dieser Offensive gemacht wurden, eingesetzt. Als die Offensive dann schließlich scheiterte, wurden wir an die
Somme verlegt. Da habe ich die Ortelsburger Jäger, die aus Italien an die Westfront verlegt wurden, zum ersten Mal im
Einsatz gesehen.
Unser nächster Einsatzort waren dann Stellungen hinter Laon. Hier wurden die Vorbereitungen zu einer neuen Offensive
getroffen. Feindliche Flieger versuchten uns Tag und Nacht daran zu hindern die Aufmarschwege instand zu halten. Als
die Offensive dann endlich losging, hatten wir die Order eine Brücke über die Oise mit Bohlen und Balken zu verstärken.
Gleich am Anfang der Offensive mussten wir Gasmasken anlegen, um für alle Fälle gewappnet zu sein. Nur die Artillerie
und Kraftfahrzeuge durften die Landstraße benutzen, die Infanterie ging immer im Straßengraben und wurde von einer
Seite von Kopf bis Fuß mit Dreck bespritzt. Die Franzosen und Engländer haben hier schon Panzer eingesetzt, die von
Truppen aus den Kolonien gefahren wurden. Die Australier gingen mit umgekrempelten Ärmeln hinter den Panzern her.
Die letzte Offensive des Ersten Weltkrieges.
Zum Jahresende 1917 hatten noch 153 deutsche 175 alliierten Divisionen gegenübergestanden.
Zur Vorbereitung der Offensive ließ Ludendorff 39 Divisionen aus dem Osten und aus Italien heranziehen. Er ließ
spezielle Angriffsdivisionen formieren, die durch intensive Ausbildung auf den beabsichtigten, schnellen Vormarsch
vorbereitet wurden. 6608 Geschütze, 3500 Minenwerfer und 1070 Flugzeuge wurden hinter dem vorgesehenen
Angriffsabschnitt konzentriert. Den Ausbildungsbefehlen Ludendorffs, die bis zu den Kompanieführern herab verteilt
wurden, konnte man entnehmen, dass der Versuch, den Krieg mit einem mächtigen Schlag zu entscheiden schon in der
nächsten Zeit gewagt werden sollte. Wir übten die fast vergessenen Formen des Schützengefechts und des
Bewegungskrieges, auch wurde eifrig mit Gewehr und Maschinengewehr geschossen. Wir hegten keinen Zweifel daran, dass
der große Plan gelingen würde.
Den ganzen Winter 1917/18 über plante der Generalquartiermeister Ludendorff die deutsche Offensive. Zwar hatten die
Vereinigten Staaten von Amerika dem Deutschen Reich am 6. April 1917 den Krieg erklärt, aber vor dem Sommer des
Jahres 1918 war mit dem Auftreten von US-Truppen in relevanter Größenordnung nicht zu rechnen. Der deutschen Führung
blieb nur ein schmales Zeitfenster, um die Niederlage und den zu erwartenden Diktatfrieden abzuwenden. Ypern,
Armentieres, Arras, Cambrai oder Verdun wurden ernsthaft als Schauplätze erwogen. Ludendorf entschied sich für einen
Angriff zwischen Cambrai und La Fere – genau an der Nahtstelle zwischen der Französischen Armee und dem britischen
Expeditionscorps.
Der Fluss Somme bildete die Grenze zwischen Franzosen und Briten. Die Briten – nicht die Franzosen – sollten das Ziel
des Vorstoßes werden. Ihre Stellungen waren nur 130 Kilometer von der Kanalküste entfernt. Beim erreichen der
Sommemündung wäre die gesamte britische Armee eingeschlossen gewesen, denn hinter ihnen lag die Straße von Dover.
Am 21. März 1918 begann die letzte entscheidende Offensive des deutschen Westheeres im Ersten Weltkrieg. Der
Angriffsstreifen war 75 Kilometer breit. Dort hatte Ludendorff 43 Angriffsdivisionen konzentriert, dahinter 30
weitere Reservedivisionen, ihnen standen lediglich 26 britische Divisionen gegenüber. „Michael“ – so der Deckname der
„Kaiserschlacht“ – lief dank Ludendorffs akribischer Vorbereitung gut an. Der britische Oberbefehlshaber General
Douglas Haig erkannte die Chance, welche die Deutschen in dieser Situation hatten. Wollten die Deutschen diese Chance
nutzen, mussten sie darauf verzichten die Somme zu überschreiten, wo sie auf die französischen Reserven treffen und
sich von der Küste entfernen würden. Genau diesen Fehler begingen jedoch die Deutschen.
Am dritten Tag überschritt der linke Flügel mit der 18. Armee die Somme. Ludendorf stellte die Taktik über die
Strategie, wie er das bei Tannenberg und der Schlacht an den Masurischen Seen auch schon getan hatte. Ludendorffs
Befehl an die 18. Armee vom Abend des 22. März 1918 lautete: „Jetzt gilt es den Sieg auszunutzen, den Feind nicht zum
Stehen kommen zu lassen, Somme und Crozat-Kanal zu überschreiten, bevor feindliche Verstärkungen wirksam werden“.
Was Haig befürchtet hatte, trat nicht ein. Die deutsche Offensive Lief weiter Richtung Süden und lief sich schließlich
tot. Am 31 März war Ludendorff zu der Erkenntnis gekommen, dass „Michael“ gescheitert war. Am 5. April wurde die
Einstellung der Offensive befohlen. Im Hochsommer waren die US-Truppen in Frankreich angekommen und gingen mit den
Franzosen zum Angriff vor. Nur mühsam konnten Hindenburg und Ludendorf den Zusammenhalt der Front waren. Am 24. Oktober
1918 forderte US-Präsident Woodrow Wilson die bedingungslose Kapitulation, am 11.Nuvember Wurde der Waffenstillstand
von Compiegne unterzeichnet.
Zusammenbruch der Westfront und Waffenstillstand .
Als die Offensive dann letztendlich gescheitert war, wurden wir auf Eisenbahnwaggon verladen, in
eine Stellung vor Verdun gebracht und der siebenten bayerischen Division zugeteilt. Als wir ausgeladen wurden nahm der
Franzose den Bahnhof unter Beschuss. Eine Granate traf einen Waggon der mit Seifenpulver beladen war, so dass der ganze
Bahnhof aussah als wäre gerade Neuschnee gefallen. Wir gingen auf die Suche nach Kartoffeln. Als ich mit einem Sack,
vollbeladen die Böschung runter ging um zur Feldküche zu gelangen, schlug unweit von mir eine Granate ein und riss mir
den Sack vom Rücken. Ich bin mit dem Schrecken davon gekommen, mir war nichts passiert.
Der Bahnhof war menschenleer, nur ein par Kaninchen liefen verschreckt durch die Gegend und einigen Kameraden gelang
es welche einzufangen. Am nächsten Tag gelang es uns endlich die Feldküche zu erreichen. Als wir gerade beim Essen
fassen waren, schlug unweit eine Granate ein so dass Pflastersteine das Dach durchschlugen und wir das Weite suchen
mussten. und wir wieder nichts zu Essen bekamen. Ein Friseur aus unserer Kompanie fuhr immer ins Hinterland um uns
mit Proviant zu versorgen. Als er 14 Tage vor dem Zusammenbruch wieder mal zurückkam erzählte er uns schon das der
Krieg nicht mehr lange dauern würde, weil Kaiser Wilhelm mit Frack und Zylinder bekleidet, Deutschland verlassen und
ins Ausland gehen würde. In unserer Einheit hatten wir auch einen Juden der glaubte dass er sich alles erlauben darf.
Eines Morgens ging er in die Küche, als er keinen Koch vorfand stieg er auf die Gulaschkanone und hob den Deckel vom
Kessel in dem der Kaffee kochte an. Der kochende Kaffee verbrühte seine Füße so sehr das er sofort ins Lazarett musste,
für ihn war der Krieg somit zuende. Es kam noch ein Erlass, das Kameraden die 2 Jahre aktiv gedient hatten und
Gefreiter waren sofort zum Sergeanten befördert wurden. Für den 11. November 1918 war ein Waffenstillstand vereinbart
und ab 11 Uhr sollte nicht mehr geschossen werden. Wir hatten unsere Kopfkissen aufgetrennt und eine Kissenschlacht
veranstaltet, um auf diese Art und Weise unserer Freude Ausdruck zu verleihen. Als die Federn durch die Luft flogen
brachen wir in Tränen aus.
In jeder Kompanie wurde ein Soldatenrat gewählt, der aus drei Mann bestand. Wenn der Kompanieführer jemanden bestrafen
wollte, musste er erst den Soldatenrat fragen, der die Strafe befürworten, aber auch ablehnen konnte. Die Offiziere
durften keine Achselstücke mehr tragen, was für sie einer Degradierung gleich kam. Wir waren in einem Dorf
einquartiert und morgens zum Appell angetreten, als einer vom Soldatenrat sich stockbesoffen vor den auf dem Pferd
sitzenden Kompanieführer stellte und schrie: „Alles hört auf mein Kommando”. Der Kompaniechef war wie vom Blitz
getroffen, ihm versagte die Stimme. Wir sahen ein das dies nicht so weiter gehen kann und wählten einen neuen
Soldatenrat. Unser Rückzug begann bei Konflanz, einer Vorfestung von Metz und führte uns zunächst über die
luxemburgische Grenze, wo wir in einem Ort einquartiert wurden. Als wir für die Küche Holz aus dem Wald holen gingen,
entschieden wir uns eine Eiche abzusägen, ohne uns dessen bewusst zu sein, in welchem Forst wir uns befanden. Als wir
beim fällen waren fielen plötzlich Schüsse, die wir auch sofort erwiderten, bis uns ein Elsässer der sich in unserer
Kompanie befand aufklärte: „Kameraden, wir befinden uns hier auf Luxemburgischem Hoheitsgebiet”.
Wir sind dann weiter durch das Fürstentum Birkenfeld marschiert, wo das Städtchen Merzig für uns geflaggt hatte. Das
Elsass haben wir auch noch kurz gestreift. Wo wir bei einem Bauern, der uns kein Stroh für das Nachtlager geben wollte,
einquartiert wurden. Daraufhin gingen wir in die Scheune und haben uns selbst was besorgt. Wir haben dann noch erfahren,
sie hätten ein Schwein geschlachtet und warteten auf den Einzug der Franzosen. Als wir uns 1917, an der Ostfront, in
den in Karpaten, im Einsatz befanden, waren unter uns auch viele Elsässer. Sie durften ihre Heimatpost nicht in
französischer Sprache schreiben, mussten ihre Briefe offen auf der Schreibstube abgeben, wo sie zuerst kontrolliert
und dann abgeschickt wurden. Als ich in einer Nacht, mit einem Elsässer auf einem Vorposten Wache schieben musste,
wollte er mich überreden zum Russen überzulaufen. Als ich darauf nicht eingehen wollte verschwand er plötzlich in der
Dunkelheit und ich habe ihn nie wieder gesehen.
Wir sind dann weiter Richtung Worms und Ludwighafen gezogen, dort wurden wir bei einem Mühlenbesitzer einquartiert,
ein Unteroffizier und vier Mann. Obwohl wir verlaust und verdreckt waren bestand die Müllerin darauf das wir in ihren
Betten übernachteten. „Wenn alles durch ist”, sagte sie, „werde ich alles gründlich reinigen”. Der Müller brachte uns
eine Gießkanne voll Wein und sagte wir sollen es uns Schmecken lassen. Wir haben reichlich davon Gebrauch gemacht, so
dass ich gar nicht weiß wie ich ins Bett kam. Das war meine Erinnerung an die Pfalz. Manchmal waren wir auch 2 Tage im
Quartier.
Vor dem Weitemarsch wurde uns immer gesagt welche Truppe die Vorhut und welche Truppe die Nachhut übernehmen sollte.
Die Nachhut hielt immer Verbindung zu den nachrückenden Franzosen und man muss staunen wie alles reibungslos, ohne
Zwischenfälle von statten ging, was wir in erster Linie dem General-Feldmarschall Paul von Hindenburg zu verdanken
haben, der den Rückzug an der Westfront koordiniert hat.
In Köln angekommen, erhielten wir im Volkshaus unsere Entlassungspapiere, Eisenbahnfahrscheine, Reisepässe,
unterschrieben von Oberstleutnant Mann. Wir mussten Köln umgehend verlassen, weil schon am nächsten Tag die
französischen Besatzungstruppen in einmarschieren sollten. Wir fuhren mit einem Zug der bis Allenstein fuhr, dort
wurden unsere Papiere vom Soldatenrat kontrolliert. Die jüngren Jahrgänge wurden festgehalten, zu neuen Einheiten
zusammengestellt und zur Sicherung der Ostgrenze gegen die Bolschewisten abkommandiert. Ich hatte gesagt das ich noch
einen Schrapnellsplitter in der Kreuzbeingegend habe und durfte daraufhin nach Hause fahren.
Kaum in Ortelsburg angekommen fiel ich wieder dem Soldatenrat in die Hände. Sie haben alles durchsucht, haben mir mein
Seitengewehr und eine Decke abgenommen, aber ich durfte weiter und bin dann kurz vor Weihnachten 1918 auf dem
elterlichen Hof angekommen. Schon auf dem Hof habe ich meine Kleider vom Leib gerissen, weil vor Läusen und anderem
Ungeziefer nicht mehr aushalten konnte und mich erst gründlich gewaschen bevor ich das elterliche Haus betreten habe.
Die Freude über das Wiedersehen war sehr groß.
“ Unser Leben zwischen den beiden Weltkriegen.”
Endlich wieder zurück in der Heimat
Rohmanen war durch die Kampfhandlungen 1914/15 zu einem drittel zerstört worden, aber schon
wieder im Aufbau. Die Firma Grzella aus Ortelsburg hatte die Bauarbeiten übernommen. Unter der Aufsicht von Polier
Karl Kontor wurden die Dachstühle errichtet. Ich habe mich, nach kurzer Erholungspause, auch als Zimmermanngehilfe am
Wiederaufbau beteiligt. Die Firma Grzella hat das Material geliefert und auch unsere Löhne gezahlt. Wegen meinem
Steckschuss bin ich dem VDK beigetreten und habe mit dessen Hilfe eine Rente beantragt die mir auch bewilligt wurde.
Nach vier Jahren wurde ich nach Allenstein zur Nachuntersuchung vorgeladen. Die ärztliche Untersuchung hatte ergeben,
das Geschoß sei verkapselt, und nur das linke Bein etwas in Mitleidenschaft gezogen. Daraufhin wurde die Rentenzahlung
eingestellt.
Der Stellmacher Adam Ornowski war im Krieg als Sanitäter eingesetzt und hatte auf Grund seiner Erfahrungen,
 Beziehungen zum medizinischen Dienst in Ortelsburg aufgebaut. Es wurden dort Lehrgänge in Erster Hilfe angeboten,
die von Prof. Dr. Kutz geleitet wurden. Adam Ornowski hat dafür gesorgt das einige junge Männer aus Rohmanen daran
teilnehmen konnten. Adam Ornowski, August Linka, Emil Rosowski, Johann Dembek, Emil Baschek und ich sind dann dem
Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes beigetreten und mussten jeden Sonntag am Lehrgang teilnehmen. Unser
Gruppenführer war Kreisobersekretär Albrecht, Landrat von Poser, als unser Ehrenvorsitzender, hat viel zu unserer
finanziellen Unterstützung beigetragen und hat dafür gesorgt dass die Bereitschaft eingekleidet wurde.
Beziehungen zum medizinischen Dienst in Ortelsburg aufgebaut. Es wurden dort Lehrgänge in Erster Hilfe angeboten,
die von Prof. Dr. Kutz geleitet wurden. Adam Ornowski hat dafür gesorgt das einige junge Männer aus Rohmanen daran
teilnehmen konnten. Adam Ornowski, August Linka, Emil Rosowski, Johann Dembek, Emil Baschek und ich sind dann dem
Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes beigetreten und mussten jeden Sonntag am Lehrgang teilnehmen. Unser
Gruppenführer war Kreisobersekretär Albrecht, Landrat von Poser, als unser Ehrenvorsitzender, hat viel zu unserer
finanziellen Unterstützung beigetragen und hat dafür gesorgt dass die Bereitschaft eingekleidet wurde.
In jedem Dorf wurde eine Unfallstelle eingerichtet, mit einem Verbandskasten und mit Verbandsmaterial für die erste
Hilfe ausgerüstet. Die Unfallstelle in Rohmanen, die am Haus von der Straßenseite, durch eine Tafel mit einem roten
Kreuz gekennzeichnet war, hatte ich zu verantworten. An Sonntagen wurden wir an Badestellen und bei Fußballspielen
eingesetzt, haben viele Übungen bei Waldbränden durchgeführt und auch Ausflüge nach Rudzany am Niedersee gemacht. Bei
der Einweihung des Tannenbergdenkmals in der Nähe von Hohenstein kamen wir an Straßenkreuzungen zum Einsatz.
Rohmanen hatte auch eine freiwillige Feuerwehr. Bis zum ersten Weltkrieg hat Friedrich Biella als Brandmeister das
Kommando gehabt. Er war aktiver Unteroffizier, hatte gute Führungsqualitäten und die Männer, die allesamt aus dem
aktiven Militärdienst stammten hatten zu ihm ein großes Vertrauen. Nach dem Krieg wollten diese Männer,
(Friedrich Nickel, Friedrich Willam, Julius Wittkowski, Jakob Janowski, Johann Gloddek, Gustav Bednarz), nicht mehr
weitermachen. Friedrich Biella, der inzwischen zum Gemeindevorsteher gewählt wurde, hat sich dann auf einer
Gemeinderatsitzung vorgeschlagen, für die Freiwillige Feuerwehr jüngere Kräfte anzuwerben.
Zum Brandmeister hat er Herrn Wilhelm Pilath vorgeschlagen. Der wurde dann nach Königsberg zur Fortbildung geschickt.
Der Feuerwehr gehörten nun folgende Personen an: Wilhelm Pilath(Brandmeister), August Linka(Stellvertreter), Gustav
Deptolla, Julius Matzey, Johann Dembek, Willy Willam, Gustav Rattay. Der Kreisbrandmeister war Heinrich Thalmann aus
Ortelsburg, sein Stellvertreter war Kreisobersekretär Salzmann. Der Bezirks-Kommissar bei der Ostpreußischen
Feuersozität War Herr Ernst Trzaska. Er hat dafür gesorgt das die Wehr uniformiert und mit Löschgeräten ausgerüstet
wurde. Da die alten Schläuche schon sehr marode waren, wurden sie durch moderne ersetzt, deren Kupplungen auch mit der
Motorspritze übereinstimmten.
Ernst Trzaska hat bei der Feuersozität und beim Landratsamt Finanzmittel beantragt und auch genehmigt bekommen. Der
Schneidermeister Wilhelm Baran wurde beauftragt Tuch und Drillichanzüge nach Maas zu schneidern. Er hat uns
Stoffmuster vorgelegt aus denen wir wählen sollten. Feuerwehrhelme haben wir auch bekommen. Die Gemeinde musste
Finanzmittel bereitstellen, einen Prozentsatz vom Gemeindebudget. Im Brandfall mussten für den Spritzenwagen Pferde
zur Verfügung stehen, von Willy Willam, Gustav Rattay, Julius Matzey und Gustav Dorka, weil sie in der Nähe des
Spritzenhauses wohnten. Am Spritzenhaus wurde ein großer Baum mit Querleisten aufgestellt, wo nach jedem Brand oder
einer größeren Übung die Schläuche zum trocknen aufgehängt wurden.
Der Kreisbrandmeister hat mindestens 2-3-mal im Jahr die Wehren besichtigt. Das ganze Dorf war dann auf den Beinen,
die Bauern mit Pferden, und andere Dorfbewohner mit Eimern und Spaten, wurden dann in verschiedene Gruppen eingeteilt.
Erst hat die Wehr sämtliche Aufstellungen am Gerät geübt; Grundstellung Fahrstellung und Marschstellung. Dann wurde
ein Brand angekündigt, die Feuerwehr mit der Spritze an den Brunnen, die Gruppen dort wohin sie beordert wurden, die
Bauern brachten mit den Wasserkiwen Wasser aus dem Brunnen zum Brandort. Wenn das Wasser im Brunnen alle wurde hat
man den Saugkorb in die Kiewen gelegt und dort Wasser entnommen. Die Wassergruppe ging mit Eimern zum Dorfteich, holte
Wasser und füllte damit die leeren Kiewen.
Der Löschtrupp ging mit Feuerhaken und Löschpatschen auf die umliegenden Gehöfte und versuchte das vermeintliche Feuer
von ihnen fernzuhalten. Nach dem Alarm wurde wieder am Spritzenhaus angetreten. Die Gruppenführer mussten angeben ob
ihre Gruppe auch vollständig erschienen war, denn Übungen wurden nur vor, oder nach der Feldarbeit durchgeführt, so
dass niemand eine Entschuldigung vorbringen konnte. Wer ohne begründete Entschuldigung nicht anwesend war erhielt eine
Verwarnung. Der Kreisbrandmeister erklärte dann welche Handgriffe den Vorschriften entsprachen und welche nicht. Die
Schläuche wurden noch schnell zum Trocknen aufgehängt. Anschließend gingen wir alle in den Gasthof Trzaska, haben über
vorhandene Mängel diskutiert, Verbesserungsvorschläge unterbreitet und zwischendurch den Durst gelöscht. Der
Kreisbrandmeister ist dann, nach einer kurzen Verabschiedung, ins nächste Dorf gefahren, weil er an einem Tag mehrere
Feuerwehren betreuen musste.
Der Rohmaner Dorffriedhof

Einen Kilometer vom Ende des Dorfes entfernt, auf der rechten Seite der Landstraße in Richtung
Ortelsburg, befand sich der Rohmaner Dorffriedhof. Wann dieser Friedhof angelegt wurde entzieht sich meiner Kenntnis.
Nach Aussagen älterer Dorfbewohner soll davor auch schon eine Ruhestätte vorhanden gewesen sein, und
zwar auf der linken Straßenseite gegenüber dem jetzigen Friedhof. An dieser Stelle befand sich bis in die
Nachkriegszeit ein kleiner Brunnen, aus dem die Dorfbewohner, das Wasser zum begießen der Grabbepflanzung auf den
Gräbern ihrer verstorbenen Angehörigen holten. Der Friedhof war in einer Hanglage angelegt, wahrscheinlich weil diese
Parzelle für eine landwirtschaftliche Nutzung nicht geeignet war. Um das Gräberfeld vor herumstreunenden Tieren oder
von der Weide entlaufenen Kühen zu schützen, hat man das ganze Gelände mit einem Holzzaun umgeben. Der Zugang befand
sich von der Straßenseite. Unter einem Torbogen hindurch wurden die Verstorbenen zu Grabe getragen. Die Gräber der
einzelnen Familien waren nebeneinander angelegt, mache, wie zum Beispiel die der Familie Trzaska, sogar mit einem
schmiedeeisernen Zaun eingefasst.
Nach dem 2. Weltkrieg verfiel der Friedhof immer mehr. Die nötigen Finanzmittel für die Pflege der Einfriedung konnten
von den restlichen noch verbliebenen Deutschen nicht mehr aufgebracht werden. An den gepflegten Gräbern konnte man noch
erkennen dass es Verwandte von noch in Rohmanen wohnenden Deutschen waren, oder von bereits im Westen Deutschlands
lebenden, die ihre noch in Rohmanen wohnenden Nachbarn damit beauftragt hatten. Die übrigen Gräber wurden von Jahr zu
Jahr immer mehr von Wildkräutern überwuchert und schließlich auch von Sträuchern und schnell wachsenden Bäumen.
In den späteren Jahren konnte man nicht mehr erkennen dass dort vor Jahren Tote zur letzten Ruhe gebettet wurden. Die
Natur holte sich das ganze Gelände zurück und nur unter großen Schwierigkeiten konnten Besucher aus dem Westen das
Friedhofsgelände noch betreten.
Das Gasthaus Trzaska

Nach dem ersten Weltkrieg hat der Gastwirt Friedrich Trzaska neben dem Gasthof einen großen Saal
für Festlichkeiten und Vereinsfeiern gebaut, in dem schon mal Feuerwehrfeste veranstaltet wurden. Ernst Trzaska war
Feuerkommissar bei der Ostpreußischen Feuersozität. Erich Trzaska war Vollziehungsbeamter beim Amtsgericht in
Ortelsburg. Unser Feuerkommissar war uns beim organisieren der Veranstaltungen sehr behilflich, hat uns den Saal, die
Musik und die Theaterstücke besorgt und die Feuerwehren aus den Nachbardörfern eingeladen.
Zu Manöverzeiten, vor dem 2. Weltkrieg und dann auch während des Krieges, waren im Gasthof Soldaten, meist im Range
eines Offiziers, einquartiert. Fräulein Mariechen Trzaska hat die Poststelle im Dorf betreut. Nachdem ich 1939 zum
Militär eingezogen wurde, hat sie, nach einer Schulung im Ortelsburger Krankenhaus, auch die Unfallmeldestelle
übernommen. Nach dem Krieg, pflegte sie mit vielen Bekannten, die bereits in der Bundesrepublik wohnten, einen regen
Briefwechsel. Auf dem Rohmaner Friedhof hat sie viele Gräber, im Auftrag von Angehörigen, die auf Grund ihrer
Abwesenheit, dazu nicht mehr in der Lage waren, gepflegt. Der Bauunternehmer Kurnitzki aus Ortelsburg, äußerte die
Bitte, sie möchte ihm doch ein Blatt vom Rosenstrauch, der auf dem Grab seiner Eltern steht, in den Brief legen. Als
sie uns den Brief vorgelesen hat, waren wir zu Tränen Gerührt. Sie hat als Letzte aus ihrer Familie, bis zu ihrem Tod
im Jahre 1960, in Rohmanen, im Gebäude der Gastwirtschaft gewohnt und ist auf dem Rohmaner Friedhof beerdigt worden.
Fleisch und Wurstwaren Karl Pelkowski
Im Jahr 1931 hat der Fleischermeister Karl Pelkowski, aus Grammen, direkt neben unserem Hof ein
Anwesen gekauft und dort eine Fleischerei eingerichtet. Er war mit meiner Schwester Frieda, verheiratet. Am Anfang hat
er die Schweine noch auf seinem Hof geschlachtet, später dann im Ortelsburger Schlachthof. Jede Woche fuhr er 2-mal,
mit dem Pferdewagen(Einspänner), nach Ortelsburg zum Wochenmarkt, wo er seine Fleisch und Wurstwaren zu Verkauf anbot.
Am Tag davor, wenn er die Wurst gekocht hat, kamen viele Rohmaner mit Kannen oder anderen Gefäßen, wegen der guten
Wurstsuppe, die er umsonst unter die Leute verteilte. Als Karl Pelkowski, Ende August 1939 zum Militär eingezogen
wurde, hat seine Frau das Pferd verkauft und den Beitrieb stillgelegt. Am Haus hing, immer noch die Tafel mit der
Aufschrift: Karl Pelkowski, Fleisch und Wurstwaren. Ein Witzbold hat irgendwann darunter geschrieben; „Fleisch und
Wurst waren einmal”, drauf hin hat Frau Pelkowski die Tafel entfernen lassen. Karl Pelkowski ist im Mai 1946 in
französischer Gefangenschaft verstorben. Seine Ehefrau Frieda, verstarb an ihrem 85. Geburtstag in Mettmann bei
Düsseldorf.
Die steinreichen Rohmaner Felder
Die letzte Eiszeit hat bei der Schmelze, auf der Rohmaner Feldgemarkung viele Steine und
Granitblöcke zurück gelassen. Überirdisch, aber besonders unter der Erde, gab es viele kleine, aber auch große Steine,
die, den Bauern, beim Pflügen und anderen Feldarbeiten sehr viel Schweiß, abverlangten. In einer Kiesgrube, auf dem
Feld des Bauern August Radek, lag ein Granitblock, von schätzungsweise 100 cbm. Vor etwa 80 Jahren, als man für diese
Steine noch keine Verwendung hatte, griffen die Bauern zu einer „List”. Weil er sonst nicht pflügen konnte, hat mancher
seinem Nachbarn, die Steine in der Nacht auf dessen Feld abgeladen. Als diese Tätigkeit unter Strafe gestellt wurde,
hat man die Steine in Schluchten gekippt und mit Mutterboden zugeschüttet. In späteren Jahren kam diese jedoch beim
pflügen wieder an die Oberfläche. Dann hat man aber schon Steine für den Straßenbau gebraucht und konnte sie so zu Geld
machen. Besonders im Raum südlich von Ortelsburg, bis zur polnischen Grenze, wo Steine eine Rarität waren, kamen sie
jetzt zum Einsatz. Auch beim Bau von Häusern, besonders für die Fundamente, wurden sie eingesetzt, weil auf diese
Weise viel Ziegeln eingespart wurden. Die Firma Gribienski aus Ortelsburg hat die großen Steine mit Dynamit gesprengt
und auf diese Weise die weitere Verarbeitung erleichtert.
Die Steine welche beim Pflügen aus dem Boden geholt wurden, hat man am Feldrand auf große Haufen zusammen getragen.
Wenn die Feldarbeit beendet war, sowie auch in den Wintermonaten, waren wir jeden Tag mit Steinen unterwegs. Wir sind
vorwiegend am Abend los gefahren, weil unter der schweren Last die Wagenachsen so heiß wurden und die Gefahr bestand,
das durch die Dehnung, die Räder blockiert würden. Bei einer Fahrt konnte man bis zu 24 Reichsmark verdienen, wogegen
1 Zentner Roggen für 8 bis 9 Reichsmark zu haben war. Ich bin selbst, mit dem Pferdewagen bis Fürstenwalde, Radostowen,
Luka, Altkirchen, Höhenwerder, ja sogar bis Friedrichshof gefahren.
In Rohmanen wurden auch rote Ziegeln gebrannt. Viele Häuser wurden, mit Ziegeln erbaut, die nur wenige 100 Meter von
der Baustelle entfernt hergestellt wurden. Der Lehn wurde auf den Feldern in der näheren Umgebung entnommen, dann von
Ochsen solange getreten, bis er so geschmeidig war, das er sich in Formen einstreichen ließ. Wenn die Ziegel in der
Form trocken war, wurde sie entnommen und in einem Brennofen gestapelt. Um einen Ofen richtig anzufeuern, brauchte man
12 Raummeter Holz, das im Zeitraum von ein par Tagen verheizt wurde. Der Fischer Karl Glitza hatte schon eine
Knetmaschine, die von einem Pferd angetrieben wurde, das mit verbundenen Augen, den ganzen Tag in die Runde ging.
Im Dorf waren auch vier Kalköfen, in denen so genannte Kalksteine, die sich an gewissen Stellen, im Erdboden befanden,
gebrannt wurden. Nach dem Brennen wurden die Steine mit Wasser abgelöscht und die daraus entstandne Masse diente, nach
dem Beimischen einer gewissen Menge Sand, dann als Bindemittel beim Häuserbau. Das Gerichtsgebäude und das
Lehrerseminar in Ortelsburg wurden mit Kalk, aus dem Rohmaner Brennöfen erbaut. Auch zum Bau einer Eisenbahnbrücke, auf
der, der Zug, den Sawitzfluß, von Ortelsburg nach Allenstein überquerte, hat mein Großvater, mit einem Ochsengespann,
Kalk gefahren.
Hinter der Scheune, beim Bauern Johann Dembek hat man Tonerde gefördert, aus der man mit Hilfe einer Formerscheibe,
die von einem Arbeiter mit Muskelkraft(Fußbetrieb) angetrieben wurde, schöne Krüge, Schalen und Vasen geformt hat.
Die Töpferware wurde, nachdem sie trocken genug war, auch in einem Ofen gebrannt, anschließend mit einer Lasur
überzogen und wieder gebrannt. Es wurden auch Kacheln zum Bau von Kachelöfen hergestellt, die mit verschiedenen
Ornamenten versehen, die Wohnstuben unserer Vorfahren schmückten. So haben unsere Großväter ihr Leben gemeistert und
nach und nach, unsere Dörfer aus der Rückständigkeit in die Neuzeit geführt.
Das gesellschaftliche Leben nach dem 1. Weltkrieg

Als der Lehrer Alfred Dorka, ein Frontkämpfer des Ersten Weltkrieges und ein Sportsmann, als
zweite Lehrkraft an der Rohmaner Schule angestellt wurde, hat er die Sitten und Gebräuche aus früherer Zeit wieder zum
Leben erweckt. Zuerst hat er die Jugend zusammen gerufen, einen Jugendverein und einen Fußballclub, gegründet. Zum
Vorsitzenden des Fußballclubs wurde Johann Gloddek berufen, der ihn auch geleitet hat. Bauer Wilhelm Spittka, der am
Rohmaner See wohnte, stellte Land für einen Sportplatz unentgeltlich zur Verfügung. Lehrer Alfred Dorka hat am
Rohmaner See eine Badestelle ausgesucht und ein Sprungbrett bauen lassen. An jedem Sonnabend im Sommer, bevor die
Sonne unterging, versammelte sich die gestammte Jugend des Dorfes an der Badestelle am See. Es wurde gebadet,
Heimatlieder gesungen, gespielt, im Fackelschein eines großen Biwakfeuers, bis in die späte Nacht hinein. Der Fischer
Karl Glitza hat uns Kähne zur Verfügung gestellt, mit denen wir auf den See hinausgepaddelt sind, dabei hatten wir viel
Spaß, was wiederum den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft gefördert hat. Ich habe mit meiner Mandoline den Gesang von
Volks- und Heimatliedern begleitet.
Der Rohmaner See liegt in einem Tal, dessen Hänge zu beiden Seiten mit Kiefern und Tannen bewaldet sind. Wenn man
gesungen oder Musiziert hat, hallte es von den Hängen zurück. Die Ufer waren mit Kalmus und Schilf bewachsen, was für
die Fischaufzucht von Vorteil war. Wenn man an einem sonnigen, windstillen Tag, am Seeufer spazieren ging, traf man
oft auf Flachstellen, an denen sich die Fischbrut im Sonnenlicht wärmte, wie ein Mückenschwarm. Im See befanden sich
folgende Fische: Karpfen, Hechte, Schleie, Barsche Plötze, Rotaugen, Aale und Krebse. Am Sonntagmorgen brachten viele
Rohmaner ihre Pferde zum See um sie zu baden.
Es wurden dort, unter der Aufsicht von Lehrer Dorka, auch viele Jugendfeste mit Theatervorführungen veranstaltet, zu
denen er selbst die Vorlagen organisiert hat. Der am See wohnende Bauer Johann Nadrowski, hat uns ein Scheunentor, als
Tanzboden zur Verfügung gestellt. Der Zimmermann Wilhelm Wittek hat uns eine Windmühle gebaut, die am auf dem Boden
liegenden Scheunentor aufgestellt wurde, dazu kamen Noch Tannen und Fichten, die das Ganze wie ein Bühnenbild
erscheinen ließen. Es wunden viele Bühnenstücke aufgeführt, unter anderen >Alte Weiber werden jung gemahlen<. Dazu bot
die Windmühle die entsprechende Kulisse.
Nach der Vorführung wurde der Boden aufgeräumt, um dann als Tanzdiele zur Verfügung zu stehen. Der Gastwirt Trzaska
hatte Tische und Bänke aufgestellt, Speisen und Getränke angeboten, so dass sich die die Veranstaltung bis in die
späte Nacht hinein zog. Es waren auch Leute aus Ortelsburg und anderen Nachbardörfern dabei. Im Winter hat Lehrer
Dorka eine Kreisrodelbahn eingerichtet, die von Zeit zu Zeit mit Wasser besprengt wurde, um die Gleitfähigkeit zu
verbessern. Von einer Anhöhe ging hinunter bis auf den halben See, was für alle ein großes Vergnügen war. Es kamen
Lehrer mit Schulklassen aus der näheren Umgebung um hier zu Rodeln.
Als Herr Lehrer Jobski als Hauptlehrer nach Rohmanen kam hat er mit dem Bürgermeister und der Gemeindeverwaltung
beschlossen, in der Nähe des Dorfes, auf einem zur Schule gehörenden Grundstück, einen Sportplatz anzulegen. Dafür
wurde gleich hinter den Gärten, 6 Morgen Ackerland abgetrennt, und nach Feierabend hat Lehrer Dorka mit den
Jugendlichen eingeebnet und gleich nebenan einen Graben für Schützenstand und Kugelfang ausgehoben. Am Sonntagvormittag
wurde Fußball gespielt und um 15:00 Uhr war Kleinkalieberschießen angesagt. Es musste auch ein kleiner Beitrag erhoben
werden, um Munition kaufen zu können. Eine Büchse konnten wir aus beim Kleinkalieberverein in Ortelsburg ausleihen.
Nach Hitlers Machtergreifung
Als Adolf Hitler an die Macht kam wurde die SA gegründet. Der Bürgermeister Michael Kownatzki
wurde zum Gruppenführer ernannt und folgende Männer haben sich freiwillig gemeldet: Wilhelm Matzey, Johann Gloddek,
Gustav Nadrowski, August Buttler, Karl Baran, Emil Nickel, Wilhelm Jaschinski, Emil Bork, Ernst Rattay und Gustav Bach.
Bei Versammlungen war die SA in Uniform angetreten um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Wer versucht hat Unruhe zu
stiften, egal aus welchem Grunde, wurde aufgefordert den Saal zu verlassen, andernfalls wurde er mit Gewalt entfernt.
Herr Lehrer Jobski wurde zum politischen Leiter ernannt, seine Frau hat die NS-Frauenschaft gegründet, Lehrer Dorka
die HJ, und so bekam die Dorfgemeinschaft, nach und nach ein anderes Gesicht. Der Sportplatz und der Schützenstand
wurden jetzt mehr als früher in den Mittelpunkt gestellt. Nach der Feldarbeit hat der Bürgermeister Fuhrwerke bestellt
und den Sportplatz noch besser herrichten lassen.
Der Bauer Wilhelm Both wurde zum Ortsbauernführer ernannt, mit der Aufgabe alles Land für den Anbau von Getreide und
Futtermittel bereitzustellen, oder wenn das nicht möglich war mit Wald aufzuforsten. Durch den Einsatz von Kunstdüngern
sollten größere Erträge aus dem Boden geholt werden, um den Viehbestand zu vergrößern und mehr Milch und Butter zu
produzieren. Deutschland sollte im Stande sein sich selbst zu selbst zu ernähren, ohne auf Importe angewiesen zu sein.
Frau Jobski hat, innerhalb der der NS-Frauenschaft, mit Hilfe von Fachkräften aus Ortelsburg, Lehrgänge veranstaltet,
auf denen man Backen und Nähen lernte. Auf den Bauernhöfen befand sich auch immer mehr Rassegeflügel, das eine erhöhte
Produktion von Eiern und Geflügelfleisch sicherstellen sollte.
Die Rohmaner Bauern hatten, außer in der Landwirtschaft, noch andere Verdienstmöglichkeiten in der Kreisstadt. In
Ortelsburg wurden vier Sägewerke betrieben, die mit Langholz aus dem Walde versorgt werden mussten. Wir haben eine
Kiefer von über 8 Festmeter angefahren, der wir zuerst 6 Meter Spitze abschneiden mussten, um diese Last überhaupt
auf den Wagen zu bekommen. Sechs Pferde musste angespannt werden um den Wagen zur befestigten Straße zu bringen.
Fichten und Tannen wuchsen bis zu einer Länge von 30 Metern. Auch beim Transport von Ziegel, von der Ziegelei zum
Bahnhof, konnte man gutes Geld verdienen.
Im Jahr 1934 wurde Rohmanen an das überregionale Stromnetz angeschlossen und schaffte auf diese Weise den Sprung von
der Petroleumlampe zur Glühbirne. Neben dem Grundstück von Karl Pietzonka wurde ein Transformatorhäuschen errichtet,
in dem der ankommende Strom von einer Hochspannung auf eine Verbrauchsspannung transformiert wurde. Es gab schon eine
Überlandleitung, die aus Richtung Ortelsburg kommend, quer über die Felder, in Richtung Neu Keykuth weiter ging.
Durch eine Zwischenspanne wurde der Transformator, mit der Hauptleitung auf Kownatzkis Feld verbunden.
Ein Stromanschluss konnte die Arbeit im Haus und Hof auf vielfältige Weise erleichtern, doch nur die besser gestellten
Bauern, sowie noch manche Pensionäre, die ein festes Einkommen hatten, konnten sich dass leisten. Weil nur wenige an
der Elektrifizierung teilnahmen, war ein Stromanschluss mit hohen Kosten verbunden. Nur Gustav Pietzonka, Gasthof
Trzaska, Friedrich Nickel, die Schule und Wilhelm Both, wurden in der ersten Phase erfasst.
Im Jahr 1952 wurde von den polnischen Behörden die zweite Stufe der Elektrifizierung eingeleitet, in der alle im Dorf
stehen Gebäude erfasst wurden. Am Anfang wurden nur Leitungen für Lichtstrom gelegt und auch nur 3 Lichtstellen pro
Haushalt bewilligt. Doch im nachfolgenden Zeitraum wurden dann, wenn Material vorhanden war, weitere Lichtpunkte
angelegt. 1952, am zweiten Wochenende im Advent, wurden dann die Leitungen geschaltet und alle waren von der
plötzlichen Helligkeit sehr begeistert. Wenn man Glühbirnen auswechseln wollte musste man am Anfang weite Wege
zurücklegen, um welche zu bekommen. In den 60ger Jahren wurden dann immer mehr Starkstromleitungen gelegt, weil die
Bauern elektrische Geräte kaufen konnten. Ende der 60ger wurden auch die Abbauten an das Stromnetz angeschlossen.
Das Urnengrab auf unserem Feld
Auf unserem Feld, in Richtung Seelonken, bin ich oft beim pflügen gegen Steine gestoßen, manchmal
rissen sogar die Stränge am Pferdegeschirr. Eines Tages nahm ich einen Spaten, Brechstange und einen langen Baum, um
der Sache auf den Grund zu gehen. Als ich eine Menge Sand ausgehoben hatte stieß ich auf eine steile, aus Steinen
errichtete Wand, die ich auch mit dem Baum nicht aus der Fassung bringen konnte. Ich habe den ganzen Vormittag gegraben,
konnte jedoch nicht unter die Steine kommen. Einige Tage später hatten wir in der Schule eine Bauernversammlung, da
habe ich Herrn Biella und Herrn Lehrer Dorka von meinem Fund berichtet. Am nächsten Morgen kam der Lehrer Dorka mit der
ganzen Schulklasse, mit Spaten und Sieben ausgerüstet auf unser Feld und fingen an die ausgehobene Erde zu sieben.
Lehrer Dorka benachrichtigte daraufhin den Leiter des Ortelsburger Heimatmuseums, der am nächsten Morgen vorbei kam um
sich die Fundstelle genau anzusehen. Er beauftragte ihn 4 Mann zu besorgen, um die Steine ringsum frei zu schaufeln.
Zwischen den Steinen durften wir die Erde nur mit Esslöffeln ausheben. Als es plötzlich zu regnen anfing hat Lehrer
Dorka die Brauerei Daum, in Ortelsburg angerufen, die uns über der Fundstelle ein Zelt errichtet haben, damit wir
ungestört weiterarbeiten konnten. Wir fanden 8 flache und 8 hohe Urnen zu beiden Seiten am Körper. Die Urnen wurden in
Gipsbinden eingewickelt und ins Heimatmuseum nach Ortelsburg gebracht, wo sie durch einen Fachmann, der extra aus einem
Königsberger Museum angereist war. Nach Reinigung der Urnen hat er festgestellt, das die Grabstätte etwa 2000 Jahre vor
Christi Geburt angelegt wurde und ein Doppelgrab war, in dem ein Toter liegend und einer in Hochstellung beigesetzt
wurde.
Die Nachricht von der Fundstelle verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Es erschienen viele Schaulustige, ganze
Schulklassen aus der Umgebung, mit Autos und zu Fuß. Durch die vielen Menschen wurden die bestellten Ackerflächen auf
unserem Feld sehr in Mitleidenschaft gezogen, eine Entschädigung haben wir nicht erhalten. Das Grab wurde vor dem
Heimatmuseum in Ortelsburg wieder so aufgebaut wie man es auf unserem Feld vorgefunden hat. Für den Transport der
Steine wurde ich entlohnt. Die Urnen hat das Königsberger Museum an sich genommen und wollte sie nicht wieder hergeben,
weil die solch einen Fund noch nicht in ihrer Sammlung hatten.
Sonnenwendfeuer
Am 24 Juni fand eine Sonnenwendfeier statt. Ein Brauch der an die alten Germanen erinnern sollte.
Der Lehrer Dorka hat den Bürgermeister beauftragt 2 Fuhrwerke in den Wald zu schicken, die Holz und alten Reisig holen
und auf dem großen Schulberg abladen sollten. Das Straßenbauamt hat uns Teertonnen zur Verfügung gestellt. Die ganze
Dorfgemeinschaft wurde eingeladen, am Abend, nach der Feldarbeit, an der Sonnenwendfeier teilzunehmen. Lehrer Dorka
hielt zuerst eine Ansprache, in der er anschaulich erklärte wie unsere Vorfahren in grauer Vorzeit gefeiert haben.
Nach dem offiziellen Teil wurden das Holz und die Teertonnen angezündet, es wurden Heimatlieder gesungen, wie: Wild
flutet der See, drauf schaukelt der Schiffer den schwankenden Kahn, Schaum wälzt er wie Schnee, von grausiger Mitte
zum Ufer heran, wild fluten die Wellen auf Vaterlands See, wie schön, oh trag mich auf Spiegel zu Hügel, Masovias See.
Masovia Land, mein Heimatland, Masovia es lebe mein Vaterland.
Lehrer Alfred Dorka und sein Wirken für Rohmanen.

Friedrich Biella hatte auf seinem Feld einen Granitstein mit einer geraden Seite, den haben wir
mit viel Schweiß an den Dorfteich transportiert und auf einer Erhöhung abgelegt. Der Stein sollte zum Denkmahl für die
Gefallenen des Ersten Weltkrieges umgestaltet werden. Da zu Wenige daran ein Interesse zeigten, wurde diese Idee fallen
gelassen und der Stein irgendwann ins Wasser gerollt. Der Lehrer Dorka war viele Jahre in Rohmanen tätig, dort hat er
später seine ehemalige Schülerin, Lotte Biella geheiratet. Er hat sich sehr für die Entwicklung des Dorfes interessiert,
war bei jeder Gemeindeversammlung anwesend und hat auf Schwachstellen hingewiesen die den Fortschritt behinderten.
Gemeinsam mit den Schülern hat er den Ehrenfriedhof für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges gepflegt, an der
Wegegablung nach Eichtal und zu Ehren des Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg eine Eiche gepflanzt.
Zum Advent hat Lehrer Dorka mit der Jugend einen Adventstern, in verschiedenen Farben gebastelt.
Der Stern wurde auf einer 2 Meter langen Stange befestigt, in der Mitte wurde ein Wachslicht angezündet, am Stern
wurde eine Schnur angebracht, wenn man daran zog rollte der Stern hin und her. Am ersten Wochenende im Advent
versammelten sich jung und alt, um den Stern durch das Dorf zu tragen. Alle schlossen sich dem vorausgehenden
Sternträger an, der den Stern durch die Hauptstraße und die angrenzenden Wege trug. Dieser Sternmarsch wurde an den
folgenden Adventwochenenden wiederholt.
Am ersten Weihnachtfeiertag wurde um 4:00 Uhr morgens ein Frühgottesdienst gehalten. Zuerst hat der Pfarrer eine
Andacht gehalten, dann haben die Kinder ein Krippenspiel aufgeführt und die Gemeinde hat schöne Weihnachtslieder
gesungen. Der Gastwirt Trzaska hat uns den Saal zur Verfügung gestellt. Wir hatten eine Posaunen- u. eine
Gitarrengruppe. Unter der Leitung von Herrn Willi Doormann spielten: Gottlieb Brosch, Fritz Ollech,
Gustav Rattay(Sopran), Wilhelm Pilath, Gustav Brosch(Alt), Fritz Both(Tenor) und Fritz Brosch(Bass).
In der Gitarrengruppe wirkten mit: Martha Ollech, Hedwig Ollech, Martha Lekzik, Martha Michalick und Auguste Lekzick.
Willy Doormann hat sie auf der Geige begleitet.
Kurz vor Ausbruch des 2. Weltkrieges
Bei der Aufstellung des Grenzschutzes(Regiment Buchholz), hat er als Hauptfeldwebel die
Gruppenführerkurse überwacht und selbst die fähigsten Männer dafür vorgeschlagen. Das Ausbildungspersonal hat das
Jäger-Battalion gestellt. Wir kamen zuerst ins Stadion(Waldheim), wurden da eingekleidet und dann ging es gleich
kasernenmäßig zu, theoretisch und praktisch. Jeder musste vor die Front treten und nachweisen ob er im Stande ist,
Befehle zu erteilen. Abends wurden Filme vorgeführt die uns zeigen sollten wie eine Gruppe sich im Gelände entfalten
muss. Die Exerziervorschriften hatten sich, im Verhältnis zu Kaiser Wilhelms Zeiten, etwas geändert. Damals bestand
eine Gruppe aus 8 Mann und einem Unteroffizier, jetzt aus 10 Schützen, 3 für das leichte Maschinengewehr und einem
Unteroffizier(13 Mann). Nach der Schulung folgte eine Abschlussprüfung, danach ein gemütliches Beisammensein. Aus
Rohmanen haben folgende Männer die Prüfung bestanden: Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy, Gustav Rattay und
Gustav Deptolla. Unsere Uniformen waren alle zu klein und es gab viel zu lachen bei der Anprobe.
Die erste Übung habe ich mit Emil Rosowski, in Lenzinen gemacht. Der Gutsbesitzer Marzinzick hat seine Scheune als
Unterkunft zur Verfügung gestellt. Er war im Range eines Hauptfeldwebels. In seinem haus war die Schreibstube
untergebracht, die er selbst verwaltete. Ein Lastauto hatte Uniformen aus der Kaserne in Ortelsburg geholt, jeder
musste eine Uniform anlegen und dann wurde solange getauscht bis alle eine passende gefunden hatten. An den Namen des
Kompanieführers kann ich mich nicht mehr erinnern. 1935 wurden wir zu einer Übung in die Dragonerkaserne nach Lyk
einberufen. Die Gruppenführer, Zugführer, und Kompanieführer die schon Frontberührung im dem Ersten Weltkrieg hatten,
mussten eine Woche früher anreisen. Die Übungen waren auf 6 Wochen angelegt. Die meisten der einberufenen waren noch
nie mit dem Wehrdienst in Berührung gekommen. Jeder Gruppenführer bekam 13 Mann zugeteilt.
Unser Zugführer war Leutnant Neumann, Kompanieführer Oberleutnant Rutschko, Battalions-Kommandeur Major Gröning
(Regiment Buchholz). Hier ging es wieder Kasernenmäßig voran. Das Bataillon wurde hier vereidigt. Jeden zweiten
Sonntag durften unsere Frauen uns besuchen. Ein Jahr später wurden wir wieder zu einer Übung einberufen, auf den
Truppenübungsplatz nach Arys. Jeder Gruppenführer hatte den Auftrag die Gruppe zu entfalten, und auf bewegliche
Figuren zu schießen. Diese Übung musste später mit scharfer Munition wiederholt werden. Jedes Maschinengewehr bekam
50 Schuss, jeder Schütze 20 Schuss zugeteilt. Nach dem Abschießen wurden die Treffer gezählt und dem Kommandierenden
Bericht erstattet. In einiger Entfernung spaziert ein Storch umher, der gar nicht bemerkt hatte dass geschossen wurde,
was bei den Kameraden ein großes Gelächter hervorrief.
Nach der Übung wurde uns gesagt das jeder Gruppenführer eine arische Abstammung nachweisen sollte. Ich konnte in den
Rheinsweiner Kirchenbüchern meine Vorfahren aus Gellen, bis zum Jahr 1732 zurück, nachweisen und wurde zum
Unteroffizier befördert. Aus unserem Dorf wurden auch, Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy und Gustav Deptolla
befördert. Zwischendurch mussten wir schon mal in die Radfahrer-Kaserne nach Ortelsburg, Gewehre empfangen und im
Gelände üben. Am 31 Juli 1939 wurde mir von einem Soldaten ein Schreiben übereicht, das mich aufforderte, am 1. August
um 6:00 Uhr, bei der 3. Kompanie, des 2. Infanterieregiments zu erscheinen.
Um 5:30 hat mich meine Schwester in die Kaserne gebracht. Auf der Schreibstube erklärte mir der Hauptfeldwebel,
dass mir ab sofort der Dienstgrad eines Sanitäters zugewiesen wird, ich mich in der Kammer einzukleiden hätte und mir
in der Handwerkerstube die entsprechenden Schulterklappen annähen lassen sollte. Die aktiven Sanitäter wurden den
Feldlazaretten zugewiesen und wir kamen an ihre Stelle. Unser Bataillon wurde nach Schodmak zum Bunker bauen und
Stacheldraht verlegen eingeteilt. Wir zogen in Begleitung einer Musikkapelle bis zur Kreuzung am Krankenhaus, dann
weiter zu unserem Bestimmungsort, gefolgt von einer Gulaschkanone die in den nächsten Tagen für unsere Verpflegung
sorgen sollte.
Am 14 August haben wir die Jägerkaserne, begleitet von einer Musikkapelle endgültig verlassen und zogen zuerst durch
Ortelsburg, dann über Lehmanen ins Feldmanöver, hinter Rohmanen. Dort entfaltete sich das Bataillon im Gelände, die
Verwundetensammelstelle wurde auf dem Hof des Bauern Friedrich Neumann eingerichtet. Gegen Abend wurde zu Sammeln
geblasen und Biwak bezogen, wobei unsere 3.Kompanie, in einem kleinen Wallt, in der Nähe von Otto Nickels Gehöft
Stellung bezogen hatte. Die 2. und 4. Kompanie hatte sich in der Nähe vom Abbau Pallasch niedergelassen. Die Frau
Nickel hat am Abend ein Mädel in Dorf geschickt um meiner Frau Bescheid zu sagen, wo wir uns zurzeit befinden. Meine
Frau ist dann noch gekommen um sich von mir zu verabschieden, weil wir am nächsten Morgen um 3:00 Uhr Zelte abbrechen
und um 4:00 Uhr in Richtung Kaspersguth marschieren sollten.
Wir sind dann über Achodden, Seelonken, Lehmanen, Ortelsburg, bis nach Grammen und Schützendorf marschiert, wo wir an
einem See Biwak bezogen haben. Es wurde immer gesagt, wir kommen zum Tannenberg-Denkmal bei Hohenstein, wo ein Reichs
Kriegervereinsfest stattfinden sollte. Es wurden auch schon Vorkommandos aufgestellt, doch dann kamen wir nach Orlau
und Lahna-Mühle, da wo die Alle entspringt haben wir 2 Tage biwakiert. Unser Kompanieführer hat uns nach Waplitz auf
den Soldatenfriedhof des Ersten Weltkrieges geführt und uns erklärt wie das Jägerbataillon sich 1914 hier entfaltet
hat und aufgerieben wurde. Dann mussten wir in der Nähe von Gut Koslau über einen Fluss und bezogen in einem Waldstück,
vorbereitete Stellungen in der Nähe der polnischen Grenze. Herr und Frau Thalmann haben uns jeden Tag, bis zur Grenze,
mit Brötchen und Getränken versorgt. Es wurde scharfe Munition ausgegeben, weil wir am nächsten Morgen um 4:00 Uhr die
polnische Grenze überschreiten sollten.
Am nächsten Morgen um 10 Minuten vor 4:00 Uhr kam der Befehl; scharfe Munition abgeben, alles zurück in ein 6 Kilometer
entferntes Dorf, wo wir auch einquartiert wurden. Das alles geschah’ eine Woche vor dem 1. September 1939. Es wurde
gesagt dass der Führer dem polnischen Präsidenten Rid-Szmigly, ein Ultimatum gestellt hat und es wahrscheinlich nicht
zum Krieg mit Polen kommt. Genau nach 5 Tagen kehrten wir wieder in die gleichen Stellungen zurück, es wurde wieder
scharfe Munition ausgegeben und am nächsten Morgen um 4:00 Uhr überschritten wir die polnische Grenze.
“Der 2. Weltkrieg.”
Der erste Einsatz in Polen
Wir kamen zuerst in ein Dorf in dem sich nur alte Menschen befanden. Auf unsere Frage wo denn die Bewohner wären sagte
man uns dass alle geflohen sind, weil erzählt wurde, die Deutschen würden alle Polen misshandeln und verstümmeln. Ich
habe ihnen daraufhin gesagt dass uns, unter Androhung von Strafe verboten wurde, einem Zivilisten etwas anzutun. Das
Vieh, die Schweine und Hunde des Dorfes liefen frei herum und die Soldaten fingen an auf die Hunde zu schießen, bis
gesagt wurde es seien Meldehunde im Dienste der Deutschen Wehrmacht und dieser Unfug der eigenen Truppe schaden würde,
weil etwaige Querschläger eigene Kameraden verletzen könnten. Wir gingen weiter auf polnischer Seite entlang der Grenze,
bis wir am Nachmittag die ersten Vorposten der Festung Mlawa erreichten, da befanden wir uns plötzlich im Feuerhagel
polnischer Festungsflack.
Am nächsten Morgen hatte ich schon 3 Verwundete und wusste nicht wo sich eine Verwundeten Sammelstelle befindet. Ich
suchte den Bataillonsgefechtstand auf der sich auf einer Anhöhe befand. Ich habe unseren Oberstabsarzt gefragt wo denn
die Verwundetensammelstelle wäre. Er rief beim Tross an, wo er die Auskunft erhielt, das sich vor dem Dorf ein Bunker
befindet in dem man die Verwundeten sammeln sollte, die dann von Sanitätsautos abgeholt würden, weil das Dorf unter
Artilleriebeschuss stand. Am Sonnabend haben unsere Flieger die Bunkerstellungen bombardiert, konnten aber, trotz guter
Treffer nicht viel ausrichten, die Bunker wurden nur etwas angekratzt.
Der Beschuss unserer vordersten Linien ging mit unverminderter Heftigkeit weiter. Am Sonntag verkündete eine große
Staubwolke die Ankunft unserer Panzer, doch sie kamen nur bis zur Panzersperre und mussten wieder abdrehen ohne den
Polen einen schaden zuzufügen. Ein Panzer bekam einen Volltreffer, der Fahrer konnte noch umkehren. Er blutete am Kopf
und der Schütze war so eingeklemmt, das wir ihn nur mit einem Seil unter den Armen, durch die Luke nach oben ziehen
konnten. Ob er seine Verwundung überlebt hat ist mir nicht bekannt, denn in der Nacht wurden Panzergeschütze nach
vorne in Stellung gebracht, die direkt in die Schießscharten der Bunker geschossen und so die Verteidiger vertrieben
haben. Daraufhin sind wir weiter vorgerückt. Auf einer Wiese war ein tiefer Graben ausgehoben und mit Ästen getarnt,
da war ein Panzer hinein gefahren, so dass nur das Hinterteil herausragte und er sich nicht aus eigner Kraft befreien
konnte. In der Luft waren Flieger die Brandbomben abwarfen, ich habe mich auf den Boden geworfen weil ich dachte die
würden explodieren, aber sie zischten nur, so das Stoppeln und Graß rings herum in Brand gerieten.
Bei den Kampfhandlungen gab es mehrere Verwundete, denen ich gerade Verbände anlegen wollte, als unser Hauptmann zur
Trillerpfeife griff um mir klar zu machen, dass ich ihm folgen sollte. Die Polen fingen an zu schreien, ich sollte
sie ins Lazarett bringen denn hier im Wald würde sie niemand finden. Ich setzte mich aufs Fahrrad und folgte unserem
Kompanieführer, der mir sagte ich soll immer bei der kämpfenden Truppe bleiben, denn hinter der Front sind die
Sanitätsabteilungen, die werden die Verwundeten schon versorgen. Der Vormarsch dauerte bis in die späte Nacht. Auf
einem Gehöft, das nach allen Seiten durch Feldwachen abgesichert wurde, machten wir endlich Rast. Wir haben
Getreidegarben auf dem Hof ausgebreitet und uns zur Ruhe gelegt, als plötzlich um Mitternacht Leuchtraketen den Himmel
erhellten und Maschinengewehrfeuer uns aus dem Schlaf schreckte. Ein par polnische Soldaten hatten das Feuer eröffnet,
aber sich kurz darauf ergeben.
Die Narew-Überquerung
Als es hell wurde ging der Vormarsch weiter. Es wurde uns untersagt Tagebuch zu führen, darum
weiß ich nicht wie die Orte hießen, durch die wir marschiert sind. Als wir durch ein sumpfiges Gelände vor drangen
stand auf einer Anhöhe am Horizont, die polnische Artillerie, die uns sofort unter Beschuss nahm. Unser Hauptmann war
der Meinung dass wir schon in der Nähe des Flusses Narew sein müssten, als aus den Sträuchern ein mit Schlauchboten
beladenes Lastauto auftauchte. Wir wurden aufgefordert mit je 6 Mann ein Schlauchboot zu nehmen, an einem Aggregat
der daneben stand mit Luft zu füllen und zu Wasser zu lassen. In einer Stunde war das ganze Bataillon über die Narew,
wo der Vormarsch fortgesetzt wurde. In einem Dorf überraschte uns die polnische Kavallerie und fing sofort mit
Maschinengewehren zu schießen an. Da kam der Befehl: Alles wieder zurück. Es ging noch schneller als auf der Hinfahrt.
Wir sind erst einige Kilometer am Fluss entlang gegangen und haben dann zum zweiten Mal rüber gesetzt.
Die Gehöfte im Dorf standen alle in Brand. Auf einem waren viele Bienestöcke. 2 Kameraden wollten den Stöcken Waben
entnehmen, doch die Bienen durch das Feuer aufgeschreckt, überfielen sie sofort und stachen derart zu das sie nicht
mehr wieder zu erkennen waren. Ich habe die Einstichstellen mit Salmiak betupft, mehr konnte ich nicht tun. Wir mussten
auf unserem Vormarsch durch einen Wald der in Flammen stand, so dass man kaum atmen konnte. Es ging weiter in Richtung
Minsk und Warschau, wo schon die Sowjetische Armee durchgegangen war, die Pferde und Vieh von einem Gut mitgenommen
hatten. In einem Wald stießen wir unverhofft auf ein Kloster, in dem wir einige Gefangene machten. Dann trafen wir auf
eine gute Straße die nach Grochow ging.
Als wir dort einmarschierten wurden wir aus den oberen Stockwerken beschossen, so dass wir, um uns zu schützen, nur an
den Hauswänden entlang gehen konnten. Wir haben jedes Haus nach Feinden durchsucht. Vor einem Haus stand ein Hund der
niemanden reinlassen wollte, solange bis ihn eine Kugel traf. Die polnische Artillerie feuerte von Warschau aus, um
unseren Vormarsch zu stoppen. Wir hatten uns gerade eingegraben als plötzlich deutsche Flieger am Himmel erschienen,
die unsere Stellungen mit Bomben bewarfen und dabei viel Unheil anrichteten. Wir haben sofort Fliegertücher
ausgebreitet und Leuchtraketen abgeschossen. Da ich in dem Graben, den ich kurz zuvor ausgehoben hatte, sofort in
Deckung gegangen bin ist mir zum Glück nichts passiert. Unter den anderen Kameraden gab es viele Verwundete, so dass
ich nicht wusste wem ich zuerst helfen sollte.
Der Oberstabsarzt hat mich sofort tatkräftig unterstützt, so das bald alle Verwundeten versorgt waren, außer einem,
dem ein Bombensplitter den Arm abgerissen hat. Ich habe im 3 große Verbandspäckchen auf die Wunde gelegt, doch die
Blutung ließ sich trotzdem nicht stoppen, so dass er eine Stunde später auf der Krankensammelstelle verstarb. Wir
haben danach in einem Tomatenfeld einen Graben ausgehoben und eine neue Abwehrstellung bezogen. Die Gruppe Schwarz
bekam den Auftrag nach etwaigen versprengten polnischen Verbänden Ausschau zu halten, als sie unerwartet aus einer
Häuserreihe mit Maschinengewehrsalven überschüttet wurden. Der Gruppenführer und noch ein Soldat wurden dabei tödlich
verwundet. Danach wurde noch ein weiter Stoßtrupp, unter der Führung von Leutnant Briskorn, der sich dazu freiwillig
gemeldet hatte, hinaus geschickt um den Gruppenführer und den anderen Toten zu bergen.
Bei diesem Unternehmen, das erfolglos ausging, weil die Toten schon verscharrt waren, durchschlug eine Kugel den
Stahlhelm von Leutnant Briskorn, der auch sofort tot war. Alle Toten wurden später, an der Kirchenmauer in Grochow, in
Särgen beigesetzt: Hauptmann Schönwald sagte, das sie nach dem Kriege auf den Heldenfriedhof nach Ortelsburg überführt
werden. Drei Tage lagen wir bei Grochow in Stellungen, waren dem polnischen Maschinengewehrfeuer sowie den Bomben
deutscher Flugzeuge ausgesetzt. In der Nacht musste ich zu einem Verwundeten in die vorderste Linie und habe den
Rückweg nicht mehr finden können, als plötzlich Gewehrfeuer aufflammte habe ich in den Ruinen Schutz gesucht. Erst im
Morgengrauen konnte ich mich wieder orientieren und zu meinem Unterstand zurückfinden.
Warschau wurde tagelang bombardiert und stand auch unter Artilleriebeschuss. Aus dunklen Rauchwolken kamen oft ganze
Bündel von Papier angeflogen. Die Verwundeten kamen oft auf Krücken zu unserem Unterstand, ich habe sie dann zur
Krankensammelstelle hingeführt. Wir haben auch polnische Zivilpersonen betreut, die während der Kampfhandlungen
verwundet wurden. Als einmal 2 Jungen vorbeiliefen hat einer ihnen nachgerufen sie sollten seiner Frau Bescheid sagen,
er wäre auf der Krankensammelstelle an der Kirche. Als wir dort ankamen war seine Frau, mit einem Kind auf dem Arm,
schon da.
Nach der Kapitulation von Warschau, gingen wir über Sokolow zum Bug und haben dort Quartier bezogen. Der Russe hatte
sich bereits hinter den Fluss zurückgezogen, hatte alles Vieh und Pferde mitgenommen. Dort erreichte mich ein Telegramm
von zu Hause, dass meine Tochter gestorben ist. Es sprach sich auch herum dass verschiedene Heimaturlaub bekommen haben,
ich durfte auch für 14 Tage heim. Wir fuhren mit Lastautos nach Allenstein in die neue Reiterkaserne, zum
Ersatzbatallion, da haben wir unsere Gewehre und Munition abgeben, dann durften wir, jeder in seinen Heimatort
weiterfahren.
Als wir unsere Quartiere am Bug verlassen haben war sehr viel Schnee gefallen. Hier in Ortelsburg fanden wir die
gleiche Wetterlage vor, aber nach 3 Tagen war alles wieder weggetaut und wir konnten die Kartoffelernte, die durch den
frühen Wintereinbruch gestoppt wurde, zu Ende bringen. Ein Tag bevor ich zu Hause angekommen bin wurde die Tochter
beerdigt. Nach 14 Tagen mussten wir uns in Allenstein melden, Gewehre empfangen und wieder zurück zur Division an den
Bug 150 Kilometer hinter Warschau. Die elfte Division, zu der wir auch gehörten sollte in den Westen Deutschlands
verlegt werden und war schon unterwegs zur Verladestation Skiernewice 50 Kilometer vor Warschau.
Mein Dienst als Sanitätsunteroffizier
Unser Bataillon kam in das Städtchen Burscheid, im Kreis Opladen, wo wir in Privatquartieren
untergebracht wurden. Nach 3 Monaten, im Januar 1940, wurden wir nach Solingen verlegt, wo wir bis zum
Frankreichfeldzug stationiert waren. Wir mussten an Feldübungen teilnehmen, wie andere die in Kasernen untergebracht
waren. Während dieser Zeit musste jeder seine Zähne in Ordnung bringen lassen. Jeden Tag fuhren 20 Mann in die
Cäzilienstraße nach Köln, zur Zahnklinik. Im Rheinland wurde unsere Division neu aufgestellt. Ausfälle durch den
Polenfeldzug wurden durch neue Soldaten ergänzt. Ich kam nun zum Ersatzbatallion, war der Älteste in der ganzen
Kompanie. Als der Frankreichfeldzug losging wurde unser Ersatzbatallion mit den noch vorhandenen Verwundeten, in die
neue Reiterkaserne, nach Allenstein verlegt.
Meine Frau hat, mit Unterstützung der Bauernschaft, einen Antrag gestellt, daraufhin wurde ich zur Frühjahrsbestellung,
beurlaubt und später bis auf weiteres vom Militärdienst freigestellt. Als der Russlandfeldzug losging wurde ich von der
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg, für 14 Tage einberufen. Ich war seit 1922, Mitglied der freiwilligen
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg und habe jedes Jahr an Übungen teilgenommen. Jede Bereitschaft musste etliche Leute
stellen. Von Rohmanen wurden Emil Rosowski, Johann Dembek, und ich, zur Krankensammelstelle Wirballen, in Litauen,
abkommandiert. Dorthin kamen Lazarettzüge aus Russland mit der Breitspurbahn. Die Verwundeten wurden frisch verbunden
und auf Waggon mit Normalspur verladen und nach Deutschland gebracht.
Als die 14 Tage vergangen waren wollten wir wieder nach Haus zurück, doch man wollte uns nicht entlassen. Stattdessen
wurden wir dem Wehrkreisamt Königsberg zugeteilt, neu eingekleidet und zur Aushilfe ins Lazarett nach Gumbinnen
abkommandiert. Mehr als ein Jahr war ich in den Urlauber-Baracken, habe dort Krankenstube betreut. Später, bis zum
Dezember 1944, war ich im Reserve-Lazarett 4, in Königsberg tätig. Dort habe ich auch die Luftangriffe der Engländer,
vom 25 bis 26. August 1944 miterlebt.
Wir sollten gerade einen Lazarettzug in Rotenstein entladen, als plötzlich die Sirenen ertönten - Fliegeralarm. Im
gleichen Moment waren die ersten Flugzeuge auch schon da, zuerst warfen sie „Tannenbäume” und danach Foßforkanister ab.
Die Omnibusse standen schon zur Abfahrt bereit als es losging. Wir haben die Verwundeten schnell in den
Luftschutzkeller getragen, haben die Betten von den Fenstern weggerückt damit die Verwundeten nicht von den
Glasssplittern verletzt wurden. Im Kasernenhof brannten die Fosforkanister lichterloh. Unsere Unterkunft, die sich in
einer Baracke befand ist völlig abgebrannt, mit dem Wenigen was wir unser Eigen nannten. Am nächsten Tag wurden wir neu
eingekleidet und am 29. bis 30. kamen die englischen Bomber wieder, sie setzten genau da ihr Zerstörungswerk fort wo
sie vor 3 Tagen aufgehört hatten.
Anfang Dezember 1944 musste ich mich nach Stablack melden und musste dann zur Sanitätsabteilung 1, nach Gernau, das
liegt zwischen Lodz und Warschau. Vormittags hatten wir Felddienstübungen und nachmittags theoretischen Unterricht.
Jeden Tag wurden Gruppen zusammengestellt und zu anderen Einheiten abkommandiert. Ich kam zu einer Panzerabteilung, wo
wir an einem Morgen plötzlich auf dem Kasernenhof antreten mussten und zu unserer Überraschung mit der Nachricht
konfrontiert wurden, dass der Russe an mehreren Frontabschnitten durchgebrochen war. Wir bekamen sofort einen
Marschbefehl in Richtung Lodz, wo das Stadtbild noch intakt war, selbst die Straßenbahnen fuhren noch. In der Nacht
haben russische Flugzeuge die Stadt bombardiert. Die Kaserne in der wir untergebracht waren hatte keine
Luftschutzkeller, aber zum Glück blieben wir von Bombentreffern verschont. Am nächsten morgen bot sich uns ein Bild der
Verwüstung. Die entgleisten Straßenbahnwagen, sowie andere Fahrzeuge blockierten die Straßen. Die Älteren unter uns
bekamen Fahrscheine für einen Transportzug, der bereit hinter Lodz abfahrbereit, unter Dampf stehen sollte. Als
russische Panzer in den Straßen auftauchten, verbrannte die Schreibstube unsere Wehrpässe und andere wichtige
Dokumente. Wir liefen zu der Station auf der unser Transportzug bereitstehen sollte, aber da war kein Zug mehr zu sehen
und wir setzten unseren Rückzug zu Fuß fort.
Der Rückzug und Zusammenbruch der Ostfront
In Dobroschin, einer Stadt in Polen, wurde gerade ein Lazarettzug verladen, doch wir kamen nicht
mehr zum Einsatz, weil die russische Infanterie uns schon auf den Fersen war. Es ging weiter über den Fluss Bober,
Sagan, bis nach Glogau an der Oder. Dort wurden wir der 29. motorisierten Sanitätskompanie zugeteilt. Im
Garnisonslazarett wurden noch Operationen durchgeführt. Unsere Division hatte ihr eigenes Feldlazarett, so dass wir den
Befehl zu Weiterfahrt erhielten und noch unbeschadet die Oderbrücke passieren konnten, denn Glogau wurde zur Festung
erklärt. Wir haben 2 Pferdewagen organisiert und mit Verbänden, sowie medizinischen Instrumenten beladen. So kamen wir
bis nach Lübbenau im Spreewald, wo wir in einem Schloss, in zuvor ein Museum war, unser Lazarett untergebracht haben.
Weil die Amerikaner Cottbus bombardiert hatten, wurden die Verwundeten zu uns nach Lübbenau gebracht. Hier haben wir
Tag und Nacht gearbeitet, um die vielen Verwundeten, aus den schweren Kämpfen bei Grünberg und Sagan zu versorgen. Die
Soldaten von der Abwehrfront kamen schon mit abgestorbenen Armen oder Beinen bei uns an, weil in vorderster Linie keine
Frontlazarette mehr vorhanden waren; es mussten viele Amputationen durchgeführt werden. Als für unsere Pferde kein Heu
mehr vorhanden war, schickte mich unser Hauptfeldwebel, zu einem Bauern in den Spreewald, mit dem Auftrag, Futter zu
besorgen. Mit noch zwei Mann fuhren mit zwei Kähnen, zuerst den Hauptstrom entlang und dann in einen Nebenarm; da haben
wir die Boote beladen und brachten das Heu nach Lübbenau.
Als wir uns bei unser Einheit zurück melden wollten, war alles schon marschbereit. Ich bin schnell in einen Bus
eingestiegen der sofort losfuhr, weil russische Verbände schon in sichtweite waren. Russische Flugzeuge kreisten über
den Dächern und nahmen, mit ihren Bordwaffen jeden unter Beschuss, der sich irgendwo blicken ließ. Wir konnten nur
durch den Wald, oder in der Nacht vorwärts kommen, denn wenn ein Auto auf der Landstraße fuhr, war alsbald ein Flugzeug
hinter ihm her und schoss es in Brand. Als wir nach Tagen am Ufer der Elbe ankamen, war bereits eine Ponton-Brücke
erstellt worden, welche die zerstörte Brücke ersetzen sollte.
Durch die vielen Fahrzeuge waren in den Sand tiefe Spuren gefahren, so dass andere Fahrzeuge unsere Busse ins
Schlepptau nehmen mussten, weil wir mit eigener Kraft nicht mehr weiterkamen. Beiderseits der Trasse standen
Flüchtlingswagen, in der der Hoffnung die Brücke passieren zu können, doch SS-Polizei verhinderte das die Gespanne den
militärischen Rückzug zum Stillstand brachten. Es gelang uns die Elbe zu überqueren, um in einem Waldstück Schutz vor
feindlichen Fliegern zu suchen.
Als wir unsere Busse und Autos gut getarnt hatten, hat unser Bataillonschef die anwesenden Parteigrößen zu sich
gerufen und ihnen erklärt das wir eine Einheit des Roten Kreuzes sind und nach internationalem Recht keine Waffen
besitzen dürfen. Nach langer, erregter Diskussion wurde beschlossen einen Graben auszuheben und alles im Sand zu
verscharren. Als wir dann weiter, durch die Dörfer fuhren, sahen wir schon viele weiße Bettlaken, als Zeichen der
Kapitulation, aus den Fenstern hängen. Es wurde uns erzählt dass der Bürgermeister von der SS erschossen wurde, weil
er die Bevölkerung zu diesem Schritt ermutigt hatte. Jetzt waren hinter uns die Russen und vor uns schon die Amerikaner.
Amerikanische Panzer fuhren umher und schossen wild durch die Gegend, ohne ein Ziel anzuvisieren. Niemand wollte sich
dem Russen ergeben, doch der Weg der zu den Amerikanern führte, war durch abgesägte Bäume blockiert. Wir sind schnell
in das nächste Dorf gegangen, haben uns Sägen und Äxte besorgt, die Bäume durchgesägt und in den Straßengraben
geworfen.
“ Nach dem Ende des 2. Weltkrieges.”
In amerikanische Kriegsgefangenschaft
Dann fuhren wir unter internationaler Flagge an eine Mulde Brücke, vor der zwei amerikanische Soldaten, mit Zigarren,
zur Hälfte im Mund, standen. Sie rauchten und kauten gleichzeitig. Wir mussten auf einen freien Platz fahren, alle
aussteigen und rechts wieder antreten. Wäschebeutel und Tornister mussten wir abstellen; danach wurden wir nach Waffen
durchsucht, Wertsachen, Uhren und Messer wurden uns gleich abgenommen. Als wir anschließend an unserem Gepäck
vorbeigingen durfte niemand was mitnehmen. Als ich gebückt, nach meinem Wäschebeutel greifen wollte, in dem sich noch
3 Konservendosen und ein Brot befanden, bekam ich einen Fußtritt ins Gesicht, so dass mir ein Zahn ausgeschlagen wurde.
Wir wurden dann in einem Garten zusammen getrieben und gefragt ob jemand bei der SS gedient hat. Nachdem wir in Reihe
und Glied angetreten waren, mussten wir den Oberkörper freimachen und die Arme anheben. Es wurde nach SS-Zeichen
gesucht, die gewöhnlich unter dem Oberarm eintätowiert waren. Nachdem wir Grimma bei Leipzig, wo wir in amerikanische
Gefangenschaft geraten waren, verlassen hatten, mussten wir durch ganz Thüringen bis Hersfeld, an der Grenze zu Hessen,
marschieren. In Hersfeld wurden wir auf große Lastautos verladen, die von farbigen Soldaten gefahren wurden. Man hat
uns mit Stöcken hinauf getrieben, solange bis das Auto so voll war das man kaum stehen konnte. Die Soldaten fuhren, für
diese Straßenverhältnisse, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Wenn die Straße eine scharfe Kurve hatte, flogen
wir alle übereinander und mussten erst mit viel Kraftanstrengung auf die Beine kommen um diese Fahrt zu überstehen.
Da die Straßenränder in dieser Gegend mit Obstbäumen bepflanzt sind und deren Äste sehr niedrig hängen, hätten die
uns die Köpfe abgerissen, wenn wir uns nicht ständig geduckt hätten. Unsere Fahrt endete in Bad Kreuznach, in der Pfalz,
wo wir in ein Lager, in dem sich später 130.000 Mann und 6 Generäle befanden, eingepfercht wurden. Die Unterkunft der
Generäle befand sich unter einem Zelt, alle anderen mussten die Zeit unter freiem Himmel zubringen. Die Offiziere, die
Unteroffiziere, die Mannschaften; wurden in getrennten Camps untergebracht. Die Mannschaften wurden auch zur Arbeit
abkommandiert und konnten bei dieser Gelegenheit, Brot, Brötchen oder Zigarettenstummel organisieren, wogegen die
Offiziere und Unteroffiziere ihr Camp überhaupt nicht verlassen durften.
Die ersten Tage gab es kein Wasser und kein Brot, so dass die Kameraden vor Erschöpfung umfielen. Später standen wir
manchmal den ganzen Tag nach Wasser an, das von den, uns bewachenden Negern mit großen Wassertanks angefahren wurde. Am
dritten Tag bekamen wir mittags und abends etwas zu Essen; Brot bekamen wir erst nach zwei Wochen, nach dem aus der
Umgebung herbeigeholte Handwerker, Backöfen gebaut hatten. In den verschiedenen Gemeinden, die in den uns umgebenden
Weinbergen lagen, mussten sich alle Männer beim Bürgermeister melden. Als sie dann erschienen waren, wurden sie auf
bereitstehende Lastautos getrieben und zu uns ins Lager gebracht. Sie waren ohne Kopfbedeckung und ohne wärmere
Bekleidung angekommen, weil ihnen gesagt wurde, dass ihr Aufenthalt im Lager nur von kurzer Dauer sein würde. Man hat
uns, falls noch vorhanden, Decken und Mäntel abgenommen, mit der Begründung, sie würden für Kranke und Verwundete
gebraucht. Jeden Tag starben mehr als 200 Mann, die wir sofort in ein Zelt tragen mussten. In der Nacht wurden die
Toten dann mit unbekanntem Ziel, weggefahren.
Viele haben ihren Verstand verloren uns irrten im ganzen Camp ziellos umher. Als Latrinen wurden Gräben ausgehoben, in
die verschiedene Kameraden, bei der Verrichtung ihrer Notdurft, vor Schwäche hineingefallen sind und nicht mehr wieder
heraus kamen. Aus den Pfählen die, die jungen Obstbäume stützten, haben wir Krankentragen gebaut um unsere Kameraden,
bei Bedarf, zur Krankensammelstelle zu tragen. Es war in diesem Frühjahr auch sehr kalt, doch unsere Erdlöcher, die wir
zum Schutz vor Kälte und Wind, nur mit leeren Konservendosen ausgehoben hatten, durften nicht tiefer als 20 Zentimeter
sein. Nach jedem Regenguss mussten wir das Wasser ausschöpfen. Nach einem Gewitter, standen wir wiedermal, total
durchnässt in unserem Camp, als unerwartet am Horizont die Sonne hervortrat. Einer unserer Kameraden hatte noch eine
Trompete gerettet und fing, von dem Anblick völlig überwältigt, zu spielen an: "Es geht alles vorüber, es geht alles
vorbei, nach jedem Dezember, folgt wieder ein Mai". Daraufhin hob sich die Stimmung der tiefbetrübten Kriegsgefangenen,
so das Heimatlieder durch das ganze Camp erklangen, obwohl wir in den nassen Kleider herumgehen mussten, bis sie am
Körper trocken wurden.
In französischer Kriegsgefangenschaft
Nach etwa einem Monat, haben uns die Amerikaner, den Franzosen, zum Arbeitseinsatz, ausgeliefert.
Etwa 4 Kilometer von Bad Kreuznach entfernt, stand auf freier Strecke, ein Zug mit offenen Kohlenloren, auf den wir
verladen wurden. In jeden Waggon, wurde pro Person eine Tafel Schokolade und ein Päcken Zwieback rein geworfen, doch
viele Kameraden fanden nur leere Päckchen vor, weil die schon zuvor von der französischen Wachmannschaft geplündert
wurden. Wir haben uns darüber beschwert, doch die haben uns nur ausgelacht. Nachdem wir zunächst bei Mainz über den
Rhein fuhren, endete unsere Fahrt bei Paris in einem großen Zeltlager. Dort wurden wir auf andere Züge verladen, die uns
nach Südfrankreich, in ein Barackenlager, bei Mazarei, brachten.
Auf einer Zwischenstation hat man uns unter einer Pumpe, die Lokomotiven mit Wasser versorgt, abgestellt, den Kran
aufgedreht und uns anschließend ausgelacht, die Kinder Haben uns mit Steinen beworfen. Ein Wachmann kam in unseren
Waggon gekommen, hat unser Gepäck durchsucht, wenn er Tabak oder Zigaretten gefunden hat, nahm er sie mit. Die Kameraden
waren darüber so empört, dass sie vorhatten, ihn nachts unter den Waggon zu werfen. Wir haben sie gebeten dass zu
unterlassen, weil man uns in diesem Falle, alle erschießen würde.
Als wir ins Lager kamen wurden wir zuerst gezählt, dann mussten wir unser Gepäck stehen lassen und beiseite treten.
Wenn man bei der Nachkontrolle noch was in den Taschen fand, wurde das auch entwendet, selbst Esslöffel. Wir wurden
dann in drei Baracken, ohne Toiletten, eingeschlossen. Die Kameraden haben ihre Bedürfnisse in Kochgeschirre erledigt
und durch ein kleines Fenster, das sich fast unter der Decke befand, hinausgeworfen. Andere Fenster ließen sich nicht
öffnen, weil sie mit Stacheldraht zu geflochten waren. Als die Kameraden die Kochgeschirre auskippten, haben die
Wachposten geschossen und die Fenster zertrümmert. Sie waren der Meinung dass wir ausbrechen wollten. Es herrschte eine
große Hitze, in den überfüllten Baracken sind wir fast erstickt. Am nächsten Tag haben wir uns über fehlende Toilettem
beschwert, da haben sie Heringsfässer durch die Hälfte geschnitten und an der Ausgangstür hingestellt. Um bei den
überfüllten Räumen dort hinzukommen, musste man über die Köpfe der Anderen steigen. Viele hatten Fieber und Durchfall
und mussten in die Krankenstube eingeliefert werden, wo sie kurz darauf verstarben.
Besonders Raucher litten sehr an der Unterernährung, bekamen Wasser in den Beinen und waren die Ersten die verstarben.
Nach der Registrierung wurden wir auf andere Baracken verteilt. Die Zivilbevölkerung kam in die Räume und begann uns
auszuplündern. Wer noch gute Schuhe besaß musste sie ausziehen und bekam dafür die kaputten des Plünderers. Eine Woche
lang mussten wir diesen Zustand ertragen, erst als die Kameraden sich beschwerten, wurde am Eingang eine Tafel am
Eingang angebracht, dass die Zivilbevölkerung das Lager nicht betreten darf. Bis auf einige, wenige Ausnahmen wurde
diese Anweisung befolgt.
Als wir im Lager ankamen, war der französische Lagerkommandant, ein ehemaliger Kriegsgefangener, der bei einem Bauern
in Deutschland gearbeitet hatte. Dieser Bauer war jetzt als Kriegsgefangener in seinem Lager. Als er ihn erkannte, hat
er ihn gleich zum Küchendienst eingeteilt und mit dem nächsten Krankentransport nach Hause fahren lassen. Zu Mittag
bekamen wir nur gekochte Haferkörner, da schwamm alles oben, später war man dann auf Gerste umgestiegen. Als viele
daran gestorben waren, weil sie diese „Rohkost”, die nur ein Kuhmagen verträgt, nicht gegessen haben, hat man die
Körner durch eine Schrotmühle laufen lassen. Dann hat man uns Steckrüben gekocht; wir bekamen 250 Gramm Weißbrot,
etwas Quark und ein viertel Liter Magermilch. Später, als wir schon arbeiten mussten, hat man in unserem Essen einen
Kuhkopf mitgekocht, das hat dann bedeutend besser geschmeckt.
Bevor wir morgens zur Arbeit gingen, mussten wir zu Flaggenparade und abends, nach der Rückkehr, haben wir die Flagge
wieder eingeholt. Wir haben einen Kanal gereinigt, dessen Sohle 2 Meter dick mit Schlamm bedeckt war. Zuerst wurde das
Wasser abgelassen, dann haben wir, einer dem andern, den Schlamm mit der Schippe hoch gereicht. Der Letzte hat den
Schlamm, der so zäh war, dass er nicht von der Schippe wollte, oben am Rande abgelegt. Manchmal waren 10 Mann nötig um
den Höhenunterschied zu überwinden. Das Wachpersonal schoss über unsere Köpfe hinweg und rief: „schnell arbeiten”. Bei
der großen Hitze war das ein Ding der Unmöglichkeit, zumal es nichts zu Trinken gab. Auf dem Heimweg haben wir im Walde
Heilkräuter gesammelt, die man in der Küche getrocknet und als Tee zubereitet hat, den wir am nächsten tag zur Arbeit
mitnahmen, um unseren Durst zu stillen.
Unser Aufseher hatte einen Stock, an dem sich noch kurz abgeschnittene Äste befanden. Wer seiner Meinung nach, nicht
ordentlich gearbeitet hat, bekam gleich Schläge auf den Rücken. Die weißen Aufseher wurden irgendwann durch Neger
ersetzt, die uns bedeutend besser behandelt haben. Wenn irgendetwas schief ging, haben sie nichts gesagt, nur gelacht.
In den übrig gebliebenen Wassertümpeln hatten sich noch einige Aale versteckt, die wir zu fangen versuchten, was uns
auch manchmal gelang. Wir mussten ihnen das Genick brechen, damit sie uns nicht entwischen konnten. Wenn die Franzosen
bemerkten das wir Aale hatten, wurden sie uns abgenommen. Gelang es uns aber, sie ins Lager zu bringen, dann haben wir
uns eine köstliche Malzeit zubereitet.
Um sicherzustellen dass niemand geflüchtet ist, wurden wir, wenn wir abends ins Lager zurückkamen, zuerst gezählt.
Diese Zählung wurde mehrmals wiederholt, weil die Wachmannschaften sich immer wieder verzählt haben. Als einer von uns
hin ging, ihnen sagte dass alle da sind, wollten sie es nicht glauben und haben uns vor dem stehen lassen, bis es ihnen
irgendwann einfiel. uns doch das Tor zuöffnen. Einmal, als wir von der Arbeit zurückgekehrt waren, standen wir bis 23
Uhr neben der Flagge, weil uns niemand das Tor geöffnet hat. Als wir dann doch irgendwie ins Lager kamen haben wir
festgestellt, dass das ganze Wachpersonal betrunken war und niemand im Stande uns das Tor zu öffnen.
Eines Tages waren wir wieder abends zur Parole angetreten, als ein älterer Herr mit seinem Hund, am Stacheldraht
entlang, spazieren ging. Weil der Hund, unterm Stacheldraht hindurch, zu uns kam, hat ihn einer geschnappt, ihm das
Genick gebrochen und unter seiner Jacke versteckt. Der Franzose hat nach seinem Hund gerufen und gepfiffen, aber alles
vergebens, der Hund war nicht aufzufinden. Die Kameraden haben ihm gleich das Fell über die Ohren gezogen, das Fleisch
gekocht und das Fell in die Latrine geworfen. Das Fleisch wurde umgehend verspeist.
Als wir am nächsten Tag von der Arbeit zurückkehrten, war im Lager der Teufel los. Wir mussten sofort antreten und
wurden gefragt, wo der Hund geblieben ist, der Gestern Abend, mit seinem Herrchen, am Zaun entlang spazieren ging. Als
sich niemand dazu bekannte, mussten wir weiterhin stehen bleiben, während die Wachmannschaften von Baracke zu Baracke
gingen und alles durchsuchten. In einer Latrine hat man dann das Fell gefunden, was uns ein furchtbares „Donnerwetter”
einbrachte und in den nächsten Tagen, nach der Arbeit, unter dem Kommando eines Oberfeldwebels, eine Stunde
nachexerzieren.
In Südfrankreich regnet es den ganzen Sommer nicht; die Bauern haben da keine Scheunen und das Getreide wir nur in
Schobern aufgestellt und dann umgehend gedroschen. Vom Oktober bis Dezember regnete es fasst jeden Tag in Strömen.
Gesät wird nur im Frühjahr und im Herbst, weil im Sommer alles vertrocknet. Es wird viel Wein angebaut und die
Steckrübe wächst den ganzen Winter. Neben den Weinreben wurde aus Schieferplatten ein Zaun aufgestellt, um dem Wein
einen optimalen Standort zu sichern. Die Bauernwagen hatten nur zwei Räder und waren nur mit einem Pferd bespannt, das
die ganze Balance des Wagens zu halten hatte. Trotzdem haben sie soviel aufgeladen wie wir auf einen Leiterwagen. Viele
Kameraden wurden den Bauern zur Arbeit ausgeliehen. Wenn ein Bauer einen Arbeiter gebraucht hat und es wurde gefragt,
wer sich in der Landwirtschaft auskennt, da haben sich alle gemeldet. Der Bauer konnte sich dann aussuchen, wen er
mitnehmen wollte.
Wenn wir durch die Stadt zur Arbeit gingen, haben verschiedene Leute Fallobst in die Abfalleimer gelegt. Wenn das von
den Kameraden bemerkt wurde, schwenkten viele aus der Reihe, um sich etwas mit zunehmen, was von den Wachmannschaften
nicht gern gesehen wurde. Viele Kriegsgefangene hatten keine Schuhe mehr, sie haben die Füße nur mit Lumpen bewickelt.
Eines Tages kamen Kameraden aus Norwegen, die nach Deutschland entlassen werden sollten. Mann hat sie jedoch ins Lager
gesteckt und zur Arbeit eingeteilt. In Norwegen hatten sie Kleider und Stoffe eingekauft, hatten volle Seesäcke und
sogar Karren auf 2 Rädern, weil sie ja in die Heimat entlassen werden sollten. Als wir morgens zur Arbeit rausgeführt
wurden standen sie schon vor dem Lager. Wir haben ihnen zugerufen, dass sie uns etwas abgeben sollen, weil ihnen ja
sowieso alles abgenommen wird, aber sie haben uns nur ausgelacht. Als sie ins Lager Kamen mussten sie ihr Gepäck
ablegen, wurden dann wo anders hingeführt und haben es danach nie wieder gesehen.
Durch die vielen Läuse, Flöhe und Wanzen die wie im Lager hatten, kam es bei verschieden Kameraden, an den
Einstichstellen, zu eiternden Entzündungen. Um dem vorzubeugen hat man uns mit einem Pulver, das in Frankreich
hergestellt wurde, aber bei den Parasiten keine Wirkung zeigte, eingesprüht. Erst bei der Anwendung eines Mittels
amerikanischer Herkunft, war alles über Nacht verschwunden.
Der Sonntag war arbeitsfrei. Dann kam ein katholischer, französischer Pfarrer, eskortiert von 3 Mann, mit
aufgepflanztem Seitengewehr ins Lager und hat Gottesdienst gehalten. Einen evangelischen Pfarrer gab es nicht, nur
einen Baptisten Prediger. Der wurde würdevoll eingekleidet, bekam ein großes Kreuz und hat jeden Sonntag in einer
extra dafür hergerichteten Baracke Gottesdienst gehalten. Wer Theologie studiert hatte und sich meldete, wurde zu
einem Seminar geschickt und konnte sein Studium fortsetzen. Glasbläser durften das Lager auch verlassen und ihrem
erlernten Beruf wieder arbeiten.
Wer sich freiwillig, für 5 Jahre, zum Dienst in der Fremdenlegion verpflichtet hat, das waren etliche unter uns, wurde
neu eingekleidet, bekam gutes Essen und Rauchwaren soviel er wollte. Nach einem Jahr wurden, nach und nach, die
Kranken und Körperbehinderten in die Sowjetische Besatzungszone entlassen. Eine Entlassung von Kriegsgefangenen, die
in den Westzonen oder jenseits von Oder und Neise zu Hause waren, war nicht vorgesehen. Die Österreicher wurden alle,
unabhängig von ihrem Gesundheitszustand entlassen.
Ich habe Briefe nach Hause geschrieben, aber die kamen nur bis Allenstein und wurden wieder zurück geschickt. Als eine
Kommission des Roten Kreuzes aus der Schweiz unser Lager besichtigt hat, haben wir uns beschwert, das wir als
Sanitätsdienstgrade, zur Arbeit gehen müssen. Daraufhin erging ein Befehl: Wer einen vom Roten Kreuz, ausgestellten
Ausweis besitzt, gehört einem internationalen Verband an und braucht nicht zu Arbeit gehen. Aus unserem Lager hatten
sich 20 Mann gemeldet, die daraufhin Freigang, in Begleitung von zwei französischen Wachsoldaten erhielten. Als wir
gefragt wurden wo wir hin wollen, entschlossen wir uns, einen Soldatenfriedhof, auf dem unsere verstorbenen Kameraden
beerdigt waren, zu besuchen.
Da der Untergrund in dieser Gegend aus Felsen bestand, wurden die Gräben, in denen die Toten in selbst gezimmerten
Kisten nebeneinander gestellt wurden, mit Hilfe von Dynamit ausgehoben. Ein Leichenwagen, mit einem Pferd bespannt,
das mit einer schwarzen Decke abgedeckt war, wurde von einem Kutscher in angemessener Kleidung, gefahren. Der Wagen
konnte gleichzeitig 4 Kisten transportieren. Wenn wir von der Arbeit kommend, dem Leichenwagen begegneten, wurde
gehalten und mit einer Schweigeminute der Toten gedacht, bis der Wagen vorbei war. Die Zivilbevölkerung verharrte auch
im Schweigen, mit abgenommener Kopfbedeckung.
Ein Kamerad, der in Krottorf, Kreis Oschersleben, bei Magdeburg, zuhause war, sagte bei seiner Entlassung zu mir:
Sollte ich das Glück haben, meine Entlassungspapiere zu erhalten ohne eine Bleibe vorzuweisen, dann soll ich Krottorf
als Heimatadresse angeben. Auf der Krankenstube habe ich angegeben, dass sich noch ein Schrapnellsplitter, aus dem
Ersten Weltkrieg, in meiner Kreuzbeingegend befindet, er zwar verkapselt ist, aber immer noch Beschwerden verursacht.
Daraufhin wurde ich zur Entlassung vornotiert. Als bekannt wurde das ein Rückkehrertransport in die sowjetische
Besatzungszone zusammengestellt wird, habe ich mich sofort gemeldet und wurde für ein Entlassungslager in Angoleme
vorgesehen. War das eine Freude, als uns mitgeteilt wurde, wann der Rücktransport stattfindet.
In unserem Lager waren noch 2 Kameraden aus dem Kreis Ortelsburg: Ein Gustav Lumma aus Leynau und ein Alfred Moritz
aus Groß Schöndamerau. Sie mussten noch zurückbleiben und haben mir den Auftrag erteil, die Angehörigen in der Heimat
zu grüßen und ihnen die Anschrift mitzuteilen. Als wir im Entlassungslager ankamen, fragte man uns nach unserer
Heimatanschrift. Dann wurden die Entlassungspapiere angefertigt. Es wurde uns auch ein Barscheck, für die in Frankreich
geleistete Arbeit ausgehändigt, den wir bei jeder Kasse in Deutschland einlösen könnten. Ich habe ihn bis zum heutigen
Tage nicht einlösen können, obwohl ich irgendwann in der Zeitung gelesen habe, das Verrechnungschecks die den aus
französischer Kriegsgefangenschaft Entlassenen, ausgehändigt wurden, einzulösen sind.
Wir kamen zuerst nach Saar Elbe, dann in die Nähe der Zonengrenze zu Thüringen. Hier mussten wir 2 Tage warten, weil
aus der sowjetischen Besatzungszone keine Eisenbahnwagen bereitgestellt wurden. Angesichts dessen, das der Russe beim
letzten Transport die aus Frankreich kommenden Wagen kassiert und nicht mehr herausgeben wollte, bestand der Franzose
jetzt darauf, seine Wagen sofort wieder mitzunehmen. Als der sehnsüchtig erwartete Zug endlich eintraf, durften wir
umsteigen und kamen, immer noch hinter Stacheldraht, nach Erfurt. Von dort weiter ins Quarantänelager nach Prätsch an
der Elbe.
Unter Androhung von Strafe war es verboten das Lager zu verlassen, doch der Hunger zwang uns dazu, in den umliegenden
Dörfern um Lebensmittel zu betteln. Man drohte uns damit, dass Zuwiderhandlungen, mit einer 14-tägigen Verlängerung der
Quarantäne geahndet werden. Der Roggen war schon reif und wir haben, auf den umliegenden Feldern, die Ähren abgerissen,
das Korn, zwischen 2 Steinen zu Mehl zerrieben, um daraus eine Suppe zu kochen, denn von dem was unsere Lagerküche uns
bieten konnte, war es nicht möglich zu überleben. Als der Eigentümer bemerkte wer seine Roggenähren entwendet hat, kam
er ins Lager, gerade zu dem Zeitpunkt als wir mit dem Mahlen beschäftigt waren. Der Lagerkommandant, bei dem er sich
beschwerte, drohte uns zu bestrafen, wenn wir unsere „Rauzüge” nicht unmittelbar einstellen würden. Wir sagten ihm er
solle uns heimfahren lassen, da wir doch lange genug hinter Stacheldraht gesessen hätten.
Endlich wieder in Freiheit
14 Tage nach unserer Ankunft wurden uns Entlassungspapiere ausgehändigt, sowie auch Fahrscheine
zum den, von uns angegeben Heimatorten. So kam ich nach Krottof, Kreis Oschersleben, zu meinem ehemaligen
Kriegskameraden, bei dem ich einen Tag geblieben bin. Er hatte mir schon eine Stelle bei einem Bauern besorgt, der 70
Jahre alt und kinderlos war. Zum Hof, den er mit seiner Ehefrau bewirtschaftet hat, gehörten 36 Morgen Land, 2 Ochsen
und 3 Kühe. Das Ackerland bestand aus 17 Parzellen und sicherte mir einen Arbeitsplatz.
Jetzt, da ich ein Dach überm Kopf und genug zu essen hatte, fing ich an nach dem Verbleib meiner Familie zu forschen.
Bei meinem letzten Heimaturlaub hatte ich mit meiner Frau verabredet; falls wir uns in den Kriegswirren verlieren
sollten, unsere Kontaktadresse, die meiner Quartiersleute in Burscheid, Kreis Opladen, sein sollte. Ich habe zuerst
nach Rohmanen geschrieben, aber leider keine Antwort erhalten. Dann habe ich nach Burscheid geschrieben, und siehe, -
bei denen lag schon eine Anfrage meiner Frau vor, die nach mir gefragt, und ihre jetzige Anschrift hinterlassen hatte.
Ich habe dem Bauern erzählt dass meine Frau sich zurzeit, auf einem Gut, in Alt Steinhorst, im Kreis Rostock, befindet.
Er war sofort bereit uns ein Zimmer zur Verfügung zu stellen, wenn ich meine Frau nach Krottorf rüberholen wollte. Das
habe ich Ihr mitgeteilt und sie war sofort bereit ihren Wohnsitz nach Krottorf zu verlegen, denn sie wohnte dort in
einem kleinen Stübchen unterm Dach.
Im Herbst, als die Feldarbeit so ziemlich erledigt war, bin ich nach Alt Steinhorst gefahren, um meine Frau und meinen
Sohn Kurt, sowie meinen Sohn Manfred, den ich noch nicht kannte, weil er erst nach der Flucht, am 31. Januar, in Groß
Lüssewitz, geboren wurde, nach Krottorf zu holen. Meine Frau hatte schon Holz für den Winter besorgt und vom Gut, auf
dem sie im Sommer gearbeitet hatte, Mehl und Kartoffeln bekommen. Wir haben das Mehl und andere Habseligkeiten in
Kisten verpackt. Das Holz haben wir einem Bauern gegeben, der uns und unser Gepäck, mit seinem Pferdewagen, zum 14
Kilometer entfernten Bahnhof, nach Ribnitz gebracht hat. Wir sind auch gut in Krottorf angekommen, aber als wir am
nächsten Tag, unsere Kisten vom Bahnhof abholen wollten, haben wir zwar die Kisten vorgefunden, doch der gesamte Inhalt
wurde während der Bahnfahrt entwendet. Die Bahnstation in Krottorf hat die Vorkommnisse zur Kenntnis genommen und
protokolliert, aber unsere Sachen haben wir nie wieder gesehen und mussten wieder bei Null anfangen.
Im Winter musste ich auf der Genossenschaft, unentgeltlich, für die Russen Weizen einsacken. Ich hatte versucht eine
Arbeit als Zimmermann zu bekommen, doch auf dem Arbeitsamt wurde mir gesagt, ich bin Ladwirt und muss auf der
Landwirtschaft arbeiten. Da in den ersten Nachkriegsjahren, auch in der sowjetisch besetzten Zone Arbeitsplätze knapp
waren, mussten auch solche, die einen anderen Beruf erlernt hatten, jede zumutbare Arbeit annehmen. Aus der Heimat
erhielt ich einen Brief, von meiner dort noch lebenden Mutter. Sie schrieb das sie mich noch einmal sehen wollte und
ich sollte doch wieder zurück kommen; Unser Hof wäre nicht von Polen besetzt und sie wäre ganz alleine, weil der Vater
nach dem Durchzug der Front von den Russen erschlagen wurde. Daraufhin habe ich dem polnischen Konsulat in Magdeburg
mitgeteilt, dass ich in Rohmanen eine Landwirtschaft besitze, und um eine Einreisegenehmigung gebeten.
Nach 2 Monaten erhielt ich eine Postkarte, mit der Mitteilung, ich sollte mich persönlich beim Konsulat vorstellen.
Nach Aufnahme meiner Personalien, wurde mir gesagt, das ich benachrichtigt werde wenn mein Antrag genehmigt wird. Ende
Juli 1947 erhielten wir die Einreisegenehmigung nach Ostpreußen, das jetzt unter polnischer Verwaltung stand. Wir
mussten zuerst zum polnischen Konsulat in Berlin-Lichterfelde, wo wir umgeben von einer Trümmerlandschaft, gewartet
haben, bis alle Untersuchungen und Formalitäten erledigt waren.
“ Wieder zurück in Ostpreußen.”
Der schwere Wiederaufbau nach dem Kriege
Dann fuhren wir über Frankfurt/Oder, Posen, Thorn, Allenstein, nach Ortelsburg, wo wir am 2. August 1947 ankamen. Mit
einem zweirädrigen Karren, den ich mir von einem noch in Ortelsburg lebenden Bekanten ausgeliehen hatte und meinem
Sohn Manfred im Kinderwagen fuhren wir nach Rohmanen. Meine Mutter war inzwischen verstorben und auf dem Hof war nur
meine, inzwischen aus Russischer Gefangenschaft wiedergekehrte Schwester, Frieda Pelkowski.

Es war alles ausgeplündert; kein Vieh, keine Maschinen und der ganze Hof mit kniehohem Graß überwachsen. Nur schmale
Trampelpfade, vom Haus zum Holzschuppen und zum Klo, durchkreuzten das satte Grün. Ich habe das Gras auf dem Hof mit
einer Sense, die ich noch gefunden habe, abgemäht, damit der Hof nicht so verwahrlost aussah. Am nächsten Tag habe ich
mich bei der Polizei in Ortelsburg angemeldet, wo ich auch ein Startgeld von 100 Zloty erhielt und Gepäckstücke, die
ich in Krottorf aufgegeben, am Bahnhof abgeholt. Es hat mich sehr gewundert das, das Gepäck überhaupt angekommen ist.
Da man von der Landwirtschaft nicht Leben konnte, habe ich mich in den nächsten Tagen, bei der jetzt polnischen Bahn,
um Arbeit beworben und wurde auch angenommen. Wenn wir unseren Monatslohn bekamen, saß immer einer am Tisch, der von
uns 100 Zloty für den Wiederaufbau von Warschau verlangte. Wenn ich dran war, riefen die Anderen, ich hätte Warschau
zerstört und müsste deshalb 200 Zloty abgeben. Nach 3 Jahren kam eine Verfügung, die besagte, dass wer länger als 1
Jahr bei der Bahn beschäftigt ist, angestellt werden muss. Um diese Bestimmung zu umgehen hat man mich entlassen und
eine Woche später wieder eingestellt.
Als ich vor Ablauf des nächsten Jahres, aus dem gleichen Grunde wieder entlassen wurde, habe ich mich bei der
Stadtverwaltung in Ortelsburg(jetzt Szczytno)beworben, wo ich zuerst im Gaswerk als Heizer und später auf Baustellen
als Zimmermann gearbeitet habe. Wir haben durch den Krieg beschädigte Häuser repariert, in den ehemals touristischen
Zentren einige Ausbesserungen an den Einrichtungen durchgeführt, eine Ziegelei wieder in Betrieb gesetzt und andere
anfallende Arbeiten verrichtet. Im Dach des Rathausturmes war während der Kämpfe eine Granate eingeschlagen, die, die
Dachlatten und die Verschalung zerstört hatte. Da wir, unter schwersten Bedingungen, den Schaden repariert haben,
wurde uns eine Höhenzulage versprochen, die wir aber nicht bekommen haben.
Aus Verärgerung darüber habe ich bei der Stadtverwaltung gekündigt und bei einer Wiederaufbaufirma unter der Leitung
von Bauingenieur Laskowski wieder angefangen, wo ich bis 1954, als Zimmermann beschäftigt war. Ab da habe ich mich
nur um meinen Hof gekümmert, der wegen meiner Arbeitsstellen, gezwungenermaßen, sehr vernachlässigt wurde. Als wir
1947 zurückkamen, brachten wir unseren Sohn Manfred noch im Kinderwagen. Den hat meine Frau zum Markt gebracht,
verkauft, und dafür eine Ziege erworben, die dank guter Pflege, uns täglich mit 4 Liter Milch versorgte. Das war der
erste Baustein zum Wiederaufbau, unserer durch den Krieg zerstörten, und danach ausgeplünderten Landwirtschaft.
Während meiner Arbeit bei der Bahn haben wir uns eine Kuh gekauft, die nach einem halben Jahr, wegen nicht bezahlter
Grundsteuer, vom Gerichtsvollzieher gepfändet wurde. Man hat uns die Kuh weggenommen und bei einem Arbeiter, der in
der Ernst-Mey-Straße in Ortelsburg wohnte und sie wegen nicht vorhandener Futtermittel, nur mit Kartoffelkraut
gefüttert hat, untergestellt. Als ich bei der Bahn meinen Monatslohn bekommen habe, bin ich zur Gmina gegangen, habe
eine Rate angezahlt und durfte dann die Kuh wieder mit nach Hause nehmen. Durch die schlechte Ernährung war die Kuh
stark abgemagert und lieferte nur die Hälfte der ursprünglichen Milchleistung.
Später habe ich ein Pferd auf Abzahlung bekommen, das 140.000 alte Zloty gekostet hat. Die Stute war schwach und unser
Feld sehr hügelig, so dass man nur bergab pflügen konnte, was sehr beschwerlich war, bergauf ging es immer im Leerlauf.
Später habe ich die schweren Böden mit dem Traktor umpflügen, und in den letzten Jahren auch mit dem Binder mähen
lassen. Von der Stute habe ich 2 schöne Fohlen gezogen; ein davon habe ich bei der Ausreise in die Bundesrepublik
mitgebracht und bei der Viehverwertungs-Genossenschaft in Göttingen verkauft. In den ersten Nachkriegsjahren als noch
wenig Land bestellt wurde, breiteten sich auf den nicht beackerten Flächen, Wildkräuter aus. Disteln und andere
Schnellwachsende, erreichten manchmal eine Höhe von 2 Meter, besonders auf den schweren Böden.
Es hat viel Schweiß gekostet ehe man den Acker soweit hatte, das er auch befriedigende Erträge abwarf. Die
Währungsreform von 1950, hat unser weiniges Geld das wir schon gespart hatten, wieder vernichtet. Ich hatte 2 Pferde,
1 Fohlen, 2 Kühe und Schweine, als ich wieder aufgefordert wurde nicht bezahlte Grundsteuern nachzuzahlen. Als ich
nicht bezahlen konnte, hat der Vollziehungsbeamte, ein Fohlen, eine Kuh und ein Schwein gepfändet. Es gelang mir jedoch
nach längeren Verhandlungen, ohne größere Verluste, alles zu regeln. Später kam eine Verfügung, die besagte; wenn
jemand auf seinem Hof nur eine Kuh und ein Pferd hatte, durften sie nicht gepfändet werden. Einige haben ihr Inventar
dieser Verfügung angepasst und dadurch die Zahlung von Grundsteuer umgangen.

Wer seine Steuern pünktlich bezahlt und sein Kontingent an landwirtschaftlichen Produkten fristgerecht abgeliefert hat,
der konnte seine, darüber hinaus erwirtschafteten Produkte zu marktgerechten Preisen verkaufen. Für eine hochtragende
Sterke, mindestens 400 kg schwer, die auf ein staatliches Gut verkauft wurde, konnte man bis zu 12000 Zloty bekommen.
Unsere Böden waren kalkarm, doch durch den Einsatz von Kalk und Kunstdünger konnte man den Ertrag erheblich steigern.
Kalk und Kunstdünger konnte man bei der Genossenschaft(GS) bestellen, der dann auch direkt auf den Hof geliefert wurde.
Kalk wurde geliefert und gleich auf dem Feld ausgestreut. In den 1960ger Jahren waren alle Ackerflächen der Rohmaner
Felder bestellt.
Die nach dem Krieg zurückgebliebenen deutschen Bauernfamilien, aber auch die Polen, die während des Krieges beim Bauern
in Deutschland gearbeitet haben, versuchten mit teils bescheidenen, oder auch zusammen gesuchten, landwirtschaftlichen
Geräten, die bäuerlichen Betriebe aufrecht zu erhalten. Nach den schweren Anfängen in den ersten Nachkriegsjahren
erzielten sie schließlich einen beachtlichen Erfolg, der sich in wogenden Kornfeldern, sowie in grünen Wiesen auf
denen gut genährtes Vieh weidete, widerspiegelte.
Ein schwerer Einschnitt in meinem Leben.
Am 11. Mai 1956 verstarb nach langer schwerer Krankheit, meine liebe Ehefrau Marta Rattay,
geborene Brosch. Ein Jahr zuvor war schon mein Schwiegervater Gottlib Brosch verstorben. Die schweren Bedingungen
unter denen wir nach Kriegende leben mussten, haben ihrer bereits angegriffenen Gesundheit sehr zugesetzt. Sie
verstarb mit 44 Jahren und hinterließ in unserer Familie eine große Lücke, die nicht mehr zu Überbrücken war. Wir
haben sie unter großer Anteilnahme der noch verbliebenen deutschen Bevölkerung zu Grabe getragen und auf dem Rohmaner
Friedhof beigesetzt. Die Arbeit die sie sonst verrichtet hatte fiel jetzt auf mich und meine Söhne zurück. Meine
Schwester Frieda Pelkowski half auch wo sie nur konnte. Wir waren auf die Unterstützung durch Nachbarn und Freunde
angewiesen, die uns immer wenn es nötig war, tatkräftig unterstützt haben. Im laufe der Zeit haben wir wieder zum
Alltag zurück gefunden, haben sie noch etliche Jahre auf dem Friedhof besuchen können, bis wir, bedingt durch unsere
Ausreise uns endgültig von ihr trennen mussten.
Der endgültige Abschied von Ostpreußen
Ab 1956 begannen, durch die Vermittlung des Deutschen Roten Kreuzes, die ersten Ausreisen in die
Bundesrepublik Deutschland. Zuerst waren es Kinder die zu ihren Eltern ausreisen durften, Familien deren Väter aus der
Kriegsgefangenschaft in den Westen Deutschlands entlassen wurden und andere durch den Krieg getrennte
Familienangehörige. Ab 1960 erhöhte sich die Zahl der Ausreisewilligen aus dem polnisch besetzten Ostpreußen. Es setzte
sich die Überzeugung durch, dass unsere Angestammte Heimat, uns für die Zukunft keine Perspektive mehr bieten konnte.
Meistens wurden die Anträge, die wir an die Passabteilung in Allenstein stellen mussten, um einen Ausreisepass zu
bekommen, negativ beschieden. Nach mehrmaligen Versuchen gelang es dann doch, diese begehrte Ausreiseberechtigung in
Empfang zu nehmen. Die Enttäuschung der Zurückgebliebenen war groß, wenn wieder mal Verwandte oder Nachbarn, den Weg
in Richtung Bahnhof einschlugen.
Um einen Reisepass zu beantragen, musste man zuerst eine Einladung von Verwandten aus der Bundesrepublik vorlegen, in
der, diese sich verpflichten mussten, für Unterkunft und Verpflegung der Eingeladenen zu sorgen. Diese Einladung
musste durch ein Amt in der Bundesrepublik beglaubigt werden. Außerdem mussten die Kosten für die Bahnfahrt, ab
polnischer Grenze, bis zum Zielort, beim polnischen Reisebüro ORBIS, in Warschau, in DM eingezahlt werden.
Unseren ersten Ausreiseantrag haben wir 1964, bei der Kommandantur der polnischen Miliz in Allenstein eingereicht, der
nach einer gewissen Zeitspanne, ohne eine uns verständliche Begründung zu nennen, abgelehnt wurde. Gegen diese
Ablehnung wurde ein Widerspruch zugelassen, den wir sofort einreichten. Nach einer weiteren Zeitspanne erhielten wir
wieder eine Ablehnung, gegen die kein Widerspruch mehr zulässig war. Wer seine Ausreiseabsicht nicht aufgeben wollte,
musste einen neuen Antrag stellen. Es gab Familien die schon 10 Mal einen Ausreiseantrag gestellt hatten und immer
wieder abgewiesen wurden. Da meine Söhne, nicht die Absicht hatten in Rohmanen zu bleiben und ich nach 2 Weltkriegen,
an denen ich teilgenommen, die schwere Arbeit auf der Landwirtschaft, nicht aus eigener Kraft schaffen würde, haben wir
1966 wieder einen Antrag gestellt, der prompt abgelehnt wurde. Der Widerspruch auf diese Ablehnung wurde auch negativ
beantwortet, so dass wir 1968 wieder einen Antrag eingereicht haben.
Weil das Passamt in Allenstein lange nichts von sich hören ließ, hegten wir schon die Hoffnung das es jetzt klappen
würde und waren sehr enttäuscht als wieder eine Absage kam. In der Zwischenzeit sind viele Nachbarn und Bekannte aus
Rohmanen, sowie aus der näheren Umgebung, ausgereist und das Häuflein der noch verbliebenen Deutschen, wurde immer
kleiner. Die Motivation, die uns in früheren Jahren, über so manche schwierige Lage hinweg geholfen hat, ist einer
hoffnungslosen Resignation gewichen. Man war davon überzeugt, dass unser Leben, in unser Angestammten Heimat, keine
Zukunftsperspektive mehr haben konnte und wenn wir keine Ausreisegenehmigung bekommen, wir eines Tages die letzten
Deutschen in der ganzen Umgebung sein werden.
Die Ausreise-Heimat ade
Wir hatten die Hoffnung schon aufgegeben, als am 30. April 1969, der Briefträger unseren Hof
betrat und mir einen Brief überreichte, in dem uns das Passamt in Allenstein mitteilte, dass unsere Ausreise in die
Bundesrepublik Deutschland, genehmigt worden ist. Wir müssten, nach Aushändigung der Reisepapiere, den Geltungsbereich
der Volksrepublik Polen, innerhalb von 3 Monaten verlassen. Wir waren zuerst geschockt, über den Hinweis, das wir
unsere Heimat in 3 Monaten verlassen müssen, aber dann stellte sich die Zukunftsperspektive wieder ein und wir gingen,
wie von einem schweren Ballast befreit und gut gelaunt unser weiteren Tätigkeit nach.
Als der Briefträger unseren Hof betrat, waren ich und mein Sohn Kurt gerade dabei eine Fuhre Mist zu laden. Wir hatten
den Wagen gerade halb geladen und haben nach der frohen Kunde nicht mehr weiter gemacht, sondern die Pferde vorgespannt
und den Mist aufs Feld gefahren, damit wir den Wagen für alle Fälle frei hatten. Das war die letzte Tätigkeit für
unsere Landwirtschaft in Ostpreußen.
Die Nachricht von unserer Ausreise verbreitete sich, ohne dass wir darüber gesprochen haben, wie ein Lauffeuer.
Alsbald kamen Leute aus dem Dorf, die sich für das Vieh und für diverse Landwirtschaftliche Geräte interessierten.
Etliche wollten bestimmte Sachen sofort kaufen, andere haben nur zurücklegen lassen und wollten später kommen und
bezahlen, haben es aber dann doch nicht genommen.

Wenn man eine Landwirtschaft hatte, konnte man 2 Pferde, 2 Rinder, 3 Schweine, 5 Schafe und 10 Hühner, in einem
geschlossenen Viehwaggon, in die Bundesrepublik mitnehmen. Jeden Tag war man unterwegs, von einer Behörde zur Andern.
Die Aushändigung der Reisepapiere erfolgte nur nach Vorlage bestimmter Bescheinigungen: Es mussten alle Steuern bezahlt
sein, das Kontingent landwirtschaftlicher Erzeugnisse musste abgeliefert sein, je eine Bescheinigung vom Katasteramt
und vom Notar musste vorgelegt werden, das man dem polnischen Staat das Grundstück abgetreten hat. Die Gebühren für
die notarielle Beglaubigung mussten wir selbst bezahlen. Wenn man alle Bescheinigungen beisammen hatte, bekam man bei
der Kreisverwaltung eine Gesamtbescheinigung. Mit dieser Bescheinigung konnte man nach Allenstein, zur
Polizeikommandantur fahren, wo man nach dem schriftlichen Verzicht auf die polnische Staatsangehörigkeit, einen
Reisepass ausgehändigt bekam, der den Inhaber zum Grenzübertritt berechtigte, aber nicht zur Wiedereinreise.
Wir haben 2 Pferde, eine Sterke, einen Ochsen, 5 Schafe, 2 Schweine und 10 Hühner mitgenommen. Über die Schutzimpfung
der Rinder musste man eine, vom Kreistierarzt beglaubigte Bescheinigung vorweisen. Ich habe 5 Schafsböcke gekauft, die
ich in der Zwischenzeit, hinter der Scheune, zum Weiden angekettet hatte. Einer von denen hat sich losgerissen und
seinen Nachbarn getötet. Das Fleisch konnten wir noch verkaufen, mussten aber dafür einen anderen Schafsbock kaufen.
Innerhalb von 3 Monaten mussten wir alles regeln und zwei Tage vor der Abfahrt einen Eisenbahnwagen, bei der
Eisenbahndirektion in Allenstein bestellen. Reservierungen bei den polnischen Behörden waren meist immer mit
Schmiergeld verbunden, weil man sonst nie sicher sein konnte dass diese Vereinbarungen auch eingehalten werden. Schon
2 Wochen vor unserer Abfahrt, gab es in Ortelsburg keine alkoholischen Getränke zu kaufen. Meine Söhne mussten mit dem
Motorrad die umliegenden Dörfer abfahren, damit wir für die Reise einen Vorrat anlegen konnten; denn Wodka war zu der
Zeit, in Polen, wie eine zweite Währung.
Am 25. Juli haben wir zusammen, mit meinem Neffen Siegfried Brosch, unseren sonstigen Hausrat, der in Kisten verpackt
war, in einen Eisenbahnwagen, auf dem Allensteiner Bahnhof verladen. Alles musste zuerst durch den Zoll, wo die
Federbetten gewogen wurden und über das erlaubte hinausgehende Kissen, verzollt werden mussten. Dasselbe galt auch für
Fleisch und Räucherwaren.
Am 26. Juli, unserem Verladetag, kam der Eisenbahnwagen aus Allenstein, erst um 11 Uhr auf dem Ortelsburger Bahnhof an.
Die Rinder hatten wir zu Fuß, zum Bahnhof gebracht; Schweine, Schafe und Hühner auf dem Pferdewagen. Im Eisenbahnwagen
mussten, mit Hilfe von Brettern und Bohlen, Boxen für die verschiedenen Tiere erstellt werden. Jedes Pferd und jedes
Rind in eine Bucht. Die Schafe zwischen die Pferde, die Schweine zwischen die Rinder und die Hühner in einem Käfig,
unter der Decke über den Rindern. Die Hühner hatten unterwegs Eier gelegt, somit hatten wir jeden Tag frische
Verpflegung. Bei der Fahrt im Viehwagen, begleitete mich mein Sohn Manfred. Als die Lokomotive nahte, um den Wagen
abzuholen, wurden noch schnell die restlichen Sachen hinein geworfen und so mache Abschiedsträne rollte dann die Wange
hinab.
Unsere Nachbarn, Deutsche und Polen, halfen uns beim Verladen des lebendigen Inventars. Jetzt erinnerte ich mich
plötzlich, an die oft auch schönen, Ereignisse der letzten 22 Jahre. Einer Zeit, in der das Zusammenleben von
Deutschen und Polen, von Jahr zu Jahr, besser wurde. Man half sich beim einbringen der Getreideernte, beim Dreschen
des Getreides, bei der Kartoffelernte und bei anderen Arbeiten, wo viele Menschen zupacken mussten. Es war eine
Dorfgemeinschaft, in schweren Zeiten geboren; jeder half jedem wenn Hilfe nötig war. Es wurde mir plötzlich bewusst,
das jetzt ein Lebensabschnitt zu Ende ging, zu dem ich nicht mehr zurückkehren konnte. Unsere Existenzgrundlage war
jetzt ein Eisenbahnwagen auf einem Schienenstrang, dessen Ende irgendwo in weiter Ferne lag. Obwohl, von langer Hand
vorbereitet, war dieser Moment voller Wehmut.
Doch als der Zug sich plötzlich, in Bewegung setzte, war ich sofort wieder in der Gegenwart. Menschen, mit denen man
Jahrzehnte lang, in gutem Einvernehmen zusammen gelebt hat, blieben plötzlich am Bahnsteig zurück und die Entfernung
zwischen ihnen und mir vergrößerte sich mit jeder Sekunde, bis sie letztendlich aus meinem Blickfeld verschwanden.
Es war ein heißer Julitag, als wir unsere Reise gen Westen antraten. Für die Schweine, die besonders unter der Hitze
zu leiden hatten, haben wir 10 Flaschen Essig mitgenommen und sie von Zeit zu Zeit besprenkelt, damit sie besser atmen
konnten. Für die anderen Tiere war reichlich Heu und Hafer vorhanden. Eine großes Fas und zwei Milchkannen waren mit
Wasser gefüllt, die wir auf den an der Strecke liegenden Bahnstationen, bei Bedarf wieder nachgefüllt haben.
Da der Kreistierarzt nicht in seinem Büro war, konnten wir die Impfbescheinigung für das Vieh, nicht rechtzeitig
herbeischaffen. Der Zug setzte sich in Bewegung und die Bescheinigung war immer noch nicht da. Als die Bescheinigung
dann eingetroffen, wir aber schon unterwegs waren, ist mein Sohn Kurt mit dem Motorrad hinterher gefahren und hat uns
in Passenheim, wo der Zug noch andere Wagen angehängt bekam, die Impfbescheinigung übergeben. Wir waren sehr froh das
er es noch geschafft hat, denn in solch einer Situation fühlt man sich sicherer wenn man alle Bescheinigungen bei sich
hat. Auf der Rückfahrt, mit dem Motorrad hatte er noch eine Panne, musste das Motorrad stehen lassen und per Anhalter
nach Hause fahren. Am nächsten Tag kam er mit Siegfried Deptolla, der das Motorrad wieder flott machte und brachte es
wieder nach Rohmanen zurück.
Die Fahrt mit dem Viehwagen, gen Westen
Von Ortelsburg bis Allenstein(45 km) hat unser Zug 4 Stunden gebraucht, weil auf jedem Bahnhof
gehalten wurde, um neue Wagen anzuhängen. Nachdem wir in Allenstein angekommen waren, kam ein Rangierer und fragte
nach unserem Ziel. Als wir ihm mitteilten, das wir in die Bundesrepublik Deutschland wollen, sagte er nur: „In 10
Minuten fährt ein Zug los. Wenn ich von euch 500 Zloty und einen Liter Wodka bekomme, werde euch sofort anhängen,
andernfalls kommt ihr auf ein Nebengleis und müsst dann auf den nächsten Zug warten. Es blieb uns nichts anderes übrig
als seiner Forderung nachzukommen, denn über derartige Erpressungen hat man bereits von Anderen, die vor uns ausgereist
sind, gehört. Wir wurden auch sofort angehängt und fuhren dann die ganze Nacht, an Osterode, und Thorn vorbei bis
Gnesen. Dort wurde wieder rangiert.
Von einer Anhöhe wurden die einzelnen Wagen auf verschiedene Gleise verteilt und zu neuen Zügen zusammengestellt. Der
Aufprall der ungebremsten Wagen erzeugte eine derartige Erschütterung, dass manche Bretter an den Boxen geborsten waren.
Von Gnesen ging es dann in einem Zuge durch bis zur Grenzstation Reppen(Rzepin). Dort mussten wir zum Zollamt, wo
unsere Ausfuhrpapiere durch die Zollbeamten, und durch einen Tierarzt geprüft wurden. Bis Reppen(Rzepin) haben wir für
den Eisenbahnwagen 900 Zloty bezahlt; hier mussten wir noch einmal 650 Zloty bezahlen. Bei der Wagenkontrolle erklärte
uns ein Bahnbeamter das unser Wagen, sich nicht für den internationalen Transport eignet und wir deshalb den Inhalt in
einen Anderen umladen müssen, der irgendwann, auf dem Nebengleis bereitgestellt wird. Nach langer Verhandlung, sowie
einer Zulage von 500 Zloty und einem Liter Wodka haben wir ihn davon überzeugt, das der Wagen sich doch für die
Weiterfahrt eignet.
In der Nacht war Schichtwechsel, der unseren Wagen wieder abgehängt hat, weil er angeblich von der Reichsbahn der DDR,
wegen technischer Mängel nicht weiterbefördert würde. Wir mussten unsere Verhandlung vom Vorabend wiederholen, die mit
der Zusage endete, dass wir am frühen Morgen, über die Grenze auf DDR Gebiet, gebracht werden. Um 5 Uhr morgens kam
eine Lokomotive, die uns den letzten Abschnitt bis über die Grenze bringen sollte. Als der Zug hat noch einmal anhielt,
kamen polnische Grenzbeamte und Soldaten in den Wagen. Sie durchsuchten ihn und fragten, ob wir noch polnisches Geld
oder einen Grundbuchauszug bei uns hätten. Wir zeigten ihnen 800 Zloty, die sie uns, nach Ausstellung einer Quittung
über 500 Zloty, abnahmen. Die Grundbuchauszüge habe ich, im Stroh versteckt, dem Ochsen vor die Füße gelegt. Falls
jemand da suchen sollte, hätte ich gesagt, das das Tier bösartig veranlagt ist, und ich für seine Sicherheit nicht
garantieren könnte, deshalb sollte er vorsichtig sein.
Als die Grenzkontrolle den Zug verlassen hatte, setzte sich die Lokomotive wieder in Bewegung und überquerte nach
kurzer Zeit die Oderbrücke. Auf einer eingezäunten Fläche, jenseits der Grenze, hat man uns abgestellt hat und die
Lokomotive fuhr zurück auf polnisches Gebiet. Vor und hinter uns waren die Tore verschlossen. Auf den Wachtürmen,
links und Rechts von uns, standen Posten mit einem Gewehr im Anschlag. Vier Grenzbeamte der DDR, jeder mit einer
Leiter in der Hand, sowie ein Schäferhund, kamen zu unserem Wagen. Sie öffneten die Schiebetüre, stellten die Leiter
davor und ließen den Hund in den Wagen springen, der nur etwas herum schnupperte und wieder heraussprang. 2 Beamte
haben dann anschließend, die Papiere kontrolliert und das Inventar gezählt.
Nach einiger Zeit wurden wir an einen Güterzug der Reichsbahn angehängt und fuhren von Frankfurt an der Oder, vorbei
an Berlin, Ellingen und Nordhausen, über die Grenze zur Bundesrepublik bis Herzberg. Hier hat ein Zollbeamter der
Bundesrepublik, die Formalitäten erledigt und ein Tierarzt die Pferde, Rinder und Schweine gründlich untersucht. Ich
musste ihnen die Mäuler aufhalten und die Füße hochheben. Danach hat uns die Lokomotive zu einer Wasserzapfstelle
gebracht, wo wir die Tiere tränken und unsere Behälter mit Wasser auffüllen konnten. Anschließen fuhren wir über
Northeim nach Göttingen, zur Viehverwertungsgenossenschaft, die zuvor von unserer Ankunft in Kenntnis gesetzt wurde.
Der Ochse, die Sterke und die Schweine wurden, in Göttingen zum Schlachthof gebracht; die Pferde kamen nach Hannover
und die Schafsböcke nach Kassel. Wir waren mit dem Viehtransport 5 Tage unterwegs; hatten so manche Klippe umschifft
und Schwierigkeiten gemeistert, die im normalen Leben nicht vorkommen.
Wir wurden mit einem PKW, ins Durchgangslager Friedland bei Göttingen gefahren, wo mein Sohn Kurt, meine Schwester
Frieda Pelkowski und Siegfried Brosch mit Familie, die am 30 Juli, um 14 Uhr, von Warschau mit dem Zug abgefahren, und
hier am 31. Juli in den Morgenstunden eingetroffen sind, schon auf uns gewartet haben. In Friedland hat man uns mit
Familie Siegfried Brosch in einem Raum untergebracht, wir wurden registriert und erhielten 20 DM Überbrückungsgeld,
pro Person. Da wir erst am Freitag in Friedland eingetroffen sind, mussten wir hier über das Wochenende bleiben,
obwohl die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der Regel nur 3 bis 4 Tage beträgt.
Um einen Antrag für die Ausreise stellen zu können, brauchten wir eine Einladung von in der Bundesrepublik lebenden
Verwandten. Diese Einladung hat uns mein Bruder, Ernst Rattay, aus Ingelheim am Rhein zugeschickt. Ingelheim liegt im
Bundesland Rheinland-Pfalz. Das Geld für die Bahnfahrt, hat uns, Frieda Schellin, geb. Nickel, aus Duisburg, die
Tochter unseres Nachbarn, überwiesen. In Friedland wurden wir registriert. Im Registrierschein, war als unser
nächster Aufenthaltsort in der Bundesrepublik, das Durchgangslager Osthofen bei Worms, das alle Aussiedler für
Rheinland-Pfalz aufnehmen musste, eingetragen. Die Eintragung erfolgte deshalb, weil der Ort aus dem uns unsere
Einladung zugeschickt wurde, sich auch in Rheinland-Pfalz befand.
Da ich nach dem Polenfeldzug, als Soldat, ein Jahr im Kreis Opladen, im Rheinland gewesen bin, wäre ich sehr gerne in
diese Gegend gezogen, denn die Erinnerung an die schönen Tage die ich dort verlebt habe war in mir immer noch wach.
Ich versuchte die Eintragung in unseren Regiestierscheinen ändern zu lassen, was nach einigen, vielleicht auch
berechtigten Einwänden, am 4. August, vom Beauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen, genehmigt wurde. Anstelle von
Rheinlad-Pfalz stand da jetzt Nordrhein-Westfalen und am 7. August, fuhren wir, noch mit anderen Aussiedlern, ins
Durchgangslager Unna-Massen, am östlichen Rande des Ruhrgebietes gelegen. Hier wurden wir in einem Zimmer untergebracht
und konnten unser Essen in einer Gemeinschaftsküche zubereiten.
Am 8. August wurden wir in Unna-Massen, als Bürger der Bundesrepublik Deutschland registriert, erhielten
Einhundert DM Begrüßungsgeld, den Vertriebenen Ausweis -A -und 4 Wochen später den Bundespersonalausweis. In
Unna-Massen haben wir mehr als 4 Monate verbracht, weil mein Sohn Kurt, wegen fehlender Berufsausbildung, in Unna, an
einem Grundlehrgang für Metallarbeiter teilgenommen hat, der vom Arbeitsamt finanziert wurde. Am 11 Dezember 1969 sind
wir endlich an unserem vorläufigen Wohnsitz, im Durchgangswohnheim, an der Elisabethstraße 13, in Velbert angekommen.
Ab dem 5. Januar 1970 konnten meine Söhne, in der Zahnradfabrik Reining, in Velbert ihrer geregelten Arbeit nachgehen.
Von Bau- und Sparverein in Velbert wurde uns am 20. Juni 1970, unsere erste Wohnung zugewiesen.
Velbert im Februar 1972
gezeichnet: Gustav Rattay
Kurz vor Sonnenuntergang haben wir die Pferde vor den fertig gepackten Wagen gespannt und sind
sofort losgefahren. Mein Bruder und ich nahmen 4 Milchkühe und die beste Sterke mit und gingen hinterher. Schweine,
Kälber und Geflügel haben wir aus den Ställen getrieben. Wir waren die ganze Nacht unterwegs und sind bis Rheinswein
gekommen. Da hatten wir einen Onkel wohnen, bei dem haben wir den ganzen Tag verbracht.
Unterwegs haben wir einen Mann getroffen, der erzählte uns dass die Russen bei Groß Jerutten einen Personenzug
überrumpelt haben. Sie hatten aus Eisenbahnschwellen eine Sperre auf den Schienen errichtet und somit den Zug zum
Anhalten gezwungen. Die Russen haben den Zug mit Artillerie beschossen. Als die Soldaten und Zivilisten den Zug
verlassen wollten kamen die Kosaken zu Pferde und haben ein Massaker angerichtet. Nur wer sich am Boden davon
schleichen konnte hat überlebt. Die Russen wurden durch einen Verräter darüber informiert das auf diesem Gleis ein
Zug unterwegs war und waren darauf vorbereitet. Unserem Informanten ist es auch gelungen dem Massaker zu entkommen.
Ein Kosake hatte ihm im beim vorbeireiten mit dem Säbel ein Ohr abgehauen und ihn dadurch zu Boden geschlagen. Es ist
ihm danach gelungen ins Gebüsch zu schleichen. Sein Kopf war schon verbunden als wir ihn trafen. Später wurde an der
Stelle des Überfalls ein Gedächtnisstein errichtet.
Im Morgengrauen sah man viele Kosaken über die Felder reiten. Wir sind dann später wieder weiter in Richtung
Jellinowen gefahren. Unser Vater ist mit dem Pferdewagen die Landstraße entlang gefahren. Wir mit dem Vieh sind
entlang einer tiefen Schlucht durch den Wald bis zum Babanter See gegangen. Wir hatten schon vorher versucht die
Schlucht zu verlassen aber wegen der steilen Hänge ist es uns leider nicht gelungen. Am See angekommen fanden wir drei
große Schober mit Getreide vor. Von einem dieser Schober haben uns zwei Kosaken mit einem Fernglas beobachtet. Sie
schwangen sich auf ihre Pferde und kamen uns entgegen geritten, dann hielten sie uns ihre Lanzen vor die Brust und
versuchten uns auszufragen. Wir haben leider nichts verstanden und fingen an zu weinen. Plötzlich pfiff der
Patrollienführer auf einer Trillerpfeife und die Kosaken kehrten zu ihrem Ausgangspunkt zurück.
Als wir dann weiter am See entlang gingen sahen wir von weitem drei Gehöfte. In der Nähe einer dieser Höfe hatte unser
Vater den Pferdewagen im Gestrüpp abgestellt. Die vorrückenden Schützenlinien der russischen Infanterie hatten ihn
jedoch entdeckt. Sie haben den Wagen durchwühlt und den Sack mit Rauchfleisch mitgenommen. Andere Flüchtlingswagen die
in diesem Gebüsch Schutz gesucht haben sind nicht besser davon gekommen. Wir haben das Vieh auf einen der Höfe
getrieben und am Zaun festgebunden. Dann haben wir mit Hilfe einer Leiter den Heuboden erklommen und uns dort versteckt.
Als die Kosaken auf dem Hof erschienen verlangten sie Brot und Milch. Die Frauen mussten zuerst essen und trinken,
danach haben es die Russen auch getan, sie fürchteten sich davor, dass man sie vergiften könnte. Später kam dann die
russische Infanterie und hat Haus, Scheune und Schuppen durchsucht. Die Falltüre zum Heuboden ließ sich nur nach oben
hin öffnen. Wir hatten die Türe von oben mit schweren Gegenständen beschwert, aber die Russen versuchten mit aller
Gewalt auf den Heuboden zukommen. Als die Frauen das sahen, sagten sie zu den Russen, da oben würden sich ihre Kinder
versteckt halten. Die Russen forderten nun, die Kinder sollten sofort den Heuboden verlassen. Die Mütter riefen nun
nach ihren Kindern die dann auch tatsächlich den Heuboden verließen. Als wir das sahen, haben wir uns am Giebel tief
im Heu vergraben. Drei Russen kamen nun rauf und stocherten mit ihren Bajonetten im Heu herum. Glücklicherweise kamen
sie nicht in unsere Nähe. Als die Russen den Heuboden verließen haben wir befürchtet sie würden ihn in Brand setzen.
Wahrscheinlich taten sie deshalb nicht weil so viele russische Soldaten auf dem Hof waren. Einige Zeit später
erschienen russische Offiziere auf dem Hof, mit einem Auto. Sie sagten, sie hätten das Land erobert und wir hätten ab
sofort dem russischen Zaren zu gehorchen. Wir wurden angewiwsen nach Hause fahren und unbesorgt unsere Ernte
einzubringen. Sie haben uns auch eine Bescheinigung ausgestellt, damit uns auf dem Heimweg niemand die Pferde und
das Vieh wegnehmen würde.
Erst am nächsten Morgen, als die Front weiter vorgerückt war, beschlossen wir die Heimreise anzutreten. Die Straßen
waren mit vorrückenden russischen Truppen blockiert. Manchmal mussten wir stundenlang am Wegesrand warten bis die
Soldaten mit ihrem Tross vorbeigezogen waren. Unterwegs wollten sie unser Vieh zum Schlachten wegnehmen, aber die
Bescheinigung hat uns davor bewahrt. Die Eisenbahnbrücke vor Neu-Keykuth wurde von Kavallerie bewacht. Die wollten uns
nicht drüber lassen und hielten uns bis zum frühen Morgen fest. Zurück in Rohmanen angekommen, konnten wir unser Haus
nicht betreten weil der Hof und alles rundherum ein großes Militärlager war.
Wir sind dann in Richtung Seelonken gefahren, bis Abbau Brosch. Auf dem Hof angekommen haben wir zuerst Grünfutter für
die Pferde vom Feld geholt und anschließend Mittag für uns selbst gekocht. Die Nacht haben wir erstmal auf dem Hof
verbracht. Am nächsten Morgen wagten wir es ins Dorf zu gehen um die Lage zu erkunden. Die Russen waren schon wieder
weiter gezogen, aber Haus und Hof waren in einem schrecklichen Zustand. Wir sind dann gegen Abend wieder nach Hause
zurückgekehrt.
Am 23. August 1914 waren die Russen bei uns eingebrochen, bis sie am 28. August von den Deutschen zurückgeschlagen
wurden. Dann fuhren sie wieder zurück, drei Wagen nebeneinander. Ortelsburg brannte lichterloh. Ein Wagen mit Mehl war
uns gegenüber in den Straßengraben gekippt, aber wir haben nichts davon genommen, weil man ja nicht wusste ob man die
Nacht überleben würde. Wir saßen die ganze Zeit im Keller. Am nächsten Morgen zog dann russische Kavallerie und
Infanterie durch unser Dorf. Die Kavallerie ritt orientierungslos hin und her. Die Infanterie hat den ganzen
Vormittag 1,5 Meter tiefe Schützengräben ausgehoben. Um 11 Uhr kamen aus Richtung Eichtal 3 deutsche Spähwagen nicht
ahnend dass die nördliche Hälfte des Dorfes noch von Russen besetzt war. Wir haben zu diesem Zeitpunkt auf dem
Dachboden Weizen eingesackt und hatten aus diesem Grunde einen weiten Rundblick.
Um 11 Uhr kamen aus Richtung Eichtal drei deutsche Spähwagen angefahren. Als wir die deutschen Soldaten erkannt hatten,
haben wir sie durch Handzeichen gewarnt weiter nach Norden vorzustoßen. Die Kosaken hatten sich auf den Häuserdächern
positioniert und in Richtung Norden nach deutschen Truppen Ausschau gehalten. Die Deutschen sprangen von den Spähwagen
und fingen an die nichts ahnenden Russen zu beschießen. Als die sich ihrer gefährlichen Lage bewusst wurden verließen
sie ihre Aussichtsposten und bestiegen ihre Pferde. Mit Peitschenhieben versuchten sie, die sich in panikartiger Flucht
befindliche Infanterie dazu zu Bewegen, die Deutschen anzugreifen. Zwei Spähwagen wendeten sofort, der Dritte konnte
nicht mehr umkehren. Es gelang allen, bis auf den Fahrer des dritten Wagens die Flucht. Die Russen nahmen ihn sofort
unter Beschuss, doch es gelang ihm über unseren Hof zu entkommen. Auf der rückwärtigen Seite schlug er sich quer durch
die Gärten bis zum Gehöft von Friedrich Sakowski durch. Der versteckte ihn im Keller und versorgte ihn anschließend
mit Zivilkleidung.
Als die Russen den Soldaten auf unseren Hof laufen sahen nahmen sie sofort die Verfolgung auf. Sie durchstöberten auch
die Nachbarhäuser und trieben die Bewohner auf der Straße zusammen. An der Spritzenwagenremise richteten sie einen
Sammelpunkt ein. Unter dem Vorwand es würde hier eine Schlacht stattfinden, versuchten die Russen die Zivilbevölkerung
aus dem Dorf zu drängen. Alle die dem Aufruf gefolgt sind und an unserer Sammelstelle vorbeikamen wurden unserem Haufen
hinzugefügt. Unter ihnen befand sich auch der deutsche Soldat in Zivilkleidung. Er hatte einen Sack über die Schulter
geschlagen in dem sich ein Brot befand, an der anderen Hand führte er eine Kuh am Strick. Als unser Haufen schon aus
etwa 50 Leuten bestand setzten uns die Russen mit Marschrichtung Seelonken in Bewegung. Wir Jungen versuchten in einem
unbeaufsichtigten Moment wegzulaufen, doch die Begleitmanschaft prügelte uns mit Gewehrkolben wieder in Reihe und Glied.
Unterwegs gelang es dem Soldaten mit der Kuh unbemerkt zu entkommen. Er kehrte unbehelligt ins Dorf zurück und lieferte
die Kuh wieder dort ab wo er sie entführt hatte.
Uns haben die Russen an Seelonken vorbei zum Sylvensee getrieben. Wenn sie von vorbeiziehenden russischen Offizieren
gefragt wurden weshalb wir unterwegs wären, sagten sie denen wir hätten deutsche Soldaten versteckt und wollten das
Versteck nicht verraten. Als wir am See vorbei waren begann die deutsche Artillerie aus Richtung Ortelsburg zu
schießen. Unweit von uns explodierten Granaten und richten ein großes Chaos unter Freund und Feind an. Es hieß dann
rette sich wer kann. Die Russen verließen uns in Richtung Waldpuschsee und wir kehrten orientierungslos nach Seelonken
zurück. Nach Rohmanen konnten wir nicht zurück weil die deutsche Artillerie aus Richtung Eichtal anfing unser Dorf zu
beschießen. Schließlich sind wir auf dem Abbau Brosch untergekommen. Ein durch Granatsplitter schwer verletzter Russe
suchte dort auch Zuflucht. er versucht sich mit einem Messer das Leben zu nehmen. es gelang den Frauen ihn davon
abzubringen, weil sonst bei einem etwaigen erscheinen von russischen Soldaten der Verdacht auf uns gefallen wäre.
Später erschienen tatsächlich Kosaken die ihn dann mitgenommen haben. Ihnen folgten in 50 Meter Entfernung Deutsche
Ulanen, die hinter den Russen in einem in der Nähe liegenden Wäldchen verschwanden.
Nachdem die Russen Rohmanen besetzt hatten, versteckten sie sich vorwiegend in mit Stroh gedeckten Gebäuden. Durch
Schießscharten, die sie im Strohdach anlegten, schossen sie auf die deutschen Kampfverbände, die sie wieder vertreiben
wollten. Um die Angreifer zu entlasten, wunde das Dorf von deutscher Seite unter Beschuss genommen. Durch die
Geschosse der deutschen Artillerie entstanden in Rohmanen viele Brände. Die mit Stroh gedeckten Gebäude fielen zuerst
in Schutt und Asche. Unser Vater hatte uns ins Dorf geschickt, damit wir das Vieh im Stall von der Kette losbinden
sollten. Am Dorfrand kamen uns schon deutsche Ulanen und Husaren entgegen. Rohmanen brannte an mehreren Stellen. Unser
Hof war noch unversehrt, nur die Zäune standen schon in Flammen. Wir haben das Vieh los gebunden und anschließend
versucht die Brandherde rund herum zu löschen. Es gelang uns die Flammen von unserem Hof fernzuhalten und auch bei
unserem Nachbarn einzugreifen. In vielen Scheunen und Ställen hatten sich noch viele versprengte Russen versteckt. Die
wurden anschließend von deutschen Soldaten eingesammelt und in Gefangenenlager abgeführt. Am nächste Tag haben wir dann
zerbrochene Gewehre und Munition in Körbe gesammelt und im Dorfteich versenkt.
Am 29. August haben die Russen Rohmanen verlassen, doch schon am 30. August sind sie wieder zurückgekehrt. Hauptlehrer
Müller wurde mit seinem Sohn und Karl Deptolla auf Fahrrädern fahrend von einer russischen Patrouille aufgegriffen.
Sie wurden von den Russen der Spionage verdächtigt weil der Lehrer Müller ein Fernglas bei sich trug. Der Sohn hatte
eine Gymnasiastenmütze und eine Landkarte bei sich. Sie wurden in Richtung Lehmanen abgeführt. Auf einer Anhöhe des
Grundstücks von Ernst Chittka befand sich eine nicht mehr betriebstaugliche Windmühle. Dort soll ein russisches
Kriegsgericht sie zum Tode verurteilt haben. Nach der Hinrichtung wurden sie in der Nähe der Windmühle verscharrt.
Später wurden sie wieder ausgegraben, in Särge gelegt und auf dem Rohmaner Friedhof beigesetzt. Die Ehefrau von Lehrer
Müller hat die Gräber nach dem 1. Weltkrieg mit einem schmiedeeisernen Zaun umrandet.
Die Kämpfe um Rohmanen haben viele Menschenopfer gekostet. Bei uns hinter der Scheune lagen 2 tote Russen und ein
Verwundeter. Die Toten haben wir in einer Kartoffelmiete vergraben. Alle anderen Gefallenen wurden auch gleich an der
Stelle an der sie zu Tode kamen verscharrt und mit einem Kreuz gekennzeichnet. Für die im Raum Rohmanen gefallenen
Russen wurde nach dem Krieg hinterm Dorf, in Richtung Ortelsburg, auf einer Anhöhe ein Heldenfriedhof angelegt. Dort
liegen 20 Soldaten und 1 Offizier. In der Mitte befindet sich ein Trauerbaum und Birken säumen den Zugang von der
Landstraße her. Der Lehrer Dorka hat nach dem Kriege, mit seinen Schülern immer die Gräber gepflegt.
Meine Einberufung zum Militär

Bis zu meinem 17. Lebensjahr habe ich meinem Vater in der Landwirtschaft geholfen. Im Frühjahr
1916 wurde unser Jahrgang gemustert. Im Herbst 1916 erhielten Gustav Spektor, Johann Resonek und ich einen
Einberufungsbescheid. Wir mussten uns in Allenstein im Kaisergarten melden. Dort wurden Rekruten aus mehreren
Landkreisen zusammen gezogen und danach verschiedenen Ausbildungszentren zugeteilt. Wir Rohmaner kamen zum 18.
Infanterie-Regiment nach Osterode. Ein Unteroffizier mit einer Gruppe Musketiere haben uns von Allenstein abgeholt.
Als wir in der Kaserne ankamen haben wir sofort Mittagessen in Blechnäpfen bekommen. Untergebracht wurden wir im
Dachgeschoß der Kaserne. Es waren keine Betten vorhanden, nur Strohsäcke lagen auf dem Boden.
Als dann einige Tage später ausgebildete Kompanien an die Front ausrückten durften wir in einen anderen Block umziehen.
Wir wurden der Größe nach aufgestellt, in Korporalschaften eingeteilt und dann von Kopf bis Fuß eingekleidet. Die
Ausgehuniformen hatten blanke Knöpfe dazu einen Schako mit blanker Spitze. Im neuen Block hatten wir 2stöckige Betten.
Unsere Zivilbekleidung mussten wir in einen Karton verpacken und nach Hause schicken. Dann erst begann das eigentliche
Kasernenleben. Die Kaserne durfte niemand ohne Erlaubnis verlassen, nur in Begleitung eines Unteroffiziers. In der
Kaserne war eine Kantine in der man alles kaufen konnte was in der Kaserne gebraucht wurde.
Am nächsten Tag kam unser Kompanieführer, im Range eines Hauptmanns, zu Pferde angeritten. Er begrüßte uns mit;
Guten Morgen Kameraden, wir antworteten ihm mit; Guten Morgen Herr Hauptmann. Er hat dann die Front abgeschritten und
jeder musste sich mit seinem Namen vorstellen. Um 5 Uhr wurde geweckt, 6 Uhr Kaffee holen, 7-8 Uhr Unterricht, 8-11
Uhr exerzieren auf dem Kasernenhof. Um 11.30 blies der Trompeter zur Mittagspause. Die erste Zeit war noch alles
ziemlich gemütlich aber dann wurde es von Tag zu Tag strenger. Um 10 Uhr abends war Zapfenstreich, dann ging der
Unteroffizier vom Dienst von Stube zu Stube, der Stubenälteste musste die Anwesenheit aller Rekruten melden; zum
Beispiel: Stube 56 belegt mit 14 Mann, alle zu Haus. Wir mussten in 2 Reihen antreten, mit Drillichanzug bekleidet
und in Pantoffeln, ein tadelloses Aussehen präsentieren. Der Diensthabende Unteroffizier prüfte ob alle
vorschriftsmäßig angezogen, gewaschen, gekämmt und ob alle Knöpfe an der Jacke geschlossen waren. Als er bei einem
Rekruten einen offenen Knopf erspähte, hat er uns gefragt, ob jemand ein Taschenmesser bei sich hat.
Wir ahnten nicht Gutes, darum haben wir uns ganz still verhalten und nichts gesagt. Da sagte der U.v.D. plötzlich:
”Wenn niemand von euch ein Messer bei sich hat, dann habe ich ein”. Er zog sein Messer aus der Tasche und fing an, bei
dem Rekruten die Knöpfe abzuschneiden. Als die Knöpfe zu Boden purzelten, brachen wir in lautes Gelächter aus. Das hat
ihn so in Rage gebracht, das unser unwürdiges Benehmen, zuerst mit einem „Donnerwetter” bestraft wurde. Dann schrie
er: ”In den Korridor marsch, marsch, die Treppen runter bis auf den Hof”. Als wir unten angekommen waren hieß es
wieder; "Zurück auf die Stube in der 3. Etage”. Jemand hat mir bei dem Durcheinander, von hinten in den Pantoffel
getreten, so das er auseinander gerissen wurde. Ich bin dann nur mit einem Pantoffel und einem Socken die Treppen rauf
und runter gelaufen. So wurden wir 3-mal hinunter und wieder hinauf gejagt.
Danach ließ er uns wieder antreten und hat mit einer Taschenlampe unter den Betten geleuchtet. Plötzlich schrie er
wieder los: "Das nennt ihr Fegen? wenn ihr mit dem Besen nicht fegen könnt, dann mühst ihr das mit eueren Bäuchen tun.
Marsch, marsch unter die Betten” . Als wir schon alle am Schlafen waren, kam der U.v.D. wieder und hat nachgesehen ob
alle Schränke abgeschlossen waren. Ein Kamerad hatte seinen Schlüssel verloren, deshalb hat er das Schoß nur so
eingehängt. Als der U.v.D. das bemerkte hat er die Türe aufgerissen, die ganzen Sachen aus dem Schrank, quer durch die
Stube verteilt und war dann endlich gegangen.
Die Anziehsachen mussten, fein sauber gefaltet, auf dem Stuhl liegen; da drauf die Socken und die Pantoffeln unter dem
Stuhl. Die Stühle mussten in einer Reihe ausgerichtet sein; die Hosenträger im Schrank einschlossen und der Brustbeutel
mit Geld auf dem Hals tragen werden. Morgens wurden wir geweckt und kamen zuerst in den Waschraum. Jeder musste seinen
entblößten Oberkörper mit kaltem Wasser abreiben. Da draußen strenger Frost herrschte war es im Waschraum auch sehr
kalt, so das manche ihr Hemd anbehielten. Der UvD hat dann bei seinem Kontrollgang alle Verweigerer aufgeschrieben
und ihnen befohlen in 30 Minuten mit einem Besen in der Hand auf der Schreibstube zu erscheinen. Einige mussten den
Kasernenhof fegen, andere die zugefrorenen Latrinen enteisen und reinigen. Während unserer Ausbildungszeit durften wir
die Kaserne nicht verlassen. Wenn man Stuben- oder Frühdienst hatte, blieb keine Zeit zum Frühstücken.
Nach 6 Wochen wurden wir in der Grollmann Kaserne vereidigt. Die Regimentskapelle spielte "Heil dir im Siegerkranz",
danach folgten 3 Strophen des Deutschlandliedes. Vor der Vereidigung wurden die Rekruten gefragt wer keine deutsche
Staatsangehörigkeit besitzt. Es sind dann Luxemburger und auch noch welche aus anderen Ländern hervorgetreten. Sie
wurden gefragt ob sie die deutsche Staatsangehörigkeit annehmen wollen. Die das abgelehnt haben wurden auf die
Schreibstube gerufen und sofort aus dem Militärdienst entlassen. Nach der Vereidigung erfolgte ein Kirchgang, danach
konnte man einen Stadturlaub beantragen. Nach dem Mittagessen mussten alle, die einen Urlaubschein beantragt hatten
vor der Kaserne antreten. Der Hauptfeldwebel prüfte dann ob an der Uniform alle Knöpfe blank geputzt waren, die Stiefel
glänzten und der Rekrut auch vorschriftsmäßig grüßen konnte. Wer diese Anforderungen nicht erfüllen konnte musste
seinen Urlaubschein wieder abgeben und zurück auf sein Zimmer gehen.
Wenn man die Kaserne für eine gewisse Zeit verlassen wollte, mussten zuerst der Korporal, dann der Hauptfeldwebel und
letzt endlich der Hauptmann, seine Zustimmung erteilen. Es wurde geprüft; ob die Ausgeh-Uniform sitzt, alle Knöpfe
blank geputzt sind und der Helm so blank ist das man sich darin spiegeln kann. Unser Hauptmann war in Zivil,
Bürgermeister von Osterode. Er war sehr stolz wenn er seine Kompanie, in Parade Uniform und mit einem fröhlichen Lied
auf den Lippen, durch seine Stadt führen durfte.
Als wir eines Tages zum etwa 6 Kilometer entfernten Schießstand marschieren sollten, war es sehr kalt und glatt. Der
Hauptmann ritt durch das große Tor, wir aber sind durch das kleine Tor gegangen und haben eine steil bergab führende
Abkürzung gewählt. Die Zug- und Gruppenführer gingen voraus und wir im Gänsemarsch hinterher. Ein Kamerad hat sich auf
den Gewehrkolben gesetzt und ist darauf den Berg hinunter gerutscht. Als die Anderen das sahen haben sie es ihm
nachgemacht und hatten einen Riesenspaß. Da kam der Hauptmann plötzlich im Galopp angeritten; ließ alles anhalten und
hat zuerst die Zugführer ausgeschimpft, dann anschließend die ganze Kompanie. Er sagte: „Wie könnt ihr es wagen, so
mit eueren Gewehren umgehen. Ein Gewehr soll man wie seine Braut behandeln und nicht wie einen Straßenbesen”. Zur
Strafe mussten wir, links und rechts der Straße, in zwei Reihen antreten und durch den verschneiten Straßengraben
robben. Die Herrn Zug- und Gruppenführer durften die Straße benutzen und erteilten uns nur Befehle, wie: hinlegen,
nach rechts schwenken, nach links schwenken, einzeln vorarbeiten und sammeln. Als wir dann abgekämpft, in Linien zu
2 Glieder angetreten waren, ging es mit Gesang zum Schießstand.
Auf dem Schießstand angekommen, erhielten wir zuerst eine praktische Unterweisung, für den Gebrauch von Schusswaffen.
Wir mussten solange mit einem nicht geladenen Gewehr üben, bis wir unserem Vorgesetzten beweisen konnten, dass wir
alles im Griff haben. Daraufhin wurden jedem 10 Patronen zugeteilt, so das er unter der Aufsicht eines Unteroffiziers
mit den Schießübungen beginnen konnte. Der Unteroffizier hat die Position der Einschüsse, auf der Scheibe, in einem
Buch eingetragen und nach Beendigung der Übung dem Hauptmann Bericht erstattet, ob der Schütze seine Aufgabe erfüllt
hat oder nicht. Nach dem Schießen wurden die Gewehre zu Pyramiden zusammengestellt. Diejenigen die ihre Aufgabe nicht
erfüllt haben, mussten rund um die Zielscheibe, die Bleikugeln aufsammeln.
Seit unserer Einberufung hatten wir noch keinen Heimaturlaub. Urlaub bekamen nur die, die ihren Heimatort zu Fuß
erreichen konnten. Wegen der vielen Truppentransporte die täglich von Ost nach West unterwegs waren durften wir die
Eisenbahn nicht benutzen. Einmal wurde uns gesagt; wenn jemand gut schießen kann der bekommt Heimaturlaub, aber auch
das war nur ein leeres Versprechen.
Kaisers Wilhelms Geburtstag
Der beste Tag war des Kaisers Geburtstag. Am 27. Januar mussten alle in der Grollmann Kaserne
antreten, der Battalions-Kommandeur beendete seine Laudatio mit den Worten: Seine Majestät, unser Kaiser und König
Wilhelm II, erlebe hoch, hoch, hoch. Dann spielte die Regimentskapelle: Heil dir im Siegerkranz, Herrscher des
Vaterlands, Heil Kaiser dir. Danach folgten 3 Strophen des Deutschlandliedes und anschließend fand ein Gottesdienst
statt. Anschließend gab es ein vorzügliches Mittagessen, Schweinebraten, ein Stück Wurst auf die Faust und Biermarken,
die man in der Kantine gegen gutes Bier einlösen konnte, danach Urlaub bis zum Wecken, ohne Urlaubschein. Mein Vater
und die Mutter eines Kameraden waren schon morgens angekommen, konnten uns aber nicht finden, wurden von einer Kaserne
in die andere geschickt. Erst als wir mit Musik, von der Kirche zurück zur Kaserne marschiert sind habe ich sie
zufällig entdeckt. Als sie mich auch erkannt haben, sind sie nachgekommen. Da war die Freude groß: Der Vater hatte
einen großen Koffer auf einem Krückstock über die Schulter getragen. Ich ging gleich zur Wache und habe sie angemeldet,
sie sind dann bis zum Abend geblieben. Es war einer der schönsten Tage in der Grollmann-Kaserne in Osterode.
Alle 10 Tage bekamen wir Sold. Vor der Auszahlung mussten wir antreten, jeder wurde gefragt ob noch Restgeld vom
letzten Sold vorhanden war. Dann bekam jeder 3,30 Mark, davon musste man noch Sidol für das Koppelschloss und
Schuhkreme für die Stiefel kaufen. Wer geraucht hat und nichts von zu Hause bekam war schlimm dran. Beim Militär bekam
man nicht nur die Ausbildung an der Waffe beigebracht, man lernte auch putzen, nähen, Strümpfe stopfen und vieles
Andere. Man bekam einen beschädigten Strumpf, der musste aufgeribbelt werden, mit der Wolle konnte man dann andere
Strümpfe stopfen oder Kleidungsstücke mit Namen kennzeichnen. wer das nicht konnte, der musste seinen Kameraden
Zigaretten oder Geld geben die das dann für ihn erledigten.
Verschiedene Kameraden gingen nach dem Dienst noch in die Stadt. Um 21:45 Uhr wurde zum Zapfenstreich geblasen, dann
musste man schnell zurück in die Kaserne, weil um 22:00 Uhr der Wachhabende von Bett zu Bett ging und prüfte ob auch
alle anwesend waren. Zwei mal pro Woche fanden Gewaltmärsche statt, mit vollem Gepäck im Tornister. Am Ende der
Marschkolonne fuhr dann ein Pferdewagen, wenn der Feldarzt bei jemandem einen Erschöpfungszustand feststellte, der
durfte dann aufsitzen. Am Sonnabend wurden auf dem großen Exerzierplatz Felddienstübungen durchgeführt, es befand sich
dort ein großer Hügel, den wir immer wieder erstürmen mussten. Am Nachmittag war Revierreinigen angesagt, wir mussten
dann die Tische schrubben, auf einen Tisch wurde Sand mit etwas Wasser gestreut, der nächste Tisch wurde mit der den
Beinen nach oben drauf gelegt und solange hin und her geschoben bis beide sauber waren. Mit den Stühlen geschah das
Gleiche. Dann wurde der Fußboden in der Stube geschrubbt, die Schränke abgewaschen, Staub geputzt, zuletzt kamen Flur
und Treppe dran.
Für die Arbeit war eine Stunde angesetzt, wenn jemand zu früh fertig war erregte er den Argwohn des Diensthabenden
Korporals, der prüfte dann alles genau, fand natürlich immer etwas das nicht seinen Erwartungen entsprach. Der
Übereifrige musste dann Nacharbeiten bis die Stunde um war. Eine Stunde war für Gewehr reinigen und Unterricht an der
Waffe vorgesehen.
Im Februar wurden wir neu eingekleidet; Schnürschuhe, Koppel, alles gelbes Leder mussten wir mit Lederschwärze
behandeln. 2 Wolldecken, Uniform und Helm in feldgrau, da brauchten wir die Knöpfe nicht mehr zu putzen. Die neuen
Gewehre mussten zuerst eingeschossen werden. Es wurden 90 scharfe Patronen und Marschverpflegung ausgegeben, danach
mussten wir mit vollem Gepäck zum Appell antreten. Man konnte kaum gerade stehen, weil der Tornister einen in die Knie
zwang. Der Major, der die Aufstellung besichtigte rief >Brust raus<, dann informierte er uns dass wir ins
Feldrekrutendepot und in Feindesland kommen. Urlaub bekam niemand. Ich habe ein Telegramm nach Hause geschickt, mit
der Nachricht dass wir bald abrücken werden. Einen Tag vor dem ausrücken hat mich meine Mutter noch besucht, sie hat
mir vieles mitgebracht. Alles konnte ich nicht mitnehmen, weil es nicht gestattet war anderes Gepäck bei sich zu haben
als dem Soldaten zustand.
Abmarsch zum Fronteinsatz
Am nächsten Tag hat uns die Regimentskapelle mit Musik zum Bahnhof gebracht. Von Osterode ging
es über Thorn, Posen,
Annaberg, Warschau, Brestlitowsk ins Pruschana-Lager. Das war eine russische Artillerie-Kaserne, in der 2 deutsche,
3 österreichische Bataillone und eine Offiziersschule untergebracht waren. Ein Bataillon das waren wir 18 und 19
jährige, die Anderen waren Männer bis 45 Jahre. Als wir in Osterode abfuhren lag Schnee, in Annaberg/Schlesien waren
die Kühe auf der Weide und im Pruschana-Lager lag der Schnee wieder einen Meter hoch. Drei Kilometer vor unserem vor
unserem Lager war die Bahnfahrt zu Ende. Mit den schweren Tornistern waren viele überfordert, wir mussten immer wieder
warten bis alle nachkamen. Unsere Unterkünfte das waren Baracken die den Russen als Pferdeställe gedient hatten. In
jeder Baracke wurde eine Kompanie mit Schreibstube untergebracht, die nur durch ein Zelt abgegrenzt war.
Wir haben aus Brettern Doppelbetten hergestellt, in jeder Baracke war ein Ziegelofen. Unsere neuen Uniformen und die
scharfe Munition mussten wir abgeben und bekamen dafür alte Bekleidung, sowie Ecksezierpatronen. Hier ging es wieder
Kasernenmäßig zu, das jüngere Bataillon bekam besseres Essen, doppelte Portionen und nach dem Essen 2 Stunden Bettruhe.
Wenn jemand die Bettruhe nicht einhielt und dabei erwischt wurde wusste zur Strafe Holz hacken oder Schnee schaufeln.
Zwei Wochen war Frost bis minus 40 Grad, da hatten wir keinen Unterricht im Freien, alle Aktivitäten fanden in der
Baracke statt, die nur mit nassem Holz beheizt wurde und dem entsprechend war auch die Temperatur im Inneren. Um
Brennmaterial für die Küche zu besorgen mussten wir ins nächste Dorf gehen und von zerfallenen Häusern Holz holen.
Als endlich das Tauwetter einsetzte verwandelte sich die Gegend um Baranowitschi in ein unüberwindbares Sumpfgelände.
Wir wurden mit anderen Einheiten die aus Frankreich zu uns verlegt wurden, zusammengelegt. Wenn jemand nachweisen
konnte dass er Landwirt ist und mehr als 100 Morgen Ackerland besitzt, konnte er einen Urlaub zur Frühjahrsbestellung
beantragen. Ein Gottlieb Piotrowski aus Plohsen hat seinen Urlaub bewilligt bekommen und durfte für 14 Tage nach Hause.
Wenn von der unweit entfernten Front Kanonendonner zuhören war und Alarm ausgerufen wurde, dachten wir es geht los.
Obwohl wir als Reserve aufgestellt waren mussten wir allzeit einsatzbereit sein. Wir haben auch Bunker und Stollen
gebaut, Schützengräben ausgeworfen und mit scharfen Handgranaten exerziert.
Als Gottlieb Piotrowski nach 2 Wochen zurückkam waren wir schon in Alarmbereitschaft und sind dann auch 2 Tage später
ausgerückt. Kamerad Piotrowski hatte mir noch ein großes Paket von zu Hause mitgebracht.
Italien hat Deutschland und Österreich den Krieg erklärt.
Zuerst sind drei Bataillone Österreicher ausgerückt, dann die Deutschen hinterher. Bis zum
Bahnhof Linowa wurden wir von einer Musikkapelle begleitet, dann ging es per Eisenbahn ab nach Baranowitsche. Dort
wurden wir der, an der Westfront aufgeriebenen, 15ten Reserve Division zugeteilt. Es wurde uns gesagt das Kameraden
aus der Heimat gleichen Gruppen zugeordnet werden können. Ich hatte einen Freund aus meinem Dorf, Gustav Spektor,
einen aus Groß Schöndamrau, Wilhelm Lukas und einen aus Ortelsburg, Karl Schlensack, wir kamen zu zusammen in eine
Kompanie. Zuerst waren wir in einem Kinosaal einquartiert, haben jeden Tag Schützengräben ausgehoben und Feldübungen
gemacht. Es war ein sumpfiges Gelände, so dass die Soldaten wegen den vielen Mücken, Netze auf den Köpfen tragen
mussten. Nach einem Gewitter wurde es plötzlich unerträglich. Die Mücken hatten meinen Freund so zerstochen dass sein
Gesicht dermaßen angeschwollen war und ich ihn gar nicht wieder erkannt habe.
Von Baranowitsche wurden wir wieder auf die Eisenbahn verladen, die uns mit unbekanntem Ziel Richtung Osten fuhr.
Nachdem wir unterwegs einmal zum Essenfassen gehalten haben, kamen wir in der Nacht in Krakau an. In der nächsten
Nacht befanden wir uns schon in den Karpaten, wo wir die Hügelketten zu Fuß überqueren mussten, die Fahrzeuge fuhren
um die Berge herum und wir mussten manchmal 2 Stunden warten bis sie uns wieder eingeholt hatten. So ging es immer
weiter bis wir auf einen Berg kamen wo wir Zelte aufgebaut und Biwak bezogen haben. Dort stießen wir auf türkische
Einheiten die auf Mauleseln Munition und Verpflegung über die Berge transportiert haben. Die Esel hatten ein Gestell
auf dem Rücken, auf jeder Seite eine Fass mit Wasser oder Kisten mit Proviant. Ihre Artillerie wurde von 6 Mauleseln
gezogen, während die Offiziere, ohne Sattel, ohne Zaumzeug, nur mit einem Hanfseil ausgerüstet, daher kamen.
Die Mannschaften marschierten wie es jeder für richtig hielt, mit aufgekrempelten Ärmeln, das Gewehr über den Tornister
gelegt, wie die Wilddiebe. Im Gegensatz dazu herrschte bei uns strenge Disziplin, wen jemand aus der Reihe ging kam
sofort der Kompanieführer angeritten, hat uns angeschrieen, uns klar gemacht dass wir keine Türken seien und nur auf
höheren Befehl etwas an der Marschordnung ändern dürften, wer dagegen verstoße, müsste mit einem 3tägigen Arrest
rechnen. Wir haben hinter der der Front Gewaltmärsche durchgeführt die dem Feind große Truppenaufmärsche vortäuschen
sollten.
Wir lagen in einem Buchenwald in Bereitschaft. Überläufer berichteten dass auf russischer Seite eine Großoffensive
vorbereitet wird. In einer Nacht wurde plötzlich Alarm geschlagen, der Russe war zu einem Angriff mit Gasgranaten
übergegangen. Wir lagen unter Zelten und hatten die Gasmasken gar nicht bei uns, sondern nur etwas abseits liegen. In
der Dunkelheit hat mach einer keine Gasmaske mehr gefunden. Es war ein fürchterliches Durcheinander. Dabei war es
unsere Pflicht die Maske immer an dem Tragriemen über dem Hals zu tragen, mit halb geöffnetem Deckel. Uns hat es zum
Glück nicht so stark betroffen weil wir auf einer Anhöhe lagen und die Gaswolken sich im Tal verteilten. Wir wurden in
höchste Alarmbereitschaft versetzt weil der Russe die österreichische Front durchbrochen hatte.
Eigentlich sollten wir noch an einer Gulaschkanone Essen fassen, aber es blieb uns dazu keine Zeit mehr. Der
Kompanieführer befahl uns die Zelte abzubrechen, auf den Tornister aufzurollen und in fünf Minuten marschbereit zu
sein. Die Kanoniere befanden sich schon in der Batteriestellung, luden die Granaten, die sofort abgefeuert wurden. Der
Battalions-Kommandeur versammelte die Kompanieführer und erteilte ihnen die Angriffsbefehle. Derweil sollten wir in
einem Eichenwal der schon mit Granattrichter übersät war, Deckung suchen. Bald hatten wir die Verbindung zu unserem
Batteriestab verloren. Wir warfen unsere Tornister auf einen Haufen, schwärmten unverzüglich, nur mit Sturmgepäck
ausgerüstet, 4 Handgranaten im Brotbeutel, zum Angriff aus. Wir robbten uns einzeln voran. Weil der Russe unsere
Stellungen schon überrannt hatte war jeder auf sich selbst angewiesen. Mann hörte kein Kommando mehr weil der Russe
inzwischen den Rückzug angetreten hatte, um sich auf einer Bergspitze zu verschanzen, von der er uns mit
Flachbahngeschützen beschoss. Irgendwann befanden wir uns in einem Schützengraben, wo ein Leutnant und 17 Mann aus
unserer Division die Stellung hielten. Unter Androhung von Gewalt befahl er uns den Graben sofort zu verlassen und am
Gegenangriff teilzunehmen. Wir sprangen über den Stacheldraht, duckten uns aber sofort im nächsten Graben damit das
mörderische Maschinengewehrfeuer uns nicht hinwegfegte.
Dort blieben wir bis zum Eintritt der Dunkelheit liegen. Wir konnten unsere Waffen nicht mehr einsetzen weil der Sand
die Gewehrschlösser blockiert hatte. Als es Nacht wurde herrschte ein gespenstische Stille. Wir krochen aus dem
Schützengraben und lauschten nach irgendeinem Lebenszeichen von anderen Kameraden. Dann hörten wir irgendwelche Laute
die wir nicht genau zuordnen konnten. Sie kamen aus einem Holzbunker ganz in der Nähe. Wir näherten uns ganz
vorsichtig, als plötzlich eine Schar österreichischer Soldaten herausstürmte. An unseren Stahlhelmen erkannten sie
dass wir Deutsche sind. Bald danach trafen wir auch auf 69 deutsche Soldaten die zu unserer Division gehörten. Dann
kam ein Hauptmann der uns mit Vorwürfen überschüttete, wir seien Feiglinge, wir hätten uns von unserer Einheit entfernt.
Wir haben ihm den Vorgang geschildert, aber ließ nicht mit sich reden und sagte nur dass wir bestraft werden und nichts
zu essen bekommen. Wir wurden einer Maschinengewehr Einheit zugeteilt welche die vorderste Stellung verteidigen
musste. Wir hatten einen Stollen mit 2 Ausgängen.
Die Russen haben bemerkt das sich etwas bewegte und haben uns unverzüglich mit Artilleriefeuer belegt. Schon die
dritte Granate war ein Volltreffer. Vier Kameraden waren sofort tot, ich bekam mit einem Stollenbrett in den Rücken
der sofort blau und grün angelaufen war. Ich schaute nach oben, alles war verschüttet. Ich wusste nicht das da noch
ein Ausgang war, doch die Kameraden die hier in Stellung waren haben mir geholfen das Freie zu erreichen. Ich habe
mich am nächsten Tag krank gemeldet, dachte 2 Tage Schonung zu bekommen, aber der Sanitäter hat mir nur den Rücken mit
Spiritus eingerieben und mich wieder, zurück zu unserer Kompanie geschickt. Sie bestand nur noch aus 3 Gruppen, die in
einem Stollen, der in einen Berg gehauen war, Stellung bezogen hatten. Wir konnten uns hier wenigstens waschen, an
einer Quelle die aus dem Felsen sprudelte. Wir waren nicht mehr einsatzfähig und mussten durch andere Truppenteile
verstärkt werden.
Beim Essen holen musste man auch das Gewehr bei sich haben, es wurde erzählt dass hier der braune Bär herumwandert.
Ich habe keinen gesehen, nur das die Toten ausgescharrt wurden und verstümmelt herumlagen. Nach einigen Wochen haben
die Deutschen eine Gegenoffensive gestartet, von den Bergen herunter, über den Fluss Zlota Lipa, bis zu einer Stadt
die Brzezany hieß. 2 Tage später wurden wir auch eingesetzt, bei großer Hitze ging es in Dauermärschen vorwärts, man
durfte aus den Flüssen kein Wasser trinken, weil es mit Petroleum verseucht war. Nur wenn es dunkel wurde machten wir
halt, dann mussten wir Gräben ausheben um vor Überraschungen sicher zu sein.
Links von uns war Tarnopol und rechts Rumänien. Wenn es nach einer Ruhepause wieder losging dann war es am schlimmsten,
man ging wie auf Nägel, weil die Füße die Strapazen nicht so ohne weiteres wegsteckten. Im Dorf wurde niemals Rast
gemacht, denn da waren immer Brunnen, zu denen alle hinstürmten. Später wurden Melder vorausgeschickt, die von den
Dorfbewohnern Wasser in Eimern am Weg raussetzen ließen, damit die Soldaten Ihren Durst löschen konnten. Ein Soldat hat
gleich den ganzen Eimer mitgenommen und ihn dann als er leer war, irgendwo am Wegrand stehen lassen. Der Kompanieführer
kam angeritten, hat ihn ausgeschimpft und gedroht, ihn mit 3 Tagen Arrest zu bestrafen. Wir gehörten zur Südarmee
welche von Graf Bothmer befehligt wurde.
Die Stellungen waren schlecht ausgebaut, abends mussten wir, von der 2 Kilometer hinter der Front liegenden Feldküche,
Essen und andren Proviant holen. Ich war der Jüngste der Gruppe, musste immer 9 Kochgeschirre tragen, Brot und Post
habe ich in 2 Sandsäcke, die ich über der Schulter hängen hatte, verstaut. Wenn wir unterwegs waren wurde der
Laufgraben immer beschossen. Einmal schlug eine Granate am Schützengrabenrand ein und hat mich halb verschütte, die
Kochgeschirre aus den Händen gerissen, so dass ich ohne Verpflegung im vorderen Graben ankam. Nach drei Wochen sollten
wir abgelöst werden Es hat jeden Tag geregnet, wir haben unsere Mäntel angezogen und uns mit Zelten bedeckt. Nach dem
wir abgelöst wurden kamen wir in ein Dorf dass von Juden bewohnt war. Die Bewohner waren froh dass wir keine Kosaken
waren, mit denen hatten sie vor ein par Tagen schon schlechte Erfahrung gemacht, die hatten ihnen beim Abzug Vieh und
Pferde weggenommen.
Der Boden war sehr fruchtbar, es wurden Hanf, Weizen, Hafer, Mais, Bohnen, Roggen und Kartoffeln angebaut. Die
Bewohner waren gerade mit der Ernte beschäftigt. Die Häuser waren nur aus Holz und Stroh erbaut. Die Leute lebten in
sehr ärmlichen Verhältnissen. Ich hatte mir in unserer Kantine für 20 Pfennig ein Taschenmesser gekauft, das hat mir
ein Bauer für 6 Eier und 2 Pfund Brot abgekauft, daraus hat er sich dann ein Rasiermesser geschliffen. Wenn unser
Versorgungstross auf denn holperigen Wegen nicht nachkam, haben im Dorf auch Verpflegung eingekauft. Die Leute hatten
Angst dass wir nicht bezahlen werden, doch wir bekamen meistens pünktlich unseren Wehrsold ausgezahlt und konnten uns
so manches genehmigen. Um unser Marschgepäck zu erleichtern haben wir so manches aus dem Tornister weg geworfen.
Unweit eines Dorfes wurde halt gemacht, wir sollten Zelte aufschlagen, doch niemand hatte mehr Zeltstöcke im Tornister,
alles war unterwegs liegen geblieben. Der Zugführer befahl uns ins Dorf zugehen und Stöcke zu besorgen. In einer
Scheune stießen wir auf eine Hühnerschar, mit den Stöcken haben wir einige Hühner erlegt, in einem Hanffeld gerupft
und dann im Eiltempo zurück zu unserer Truppe. Als wir ankamen war die Kompanie schon marschbereit, es gleich weiter,
mit dem Huhn im Tornister. Bei der nächsten Rast haben wir die Hühner ausgenommen und Holz besorgt um sie zu kochen,
doch wir mussten schnell wieder weiter marschieren und erst nach 2 Tagen konnten wir uns mit den Hühnern befassen,
leider waren die so alt das sie nicht gar wurden. Das Fleisch mussten wir wegwerfen, nur die Suppe konnten wir noch
gebrauchen.
Meine Verwundung am Pruth.
Wir befanden uns 8 km vor der russischen Grenze. Der Kompanieführer hatte uns informiert das
wir hier zum Einsatz kommen. Wir bekamen noch ein Mittagessen aus der Gulaschkanone, konnten unsere Feldflaschen mit
Tee, der mit Rum angereichert war, auffüllen, Munition und Handgranaten in Empfang nehmen und dann ging es zum Einsatz.
Um 3 Uhr begann das ganze Bataillon auszuschwärmen, sofort hat uns der Russen entdeckt und begann uns mit Artillerie
zu beschießen, je weiter wir vorrückten desto heftiger.
Bis zu einem Eisenbahndamm hatten wir gute Deckung, doch wir sollten den dahinter fließenden Fluss überqueren. Doch
plötzlich explodierte über meinem Kopf eine Schrapnellkugel, der Stahlhelm wurde mir vom Kopf gerissen, Tornister und
Koppel flogen auch weg, ich lag auf der Erde und wusste gar nicht was passiert war. Plötzlich fing Blut aus der
Kreuzbeingegend zu rieseln, aus dem rechten Oberschenkel auch. Gleich nebenan war ein Granattrichter, dort habe ich
Schutz gesucht. In der rechten Rockecke hatte man immer ein großes Verbandspäckchen, das habe ich herausgenommen und
auf die Wunde gedrückt, doch das Blut floss mir bis in den Stiefel. Links und rechts von mir schlugen Granaten ein,
dicke Erdbrocken und Schlamm fielen auf mich herab, doch in meinem Erdloch war ich vor Maschinengewehrsalven geschützt.
Der ganze Rücken war angeschwollen und ich konnte mich überhaupt nicht bewegen.
Die Deutschen mussten die Stellung den Russen überlassen, einer hatte mich entdeckt, da ich aber so blutverschmiert da
lag, hat er bestimmt gemeint ich wäre nicht mehr am leben und ist weitergegangen. Nach zwei Stunden habe ich gehört
das die Russen sich wieder zurückzogen, danach herrschte eine gespenstische Stille. Als es dunkel wurde kamen deutsche
Sanitäter mit Spürhunden und haben die Verwundeten aufgesammelt. Ich wurde auf eine Trage gelegt, lag gebeugt und
konnte mich nicht rühren weil der blutverschmierte Rücken völlig verkrustet war. Ein Pferdegespann konnte nur vier
Tragen befördern, die Fahrt über Ackerfurchen war eine Tortur, ich habe nicht geglaubt das ich es überleben werde. In
einer Dorfkirche wurden wir dann ausgeladen und zu den etwa 50 Verwundeten gelegt die da schon lagen.
Mich haben sie zu den Bauchschüssen gelegt, weil ich einen Nervenschock hatte und am ganzen Körper gezittert habe. Zu
trinken bekam ich nichts, nur einen feuchten Lappen in den Mund. Ich sollte gleich operiert werden, aber es kamen
immer mehr Verwundete, so bekam ich nur eine Tetanusspritze, wurde verbunden und für den Weitertransport ins Hinterland
vorbereitet. Im Morgengrauen wurden wir auf Lastautos verladen, die aus auf ein Landgut brachten, wo wir in einem
Pferdestall untergebracht wurden. Die Fahrer fuhren so schnell über die Granatlöcher, das wir vor Schmerzen geschrieen
haben. Wir baten sie langsamer zu fahren, aber die bekamen es in ihrem Führerhaus nicht mit, erst alt ein Verwundeter,
der einen Krückstock bei sich hatte von hinten die Scheibe einschlug wurde die Fahrt erträglich. Lastautos, die
Munition und Verpflegung an die Front transportiert hatten, brachten in den nächsten Tagen immer wieder Verwundete
ins Hinterland. Die Deutschen hatten an diesem Fronabschnitt hohe Verluste zu beklagen. Wir können von Glück reden
dass wir dem Höllenfeuer überhaupt entkommen sind.
Wir wurden mit Lastautos, die ein Feldlazarett uns geschickt hatte, bis nach Lemberg befördert. da wurden wir gewaschen,
rasiert und frisch verbunden. Auf einem Nebengleis stand ein Lazarettzug, in dem wurden wir anschließend in frisch
bezogenen Betten untergebracht. Der Zug brachte uns über Annaberg nach Freiburg in Sachsen, eine Stunde hinter Dresden.
Hier wurden wir auf Tragen gebettet und mit einem Möbelwagen in ein Reservelazarett transportiert.
Im Heimatlazarett.
Als ich am nächsten Tag aufwachte und das schöne Bett sah in dem ich lag, dachte ich dass ich
im Himmel bin. Ich dankte meinem Herrgott das er mich bis zu diesem Ort begleitet hat. Am Nachmittag kamen Schulkinder
mit Geschenken und haben uns schöne Lieder vorgesungen. Anhand von Röntgenaufnahmen wurde in den nächsten Tagen
festgestellt dass bei mir ein Schrapnellsplitter an der Wirbelsäule in die Kreuzbeingegend eingedrungen war. Ich wurde
jeden Tag in Salzwasser gebadet und bekam wieder volle Verpflegung, da mein Magen zum Glück nicht verletzt war. Auf
dem Transport bekam ich nur Suppe und bei Bedarf einen feuchten Lappen auf die Lippen. Ich bin von 62 auf 43 Kilogramm
abgemagert, gehen konnte ich wegen dem Nervenschock den ich bei der Verwundung erlitten hatte auch noch nicht. Die
Wunde am rechten Oberschenkel war nur ein Streifschuss und wurde mit einem Schutzverband versorgt.
In den nächsten Tagen habe ich einen Brief nach Hause geschrieben und mitgeteilt wo ich mich zurzeit befinde. Meine
Eltern schickten mir ein Paket mit Lebensmitteln, jetzt konnte ich essen was ich wollte. Das Essen im Lazarett war
nicht besonders, jeden Tag nur Kohlblätter. Der weg zu den Toiletten führte durch einen Gemüsegarten. Die gehfähigen
Kameraden haben den ganzen Kohlrabi aufgegessen, so dass schließlich Wachposten aufgestellt werden mussten. Sechs
Wochen lang konnte ich mich nur auf allen Vieren fortbewegen, denn sobald ich mich aufrichtete wurde es mir
schwindelig und ich musste zurück ins Bett.
Als ich wieder bei Kräften war habe ich meinen Eltern mitgeteilt das ich mich in ein Lazarett in ihrer Nähe verlegen
lassen will. Der Chefarzt hatte mir zugesichert, wenn die Möglichkeit besteht in Ortelsburg unterzukommen, wird er dem
zustimmen. Meine Mutter hat daraufhin, in Ortelsburg, beim Lazarettinspektor Zantopf nachgefragt und er hat angedeutet
das sie mich aufnehmen können. Daraufhin bekam ich die Krankenpapiere und einen Fahrschein nach Ortelsburg. Da ich als
Soldat nie Heimaturlaub hatte, beschloss ich zuerst meine Eltern zu besuchen. Ich fühlte mich noch sehr schwach, habe
nach jedem Kilometer Rast gemacht, aber letztendlich war ich wieder daheim bei meinen Eltern. Die Wiedersehensfreude
war sehr groß. Ich bin am 30 Juli verwundet worden und am gleichen Tag wurde mein ältester Bruder beerdigt. Er bekam
den Splitter einer Gasgranate ins rechte Bein und ist an einer Blutvergiftung verstorben.
Am nächsten Tag brachte mich mein Vater ins Garnisonslazarett nach Ortelsburg. Ich wurde jeden Tag gebadet und massiert,
weil die Rückenhaut am Knochen angewachsen war konnte ich mich nicht schmerzfrei bücken. In Ortelsburg verbrachte ich
noch sechs Wochen, bis Ende Oktober, da wurde es schon ziemlich kalt und in unserer Barackenunterkunft ziemlich
ungemütlich. Kohlen und anderes Brennmaterial lagen im Hof auf Halde, aber es war verboten zu heizen. Kameraden die in
der Nähe zu Hause waren konnten Sonntagsurlaub beantragen.
Einer von ihnen brachte von zuhause Brennholz mit und entzündete damit im Ofen ein wärmendes Feuer, andere holten vom
Hof Kohlen, so dass der Ofen in kurzer Zeit glühend heiß wurde und die Gefahr bestand das die Betten Feuer fangen
würden. Wir hatten die Betten schon weg gerückt, da kam der Feldwebel herein und fragte wer das Feuer im Ofen
angezündet hat, doch niemand fühlte sich angesprochen. Der Feldwebel hatte den Vorfall dem Stabsarzt gemeldet, als der
am nächsten Morgen zur Visite kam, war seine erste Frage: ”Wer hat gestern Abend das Feuer im Ofen angezündet”. Als
sich niemand meldete, schrie er uns an: ”Morgen wird alles entlassen, zum Ersatzbatallion, in Diez an der Lahn! Wer
gehen kann, sofort zur Schreibstube, Krankenpapiere und Fahrscheine abholen”. Er erinnerte uns noch daran am nächsten
Tag pünktlich am Bahnhof zu sein, weil eine Verspätung unangenehme Folgen für uns haben würde. Das war das Ende der
schönen Erholungsphase. Ich blieb noch eine Nacht zu Hause und bin dann am nächsten Tag von dort zum Bahnhof gegangen.
Wieder Kriegsverwendungsfähig.
Als wir am nächsten Tag in Diez angekommen waren, wurde ich gefragt ob ich aus dem Heimaturlaub
käme, als ich das verneinte wurden mir 2 Tage genehmigt und 14 Tage Genesungsurlaub dazu. Wieder zurück im
Ersatzbatallion bestand unsere Tätigkeit aus Wache schieben und Kartoffel schälen. Nach einem Monat wurden wir von
einem Generalarzt untersucht, er hat mich für nicht einsatzfähig befunden weil ich noch den Steckschuss im Rücken
hatte und das linke Bein 10 Zentimeter dünner war. Jetzt fing das Kasernenleben wieder von vorne an. Wachdienst,
Gewehr laden, sichern, Ehrenbezeugung, Einzelmarsch und Appell. Wer nicht weit nach Hause hatte bekam zu Weihnachten
Urlaub. Ich hatte zu Heiligabend und Silvester Torwache, denn nach Ostpreußen wurde niemand beurlaubt.
Nach Neujahr 1918 wurden wir neu eingekleidet und kamen nach Köln zur Baukompanie. Mit Musik wurden wir zum Bahnhof
gebracht. In Köln wurden wir noch mit Soldaten die von andern Truppenteilen dorthin verlegt wurden in einem großen
Kinosaal, im Stadtteil Edengarten untergebracht. Wir brauchten keinen Dienst zu machen und konnten zu Heilige Drei
Könige den Gottesdienst im Dom besuchen. Kameraden die aus irgendwelchen Gründen im Arrest saßen wurden gefragt ob sie
auch am Gottesdienst teilnehmen möchten, dann würde ihnen die Strafe erlassen. Fast alle haben dem zugestimmt. Einige
Tage später wurden wir wieder auf einen Transportzug verladen, der uns über Herbestal, Antwerpen nach Brügge in Belgien
brachte. Hier mussten wir den Zug kurzfristig verlassen und einen Luftschutzkeller aufsuchen, weil Fliegeralarm
gemeldet wurde. Danach ging es wieder weiter nach Turut, Kortemark, Hauseme, Kautremollen, Zaren, Zarenlinde. Dort
wurden wir in verschiedene Gruppen aufgeteilt und einer Pionierkompanie auf dem Pionierpark Struwendorf zugewiesen.
Wir haben hinter Klerken Bunker für schwere Maschinengewehre gebaut. Unsere Arbeit konnten wir nur bei Nebel verrichten,
denn bei Sonnenschein waren wir sofort dem Beschuss der feindlichen Artillerie ausgesetzt. eine Kleinbahn die Munition
und Stacheldraht an die Front brachte war dem Beschuss besonders ausgesetzt. Die Gleise, von schweren Geschossen
zerfetzt, mussten immer wieder hergerichtet werden, damit der Nachschub aufrechterhalten werden konnte. Später haben
wir am Kemelberg bei Armentier, eine Brücke über die Lys gebaut. Um in dem Sumpfgelände einen Untergrund dafür zu
schaffen, mussten wir 10 bis 12 Meter lange Pfähle in den Boden rammen. Ein Feldwebel gab immer den Befehl: „Hoch den
Bär, noch viel mehr, dass man sieht, wie er zieht, denn dieser Pfahl, glatt wie ein Aal, durch Fels und Stein, durch
Wasser und Sand, fürs Vaterland”. Jedes mal mussten wir den Bär an Schnüren hochziehen und dann wieder herunterlassen.
Wenn es manchmal, trotz vieler Mühe nicht mehr weiter ging wurde der Pfahl auf eine bestimmte Länge abgeschnitten.
Nach Fertigstellung der Brücke kamen wir in die Siegfriedstellung bei Kambrei, zum Bau eines Bataillons-Gefechtstandes.
Da der Boden kreidehaltig war, mussten wir die großen Stücke von Hand zu Hand reichen, den Schutt haben wir dann mit
Sandsäcken aus der Baugrube gehoben und mit Ästen getarnt, damit der Stand nicht von feindlichen Fliegern entdeckt
werden konnte. Alle acht Stunden wechselte die Arbeitsgruppe. Wir mussten von der Baustelle durch das Gelände robben,
denn aufrecht gehend war man dem Beschuss der feindlichen Scharfschützen ausgesetzt, die von einem Fesselballon aus
informiert wurden der über den feindlichen Linien stand.
Der Wechsel war mit einem großen Risiko verbunden, und wurde wenn Möglich bei Dunkelheit vollzogen. Um vor
Überraschungen sicher zu sein haben wir spanische Reiter (Stacheldrahtverhaue) gebaut und vor die ersten Gräben
gestellt, die dann oft in der Nacht von den Franzosen geklaut, und dann vor ihren eigenen Linien wieder aufbaut wurden.
Wir hatten aus Bohlen eine Brücke auf Rädern gebaut, die dann in den Graben geschoben wurde, damit die Artillerie und
andere Fahrzeuge über die Schützengräben kamen. Weil um vier Uhr morgens der Beschuss mit Gasgranaten begann, mussten
wir Gasmasken aufsetzen, danach haben feindliche Flieger unsere Munitionskolonne bombardiert und total aufgerieben.
Es wurde auch eine Marinedivision eingesetzt, die bis dahin dem Küstenschutz gedient hatte und jetzt ihren ersten
Einsatz hatte.
Wir sind zuerst ein ganzes Stück in Richtung Amiens vorangekommen, doch dann blieb unser Angriff in den zuvor von
Engländern besetzten Stellungen, stecken. Da die Engländer ihre Stellungen fluchtartig verlassen hatten, fiel ihr
ganzer Proviant in unsere Hände; Schokolade, Weißbrot, Flaschenwein. Die erste Nacht haben wir in einem runden Zelt
verbracht, weil ich mir durch den starken Wind, der da herrschte eine Angina zugezogen hatte, die mit hohem Fieber
verbunden war, konnte ich die vielen Köstlichkeiten überhaupt nicht genießen.
An eine ärztliche Versorgung war überhaupt nicht zu denken, denn es mussten zuerst die vielen Granatlöcher eingeebnet
werden damit die vielen Fahrzeuge und Geschütze wieder weiter fahren konnten. Auch eine Bahnlinie musste repariert
werden, damit die großen Geschütze in Stellung gebracht werden konnten, dabei wurden auch die vielen Kriegsgefangenen,
die bei dieser Offensive gemacht wurden, eingesetzt. Als die Offensive dann schließlich scheiterte, wurden wir an die
Somme verlegt. Da habe ich die Ortelsburger Jäger, die aus Italien an die Westfront verlegt wurden, zum ersten Mal im
Einsatz gesehen.
Unser nächster Einsatzort waren dann Stellungen hinter Laon. Hier wurden die Vorbereitungen zu einer neuen Offensive
getroffen. Feindliche Flieger versuchten uns Tag und Nacht daran zu hindern die Aufmarschwege instand zu halten. Als
die Offensive dann endlich losging, hatten wir die Order eine Brücke über die Oise mit Bohlen und Balken zu verstärken.
Gleich am Anfang der Offensive mussten wir Gasmasken anlegen, um für alle Fälle gewappnet zu sein. Nur die Artillerie
und Kraftfahrzeuge durften die Landstraße benutzen, die Infanterie ging immer im Straßengraben und wurde von einer
Seite von Kopf bis Fuß mit Dreck bespritzt. Die Franzosen und Engländer haben hier schon Panzer eingesetzt, die von
Truppen aus den Kolonien gefahren wurden. Die Australier gingen mit umgekrempelten Ärmeln hinter den Panzern her.
Die letzte Offensive des Ersten Weltkrieges.
Zum Jahresende 1917 hatten noch 153 deutsche 175 alliierten Divisionen gegenübergestanden.
Zur Vorbereitung der Offensive ließ Ludendorff 39 Divisionen aus dem Osten und aus Italien heranziehen. Er ließ
spezielle Angriffsdivisionen formieren, die durch intensive Ausbildung auf den beabsichtigten, schnellen Vormarsch
vorbereitet wurden. 6608 Geschütze, 3500 Minenwerfer und 1070 Flugzeuge wurden hinter dem vorgesehenen
Angriffsabschnitt konzentriert. Den Ausbildungsbefehlen Ludendorffs, die bis zu den Kompanieführern herab verteilt
wurden, konnte man entnehmen, dass der Versuch, den Krieg mit einem mächtigen Schlag zu entscheiden schon in der
nächsten Zeit gewagt werden sollte. Wir übten die fast vergessenen Formen des Schützengefechts und des
Bewegungskrieges, auch wurde eifrig mit Gewehr und Maschinengewehr geschossen. Wir hegten keinen Zweifel daran, dass
der große Plan gelingen würde.
Den ganzen Winter 1917/18 über plante der Generalquartiermeister Ludendorff die deutsche Offensive. Zwar hatten die
Vereinigten Staaten von Amerika dem Deutschen Reich am 6. April 1917 den Krieg erklärt, aber vor dem Sommer des
Jahres 1918 war mit dem Auftreten von US-Truppen in relevanter Größenordnung nicht zu rechnen. Der deutschen Führung
blieb nur ein schmales Zeitfenster, um die Niederlage und den zu erwartenden Diktatfrieden abzuwenden. Ypern,
Armentieres, Arras, Cambrai oder Verdun wurden ernsthaft als Schauplätze erwogen. Ludendorf entschied sich für einen
Angriff zwischen Cambrai und La Fere – genau an der Nahtstelle zwischen der Französischen Armee und dem britischen
Expeditionscorps.
Der Fluss Somme bildete die Grenze zwischen Franzosen und Briten. Die Briten – nicht die Franzosen – sollten das Ziel
des Vorstoßes werden. Ihre Stellungen waren nur 130 Kilometer von der Kanalküste entfernt. Beim erreichen der
Sommemündung wäre die gesamte britische Armee eingeschlossen gewesen, denn hinter ihnen lag die Straße von Dover.
Am 21. März 1918 begann die letzte entscheidende Offensive des deutschen Westheeres im Ersten Weltkrieg. Der
Angriffsstreifen war 75 Kilometer breit. Dort hatte Ludendorff 43 Angriffsdivisionen konzentriert, dahinter 30
weitere Reservedivisionen, ihnen standen lediglich 26 britische Divisionen gegenüber. „Michael“ – so der Deckname der
„Kaiserschlacht“ – lief dank Ludendorffs akribischer Vorbereitung gut an. Der britische Oberbefehlshaber General
Douglas Haig erkannte die Chance, welche die Deutschen in dieser Situation hatten. Wollten die Deutschen diese Chance
nutzen, mussten sie darauf verzichten die Somme zu überschreiten, wo sie auf die französischen Reserven treffen und
sich von der Küste entfernen würden. Genau diesen Fehler begingen jedoch die Deutschen.
Am dritten Tag überschritt der linke Flügel mit der 18. Armee die Somme. Ludendorf stellte die Taktik über die
Strategie, wie er das bei Tannenberg und der Schlacht an den Masurischen Seen auch schon getan hatte. Ludendorffs
Befehl an die 18. Armee vom Abend des 22. März 1918 lautete: „Jetzt gilt es den Sieg auszunutzen, den Feind nicht zum
Stehen kommen zu lassen, Somme und Crozat-Kanal zu überschreiten, bevor feindliche Verstärkungen wirksam werden“.
Was Haig befürchtet hatte, trat nicht ein. Die deutsche Offensive Lief weiter Richtung Süden und lief sich schließlich
tot. Am 31 März war Ludendorff zu der Erkenntnis gekommen, dass „Michael“ gescheitert war. Am 5. April wurde die
Einstellung der Offensive befohlen. Im Hochsommer waren die US-Truppen in Frankreich angekommen und gingen mit den
Franzosen zum Angriff vor. Nur mühsam konnten Hindenburg und Ludendorf den Zusammenhalt der Front waren. Am 24. Oktober
1918 forderte US-Präsident Woodrow Wilson die bedingungslose Kapitulation, am 11.Nuvember Wurde der Waffenstillstand
von Compiegne unterzeichnet.
Zusammenbruch der Westfront und Waffenstillstand .
Als die Offensive dann letztendlich gescheitert war, wurden wir auf Eisenbahnwaggon verladen, in
eine Stellung vor Verdun gebracht und der siebenten bayerischen Division zugeteilt. Als wir ausgeladen wurden nahm der
Franzose den Bahnhof unter Beschuss. Eine Granate traf einen Waggon der mit Seifenpulver beladen war, so dass der ganze
Bahnhof aussah als wäre gerade Neuschnee gefallen. Wir gingen auf die Suche nach Kartoffeln. Als ich mit einem Sack,
vollbeladen die Böschung runter ging um zur Feldküche zu gelangen, schlug unweit von mir eine Granate ein und riss mir
den Sack vom Rücken. Ich bin mit dem Schrecken davon gekommen, mir war nichts passiert.
Der Bahnhof war menschenleer, nur ein par Kaninchen liefen verschreckt durch die Gegend und einigen Kameraden gelang
es welche einzufangen. Am nächsten Tag gelang es uns endlich die Feldküche zu erreichen. Als wir gerade beim Essen
fassen waren, schlug unweit eine Granate ein so dass Pflastersteine das Dach durchschlugen und wir das Weite suchen
mussten. und wir wieder nichts zu Essen bekamen. Ein Friseur aus unserer Kompanie fuhr immer ins Hinterland um uns
mit Proviant zu versorgen. Als er 14 Tage vor dem Zusammenbruch wieder mal zurückkam erzählte er uns schon das der
Krieg nicht mehr lange dauern würde, weil Kaiser Wilhelm mit Frack und Zylinder bekleidet, Deutschland verlassen und
ins Ausland gehen würde. In unserer Einheit hatten wir auch einen Juden der glaubte dass er sich alles erlauben darf.
Eines Morgens ging er in die Küche, als er keinen Koch vorfand stieg er auf die Gulaschkanone und hob den Deckel vom
Kessel in dem der Kaffee kochte an. Der kochende Kaffee verbrühte seine Füße so sehr das er sofort ins Lazarett musste,
für ihn war der Krieg somit zuende. Es kam noch ein Erlass, das Kameraden die 2 Jahre aktiv gedient hatten und
Gefreiter waren sofort zum Sergeanten befördert wurden. Für den 11. November 1918 war ein Waffenstillstand vereinbart
und ab 11 Uhr sollte nicht mehr geschossen werden. Wir hatten unsere Kopfkissen aufgetrennt und eine Kissenschlacht
veranstaltet, um auf diese Art und Weise unserer Freude Ausdruck zu verleihen. Als die Federn durch die Luft flogen
brachen wir in Tränen aus.
In jeder Kompanie wurde ein Soldatenrat gewählt, der aus drei Mann bestand. Wenn der Kompanieführer jemanden bestrafen
wollte, musste er erst den Soldatenrat fragen, der die Strafe befürworten, aber auch ablehnen konnte. Die Offiziere
durften keine Achselstücke mehr tragen, was für sie einer Degradierung gleich kam. Wir waren in einem Dorf
einquartiert und morgens zum Appell angetreten, als einer vom Soldatenrat sich stockbesoffen vor den auf dem Pferd
sitzenden Kompanieführer stellte und schrie: „Alles hört auf mein Kommando”. Der Kompaniechef war wie vom Blitz
getroffen, ihm versagte die Stimme. Wir sahen ein das dies nicht so weiter gehen kann und wählten einen neuen
Soldatenrat. Unser Rückzug begann bei Konflanz, einer Vorfestung von Metz und führte uns zunächst über die
luxemburgische Grenze, wo wir in einem Ort einquartiert wurden. Als wir für die Küche Holz aus dem Wald holen gingen,
entschieden wir uns eine Eiche abzusägen, ohne uns dessen bewusst zu sein, in welchem Forst wir uns befanden. Als wir
beim fällen waren fielen plötzlich Schüsse, die wir auch sofort erwiderten, bis uns ein Elsässer der sich in unserer
Kompanie befand aufklärte: „Kameraden, wir befinden uns hier auf Luxemburgischem Hoheitsgebiet”.
Wir sind dann weiter durch das Fürstentum Birkenfeld marschiert, wo das Städtchen Merzig für uns geflaggt hatte. Das
Elsass haben wir auch noch kurz gestreift. Wo wir bei einem Bauern, der uns kein Stroh für das Nachtlager geben wollte,
einquartiert wurden. Daraufhin gingen wir in die Scheune und haben uns selbst was besorgt. Wir haben dann noch erfahren,
sie hätten ein Schwein geschlachtet und warteten auf den Einzug der Franzosen. Als wir uns 1917, an der Ostfront, in
den in Karpaten, im Einsatz befanden, waren unter uns auch viele Elsässer. Sie durften ihre Heimatpost nicht in
französischer Sprache schreiben, mussten ihre Briefe offen auf der Schreibstube abgeben, wo sie zuerst kontrolliert
und dann abgeschickt wurden. Als ich in einer Nacht, mit einem Elsässer auf einem Vorposten Wache schieben musste,
wollte er mich überreden zum Russen überzulaufen. Als ich darauf nicht eingehen wollte verschwand er plötzlich in der
Dunkelheit und ich habe ihn nie wieder gesehen.
Wir sind dann weiter Richtung Worms und Ludwighafen gezogen, dort wurden wir bei einem Mühlenbesitzer einquartiert,
ein Unteroffizier und vier Mann. Obwohl wir verlaust und verdreckt waren bestand die Müllerin darauf das wir in ihren
Betten übernachteten. „Wenn alles durch ist”, sagte sie, „werde ich alles gründlich reinigen”. Der Müller brachte uns
eine Gießkanne voll Wein und sagte wir sollen es uns Schmecken lassen. Wir haben reichlich davon Gebrauch gemacht, so
dass ich gar nicht weiß wie ich ins Bett kam. Das war meine Erinnerung an die Pfalz. Manchmal waren wir auch 2 Tage im
Quartier.
Vor dem Weitemarsch wurde uns immer gesagt welche Truppe die Vorhut und welche Truppe die Nachhut übernehmen sollte.
Die Nachhut hielt immer Verbindung zu den nachrückenden Franzosen und man muss staunen wie alles reibungslos, ohne
Zwischenfälle von statten ging, was wir in erster Linie dem General-Feldmarschall Paul von Hindenburg zu verdanken
haben, der den Rückzug an der Westfront koordiniert hat.
In Köln angekommen, erhielten wir im Volkshaus unsere Entlassungspapiere, Eisenbahnfahrscheine, Reisepässe,
unterschrieben von Oberstleutnant Mann. Wir mussten Köln umgehend verlassen, weil schon am nächsten Tag die
französischen Besatzungstruppen in einmarschieren sollten. Wir fuhren mit einem Zug der bis Allenstein fuhr, dort
wurden unsere Papiere vom Soldatenrat kontrolliert. Die jüngren Jahrgänge wurden festgehalten, zu neuen Einheiten
zusammengestellt und zur Sicherung der Ostgrenze gegen die Bolschewisten abkommandiert. Ich hatte gesagt das ich noch
einen Schrapnellsplitter in der Kreuzbeingegend habe und durfte daraufhin nach Hause fahren.
Kaum in Ortelsburg angekommen fiel ich wieder dem Soldatenrat in die Hände. Sie haben alles durchsucht, haben mir mein
Seitengewehr und eine Decke abgenommen, aber ich durfte weiter und bin dann kurz vor Weihnachten 1918 auf dem
elterlichen Hof angekommen. Schon auf dem Hof habe ich meine Kleider vom Leib gerissen, weil vor Läusen und anderem
Ungeziefer nicht mehr aushalten konnte und mich erst gründlich gewaschen bevor ich das elterliche Haus betreten habe.
Die Freude über das Wiedersehen war sehr groß.
“ Unser Leben zwischen den beiden Weltkriegen.”
Endlich wieder zurück in der Heimat
Rohmanen war durch die Kampfhandlungen 1914/15 zu einem drittel zerstört worden, aber schon
wieder im Aufbau. Die Firma Grzella aus Ortelsburg hatte die Bauarbeiten übernommen. Unter der Aufsicht von Polier
Karl Kontor wurden die Dachstühle errichtet. Ich habe mich, nach kurzer Erholungspause, auch als Zimmermanngehilfe am
Wiederaufbau beteiligt. Die Firma Grzella hat das Material geliefert und auch unsere Löhne gezahlt. Wegen meinem
Steckschuss bin ich dem VDK beigetreten und habe mit dessen Hilfe eine Rente beantragt die mir auch bewilligt wurde.
Nach vier Jahren wurde ich nach Allenstein zur Nachuntersuchung vorgeladen. Die ärztliche Untersuchung hatte ergeben,
das Geschoß sei verkapselt, und nur das linke Bein etwas in Mitleidenschaft gezogen. Daraufhin wurde die Rentenzahlung
eingestellt.
Der Stellmacher Adam Ornowski war im Krieg als Sanitäter eingesetzt und hatte auf Grund seiner Erfahrungen,
 Beziehungen zum medizinischen Dienst in Ortelsburg aufgebaut. Es wurden dort Lehrgänge in Erster Hilfe angeboten,
die von Prof. Dr. Kutz geleitet wurden. Adam Ornowski hat dafür gesorgt das einige junge Männer aus Rohmanen daran
teilnehmen konnten. Adam Ornowski, August Linka, Emil Rosowski, Johann Dembek, Emil Baschek und ich sind dann dem
Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes beigetreten und mussten jeden Sonntag am Lehrgang teilnehmen. Unser
Gruppenführer war Kreisobersekretär Albrecht, Landrat von Poser, als unser Ehrenvorsitzender, hat viel zu unserer
finanziellen Unterstützung beigetragen und hat dafür gesorgt dass die Bereitschaft eingekleidet wurde.
Beziehungen zum medizinischen Dienst in Ortelsburg aufgebaut. Es wurden dort Lehrgänge in Erster Hilfe angeboten,
die von Prof. Dr. Kutz geleitet wurden. Adam Ornowski hat dafür gesorgt das einige junge Männer aus Rohmanen daran
teilnehmen konnten. Adam Ornowski, August Linka, Emil Rosowski, Johann Dembek, Emil Baschek und ich sind dann dem
Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes beigetreten und mussten jeden Sonntag am Lehrgang teilnehmen. Unser
Gruppenführer war Kreisobersekretär Albrecht, Landrat von Poser, als unser Ehrenvorsitzender, hat viel zu unserer
finanziellen Unterstützung beigetragen und hat dafür gesorgt dass die Bereitschaft eingekleidet wurde.
In jedem Dorf wurde eine Unfallstelle eingerichtet, mit einem Verbandskasten und mit Verbandsmaterial für die erste
Hilfe ausgerüstet. Die Unfallstelle in Rohmanen, die am Haus von der Straßenseite, durch eine Tafel mit einem roten
Kreuz gekennzeichnet war, hatte ich zu verantworten. An Sonntagen wurden wir an Badestellen und bei Fußballspielen
eingesetzt, haben viele Übungen bei Waldbränden durchgeführt und auch Ausflüge nach Rudzany am Niedersee gemacht. Bei
der Einweihung des Tannenbergdenkmals in der Nähe von Hohenstein kamen wir an Straßenkreuzungen zum Einsatz.
Rohmanen hatte auch eine freiwillige Feuerwehr. Bis zum ersten Weltkrieg hat Friedrich Biella als Brandmeister das
Kommando gehabt. Er war aktiver Unteroffizier, hatte gute Führungsqualitäten und die Männer, die allesamt aus dem
aktiven Militärdienst stammten hatten zu ihm ein großes Vertrauen. Nach dem Krieg wollten diese Männer,
(Friedrich Nickel, Friedrich Willam, Julius Wittkowski, Jakob Janowski, Johann Gloddek, Gustav Bednarz), nicht mehr
weitermachen. Friedrich Biella, der inzwischen zum Gemeindevorsteher gewählt wurde, hat sich dann auf einer
Gemeinderatsitzung vorgeschlagen, für die Freiwillige Feuerwehr jüngere Kräfte anzuwerben.
Zum Brandmeister hat er Herrn Wilhelm Pilath vorgeschlagen. Der wurde dann nach Königsberg zur Fortbildung geschickt.
Der Feuerwehr gehörten nun folgende Personen an: Wilhelm Pilath(Brandmeister), August Linka(Stellvertreter), Gustav
Deptolla, Julius Matzey, Johann Dembek, Willy Willam, Gustav Rattay. Der Kreisbrandmeister war Heinrich Thalmann aus
Ortelsburg, sein Stellvertreter war Kreisobersekretär Salzmann. Der Bezirks-Kommissar bei der Ostpreußischen
Feuersozität War Herr Ernst Trzaska. Er hat dafür gesorgt das die Wehr uniformiert und mit Löschgeräten ausgerüstet
wurde. Da die alten Schläuche schon sehr marode waren, wurden sie durch moderne ersetzt, deren Kupplungen auch mit der
Motorspritze übereinstimmten.
Ernst Trzaska hat bei der Feuersozität und beim Landratsamt Finanzmittel beantragt und auch genehmigt bekommen. Der
Schneidermeister Wilhelm Baran wurde beauftragt Tuch und Drillichanzüge nach Maas zu schneidern. Er hat uns
Stoffmuster vorgelegt aus denen wir wählen sollten. Feuerwehrhelme haben wir auch bekommen. Die Gemeinde musste
Finanzmittel bereitstellen, einen Prozentsatz vom Gemeindebudget. Im Brandfall mussten für den Spritzenwagen Pferde
zur Verfügung stehen, von Willy Willam, Gustav Rattay, Julius Matzey und Gustav Dorka, weil sie in der Nähe des
Spritzenhauses wohnten. Am Spritzenhaus wurde ein großer Baum mit Querleisten aufgestellt, wo nach jedem Brand oder
einer größeren Übung die Schläuche zum trocknen aufgehängt wurden.
Der Kreisbrandmeister hat mindestens 2-3-mal im Jahr die Wehren besichtigt. Das ganze Dorf war dann auf den Beinen,
die Bauern mit Pferden, und andere Dorfbewohner mit Eimern und Spaten, wurden dann in verschiedene Gruppen eingeteilt.
Erst hat die Wehr sämtliche Aufstellungen am Gerät geübt; Grundstellung Fahrstellung und Marschstellung. Dann wurde
ein Brand angekündigt, die Feuerwehr mit der Spritze an den Brunnen, die Gruppen dort wohin sie beordert wurden, die
Bauern brachten mit den Wasserkiwen Wasser aus dem Brunnen zum Brandort. Wenn das Wasser im Brunnen alle wurde hat
man den Saugkorb in die Kiewen gelegt und dort Wasser entnommen. Die Wassergruppe ging mit Eimern zum Dorfteich, holte
Wasser und füllte damit die leeren Kiewen.
Der Löschtrupp ging mit Feuerhaken und Löschpatschen auf die umliegenden Gehöfte und versuchte das vermeintliche Feuer
von ihnen fernzuhalten. Nach dem Alarm wurde wieder am Spritzenhaus angetreten. Die Gruppenführer mussten angeben ob
ihre Gruppe auch vollständig erschienen war, denn Übungen wurden nur vor, oder nach der Feldarbeit durchgeführt, so
dass niemand eine Entschuldigung vorbringen konnte. Wer ohne begründete Entschuldigung nicht anwesend war erhielt eine
Verwarnung. Der Kreisbrandmeister erklärte dann welche Handgriffe den Vorschriften entsprachen und welche nicht. Die
Schläuche wurden noch schnell zum Trocknen aufgehängt. Anschließend gingen wir alle in den Gasthof Trzaska, haben über
vorhandene Mängel diskutiert, Verbesserungsvorschläge unterbreitet und zwischendurch den Durst gelöscht. Der
Kreisbrandmeister ist dann, nach einer kurzen Verabschiedung, ins nächste Dorf gefahren, weil er an einem Tag mehrere
Feuerwehren betreuen musste.
Der Rohmaner Dorffriedhof

Einen Kilometer vom Ende des Dorfes entfernt, auf der rechten Seite der Landstraße in Richtung
Ortelsburg, befand sich der Rohmaner Dorffriedhof. Wann dieser Friedhof angelegt wurde entzieht sich meiner Kenntnis.
Nach Aussagen älterer Dorfbewohner soll davor auch schon eine Ruhestätte vorhanden gewesen sein, und
zwar auf der linken Straßenseite gegenüber dem jetzigen Friedhof. An dieser Stelle befand sich bis in die
Nachkriegszeit ein kleiner Brunnen, aus dem die Dorfbewohner, das Wasser zum begießen der Grabbepflanzung auf den
Gräbern ihrer verstorbenen Angehörigen holten. Der Friedhof war in einer Hanglage angelegt, wahrscheinlich weil diese
Parzelle für eine landwirtschaftliche Nutzung nicht geeignet war. Um das Gräberfeld vor herumstreunenden Tieren oder
von der Weide entlaufenen Kühen zu schützen, hat man das ganze Gelände mit einem Holzzaun umgeben. Der Zugang befand
sich von der Straßenseite. Unter einem Torbogen hindurch wurden die Verstorbenen zu Grabe getragen. Die Gräber der
einzelnen Familien waren nebeneinander angelegt, mache, wie zum Beispiel die der Familie Trzaska, sogar mit einem
schmiedeeisernen Zaun eingefasst.
Nach dem 2. Weltkrieg verfiel der Friedhof immer mehr. Die nötigen Finanzmittel für die Pflege der Einfriedung konnten
von den restlichen noch verbliebenen Deutschen nicht mehr aufgebracht werden. An den gepflegten Gräbern konnte man noch
erkennen dass es Verwandte von noch in Rohmanen wohnenden Deutschen waren, oder von bereits im Westen Deutschlands
lebenden, die ihre noch in Rohmanen wohnenden Nachbarn damit beauftragt hatten. Die übrigen Gräber wurden von Jahr zu
Jahr immer mehr von Wildkräutern überwuchert und schließlich auch von Sträuchern und schnell wachsenden Bäumen.
In den späteren Jahren konnte man nicht mehr erkennen dass dort vor Jahren Tote zur letzten Ruhe gebettet wurden. Die
Natur holte sich das ganze Gelände zurück und nur unter großen Schwierigkeiten konnten Besucher aus dem Westen das
Friedhofsgelände noch betreten.
Das Gasthaus Trzaska

Nach dem ersten Weltkrieg hat der Gastwirt Friedrich Trzaska neben dem Gasthof einen großen Saal
für Festlichkeiten und Vereinsfeiern gebaut, in dem schon mal Feuerwehrfeste veranstaltet wurden. Ernst Trzaska war
Feuerkommissar bei der Ostpreußischen Feuersozität. Erich Trzaska war Vollziehungsbeamter beim Amtsgericht in
Ortelsburg. Unser Feuerkommissar war uns beim organisieren der Veranstaltungen sehr behilflich, hat uns den Saal, die
Musik und die Theaterstücke besorgt und die Feuerwehren aus den Nachbardörfern eingeladen.
Zu Manöverzeiten, vor dem 2. Weltkrieg und dann auch während des Krieges, waren im Gasthof Soldaten, meist im Range
eines Offiziers, einquartiert. Fräulein Mariechen Trzaska hat die Poststelle im Dorf betreut. Nachdem ich 1939 zum
Militär eingezogen wurde, hat sie, nach einer Schulung im Ortelsburger Krankenhaus, auch die Unfallmeldestelle
übernommen. Nach dem Krieg, pflegte sie mit vielen Bekannten, die bereits in der Bundesrepublik wohnten, einen regen
Briefwechsel. Auf dem Rohmaner Friedhof hat sie viele Gräber, im Auftrag von Angehörigen, die auf Grund ihrer
Abwesenheit, dazu nicht mehr in der Lage waren, gepflegt. Der Bauunternehmer Kurnitzki aus Ortelsburg, äußerte die
Bitte, sie möchte ihm doch ein Blatt vom Rosenstrauch, der auf dem Grab seiner Eltern steht, in den Brief legen. Als
sie uns den Brief vorgelesen hat, waren wir zu Tränen Gerührt. Sie hat als Letzte aus ihrer Familie, bis zu ihrem Tod
im Jahre 1960, in Rohmanen, im Gebäude der Gastwirtschaft gewohnt und ist auf dem Rohmaner Friedhof beerdigt worden.
Fleisch und Wurstwaren Karl Pelkowski
Im Jahr 1931 hat der Fleischermeister Karl Pelkowski, aus Grammen, direkt neben unserem Hof ein
Anwesen gekauft und dort eine Fleischerei eingerichtet. Er war mit meiner Schwester Frieda, verheiratet. Am Anfang hat
er die Schweine noch auf seinem Hof geschlachtet, später dann im Ortelsburger Schlachthof. Jede Woche fuhr er 2-mal,
mit dem Pferdewagen(Einspänner), nach Ortelsburg zum Wochenmarkt, wo er seine Fleisch und Wurstwaren zu Verkauf anbot.
Am Tag davor, wenn er die Wurst gekocht hat, kamen viele Rohmaner mit Kannen oder anderen Gefäßen, wegen der guten
Wurstsuppe, die er umsonst unter die Leute verteilte. Als Karl Pelkowski, Ende August 1939 zum Militär eingezogen
wurde, hat seine Frau das Pferd verkauft und den Beitrieb stillgelegt. Am Haus hing, immer noch die Tafel mit der
Aufschrift: Karl Pelkowski, Fleisch und Wurstwaren. Ein Witzbold hat irgendwann darunter geschrieben; „Fleisch und
Wurst waren einmal”, drauf hin hat Frau Pelkowski die Tafel entfernen lassen. Karl Pelkowski ist im Mai 1946 in
französischer Gefangenschaft verstorben. Seine Ehefrau Frieda, verstarb an ihrem 85. Geburtstag in Mettmann bei
Düsseldorf.
Die steinreichen Rohmaner Felder
Die letzte Eiszeit hat bei der Schmelze, auf der Rohmaner Feldgemarkung viele Steine und
Granitblöcke zurück gelassen. Überirdisch, aber besonders unter der Erde, gab es viele kleine, aber auch große Steine,
die, den Bauern, beim Pflügen und anderen Feldarbeiten sehr viel Schweiß, abverlangten. In einer Kiesgrube, auf dem
Feld des Bauern August Radek, lag ein Granitblock, von schätzungsweise 100 cbm. Vor etwa 80 Jahren, als man für diese
Steine noch keine Verwendung hatte, griffen die Bauern zu einer „List”. Weil er sonst nicht pflügen konnte, hat mancher
seinem Nachbarn, die Steine in der Nacht auf dessen Feld abgeladen. Als diese Tätigkeit unter Strafe gestellt wurde,
hat man die Steine in Schluchten gekippt und mit Mutterboden zugeschüttet. In späteren Jahren kam diese jedoch beim
pflügen wieder an die Oberfläche. Dann hat man aber schon Steine für den Straßenbau gebraucht und konnte sie so zu Geld
machen. Besonders im Raum südlich von Ortelsburg, bis zur polnischen Grenze, wo Steine eine Rarität waren, kamen sie
jetzt zum Einsatz. Auch beim Bau von Häusern, besonders für die Fundamente, wurden sie eingesetzt, weil auf diese
Weise viel Ziegeln eingespart wurden. Die Firma Gribienski aus Ortelsburg hat die großen Steine mit Dynamit gesprengt
und auf diese Weise die weitere Verarbeitung erleichtert.
Die Steine welche beim Pflügen aus dem Boden geholt wurden, hat man am Feldrand auf große Haufen zusammen getragen.
Wenn die Feldarbeit beendet war, sowie auch in den Wintermonaten, waren wir jeden Tag mit Steinen unterwegs. Wir sind
vorwiegend am Abend los gefahren, weil unter der schweren Last die Wagenachsen so heiß wurden und die Gefahr bestand,
das durch die Dehnung, die Räder blockiert würden. Bei einer Fahrt konnte man bis zu 24 Reichsmark verdienen, wogegen
1 Zentner Roggen für 8 bis 9 Reichsmark zu haben war. Ich bin selbst, mit dem Pferdewagen bis Fürstenwalde, Radostowen,
Luka, Altkirchen, Höhenwerder, ja sogar bis Friedrichshof gefahren.
In Rohmanen wurden auch rote Ziegeln gebrannt. Viele Häuser wurden, mit Ziegeln erbaut, die nur wenige 100 Meter von
der Baustelle entfernt hergestellt wurden. Der Lehn wurde auf den Feldern in der näheren Umgebung entnommen, dann von
Ochsen solange getreten, bis er so geschmeidig war, das er sich in Formen einstreichen ließ. Wenn die Ziegel in der
Form trocken war, wurde sie entnommen und in einem Brennofen gestapelt. Um einen Ofen richtig anzufeuern, brauchte man
12 Raummeter Holz, das im Zeitraum von ein par Tagen verheizt wurde. Der Fischer Karl Glitza hatte schon eine
Knetmaschine, die von einem Pferd angetrieben wurde, das mit verbundenen Augen, den ganzen Tag in die Runde ging.
Im Dorf waren auch vier Kalköfen, in denen so genannte Kalksteine, die sich an gewissen Stellen, im Erdboden befanden,
gebrannt wurden. Nach dem Brennen wurden die Steine mit Wasser abgelöscht und die daraus entstandne Masse diente, nach
dem Beimischen einer gewissen Menge Sand, dann als Bindemittel beim Häuserbau. Das Gerichtsgebäude und das
Lehrerseminar in Ortelsburg wurden mit Kalk, aus dem Rohmaner Brennöfen erbaut. Auch zum Bau einer Eisenbahnbrücke, auf
der, der Zug, den Sawitzfluß, von Ortelsburg nach Allenstein überquerte, hat mein Großvater, mit einem Ochsengespann,
Kalk gefahren.
Hinter der Scheune, beim Bauern Johann Dembek hat man Tonerde gefördert, aus der man mit Hilfe einer Formerscheibe,
die von einem Arbeiter mit Muskelkraft(Fußbetrieb) angetrieben wurde, schöne Krüge, Schalen und Vasen geformt hat.
Die Töpferware wurde, nachdem sie trocken genug war, auch in einem Ofen gebrannt, anschließend mit einer Lasur
überzogen und wieder gebrannt. Es wurden auch Kacheln zum Bau von Kachelöfen hergestellt, die mit verschiedenen
Ornamenten versehen, die Wohnstuben unserer Vorfahren schmückten. So haben unsere Großväter ihr Leben gemeistert und
nach und nach, unsere Dörfer aus der Rückständigkeit in die Neuzeit geführt.
Das gesellschaftliche Leben nach dem 1. Weltkrieg

Als der Lehrer Alfred Dorka, ein Frontkämpfer des Ersten Weltkrieges und ein Sportsmann, als
zweite Lehrkraft an der Rohmaner Schule angestellt wurde, hat er die Sitten und Gebräuche aus früherer Zeit wieder zum
Leben erweckt. Zuerst hat er die Jugend zusammen gerufen, einen Jugendverein und einen Fußballclub, gegründet. Zum
Vorsitzenden des Fußballclubs wurde Johann Gloddek berufen, der ihn auch geleitet hat. Bauer Wilhelm Spittka, der am
Rohmaner See wohnte, stellte Land für einen Sportplatz unentgeltlich zur Verfügung. Lehrer Alfred Dorka hat am
Rohmaner See eine Badestelle ausgesucht und ein Sprungbrett bauen lassen. An jedem Sonnabend im Sommer, bevor die
Sonne unterging, versammelte sich die gestammte Jugend des Dorfes an der Badestelle am See. Es wurde gebadet,
Heimatlieder gesungen, gespielt, im Fackelschein eines großen Biwakfeuers, bis in die späte Nacht hinein. Der Fischer
Karl Glitza hat uns Kähne zur Verfügung gestellt, mit denen wir auf den See hinausgepaddelt sind, dabei hatten wir viel
Spaß, was wiederum den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft gefördert hat. Ich habe mit meiner Mandoline den Gesang von
Volks- und Heimatliedern begleitet.
Der Rohmaner See liegt in einem Tal, dessen Hänge zu beiden Seiten mit Kiefern und Tannen bewaldet sind. Wenn man
gesungen oder Musiziert hat, hallte es von den Hängen zurück. Die Ufer waren mit Kalmus und Schilf bewachsen, was für
die Fischaufzucht von Vorteil war. Wenn man an einem sonnigen, windstillen Tag, am Seeufer spazieren ging, traf man
oft auf Flachstellen, an denen sich die Fischbrut im Sonnenlicht wärmte, wie ein Mückenschwarm. Im See befanden sich
folgende Fische: Karpfen, Hechte, Schleie, Barsche Plötze, Rotaugen, Aale und Krebse. Am Sonntagmorgen brachten viele
Rohmaner ihre Pferde zum See um sie zu baden.
Es wurden dort, unter der Aufsicht von Lehrer Dorka, auch viele Jugendfeste mit Theatervorführungen veranstaltet, zu
denen er selbst die Vorlagen organisiert hat. Der am See wohnende Bauer Johann Nadrowski, hat uns ein Scheunentor, als
Tanzboden zur Verfügung gestellt. Der Zimmermann Wilhelm Wittek hat uns eine Windmühle gebaut, die am auf dem Boden
liegenden Scheunentor aufgestellt wurde, dazu kamen Noch Tannen und Fichten, die das Ganze wie ein Bühnenbild
erscheinen ließen. Es wunden viele Bühnenstücke aufgeführt, unter anderen >Alte Weiber werden jung gemahlen<. Dazu bot
die Windmühle die entsprechende Kulisse.
Nach der Vorführung wurde der Boden aufgeräumt, um dann als Tanzdiele zur Verfügung zu stehen. Der Gastwirt Trzaska
hatte Tische und Bänke aufgestellt, Speisen und Getränke angeboten, so dass sich die die Veranstaltung bis in die
späte Nacht hinein zog. Es waren auch Leute aus Ortelsburg und anderen Nachbardörfern dabei. Im Winter hat Lehrer
Dorka eine Kreisrodelbahn eingerichtet, die von Zeit zu Zeit mit Wasser besprengt wurde, um die Gleitfähigkeit zu
verbessern. Von einer Anhöhe ging hinunter bis auf den halben See, was für alle ein großes Vergnügen war. Es kamen
Lehrer mit Schulklassen aus der näheren Umgebung um hier zu Rodeln.
Als Herr Lehrer Jobski als Hauptlehrer nach Rohmanen kam hat er mit dem Bürgermeister und der Gemeindeverwaltung
beschlossen, in der Nähe des Dorfes, auf einem zur Schule gehörenden Grundstück, einen Sportplatz anzulegen. Dafür
wurde gleich hinter den Gärten, 6 Morgen Ackerland abgetrennt, und nach Feierabend hat Lehrer Dorka mit den
Jugendlichen eingeebnet und gleich nebenan einen Graben für Schützenstand und Kugelfang ausgehoben. Am Sonntagvormittag
wurde Fußball gespielt und um 15:00 Uhr war Kleinkalieberschießen angesagt. Es musste auch ein kleiner Beitrag erhoben
werden, um Munition kaufen zu können. Eine Büchse konnten wir aus beim Kleinkalieberverein in Ortelsburg ausleihen.
Nach Hitlers Machtergreifung
Als Adolf Hitler an die Macht kam wurde die SA gegründet. Der Bürgermeister Michael Kownatzki
wurde zum Gruppenführer ernannt und folgende Männer haben sich freiwillig gemeldet: Wilhelm Matzey, Johann Gloddek,
Gustav Nadrowski, August Buttler, Karl Baran, Emil Nickel, Wilhelm Jaschinski, Emil Bork, Ernst Rattay und Gustav Bach.
Bei Versammlungen war die SA in Uniform angetreten um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Wer versucht hat Unruhe zu
stiften, egal aus welchem Grunde, wurde aufgefordert den Saal zu verlassen, andernfalls wurde er mit Gewalt entfernt.
Herr Lehrer Jobski wurde zum politischen Leiter ernannt, seine Frau hat die NS-Frauenschaft gegründet, Lehrer Dorka
die HJ, und so bekam die Dorfgemeinschaft, nach und nach ein anderes Gesicht. Der Sportplatz und der Schützenstand
wurden jetzt mehr als früher in den Mittelpunkt gestellt. Nach der Feldarbeit hat der Bürgermeister Fuhrwerke bestellt
und den Sportplatz noch besser herrichten lassen.
Der Bauer Wilhelm Both wurde zum Ortsbauernführer ernannt, mit der Aufgabe alles Land für den Anbau von Getreide und
Futtermittel bereitzustellen, oder wenn das nicht möglich war mit Wald aufzuforsten. Durch den Einsatz von Kunstdüngern
sollten größere Erträge aus dem Boden geholt werden, um den Viehbestand zu vergrößern und mehr Milch und Butter zu
produzieren. Deutschland sollte im Stande sein sich selbst zu selbst zu ernähren, ohne auf Importe angewiesen zu sein.
Frau Jobski hat, innerhalb der der NS-Frauenschaft, mit Hilfe von Fachkräften aus Ortelsburg, Lehrgänge veranstaltet,
auf denen man Backen und Nähen lernte. Auf den Bauernhöfen befand sich auch immer mehr Rassegeflügel, das eine erhöhte
Produktion von Eiern und Geflügelfleisch sicherstellen sollte.
Die Rohmaner Bauern hatten, außer in der Landwirtschaft, noch andere Verdienstmöglichkeiten in der Kreisstadt. In
Ortelsburg wurden vier Sägewerke betrieben, die mit Langholz aus dem Walde versorgt werden mussten. Wir haben eine
Kiefer von über 8 Festmeter angefahren, der wir zuerst 6 Meter Spitze abschneiden mussten, um diese Last überhaupt
auf den Wagen zu bekommen. Sechs Pferde musste angespannt werden um den Wagen zur befestigten Straße zu bringen.
Fichten und Tannen wuchsen bis zu einer Länge von 30 Metern. Auch beim Transport von Ziegel, von der Ziegelei zum
Bahnhof, konnte man gutes Geld verdienen.
Im Jahr 1934 wurde Rohmanen an das überregionale Stromnetz angeschlossen und schaffte auf diese Weise den Sprung von
der Petroleumlampe zur Glühbirne. Neben dem Grundstück von Karl Pietzonka wurde ein Transformatorhäuschen errichtet,
in dem der ankommende Strom von einer Hochspannung auf eine Verbrauchsspannung transformiert wurde. Es gab schon eine
Überlandleitung, die aus Richtung Ortelsburg kommend, quer über die Felder, in Richtung Neu Keykuth weiter ging.
Durch eine Zwischenspanne wurde der Transformator, mit der Hauptleitung auf Kownatzkis Feld verbunden.
Ein Stromanschluss konnte die Arbeit im Haus und Hof auf vielfältige Weise erleichtern, doch nur die besser gestellten
Bauern, sowie noch manche Pensionäre, die ein festes Einkommen hatten, konnten sich dass leisten. Weil nur wenige an
der Elektrifizierung teilnahmen, war ein Stromanschluss mit hohen Kosten verbunden. Nur Gustav Pietzonka, Gasthof
Trzaska, Friedrich Nickel, die Schule und Wilhelm Both, wurden in der ersten Phase erfasst.
Im Jahr 1952 wurde von den polnischen Behörden die zweite Stufe der Elektrifizierung eingeleitet, in der alle im Dorf
stehen Gebäude erfasst wurden. Am Anfang wurden nur Leitungen für Lichtstrom gelegt und auch nur 3 Lichtstellen pro
Haushalt bewilligt. Doch im nachfolgenden Zeitraum wurden dann, wenn Material vorhanden war, weitere Lichtpunkte
angelegt. 1952, am zweiten Wochenende im Advent, wurden dann die Leitungen geschaltet und alle waren von der
plötzlichen Helligkeit sehr begeistert. Wenn man Glühbirnen auswechseln wollte musste man am Anfang weite Wege
zurücklegen, um welche zu bekommen. In den 60ger Jahren wurden dann immer mehr Starkstromleitungen gelegt, weil die
Bauern elektrische Geräte kaufen konnten. Ende der 60ger wurden auch die Abbauten an das Stromnetz angeschlossen.
Das Urnengrab auf unserem Feld
Auf unserem Feld, in Richtung Seelonken, bin ich oft beim pflügen gegen Steine gestoßen, manchmal
rissen sogar die Stränge am Pferdegeschirr. Eines Tages nahm ich einen Spaten, Brechstange und einen langen Baum, um
der Sache auf den Grund zu gehen. Als ich eine Menge Sand ausgehoben hatte stieß ich auf eine steile, aus Steinen
errichtete Wand, die ich auch mit dem Baum nicht aus der Fassung bringen konnte. Ich habe den ganzen Vormittag gegraben,
konnte jedoch nicht unter die Steine kommen. Einige Tage später hatten wir in der Schule eine Bauernversammlung, da
habe ich Herrn Biella und Herrn Lehrer Dorka von meinem Fund berichtet. Am nächsten Morgen kam der Lehrer Dorka mit der
ganzen Schulklasse, mit Spaten und Sieben ausgerüstet auf unser Feld und fingen an die ausgehobene Erde zu sieben.
Lehrer Dorka benachrichtigte daraufhin den Leiter des Ortelsburger Heimatmuseums, der am nächsten Morgen vorbei kam um
sich die Fundstelle genau anzusehen. Er beauftragte ihn 4 Mann zu besorgen, um die Steine ringsum frei zu schaufeln.
Zwischen den Steinen durften wir die Erde nur mit Esslöffeln ausheben. Als es plötzlich zu regnen anfing hat Lehrer
Dorka die Brauerei Daum, in Ortelsburg angerufen, die uns über der Fundstelle ein Zelt errichtet haben, damit wir
ungestört weiterarbeiten konnten. Wir fanden 8 flache und 8 hohe Urnen zu beiden Seiten am Körper. Die Urnen wurden in
Gipsbinden eingewickelt und ins Heimatmuseum nach Ortelsburg gebracht, wo sie durch einen Fachmann, der extra aus einem
Königsberger Museum angereist war. Nach Reinigung der Urnen hat er festgestellt, das die Grabstätte etwa 2000 Jahre vor
Christi Geburt angelegt wurde und ein Doppelgrab war, in dem ein Toter liegend und einer in Hochstellung beigesetzt
wurde.
Die Nachricht von der Fundstelle verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Es erschienen viele Schaulustige, ganze
Schulklassen aus der Umgebung, mit Autos und zu Fuß. Durch die vielen Menschen wurden die bestellten Ackerflächen auf
unserem Feld sehr in Mitleidenschaft gezogen, eine Entschädigung haben wir nicht erhalten. Das Grab wurde vor dem
Heimatmuseum in Ortelsburg wieder so aufgebaut wie man es auf unserem Feld vorgefunden hat. Für den Transport der
Steine wurde ich entlohnt. Die Urnen hat das Königsberger Museum an sich genommen und wollte sie nicht wieder hergeben,
weil die solch einen Fund noch nicht in ihrer Sammlung hatten.
Sonnenwendfeuer
Am 24 Juni fand eine Sonnenwendfeier statt. Ein Brauch der an die alten Germanen erinnern sollte.
Der Lehrer Dorka hat den Bürgermeister beauftragt 2 Fuhrwerke in den Wald zu schicken, die Holz und alten Reisig holen
und auf dem großen Schulberg abladen sollten. Das Straßenbauamt hat uns Teertonnen zur Verfügung gestellt. Die ganze
Dorfgemeinschaft wurde eingeladen, am Abend, nach der Feldarbeit, an der Sonnenwendfeier teilzunehmen. Lehrer Dorka
hielt zuerst eine Ansprache, in der er anschaulich erklärte wie unsere Vorfahren in grauer Vorzeit gefeiert haben.
Nach dem offiziellen Teil wurden das Holz und die Teertonnen angezündet, es wurden Heimatlieder gesungen, wie: Wild
flutet der See, drauf schaukelt der Schiffer den schwankenden Kahn, Schaum wälzt er wie Schnee, von grausiger Mitte
zum Ufer heran, wild fluten die Wellen auf Vaterlands See, wie schön, oh trag mich auf Spiegel zu Hügel, Masovias See.
Masovia Land, mein Heimatland, Masovia es lebe mein Vaterland.
Lehrer Alfred Dorka und sein Wirken für Rohmanen.

Friedrich Biella hatte auf seinem Feld einen Granitstein mit einer geraden Seite, den haben wir
mit viel Schweiß an den Dorfteich transportiert und auf einer Erhöhung abgelegt. Der Stein sollte zum Denkmahl für die
Gefallenen des Ersten Weltkrieges umgestaltet werden. Da zu Wenige daran ein Interesse zeigten, wurde diese Idee fallen
gelassen und der Stein irgendwann ins Wasser gerollt. Der Lehrer Dorka war viele Jahre in Rohmanen tätig, dort hat er
später seine ehemalige Schülerin, Lotte Biella geheiratet. Er hat sich sehr für die Entwicklung des Dorfes interessiert,
war bei jeder Gemeindeversammlung anwesend und hat auf Schwachstellen hingewiesen die den Fortschritt behinderten.
Gemeinsam mit den Schülern hat er den Ehrenfriedhof für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges gepflegt, an der
Wegegablung nach Eichtal und zu Ehren des Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg eine Eiche gepflanzt.
Zum Advent hat Lehrer Dorka mit der Jugend einen Adventstern, in verschiedenen Farben gebastelt.
Der Stern wurde auf einer 2 Meter langen Stange befestigt, in der Mitte wurde ein Wachslicht angezündet, am Stern
wurde eine Schnur angebracht, wenn man daran zog rollte der Stern hin und her. Am ersten Wochenende im Advent
versammelten sich jung und alt, um den Stern durch das Dorf zu tragen. Alle schlossen sich dem vorausgehenden
Sternträger an, der den Stern durch die Hauptstraße und die angrenzenden Wege trug. Dieser Sternmarsch wurde an den
folgenden Adventwochenenden wiederholt.
Am ersten Weihnachtfeiertag wurde um 4:00 Uhr morgens ein Frühgottesdienst gehalten. Zuerst hat der Pfarrer eine
Andacht gehalten, dann haben die Kinder ein Krippenspiel aufgeführt und die Gemeinde hat schöne Weihnachtslieder
gesungen. Der Gastwirt Trzaska hat uns den Saal zur Verfügung gestellt. Wir hatten eine Posaunen- u. eine
Gitarrengruppe. Unter der Leitung von Herrn Willi Doormann spielten: Gottlieb Brosch, Fritz Ollech,
Gustav Rattay(Sopran), Wilhelm Pilath, Gustav Brosch(Alt), Fritz Both(Tenor) und Fritz Brosch(Bass).
In der Gitarrengruppe wirkten mit: Martha Ollech, Hedwig Ollech, Martha Lekzik, Martha Michalick und Auguste Lekzick.
Willy Doormann hat sie auf der Geige begleitet.
Kurz vor Ausbruch des 2. Weltkrieges
Bei der Aufstellung des Grenzschutzes(Regiment Buchholz), hat er als Hauptfeldwebel die
Gruppenführerkurse überwacht und selbst die fähigsten Männer dafür vorgeschlagen. Das Ausbildungspersonal hat das
Jäger-Battalion gestellt. Wir kamen zuerst ins Stadion(Waldheim), wurden da eingekleidet und dann ging es gleich
kasernenmäßig zu, theoretisch und praktisch. Jeder musste vor die Front treten und nachweisen ob er im Stande ist,
Befehle zu erteilen. Abends wurden Filme vorgeführt die uns zeigen sollten wie eine Gruppe sich im Gelände entfalten
muss. Die Exerziervorschriften hatten sich, im Verhältnis zu Kaiser Wilhelms Zeiten, etwas geändert. Damals bestand
eine Gruppe aus 8 Mann und einem Unteroffizier, jetzt aus 10 Schützen, 3 für das leichte Maschinengewehr und einem
Unteroffizier(13 Mann). Nach der Schulung folgte eine Abschlussprüfung, danach ein gemütliches Beisammensein. Aus
Rohmanen haben folgende Männer die Prüfung bestanden: Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy, Gustav Rattay und
Gustav Deptolla. Unsere Uniformen waren alle zu klein und es gab viel zu lachen bei der Anprobe.
Die erste Übung habe ich mit Emil Rosowski, in Lenzinen gemacht. Der Gutsbesitzer Marzinzick hat seine Scheune als
Unterkunft zur Verfügung gestellt. Er war im Range eines Hauptfeldwebels. In seinem haus war die Schreibstube
untergebracht, die er selbst verwaltete. Ein Lastauto hatte Uniformen aus der Kaserne in Ortelsburg geholt, jeder
musste eine Uniform anlegen und dann wurde solange getauscht bis alle eine passende gefunden hatten. An den Namen des
Kompanieführers kann ich mich nicht mehr erinnern. 1935 wurden wir zu einer Übung in die Dragonerkaserne nach Lyk
einberufen. Die Gruppenführer, Zugführer, und Kompanieführer die schon Frontberührung im dem Ersten Weltkrieg hatten,
mussten eine Woche früher anreisen. Die Übungen waren auf 6 Wochen angelegt. Die meisten der einberufenen waren noch
nie mit dem Wehrdienst in Berührung gekommen. Jeder Gruppenführer bekam 13 Mann zugeteilt.
Unser Zugführer war Leutnant Neumann, Kompanieführer Oberleutnant Rutschko, Battalions-Kommandeur Major Gröning
(Regiment Buchholz). Hier ging es wieder Kasernenmäßig voran. Das Bataillon wurde hier vereidigt. Jeden zweiten
Sonntag durften unsere Frauen uns besuchen. Ein Jahr später wurden wir wieder zu einer Übung einberufen, auf den
Truppenübungsplatz nach Arys. Jeder Gruppenführer hatte den Auftrag die Gruppe zu entfalten, und auf bewegliche
Figuren zu schießen. Diese Übung musste später mit scharfer Munition wiederholt werden. Jedes Maschinengewehr bekam
50 Schuss, jeder Schütze 20 Schuss zugeteilt. Nach dem Abschießen wurden die Treffer gezählt und dem Kommandierenden
Bericht erstattet. In einiger Entfernung spaziert ein Storch umher, der gar nicht bemerkt hatte dass geschossen wurde,
was bei den Kameraden ein großes Gelächter hervorrief.
Nach der Übung wurde uns gesagt das jeder Gruppenführer eine arische Abstammung nachweisen sollte. Ich konnte in den
Rheinsweiner Kirchenbüchern meine Vorfahren aus Gellen, bis zum Jahr 1732 zurück, nachweisen und wurde zum
Unteroffizier befördert. Aus unserem Dorf wurden auch, Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy und Gustav Deptolla
befördert. Zwischendurch mussten wir schon mal in die Radfahrer-Kaserne nach Ortelsburg, Gewehre empfangen und im
Gelände üben. Am 31 Juli 1939 wurde mir von einem Soldaten ein Schreiben übereicht, das mich aufforderte, am 1. August
um 6:00 Uhr, bei der 3. Kompanie, des 2. Infanterieregiments zu erscheinen.
Um 5:30 hat mich meine Schwester in die Kaserne gebracht. Auf der Schreibstube erklärte mir der Hauptfeldwebel,
dass mir ab sofort der Dienstgrad eines Sanitäters zugewiesen wird, ich mich in der Kammer einzukleiden hätte und mir
in der Handwerkerstube die entsprechenden Schulterklappen annähen lassen sollte. Die aktiven Sanitäter wurden den
Feldlazaretten zugewiesen und wir kamen an ihre Stelle. Unser Bataillon wurde nach Schodmak zum Bunker bauen und
Stacheldraht verlegen eingeteilt. Wir zogen in Begleitung einer Musikkapelle bis zur Kreuzung am Krankenhaus, dann
weiter zu unserem Bestimmungsort, gefolgt von einer Gulaschkanone die in den nächsten Tagen für unsere Verpflegung
sorgen sollte.
Am 14 August haben wir die Jägerkaserne, begleitet von einer Musikkapelle endgültig verlassen und zogen zuerst durch
Ortelsburg, dann über Lehmanen ins Feldmanöver, hinter Rohmanen. Dort entfaltete sich das Bataillon im Gelände, die
Verwundetensammelstelle wurde auf dem Hof des Bauern Friedrich Neumann eingerichtet. Gegen Abend wurde zu Sammeln
geblasen und Biwak bezogen, wobei unsere 3.Kompanie, in einem kleinen Wallt, in der Nähe von Otto Nickels Gehöft
Stellung bezogen hatte. Die 2. und 4. Kompanie hatte sich in der Nähe vom Abbau Pallasch niedergelassen. Die Frau
Nickel hat am Abend ein Mädel in Dorf geschickt um meiner Frau Bescheid zu sagen, wo wir uns zurzeit befinden. Meine
Frau ist dann noch gekommen um sich von mir zu verabschieden, weil wir am nächsten Morgen um 3:00 Uhr Zelte abbrechen
und um 4:00 Uhr in Richtung Kaspersguth marschieren sollten.
Wir sind dann über Achodden, Seelonken, Lehmanen, Ortelsburg, bis nach Grammen und Schützendorf marschiert, wo wir an
einem See Biwak bezogen haben. Es wurde immer gesagt, wir kommen zum Tannenberg-Denkmal bei Hohenstein, wo ein Reichs
Kriegervereinsfest stattfinden sollte. Es wurden auch schon Vorkommandos aufgestellt, doch dann kamen wir nach Orlau
und Lahna-Mühle, da wo die Alle entspringt haben wir 2 Tage biwakiert. Unser Kompanieführer hat uns nach Waplitz auf
den Soldatenfriedhof des Ersten Weltkrieges geführt und uns erklärt wie das Jägerbataillon sich 1914 hier entfaltet
hat und aufgerieben wurde. Dann mussten wir in der Nähe von Gut Koslau über einen Fluss und bezogen in einem Waldstück,
vorbereitete Stellungen in der Nähe der polnischen Grenze. Herr und Frau Thalmann haben uns jeden Tag, bis zur Grenze,
mit Brötchen und Getränken versorgt. Es wurde scharfe Munition ausgegeben, weil wir am nächsten Morgen um 4:00 Uhr die
polnische Grenze überschreiten sollten.
Am nächsten Morgen um 10 Minuten vor 4:00 Uhr kam der Befehl; scharfe Munition abgeben, alles zurück in ein 6 Kilometer
entferntes Dorf, wo wir auch einquartiert wurden. Das alles geschah’ eine Woche vor dem 1. September 1939. Es wurde
gesagt dass der Führer dem polnischen Präsidenten Rid-Szmigly, ein Ultimatum gestellt hat und es wahrscheinlich nicht
zum Krieg mit Polen kommt. Genau nach 5 Tagen kehrten wir wieder in die gleichen Stellungen zurück, es wurde wieder
scharfe Munition ausgegeben und am nächsten Morgen um 4:00 Uhr überschritten wir die polnische Grenze.
“Der 2. Weltkrieg.”
Der erste Einsatz in Polen
Wir kamen zuerst in ein Dorf in dem sich nur alte Menschen befanden. Auf unsere Frage wo denn die Bewohner wären sagte
man uns dass alle geflohen sind, weil erzählt wurde, die Deutschen würden alle Polen misshandeln und verstümmeln. Ich
habe ihnen daraufhin gesagt dass uns, unter Androhung von Strafe verboten wurde, einem Zivilisten etwas anzutun. Das
Vieh, die Schweine und Hunde des Dorfes liefen frei herum und die Soldaten fingen an auf die Hunde zu schießen, bis
gesagt wurde es seien Meldehunde im Dienste der Deutschen Wehrmacht und dieser Unfug der eigenen Truppe schaden würde,
weil etwaige Querschläger eigene Kameraden verletzen könnten. Wir gingen weiter auf polnischer Seite entlang der Grenze,
bis wir am Nachmittag die ersten Vorposten der Festung Mlawa erreichten, da befanden wir uns plötzlich im Feuerhagel
polnischer Festungsflack.
Am nächsten Morgen hatte ich schon 3 Verwundete und wusste nicht wo sich eine Verwundeten Sammelstelle befindet. Ich
suchte den Bataillonsgefechtstand auf der sich auf einer Anhöhe befand. Ich habe unseren Oberstabsarzt gefragt wo denn
die Verwundetensammelstelle wäre. Er rief beim Tross an, wo er die Auskunft erhielt, das sich vor dem Dorf ein Bunker
befindet in dem man die Verwundeten sammeln sollte, die dann von Sanitätsautos abgeholt würden, weil das Dorf unter
Artilleriebeschuss stand. Am Sonnabend haben unsere Flieger die Bunkerstellungen bombardiert, konnten aber, trotz guter
Treffer nicht viel ausrichten, die Bunker wurden nur etwas angekratzt.
Der Beschuss unserer vordersten Linien ging mit unverminderter Heftigkeit weiter. Am Sonntag verkündete eine große
Staubwolke die Ankunft unserer Panzer, doch sie kamen nur bis zur Panzersperre und mussten wieder abdrehen ohne den
Polen einen schaden zuzufügen. Ein Panzer bekam einen Volltreffer, der Fahrer konnte noch umkehren. Er blutete am Kopf
und der Schütze war so eingeklemmt, das wir ihn nur mit einem Seil unter den Armen, durch die Luke nach oben ziehen
konnten. Ob er seine Verwundung überlebt hat ist mir nicht bekannt, denn in der Nacht wurden Panzergeschütze nach
vorne in Stellung gebracht, die direkt in die Schießscharten der Bunker geschossen und so die Verteidiger vertrieben
haben. Daraufhin sind wir weiter vorgerückt. Auf einer Wiese war ein tiefer Graben ausgehoben und mit Ästen getarnt,
da war ein Panzer hinein gefahren, so dass nur das Hinterteil herausragte und er sich nicht aus eigner Kraft befreien
konnte. In der Luft waren Flieger die Brandbomben abwarfen, ich habe mich auf den Boden geworfen weil ich dachte die
würden explodieren, aber sie zischten nur, so das Stoppeln und Graß rings herum in Brand gerieten.
Bei den Kampfhandlungen gab es mehrere Verwundete, denen ich gerade Verbände anlegen wollte, als unser Hauptmann zur
Trillerpfeife griff um mir klar zu machen, dass ich ihm folgen sollte. Die Polen fingen an zu schreien, ich sollte
sie ins Lazarett bringen denn hier im Wald würde sie niemand finden. Ich setzte mich aufs Fahrrad und folgte unserem
Kompanieführer, der mir sagte ich soll immer bei der kämpfenden Truppe bleiben, denn hinter der Front sind die
Sanitätsabteilungen, die werden die Verwundeten schon versorgen. Der Vormarsch dauerte bis in die späte Nacht. Auf
einem Gehöft, das nach allen Seiten durch Feldwachen abgesichert wurde, machten wir endlich Rast. Wir haben
Getreidegarben auf dem Hof ausgebreitet und uns zur Ruhe gelegt, als plötzlich um Mitternacht Leuchtraketen den Himmel
erhellten und Maschinengewehrfeuer uns aus dem Schlaf schreckte. Ein par polnische Soldaten hatten das Feuer eröffnet,
aber sich kurz darauf ergeben.
Die Narew-Überquerung
Als es hell wurde ging der Vormarsch weiter. Es wurde uns untersagt Tagebuch zu führen, darum
weiß ich nicht wie die Orte hießen, durch die wir marschiert sind. Als wir durch ein sumpfiges Gelände vor drangen
stand auf einer Anhöhe am Horizont, die polnische Artillerie, die uns sofort unter Beschuss nahm. Unser Hauptmann war
der Meinung dass wir schon in der Nähe des Flusses Narew sein müssten, als aus den Sträuchern ein mit Schlauchboten
beladenes Lastauto auftauchte. Wir wurden aufgefordert mit je 6 Mann ein Schlauchboot zu nehmen, an einem Aggregat
der daneben stand mit Luft zu füllen und zu Wasser zu lassen. In einer Stunde war das ganze Bataillon über die Narew,
wo der Vormarsch fortgesetzt wurde. In einem Dorf überraschte uns die polnische Kavallerie und fing sofort mit
Maschinengewehren zu schießen an. Da kam der Befehl: Alles wieder zurück. Es ging noch schneller als auf der Hinfahrt.
Wir sind erst einige Kilometer am Fluss entlang gegangen und haben dann zum zweiten Mal rüber gesetzt.
Die Gehöfte im Dorf standen alle in Brand. Auf einem waren viele Bienestöcke. 2 Kameraden wollten den Stöcken Waben
entnehmen, doch die Bienen durch das Feuer aufgeschreckt, überfielen sie sofort und stachen derart zu das sie nicht
mehr wieder zu erkennen waren. Ich habe die Einstichstellen mit Salmiak betupft, mehr konnte ich nicht tun. Wir mussten
auf unserem Vormarsch durch einen Wald der in Flammen stand, so dass man kaum atmen konnte. Es ging weiter in Richtung
Minsk und Warschau, wo schon die Sowjetische Armee durchgegangen war, die Pferde und Vieh von einem Gut mitgenommen
hatten. In einem Wald stießen wir unverhofft auf ein Kloster, in dem wir einige Gefangene machten. Dann trafen wir auf
eine gute Straße die nach Grochow ging.
Als wir dort einmarschierten wurden wir aus den oberen Stockwerken beschossen, so dass wir, um uns zu schützen, nur an
den Hauswänden entlang gehen konnten. Wir haben jedes Haus nach Feinden durchsucht. Vor einem Haus stand ein Hund der
niemanden reinlassen wollte, solange bis ihn eine Kugel traf. Die polnische Artillerie feuerte von Warschau aus, um
unseren Vormarsch zu stoppen. Wir hatten uns gerade eingegraben als plötzlich deutsche Flieger am Himmel erschienen,
die unsere Stellungen mit Bomben bewarfen und dabei viel Unheil anrichteten. Wir haben sofort Fliegertücher
ausgebreitet und Leuchtraketen abgeschossen. Da ich in dem Graben, den ich kurz zuvor ausgehoben hatte, sofort in
Deckung gegangen bin ist mir zum Glück nichts passiert. Unter den anderen Kameraden gab es viele Verwundete, so dass
ich nicht wusste wem ich zuerst helfen sollte.
Der Oberstabsarzt hat mich sofort tatkräftig unterstützt, so das bald alle Verwundeten versorgt waren, außer einem,
dem ein Bombensplitter den Arm abgerissen hat. Ich habe im 3 große Verbandspäckchen auf die Wunde gelegt, doch die
Blutung ließ sich trotzdem nicht stoppen, so dass er eine Stunde später auf der Krankensammelstelle verstarb. Wir
haben danach in einem Tomatenfeld einen Graben ausgehoben und eine neue Abwehrstellung bezogen. Die Gruppe Schwarz
bekam den Auftrag nach etwaigen versprengten polnischen Verbänden Ausschau zu halten, als sie unerwartet aus einer
Häuserreihe mit Maschinengewehrsalven überschüttet wurden. Der Gruppenführer und noch ein Soldat wurden dabei tödlich
verwundet. Danach wurde noch ein weiter Stoßtrupp, unter der Führung von Leutnant Briskorn, der sich dazu freiwillig
gemeldet hatte, hinaus geschickt um den Gruppenführer und den anderen Toten zu bergen.
Bei diesem Unternehmen, das erfolglos ausging, weil die Toten schon verscharrt waren, durchschlug eine Kugel den
Stahlhelm von Leutnant Briskorn, der auch sofort tot war. Alle Toten wurden später, an der Kirchenmauer in Grochow, in
Särgen beigesetzt: Hauptmann Schönwald sagte, das sie nach dem Kriege auf den Heldenfriedhof nach Ortelsburg überführt
werden. Drei Tage lagen wir bei Grochow in Stellungen, waren dem polnischen Maschinengewehrfeuer sowie den Bomben
deutscher Flugzeuge ausgesetzt. In der Nacht musste ich zu einem Verwundeten in die vorderste Linie und habe den
Rückweg nicht mehr finden können, als plötzlich Gewehrfeuer aufflammte habe ich in den Ruinen Schutz gesucht. Erst im
Morgengrauen konnte ich mich wieder orientieren und zu meinem Unterstand zurückfinden.
Warschau wurde tagelang bombardiert und stand auch unter Artilleriebeschuss. Aus dunklen Rauchwolken kamen oft ganze
Bündel von Papier angeflogen. Die Verwundeten kamen oft auf Krücken zu unserem Unterstand, ich habe sie dann zur
Krankensammelstelle hingeführt. Wir haben auch polnische Zivilpersonen betreut, die während der Kampfhandlungen
verwundet wurden. Als einmal 2 Jungen vorbeiliefen hat einer ihnen nachgerufen sie sollten seiner Frau Bescheid sagen,
er wäre auf der Krankensammelstelle an der Kirche. Als wir dort ankamen war seine Frau, mit einem Kind auf dem Arm,
schon da.
Nach der Kapitulation von Warschau, gingen wir über Sokolow zum Bug und haben dort Quartier bezogen. Der Russe hatte
sich bereits hinter den Fluss zurückgezogen, hatte alles Vieh und Pferde mitgenommen. Dort erreichte mich ein Telegramm
von zu Hause, dass meine Tochter gestorben ist. Es sprach sich auch herum dass verschiedene Heimaturlaub bekommen haben,
ich durfte auch für 14 Tage heim. Wir fuhren mit Lastautos nach Allenstein in die neue Reiterkaserne, zum
Ersatzbatallion, da haben wir unsere Gewehre und Munition abgeben, dann durften wir, jeder in seinen Heimatort
weiterfahren.
Als wir unsere Quartiere am Bug verlassen haben war sehr viel Schnee gefallen. Hier in Ortelsburg fanden wir die
gleiche Wetterlage vor, aber nach 3 Tagen war alles wieder weggetaut und wir konnten die Kartoffelernte, die durch den
frühen Wintereinbruch gestoppt wurde, zu Ende bringen. Ein Tag bevor ich zu Hause angekommen bin wurde die Tochter
beerdigt. Nach 14 Tagen mussten wir uns in Allenstein melden, Gewehre empfangen und wieder zurück zur Division an den
Bug 150 Kilometer hinter Warschau. Die elfte Division, zu der wir auch gehörten sollte in den Westen Deutschlands
verlegt werden und war schon unterwegs zur Verladestation Skiernewice 50 Kilometer vor Warschau.
Mein Dienst als Sanitätsunteroffizier
Unser Bataillon kam in das Städtchen Burscheid, im Kreis Opladen, wo wir in Privatquartieren
untergebracht wurden. Nach 3 Monaten, im Januar 1940, wurden wir nach Solingen verlegt, wo wir bis zum
Frankreichfeldzug stationiert waren. Wir mussten an Feldübungen teilnehmen, wie andere die in Kasernen untergebracht
waren. Während dieser Zeit musste jeder seine Zähne in Ordnung bringen lassen. Jeden Tag fuhren 20 Mann in die
Cäzilienstraße nach Köln, zur Zahnklinik. Im Rheinland wurde unsere Division neu aufgestellt. Ausfälle durch den
Polenfeldzug wurden durch neue Soldaten ergänzt. Ich kam nun zum Ersatzbatallion, war der Älteste in der ganzen
Kompanie. Als der Frankreichfeldzug losging wurde unser Ersatzbatallion mit den noch vorhandenen Verwundeten, in die
neue Reiterkaserne, nach Allenstein verlegt.
Meine Frau hat, mit Unterstützung der Bauernschaft, einen Antrag gestellt, daraufhin wurde ich zur Frühjahrsbestellung,
beurlaubt und später bis auf weiteres vom Militärdienst freigestellt. Als der Russlandfeldzug losging wurde ich von der
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg, für 14 Tage einberufen. Ich war seit 1922, Mitglied der freiwilligen
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg und habe jedes Jahr an Übungen teilgenommen. Jede Bereitschaft musste etliche Leute
stellen. Von Rohmanen wurden Emil Rosowski, Johann Dembek, und ich, zur Krankensammelstelle Wirballen, in Litauen,
abkommandiert. Dorthin kamen Lazarettzüge aus Russland mit der Breitspurbahn. Die Verwundeten wurden frisch verbunden
und auf Waggon mit Normalspur verladen und nach Deutschland gebracht.
Als die 14 Tage vergangen waren wollten wir wieder nach Haus zurück, doch man wollte uns nicht entlassen. Stattdessen
wurden wir dem Wehrkreisamt Königsberg zugeteilt, neu eingekleidet und zur Aushilfe ins Lazarett nach Gumbinnen
abkommandiert. Mehr als ein Jahr war ich in den Urlauber-Baracken, habe dort Krankenstube betreut. Später, bis zum
Dezember 1944, war ich im Reserve-Lazarett 4, in Königsberg tätig. Dort habe ich auch die Luftangriffe der Engländer,
vom 25 bis 26. August 1944 miterlebt.
Wir sollten gerade einen Lazarettzug in Rotenstein entladen, als plötzlich die Sirenen ertönten - Fliegeralarm. Im
gleichen Moment waren die ersten Flugzeuge auch schon da, zuerst warfen sie „Tannenbäume” und danach Foßforkanister ab.
Die Omnibusse standen schon zur Abfahrt bereit als es losging. Wir haben die Verwundeten schnell in den
Luftschutzkeller getragen, haben die Betten von den Fenstern weggerückt damit die Verwundeten nicht von den
Glasssplittern verletzt wurden. Im Kasernenhof brannten die Fosforkanister lichterloh. Unsere Unterkunft, die sich in
einer Baracke befand ist völlig abgebrannt, mit dem Wenigen was wir unser Eigen nannten. Am nächsten Tag wurden wir neu
eingekleidet und am 29. bis 30. kamen die englischen Bomber wieder, sie setzten genau da ihr Zerstörungswerk fort wo
sie vor 3 Tagen aufgehört hatten.
Anfang Dezember 1944 musste ich mich nach Stablack melden und musste dann zur Sanitätsabteilung 1, nach Gernau, das
liegt zwischen Lodz und Warschau. Vormittags hatten wir Felddienstübungen und nachmittags theoretischen Unterricht.
Jeden Tag wurden Gruppen zusammengestellt und zu anderen Einheiten abkommandiert. Ich kam zu einer Panzerabteilung, wo
wir an einem Morgen plötzlich auf dem Kasernenhof antreten mussten und zu unserer Überraschung mit der Nachricht
konfrontiert wurden, dass der Russe an mehreren Frontabschnitten durchgebrochen war. Wir bekamen sofort einen
Marschbefehl in Richtung Lodz, wo das Stadtbild noch intakt war, selbst die Straßenbahnen fuhren noch. In der Nacht
haben russische Flugzeuge die Stadt bombardiert. Die Kaserne in der wir untergebracht waren hatte keine
Luftschutzkeller, aber zum Glück blieben wir von Bombentreffern verschont. Am nächsten morgen bot sich uns ein Bild der
Verwüstung. Die entgleisten Straßenbahnwagen, sowie andere Fahrzeuge blockierten die Straßen. Die Älteren unter uns
bekamen Fahrscheine für einen Transportzug, der bereit hinter Lodz abfahrbereit, unter Dampf stehen sollte. Als
russische Panzer in den Straßen auftauchten, verbrannte die Schreibstube unsere Wehrpässe und andere wichtige
Dokumente. Wir liefen zu der Station auf der unser Transportzug bereitstehen sollte, aber da war kein Zug mehr zu sehen
und wir setzten unseren Rückzug zu Fuß fort.
Der Rückzug und Zusammenbruch der Ostfront
In Dobroschin, einer Stadt in Polen, wurde gerade ein Lazarettzug verladen, doch wir kamen nicht
mehr zum Einsatz, weil die russische Infanterie uns schon auf den Fersen war. Es ging weiter über den Fluss Bober,
Sagan, bis nach Glogau an der Oder. Dort wurden wir der 29. motorisierten Sanitätskompanie zugeteilt. Im
Garnisonslazarett wurden noch Operationen durchgeführt. Unsere Division hatte ihr eigenes Feldlazarett, so dass wir den
Befehl zu Weiterfahrt erhielten und noch unbeschadet die Oderbrücke passieren konnten, denn Glogau wurde zur Festung
erklärt. Wir haben 2 Pferdewagen organisiert und mit Verbänden, sowie medizinischen Instrumenten beladen. So kamen wir
bis nach Lübbenau im Spreewald, wo wir in einem Schloss, in zuvor ein Museum war, unser Lazarett untergebracht haben.
Weil die Amerikaner Cottbus bombardiert hatten, wurden die Verwundeten zu uns nach Lübbenau gebracht. Hier haben wir
Tag und Nacht gearbeitet, um die vielen Verwundeten, aus den schweren Kämpfen bei Grünberg und Sagan zu versorgen. Die
Soldaten von der Abwehrfront kamen schon mit abgestorbenen Armen oder Beinen bei uns an, weil in vorderster Linie keine
Frontlazarette mehr vorhanden waren; es mussten viele Amputationen durchgeführt werden. Als für unsere Pferde kein Heu
mehr vorhanden war, schickte mich unser Hauptfeldwebel, zu einem Bauern in den Spreewald, mit dem Auftrag, Futter zu
besorgen. Mit noch zwei Mann fuhren mit zwei Kähnen, zuerst den Hauptstrom entlang und dann in einen Nebenarm; da haben
wir die Boote beladen und brachten das Heu nach Lübbenau.
Als wir uns bei unser Einheit zurück melden wollten, war alles schon marschbereit. Ich bin schnell in einen Bus
eingestiegen der sofort losfuhr, weil russische Verbände schon in sichtweite waren. Russische Flugzeuge kreisten über
den Dächern und nahmen, mit ihren Bordwaffen jeden unter Beschuss, der sich irgendwo blicken ließ. Wir konnten nur
durch den Wald, oder in der Nacht vorwärts kommen, denn wenn ein Auto auf der Landstraße fuhr, war alsbald ein Flugzeug
hinter ihm her und schoss es in Brand. Als wir nach Tagen am Ufer der Elbe ankamen, war bereits eine Ponton-Brücke
erstellt worden, welche die zerstörte Brücke ersetzen sollte.
Durch die vielen Fahrzeuge waren in den Sand tiefe Spuren gefahren, so dass andere Fahrzeuge unsere Busse ins
Schlepptau nehmen mussten, weil wir mit eigener Kraft nicht mehr weiterkamen. Beiderseits der Trasse standen
Flüchtlingswagen, in der der Hoffnung die Brücke passieren zu können, doch SS-Polizei verhinderte das die Gespanne den
militärischen Rückzug zum Stillstand brachten. Es gelang uns die Elbe zu überqueren, um in einem Waldstück Schutz vor
feindlichen Fliegern zu suchen.
Als wir unsere Busse und Autos gut getarnt hatten, hat unser Bataillonschef die anwesenden Parteigrößen zu sich
gerufen und ihnen erklärt das wir eine Einheit des Roten Kreuzes sind und nach internationalem Recht keine Waffen
besitzen dürfen. Nach langer, erregter Diskussion wurde beschlossen einen Graben auszuheben und alles im Sand zu
verscharren. Als wir dann weiter, durch die Dörfer fuhren, sahen wir schon viele weiße Bettlaken, als Zeichen der
Kapitulation, aus den Fenstern hängen. Es wurde uns erzählt dass der Bürgermeister von der SS erschossen wurde, weil
er die Bevölkerung zu diesem Schritt ermutigt hatte. Jetzt waren hinter uns die Russen und vor uns schon die Amerikaner.
Amerikanische Panzer fuhren umher und schossen wild durch die Gegend, ohne ein Ziel anzuvisieren. Niemand wollte sich
dem Russen ergeben, doch der Weg der zu den Amerikanern führte, war durch abgesägte Bäume blockiert. Wir sind schnell
in das nächste Dorf gegangen, haben uns Sägen und Äxte besorgt, die Bäume durchgesägt und in den Straßengraben
geworfen.
“ Nach dem Ende des 2. Weltkrieges.”
In amerikanische Kriegsgefangenschaft
Dann fuhren wir unter internationaler Flagge an eine Mulde Brücke, vor der zwei amerikanische Soldaten, mit Zigarren,
zur Hälfte im Mund, standen. Sie rauchten und kauten gleichzeitig. Wir mussten auf einen freien Platz fahren, alle
aussteigen und rechts wieder antreten. Wäschebeutel und Tornister mussten wir abstellen; danach wurden wir nach Waffen
durchsucht, Wertsachen, Uhren und Messer wurden uns gleich abgenommen. Als wir anschließend an unserem Gepäck
vorbeigingen durfte niemand was mitnehmen. Als ich gebückt, nach meinem Wäschebeutel greifen wollte, in dem sich noch
3 Konservendosen und ein Brot befanden, bekam ich einen Fußtritt ins Gesicht, so dass mir ein Zahn ausgeschlagen wurde.
Wir wurden dann in einem Garten zusammen getrieben und gefragt ob jemand bei der SS gedient hat. Nachdem wir in Reihe
und Glied angetreten waren, mussten wir den Oberkörper freimachen und die Arme anheben. Es wurde nach SS-Zeichen
gesucht, die gewöhnlich unter dem Oberarm eintätowiert waren. Nachdem wir Grimma bei Leipzig, wo wir in amerikanische
Gefangenschaft geraten waren, verlassen hatten, mussten wir durch ganz Thüringen bis Hersfeld, an der Grenze zu Hessen,
marschieren. In Hersfeld wurden wir auf große Lastautos verladen, die von farbigen Soldaten gefahren wurden. Man hat
uns mit Stöcken hinauf getrieben, solange bis das Auto so voll war das man kaum stehen konnte. Die Soldaten fuhren, für
diese Straßenverhältnisse, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Wenn die Straße eine scharfe Kurve hatte, flogen
wir alle übereinander und mussten erst mit viel Kraftanstrengung auf die Beine kommen um diese Fahrt zu überstehen.
Da die Straßenränder in dieser Gegend mit Obstbäumen bepflanzt sind und deren Äste sehr niedrig hängen, hätten die
uns die Köpfe abgerissen, wenn wir uns nicht ständig geduckt hätten. Unsere Fahrt endete in Bad Kreuznach, in der Pfalz,
wo wir in ein Lager, in dem sich später 130.000 Mann und 6 Generäle befanden, eingepfercht wurden. Die Unterkunft der
Generäle befand sich unter einem Zelt, alle anderen mussten die Zeit unter freiem Himmel zubringen. Die Offiziere, die
Unteroffiziere, die Mannschaften; wurden in getrennten Camps untergebracht. Die Mannschaften wurden auch zur Arbeit
abkommandiert und konnten bei dieser Gelegenheit, Brot, Brötchen oder Zigarettenstummel organisieren, wogegen die
Offiziere und Unteroffiziere ihr Camp überhaupt nicht verlassen durften.
Die ersten Tage gab es kein Wasser und kein Brot, so dass die Kameraden vor Erschöpfung umfielen. Später standen wir
manchmal den ganzen Tag nach Wasser an, das von den, uns bewachenden Negern mit großen Wassertanks angefahren wurde. Am
dritten Tag bekamen wir mittags und abends etwas zu Essen; Brot bekamen wir erst nach zwei Wochen, nach dem aus der
Umgebung herbeigeholte Handwerker, Backöfen gebaut hatten. In den verschiedenen Gemeinden, die in den uns umgebenden
Weinbergen lagen, mussten sich alle Männer beim Bürgermeister melden. Als sie dann erschienen waren, wurden sie auf
bereitstehende Lastautos getrieben und zu uns ins Lager gebracht. Sie waren ohne Kopfbedeckung und ohne wärmere
Bekleidung angekommen, weil ihnen gesagt wurde, dass ihr Aufenthalt im Lager nur von kurzer Dauer sein würde. Man hat
uns, falls noch vorhanden, Decken und Mäntel abgenommen, mit der Begründung, sie würden für Kranke und Verwundete
gebraucht. Jeden Tag starben mehr als 200 Mann, die wir sofort in ein Zelt tragen mussten. In der Nacht wurden die
Toten dann mit unbekanntem Ziel, weggefahren.
Viele haben ihren Verstand verloren uns irrten im ganzen Camp ziellos umher. Als Latrinen wurden Gräben ausgehoben, in
die verschiedene Kameraden, bei der Verrichtung ihrer Notdurft, vor Schwäche hineingefallen sind und nicht mehr wieder
heraus kamen. Aus den Pfählen die, die jungen Obstbäume stützten, haben wir Krankentragen gebaut um unsere Kameraden,
bei Bedarf, zur Krankensammelstelle zu tragen. Es war in diesem Frühjahr auch sehr kalt, doch unsere Erdlöcher, die wir
zum Schutz vor Kälte und Wind, nur mit leeren Konservendosen ausgehoben hatten, durften nicht tiefer als 20 Zentimeter
sein. Nach jedem Regenguss mussten wir das Wasser ausschöpfen. Nach einem Gewitter, standen wir wiedermal, total
durchnässt in unserem Camp, als unerwartet am Horizont die Sonne hervortrat. Einer unserer Kameraden hatte noch eine
Trompete gerettet und fing, von dem Anblick völlig überwältigt, zu spielen an: "Es geht alles vorüber, es geht alles
vorbei, nach jedem Dezember, folgt wieder ein Mai". Daraufhin hob sich die Stimmung der tiefbetrübten Kriegsgefangenen,
so das Heimatlieder durch das ganze Camp erklangen, obwohl wir in den nassen Kleider herumgehen mussten, bis sie am
Körper trocken wurden.
In französischer Kriegsgefangenschaft
Nach etwa einem Monat, haben uns die Amerikaner, den Franzosen, zum Arbeitseinsatz, ausgeliefert.
Etwa 4 Kilometer von Bad Kreuznach entfernt, stand auf freier Strecke, ein Zug mit offenen Kohlenloren, auf den wir
verladen wurden. In jeden Waggon, wurde pro Person eine Tafel Schokolade und ein Päcken Zwieback rein geworfen, doch
viele Kameraden fanden nur leere Päckchen vor, weil die schon zuvor von der französischen Wachmannschaft geplündert
wurden. Wir haben uns darüber beschwert, doch die haben uns nur ausgelacht. Nachdem wir zunächst bei Mainz über den
Rhein fuhren, endete unsere Fahrt bei Paris in einem großen Zeltlager. Dort wurden wir auf andere Züge verladen, die uns
nach Südfrankreich, in ein Barackenlager, bei Mazarei, brachten.
Auf einer Zwischenstation hat man uns unter einer Pumpe, die Lokomotiven mit Wasser versorgt, abgestellt, den Kran
aufgedreht und uns anschließend ausgelacht, die Kinder Haben uns mit Steinen beworfen. Ein Wachmann kam in unseren
Waggon gekommen, hat unser Gepäck durchsucht, wenn er Tabak oder Zigaretten gefunden hat, nahm er sie mit. Die Kameraden
waren darüber so empört, dass sie vorhatten, ihn nachts unter den Waggon zu werfen. Wir haben sie gebeten dass zu
unterlassen, weil man uns in diesem Falle, alle erschießen würde.
Als wir ins Lager kamen wurden wir zuerst gezählt, dann mussten wir unser Gepäck stehen lassen und beiseite treten.
Wenn man bei der Nachkontrolle noch was in den Taschen fand, wurde das auch entwendet, selbst Esslöffel. Wir wurden
dann in drei Baracken, ohne Toiletten, eingeschlossen. Die Kameraden haben ihre Bedürfnisse in Kochgeschirre erledigt
und durch ein kleines Fenster, das sich fast unter der Decke befand, hinausgeworfen. Andere Fenster ließen sich nicht
öffnen, weil sie mit Stacheldraht zu geflochten waren. Als die Kameraden die Kochgeschirre auskippten, haben die
Wachposten geschossen und die Fenster zertrümmert. Sie waren der Meinung dass wir ausbrechen wollten. Es herrschte eine
große Hitze, in den überfüllten Baracken sind wir fast erstickt. Am nächsten Tag haben wir uns über fehlende Toilettem
beschwert, da haben sie Heringsfässer durch die Hälfte geschnitten und an der Ausgangstür hingestellt. Um bei den
überfüllten Räumen dort hinzukommen, musste man über die Köpfe der Anderen steigen. Viele hatten Fieber und Durchfall
und mussten in die Krankenstube eingeliefert werden, wo sie kurz darauf verstarben.
Besonders Raucher litten sehr an der Unterernährung, bekamen Wasser in den Beinen und waren die Ersten die verstarben.
Nach der Registrierung wurden wir auf andere Baracken verteilt. Die Zivilbevölkerung kam in die Räume und begann uns
auszuplündern. Wer noch gute Schuhe besaß musste sie ausziehen und bekam dafür die kaputten des Plünderers. Eine Woche
lang mussten wir diesen Zustand ertragen, erst als die Kameraden sich beschwerten, wurde am Eingang eine Tafel am
Eingang angebracht, dass die Zivilbevölkerung das Lager nicht betreten darf. Bis auf einige, wenige Ausnahmen wurde
diese Anweisung befolgt.
Als wir im Lager ankamen, war der französische Lagerkommandant, ein ehemaliger Kriegsgefangener, der bei einem Bauern
in Deutschland gearbeitet hatte. Dieser Bauer war jetzt als Kriegsgefangener in seinem Lager. Als er ihn erkannte, hat
er ihn gleich zum Küchendienst eingeteilt und mit dem nächsten Krankentransport nach Hause fahren lassen. Zu Mittag
bekamen wir nur gekochte Haferkörner, da schwamm alles oben, später war man dann auf Gerste umgestiegen. Als viele
daran gestorben waren, weil sie diese „Rohkost”, die nur ein Kuhmagen verträgt, nicht gegessen haben, hat man die
Körner durch eine Schrotmühle laufen lassen. Dann hat man uns Steckrüben gekocht; wir bekamen 250 Gramm Weißbrot,
etwas Quark und ein viertel Liter Magermilch. Später, als wir schon arbeiten mussten, hat man in unserem Essen einen
Kuhkopf mitgekocht, das hat dann bedeutend besser geschmeckt.
Bevor wir morgens zur Arbeit gingen, mussten wir zu Flaggenparade und abends, nach der Rückkehr, haben wir die Flagge
wieder eingeholt. Wir haben einen Kanal gereinigt, dessen Sohle 2 Meter dick mit Schlamm bedeckt war. Zuerst wurde das
Wasser abgelassen, dann haben wir, einer dem andern, den Schlamm mit der Schippe hoch gereicht. Der Letzte hat den
Schlamm, der so zäh war, dass er nicht von der Schippe wollte, oben am Rande abgelegt. Manchmal waren 10 Mann nötig um
den Höhenunterschied zu überwinden. Das Wachpersonal schoss über unsere Köpfe hinweg und rief: „schnell arbeiten”. Bei
der großen Hitze war das ein Ding der Unmöglichkeit, zumal es nichts zu Trinken gab. Auf dem Heimweg haben wir im Walde
Heilkräuter gesammelt, die man in der Küche getrocknet und als Tee zubereitet hat, den wir am nächsten tag zur Arbeit
mitnahmen, um unseren Durst zu stillen.
Unser Aufseher hatte einen Stock, an dem sich noch kurz abgeschnittene Äste befanden. Wer seiner Meinung nach, nicht
ordentlich gearbeitet hat, bekam gleich Schläge auf den Rücken. Die weißen Aufseher wurden irgendwann durch Neger
ersetzt, die uns bedeutend besser behandelt haben. Wenn irgendetwas schief ging, haben sie nichts gesagt, nur gelacht.
In den übrig gebliebenen Wassertümpeln hatten sich noch einige Aale versteckt, die wir zu fangen versuchten, was uns
auch manchmal gelang. Wir mussten ihnen das Genick brechen, damit sie uns nicht entwischen konnten. Wenn die Franzosen
bemerkten das wir Aale hatten, wurden sie uns abgenommen. Gelang es uns aber, sie ins Lager zu bringen, dann haben wir
uns eine köstliche Malzeit zubereitet.
Um sicherzustellen dass niemand geflüchtet ist, wurden wir, wenn wir abends ins Lager zurückkamen, zuerst gezählt.
Diese Zählung wurde mehrmals wiederholt, weil die Wachmannschaften sich immer wieder verzählt haben. Als einer von uns
hin ging, ihnen sagte dass alle da sind, wollten sie es nicht glauben und haben uns vor dem stehen lassen, bis es ihnen
irgendwann einfiel. uns doch das Tor zuöffnen. Einmal, als wir von der Arbeit zurückgekehrt waren, standen wir bis 23
Uhr neben der Flagge, weil uns niemand das Tor geöffnet hat. Als wir dann doch irgendwie ins Lager kamen haben wir
festgestellt, dass das ganze Wachpersonal betrunken war und niemand im Stande uns das Tor zu öffnen.
Eines Tages waren wir wieder abends zur Parole angetreten, als ein älterer Herr mit seinem Hund, am Stacheldraht
entlang, spazieren ging. Weil der Hund, unterm Stacheldraht hindurch, zu uns kam, hat ihn einer geschnappt, ihm das
Genick gebrochen und unter seiner Jacke versteckt. Der Franzose hat nach seinem Hund gerufen und gepfiffen, aber alles
vergebens, der Hund war nicht aufzufinden. Die Kameraden haben ihm gleich das Fell über die Ohren gezogen, das Fleisch
gekocht und das Fell in die Latrine geworfen. Das Fleisch wurde umgehend verspeist.
Als wir am nächsten Tag von der Arbeit zurückkehrten, war im Lager der Teufel los. Wir mussten sofort antreten und
wurden gefragt, wo der Hund geblieben ist, der Gestern Abend, mit seinem Herrchen, am Zaun entlang spazieren ging. Als
sich niemand dazu bekannte, mussten wir weiterhin stehen bleiben, während die Wachmannschaften von Baracke zu Baracke
gingen und alles durchsuchten. In einer Latrine hat man dann das Fell gefunden, was uns ein furchtbares „Donnerwetter”
einbrachte und in den nächsten Tagen, nach der Arbeit, unter dem Kommando eines Oberfeldwebels, eine Stunde
nachexerzieren.
In Südfrankreich regnet es den ganzen Sommer nicht; die Bauern haben da keine Scheunen und das Getreide wir nur in
Schobern aufgestellt und dann umgehend gedroschen. Vom Oktober bis Dezember regnete es fasst jeden Tag in Strömen.
Gesät wird nur im Frühjahr und im Herbst, weil im Sommer alles vertrocknet. Es wird viel Wein angebaut und die
Steckrübe wächst den ganzen Winter. Neben den Weinreben wurde aus Schieferplatten ein Zaun aufgestellt, um dem Wein
einen optimalen Standort zu sichern. Die Bauernwagen hatten nur zwei Räder und waren nur mit einem Pferd bespannt, das
die ganze Balance des Wagens zu halten hatte. Trotzdem haben sie soviel aufgeladen wie wir auf einen Leiterwagen. Viele
Kameraden wurden den Bauern zur Arbeit ausgeliehen. Wenn ein Bauer einen Arbeiter gebraucht hat und es wurde gefragt,
wer sich in der Landwirtschaft auskennt, da haben sich alle gemeldet. Der Bauer konnte sich dann aussuchen, wen er
mitnehmen wollte.
Wenn wir durch die Stadt zur Arbeit gingen, haben verschiedene Leute Fallobst in die Abfalleimer gelegt. Wenn das von
den Kameraden bemerkt wurde, schwenkten viele aus der Reihe, um sich etwas mit zunehmen, was von den Wachmannschaften
nicht gern gesehen wurde. Viele Kriegsgefangene hatten keine Schuhe mehr, sie haben die Füße nur mit Lumpen bewickelt.
Eines Tages kamen Kameraden aus Norwegen, die nach Deutschland entlassen werden sollten. Mann hat sie jedoch ins Lager
gesteckt und zur Arbeit eingeteilt. In Norwegen hatten sie Kleider und Stoffe eingekauft, hatten volle Seesäcke und
sogar Karren auf 2 Rädern, weil sie ja in die Heimat entlassen werden sollten. Als wir morgens zur Arbeit rausgeführt
wurden standen sie schon vor dem Lager. Wir haben ihnen zugerufen, dass sie uns etwas abgeben sollen, weil ihnen ja
sowieso alles abgenommen wird, aber sie haben uns nur ausgelacht. Als sie ins Lager Kamen mussten sie ihr Gepäck
ablegen, wurden dann wo anders hingeführt und haben es danach nie wieder gesehen.
Durch die vielen Läuse, Flöhe und Wanzen die wie im Lager hatten, kam es bei verschieden Kameraden, an den
Einstichstellen, zu eiternden Entzündungen. Um dem vorzubeugen hat man uns mit einem Pulver, das in Frankreich
hergestellt wurde, aber bei den Parasiten keine Wirkung zeigte, eingesprüht. Erst bei der Anwendung eines Mittels
amerikanischer Herkunft, war alles über Nacht verschwunden.
Der Sonntag war arbeitsfrei. Dann kam ein katholischer, französischer Pfarrer, eskortiert von 3 Mann, mit
aufgepflanztem Seitengewehr ins Lager und hat Gottesdienst gehalten. Einen evangelischen Pfarrer gab es nicht, nur
einen Baptisten Prediger. Der wurde würdevoll eingekleidet, bekam ein großes Kreuz und hat jeden Sonntag in einer
extra dafür hergerichteten Baracke Gottesdienst gehalten. Wer Theologie studiert hatte und sich meldete, wurde zu
einem Seminar geschickt und konnte sein Studium fortsetzen. Glasbläser durften das Lager auch verlassen und ihrem
erlernten Beruf wieder arbeiten.
Wer sich freiwillig, für 5 Jahre, zum Dienst in der Fremdenlegion verpflichtet hat, das waren etliche unter uns, wurde
neu eingekleidet, bekam gutes Essen und Rauchwaren soviel er wollte. Nach einem Jahr wurden, nach und nach, die
Kranken und Körperbehinderten in die Sowjetische Besatzungszone entlassen. Eine Entlassung von Kriegsgefangenen, die
in den Westzonen oder jenseits von Oder und Neise zu Hause waren, war nicht vorgesehen. Die Österreicher wurden alle,
unabhängig von ihrem Gesundheitszustand entlassen.
Ich habe Briefe nach Hause geschrieben, aber die kamen nur bis Allenstein und wurden wieder zurück geschickt. Als eine
Kommission des Roten Kreuzes aus der Schweiz unser Lager besichtigt hat, haben wir uns beschwert, das wir als
Sanitätsdienstgrade, zur Arbeit gehen müssen. Daraufhin erging ein Befehl: Wer einen vom Roten Kreuz, ausgestellten
Ausweis besitzt, gehört einem internationalen Verband an und braucht nicht zu Arbeit gehen. Aus unserem Lager hatten
sich 20 Mann gemeldet, die daraufhin Freigang, in Begleitung von zwei französischen Wachsoldaten erhielten. Als wir
gefragt wurden wo wir hin wollen, entschlossen wir uns, einen Soldatenfriedhof, auf dem unsere verstorbenen Kameraden
beerdigt waren, zu besuchen.
Da der Untergrund in dieser Gegend aus Felsen bestand, wurden die Gräben, in denen die Toten in selbst gezimmerten
Kisten nebeneinander gestellt wurden, mit Hilfe von Dynamit ausgehoben. Ein Leichenwagen, mit einem Pferd bespannt,
das mit einer schwarzen Decke abgedeckt war, wurde von einem Kutscher in angemessener Kleidung, gefahren. Der Wagen
konnte gleichzeitig 4 Kisten transportieren. Wenn wir von der Arbeit kommend, dem Leichenwagen begegneten, wurde
gehalten und mit einer Schweigeminute der Toten gedacht, bis der Wagen vorbei war. Die Zivilbevölkerung verharrte auch
im Schweigen, mit abgenommener Kopfbedeckung.
Ein Kamerad, der in Krottorf, Kreis Oschersleben, bei Magdeburg, zuhause war, sagte bei seiner Entlassung zu mir:
Sollte ich das Glück haben, meine Entlassungspapiere zu erhalten ohne eine Bleibe vorzuweisen, dann soll ich Krottorf
als Heimatadresse angeben. Auf der Krankenstube habe ich angegeben, dass sich noch ein Schrapnellsplitter, aus dem
Ersten Weltkrieg, in meiner Kreuzbeingegend befindet, er zwar verkapselt ist, aber immer noch Beschwerden verursacht.
Daraufhin wurde ich zur Entlassung vornotiert. Als bekannt wurde das ein Rückkehrertransport in die sowjetische
Besatzungszone zusammengestellt wird, habe ich mich sofort gemeldet und wurde für ein Entlassungslager in Angoleme
vorgesehen. War das eine Freude, als uns mitgeteilt wurde, wann der Rücktransport stattfindet.
In unserem Lager waren noch 2 Kameraden aus dem Kreis Ortelsburg: Ein Gustav Lumma aus Leynau und ein Alfred Moritz
aus Groß Schöndamerau. Sie mussten noch zurückbleiben und haben mir den Auftrag erteil, die Angehörigen in der Heimat
zu grüßen und ihnen die Anschrift mitzuteilen. Als wir im Entlassungslager ankamen, fragte man uns nach unserer
Heimatanschrift. Dann wurden die Entlassungspapiere angefertigt. Es wurde uns auch ein Barscheck, für die in Frankreich
geleistete Arbeit ausgehändigt, den wir bei jeder Kasse in Deutschland einlösen könnten. Ich habe ihn bis zum heutigen
Tage nicht einlösen können, obwohl ich irgendwann in der Zeitung gelesen habe, das Verrechnungschecks die den aus
französischer Kriegsgefangenschaft Entlassenen, ausgehändigt wurden, einzulösen sind.
Wir kamen zuerst nach Saar Elbe, dann in die Nähe der Zonengrenze zu Thüringen. Hier mussten wir 2 Tage warten, weil
aus der sowjetischen Besatzungszone keine Eisenbahnwagen bereitgestellt wurden. Angesichts dessen, das der Russe beim
letzten Transport die aus Frankreich kommenden Wagen kassiert und nicht mehr herausgeben wollte, bestand der Franzose
jetzt darauf, seine Wagen sofort wieder mitzunehmen. Als der sehnsüchtig erwartete Zug endlich eintraf, durften wir
umsteigen und kamen, immer noch hinter Stacheldraht, nach Erfurt. Von dort weiter ins Quarantänelager nach Prätsch an
der Elbe.
Unter Androhung von Strafe war es verboten das Lager zu verlassen, doch der Hunger zwang uns dazu, in den umliegenden
Dörfern um Lebensmittel zu betteln. Man drohte uns damit, dass Zuwiderhandlungen, mit einer 14-tägigen Verlängerung der
Quarantäne geahndet werden. Der Roggen war schon reif und wir haben, auf den umliegenden Feldern, die Ähren abgerissen,
das Korn, zwischen 2 Steinen zu Mehl zerrieben, um daraus eine Suppe zu kochen, denn von dem was unsere Lagerküche uns
bieten konnte, war es nicht möglich zu überleben. Als der Eigentümer bemerkte wer seine Roggenähren entwendet hat, kam
er ins Lager, gerade zu dem Zeitpunkt als wir mit dem Mahlen beschäftigt waren. Der Lagerkommandant, bei dem er sich
beschwerte, drohte uns zu bestrafen, wenn wir unsere „Rauzüge” nicht unmittelbar einstellen würden. Wir sagten ihm er
solle uns heimfahren lassen, da wir doch lange genug hinter Stacheldraht gesessen hätten.
Endlich wieder in Freiheit
14 Tage nach unserer Ankunft wurden uns Entlassungspapiere ausgehändigt, sowie auch Fahrscheine
zum den, von uns angegeben Heimatorten. So kam ich nach Krottof, Kreis Oschersleben, zu meinem ehemaligen
Kriegskameraden, bei dem ich einen Tag geblieben bin. Er hatte mir schon eine Stelle bei einem Bauern besorgt, der 70
Jahre alt und kinderlos war. Zum Hof, den er mit seiner Ehefrau bewirtschaftet hat, gehörten 36 Morgen Land, 2 Ochsen
und 3 Kühe. Das Ackerland bestand aus 17 Parzellen und sicherte mir einen Arbeitsplatz.
Jetzt, da ich ein Dach überm Kopf und genug zu essen hatte, fing ich an nach dem Verbleib meiner Familie zu forschen.
Bei meinem letzten Heimaturlaub hatte ich mit meiner Frau verabredet; falls wir uns in den Kriegswirren verlieren
sollten, unsere Kontaktadresse, die meiner Quartiersleute in Burscheid, Kreis Opladen, sein sollte. Ich habe zuerst
nach Rohmanen geschrieben, aber leider keine Antwort erhalten. Dann habe ich nach Burscheid geschrieben, und siehe, -
bei denen lag schon eine Anfrage meiner Frau vor, die nach mir gefragt, und ihre jetzige Anschrift hinterlassen hatte.
Ich habe dem Bauern erzählt dass meine Frau sich zurzeit, auf einem Gut, in Alt Steinhorst, im Kreis Rostock, befindet.
Er war sofort bereit uns ein Zimmer zur Verfügung zu stellen, wenn ich meine Frau nach Krottorf rüberholen wollte. Das
habe ich Ihr mitgeteilt und sie war sofort bereit ihren Wohnsitz nach Krottorf zu verlegen, denn sie wohnte dort in
einem kleinen Stübchen unterm Dach.
Im Herbst, als die Feldarbeit so ziemlich erledigt war, bin ich nach Alt Steinhorst gefahren, um meine Frau und meinen
Sohn Kurt, sowie meinen Sohn Manfred, den ich noch nicht kannte, weil er erst nach der Flucht, am 31. Januar, in Groß
Lüssewitz, geboren wurde, nach Krottorf zu holen. Meine Frau hatte schon Holz für den Winter besorgt und vom Gut, auf
dem sie im Sommer gearbeitet hatte, Mehl und Kartoffeln bekommen. Wir haben das Mehl und andere Habseligkeiten in
Kisten verpackt. Das Holz haben wir einem Bauern gegeben, der uns und unser Gepäck, mit seinem Pferdewagen, zum 14
Kilometer entfernten Bahnhof, nach Ribnitz gebracht hat. Wir sind auch gut in Krottorf angekommen, aber als wir am
nächsten Tag, unsere Kisten vom Bahnhof abholen wollten, haben wir zwar die Kisten vorgefunden, doch der gesamte Inhalt
wurde während der Bahnfahrt entwendet. Die Bahnstation in Krottorf hat die Vorkommnisse zur Kenntnis genommen und
protokolliert, aber unsere Sachen haben wir nie wieder gesehen und mussten wieder bei Null anfangen.
Im Winter musste ich auf der Genossenschaft, unentgeltlich, für die Russen Weizen einsacken. Ich hatte versucht eine
Arbeit als Zimmermann zu bekommen, doch auf dem Arbeitsamt wurde mir gesagt, ich bin Ladwirt und muss auf der
Landwirtschaft arbeiten. Da in den ersten Nachkriegsjahren, auch in der sowjetisch besetzten Zone Arbeitsplätze knapp
waren, mussten auch solche, die einen anderen Beruf erlernt hatten, jede zumutbare Arbeit annehmen. Aus der Heimat
erhielt ich einen Brief, von meiner dort noch lebenden Mutter. Sie schrieb das sie mich noch einmal sehen wollte und
ich sollte doch wieder zurück kommen; Unser Hof wäre nicht von Polen besetzt und sie wäre ganz alleine, weil der Vater
nach dem Durchzug der Front von den Russen erschlagen wurde. Daraufhin habe ich dem polnischen Konsulat in Magdeburg
mitgeteilt, dass ich in Rohmanen eine Landwirtschaft besitze, und um eine Einreisegenehmigung gebeten.
Nach 2 Monaten erhielt ich eine Postkarte, mit der Mitteilung, ich sollte mich persönlich beim Konsulat vorstellen.
Nach Aufnahme meiner Personalien, wurde mir gesagt, das ich benachrichtigt werde wenn mein Antrag genehmigt wird. Ende
Juli 1947 erhielten wir die Einreisegenehmigung nach Ostpreußen, das jetzt unter polnischer Verwaltung stand. Wir
mussten zuerst zum polnischen Konsulat in Berlin-Lichterfelde, wo wir umgeben von einer Trümmerlandschaft, gewartet
haben, bis alle Untersuchungen und Formalitäten erledigt waren.
“ Wieder zurück in Ostpreußen.”
Der schwere Wiederaufbau nach dem Kriege
Dann fuhren wir über Frankfurt/Oder, Posen, Thorn, Allenstein, nach Ortelsburg, wo wir am 2. August 1947 ankamen. Mit
einem zweirädrigen Karren, den ich mir von einem noch in Ortelsburg lebenden Bekanten ausgeliehen hatte und meinem
Sohn Manfred im Kinderwagen fuhren wir nach Rohmanen. Meine Mutter war inzwischen verstorben und auf dem Hof war nur
meine, inzwischen aus Russischer Gefangenschaft wiedergekehrte Schwester, Frieda Pelkowski.

Es war alles ausgeplündert; kein Vieh, keine Maschinen und der ganze Hof mit kniehohem Graß überwachsen. Nur schmale
Trampelpfade, vom Haus zum Holzschuppen und zum Klo, durchkreuzten das satte Grün. Ich habe das Gras auf dem Hof mit
einer Sense, die ich noch gefunden habe, abgemäht, damit der Hof nicht so verwahrlost aussah. Am nächsten Tag habe ich
mich bei der Polizei in Ortelsburg angemeldet, wo ich auch ein Startgeld von 100 Zloty erhielt und Gepäckstücke, die
ich in Krottorf aufgegeben, am Bahnhof abgeholt. Es hat mich sehr gewundert das, das Gepäck überhaupt angekommen ist.
Da man von der Landwirtschaft nicht Leben konnte, habe ich mich in den nächsten Tagen, bei der jetzt polnischen Bahn,
um Arbeit beworben und wurde auch angenommen. Wenn wir unseren Monatslohn bekamen, saß immer einer am Tisch, der von
uns 100 Zloty für den Wiederaufbau von Warschau verlangte. Wenn ich dran war, riefen die Anderen, ich hätte Warschau
zerstört und müsste deshalb 200 Zloty abgeben. Nach 3 Jahren kam eine Verfügung, die besagte, dass wer länger als 1
Jahr bei der Bahn beschäftigt ist, angestellt werden muss. Um diese Bestimmung zu umgehen hat man mich entlassen und
eine Woche später wieder eingestellt.
Als ich vor Ablauf des nächsten Jahres, aus dem gleichen Grunde wieder entlassen wurde, habe ich mich bei der
Stadtverwaltung in Ortelsburg(jetzt Szczytno)beworben, wo ich zuerst im Gaswerk als Heizer und später auf Baustellen
als Zimmermann gearbeitet habe. Wir haben durch den Krieg beschädigte Häuser repariert, in den ehemals touristischen
Zentren einige Ausbesserungen an den Einrichtungen durchgeführt, eine Ziegelei wieder in Betrieb gesetzt und andere
anfallende Arbeiten verrichtet. Im Dach des Rathausturmes war während der Kämpfe eine Granate eingeschlagen, die, die
Dachlatten und die Verschalung zerstört hatte. Da wir, unter schwersten Bedingungen, den Schaden repariert haben,
wurde uns eine Höhenzulage versprochen, die wir aber nicht bekommen haben.
Aus Verärgerung darüber habe ich bei der Stadtverwaltung gekündigt und bei einer Wiederaufbaufirma unter der Leitung
von Bauingenieur Laskowski wieder angefangen, wo ich bis 1954, als Zimmermann beschäftigt war. Ab da habe ich mich
nur um meinen Hof gekümmert, der wegen meiner Arbeitsstellen, gezwungenermaßen, sehr vernachlässigt wurde. Als wir
1947 zurückkamen, brachten wir unseren Sohn Manfred noch im Kinderwagen. Den hat meine Frau zum Markt gebracht,
verkauft, und dafür eine Ziege erworben, die dank guter Pflege, uns täglich mit 4 Liter Milch versorgte. Das war der
erste Baustein zum Wiederaufbau, unserer durch den Krieg zerstörten, und danach ausgeplünderten Landwirtschaft.
Während meiner Arbeit bei der Bahn haben wir uns eine Kuh gekauft, die nach einem halben Jahr, wegen nicht bezahlter
Grundsteuer, vom Gerichtsvollzieher gepfändet wurde. Man hat uns die Kuh weggenommen und bei einem Arbeiter, der in
der Ernst-Mey-Straße in Ortelsburg wohnte und sie wegen nicht vorhandener Futtermittel, nur mit Kartoffelkraut
gefüttert hat, untergestellt. Als ich bei der Bahn meinen Monatslohn bekommen habe, bin ich zur Gmina gegangen, habe
eine Rate angezahlt und durfte dann die Kuh wieder mit nach Hause nehmen. Durch die schlechte Ernährung war die Kuh
stark abgemagert und lieferte nur die Hälfte der ursprünglichen Milchleistung.
Später habe ich ein Pferd auf Abzahlung bekommen, das 140.000 alte Zloty gekostet hat. Die Stute war schwach und unser
Feld sehr hügelig, so dass man nur bergab pflügen konnte, was sehr beschwerlich war, bergauf ging es immer im Leerlauf.
Später habe ich die schweren Böden mit dem Traktor umpflügen, und in den letzten Jahren auch mit dem Binder mähen
lassen. Von der Stute habe ich 2 schöne Fohlen gezogen; ein davon habe ich bei der Ausreise in die Bundesrepublik
mitgebracht und bei der Viehverwertungs-Genossenschaft in Göttingen verkauft. In den ersten Nachkriegsjahren als noch
wenig Land bestellt wurde, breiteten sich auf den nicht beackerten Flächen, Wildkräuter aus. Disteln und andere
Schnellwachsende, erreichten manchmal eine Höhe von 2 Meter, besonders auf den schweren Böden.
Es hat viel Schweiß gekostet ehe man den Acker soweit hatte, das er auch befriedigende Erträge abwarf. Die
Währungsreform von 1950, hat unser weiniges Geld das wir schon gespart hatten, wieder vernichtet. Ich hatte 2 Pferde,
1 Fohlen, 2 Kühe und Schweine, als ich wieder aufgefordert wurde nicht bezahlte Grundsteuern nachzuzahlen. Als ich
nicht bezahlen konnte, hat der Vollziehungsbeamte, ein Fohlen, eine Kuh und ein Schwein gepfändet. Es gelang mir jedoch
nach längeren Verhandlungen, ohne größere Verluste, alles zu regeln. Später kam eine Verfügung, die besagte; wenn
jemand auf seinem Hof nur eine Kuh und ein Pferd hatte, durften sie nicht gepfändet werden. Einige haben ihr Inventar
dieser Verfügung angepasst und dadurch die Zahlung von Grundsteuer umgangen.

Wer seine Steuern pünktlich bezahlt und sein Kontingent an landwirtschaftlichen Produkten fristgerecht abgeliefert hat,
der konnte seine, darüber hinaus erwirtschafteten Produkte zu marktgerechten Preisen verkaufen. Für eine hochtragende
Sterke, mindestens 400 kg schwer, die auf ein staatliches Gut verkauft wurde, konnte man bis zu 12000 Zloty bekommen.
Unsere Böden waren kalkarm, doch durch den Einsatz von Kalk und Kunstdünger konnte man den Ertrag erheblich steigern.
Kalk und Kunstdünger konnte man bei der Genossenschaft(GS) bestellen, der dann auch direkt auf den Hof geliefert wurde.
Kalk wurde geliefert und gleich auf dem Feld ausgestreut. In den 1960ger Jahren waren alle Ackerflächen der Rohmaner
Felder bestellt.
Die nach dem Krieg zurückgebliebenen deutschen Bauernfamilien, aber auch die Polen, die während des Krieges beim Bauern
in Deutschland gearbeitet haben, versuchten mit teils bescheidenen, oder auch zusammen gesuchten, landwirtschaftlichen
Geräten, die bäuerlichen Betriebe aufrecht zu erhalten. Nach den schweren Anfängen in den ersten Nachkriegsjahren
erzielten sie schließlich einen beachtlichen Erfolg, der sich in wogenden Kornfeldern, sowie in grünen Wiesen auf
denen gut genährtes Vieh weidete, widerspiegelte.
Ein schwerer Einschnitt in meinem Leben.
Am 11. Mai 1956 verstarb nach langer schwerer Krankheit, meine liebe Ehefrau Marta Rattay,
geborene Brosch. Ein Jahr zuvor war schon mein Schwiegervater Gottlib Brosch verstorben. Die schweren Bedingungen
unter denen wir nach Kriegende leben mussten, haben ihrer bereits angegriffenen Gesundheit sehr zugesetzt. Sie
verstarb mit 44 Jahren und hinterließ in unserer Familie eine große Lücke, die nicht mehr zu Überbrücken war. Wir
haben sie unter großer Anteilnahme der noch verbliebenen deutschen Bevölkerung zu Grabe getragen und auf dem Rohmaner
Friedhof beigesetzt. Die Arbeit die sie sonst verrichtet hatte fiel jetzt auf mich und meine Söhne zurück. Meine
Schwester Frieda Pelkowski half auch wo sie nur konnte. Wir waren auf die Unterstützung durch Nachbarn und Freunde
angewiesen, die uns immer wenn es nötig war, tatkräftig unterstützt haben. Im laufe der Zeit haben wir wieder zum
Alltag zurück gefunden, haben sie noch etliche Jahre auf dem Friedhof besuchen können, bis wir, bedingt durch unsere
Ausreise uns endgültig von ihr trennen mussten.
Der endgültige Abschied von Ostpreußen
Ab 1956 begannen, durch die Vermittlung des Deutschen Roten Kreuzes, die ersten Ausreisen in die
Bundesrepublik Deutschland. Zuerst waren es Kinder die zu ihren Eltern ausreisen durften, Familien deren Väter aus der
Kriegsgefangenschaft in den Westen Deutschlands entlassen wurden und andere durch den Krieg getrennte
Familienangehörige. Ab 1960 erhöhte sich die Zahl der Ausreisewilligen aus dem polnisch besetzten Ostpreußen. Es setzte
sich die Überzeugung durch, dass unsere Angestammte Heimat, uns für die Zukunft keine Perspektive mehr bieten konnte.
Meistens wurden die Anträge, die wir an die Passabteilung in Allenstein stellen mussten, um einen Ausreisepass zu
bekommen, negativ beschieden. Nach mehrmaligen Versuchen gelang es dann doch, diese begehrte Ausreiseberechtigung in
Empfang zu nehmen. Die Enttäuschung der Zurückgebliebenen war groß, wenn wieder mal Verwandte oder Nachbarn, den Weg
in Richtung Bahnhof einschlugen.
Um einen Reisepass zu beantragen, musste man zuerst eine Einladung von Verwandten aus der Bundesrepublik vorlegen, in
der, diese sich verpflichten mussten, für Unterkunft und Verpflegung der Eingeladenen zu sorgen. Diese Einladung
musste durch ein Amt in der Bundesrepublik beglaubigt werden. Außerdem mussten die Kosten für die Bahnfahrt, ab
polnischer Grenze, bis zum Zielort, beim polnischen Reisebüro ORBIS, in Warschau, in DM eingezahlt werden.
Unseren ersten Ausreiseantrag haben wir 1964, bei der Kommandantur der polnischen Miliz in Allenstein eingereicht, der
nach einer gewissen Zeitspanne, ohne eine uns verständliche Begründung zu nennen, abgelehnt wurde. Gegen diese
Ablehnung wurde ein Widerspruch zugelassen, den wir sofort einreichten. Nach einer weiteren Zeitspanne erhielten wir
wieder eine Ablehnung, gegen die kein Widerspruch mehr zulässig war. Wer seine Ausreiseabsicht nicht aufgeben wollte,
musste einen neuen Antrag stellen. Es gab Familien die schon 10 Mal einen Ausreiseantrag gestellt hatten und immer
wieder abgewiesen wurden. Da meine Söhne, nicht die Absicht hatten in Rohmanen zu bleiben und ich nach 2 Weltkriegen,
an denen ich teilgenommen, die schwere Arbeit auf der Landwirtschaft, nicht aus eigener Kraft schaffen würde, haben wir
1966 wieder einen Antrag gestellt, der prompt abgelehnt wurde. Der Widerspruch auf diese Ablehnung wurde auch negativ
beantwortet, so dass wir 1968 wieder einen Antrag eingereicht haben.
Weil das Passamt in Allenstein lange nichts von sich hören ließ, hegten wir schon die Hoffnung das es jetzt klappen
würde und waren sehr enttäuscht als wieder eine Absage kam. In der Zwischenzeit sind viele Nachbarn und Bekannte aus
Rohmanen, sowie aus der näheren Umgebung, ausgereist und das Häuflein der noch verbliebenen Deutschen, wurde immer
kleiner. Die Motivation, die uns in früheren Jahren, über so manche schwierige Lage hinweg geholfen hat, ist einer
hoffnungslosen Resignation gewichen. Man war davon überzeugt, dass unser Leben, in unser Angestammten Heimat, keine
Zukunftsperspektive mehr haben konnte und wenn wir keine Ausreisegenehmigung bekommen, wir eines Tages die letzten
Deutschen in der ganzen Umgebung sein werden.
Die Ausreise-Heimat ade
Wir hatten die Hoffnung schon aufgegeben, als am 30. April 1969, der Briefträger unseren Hof
betrat und mir einen Brief überreichte, in dem uns das Passamt in Allenstein mitteilte, dass unsere Ausreise in die
Bundesrepublik Deutschland, genehmigt worden ist. Wir müssten, nach Aushändigung der Reisepapiere, den Geltungsbereich
der Volksrepublik Polen, innerhalb von 3 Monaten verlassen. Wir waren zuerst geschockt, über den Hinweis, das wir
unsere Heimat in 3 Monaten verlassen müssen, aber dann stellte sich die Zukunftsperspektive wieder ein und wir gingen,
wie von einem schweren Ballast befreit und gut gelaunt unser weiteren Tätigkeit nach.
Als der Briefträger unseren Hof betrat, waren ich und mein Sohn Kurt gerade dabei eine Fuhre Mist zu laden. Wir hatten
den Wagen gerade halb geladen und haben nach der frohen Kunde nicht mehr weiter gemacht, sondern die Pferde vorgespannt
und den Mist aufs Feld gefahren, damit wir den Wagen für alle Fälle frei hatten. Das war die letzte Tätigkeit für
unsere Landwirtschaft in Ostpreußen.
Die Nachricht von unserer Ausreise verbreitete sich, ohne dass wir darüber gesprochen haben, wie ein Lauffeuer.
Alsbald kamen Leute aus dem Dorf, die sich für das Vieh und für diverse Landwirtschaftliche Geräte interessierten.
Etliche wollten bestimmte Sachen sofort kaufen, andere haben nur zurücklegen lassen und wollten später kommen und
bezahlen, haben es aber dann doch nicht genommen.

Wenn man eine Landwirtschaft hatte, konnte man 2 Pferde, 2 Rinder, 3 Schweine, 5 Schafe und 10 Hühner, in einem
geschlossenen Viehwaggon, in die Bundesrepublik mitnehmen. Jeden Tag war man unterwegs, von einer Behörde zur Andern.
Die Aushändigung der Reisepapiere erfolgte nur nach Vorlage bestimmter Bescheinigungen: Es mussten alle Steuern bezahlt
sein, das Kontingent landwirtschaftlicher Erzeugnisse musste abgeliefert sein, je eine Bescheinigung vom Katasteramt
und vom Notar musste vorgelegt werden, das man dem polnischen Staat das Grundstück abgetreten hat. Die Gebühren für
die notarielle Beglaubigung mussten wir selbst bezahlen. Wenn man alle Bescheinigungen beisammen hatte, bekam man bei
der Kreisverwaltung eine Gesamtbescheinigung. Mit dieser Bescheinigung konnte man nach Allenstein, zur
Polizeikommandantur fahren, wo man nach dem schriftlichen Verzicht auf die polnische Staatsangehörigkeit, einen
Reisepass ausgehändigt bekam, der den Inhaber zum Grenzübertritt berechtigte, aber nicht zur Wiedereinreise.
Wir haben 2 Pferde, eine Sterke, einen Ochsen, 5 Schafe, 2 Schweine und 10 Hühner mitgenommen. Über die Schutzimpfung
der Rinder musste man eine, vom Kreistierarzt beglaubigte Bescheinigung vorweisen. Ich habe 5 Schafsböcke gekauft, die
ich in der Zwischenzeit, hinter der Scheune, zum Weiden angekettet hatte. Einer von denen hat sich losgerissen und
seinen Nachbarn getötet. Das Fleisch konnten wir noch verkaufen, mussten aber dafür einen anderen Schafsbock kaufen.
Innerhalb von 3 Monaten mussten wir alles regeln und zwei Tage vor der Abfahrt einen Eisenbahnwagen, bei der
Eisenbahndirektion in Allenstein bestellen. Reservierungen bei den polnischen Behörden waren meist immer mit
Schmiergeld verbunden, weil man sonst nie sicher sein konnte dass diese Vereinbarungen auch eingehalten werden. Schon
2 Wochen vor unserer Abfahrt, gab es in Ortelsburg keine alkoholischen Getränke zu kaufen. Meine Söhne mussten mit dem
Motorrad die umliegenden Dörfer abfahren, damit wir für die Reise einen Vorrat anlegen konnten; denn Wodka war zu der
Zeit, in Polen, wie eine zweite Währung.
Am 25. Juli haben wir zusammen, mit meinem Neffen Siegfried Brosch, unseren sonstigen Hausrat, der in Kisten verpackt
war, in einen Eisenbahnwagen, auf dem Allensteiner Bahnhof verladen. Alles musste zuerst durch den Zoll, wo die
Federbetten gewogen wurden und über das erlaubte hinausgehende Kissen, verzollt werden mussten. Dasselbe galt auch für
Fleisch und Räucherwaren.
Am 26. Juli, unserem Verladetag, kam der Eisenbahnwagen aus Allenstein, erst um 11 Uhr auf dem Ortelsburger Bahnhof an.
Die Rinder hatten wir zu Fuß, zum Bahnhof gebracht; Schweine, Schafe und Hühner auf dem Pferdewagen. Im Eisenbahnwagen
mussten, mit Hilfe von Brettern und Bohlen, Boxen für die verschiedenen Tiere erstellt werden. Jedes Pferd und jedes
Rind in eine Bucht. Die Schafe zwischen die Pferde, die Schweine zwischen die Rinder und die Hühner in einem Käfig,
unter der Decke über den Rindern. Die Hühner hatten unterwegs Eier gelegt, somit hatten wir jeden Tag frische
Verpflegung. Bei der Fahrt im Viehwagen, begleitete mich mein Sohn Manfred. Als die Lokomotive nahte, um den Wagen
abzuholen, wurden noch schnell die restlichen Sachen hinein geworfen und so mache Abschiedsträne rollte dann die Wange
hinab.
Unsere Nachbarn, Deutsche und Polen, halfen uns beim Verladen des lebendigen Inventars. Jetzt erinnerte ich mich
plötzlich, an die oft auch schönen, Ereignisse der letzten 22 Jahre. Einer Zeit, in der das Zusammenleben von
Deutschen und Polen, von Jahr zu Jahr, besser wurde. Man half sich beim einbringen der Getreideernte, beim Dreschen
des Getreides, bei der Kartoffelernte und bei anderen Arbeiten, wo viele Menschen zupacken mussten. Es war eine
Dorfgemeinschaft, in schweren Zeiten geboren; jeder half jedem wenn Hilfe nötig war. Es wurde mir plötzlich bewusst,
das jetzt ein Lebensabschnitt zu Ende ging, zu dem ich nicht mehr zurückkehren konnte. Unsere Existenzgrundlage war
jetzt ein Eisenbahnwagen auf einem Schienenstrang, dessen Ende irgendwo in weiter Ferne lag. Obwohl, von langer Hand
vorbereitet, war dieser Moment voller Wehmut.
Doch als der Zug sich plötzlich, in Bewegung setzte, war ich sofort wieder in der Gegenwart. Menschen, mit denen man
Jahrzehnte lang, in gutem Einvernehmen zusammen gelebt hat, blieben plötzlich am Bahnsteig zurück und die Entfernung
zwischen ihnen und mir vergrößerte sich mit jeder Sekunde, bis sie letztendlich aus meinem Blickfeld verschwanden.
Es war ein heißer Julitag, als wir unsere Reise gen Westen antraten. Für die Schweine, die besonders unter der Hitze
zu leiden hatten, haben wir 10 Flaschen Essig mitgenommen und sie von Zeit zu Zeit besprenkelt, damit sie besser atmen
konnten. Für die anderen Tiere war reichlich Heu und Hafer vorhanden. Eine großes Fas und zwei Milchkannen waren mit
Wasser gefüllt, die wir auf den an der Strecke liegenden Bahnstationen, bei Bedarf wieder nachgefüllt haben.
Da der Kreistierarzt nicht in seinem Büro war, konnten wir die Impfbescheinigung für das Vieh, nicht rechtzeitig
herbeischaffen. Der Zug setzte sich in Bewegung und die Bescheinigung war immer noch nicht da. Als die Bescheinigung
dann eingetroffen, wir aber schon unterwegs waren, ist mein Sohn Kurt mit dem Motorrad hinterher gefahren und hat uns
in Passenheim, wo der Zug noch andere Wagen angehängt bekam, die Impfbescheinigung übergeben. Wir waren sehr froh das
er es noch geschafft hat, denn in solch einer Situation fühlt man sich sicherer wenn man alle Bescheinigungen bei sich
hat. Auf der Rückfahrt, mit dem Motorrad hatte er noch eine Panne, musste das Motorrad stehen lassen und per Anhalter
nach Hause fahren. Am nächsten Tag kam er mit Siegfried Deptolla, der das Motorrad wieder flott machte und brachte es
wieder nach Rohmanen zurück.
Die Fahrt mit dem Viehwagen, gen Westen
Von Ortelsburg bis Allenstein(45 km) hat unser Zug 4 Stunden gebraucht, weil auf jedem Bahnhof
gehalten wurde, um neue Wagen anzuhängen. Nachdem wir in Allenstein angekommen waren, kam ein Rangierer und fragte
nach unserem Ziel. Als wir ihm mitteilten, das wir in die Bundesrepublik Deutschland wollen, sagte er nur: „In 10
Minuten fährt ein Zug los. Wenn ich von euch 500 Zloty und einen Liter Wodka bekomme, werde euch sofort anhängen,
andernfalls kommt ihr auf ein Nebengleis und müsst dann auf den nächsten Zug warten. Es blieb uns nichts anderes übrig
als seiner Forderung nachzukommen, denn über derartige Erpressungen hat man bereits von Anderen, die vor uns ausgereist
sind, gehört. Wir wurden auch sofort angehängt und fuhren dann die ganze Nacht, an Osterode, und Thorn vorbei bis
Gnesen. Dort wurde wieder rangiert.
Von einer Anhöhe wurden die einzelnen Wagen auf verschiedene Gleise verteilt und zu neuen Zügen zusammengestellt. Der
Aufprall der ungebremsten Wagen erzeugte eine derartige Erschütterung, dass manche Bretter an den Boxen geborsten waren.
Von Gnesen ging es dann in einem Zuge durch bis zur Grenzstation Reppen(Rzepin). Dort mussten wir zum Zollamt, wo
unsere Ausfuhrpapiere durch die Zollbeamten, und durch einen Tierarzt geprüft wurden. Bis Reppen(Rzepin) haben wir für
den Eisenbahnwagen 900 Zloty bezahlt; hier mussten wir noch einmal 650 Zloty bezahlen. Bei der Wagenkontrolle erklärte
uns ein Bahnbeamter das unser Wagen, sich nicht für den internationalen Transport eignet und wir deshalb den Inhalt in
einen Anderen umladen müssen, der irgendwann, auf dem Nebengleis bereitgestellt wird. Nach langer Verhandlung, sowie
einer Zulage von 500 Zloty und einem Liter Wodka haben wir ihn davon überzeugt, das der Wagen sich doch für die
Weiterfahrt eignet.
In der Nacht war Schichtwechsel, der unseren Wagen wieder abgehängt hat, weil er angeblich von der Reichsbahn der DDR,
wegen technischer Mängel nicht weiterbefördert würde. Wir mussten unsere Verhandlung vom Vorabend wiederholen, die mit
der Zusage endete, dass wir am frühen Morgen, über die Grenze auf DDR Gebiet, gebracht werden. Um 5 Uhr morgens kam
eine Lokomotive, die uns den letzten Abschnitt bis über die Grenze bringen sollte. Als der Zug hat noch einmal anhielt,
kamen polnische Grenzbeamte und Soldaten in den Wagen. Sie durchsuchten ihn und fragten, ob wir noch polnisches Geld
oder einen Grundbuchauszug bei uns hätten. Wir zeigten ihnen 800 Zloty, die sie uns, nach Ausstellung einer Quittung
über 500 Zloty, abnahmen. Die Grundbuchauszüge habe ich, im Stroh versteckt, dem Ochsen vor die Füße gelegt. Falls
jemand da suchen sollte, hätte ich gesagt, das das Tier bösartig veranlagt ist, und ich für seine Sicherheit nicht
garantieren könnte, deshalb sollte er vorsichtig sein.
Als die Grenzkontrolle den Zug verlassen hatte, setzte sich die Lokomotive wieder in Bewegung und überquerte nach
kurzer Zeit die Oderbrücke. Auf einer eingezäunten Fläche, jenseits der Grenze, hat man uns abgestellt hat und die
Lokomotive fuhr zurück auf polnisches Gebiet. Vor und hinter uns waren die Tore verschlossen. Auf den Wachtürmen,
links und Rechts von uns, standen Posten mit einem Gewehr im Anschlag. Vier Grenzbeamte der DDR, jeder mit einer
Leiter in der Hand, sowie ein Schäferhund, kamen zu unserem Wagen. Sie öffneten die Schiebetüre, stellten die Leiter
davor und ließen den Hund in den Wagen springen, der nur etwas herum schnupperte und wieder heraussprang. 2 Beamte
haben dann anschließend, die Papiere kontrolliert und das Inventar gezählt.
Nach einiger Zeit wurden wir an einen Güterzug der Reichsbahn angehängt und fuhren von Frankfurt an der Oder, vorbei
an Berlin, Ellingen und Nordhausen, über die Grenze zur Bundesrepublik bis Herzberg. Hier hat ein Zollbeamter der
Bundesrepublik, die Formalitäten erledigt und ein Tierarzt die Pferde, Rinder und Schweine gründlich untersucht. Ich
musste ihnen die Mäuler aufhalten und die Füße hochheben. Danach hat uns die Lokomotive zu einer Wasserzapfstelle
gebracht, wo wir die Tiere tränken und unsere Behälter mit Wasser auffüllen konnten. Anschließen fuhren wir über
Northeim nach Göttingen, zur Viehverwertungsgenossenschaft, die zuvor von unserer Ankunft in Kenntnis gesetzt wurde.
Der Ochse, die Sterke und die Schweine wurden, in Göttingen zum Schlachthof gebracht; die Pferde kamen nach Hannover
und die Schafsböcke nach Kassel. Wir waren mit dem Viehtransport 5 Tage unterwegs; hatten so manche Klippe umschifft
und Schwierigkeiten gemeistert, die im normalen Leben nicht vorkommen.
Wir wurden mit einem PKW, ins Durchgangslager Friedland bei Göttingen gefahren, wo mein Sohn Kurt, meine Schwester
Frieda Pelkowski und Siegfried Brosch mit Familie, die am 30 Juli, um 14 Uhr, von Warschau mit dem Zug abgefahren, und
hier am 31. Juli in den Morgenstunden eingetroffen sind, schon auf uns gewartet haben. In Friedland hat man uns mit
Familie Siegfried Brosch in einem Raum untergebracht, wir wurden registriert und erhielten 20 DM Überbrückungsgeld,
pro Person. Da wir erst am Freitag in Friedland eingetroffen sind, mussten wir hier über das Wochenende bleiben,
obwohl die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der Regel nur 3 bis 4 Tage beträgt.
Um einen Antrag für die Ausreise stellen zu können, brauchten wir eine Einladung von in der Bundesrepublik lebenden
Verwandten. Diese Einladung hat uns mein Bruder, Ernst Rattay, aus Ingelheim am Rhein zugeschickt. Ingelheim liegt im
Bundesland Rheinland-Pfalz. Das Geld für die Bahnfahrt, hat uns, Frieda Schellin, geb. Nickel, aus Duisburg, die
Tochter unseres Nachbarn, überwiesen. In Friedland wurden wir registriert. Im Registrierschein, war als unser
nächster Aufenthaltsort in der Bundesrepublik, das Durchgangslager Osthofen bei Worms, das alle Aussiedler für
Rheinland-Pfalz aufnehmen musste, eingetragen. Die Eintragung erfolgte deshalb, weil der Ort aus dem uns unsere
Einladung zugeschickt wurde, sich auch in Rheinland-Pfalz befand.
Da ich nach dem Polenfeldzug, als Soldat, ein Jahr im Kreis Opladen, im Rheinland gewesen bin, wäre ich sehr gerne in
diese Gegend gezogen, denn die Erinnerung an die schönen Tage die ich dort verlebt habe war in mir immer noch wach.
Ich versuchte die Eintragung in unseren Regiestierscheinen ändern zu lassen, was nach einigen, vielleicht auch
berechtigten Einwänden, am 4. August, vom Beauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen, genehmigt wurde. Anstelle von
Rheinlad-Pfalz stand da jetzt Nordrhein-Westfalen und am 7. August, fuhren wir, noch mit anderen Aussiedlern, ins
Durchgangslager Unna-Massen, am östlichen Rande des Ruhrgebietes gelegen. Hier wurden wir in einem Zimmer untergebracht
und konnten unser Essen in einer Gemeinschaftsküche zubereiten.
Am 8. August wurden wir in Unna-Massen, als Bürger der Bundesrepublik Deutschland registriert, erhielten
Einhundert DM Begrüßungsgeld, den Vertriebenen Ausweis -A -und 4 Wochen später den Bundespersonalausweis. In
Unna-Massen haben wir mehr als 4 Monate verbracht, weil mein Sohn Kurt, wegen fehlender Berufsausbildung, in Unna, an
einem Grundlehrgang für Metallarbeiter teilgenommen hat, der vom Arbeitsamt finanziert wurde. Am 11 Dezember 1969 sind
wir endlich an unserem vorläufigen Wohnsitz, im Durchgangswohnheim, an der Elisabethstraße 13, in Velbert angekommen.
Ab dem 5. Januar 1970 konnten meine Söhne, in der Zahnradfabrik Reining, in Velbert ihrer geregelten Arbeit nachgehen.
Von Bau- und Sparverein in Velbert wurde uns am 20. Juni 1970, unsere erste Wohnung zugewiesen.
Velbert im Februar 1972
gezeichnet: Gustav Rattay
Im Morgengrauen sah man viele Kosaken über die Felder reiten. Wir sind dann später wieder weiter in Richtung
Jellinowen gefahren. Unser Vater ist mit dem Pferdewagen die Landstraße entlang gefahren. Wir mit dem Vieh sind
entlang einer tiefen Schlucht durch den Wald bis zum Babanter See gegangen. Wir hatten schon vorher versucht die
Schlucht zu verlassen aber wegen der steilen Hänge ist es uns leider nicht gelungen. Am See angekommen fanden wir drei
große Schober mit Getreide vor. Von einem dieser Schober haben uns zwei Kosaken mit einem Fernglas beobachtet. Sie
schwangen sich auf ihre Pferde und kamen uns entgegen geritten, dann hielten sie uns ihre Lanzen vor die Brust und
versuchten uns auszufragen. Wir haben leider nichts verstanden und fingen an zu weinen. Plötzlich pfiff der
Patrollienführer auf einer Trillerpfeife und die Kosaken kehrten zu ihrem Ausgangspunkt zurück.
Als wir dann weiter am See entlang gingen sahen wir von weitem drei Gehöfte. In der Nähe einer dieser Höfe hatte unser
Vater den Pferdewagen im Gestrüpp abgestellt. Die vorrückenden Schützenlinien der russischen Infanterie hatten ihn
jedoch entdeckt. Sie haben den Wagen durchwühlt und den Sack mit Rauchfleisch mitgenommen. Andere Flüchtlingswagen die
in diesem Gebüsch Schutz gesucht haben sind nicht besser davon gekommen. Wir haben das Vieh auf einen der Höfe
getrieben und am Zaun festgebunden. Dann haben wir mit Hilfe einer Leiter den Heuboden erklommen und uns dort versteckt.
Als die Kosaken auf dem Hof erschienen verlangten sie Brot und Milch. Die Frauen mussten zuerst essen und trinken,
danach haben es die Russen auch getan, sie fürchteten sich davor, dass man sie vergiften könnte. Später kam dann die
russische Infanterie und hat Haus, Scheune und Schuppen durchsucht. Die Falltüre zum Heuboden ließ sich nur nach oben
hin öffnen. Wir hatten die Türe von oben mit schweren Gegenständen beschwert, aber die Russen versuchten mit aller
Gewalt auf den Heuboden zukommen. Als die Frauen das sahen, sagten sie zu den Russen, da oben würden sich ihre Kinder
versteckt halten. Die Russen forderten nun, die Kinder sollten sofort den Heuboden verlassen. Die Mütter riefen nun
nach ihren Kindern die dann auch tatsächlich den Heuboden verließen. Als wir das sahen, haben wir uns am Giebel tief
im Heu vergraben. Drei Russen kamen nun rauf und stocherten mit ihren Bajonetten im Heu herum. Glücklicherweise kamen
sie nicht in unsere Nähe. Als die Russen den Heuboden verließen haben wir befürchtet sie würden ihn in Brand setzen.
Wahrscheinlich taten sie deshalb nicht weil so viele russische Soldaten auf dem Hof waren. Einige Zeit später
erschienen russische Offiziere auf dem Hof, mit einem Auto. Sie sagten, sie hätten das Land erobert und wir hätten ab
sofort dem russischen Zaren zu gehorchen. Wir wurden angewiwsen nach Hause fahren und unbesorgt unsere Ernte
einzubringen. Sie haben uns auch eine Bescheinigung ausgestellt, damit uns auf dem Heimweg niemand die Pferde und
das Vieh wegnehmen würde.
Erst am nächsten Morgen, als die Front weiter vorgerückt war, beschlossen wir die Heimreise anzutreten. Die Straßen
waren mit vorrückenden russischen Truppen blockiert. Manchmal mussten wir stundenlang am Wegesrand warten bis die
Soldaten mit ihrem Tross vorbeigezogen waren. Unterwegs wollten sie unser Vieh zum Schlachten wegnehmen, aber die
Bescheinigung hat uns davor bewahrt. Die Eisenbahnbrücke vor Neu-Keykuth wurde von Kavallerie bewacht. Die wollten uns
nicht drüber lassen und hielten uns bis zum frühen Morgen fest. Zurück in Rohmanen angekommen, konnten wir unser Haus
nicht betreten weil der Hof und alles rundherum ein großes Militärlager war.
Wir sind dann in Richtung Seelonken gefahren, bis Abbau Brosch. Auf dem Hof angekommen haben wir zuerst Grünfutter für
die Pferde vom Feld geholt und anschließend Mittag für uns selbst gekocht. Die Nacht haben wir erstmal auf dem Hof
verbracht. Am nächsten Morgen wagten wir es ins Dorf zu gehen um die Lage zu erkunden. Die Russen waren schon wieder
weiter gezogen, aber Haus und Hof waren in einem schrecklichen Zustand. Wir sind dann gegen Abend wieder nach Hause
zurückgekehrt.
Am 23. August 1914 waren die Russen bei uns eingebrochen, bis sie am 28. August von den Deutschen zurückgeschlagen
wurden. Dann fuhren sie wieder zurück, drei Wagen nebeneinander. Ortelsburg brannte lichterloh. Ein Wagen mit Mehl war
uns gegenüber in den Straßengraben gekippt, aber wir haben nichts davon genommen, weil man ja nicht wusste ob man die
Nacht überleben würde. Wir saßen die ganze Zeit im Keller. Am nächsten Morgen zog dann russische Kavallerie und
Infanterie durch unser Dorf. Die Kavallerie ritt orientierungslos hin und her. Die Infanterie hat den ganzen
Vormittag 1,5 Meter tiefe Schützengräben ausgehoben. Um 11 Uhr kamen aus Richtung Eichtal 3 deutsche Spähwagen nicht
ahnend dass die nördliche Hälfte des Dorfes noch von Russen besetzt war. Wir haben zu diesem Zeitpunkt auf dem
Dachboden Weizen eingesackt und hatten aus diesem Grunde einen weiten Rundblick.
Um 11 Uhr kamen aus Richtung Eichtal drei deutsche Spähwagen angefahren. Als wir die deutschen Soldaten erkannt hatten,
haben wir sie durch Handzeichen gewarnt weiter nach Norden vorzustoßen. Die Kosaken hatten sich auf den Häuserdächern
positioniert und in Richtung Norden nach deutschen Truppen Ausschau gehalten. Die Deutschen sprangen von den Spähwagen
und fingen an die nichts ahnenden Russen zu beschießen. Als die sich ihrer gefährlichen Lage bewusst wurden verließen
sie ihre Aussichtsposten und bestiegen ihre Pferde. Mit Peitschenhieben versuchten sie, die sich in panikartiger Flucht
befindliche Infanterie dazu zu Bewegen, die Deutschen anzugreifen. Zwei Spähwagen wendeten sofort, der Dritte konnte
nicht mehr umkehren. Es gelang allen, bis auf den Fahrer des dritten Wagens die Flucht. Die Russen nahmen ihn sofort
unter Beschuss, doch es gelang ihm über unseren Hof zu entkommen. Auf der rückwärtigen Seite schlug er sich quer durch
die Gärten bis zum Gehöft von Friedrich Sakowski durch. Der versteckte ihn im Keller und versorgte ihn anschließend
mit Zivilkleidung.
Als die Russen den Soldaten auf unseren Hof laufen sahen nahmen sie sofort die Verfolgung auf. Sie durchstöberten auch
die Nachbarhäuser und trieben die Bewohner auf der Straße zusammen. An der Spritzenwagenremise richteten sie einen
Sammelpunkt ein. Unter dem Vorwand es würde hier eine Schlacht stattfinden, versuchten die Russen die Zivilbevölkerung
aus dem Dorf zu drängen. Alle die dem Aufruf gefolgt sind und an unserer Sammelstelle vorbeikamen wurden unserem Haufen
hinzugefügt. Unter ihnen befand sich auch der deutsche Soldat in Zivilkleidung. Er hatte einen Sack über die Schulter
geschlagen in dem sich ein Brot befand, an der anderen Hand führte er eine Kuh am Strick. Als unser Haufen schon aus
etwa 50 Leuten bestand setzten uns die Russen mit Marschrichtung Seelonken in Bewegung. Wir Jungen versuchten in einem
unbeaufsichtigten Moment wegzulaufen, doch die Begleitmanschaft prügelte uns mit Gewehrkolben wieder in Reihe und Glied.
Unterwegs gelang es dem Soldaten mit der Kuh unbemerkt zu entkommen. Er kehrte unbehelligt ins Dorf zurück und lieferte
die Kuh wieder dort ab wo er sie entführt hatte.
Uns haben die Russen an Seelonken vorbei zum Sylvensee getrieben. Wenn sie von vorbeiziehenden russischen Offizieren
gefragt wurden weshalb wir unterwegs wären, sagten sie denen wir hätten deutsche Soldaten versteckt und wollten das
Versteck nicht verraten. Als wir am See vorbei waren begann die deutsche Artillerie aus Richtung Ortelsburg zu
schießen. Unweit von uns explodierten Granaten und richten ein großes Chaos unter Freund und Feind an. Es hieß dann
rette sich wer kann. Die Russen verließen uns in Richtung Waldpuschsee und wir kehrten orientierungslos nach Seelonken
zurück. Nach Rohmanen konnten wir nicht zurück weil die deutsche Artillerie aus Richtung Eichtal anfing unser Dorf zu
beschießen. Schließlich sind wir auf dem Abbau Brosch untergekommen. Ein durch Granatsplitter schwer verletzter Russe
suchte dort auch Zuflucht. er versucht sich mit einem Messer das Leben zu nehmen. es gelang den Frauen ihn davon
abzubringen, weil sonst bei einem etwaigen erscheinen von russischen Soldaten der Verdacht auf uns gefallen wäre.
Später erschienen tatsächlich Kosaken die ihn dann mitgenommen haben. Ihnen folgten in 50 Meter Entfernung Deutsche
Ulanen, die hinter den Russen in einem in der Nähe liegenden Wäldchen verschwanden.
Nachdem die Russen Rohmanen besetzt hatten, versteckten sie sich vorwiegend in mit Stroh gedeckten Gebäuden. Durch
Schießscharten, die sie im Strohdach anlegten, schossen sie auf die deutschen Kampfverbände, die sie wieder vertreiben
wollten. Um die Angreifer zu entlasten, wunde das Dorf von deutscher Seite unter Beschuss genommen. Durch die
Geschosse der deutschen Artillerie entstanden in Rohmanen viele Brände. Die mit Stroh gedeckten Gebäude fielen zuerst
in Schutt und Asche. Unser Vater hatte uns ins Dorf geschickt, damit wir das Vieh im Stall von der Kette losbinden
sollten. Am Dorfrand kamen uns schon deutsche Ulanen und Husaren entgegen. Rohmanen brannte an mehreren Stellen. Unser
Hof war noch unversehrt, nur die Zäune standen schon in Flammen. Wir haben das Vieh los gebunden und anschließend
versucht die Brandherde rund herum zu löschen. Es gelang uns die Flammen von unserem Hof fernzuhalten und auch bei
unserem Nachbarn einzugreifen. In vielen Scheunen und Ställen hatten sich noch viele versprengte Russen versteckt. Die
wurden anschließend von deutschen Soldaten eingesammelt und in Gefangenenlager abgeführt. Am nächste Tag haben wir dann
zerbrochene Gewehre und Munition in Körbe gesammelt und im Dorfteich versenkt.
Am 29. August haben die Russen Rohmanen verlassen, doch schon am 30. August sind sie wieder zurückgekehrt. Hauptlehrer
Müller wurde mit seinem Sohn und Karl Deptolla auf Fahrrädern fahrend von einer russischen Patrouille aufgegriffen.
Sie wurden von den Russen der Spionage verdächtigt weil der Lehrer Müller ein Fernglas bei sich trug. Der Sohn hatte
eine Gymnasiastenmütze und eine Landkarte bei sich. Sie wurden in Richtung Lehmanen abgeführt. Auf einer Anhöhe des
Grundstücks von Ernst Chittka befand sich eine nicht mehr betriebstaugliche Windmühle. Dort soll ein russisches
Kriegsgericht sie zum Tode verurteilt haben. Nach der Hinrichtung wurden sie in der Nähe der Windmühle verscharrt.
Später wurden sie wieder ausgegraben, in Särge gelegt und auf dem Rohmaner Friedhof beigesetzt. Die Ehefrau von Lehrer
Müller hat die Gräber nach dem 1. Weltkrieg mit einem schmiedeeisernen Zaun umrandet.
Die Kämpfe um Rohmanen haben viele Menschenopfer gekostet. Bei uns hinter der Scheune lagen 2 tote Russen und ein
Verwundeter. Die Toten haben wir in einer Kartoffelmiete vergraben. Alle anderen Gefallenen wurden auch gleich an der
Stelle an der sie zu Tode kamen verscharrt und mit einem Kreuz gekennzeichnet. Für die im Raum Rohmanen gefallenen
Russen wurde nach dem Krieg hinterm Dorf, in Richtung Ortelsburg, auf einer Anhöhe ein Heldenfriedhof angelegt. Dort
liegen 20 Soldaten und 1 Offizier. In der Mitte befindet sich ein Trauerbaum und Birken säumen den Zugang von der
Landstraße her. Der Lehrer Dorka hat nach dem Kriege, mit seinen Schülern immer die Gräber gepflegt.
Als die Kosaken auf dem Hof erschienen verlangten sie Brot und Milch. Die Frauen mussten zuerst essen und trinken,
danach haben es die Russen auch getan, sie fürchteten sich davor, dass man sie vergiften könnte. Später kam dann die
russische Infanterie und hat Haus, Scheune und Schuppen durchsucht. Die Falltüre zum Heuboden ließ sich nur nach oben
hin öffnen. Wir hatten die Türe von oben mit schweren Gegenständen beschwert, aber die Russen versuchten mit aller
Gewalt auf den Heuboden zukommen. Als die Frauen das sahen, sagten sie zu den Russen, da oben würden sich ihre Kinder
versteckt halten. Die Russen forderten nun, die Kinder sollten sofort den Heuboden verlassen. Die Mütter riefen nun
nach ihren Kindern die dann auch tatsächlich den Heuboden verließen. Als wir das sahen, haben wir uns am Giebel tief
im Heu vergraben. Drei Russen kamen nun rauf und stocherten mit ihren Bajonetten im Heu herum. Glücklicherweise kamen
sie nicht in unsere Nähe. Als die Russen den Heuboden verließen haben wir befürchtet sie würden ihn in Brand setzen.
Wahrscheinlich taten sie deshalb nicht weil so viele russische Soldaten auf dem Hof waren. Einige Zeit später
erschienen russische Offiziere auf dem Hof, mit einem Auto. Sie sagten, sie hätten das Land erobert und wir hätten ab
sofort dem russischen Zaren zu gehorchen. Wir wurden angewiwsen nach Hause fahren und unbesorgt unsere Ernte
einzubringen. Sie haben uns auch eine Bescheinigung ausgestellt, damit uns auf dem Heimweg niemand die Pferde und
das Vieh wegnehmen würde.
Erst am nächsten Morgen, als die Front weiter vorgerückt war, beschlossen wir die Heimreise anzutreten. Die Straßen
waren mit vorrückenden russischen Truppen blockiert. Manchmal mussten wir stundenlang am Wegesrand warten bis die
Soldaten mit ihrem Tross vorbeigezogen waren. Unterwegs wollten sie unser Vieh zum Schlachten wegnehmen, aber die
Bescheinigung hat uns davor bewahrt. Die Eisenbahnbrücke vor Neu-Keykuth wurde von Kavallerie bewacht. Die wollten uns
nicht drüber lassen und hielten uns bis zum frühen Morgen fest. Zurück in Rohmanen angekommen, konnten wir unser Haus
nicht betreten weil der Hof und alles rundherum ein großes Militärlager war.
Wir sind dann in Richtung Seelonken gefahren, bis Abbau Brosch. Auf dem Hof angekommen haben wir zuerst Grünfutter für
die Pferde vom Feld geholt und anschließend Mittag für uns selbst gekocht. Die Nacht haben wir erstmal auf dem Hof
verbracht. Am nächsten Morgen wagten wir es ins Dorf zu gehen um die Lage zu erkunden. Die Russen waren schon wieder
weiter gezogen, aber Haus und Hof waren in einem schrecklichen Zustand. Wir sind dann gegen Abend wieder nach Hause
zurückgekehrt.
Am 23. August 1914 waren die Russen bei uns eingebrochen, bis sie am 28. August von den Deutschen zurückgeschlagen
wurden. Dann fuhren sie wieder zurück, drei Wagen nebeneinander. Ortelsburg brannte lichterloh. Ein Wagen mit Mehl war
uns gegenüber in den Straßengraben gekippt, aber wir haben nichts davon genommen, weil man ja nicht wusste ob man die
Nacht überleben würde. Wir saßen die ganze Zeit im Keller. Am nächsten Morgen zog dann russische Kavallerie und
Infanterie durch unser Dorf. Die Kavallerie ritt orientierungslos hin und her. Die Infanterie hat den ganzen
Vormittag 1,5 Meter tiefe Schützengräben ausgehoben. Um 11 Uhr kamen aus Richtung Eichtal 3 deutsche Spähwagen nicht
ahnend dass die nördliche Hälfte des Dorfes noch von Russen besetzt war. Wir haben zu diesem Zeitpunkt auf dem
Dachboden Weizen eingesackt und hatten aus diesem Grunde einen weiten Rundblick.
Um 11 Uhr kamen aus Richtung Eichtal drei deutsche Spähwagen angefahren. Als wir die deutschen Soldaten erkannt hatten,
haben wir sie durch Handzeichen gewarnt weiter nach Norden vorzustoßen. Die Kosaken hatten sich auf den Häuserdächern
positioniert und in Richtung Norden nach deutschen Truppen Ausschau gehalten. Die Deutschen sprangen von den Spähwagen
und fingen an die nichts ahnenden Russen zu beschießen. Als die sich ihrer gefährlichen Lage bewusst wurden verließen
sie ihre Aussichtsposten und bestiegen ihre Pferde. Mit Peitschenhieben versuchten sie, die sich in panikartiger Flucht
befindliche Infanterie dazu zu Bewegen, die Deutschen anzugreifen. Zwei Spähwagen wendeten sofort, der Dritte konnte
nicht mehr umkehren. Es gelang allen, bis auf den Fahrer des dritten Wagens die Flucht. Die Russen nahmen ihn sofort
unter Beschuss, doch es gelang ihm über unseren Hof zu entkommen. Auf der rückwärtigen Seite schlug er sich quer durch
die Gärten bis zum Gehöft von Friedrich Sakowski durch. Der versteckte ihn im Keller und versorgte ihn anschließend
mit Zivilkleidung.
Als die Russen den Soldaten auf unseren Hof laufen sahen nahmen sie sofort die Verfolgung auf. Sie durchstöberten auch
die Nachbarhäuser und trieben die Bewohner auf der Straße zusammen. An der Spritzenwagenremise richteten sie einen
Sammelpunkt ein. Unter dem Vorwand es würde hier eine Schlacht stattfinden, versuchten die Russen die Zivilbevölkerung
aus dem Dorf zu drängen. Alle die dem Aufruf gefolgt sind und an unserer Sammelstelle vorbeikamen wurden unserem Haufen
hinzugefügt. Unter ihnen befand sich auch der deutsche Soldat in Zivilkleidung. Er hatte einen Sack über die Schulter
geschlagen in dem sich ein Brot befand, an der anderen Hand führte er eine Kuh am Strick. Als unser Haufen schon aus
etwa 50 Leuten bestand setzten uns die Russen mit Marschrichtung Seelonken in Bewegung. Wir Jungen versuchten in einem
unbeaufsichtigten Moment wegzulaufen, doch die Begleitmanschaft prügelte uns mit Gewehrkolben wieder in Reihe und Glied.
Unterwegs gelang es dem Soldaten mit der Kuh unbemerkt zu entkommen. Er kehrte unbehelligt ins Dorf zurück und lieferte
die Kuh wieder dort ab wo er sie entführt hatte.
Uns haben die Russen an Seelonken vorbei zum Sylvensee getrieben. Wenn sie von vorbeiziehenden russischen Offizieren
gefragt wurden weshalb wir unterwegs wären, sagten sie denen wir hätten deutsche Soldaten versteckt und wollten das
Versteck nicht verraten. Als wir am See vorbei waren begann die deutsche Artillerie aus Richtung Ortelsburg zu
schießen. Unweit von uns explodierten Granaten und richten ein großes Chaos unter Freund und Feind an. Es hieß dann
rette sich wer kann. Die Russen verließen uns in Richtung Waldpuschsee und wir kehrten orientierungslos nach Seelonken
zurück. Nach Rohmanen konnten wir nicht zurück weil die deutsche Artillerie aus Richtung Eichtal anfing unser Dorf zu
beschießen. Schließlich sind wir auf dem Abbau Brosch untergekommen. Ein durch Granatsplitter schwer verletzter Russe
suchte dort auch Zuflucht. er versucht sich mit einem Messer das Leben zu nehmen. es gelang den Frauen ihn davon
abzubringen, weil sonst bei einem etwaigen erscheinen von russischen Soldaten der Verdacht auf uns gefallen wäre.
Später erschienen tatsächlich Kosaken die ihn dann mitgenommen haben. Ihnen folgten in 50 Meter Entfernung Deutsche
Ulanen, die hinter den Russen in einem in der Nähe liegenden Wäldchen verschwanden.
Nachdem die Russen Rohmanen besetzt hatten, versteckten sie sich vorwiegend in mit Stroh gedeckten Gebäuden. Durch
Schießscharten, die sie im Strohdach anlegten, schossen sie auf die deutschen Kampfverbände, die sie wieder vertreiben
wollten. Um die Angreifer zu entlasten, wunde das Dorf von deutscher Seite unter Beschuss genommen. Durch die
Geschosse der deutschen Artillerie entstanden in Rohmanen viele Brände. Die mit Stroh gedeckten Gebäude fielen zuerst
in Schutt und Asche. Unser Vater hatte uns ins Dorf geschickt, damit wir das Vieh im Stall von der Kette losbinden
sollten. Am Dorfrand kamen uns schon deutsche Ulanen und Husaren entgegen. Rohmanen brannte an mehreren Stellen. Unser
Hof war noch unversehrt, nur die Zäune standen schon in Flammen. Wir haben das Vieh los gebunden und anschließend
versucht die Brandherde rund herum zu löschen. Es gelang uns die Flammen von unserem Hof fernzuhalten und auch bei
unserem Nachbarn einzugreifen. In vielen Scheunen und Ställen hatten sich noch viele versprengte Russen versteckt. Die
wurden anschließend von deutschen Soldaten eingesammelt und in Gefangenenlager abgeführt. Am nächste Tag haben wir dann
zerbrochene Gewehre und Munition in Körbe gesammelt und im Dorfteich versenkt.
Am 29. August haben die Russen Rohmanen verlassen, doch schon am 30. August sind sie wieder zurückgekehrt. Hauptlehrer
Müller wurde mit seinem Sohn und Karl Deptolla auf Fahrrädern fahrend von einer russischen Patrouille aufgegriffen.
Sie wurden von den Russen der Spionage verdächtigt weil der Lehrer Müller ein Fernglas bei sich trug. Der Sohn hatte
eine Gymnasiastenmütze und eine Landkarte bei sich. Sie wurden in Richtung Lehmanen abgeführt. Auf einer Anhöhe des
Grundstücks von Ernst Chittka befand sich eine nicht mehr betriebstaugliche Windmühle. Dort soll ein russisches
Kriegsgericht sie zum Tode verurteilt haben. Nach der Hinrichtung wurden sie in der Nähe der Windmühle verscharrt.
Später wurden sie wieder ausgegraben, in Särge gelegt und auf dem Rohmaner Friedhof beigesetzt. Die Ehefrau von Lehrer
Müller hat die Gräber nach dem 1. Weltkrieg mit einem schmiedeeisernen Zaun umrandet.
Die Kämpfe um Rohmanen haben viele Menschenopfer gekostet. Bei uns hinter der Scheune lagen 2 tote Russen und ein
Verwundeter. Die Toten haben wir in einer Kartoffelmiete vergraben. Alle anderen Gefallenen wurden auch gleich an der
Stelle an der sie zu Tode kamen verscharrt und mit einem Kreuz gekennzeichnet. Für die im Raum Rohmanen gefallenen
Russen wurde nach dem Krieg hinterm Dorf, in Richtung Ortelsburg, auf einer Anhöhe ein Heldenfriedhof angelegt. Dort
liegen 20 Soldaten und 1 Offizier. In der Mitte befindet sich ein Trauerbaum und Birken säumen den Zugang von der
Landstraße her. Der Lehrer Dorka hat nach dem Kriege, mit seinen Schülern immer die Gräber gepflegt.
Wir sind dann in Richtung Seelonken gefahren, bis Abbau Brosch. Auf dem Hof angekommen haben wir zuerst Grünfutter für
die Pferde vom Feld geholt und anschließend Mittag für uns selbst gekocht. Die Nacht haben wir erstmal auf dem Hof
verbracht. Am nächsten Morgen wagten wir es ins Dorf zu gehen um die Lage zu erkunden. Die Russen waren schon wieder
weiter gezogen, aber Haus und Hof waren in einem schrecklichen Zustand. Wir sind dann gegen Abend wieder nach Hause
zurückgekehrt.
Am 23. August 1914 waren die Russen bei uns eingebrochen, bis sie am 28. August von den Deutschen zurückgeschlagen
wurden. Dann fuhren sie wieder zurück, drei Wagen nebeneinander. Ortelsburg brannte lichterloh. Ein Wagen mit Mehl war
uns gegenüber in den Straßengraben gekippt, aber wir haben nichts davon genommen, weil man ja nicht wusste ob man die
Nacht überleben würde. Wir saßen die ganze Zeit im Keller. Am nächsten Morgen zog dann russische Kavallerie und
Infanterie durch unser Dorf. Die Kavallerie ritt orientierungslos hin und her. Die Infanterie hat den ganzen
Vormittag 1,5 Meter tiefe Schützengräben ausgehoben. Um 11 Uhr kamen aus Richtung Eichtal 3 deutsche Spähwagen nicht
ahnend dass die nördliche Hälfte des Dorfes noch von Russen besetzt war. Wir haben zu diesem Zeitpunkt auf dem
Dachboden Weizen eingesackt und hatten aus diesem Grunde einen weiten Rundblick.
Um 11 Uhr kamen aus Richtung Eichtal drei deutsche Spähwagen angefahren. Als wir die deutschen Soldaten erkannt hatten,
haben wir sie durch Handzeichen gewarnt weiter nach Norden vorzustoßen. Die Kosaken hatten sich auf den Häuserdächern
positioniert und in Richtung Norden nach deutschen Truppen Ausschau gehalten. Die Deutschen sprangen von den Spähwagen
und fingen an die nichts ahnenden Russen zu beschießen. Als die sich ihrer gefährlichen Lage bewusst wurden verließen
sie ihre Aussichtsposten und bestiegen ihre Pferde. Mit Peitschenhieben versuchten sie, die sich in panikartiger Flucht
befindliche Infanterie dazu zu Bewegen, die Deutschen anzugreifen. Zwei Spähwagen wendeten sofort, der Dritte konnte
nicht mehr umkehren. Es gelang allen, bis auf den Fahrer des dritten Wagens die Flucht. Die Russen nahmen ihn sofort
unter Beschuss, doch es gelang ihm über unseren Hof zu entkommen. Auf der rückwärtigen Seite schlug er sich quer durch
die Gärten bis zum Gehöft von Friedrich Sakowski durch. Der versteckte ihn im Keller und versorgte ihn anschließend
mit Zivilkleidung.
Als die Russen den Soldaten auf unseren Hof laufen sahen nahmen sie sofort die Verfolgung auf. Sie durchstöberten auch
die Nachbarhäuser und trieben die Bewohner auf der Straße zusammen. An der Spritzenwagenremise richteten sie einen
Sammelpunkt ein. Unter dem Vorwand es würde hier eine Schlacht stattfinden, versuchten die Russen die Zivilbevölkerung
aus dem Dorf zu drängen. Alle die dem Aufruf gefolgt sind und an unserer Sammelstelle vorbeikamen wurden unserem Haufen
hinzugefügt. Unter ihnen befand sich auch der deutsche Soldat in Zivilkleidung. Er hatte einen Sack über die Schulter
geschlagen in dem sich ein Brot befand, an der anderen Hand führte er eine Kuh am Strick. Als unser Haufen schon aus
etwa 50 Leuten bestand setzten uns die Russen mit Marschrichtung Seelonken in Bewegung. Wir Jungen versuchten in einem
unbeaufsichtigten Moment wegzulaufen, doch die Begleitmanschaft prügelte uns mit Gewehrkolben wieder in Reihe und Glied.
Unterwegs gelang es dem Soldaten mit der Kuh unbemerkt zu entkommen. Er kehrte unbehelligt ins Dorf zurück und lieferte
die Kuh wieder dort ab wo er sie entführt hatte.
Uns haben die Russen an Seelonken vorbei zum Sylvensee getrieben. Wenn sie von vorbeiziehenden russischen Offizieren
gefragt wurden weshalb wir unterwegs wären, sagten sie denen wir hätten deutsche Soldaten versteckt und wollten das
Versteck nicht verraten. Als wir am See vorbei waren begann die deutsche Artillerie aus Richtung Ortelsburg zu
schießen. Unweit von uns explodierten Granaten und richten ein großes Chaos unter Freund und Feind an. Es hieß dann
rette sich wer kann. Die Russen verließen uns in Richtung Waldpuschsee und wir kehrten orientierungslos nach Seelonken
zurück. Nach Rohmanen konnten wir nicht zurück weil die deutsche Artillerie aus Richtung Eichtal anfing unser Dorf zu
beschießen. Schließlich sind wir auf dem Abbau Brosch untergekommen. Ein durch Granatsplitter schwer verletzter Russe
suchte dort auch Zuflucht. er versucht sich mit einem Messer das Leben zu nehmen. es gelang den Frauen ihn davon
abzubringen, weil sonst bei einem etwaigen erscheinen von russischen Soldaten der Verdacht auf uns gefallen wäre.
Später erschienen tatsächlich Kosaken die ihn dann mitgenommen haben. Ihnen folgten in 50 Meter Entfernung Deutsche
Ulanen, die hinter den Russen in einem in der Nähe liegenden Wäldchen verschwanden.
Nachdem die Russen Rohmanen besetzt hatten, versteckten sie sich vorwiegend in mit Stroh gedeckten Gebäuden. Durch
Schießscharten, die sie im Strohdach anlegten, schossen sie auf die deutschen Kampfverbände, die sie wieder vertreiben
wollten. Um die Angreifer zu entlasten, wunde das Dorf von deutscher Seite unter Beschuss genommen. Durch die
Geschosse der deutschen Artillerie entstanden in Rohmanen viele Brände. Die mit Stroh gedeckten Gebäude fielen zuerst
in Schutt und Asche. Unser Vater hatte uns ins Dorf geschickt, damit wir das Vieh im Stall von der Kette losbinden
sollten. Am Dorfrand kamen uns schon deutsche Ulanen und Husaren entgegen. Rohmanen brannte an mehreren Stellen. Unser
Hof war noch unversehrt, nur die Zäune standen schon in Flammen. Wir haben das Vieh los gebunden und anschließend
versucht die Brandherde rund herum zu löschen. Es gelang uns die Flammen von unserem Hof fernzuhalten und auch bei
unserem Nachbarn einzugreifen. In vielen Scheunen und Ställen hatten sich noch viele versprengte Russen versteckt. Die
wurden anschließend von deutschen Soldaten eingesammelt und in Gefangenenlager abgeführt. Am nächste Tag haben wir dann
zerbrochene Gewehre und Munition in Körbe gesammelt und im Dorfteich versenkt.
Am 29. August haben die Russen Rohmanen verlassen, doch schon am 30. August sind sie wieder zurückgekehrt. Hauptlehrer
Müller wurde mit seinem Sohn und Karl Deptolla auf Fahrrädern fahrend von einer russischen Patrouille aufgegriffen.
Sie wurden von den Russen der Spionage verdächtigt weil der Lehrer Müller ein Fernglas bei sich trug. Der Sohn hatte
eine Gymnasiastenmütze und eine Landkarte bei sich. Sie wurden in Richtung Lehmanen abgeführt. Auf einer Anhöhe des
Grundstücks von Ernst Chittka befand sich eine nicht mehr betriebstaugliche Windmühle. Dort soll ein russisches
Kriegsgericht sie zum Tode verurteilt haben. Nach der Hinrichtung wurden sie in der Nähe der Windmühle verscharrt.
Später wurden sie wieder ausgegraben, in Särge gelegt und auf dem Rohmaner Friedhof beigesetzt. Die Ehefrau von Lehrer
Müller hat die Gräber nach dem 1. Weltkrieg mit einem schmiedeeisernen Zaun umrandet.
Die Kämpfe um Rohmanen haben viele Menschenopfer gekostet. Bei uns hinter der Scheune lagen 2 tote Russen und ein
Verwundeter. Die Toten haben wir in einer Kartoffelmiete vergraben. Alle anderen Gefallenen wurden auch gleich an der
Stelle an der sie zu Tode kamen verscharrt und mit einem Kreuz gekennzeichnet. Für die im Raum Rohmanen gefallenen
Russen wurde nach dem Krieg hinterm Dorf, in Richtung Ortelsburg, auf einer Anhöhe ein Heldenfriedhof angelegt. Dort
liegen 20 Soldaten und 1 Offizier. In der Mitte befindet sich ein Trauerbaum und Birken säumen den Zugang von der
Landstraße her. Der Lehrer Dorka hat nach dem Kriege, mit seinen Schülern immer die Gräber gepflegt.
Um 11 Uhr kamen aus Richtung Eichtal drei deutsche Spähwagen angefahren. Als wir die deutschen Soldaten erkannt hatten,
haben wir sie durch Handzeichen gewarnt weiter nach Norden vorzustoßen. Die Kosaken hatten sich auf den Häuserdächern
positioniert und in Richtung Norden nach deutschen Truppen Ausschau gehalten. Die Deutschen sprangen von den Spähwagen
und fingen an die nichts ahnenden Russen zu beschießen. Als die sich ihrer gefährlichen Lage bewusst wurden verließen
sie ihre Aussichtsposten und bestiegen ihre Pferde. Mit Peitschenhieben versuchten sie, die sich in panikartiger Flucht
befindliche Infanterie dazu zu Bewegen, die Deutschen anzugreifen. Zwei Spähwagen wendeten sofort, der Dritte konnte
nicht mehr umkehren. Es gelang allen, bis auf den Fahrer des dritten Wagens die Flucht. Die Russen nahmen ihn sofort
unter Beschuss, doch es gelang ihm über unseren Hof zu entkommen. Auf der rückwärtigen Seite schlug er sich quer durch
die Gärten bis zum Gehöft von Friedrich Sakowski durch. Der versteckte ihn im Keller und versorgte ihn anschließend
mit Zivilkleidung.
Als die Russen den Soldaten auf unseren Hof laufen sahen nahmen sie sofort die Verfolgung auf. Sie durchstöberten auch
die Nachbarhäuser und trieben die Bewohner auf der Straße zusammen. An der Spritzenwagenremise richteten sie einen
Sammelpunkt ein. Unter dem Vorwand es würde hier eine Schlacht stattfinden, versuchten die Russen die Zivilbevölkerung
aus dem Dorf zu drängen. Alle die dem Aufruf gefolgt sind und an unserer Sammelstelle vorbeikamen wurden unserem Haufen
hinzugefügt. Unter ihnen befand sich auch der deutsche Soldat in Zivilkleidung. Er hatte einen Sack über die Schulter
geschlagen in dem sich ein Brot befand, an der anderen Hand führte er eine Kuh am Strick. Als unser Haufen schon aus
etwa 50 Leuten bestand setzten uns die Russen mit Marschrichtung Seelonken in Bewegung. Wir Jungen versuchten in einem
unbeaufsichtigten Moment wegzulaufen, doch die Begleitmanschaft prügelte uns mit Gewehrkolben wieder in Reihe und Glied.
Unterwegs gelang es dem Soldaten mit der Kuh unbemerkt zu entkommen. Er kehrte unbehelligt ins Dorf zurück und lieferte
die Kuh wieder dort ab wo er sie entführt hatte.
Uns haben die Russen an Seelonken vorbei zum Sylvensee getrieben. Wenn sie von vorbeiziehenden russischen Offizieren
gefragt wurden weshalb wir unterwegs wären, sagten sie denen wir hätten deutsche Soldaten versteckt und wollten das
Versteck nicht verraten. Als wir am See vorbei waren begann die deutsche Artillerie aus Richtung Ortelsburg zu
schießen. Unweit von uns explodierten Granaten und richten ein großes Chaos unter Freund und Feind an. Es hieß dann
rette sich wer kann. Die Russen verließen uns in Richtung Waldpuschsee und wir kehrten orientierungslos nach Seelonken
zurück. Nach Rohmanen konnten wir nicht zurück weil die deutsche Artillerie aus Richtung Eichtal anfing unser Dorf zu
beschießen. Schließlich sind wir auf dem Abbau Brosch untergekommen. Ein durch Granatsplitter schwer verletzter Russe
suchte dort auch Zuflucht. er versucht sich mit einem Messer das Leben zu nehmen. es gelang den Frauen ihn davon
abzubringen, weil sonst bei einem etwaigen erscheinen von russischen Soldaten der Verdacht auf uns gefallen wäre.
Später erschienen tatsächlich Kosaken die ihn dann mitgenommen haben. Ihnen folgten in 50 Meter Entfernung Deutsche
Ulanen, die hinter den Russen in einem in der Nähe liegenden Wäldchen verschwanden.
Nachdem die Russen Rohmanen besetzt hatten, versteckten sie sich vorwiegend in mit Stroh gedeckten Gebäuden. Durch
Schießscharten, die sie im Strohdach anlegten, schossen sie auf die deutschen Kampfverbände, die sie wieder vertreiben
wollten. Um die Angreifer zu entlasten, wunde das Dorf von deutscher Seite unter Beschuss genommen. Durch die
Geschosse der deutschen Artillerie entstanden in Rohmanen viele Brände. Die mit Stroh gedeckten Gebäude fielen zuerst
in Schutt und Asche. Unser Vater hatte uns ins Dorf geschickt, damit wir das Vieh im Stall von der Kette losbinden
sollten. Am Dorfrand kamen uns schon deutsche Ulanen und Husaren entgegen. Rohmanen brannte an mehreren Stellen. Unser
Hof war noch unversehrt, nur die Zäune standen schon in Flammen. Wir haben das Vieh los gebunden und anschließend
versucht die Brandherde rund herum zu löschen. Es gelang uns die Flammen von unserem Hof fernzuhalten und auch bei
unserem Nachbarn einzugreifen. In vielen Scheunen und Ställen hatten sich noch viele versprengte Russen versteckt. Die
wurden anschließend von deutschen Soldaten eingesammelt und in Gefangenenlager abgeführt. Am nächste Tag haben wir dann
zerbrochene Gewehre und Munition in Körbe gesammelt und im Dorfteich versenkt.
Am 29. August haben die Russen Rohmanen verlassen, doch schon am 30. August sind sie wieder zurückgekehrt. Hauptlehrer
Müller wurde mit seinem Sohn und Karl Deptolla auf Fahrrädern fahrend von einer russischen Patrouille aufgegriffen.
Sie wurden von den Russen der Spionage verdächtigt weil der Lehrer Müller ein Fernglas bei sich trug. Der Sohn hatte
eine Gymnasiastenmütze und eine Landkarte bei sich. Sie wurden in Richtung Lehmanen abgeführt. Auf einer Anhöhe des
Grundstücks von Ernst Chittka befand sich eine nicht mehr betriebstaugliche Windmühle. Dort soll ein russisches
Kriegsgericht sie zum Tode verurteilt haben. Nach der Hinrichtung wurden sie in der Nähe der Windmühle verscharrt.
Später wurden sie wieder ausgegraben, in Särge gelegt und auf dem Rohmaner Friedhof beigesetzt. Die Ehefrau von Lehrer
Müller hat die Gräber nach dem 1. Weltkrieg mit einem schmiedeeisernen Zaun umrandet.
Die Kämpfe um Rohmanen haben viele Menschenopfer gekostet. Bei uns hinter der Scheune lagen 2 tote Russen und ein
Verwundeter. Die Toten haben wir in einer Kartoffelmiete vergraben. Alle anderen Gefallenen wurden auch gleich an der
Stelle an der sie zu Tode kamen verscharrt und mit einem Kreuz gekennzeichnet. Für die im Raum Rohmanen gefallenen
Russen wurde nach dem Krieg hinterm Dorf, in Richtung Ortelsburg, auf einer Anhöhe ein Heldenfriedhof angelegt. Dort
liegen 20 Soldaten und 1 Offizier. In der Mitte befindet sich ein Trauerbaum und Birken säumen den Zugang von der
Landstraße her. Der Lehrer Dorka hat nach dem Kriege, mit seinen Schülern immer die Gräber gepflegt.
Uns haben die Russen an Seelonken vorbei zum Sylvensee getrieben. Wenn sie von vorbeiziehenden russischen Offizieren
gefragt wurden weshalb wir unterwegs wären, sagten sie denen wir hätten deutsche Soldaten versteckt und wollten das
Versteck nicht verraten. Als wir am See vorbei waren begann die deutsche Artillerie aus Richtung Ortelsburg zu
schießen. Unweit von uns explodierten Granaten und richten ein großes Chaos unter Freund und Feind an. Es hieß dann
rette sich wer kann. Die Russen verließen uns in Richtung Waldpuschsee und wir kehrten orientierungslos nach Seelonken
zurück. Nach Rohmanen konnten wir nicht zurück weil die deutsche Artillerie aus Richtung Eichtal anfing unser Dorf zu
beschießen. Schließlich sind wir auf dem Abbau Brosch untergekommen. Ein durch Granatsplitter schwer verletzter Russe
suchte dort auch Zuflucht. er versucht sich mit einem Messer das Leben zu nehmen. es gelang den Frauen ihn davon
abzubringen, weil sonst bei einem etwaigen erscheinen von russischen Soldaten der Verdacht auf uns gefallen wäre.
Später erschienen tatsächlich Kosaken die ihn dann mitgenommen haben. Ihnen folgten in 50 Meter Entfernung Deutsche
Ulanen, die hinter den Russen in einem in der Nähe liegenden Wäldchen verschwanden.
Nachdem die Russen Rohmanen besetzt hatten, versteckten sie sich vorwiegend in mit Stroh gedeckten Gebäuden. Durch
Schießscharten, die sie im Strohdach anlegten, schossen sie auf die deutschen Kampfverbände, die sie wieder vertreiben
wollten. Um die Angreifer zu entlasten, wunde das Dorf von deutscher Seite unter Beschuss genommen. Durch die
Geschosse der deutschen Artillerie entstanden in Rohmanen viele Brände. Die mit Stroh gedeckten Gebäude fielen zuerst
in Schutt und Asche. Unser Vater hatte uns ins Dorf geschickt, damit wir das Vieh im Stall von der Kette losbinden
sollten. Am Dorfrand kamen uns schon deutsche Ulanen und Husaren entgegen. Rohmanen brannte an mehreren Stellen. Unser
Hof war noch unversehrt, nur die Zäune standen schon in Flammen. Wir haben das Vieh los gebunden und anschließend
versucht die Brandherde rund herum zu löschen. Es gelang uns die Flammen von unserem Hof fernzuhalten und auch bei
unserem Nachbarn einzugreifen. In vielen Scheunen und Ställen hatten sich noch viele versprengte Russen versteckt. Die
wurden anschließend von deutschen Soldaten eingesammelt und in Gefangenenlager abgeführt. Am nächste Tag haben wir dann
zerbrochene Gewehre und Munition in Körbe gesammelt und im Dorfteich versenkt.
Am 29. August haben die Russen Rohmanen verlassen, doch schon am 30. August sind sie wieder zurückgekehrt. Hauptlehrer
Müller wurde mit seinem Sohn und Karl Deptolla auf Fahrrädern fahrend von einer russischen Patrouille aufgegriffen.
Sie wurden von den Russen der Spionage verdächtigt weil der Lehrer Müller ein Fernglas bei sich trug. Der Sohn hatte
eine Gymnasiastenmütze und eine Landkarte bei sich. Sie wurden in Richtung Lehmanen abgeführt. Auf einer Anhöhe des
Grundstücks von Ernst Chittka befand sich eine nicht mehr betriebstaugliche Windmühle. Dort soll ein russisches
Kriegsgericht sie zum Tode verurteilt haben. Nach der Hinrichtung wurden sie in der Nähe der Windmühle verscharrt.
Später wurden sie wieder ausgegraben, in Särge gelegt und auf dem Rohmaner Friedhof beigesetzt. Die Ehefrau von Lehrer
Müller hat die Gräber nach dem 1. Weltkrieg mit einem schmiedeeisernen Zaun umrandet.
Die Kämpfe um Rohmanen haben viele Menschenopfer gekostet. Bei uns hinter der Scheune lagen 2 tote Russen und ein
Verwundeter. Die Toten haben wir in einer Kartoffelmiete vergraben. Alle anderen Gefallenen wurden auch gleich an der
Stelle an der sie zu Tode kamen verscharrt und mit einem Kreuz gekennzeichnet. Für die im Raum Rohmanen gefallenen
Russen wurde nach dem Krieg hinterm Dorf, in Richtung Ortelsburg, auf einer Anhöhe ein Heldenfriedhof angelegt. Dort
liegen 20 Soldaten und 1 Offizier. In der Mitte befindet sich ein Trauerbaum und Birken säumen den Zugang von der
Landstraße her. Der Lehrer Dorka hat nach dem Kriege, mit seinen Schülern immer die Gräber gepflegt.
Am 29. August haben die Russen Rohmanen verlassen, doch schon am 30. August sind sie wieder zurückgekehrt. Hauptlehrer
Müller wurde mit seinem Sohn und Karl Deptolla auf Fahrrädern fahrend von einer russischen Patrouille aufgegriffen.
Sie wurden von den Russen der Spionage verdächtigt weil der Lehrer Müller ein Fernglas bei sich trug. Der Sohn hatte
eine Gymnasiastenmütze und eine Landkarte bei sich. Sie wurden in Richtung Lehmanen abgeführt. Auf einer Anhöhe des
Grundstücks von Ernst Chittka befand sich eine nicht mehr betriebstaugliche Windmühle. Dort soll ein russisches
Kriegsgericht sie zum Tode verurteilt haben. Nach der Hinrichtung wurden sie in der Nähe der Windmühle verscharrt.
Später wurden sie wieder ausgegraben, in Särge gelegt und auf dem Rohmaner Friedhof beigesetzt. Die Ehefrau von Lehrer
Müller hat die Gräber nach dem 1. Weltkrieg mit einem schmiedeeisernen Zaun umrandet.
Die Kämpfe um Rohmanen haben viele Menschenopfer gekostet. Bei uns hinter der Scheune lagen 2 tote Russen und ein
Verwundeter. Die Toten haben wir in einer Kartoffelmiete vergraben. Alle anderen Gefallenen wurden auch gleich an der
Stelle an der sie zu Tode kamen verscharrt und mit einem Kreuz gekennzeichnet. Für die im Raum Rohmanen gefallenen
Russen wurde nach dem Krieg hinterm Dorf, in Richtung Ortelsburg, auf einer Anhöhe ein Heldenfriedhof angelegt. Dort
liegen 20 Soldaten und 1 Offizier. In der Mitte befindet sich ein Trauerbaum und Birken säumen den Zugang von der
Landstraße her. Der Lehrer Dorka hat nach dem Kriege, mit seinen Schülern immer die Gräber gepflegt.

Bis zu meinem 17. Lebensjahr habe ich meinem Vater in der Landwirtschaft geholfen. Im Frühjahr
1916 wurde unser Jahrgang gemustert. Im Herbst 1916 erhielten Gustav Spektor, Johann Resonek und ich einen
Einberufungsbescheid. Wir mussten uns in Allenstein im Kaisergarten melden. Dort wurden Rekruten aus mehreren
Landkreisen zusammen gezogen und danach verschiedenen Ausbildungszentren zugeteilt. Wir Rohmaner kamen zum 18.
Infanterie-Regiment nach Osterode. Ein Unteroffizier mit einer Gruppe Musketiere haben uns von Allenstein abgeholt.
Als wir in der Kaserne ankamen haben wir sofort Mittagessen in Blechnäpfen bekommen. Untergebracht wurden wir im
Dachgeschoß der Kaserne. Es waren keine Betten vorhanden, nur Strohsäcke lagen auf dem Boden.
Als dann einige Tage später ausgebildete Kompanien an die Front ausrückten durften wir in einen anderen Block umziehen.
Wir wurden der Größe nach aufgestellt, in Korporalschaften eingeteilt und dann von Kopf bis Fuß eingekleidet. Die
Ausgehuniformen hatten blanke Knöpfe dazu einen Schako mit blanker Spitze. Im neuen Block hatten wir 2stöckige Betten.
Unsere Zivilbekleidung mussten wir in einen Karton verpacken und nach Hause schicken. Dann erst begann das eigentliche
Kasernenleben. Die Kaserne durfte niemand ohne Erlaubnis verlassen, nur in Begleitung eines Unteroffiziers. In der
Kaserne war eine Kantine in der man alles kaufen konnte was in der Kaserne gebraucht wurde.
Am nächsten Tag kam unser Kompanieführer, im Range eines Hauptmanns, zu Pferde angeritten. Er begrüßte uns mit;
Guten Morgen Kameraden, wir antworteten ihm mit; Guten Morgen Herr Hauptmann. Er hat dann die Front abgeschritten und
jeder musste sich mit seinem Namen vorstellen. Um 5 Uhr wurde geweckt, 6 Uhr Kaffee holen, 7-8 Uhr Unterricht, 8-11
Uhr exerzieren auf dem Kasernenhof. Um 11.30 blies der Trompeter zur Mittagspause. Die erste Zeit war noch alles
ziemlich gemütlich aber dann wurde es von Tag zu Tag strenger. Um 10 Uhr abends war Zapfenstreich, dann ging der
Unteroffizier vom Dienst von Stube zu Stube, der Stubenälteste musste die Anwesenheit aller Rekruten melden; zum
Beispiel: Stube 56 belegt mit 14 Mann, alle zu Haus. Wir mussten in 2 Reihen antreten, mit Drillichanzug bekleidet
und in Pantoffeln, ein tadelloses Aussehen präsentieren. Der Diensthabende Unteroffizier prüfte ob alle
vorschriftsmäßig angezogen, gewaschen, gekämmt und ob alle Knöpfe an der Jacke geschlossen waren. Als er bei einem
Rekruten einen offenen Knopf erspähte, hat er uns gefragt, ob jemand ein Taschenmesser bei sich hat.
Wir ahnten nicht Gutes, darum haben wir uns ganz still verhalten und nichts gesagt. Da sagte der U.v.D. plötzlich:
”Wenn niemand von euch ein Messer bei sich hat, dann habe ich ein”. Er zog sein Messer aus der Tasche und fing an, bei
dem Rekruten die Knöpfe abzuschneiden. Als die Knöpfe zu Boden purzelten, brachen wir in lautes Gelächter aus. Das hat
ihn so in Rage gebracht, das unser unwürdiges Benehmen, zuerst mit einem „Donnerwetter” bestraft wurde. Dann schrie
er: ”In den Korridor marsch, marsch, die Treppen runter bis auf den Hof”. Als wir unten angekommen waren hieß es
wieder; "Zurück auf die Stube in der 3. Etage”. Jemand hat mir bei dem Durcheinander, von hinten in den Pantoffel
getreten, so das er auseinander gerissen wurde. Ich bin dann nur mit einem Pantoffel und einem Socken die Treppen rauf
und runter gelaufen. So wurden wir 3-mal hinunter und wieder hinauf gejagt.
Danach ließ er uns wieder antreten und hat mit einer Taschenlampe unter den Betten geleuchtet. Plötzlich schrie er
wieder los: "Das nennt ihr Fegen? wenn ihr mit dem Besen nicht fegen könnt, dann mühst ihr das mit eueren Bäuchen tun.
Marsch, marsch unter die Betten” . Als wir schon alle am Schlafen waren, kam der U.v.D. wieder und hat nachgesehen ob
alle Schränke abgeschlossen waren. Ein Kamerad hatte seinen Schlüssel verloren, deshalb hat er das Schoß nur so
eingehängt. Als der U.v.D. das bemerkte hat er die Türe aufgerissen, die ganzen Sachen aus dem Schrank, quer durch die
Stube verteilt und war dann endlich gegangen.
Die Anziehsachen mussten, fein sauber gefaltet, auf dem Stuhl liegen; da drauf die Socken und die Pantoffeln unter dem
Stuhl. Die Stühle mussten in einer Reihe ausgerichtet sein; die Hosenträger im Schrank einschlossen und der Brustbeutel
mit Geld auf dem Hals tragen werden. Morgens wurden wir geweckt und kamen zuerst in den Waschraum. Jeder musste seinen
entblößten Oberkörper mit kaltem Wasser abreiben. Da draußen strenger Frost herrschte war es im Waschraum auch sehr
kalt, so das manche ihr Hemd anbehielten. Der UvD hat dann bei seinem Kontrollgang alle Verweigerer aufgeschrieben
und ihnen befohlen in 30 Minuten mit einem Besen in der Hand auf der Schreibstube zu erscheinen. Einige mussten den
Kasernenhof fegen, andere die zugefrorenen Latrinen enteisen und reinigen. Während unserer Ausbildungszeit durften wir
die Kaserne nicht verlassen. Wenn man Stuben- oder Frühdienst hatte, blieb keine Zeit zum Frühstücken.
Nach 6 Wochen wurden wir in der Grollmann Kaserne vereidigt. Die Regimentskapelle spielte "Heil dir im Siegerkranz",
danach folgten 3 Strophen des Deutschlandliedes. Vor der Vereidigung wurden die Rekruten gefragt wer keine deutsche
Staatsangehörigkeit besitzt. Es sind dann Luxemburger und auch noch welche aus anderen Ländern hervorgetreten. Sie
wurden gefragt ob sie die deutsche Staatsangehörigkeit annehmen wollen. Die das abgelehnt haben wurden auf die
Schreibstube gerufen und sofort aus dem Militärdienst entlassen. Nach der Vereidigung erfolgte ein Kirchgang, danach
konnte man einen Stadturlaub beantragen. Nach dem Mittagessen mussten alle, die einen Urlaubschein beantragt hatten
vor der Kaserne antreten. Der Hauptfeldwebel prüfte dann ob an der Uniform alle Knöpfe blank geputzt waren, die Stiefel
glänzten und der Rekrut auch vorschriftsmäßig grüßen konnte. Wer diese Anforderungen nicht erfüllen konnte musste
seinen Urlaubschein wieder abgeben und zurück auf sein Zimmer gehen.
Wenn man die Kaserne für eine gewisse Zeit verlassen wollte, mussten zuerst der Korporal, dann der Hauptfeldwebel und
letzt endlich der Hauptmann, seine Zustimmung erteilen. Es wurde geprüft; ob die Ausgeh-Uniform sitzt, alle Knöpfe
blank geputzt sind und der Helm so blank ist das man sich darin spiegeln kann. Unser Hauptmann war in Zivil,
Bürgermeister von Osterode. Er war sehr stolz wenn er seine Kompanie, in Parade Uniform und mit einem fröhlichen Lied
auf den Lippen, durch seine Stadt führen durfte.
Als wir eines Tages zum etwa 6 Kilometer entfernten Schießstand marschieren sollten, war es sehr kalt und glatt. Der
Hauptmann ritt durch das große Tor, wir aber sind durch das kleine Tor gegangen und haben eine steil bergab führende
Abkürzung gewählt. Die Zug- und Gruppenführer gingen voraus und wir im Gänsemarsch hinterher. Ein Kamerad hat sich auf
den Gewehrkolben gesetzt und ist darauf den Berg hinunter gerutscht. Als die Anderen das sahen haben sie es ihm
nachgemacht und hatten einen Riesenspaß. Da kam der Hauptmann plötzlich im Galopp angeritten; ließ alles anhalten und
hat zuerst die Zugführer ausgeschimpft, dann anschließend die ganze Kompanie. Er sagte: „Wie könnt ihr es wagen, so
mit eueren Gewehren umgehen. Ein Gewehr soll man wie seine Braut behandeln und nicht wie einen Straßenbesen”. Zur
Strafe mussten wir, links und rechts der Straße, in zwei Reihen antreten und durch den verschneiten Straßengraben
robben. Die Herrn Zug- und Gruppenführer durften die Straße benutzen und erteilten uns nur Befehle, wie: hinlegen,
nach rechts schwenken, nach links schwenken, einzeln vorarbeiten und sammeln. Als wir dann abgekämpft, in Linien zu
2 Glieder angetreten waren, ging es mit Gesang zum Schießstand.
Auf dem Schießstand angekommen, erhielten wir zuerst eine praktische Unterweisung, für den Gebrauch von Schusswaffen.
Wir mussten solange mit einem nicht geladenen Gewehr üben, bis wir unserem Vorgesetzten beweisen konnten, dass wir
alles im Griff haben. Daraufhin wurden jedem 10 Patronen zugeteilt, so das er unter der Aufsicht eines Unteroffiziers
mit den Schießübungen beginnen konnte. Der Unteroffizier hat die Position der Einschüsse, auf der Scheibe, in einem
Buch eingetragen und nach Beendigung der Übung dem Hauptmann Bericht erstattet, ob der Schütze seine Aufgabe erfüllt
hat oder nicht. Nach dem Schießen wurden die Gewehre zu Pyramiden zusammengestellt. Diejenigen die ihre Aufgabe nicht
erfüllt haben, mussten rund um die Zielscheibe, die Bleikugeln aufsammeln.
Seit unserer Einberufung hatten wir noch keinen Heimaturlaub. Urlaub bekamen nur die, die ihren Heimatort zu Fuß
erreichen konnten. Wegen der vielen Truppentransporte die täglich von Ost nach West unterwegs waren durften wir die
Eisenbahn nicht benutzen. Einmal wurde uns gesagt; wenn jemand gut schießen kann der bekommt Heimaturlaub, aber auch
das war nur ein leeres Versprechen.
Kaisers Wilhelms Geburtstag
Der beste Tag war des Kaisers Geburtstag. Am 27. Januar mussten alle in der Grollmann Kaserne
antreten, der Battalions-Kommandeur beendete seine Laudatio mit den Worten: Seine Majestät, unser Kaiser und König
Wilhelm II, erlebe hoch, hoch, hoch. Dann spielte die Regimentskapelle: Heil dir im Siegerkranz, Herrscher des
Vaterlands, Heil Kaiser dir. Danach folgten 3 Strophen des Deutschlandliedes und anschließend fand ein Gottesdienst
statt. Anschließend gab es ein vorzügliches Mittagessen, Schweinebraten, ein Stück Wurst auf die Faust und Biermarken,
die man in der Kantine gegen gutes Bier einlösen konnte, danach Urlaub bis zum Wecken, ohne Urlaubschein. Mein Vater
und die Mutter eines Kameraden waren schon morgens angekommen, konnten uns aber nicht finden, wurden von einer Kaserne
in die andere geschickt. Erst als wir mit Musik, von der Kirche zurück zur Kaserne marschiert sind habe ich sie
zufällig entdeckt. Als sie mich auch erkannt haben, sind sie nachgekommen. Da war die Freude groß: Der Vater hatte
einen großen Koffer auf einem Krückstock über die Schulter getragen. Ich ging gleich zur Wache und habe sie angemeldet,
sie sind dann bis zum Abend geblieben. Es war einer der schönsten Tage in der Grollmann-Kaserne in Osterode.
Alle 10 Tage bekamen wir Sold. Vor der Auszahlung mussten wir antreten, jeder wurde gefragt ob noch Restgeld vom
letzten Sold vorhanden war. Dann bekam jeder 3,30 Mark, davon musste man noch Sidol für das Koppelschloss und
Schuhkreme für die Stiefel kaufen. Wer geraucht hat und nichts von zu Hause bekam war schlimm dran. Beim Militär bekam
man nicht nur die Ausbildung an der Waffe beigebracht, man lernte auch putzen, nähen, Strümpfe stopfen und vieles
Andere. Man bekam einen beschädigten Strumpf, der musste aufgeribbelt werden, mit der Wolle konnte man dann andere
Strümpfe stopfen oder Kleidungsstücke mit Namen kennzeichnen. wer das nicht konnte, der musste seinen Kameraden
Zigaretten oder Geld geben die das dann für ihn erledigten.
Verschiedene Kameraden gingen nach dem Dienst noch in die Stadt. Um 21:45 Uhr wurde zum Zapfenstreich geblasen, dann
musste man schnell zurück in die Kaserne, weil um 22:00 Uhr der Wachhabende von Bett zu Bett ging und prüfte ob auch
alle anwesend waren. Zwei mal pro Woche fanden Gewaltmärsche statt, mit vollem Gepäck im Tornister. Am Ende der
Marschkolonne fuhr dann ein Pferdewagen, wenn der Feldarzt bei jemandem einen Erschöpfungszustand feststellte, der
durfte dann aufsitzen. Am Sonnabend wurden auf dem großen Exerzierplatz Felddienstübungen durchgeführt, es befand sich
dort ein großer Hügel, den wir immer wieder erstürmen mussten. Am Nachmittag war Revierreinigen angesagt, wir mussten
dann die Tische schrubben, auf einen Tisch wurde Sand mit etwas Wasser gestreut, der nächste Tisch wurde mit der den
Beinen nach oben drauf gelegt und solange hin und her geschoben bis beide sauber waren. Mit den Stühlen geschah das
Gleiche. Dann wurde der Fußboden in der Stube geschrubbt, die Schränke abgewaschen, Staub geputzt, zuletzt kamen Flur
und Treppe dran.
Für die Arbeit war eine Stunde angesetzt, wenn jemand zu früh fertig war erregte er den Argwohn des Diensthabenden
Korporals, der prüfte dann alles genau, fand natürlich immer etwas das nicht seinen Erwartungen entsprach. Der
Übereifrige musste dann Nacharbeiten bis die Stunde um war. Eine Stunde war für Gewehr reinigen und Unterricht an der
Waffe vorgesehen.
Im Februar wurden wir neu eingekleidet; Schnürschuhe, Koppel, alles gelbes Leder mussten wir mit Lederschwärze
behandeln. 2 Wolldecken, Uniform und Helm in feldgrau, da brauchten wir die Knöpfe nicht mehr zu putzen. Die neuen
Gewehre mussten zuerst eingeschossen werden. Es wurden 90 scharfe Patronen und Marschverpflegung ausgegeben, danach
mussten wir mit vollem Gepäck zum Appell antreten. Man konnte kaum gerade stehen, weil der Tornister einen in die Knie
zwang. Der Major, der die Aufstellung besichtigte rief >Brust raus<, dann informierte er uns dass wir ins
Feldrekrutendepot und in Feindesland kommen. Urlaub bekam niemand. Ich habe ein Telegramm nach Hause geschickt, mit
der Nachricht dass wir bald abrücken werden. Einen Tag vor dem ausrücken hat mich meine Mutter noch besucht, sie hat
mir vieles mitgebracht. Alles konnte ich nicht mitnehmen, weil es nicht gestattet war anderes Gepäck bei sich zu haben
als dem Soldaten zustand.
Abmarsch zum Fronteinsatz
Am nächsten Tag hat uns die Regimentskapelle mit Musik zum Bahnhof gebracht. Von Osterode ging
es über Thorn, Posen,
Annaberg, Warschau, Brestlitowsk ins Pruschana-Lager. Das war eine russische Artillerie-Kaserne, in der 2 deutsche,
3 österreichische Bataillone und eine Offiziersschule untergebracht waren. Ein Bataillon das waren wir 18 und 19
jährige, die Anderen waren Männer bis 45 Jahre. Als wir in Osterode abfuhren lag Schnee, in Annaberg/Schlesien waren
die Kühe auf der Weide und im Pruschana-Lager lag der Schnee wieder einen Meter hoch. Drei Kilometer vor unserem vor
unserem Lager war die Bahnfahrt zu Ende. Mit den schweren Tornistern waren viele überfordert, wir mussten immer wieder
warten bis alle nachkamen. Unsere Unterkünfte das waren Baracken die den Russen als Pferdeställe gedient hatten. In
jeder Baracke wurde eine Kompanie mit Schreibstube untergebracht, die nur durch ein Zelt abgegrenzt war.
Wir haben aus Brettern Doppelbetten hergestellt, in jeder Baracke war ein Ziegelofen. Unsere neuen Uniformen und die
scharfe Munition mussten wir abgeben und bekamen dafür alte Bekleidung, sowie Ecksezierpatronen. Hier ging es wieder
Kasernenmäßig zu, das jüngere Bataillon bekam besseres Essen, doppelte Portionen und nach dem Essen 2 Stunden Bettruhe.
Wenn jemand die Bettruhe nicht einhielt und dabei erwischt wurde wusste zur Strafe Holz hacken oder Schnee schaufeln.
Zwei Wochen war Frost bis minus 40 Grad, da hatten wir keinen Unterricht im Freien, alle Aktivitäten fanden in der
Baracke statt, die nur mit nassem Holz beheizt wurde und dem entsprechend war auch die Temperatur im Inneren. Um
Brennmaterial für die Küche zu besorgen mussten wir ins nächste Dorf gehen und von zerfallenen Häusern Holz holen.
Als endlich das Tauwetter einsetzte verwandelte sich die Gegend um Baranowitschi in ein unüberwindbares Sumpfgelände.
Wir wurden mit anderen Einheiten die aus Frankreich zu uns verlegt wurden, zusammengelegt. Wenn jemand nachweisen
konnte dass er Landwirt ist und mehr als 100 Morgen Ackerland besitzt, konnte er einen Urlaub zur Frühjahrsbestellung
beantragen. Ein Gottlieb Piotrowski aus Plohsen hat seinen Urlaub bewilligt bekommen und durfte für 14 Tage nach Hause.
Wenn von der unweit entfernten Front Kanonendonner zuhören war und Alarm ausgerufen wurde, dachten wir es geht los.
Obwohl wir als Reserve aufgestellt waren mussten wir allzeit einsatzbereit sein. Wir haben auch Bunker und Stollen
gebaut, Schützengräben ausgeworfen und mit scharfen Handgranaten exerziert.
Als Gottlieb Piotrowski nach 2 Wochen zurückkam waren wir schon in Alarmbereitschaft und sind dann auch 2 Tage später
ausgerückt. Kamerad Piotrowski hatte mir noch ein großes Paket von zu Hause mitgebracht.
Italien hat Deutschland und Österreich den Krieg erklärt.
Zuerst sind drei Bataillone Österreicher ausgerückt, dann die Deutschen hinterher. Bis zum
Bahnhof Linowa wurden wir von einer Musikkapelle begleitet, dann ging es per Eisenbahn ab nach Baranowitsche. Dort
wurden wir der, an der Westfront aufgeriebenen, 15ten Reserve Division zugeteilt. Es wurde uns gesagt das Kameraden
aus der Heimat gleichen Gruppen zugeordnet werden können. Ich hatte einen Freund aus meinem Dorf, Gustav Spektor,
einen aus Groß Schöndamrau, Wilhelm Lukas und einen aus Ortelsburg, Karl Schlensack, wir kamen zu zusammen in eine
Kompanie. Zuerst waren wir in einem Kinosaal einquartiert, haben jeden Tag Schützengräben ausgehoben und Feldübungen
gemacht. Es war ein sumpfiges Gelände, so dass die Soldaten wegen den vielen Mücken, Netze auf den Köpfen tragen
mussten. Nach einem Gewitter wurde es plötzlich unerträglich. Die Mücken hatten meinen Freund so zerstochen dass sein
Gesicht dermaßen angeschwollen war und ich ihn gar nicht wieder erkannt habe.
Von Baranowitsche wurden wir wieder auf die Eisenbahn verladen, die uns mit unbekanntem Ziel Richtung Osten fuhr.
Nachdem wir unterwegs einmal zum Essenfassen gehalten haben, kamen wir in der Nacht in Krakau an. In der nächsten
Nacht befanden wir uns schon in den Karpaten, wo wir die Hügelketten zu Fuß überqueren mussten, die Fahrzeuge fuhren
um die Berge herum und wir mussten manchmal 2 Stunden warten bis sie uns wieder eingeholt hatten. So ging es immer
weiter bis wir auf einen Berg kamen wo wir Zelte aufgebaut und Biwak bezogen haben. Dort stießen wir auf türkische
Einheiten die auf Mauleseln Munition und Verpflegung über die Berge transportiert haben. Die Esel hatten ein Gestell
auf dem Rücken, auf jeder Seite eine Fass mit Wasser oder Kisten mit Proviant. Ihre Artillerie wurde von 6 Mauleseln
gezogen, während die Offiziere, ohne Sattel, ohne Zaumzeug, nur mit einem Hanfseil ausgerüstet, daher kamen.
Die Mannschaften marschierten wie es jeder für richtig hielt, mit aufgekrempelten Ärmeln, das Gewehr über den Tornister
gelegt, wie die Wilddiebe. Im Gegensatz dazu herrschte bei uns strenge Disziplin, wen jemand aus der Reihe ging kam
sofort der Kompanieführer angeritten, hat uns angeschrieen, uns klar gemacht dass wir keine Türken seien und nur auf
höheren Befehl etwas an der Marschordnung ändern dürften, wer dagegen verstoße, müsste mit einem 3tägigen Arrest
rechnen. Wir haben hinter der der Front Gewaltmärsche durchgeführt die dem Feind große Truppenaufmärsche vortäuschen
sollten.
Wir lagen in einem Buchenwald in Bereitschaft. Überläufer berichteten dass auf russischer Seite eine Großoffensive
vorbereitet wird. In einer Nacht wurde plötzlich Alarm geschlagen, der Russe war zu einem Angriff mit Gasgranaten
übergegangen. Wir lagen unter Zelten und hatten die Gasmasken gar nicht bei uns, sondern nur etwas abseits liegen. In
der Dunkelheit hat mach einer keine Gasmaske mehr gefunden. Es war ein fürchterliches Durcheinander. Dabei war es
unsere Pflicht die Maske immer an dem Tragriemen über dem Hals zu tragen, mit halb geöffnetem Deckel. Uns hat es zum
Glück nicht so stark betroffen weil wir auf einer Anhöhe lagen und die Gaswolken sich im Tal verteilten. Wir wurden in
höchste Alarmbereitschaft versetzt weil der Russe die österreichische Front durchbrochen hatte.
Eigentlich sollten wir noch an einer Gulaschkanone Essen fassen, aber es blieb uns dazu keine Zeit mehr. Der
Kompanieführer befahl uns die Zelte abzubrechen, auf den Tornister aufzurollen und in fünf Minuten marschbereit zu
sein. Die Kanoniere befanden sich schon in der Batteriestellung, luden die Granaten, die sofort abgefeuert wurden. Der
Battalions-Kommandeur versammelte die Kompanieführer und erteilte ihnen die Angriffsbefehle. Derweil sollten wir in
einem Eichenwal der schon mit Granattrichter übersät war, Deckung suchen. Bald hatten wir die Verbindung zu unserem
Batteriestab verloren. Wir warfen unsere Tornister auf einen Haufen, schwärmten unverzüglich, nur mit Sturmgepäck
ausgerüstet, 4 Handgranaten im Brotbeutel, zum Angriff aus. Wir robbten uns einzeln voran. Weil der Russe unsere
Stellungen schon überrannt hatte war jeder auf sich selbst angewiesen. Mann hörte kein Kommando mehr weil der Russe
inzwischen den Rückzug angetreten hatte, um sich auf einer Bergspitze zu verschanzen, von der er uns mit
Flachbahngeschützen beschoss. Irgendwann befanden wir uns in einem Schützengraben, wo ein Leutnant und 17 Mann aus
unserer Division die Stellung hielten. Unter Androhung von Gewalt befahl er uns den Graben sofort zu verlassen und am
Gegenangriff teilzunehmen. Wir sprangen über den Stacheldraht, duckten uns aber sofort im nächsten Graben damit das
mörderische Maschinengewehrfeuer uns nicht hinwegfegte.
Dort blieben wir bis zum Eintritt der Dunkelheit liegen. Wir konnten unsere Waffen nicht mehr einsetzen weil der Sand
die Gewehrschlösser blockiert hatte. Als es Nacht wurde herrschte ein gespenstische Stille. Wir krochen aus dem
Schützengraben und lauschten nach irgendeinem Lebenszeichen von anderen Kameraden. Dann hörten wir irgendwelche Laute
die wir nicht genau zuordnen konnten. Sie kamen aus einem Holzbunker ganz in der Nähe. Wir näherten uns ganz
vorsichtig, als plötzlich eine Schar österreichischer Soldaten herausstürmte. An unseren Stahlhelmen erkannten sie
dass wir Deutsche sind. Bald danach trafen wir auch auf 69 deutsche Soldaten die zu unserer Division gehörten. Dann
kam ein Hauptmann der uns mit Vorwürfen überschüttete, wir seien Feiglinge, wir hätten uns von unserer Einheit entfernt.
Wir haben ihm den Vorgang geschildert, aber ließ nicht mit sich reden und sagte nur dass wir bestraft werden und nichts
zu essen bekommen. Wir wurden einer Maschinengewehr Einheit zugeteilt welche die vorderste Stellung verteidigen
musste. Wir hatten einen Stollen mit 2 Ausgängen.
Die Russen haben bemerkt das sich etwas bewegte und haben uns unverzüglich mit Artilleriefeuer belegt. Schon die
dritte Granate war ein Volltreffer. Vier Kameraden waren sofort tot, ich bekam mit einem Stollenbrett in den Rücken
der sofort blau und grün angelaufen war. Ich schaute nach oben, alles war verschüttet. Ich wusste nicht das da noch
ein Ausgang war, doch die Kameraden die hier in Stellung waren haben mir geholfen das Freie zu erreichen. Ich habe
mich am nächsten Tag krank gemeldet, dachte 2 Tage Schonung zu bekommen, aber der Sanitäter hat mir nur den Rücken mit
Spiritus eingerieben und mich wieder, zurück zu unserer Kompanie geschickt. Sie bestand nur noch aus 3 Gruppen, die in
einem Stollen, der in einen Berg gehauen war, Stellung bezogen hatten. Wir konnten uns hier wenigstens waschen, an
einer Quelle die aus dem Felsen sprudelte. Wir waren nicht mehr einsatzfähig und mussten durch andere Truppenteile
verstärkt werden.
Beim Essen holen musste man auch das Gewehr bei sich haben, es wurde erzählt dass hier der braune Bär herumwandert.
Ich habe keinen gesehen, nur das die Toten ausgescharrt wurden und verstümmelt herumlagen. Nach einigen Wochen haben
die Deutschen eine Gegenoffensive gestartet, von den Bergen herunter, über den Fluss Zlota Lipa, bis zu einer Stadt
die Brzezany hieß. 2 Tage später wurden wir auch eingesetzt, bei großer Hitze ging es in Dauermärschen vorwärts, man
durfte aus den Flüssen kein Wasser trinken, weil es mit Petroleum verseucht war. Nur wenn es dunkel wurde machten wir
halt, dann mussten wir Gräben ausheben um vor Überraschungen sicher zu sein.
Links von uns war Tarnopol und rechts Rumänien. Wenn es nach einer Ruhepause wieder losging dann war es am schlimmsten,
man ging wie auf Nägel, weil die Füße die Strapazen nicht so ohne weiteres wegsteckten. Im Dorf wurde niemals Rast
gemacht, denn da waren immer Brunnen, zu denen alle hinstürmten. Später wurden Melder vorausgeschickt, die von den
Dorfbewohnern Wasser in Eimern am Weg raussetzen ließen, damit die Soldaten Ihren Durst löschen konnten. Ein Soldat hat
gleich den ganzen Eimer mitgenommen und ihn dann als er leer war, irgendwo am Wegrand stehen lassen. Der Kompanieführer
kam angeritten, hat ihn ausgeschimpft und gedroht, ihn mit 3 Tagen Arrest zu bestrafen. Wir gehörten zur Südarmee
welche von Graf Bothmer befehligt wurde.
Die Stellungen waren schlecht ausgebaut, abends mussten wir, von der 2 Kilometer hinter der Front liegenden Feldküche,
Essen und andren Proviant holen. Ich war der Jüngste der Gruppe, musste immer 9 Kochgeschirre tragen, Brot und Post
habe ich in 2 Sandsäcke, die ich über der Schulter hängen hatte, verstaut. Wenn wir unterwegs waren wurde der
Laufgraben immer beschossen. Einmal schlug eine Granate am Schützengrabenrand ein und hat mich halb verschütte, die
Kochgeschirre aus den Händen gerissen, so dass ich ohne Verpflegung im vorderen Graben ankam. Nach drei Wochen sollten
wir abgelöst werden Es hat jeden Tag geregnet, wir haben unsere Mäntel angezogen und uns mit Zelten bedeckt. Nach dem
wir abgelöst wurden kamen wir in ein Dorf dass von Juden bewohnt war. Die Bewohner waren froh dass wir keine Kosaken
waren, mit denen hatten sie vor ein par Tagen schon schlechte Erfahrung gemacht, die hatten ihnen beim Abzug Vieh und
Pferde weggenommen.
Der Boden war sehr fruchtbar, es wurden Hanf, Weizen, Hafer, Mais, Bohnen, Roggen und Kartoffeln angebaut. Die
Bewohner waren gerade mit der Ernte beschäftigt. Die Häuser waren nur aus Holz und Stroh erbaut. Die Leute lebten in
sehr ärmlichen Verhältnissen. Ich hatte mir in unserer Kantine für 20 Pfennig ein Taschenmesser gekauft, das hat mir
ein Bauer für 6 Eier und 2 Pfund Brot abgekauft, daraus hat er sich dann ein Rasiermesser geschliffen. Wenn unser
Versorgungstross auf denn holperigen Wegen nicht nachkam, haben im Dorf auch Verpflegung eingekauft. Die Leute hatten
Angst dass wir nicht bezahlen werden, doch wir bekamen meistens pünktlich unseren Wehrsold ausgezahlt und konnten uns
so manches genehmigen. Um unser Marschgepäck zu erleichtern haben wir so manches aus dem Tornister weg geworfen.
Unweit eines Dorfes wurde halt gemacht, wir sollten Zelte aufschlagen, doch niemand hatte mehr Zeltstöcke im Tornister,
alles war unterwegs liegen geblieben. Der Zugführer befahl uns ins Dorf zugehen und Stöcke zu besorgen. In einer
Scheune stießen wir auf eine Hühnerschar, mit den Stöcken haben wir einige Hühner erlegt, in einem Hanffeld gerupft
und dann im Eiltempo zurück zu unserer Truppe. Als wir ankamen war die Kompanie schon marschbereit, es gleich weiter,
mit dem Huhn im Tornister. Bei der nächsten Rast haben wir die Hühner ausgenommen und Holz besorgt um sie zu kochen,
doch wir mussten schnell wieder weiter marschieren und erst nach 2 Tagen konnten wir uns mit den Hühnern befassen,
leider waren die so alt das sie nicht gar wurden. Das Fleisch mussten wir wegwerfen, nur die Suppe konnten wir noch
gebrauchen.
Meine Verwundung am Pruth.
Wir befanden uns 8 km vor der russischen Grenze. Der Kompanieführer hatte uns informiert das
wir hier zum Einsatz kommen. Wir bekamen noch ein Mittagessen aus der Gulaschkanone, konnten unsere Feldflaschen mit
Tee, der mit Rum angereichert war, auffüllen, Munition und Handgranaten in Empfang nehmen und dann ging es zum Einsatz.
Um 3 Uhr begann das ganze Bataillon auszuschwärmen, sofort hat uns der Russen entdeckt und begann uns mit Artillerie
zu beschießen, je weiter wir vorrückten desto heftiger.
Bis zu einem Eisenbahndamm hatten wir gute Deckung, doch wir sollten den dahinter fließenden Fluss überqueren. Doch
plötzlich explodierte über meinem Kopf eine Schrapnellkugel, der Stahlhelm wurde mir vom Kopf gerissen, Tornister und
Koppel flogen auch weg, ich lag auf der Erde und wusste gar nicht was passiert war. Plötzlich fing Blut aus der
Kreuzbeingegend zu rieseln, aus dem rechten Oberschenkel auch. Gleich nebenan war ein Granattrichter, dort habe ich
Schutz gesucht. In der rechten Rockecke hatte man immer ein großes Verbandspäckchen, das habe ich herausgenommen und
auf die Wunde gedrückt, doch das Blut floss mir bis in den Stiefel. Links und rechts von mir schlugen Granaten ein,
dicke Erdbrocken und Schlamm fielen auf mich herab, doch in meinem Erdloch war ich vor Maschinengewehrsalven geschützt.
Der ganze Rücken war angeschwollen und ich konnte mich überhaupt nicht bewegen.
Die Deutschen mussten die Stellung den Russen überlassen, einer hatte mich entdeckt, da ich aber so blutverschmiert da
lag, hat er bestimmt gemeint ich wäre nicht mehr am leben und ist weitergegangen. Nach zwei Stunden habe ich gehört
das die Russen sich wieder zurückzogen, danach herrschte eine gespenstische Stille. Als es dunkel wurde kamen deutsche
Sanitäter mit Spürhunden und haben die Verwundeten aufgesammelt. Ich wurde auf eine Trage gelegt, lag gebeugt und
konnte mich nicht rühren weil der blutverschmierte Rücken völlig verkrustet war. Ein Pferdegespann konnte nur vier
Tragen befördern, die Fahrt über Ackerfurchen war eine Tortur, ich habe nicht geglaubt das ich es überleben werde. In
einer Dorfkirche wurden wir dann ausgeladen und zu den etwa 50 Verwundeten gelegt die da schon lagen.
Mich haben sie zu den Bauchschüssen gelegt, weil ich einen Nervenschock hatte und am ganzen Körper gezittert habe. Zu
trinken bekam ich nichts, nur einen feuchten Lappen in den Mund. Ich sollte gleich operiert werden, aber es kamen
immer mehr Verwundete, so bekam ich nur eine Tetanusspritze, wurde verbunden und für den Weitertransport ins Hinterland
vorbereitet. Im Morgengrauen wurden wir auf Lastautos verladen, die aus auf ein Landgut brachten, wo wir in einem
Pferdestall untergebracht wurden. Die Fahrer fuhren so schnell über die Granatlöcher, das wir vor Schmerzen geschrieen
haben. Wir baten sie langsamer zu fahren, aber die bekamen es in ihrem Führerhaus nicht mit, erst alt ein Verwundeter,
der einen Krückstock bei sich hatte von hinten die Scheibe einschlug wurde die Fahrt erträglich. Lastautos, die
Munition und Verpflegung an die Front transportiert hatten, brachten in den nächsten Tagen immer wieder Verwundete
ins Hinterland. Die Deutschen hatten an diesem Fronabschnitt hohe Verluste zu beklagen. Wir können von Glück reden
dass wir dem Höllenfeuer überhaupt entkommen sind.
Wir wurden mit Lastautos, die ein Feldlazarett uns geschickt hatte, bis nach Lemberg befördert. da wurden wir gewaschen,
rasiert und frisch verbunden. Auf einem Nebengleis stand ein Lazarettzug, in dem wurden wir anschließend in frisch
bezogenen Betten untergebracht. Der Zug brachte uns über Annaberg nach Freiburg in Sachsen, eine Stunde hinter Dresden.
Hier wurden wir auf Tragen gebettet und mit einem Möbelwagen in ein Reservelazarett transportiert.
Im Heimatlazarett.
Als ich am nächsten Tag aufwachte und das schöne Bett sah in dem ich lag, dachte ich dass ich
im Himmel bin. Ich dankte meinem Herrgott das er mich bis zu diesem Ort begleitet hat. Am Nachmittag kamen Schulkinder
mit Geschenken und haben uns schöne Lieder vorgesungen. Anhand von Röntgenaufnahmen wurde in den nächsten Tagen
festgestellt dass bei mir ein Schrapnellsplitter an der Wirbelsäule in die Kreuzbeingegend eingedrungen war. Ich wurde
jeden Tag in Salzwasser gebadet und bekam wieder volle Verpflegung, da mein Magen zum Glück nicht verletzt war. Auf
dem Transport bekam ich nur Suppe und bei Bedarf einen feuchten Lappen auf die Lippen. Ich bin von 62 auf 43 Kilogramm
abgemagert, gehen konnte ich wegen dem Nervenschock den ich bei der Verwundung erlitten hatte auch noch nicht. Die
Wunde am rechten Oberschenkel war nur ein Streifschuss und wurde mit einem Schutzverband versorgt.
In den nächsten Tagen habe ich einen Brief nach Hause geschrieben und mitgeteilt wo ich mich zurzeit befinde. Meine
Eltern schickten mir ein Paket mit Lebensmitteln, jetzt konnte ich essen was ich wollte. Das Essen im Lazarett war
nicht besonders, jeden Tag nur Kohlblätter. Der weg zu den Toiletten führte durch einen Gemüsegarten. Die gehfähigen
Kameraden haben den ganzen Kohlrabi aufgegessen, so dass schließlich Wachposten aufgestellt werden mussten. Sechs
Wochen lang konnte ich mich nur auf allen Vieren fortbewegen, denn sobald ich mich aufrichtete wurde es mir
schwindelig und ich musste zurück ins Bett.
Als ich wieder bei Kräften war habe ich meinen Eltern mitgeteilt das ich mich in ein Lazarett in ihrer Nähe verlegen
lassen will. Der Chefarzt hatte mir zugesichert, wenn die Möglichkeit besteht in Ortelsburg unterzukommen, wird er dem
zustimmen. Meine Mutter hat daraufhin, in Ortelsburg, beim Lazarettinspektor Zantopf nachgefragt und er hat angedeutet
das sie mich aufnehmen können. Daraufhin bekam ich die Krankenpapiere und einen Fahrschein nach Ortelsburg. Da ich als
Soldat nie Heimaturlaub hatte, beschloss ich zuerst meine Eltern zu besuchen. Ich fühlte mich noch sehr schwach, habe
nach jedem Kilometer Rast gemacht, aber letztendlich war ich wieder daheim bei meinen Eltern. Die Wiedersehensfreude
war sehr groß. Ich bin am 30 Juli verwundet worden und am gleichen Tag wurde mein ältester Bruder beerdigt. Er bekam
den Splitter einer Gasgranate ins rechte Bein und ist an einer Blutvergiftung verstorben.
Am nächsten Tag brachte mich mein Vater ins Garnisonslazarett nach Ortelsburg. Ich wurde jeden Tag gebadet und massiert,
weil die Rückenhaut am Knochen angewachsen war konnte ich mich nicht schmerzfrei bücken. In Ortelsburg verbrachte ich
noch sechs Wochen, bis Ende Oktober, da wurde es schon ziemlich kalt und in unserer Barackenunterkunft ziemlich
ungemütlich. Kohlen und anderes Brennmaterial lagen im Hof auf Halde, aber es war verboten zu heizen. Kameraden die in
der Nähe zu Hause waren konnten Sonntagsurlaub beantragen.
Einer von ihnen brachte von zuhause Brennholz mit und entzündete damit im Ofen ein wärmendes Feuer, andere holten vom
Hof Kohlen, so dass der Ofen in kurzer Zeit glühend heiß wurde und die Gefahr bestand das die Betten Feuer fangen
würden. Wir hatten die Betten schon weg gerückt, da kam der Feldwebel herein und fragte wer das Feuer im Ofen
angezündet hat, doch niemand fühlte sich angesprochen. Der Feldwebel hatte den Vorfall dem Stabsarzt gemeldet, als der
am nächsten Morgen zur Visite kam, war seine erste Frage: ”Wer hat gestern Abend das Feuer im Ofen angezündet”. Als
sich niemand meldete, schrie er uns an: ”Morgen wird alles entlassen, zum Ersatzbatallion, in Diez an der Lahn! Wer
gehen kann, sofort zur Schreibstube, Krankenpapiere und Fahrscheine abholen”. Er erinnerte uns noch daran am nächsten
Tag pünktlich am Bahnhof zu sein, weil eine Verspätung unangenehme Folgen für uns haben würde. Das war das Ende der
schönen Erholungsphase. Ich blieb noch eine Nacht zu Hause und bin dann am nächsten Tag von dort zum Bahnhof gegangen.
Wieder Kriegsverwendungsfähig.
Als wir am nächsten Tag in Diez angekommen waren, wurde ich gefragt ob ich aus dem Heimaturlaub
käme, als ich das verneinte wurden mir 2 Tage genehmigt und 14 Tage Genesungsurlaub dazu. Wieder zurück im
Ersatzbatallion bestand unsere Tätigkeit aus Wache schieben und Kartoffel schälen. Nach einem Monat wurden wir von
einem Generalarzt untersucht, er hat mich für nicht einsatzfähig befunden weil ich noch den Steckschuss im Rücken
hatte und das linke Bein 10 Zentimeter dünner war. Jetzt fing das Kasernenleben wieder von vorne an. Wachdienst,
Gewehr laden, sichern, Ehrenbezeugung, Einzelmarsch und Appell. Wer nicht weit nach Hause hatte bekam zu Weihnachten
Urlaub. Ich hatte zu Heiligabend und Silvester Torwache, denn nach Ostpreußen wurde niemand beurlaubt.
Nach Neujahr 1918 wurden wir neu eingekleidet und kamen nach Köln zur Baukompanie. Mit Musik wurden wir zum Bahnhof
gebracht. In Köln wurden wir noch mit Soldaten die von andern Truppenteilen dorthin verlegt wurden in einem großen
Kinosaal, im Stadtteil Edengarten untergebracht. Wir brauchten keinen Dienst zu machen und konnten zu Heilige Drei
Könige den Gottesdienst im Dom besuchen. Kameraden die aus irgendwelchen Gründen im Arrest saßen wurden gefragt ob sie
auch am Gottesdienst teilnehmen möchten, dann würde ihnen die Strafe erlassen. Fast alle haben dem zugestimmt. Einige
Tage später wurden wir wieder auf einen Transportzug verladen, der uns über Herbestal, Antwerpen nach Brügge in Belgien
brachte. Hier mussten wir den Zug kurzfristig verlassen und einen Luftschutzkeller aufsuchen, weil Fliegeralarm
gemeldet wurde. Danach ging es wieder weiter nach Turut, Kortemark, Hauseme, Kautremollen, Zaren, Zarenlinde. Dort
wurden wir in verschiedene Gruppen aufgeteilt und einer Pionierkompanie auf dem Pionierpark Struwendorf zugewiesen.
Wir haben hinter Klerken Bunker für schwere Maschinengewehre gebaut. Unsere Arbeit konnten wir nur bei Nebel verrichten,
denn bei Sonnenschein waren wir sofort dem Beschuss der feindlichen Artillerie ausgesetzt. eine Kleinbahn die Munition
und Stacheldraht an die Front brachte war dem Beschuss besonders ausgesetzt. Die Gleise, von schweren Geschossen
zerfetzt, mussten immer wieder hergerichtet werden, damit der Nachschub aufrechterhalten werden konnte. Später haben
wir am Kemelberg bei Armentier, eine Brücke über die Lys gebaut. Um in dem Sumpfgelände einen Untergrund dafür zu
schaffen, mussten wir 10 bis 12 Meter lange Pfähle in den Boden rammen. Ein Feldwebel gab immer den Befehl: „Hoch den
Bär, noch viel mehr, dass man sieht, wie er zieht, denn dieser Pfahl, glatt wie ein Aal, durch Fels und Stein, durch
Wasser und Sand, fürs Vaterland”. Jedes mal mussten wir den Bär an Schnüren hochziehen und dann wieder herunterlassen.
Wenn es manchmal, trotz vieler Mühe nicht mehr weiter ging wurde der Pfahl auf eine bestimmte Länge abgeschnitten.
Nach Fertigstellung der Brücke kamen wir in die Siegfriedstellung bei Kambrei, zum Bau eines Bataillons-Gefechtstandes.
Da der Boden kreidehaltig war, mussten wir die großen Stücke von Hand zu Hand reichen, den Schutt haben wir dann mit
Sandsäcken aus der Baugrube gehoben und mit Ästen getarnt, damit der Stand nicht von feindlichen Fliegern entdeckt
werden konnte. Alle acht Stunden wechselte die Arbeitsgruppe. Wir mussten von der Baustelle durch das Gelände robben,
denn aufrecht gehend war man dem Beschuss der feindlichen Scharfschützen ausgesetzt, die von einem Fesselballon aus
informiert wurden der über den feindlichen Linien stand.
Der Wechsel war mit einem großen Risiko verbunden, und wurde wenn Möglich bei Dunkelheit vollzogen. Um vor
Überraschungen sicher zu sein haben wir spanische Reiter (Stacheldrahtverhaue) gebaut und vor die ersten Gräben
gestellt, die dann oft in der Nacht von den Franzosen geklaut, und dann vor ihren eigenen Linien wieder aufbaut wurden.
Wir hatten aus Bohlen eine Brücke auf Rädern gebaut, die dann in den Graben geschoben wurde, damit die Artillerie und
andere Fahrzeuge über die Schützengräben kamen. Weil um vier Uhr morgens der Beschuss mit Gasgranaten begann, mussten
wir Gasmasken aufsetzen, danach haben feindliche Flieger unsere Munitionskolonne bombardiert und total aufgerieben.
Es wurde auch eine Marinedivision eingesetzt, die bis dahin dem Küstenschutz gedient hatte und jetzt ihren ersten
Einsatz hatte.
Wir sind zuerst ein ganzes Stück in Richtung Amiens vorangekommen, doch dann blieb unser Angriff in den zuvor von
Engländern besetzten Stellungen, stecken. Da die Engländer ihre Stellungen fluchtartig verlassen hatten, fiel ihr
ganzer Proviant in unsere Hände; Schokolade, Weißbrot, Flaschenwein. Die erste Nacht haben wir in einem runden Zelt
verbracht, weil ich mir durch den starken Wind, der da herrschte eine Angina zugezogen hatte, die mit hohem Fieber
verbunden war, konnte ich die vielen Köstlichkeiten überhaupt nicht genießen.
An eine ärztliche Versorgung war überhaupt nicht zu denken, denn es mussten zuerst die vielen Granatlöcher eingeebnet
werden damit die vielen Fahrzeuge und Geschütze wieder weiter fahren konnten. Auch eine Bahnlinie musste repariert
werden, damit die großen Geschütze in Stellung gebracht werden konnten, dabei wurden auch die vielen Kriegsgefangenen,
die bei dieser Offensive gemacht wurden, eingesetzt. Als die Offensive dann schließlich scheiterte, wurden wir an die
Somme verlegt. Da habe ich die Ortelsburger Jäger, die aus Italien an die Westfront verlegt wurden, zum ersten Mal im
Einsatz gesehen.
Unser nächster Einsatzort waren dann Stellungen hinter Laon. Hier wurden die Vorbereitungen zu einer neuen Offensive
getroffen. Feindliche Flieger versuchten uns Tag und Nacht daran zu hindern die Aufmarschwege instand zu halten. Als
die Offensive dann endlich losging, hatten wir die Order eine Brücke über die Oise mit Bohlen und Balken zu verstärken.
Gleich am Anfang der Offensive mussten wir Gasmasken anlegen, um für alle Fälle gewappnet zu sein. Nur die Artillerie
und Kraftfahrzeuge durften die Landstraße benutzen, die Infanterie ging immer im Straßengraben und wurde von einer
Seite von Kopf bis Fuß mit Dreck bespritzt. Die Franzosen und Engländer haben hier schon Panzer eingesetzt, die von
Truppen aus den Kolonien gefahren wurden. Die Australier gingen mit umgekrempelten Ärmeln hinter den Panzern her.
Die letzte Offensive des Ersten Weltkrieges.
Zum Jahresende 1917 hatten noch 153 deutsche 175 alliierten Divisionen gegenübergestanden.
Zur Vorbereitung der Offensive ließ Ludendorff 39 Divisionen aus dem Osten und aus Italien heranziehen. Er ließ
spezielle Angriffsdivisionen formieren, die durch intensive Ausbildung auf den beabsichtigten, schnellen Vormarsch
vorbereitet wurden. 6608 Geschütze, 3500 Minenwerfer und 1070 Flugzeuge wurden hinter dem vorgesehenen
Angriffsabschnitt konzentriert. Den Ausbildungsbefehlen Ludendorffs, die bis zu den Kompanieführern herab verteilt
wurden, konnte man entnehmen, dass der Versuch, den Krieg mit einem mächtigen Schlag zu entscheiden schon in der
nächsten Zeit gewagt werden sollte. Wir übten die fast vergessenen Formen des Schützengefechts und des
Bewegungskrieges, auch wurde eifrig mit Gewehr und Maschinengewehr geschossen. Wir hegten keinen Zweifel daran, dass
der große Plan gelingen würde.
Den ganzen Winter 1917/18 über plante der Generalquartiermeister Ludendorff die deutsche Offensive. Zwar hatten die
Vereinigten Staaten von Amerika dem Deutschen Reich am 6. April 1917 den Krieg erklärt, aber vor dem Sommer des
Jahres 1918 war mit dem Auftreten von US-Truppen in relevanter Größenordnung nicht zu rechnen. Der deutschen Führung
blieb nur ein schmales Zeitfenster, um die Niederlage und den zu erwartenden Diktatfrieden abzuwenden. Ypern,
Armentieres, Arras, Cambrai oder Verdun wurden ernsthaft als Schauplätze erwogen. Ludendorf entschied sich für einen
Angriff zwischen Cambrai und La Fere – genau an der Nahtstelle zwischen der Französischen Armee und dem britischen
Expeditionscorps.
Der Fluss Somme bildete die Grenze zwischen Franzosen und Briten. Die Briten – nicht die Franzosen – sollten das Ziel
des Vorstoßes werden. Ihre Stellungen waren nur 130 Kilometer von der Kanalküste entfernt. Beim erreichen der
Sommemündung wäre die gesamte britische Armee eingeschlossen gewesen, denn hinter ihnen lag die Straße von Dover.
Am 21. März 1918 begann die letzte entscheidende Offensive des deutschen Westheeres im Ersten Weltkrieg. Der
Angriffsstreifen war 75 Kilometer breit. Dort hatte Ludendorff 43 Angriffsdivisionen konzentriert, dahinter 30
weitere Reservedivisionen, ihnen standen lediglich 26 britische Divisionen gegenüber. „Michael“ – so der Deckname der
„Kaiserschlacht“ – lief dank Ludendorffs akribischer Vorbereitung gut an. Der britische Oberbefehlshaber General
Douglas Haig erkannte die Chance, welche die Deutschen in dieser Situation hatten. Wollten die Deutschen diese Chance
nutzen, mussten sie darauf verzichten die Somme zu überschreiten, wo sie auf die französischen Reserven treffen und
sich von der Küste entfernen würden. Genau diesen Fehler begingen jedoch die Deutschen.
Am dritten Tag überschritt der linke Flügel mit der 18. Armee die Somme. Ludendorf stellte die Taktik über die
Strategie, wie er das bei Tannenberg und der Schlacht an den Masurischen Seen auch schon getan hatte. Ludendorffs
Befehl an die 18. Armee vom Abend des 22. März 1918 lautete: „Jetzt gilt es den Sieg auszunutzen, den Feind nicht zum
Stehen kommen zu lassen, Somme und Crozat-Kanal zu überschreiten, bevor feindliche Verstärkungen wirksam werden“.
Was Haig befürchtet hatte, trat nicht ein. Die deutsche Offensive Lief weiter Richtung Süden und lief sich schließlich
tot. Am 31 März war Ludendorff zu der Erkenntnis gekommen, dass „Michael“ gescheitert war. Am 5. April wurde die
Einstellung der Offensive befohlen. Im Hochsommer waren die US-Truppen in Frankreich angekommen und gingen mit den
Franzosen zum Angriff vor. Nur mühsam konnten Hindenburg und Ludendorf den Zusammenhalt der Front waren. Am 24. Oktober
1918 forderte US-Präsident Woodrow Wilson die bedingungslose Kapitulation, am 11.Nuvember Wurde der Waffenstillstand
von Compiegne unterzeichnet.
Zusammenbruch der Westfront und Waffenstillstand .
Als die Offensive dann letztendlich gescheitert war, wurden wir auf Eisenbahnwaggon verladen, in
eine Stellung vor Verdun gebracht und der siebenten bayerischen Division zugeteilt. Als wir ausgeladen wurden nahm der
Franzose den Bahnhof unter Beschuss. Eine Granate traf einen Waggon der mit Seifenpulver beladen war, so dass der ganze
Bahnhof aussah als wäre gerade Neuschnee gefallen. Wir gingen auf die Suche nach Kartoffeln. Als ich mit einem Sack,
vollbeladen die Böschung runter ging um zur Feldküche zu gelangen, schlug unweit von mir eine Granate ein und riss mir
den Sack vom Rücken. Ich bin mit dem Schrecken davon gekommen, mir war nichts passiert.
Der Bahnhof war menschenleer, nur ein par Kaninchen liefen verschreckt durch die Gegend und einigen Kameraden gelang
es welche einzufangen. Am nächsten Tag gelang es uns endlich die Feldküche zu erreichen. Als wir gerade beim Essen
fassen waren, schlug unweit eine Granate ein so dass Pflastersteine das Dach durchschlugen und wir das Weite suchen
mussten. und wir wieder nichts zu Essen bekamen. Ein Friseur aus unserer Kompanie fuhr immer ins Hinterland um uns
mit Proviant zu versorgen. Als er 14 Tage vor dem Zusammenbruch wieder mal zurückkam erzählte er uns schon das der
Krieg nicht mehr lange dauern würde, weil Kaiser Wilhelm mit Frack und Zylinder bekleidet, Deutschland verlassen und
ins Ausland gehen würde. In unserer Einheit hatten wir auch einen Juden der glaubte dass er sich alles erlauben darf.
Eines Morgens ging er in die Küche, als er keinen Koch vorfand stieg er auf die Gulaschkanone und hob den Deckel vom
Kessel in dem der Kaffee kochte an. Der kochende Kaffee verbrühte seine Füße so sehr das er sofort ins Lazarett musste,
für ihn war der Krieg somit zuende. Es kam noch ein Erlass, das Kameraden die 2 Jahre aktiv gedient hatten und
Gefreiter waren sofort zum Sergeanten befördert wurden. Für den 11. November 1918 war ein Waffenstillstand vereinbart
und ab 11 Uhr sollte nicht mehr geschossen werden. Wir hatten unsere Kopfkissen aufgetrennt und eine Kissenschlacht
veranstaltet, um auf diese Art und Weise unserer Freude Ausdruck zu verleihen. Als die Federn durch die Luft flogen
brachen wir in Tränen aus.
In jeder Kompanie wurde ein Soldatenrat gewählt, der aus drei Mann bestand. Wenn der Kompanieführer jemanden bestrafen
wollte, musste er erst den Soldatenrat fragen, der die Strafe befürworten, aber auch ablehnen konnte. Die Offiziere
durften keine Achselstücke mehr tragen, was für sie einer Degradierung gleich kam. Wir waren in einem Dorf
einquartiert und morgens zum Appell angetreten, als einer vom Soldatenrat sich stockbesoffen vor den auf dem Pferd
sitzenden Kompanieführer stellte und schrie: „Alles hört auf mein Kommando”. Der Kompaniechef war wie vom Blitz
getroffen, ihm versagte die Stimme. Wir sahen ein das dies nicht so weiter gehen kann und wählten einen neuen
Soldatenrat. Unser Rückzug begann bei Konflanz, einer Vorfestung von Metz und führte uns zunächst über die
luxemburgische Grenze, wo wir in einem Ort einquartiert wurden. Als wir für die Küche Holz aus dem Wald holen gingen,
entschieden wir uns eine Eiche abzusägen, ohne uns dessen bewusst zu sein, in welchem Forst wir uns befanden. Als wir
beim fällen waren fielen plötzlich Schüsse, die wir auch sofort erwiderten, bis uns ein Elsässer der sich in unserer
Kompanie befand aufklärte: „Kameraden, wir befinden uns hier auf Luxemburgischem Hoheitsgebiet”.
Wir sind dann weiter durch das Fürstentum Birkenfeld marschiert, wo das Städtchen Merzig für uns geflaggt hatte. Das
Elsass haben wir auch noch kurz gestreift. Wo wir bei einem Bauern, der uns kein Stroh für das Nachtlager geben wollte,
einquartiert wurden. Daraufhin gingen wir in die Scheune und haben uns selbst was besorgt. Wir haben dann noch erfahren,
sie hätten ein Schwein geschlachtet und warteten auf den Einzug der Franzosen. Als wir uns 1917, an der Ostfront, in
den in Karpaten, im Einsatz befanden, waren unter uns auch viele Elsässer. Sie durften ihre Heimatpost nicht in
französischer Sprache schreiben, mussten ihre Briefe offen auf der Schreibstube abgeben, wo sie zuerst kontrolliert
und dann abgeschickt wurden. Als ich in einer Nacht, mit einem Elsässer auf einem Vorposten Wache schieben musste,
wollte er mich überreden zum Russen überzulaufen. Als ich darauf nicht eingehen wollte verschwand er plötzlich in der
Dunkelheit und ich habe ihn nie wieder gesehen.
Wir sind dann weiter Richtung Worms und Ludwighafen gezogen, dort wurden wir bei einem Mühlenbesitzer einquartiert,
ein Unteroffizier und vier Mann. Obwohl wir verlaust und verdreckt waren bestand die Müllerin darauf das wir in ihren
Betten übernachteten. „Wenn alles durch ist”, sagte sie, „werde ich alles gründlich reinigen”. Der Müller brachte uns
eine Gießkanne voll Wein und sagte wir sollen es uns Schmecken lassen. Wir haben reichlich davon Gebrauch gemacht, so
dass ich gar nicht weiß wie ich ins Bett kam. Das war meine Erinnerung an die Pfalz. Manchmal waren wir auch 2 Tage im
Quartier.
Vor dem Weitemarsch wurde uns immer gesagt welche Truppe die Vorhut und welche Truppe die Nachhut übernehmen sollte.
Die Nachhut hielt immer Verbindung zu den nachrückenden Franzosen und man muss staunen wie alles reibungslos, ohne
Zwischenfälle von statten ging, was wir in erster Linie dem General-Feldmarschall Paul von Hindenburg zu verdanken
haben, der den Rückzug an der Westfront koordiniert hat.
In Köln angekommen, erhielten wir im Volkshaus unsere Entlassungspapiere, Eisenbahnfahrscheine, Reisepässe,
unterschrieben von Oberstleutnant Mann. Wir mussten Köln umgehend verlassen, weil schon am nächsten Tag die
französischen Besatzungstruppen in einmarschieren sollten. Wir fuhren mit einem Zug der bis Allenstein fuhr, dort
wurden unsere Papiere vom Soldatenrat kontrolliert. Die jüngren Jahrgänge wurden festgehalten, zu neuen Einheiten
zusammengestellt und zur Sicherung der Ostgrenze gegen die Bolschewisten abkommandiert. Ich hatte gesagt das ich noch
einen Schrapnellsplitter in der Kreuzbeingegend habe und durfte daraufhin nach Hause fahren.
Kaum in Ortelsburg angekommen fiel ich wieder dem Soldatenrat in die Hände. Sie haben alles durchsucht, haben mir mein
Seitengewehr und eine Decke abgenommen, aber ich durfte weiter und bin dann kurz vor Weihnachten 1918 auf dem
elterlichen Hof angekommen. Schon auf dem Hof habe ich meine Kleider vom Leib gerissen, weil vor Läusen und anderem
Ungeziefer nicht mehr aushalten konnte und mich erst gründlich gewaschen bevor ich das elterliche Haus betreten habe.
Die Freude über das Wiedersehen war sehr groß.
“ Unser Leben zwischen den beiden Weltkriegen.”
Endlich wieder zurück in der Heimat
Rohmanen war durch die Kampfhandlungen 1914/15 zu einem drittel zerstört worden, aber schon
wieder im Aufbau. Die Firma Grzella aus Ortelsburg hatte die Bauarbeiten übernommen. Unter der Aufsicht von Polier
Karl Kontor wurden die Dachstühle errichtet. Ich habe mich, nach kurzer Erholungspause, auch als Zimmermanngehilfe am
Wiederaufbau beteiligt. Die Firma Grzella hat das Material geliefert und auch unsere Löhne gezahlt. Wegen meinem
Steckschuss bin ich dem VDK beigetreten und habe mit dessen Hilfe eine Rente beantragt die mir auch bewilligt wurde.
Nach vier Jahren wurde ich nach Allenstein zur Nachuntersuchung vorgeladen. Die ärztliche Untersuchung hatte ergeben,
das Geschoß sei verkapselt, und nur das linke Bein etwas in Mitleidenschaft gezogen. Daraufhin wurde die Rentenzahlung
eingestellt.
Der Stellmacher Adam Ornowski war im Krieg als Sanitäter eingesetzt und hatte auf Grund seiner Erfahrungen,
 Beziehungen zum medizinischen Dienst in Ortelsburg aufgebaut. Es wurden dort Lehrgänge in Erster Hilfe angeboten,
die von Prof. Dr. Kutz geleitet wurden. Adam Ornowski hat dafür gesorgt das einige junge Männer aus Rohmanen daran
teilnehmen konnten. Adam Ornowski, August Linka, Emil Rosowski, Johann Dembek, Emil Baschek und ich sind dann dem
Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes beigetreten und mussten jeden Sonntag am Lehrgang teilnehmen. Unser
Gruppenführer war Kreisobersekretär Albrecht, Landrat von Poser, als unser Ehrenvorsitzender, hat viel zu unserer
finanziellen Unterstützung beigetragen und hat dafür gesorgt dass die Bereitschaft eingekleidet wurde.
Beziehungen zum medizinischen Dienst in Ortelsburg aufgebaut. Es wurden dort Lehrgänge in Erster Hilfe angeboten,
die von Prof. Dr. Kutz geleitet wurden. Adam Ornowski hat dafür gesorgt das einige junge Männer aus Rohmanen daran
teilnehmen konnten. Adam Ornowski, August Linka, Emil Rosowski, Johann Dembek, Emil Baschek und ich sind dann dem
Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes beigetreten und mussten jeden Sonntag am Lehrgang teilnehmen. Unser
Gruppenführer war Kreisobersekretär Albrecht, Landrat von Poser, als unser Ehrenvorsitzender, hat viel zu unserer
finanziellen Unterstützung beigetragen und hat dafür gesorgt dass die Bereitschaft eingekleidet wurde.
In jedem Dorf wurde eine Unfallstelle eingerichtet, mit einem Verbandskasten und mit Verbandsmaterial für die erste
Hilfe ausgerüstet. Die Unfallstelle in Rohmanen, die am Haus von der Straßenseite, durch eine Tafel mit einem roten
Kreuz gekennzeichnet war, hatte ich zu verantworten. An Sonntagen wurden wir an Badestellen und bei Fußballspielen
eingesetzt, haben viele Übungen bei Waldbränden durchgeführt und auch Ausflüge nach Rudzany am Niedersee gemacht. Bei
der Einweihung des Tannenbergdenkmals in der Nähe von Hohenstein kamen wir an Straßenkreuzungen zum Einsatz.
Rohmanen hatte auch eine freiwillige Feuerwehr. Bis zum ersten Weltkrieg hat Friedrich Biella als Brandmeister das
Kommando gehabt. Er war aktiver Unteroffizier, hatte gute Führungsqualitäten und die Männer, die allesamt aus dem
aktiven Militärdienst stammten hatten zu ihm ein großes Vertrauen. Nach dem Krieg wollten diese Männer,
(Friedrich Nickel, Friedrich Willam, Julius Wittkowski, Jakob Janowski, Johann Gloddek, Gustav Bednarz), nicht mehr
weitermachen. Friedrich Biella, der inzwischen zum Gemeindevorsteher gewählt wurde, hat sich dann auf einer
Gemeinderatsitzung vorgeschlagen, für die Freiwillige Feuerwehr jüngere Kräfte anzuwerben.
Zum Brandmeister hat er Herrn Wilhelm Pilath vorgeschlagen. Der wurde dann nach Königsberg zur Fortbildung geschickt.
Der Feuerwehr gehörten nun folgende Personen an: Wilhelm Pilath(Brandmeister), August Linka(Stellvertreter), Gustav
Deptolla, Julius Matzey, Johann Dembek, Willy Willam, Gustav Rattay. Der Kreisbrandmeister war Heinrich Thalmann aus
Ortelsburg, sein Stellvertreter war Kreisobersekretär Salzmann. Der Bezirks-Kommissar bei der Ostpreußischen
Feuersozität War Herr Ernst Trzaska. Er hat dafür gesorgt das die Wehr uniformiert und mit Löschgeräten ausgerüstet
wurde. Da die alten Schläuche schon sehr marode waren, wurden sie durch moderne ersetzt, deren Kupplungen auch mit der
Motorspritze übereinstimmten.
Ernst Trzaska hat bei der Feuersozität und beim Landratsamt Finanzmittel beantragt und auch genehmigt bekommen. Der
Schneidermeister Wilhelm Baran wurde beauftragt Tuch und Drillichanzüge nach Maas zu schneidern. Er hat uns
Stoffmuster vorgelegt aus denen wir wählen sollten. Feuerwehrhelme haben wir auch bekommen. Die Gemeinde musste
Finanzmittel bereitstellen, einen Prozentsatz vom Gemeindebudget. Im Brandfall mussten für den Spritzenwagen Pferde
zur Verfügung stehen, von Willy Willam, Gustav Rattay, Julius Matzey und Gustav Dorka, weil sie in der Nähe des
Spritzenhauses wohnten. Am Spritzenhaus wurde ein großer Baum mit Querleisten aufgestellt, wo nach jedem Brand oder
einer größeren Übung die Schläuche zum trocknen aufgehängt wurden.
Der Kreisbrandmeister hat mindestens 2-3-mal im Jahr die Wehren besichtigt. Das ganze Dorf war dann auf den Beinen,
die Bauern mit Pferden, und andere Dorfbewohner mit Eimern und Spaten, wurden dann in verschiedene Gruppen eingeteilt.
Erst hat die Wehr sämtliche Aufstellungen am Gerät geübt; Grundstellung Fahrstellung und Marschstellung. Dann wurde
ein Brand angekündigt, die Feuerwehr mit der Spritze an den Brunnen, die Gruppen dort wohin sie beordert wurden, die
Bauern brachten mit den Wasserkiwen Wasser aus dem Brunnen zum Brandort. Wenn das Wasser im Brunnen alle wurde hat
man den Saugkorb in die Kiewen gelegt und dort Wasser entnommen. Die Wassergruppe ging mit Eimern zum Dorfteich, holte
Wasser und füllte damit die leeren Kiewen.
Der Löschtrupp ging mit Feuerhaken und Löschpatschen auf die umliegenden Gehöfte und versuchte das vermeintliche Feuer
von ihnen fernzuhalten. Nach dem Alarm wurde wieder am Spritzenhaus angetreten. Die Gruppenführer mussten angeben ob
ihre Gruppe auch vollständig erschienen war, denn Übungen wurden nur vor, oder nach der Feldarbeit durchgeführt, so
dass niemand eine Entschuldigung vorbringen konnte. Wer ohne begründete Entschuldigung nicht anwesend war erhielt eine
Verwarnung. Der Kreisbrandmeister erklärte dann welche Handgriffe den Vorschriften entsprachen und welche nicht. Die
Schläuche wurden noch schnell zum Trocknen aufgehängt. Anschließend gingen wir alle in den Gasthof Trzaska, haben über
vorhandene Mängel diskutiert, Verbesserungsvorschläge unterbreitet und zwischendurch den Durst gelöscht. Der
Kreisbrandmeister ist dann, nach einer kurzen Verabschiedung, ins nächste Dorf gefahren, weil er an einem Tag mehrere
Feuerwehren betreuen musste.
Der Rohmaner Dorffriedhof

Einen Kilometer vom Ende des Dorfes entfernt, auf der rechten Seite der Landstraße in Richtung
Ortelsburg, befand sich der Rohmaner Dorffriedhof. Wann dieser Friedhof angelegt wurde entzieht sich meiner Kenntnis.
Nach Aussagen älterer Dorfbewohner soll davor auch schon eine Ruhestätte vorhanden gewesen sein, und
zwar auf der linken Straßenseite gegenüber dem jetzigen Friedhof. An dieser Stelle befand sich bis in die
Nachkriegszeit ein kleiner Brunnen, aus dem die Dorfbewohner, das Wasser zum begießen der Grabbepflanzung auf den
Gräbern ihrer verstorbenen Angehörigen holten. Der Friedhof war in einer Hanglage angelegt, wahrscheinlich weil diese
Parzelle für eine landwirtschaftliche Nutzung nicht geeignet war. Um das Gräberfeld vor herumstreunenden Tieren oder
von der Weide entlaufenen Kühen zu schützen, hat man das ganze Gelände mit einem Holzzaun umgeben. Der Zugang befand
sich von der Straßenseite. Unter einem Torbogen hindurch wurden die Verstorbenen zu Grabe getragen. Die Gräber der
einzelnen Familien waren nebeneinander angelegt, mache, wie zum Beispiel die der Familie Trzaska, sogar mit einem
schmiedeeisernen Zaun eingefasst.
Nach dem 2. Weltkrieg verfiel der Friedhof immer mehr. Die nötigen Finanzmittel für die Pflege der Einfriedung konnten
von den restlichen noch verbliebenen Deutschen nicht mehr aufgebracht werden. An den gepflegten Gräbern konnte man noch
erkennen dass es Verwandte von noch in Rohmanen wohnenden Deutschen waren, oder von bereits im Westen Deutschlands
lebenden, die ihre noch in Rohmanen wohnenden Nachbarn damit beauftragt hatten. Die übrigen Gräber wurden von Jahr zu
Jahr immer mehr von Wildkräutern überwuchert und schließlich auch von Sträuchern und schnell wachsenden Bäumen.
In den späteren Jahren konnte man nicht mehr erkennen dass dort vor Jahren Tote zur letzten Ruhe gebettet wurden. Die
Natur holte sich das ganze Gelände zurück und nur unter großen Schwierigkeiten konnten Besucher aus dem Westen das
Friedhofsgelände noch betreten.
Das Gasthaus Trzaska

Nach dem ersten Weltkrieg hat der Gastwirt Friedrich Trzaska neben dem Gasthof einen großen Saal
für Festlichkeiten und Vereinsfeiern gebaut, in dem schon mal Feuerwehrfeste veranstaltet wurden. Ernst Trzaska war
Feuerkommissar bei der Ostpreußischen Feuersozität. Erich Trzaska war Vollziehungsbeamter beim Amtsgericht in
Ortelsburg. Unser Feuerkommissar war uns beim organisieren der Veranstaltungen sehr behilflich, hat uns den Saal, die
Musik und die Theaterstücke besorgt und die Feuerwehren aus den Nachbardörfern eingeladen.
Zu Manöverzeiten, vor dem 2. Weltkrieg und dann auch während des Krieges, waren im Gasthof Soldaten, meist im Range
eines Offiziers, einquartiert. Fräulein Mariechen Trzaska hat die Poststelle im Dorf betreut. Nachdem ich 1939 zum
Militär eingezogen wurde, hat sie, nach einer Schulung im Ortelsburger Krankenhaus, auch die Unfallmeldestelle
übernommen. Nach dem Krieg, pflegte sie mit vielen Bekannten, die bereits in der Bundesrepublik wohnten, einen regen
Briefwechsel. Auf dem Rohmaner Friedhof hat sie viele Gräber, im Auftrag von Angehörigen, die auf Grund ihrer
Abwesenheit, dazu nicht mehr in der Lage waren, gepflegt. Der Bauunternehmer Kurnitzki aus Ortelsburg, äußerte die
Bitte, sie möchte ihm doch ein Blatt vom Rosenstrauch, der auf dem Grab seiner Eltern steht, in den Brief legen. Als
sie uns den Brief vorgelesen hat, waren wir zu Tränen Gerührt. Sie hat als Letzte aus ihrer Familie, bis zu ihrem Tod
im Jahre 1960, in Rohmanen, im Gebäude der Gastwirtschaft gewohnt und ist auf dem Rohmaner Friedhof beerdigt worden.
Fleisch und Wurstwaren Karl Pelkowski
Im Jahr 1931 hat der Fleischermeister Karl Pelkowski, aus Grammen, direkt neben unserem Hof ein
Anwesen gekauft und dort eine Fleischerei eingerichtet. Er war mit meiner Schwester Frieda, verheiratet. Am Anfang hat
er die Schweine noch auf seinem Hof geschlachtet, später dann im Ortelsburger Schlachthof. Jede Woche fuhr er 2-mal,
mit dem Pferdewagen(Einspänner), nach Ortelsburg zum Wochenmarkt, wo er seine Fleisch und Wurstwaren zu Verkauf anbot.
Am Tag davor, wenn er die Wurst gekocht hat, kamen viele Rohmaner mit Kannen oder anderen Gefäßen, wegen der guten
Wurstsuppe, die er umsonst unter die Leute verteilte. Als Karl Pelkowski, Ende August 1939 zum Militär eingezogen
wurde, hat seine Frau das Pferd verkauft und den Beitrieb stillgelegt. Am Haus hing, immer noch die Tafel mit der
Aufschrift: Karl Pelkowski, Fleisch und Wurstwaren. Ein Witzbold hat irgendwann darunter geschrieben; „Fleisch und
Wurst waren einmal”, drauf hin hat Frau Pelkowski die Tafel entfernen lassen. Karl Pelkowski ist im Mai 1946 in
französischer Gefangenschaft verstorben. Seine Ehefrau Frieda, verstarb an ihrem 85. Geburtstag in Mettmann bei
Düsseldorf.
Die steinreichen Rohmaner Felder
Die letzte Eiszeit hat bei der Schmelze, auf der Rohmaner Feldgemarkung viele Steine und
Granitblöcke zurück gelassen. Überirdisch, aber besonders unter der Erde, gab es viele kleine, aber auch große Steine,
die, den Bauern, beim Pflügen und anderen Feldarbeiten sehr viel Schweiß, abverlangten. In einer Kiesgrube, auf dem
Feld des Bauern August Radek, lag ein Granitblock, von schätzungsweise 100 cbm. Vor etwa 80 Jahren, als man für diese
Steine noch keine Verwendung hatte, griffen die Bauern zu einer „List”. Weil er sonst nicht pflügen konnte, hat mancher
seinem Nachbarn, die Steine in der Nacht auf dessen Feld abgeladen. Als diese Tätigkeit unter Strafe gestellt wurde,
hat man die Steine in Schluchten gekippt und mit Mutterboden zugeschüttet. In späteren Jahren kam diese jedoch beim
pflügen wieder an die Oberfläche. Dann hat man aber schon Steine für den Straßenbau gebraucht und konnte sie so zu Geld
machen. Besonders im Raum südlich von Ortelsburg, bis zur polnischen Grenze, wo Steine eine Rarität waren, kamen sie
jetzt zum Einsatz. Auch beim Bau von Häusern, besonders für die Fundamente, wurden sie eingesetzt, weil auf diese
Weise viel Ziegeln eingespart wurden. Die Firma Gribienski aus Ortelsburg hat die großen Steine mit Dynamit gesprengt
und auf diese Weise die weitere Verarbeitung erleichtert.
Die Steine welche beim Pflügen aus dem Boden geholt wurden, hat man am Feldrand auf große Haufen zusammen getragen.
Wenn die Feldarbeit beendet war, sowie auch in den Wintermonaten, waren wir jeden Tag mit Steinen unterwegs. Wir sind
vorwiegend am Abend los gefahren, weil unter der schweren Last die Wagenachsen so heiß wurden und die Gefahr bestand,
das durch die Dehnung, die Räder blockiert würden. Bei einer Fahrt konnte man bis zu 24 Reichsmark verdienen, wogegen
1 Zentner Roggen für 8 bis 9 Reichsmark zu haben war. Ich bin selbst, mit dem Pferdewagen bis Fürstenwalde, Radostowen,
Luka, Altkirchen, Höhenwerder, ja sogar bis Friedrichshof gefahren.
In Rohmanen wurden auch rote Ziegeln gebrannt. Viele Häuser wurden, mit Ziegeln erbaut, die nur wenige 100 Meter von
der Baustelle entfernt hergestellt wurden. Der Lehn wurde auf den Feldern in der näheren Umgebung entnommen, dann von
Ochsen solange getreten, bis er so geschmeidig war, das er sich in Formen einstreichen ließ. Wenn die Ziegel in der
Form trocken war, wurde sie entnommen und in einem Brennofen gestapelt. Um einen Ofen richtig anzufeuern, brauchte man
12 Raummeter Holz, das im Zeitraum von ein par Tagen verheizt wurde. Der Fischer Karl Glitza hatte schon eine
Knetmaschine, die von einem Pferd angetrieben wurde, das mit verbundenen Augen, den ganzen Tag in die Runde ging.
Im Dorf waren auch vier Kalköfen, in denen so genannte Kalksteine, die sich an gewissen Stellen, im Erdboden befanden,
gebrannt wurden. Nach dem Brennen wurden die Steine mit Wasser abgelöscht und die daraus entstandne Masse diente, nach
dem Beimischen einer gewissen Menge Sand, dann als Bindemittel beim Häuserbau. Das Gerichtsgebäude und das
Lehrerseminar in Ortelsburg wurden mit Kalk, aus dem Rohmaner Brennöfen erbaut. Auch zum Bau einer Eisenbahnbrücke, auf
der, der Zug, den Sawitzfluß, von Ortelsburg nach Allenstein überquerte, hat mein Großvater, mit einem Ochsengespann,
Kalk gefahren.
Hinter der Scheune, beim Bauern Johann Dembek hat man Tonerde gefördert, aus der man mit Hilfe einer Formerscheibe,
die von einem Arbeiter mit Muskelkraft(Fußbetrieb) angetrieben wurde, schöne Krüge, Schalen und Vasen geformt hat.
Die Töpferware wurde, nachdem sie trocken genug war, auch in einem Ofen gebrannt, anschließend mit einer Lasur
überzogen und wieder gebrannt. Es wurden auch Kacheln zum Bau von Kachelöfen hergestellt, die mit verschiedenen
Ornamenten versehen, die Wohnstuben unserer Vorfahren schmückten. So haben unsere Großväter ihr Leben gemeistert und
nach und nach, unsere Dörfer aus der Rückständigkeit in die Neuzeit geführt.
Das gesellschaftliche Leben nach dem 1. Weltkrieg

Als der Lehrer Alfred Dorka, ein Frontkämpfer des Ersten Weltkrieges und ein Sportsmann, als
zweite Lehrkraft an der Rohmaner Schule angestellt wurde, hat er die Sitten und Gebräuche aus früherer Zeit wieder zum
Leben erweckt. Zuerst hat er die Jugend zusammen gerufen, einen Jugendverein und einen Fußballclub, gegründet. Zum
Vorsitzenden des Fußballclubs wurde Johann Gloddek berufen, der ihn auch geleitet hat. Bauer Wilhelm Spittka, der am
Rohmaner See wohnte, stellte Land für einen Sportplatz unentgeltlich zur Verfügung. Lehrer Alfred Dorka hat am
Rohmaner See eine Badestelle ausgesucht und ein Sprungbrett bauen lassen. An jedem Sonnabend im Sommer, bevor die
Sonne unterging, versammelte sich die gestammte Jugend des Dorfes an der Badestelle am See. Es wurde gebadet,
Heimatlieder gesungen, gespielt, im Fackelschein eines großen Biwakfeuers, bis in die späte Nacht hinein. Der Fischer
Karl Glitza hat uns Kähne zur Verfügung gestellt, mit denen wir auf den See hinausgepaddelt sind, dabei hatten wir viel
Spaß, was wiederum den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft gefördert hat. Ich habe mit meiner Mandoline den Gesang von
Volks- und Heimatliedern begleitet.
Der Rohmaner See liegt in einem Tal, dessen Hänge zu beiden Seiten mit Kiefern und Tannen bewaldet sind. Wenn man
gesungen oder Musiziert hat, hallte es von den Hängen zurück. Die Ufer waren mit Kalmus und Schilf bewachsen, was für
die Fischaufzucht von Vorteil war. Wenn man an einem sonnigen, windstillen Tag, am Seeufer spazieren ging, traf man
oft auf Flachstellen, an denen sich die Fischbrut im Sonnenlicht wärmte, wie ein Mückenschwarm. Im See befanden sich
folgende Fische: Karpfen, Hechte, Schleie, Barsche Plötze, Rotaugen, Aale und Krebse. Am Sonntagmorgen brachten viele
Rohmaner ihre Pferde zum See um sie zu baden.
Es wurden dort, unter der Aufsicht von Lehrer Dorka, auch viele Jugendfeste mit Theatervorführungen veranstaltet, zu
denen er selbst die Vorlagen organisiert hat. Der am See wohnende Bauer Johann Nadrowski, hat uns ein Scheunentor, als
Tanzboden zur Verfügung gestellt. Der Zimmermann Wilhelm Wittek hat uns eine Windmühle gebaut, die am auf dem Boden
liegenden Scheunentor aufgestellt wurde, dazu kamen Noch Tannen und Fichten, die das Ganze wie ein Bühnenbild
erscheinen ließen. Es wunden viele Bühnenstücke aufgeführt, unter anderen >Alte Weiber werden jung gemahlen<. Dazu bot
die Windmühle die entsprechende Kulisse.
Nach der Vorführung wurde der Boden aufgeräumt, um dann als Tanzdiele zur Verfügung zu stehen. Der Gastwirt Trzaska
hatte Tische und Bänke aufgestellt, Speisen und Getränke angeboten, so dass sich die die Veranstaltung bis in die
späte Nacht hinein zog. Es waren auch Leute aus Ortelsburg und anderen Nachbardörfern dabei. Im Winter hat Lehrer
Dorka eine Kreisrodelbahn eingerichtet, die von Zeit zu Zeit mit Wasser besprengt wurde, um die Gleitfähigkeit zu
verbessern. Von einer Anhöhe ging hinunter bis auf den halben See, was für alle ein großes Vergnügen war. Es kamen
Lehrer mit Schulklassen aus der näheren Umgebung um hier zu Rodeln.
Als Herr Lehrer Jobski als Hauptlehrer nach Rohmanen kam hat er mit dem Bürgermeister und der Gemeindeverwaltung
beschlossen, in der Nähe des Dorfes, auf einem zur Schule gehörenden Grundstück, einen Sportplatz anzulegen. Dafür
wurde gleich hinter den Gärten, 6 Morgen Ackerland abgetrennt, und nach Feierabend hat Lehrer Dorka mit den
Jugendlichen eingeebnet und gleich nebenan einen Graben für Schützenstand und Kugelfang ausgehoben. Am Sonntagvormittag
wurde Fußball gespielt und um 15:00 Uhr war Kleinkalieberschießen angesagt. Es musste auch ein kleiner Beitrag erhoben
werden, um Munition kaufen zu können. Eine Büchse konnten wir aus beim Kleinkalieberverein in Ortelsburg ausleihen.
Nach Hitlers Machtergreifung
Als Adolf Hitler an die Macht kam wurde die SA gegründet. Der Bürgermeister Michael Kownatzki
wurde zum Gruppenführer ernannt und folgende Männer haben sich freiwillig gemeldet: Wilhelm Matzey, Johann Gloddek,
Gustav Nadrowski, August Buttler, Karl Baran, Emil Nickel, Wilhelm Jaschinski, Emil Bork, Ernst Rattay und Gustav Bach.
Bei Versammlungen war die SA in Uniform angetreten um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Wer versucht hat Unruhe zu
stiften, egal aus welchem Grunde, wurde aufgefordert den Saal zu verlassen, andernfalls wurde er mit Gewalt entfernt.
Herr Lehrer Jobski wurde zum politischen Leiter ernannt, seine Frau hat die NS-Frauenschaft gegründet, Lehrer Dorka
die HJ, und so bekam die Dorfgemeinschaft, nach und nach ein anderes Gesicht. Der Sportplatz und der Schützenstand
wurden jetzt mehr als früher in den Mittelpunkt gestellt. Nach der Feldarbeit hat der Bürgermeister Fuhrwerke bestellt
und den Sportplatz noch besser herrichten lassen.
Der Bauer Wilhelm Both wurde zum Ortsbauernführer ernannt, mit der Aufgabe alles Land für den Anbau von Getreide und
Futtermittel bereitzustellen, oder wenn das nicht möglich war mit Wald aufzuforsten. Durch den Einsatz von Kunstdüngern
sollten größere Erträge aus dem Boden geholt werden, um den Viehbestand zu vergrößern und mehr Milch und Butter zu
produzieren. Deutschland sollte im Stande sein sich selbst zu selbst zu ernähren, ohne auf Importe angewiesen zu sein.
Frau Jobski hat, innerhalb der der NS-Frauenschaft, mit Hilfe von Fachkräften aus Ortelsburg, Lehrgänge veranstaltet,
auf denen man Backen und Nähen lernte. Auf den Bauernhöfen befand sich auch immer mehr Rassegeflügel, das eine erhöhte
Produktion von Eiern und Geflügelfleisch sicherstellen sollte.
Die Rohmaner Bauern hatten, außer in der Landwirtschaft, noch andere Verdienstmöglichkeiten in der Kreisstadt. In
Ortelsburg wurden vier Sägewerke betrieben, die mit Langholz aus dem Walde versorgt werden mussten. Wir haben eine
Kiefer von über 8 Festmeter angefahren, der wir zuerst 6 Meter Spitze abschneiden mussten, um diese Last überhaupt
auf den Wagen zu bekommen. Sechs Pferde musste angespannt werden um den Wagen zur befestigten Straße zu bringen.
Fichten und Tannen wuchsen bis zu einer Länge von 30 Metern. Auch beim Transport von Ziegel, von der Ziegelei zum
Bahnhof, konnte man gutes Geld verdienen.
Im Jahr 1934 wurde Rohmanen an das überregionale Stromnetz angeschlossen und schaffte auf diese Weise den Sprung von
der Petroleumlampe zur Glühbirne. Neben dem Grundstück von Karl Pietzonka wurde ein Transformatorhäuschen errichtet,
in dem der ankommende Strom von einer Hochspannung auf eine Verbrauchsspannung transformiert wurde. Es gab schon eine
Überlandleitung, die aus Richtung Ortelsburg kommend, quer über die Felder, in Richtung Neu Keykuth weiter ging.
Durch eine Zwischenspanne wurde der Transformator, mit der Hauptleitung auf Kownatzkis Feld verbunden.
Ein Stromanschluss konnte die Arbeit im Haus und Hof auf vielfältige Weise erleichtern, doch nur die besser gestellten
Bauern, sowie noch manche Pensionäre, die ein festes Einkommen hatten, konnten sich dass leisten. Weil nur wenige an
der Elektrifizierung teilnahmen, war ein Stromanschluss mit hohen Kosten verbunden. Nur Gustav Pietzonka, Gasthof
Trzaska, Friedrich Nickel, die Schule und Wilhelm Both, wurden in der ersten Phase erfasst.
Im Jahr 1952 wurde von den polnischen Behörden die zweite Stufe der Elektrifizierung eingeleitet, in der alle im Dorf
stehen Gebäude erfasst wurden. Am Anfang wurden nur Leitungen für Lichtstrom gelegt und auch nur 3 Lichtstellen pro
Haushalt bewilligt. Doch im nachfolgenden Zeitraum wurden dann, wenn Material vorhanden war, weitere Lichtpunkte
angelegt. 1952, am zweiten Wochenende im Advent, wurden dann die Leitungen geschaltet und alle waren von der
plötzlichen Helligkeit sehr begeistert. Wenn man Glühbirnen auswechseln wollte musste man am Anfang weite Wege
zurücklegen, um welche zu bekommen. In den 60ger Jahren wurden dann immer mehr Starkstromleitungen gelegt, weil die
Bauern elektrische Geräte kaufen konnten. Ende der 60ger wurden auch die Abbauten an das Stromnetz angeschlossen.
Das Urnengrab auf unserem Feld
Auf unserem Feld, in Richtung Seelonken, bin ich oft beim pflügen gegen Steine gestoßen, manchmal
rissen sogar die Stränge am Pferdegeschirr. Eines Tages nahm ich einen Spaten, Brechstange und einen langen Baum, um
der Sache auf den Grund zu gehen. Als ich eine Menge Sand ausgehoben hatte stieß ich auf eine steile, aus Steinen
errichtete Wand, die ich auch mit dem Baum nicht aus der Fassung bringen konnte. Ich habe den ganzen Vormittag gegraben,
konnte jedoch nicht unter die Steine kommen. Einige Tage später hatten wir in der Schule eine Bauernversammlung, da
habe ich Herrn Biella und Herrn Lehrer Dorka von meinem Fund berichtet. Am nächsten Morgen kam der Lehrer Dorka mit der
ganzen Schulklasse, mit Spaten und Sieben ausgerüstet auf unser Feld und fingen an die ausgehobene Erde zu sieben.
Lehrer Dorka benachrichtigte daraufhin den Leiter des Ortelsburger Heimatmuseums, der am nächsten Morgen vorbei kam um
sich die Fundstelle genau anzusehen. Er beauftragte ihn 4 Mann zu besorgen, um die Steine ringsum frei zu schaufeln.
Zwischen den Steinen durften wir die Erde nur mit Esslöffeln ausheben. Als es plötzlich zu regnen anfing hat Lehrer
Dorka die Brauerei Daum, in Ortelsburg angerufen, die uns über der Fundstelle ein Zelt errichtet haben, damit wir
ungestört weiterarbeiten konnten. Wir fanden 8 flache und 8 hohe Urnen zu beiden Seiten am Körper. Die Urnen wurden in
Gipsbinden eingewickelt und ins Heimatmuseum nach Ortelsburg gebracht, wo sie durch einen Fachmann, der extra aus einem
Königsberger Museum angereist war. Nach Reinigung der Urnen hat er festgestellt, das die Grabstätte etwa 2000 Jahre vor
Christi Geburt angelegt wurde und ein Doppelgrab war, in dem ein Toter liegend und einer in Hochstellung beigesetzt
wurde.
Die Nachricht von der Fundstelle verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Es erschienen viele Schaulustige, ganze
Schulklassen aus der Umgebung, mit Autos und zu Fuß. Durch die vielen Menschen wurden die bestellten Ackerflächen auf
unserem Feld sehr in Mitleidenschaft gezogen, eine Entschädigung haben wir nicht erhalten. Das Grab wurde vor dem
Heimatmuseum in Ortelsburg wieder so aufgebaut wie man es auf unserem Feld vorgefunden hat. Für den Transport der
Steine wurde ich entlohnt. Die Urnen hat das Königsberger Museum an sich genommen und wollte sie nicht wieder hergeben,
weil die solch einen Fund noch nicht in ihrer Sammlung hatten.
Sonnenwendfeuer
Am 24 Juni fand eine Sonnenwendfeier statt. Ein Brauch der an die alten Germanen erinnern sollte.
Der Lehrer Dorka hat den Bürgermeister beauftragt 2 Fuhrwerke in den Wald zu schicken, die Holz und alten Reisig holen
und auf dem großen Schulberg abladen sollten. Das Straßenbauamt hat uns Teertonnen zur Verfügung gestellt. Die ganze
Dorfgemeinschaft wurde eingeladen, am Abend, nach der Feldarbeit, an der Sonnenwendfeier teilzunehmen. Lehrer Dorka
hielt zuerst eine Ansprache, in der er anschaulich erklärte wie unsere Vorfahren in grauer Vorzeit gefeiert haben.
Nach dem offiziellen Teil wurden das Holz und die Teertonnen angezündet, es wurden Heimatlieder gesungen, wie: Wild
flutet der See, drauf schaukelt der Schiffer den schwankenden Kahn, Schaum wälzt er wie Schnee, von grausiger Mitte
zum Ufer heran, wild fluten die Wellen auf Vaterlands See, wie schön, oh trag mich auf Spiegel zu Hügel, Masovias See.
Masovia Land, mein Heimatland, Masovia es lebe mein Vaterland.
Lehrer Alfred Dorka und sein Wirken für Rohmanen.

Friedrich Biella hatte auf seinem Feld einen Granitstein mit einer geraden Seite, den haben wir
mit viel Schweiß an den Dorfteich transportiert und auf einer Erhöhung abgelegt. Der Stein sollte zum Denkmahl für die
Gefallenen des Ersten Weltkrieges umgestaltet werden. Da zu Wenige daran ein Interesse zeigten, wurde diese Idee fallen
gelassen und der Stein irgendwann ins Wasser gerollt. Der Lehrer Dorka war viele Jahre in Rohmanen tätig, dort hat er
später seine ehemalige Schülerin, Lotte Biella geheiratet. Er hat sich sehr für die Entwicklung des Dorfes interessiert,
war bei jeder Gemeindeversammlung anwesend und hat auf Schwachstellen hingewiesen die den Fortschritt behinderten.
Gemeinsam mit den Schülern hat er den Ehrenfriedhof für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges gepflegt, an der
Wegegablung nach Eichtal und zu Ehren des Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg eine Eiche gepflanzt.
Zum Advent hat Lehrer Dorka mit der Jugend einen Adventstern, in verschiedenen Farben gebastelt.
Der Stern wurde auf einer 2 Meter langen Stange befestigt, in der Mitte wurde ein Wachslicht angezündet, am Stern
wurde eine Schnur angebracht, wenn man daran zog rollte der Stern hin und her. Am ersten Wochenende im Advent
versammelten sich jung und alt, um den Stern durch das Dorf zu tragen. Alle schlossen sich dem vorausgehenden
Sternträger an, der den Stern durch die Hauptstraße und die angrenzenden Wege trug. Dieser Sternmarsch wurde an den
folgenden Adventwochenenden wiederholt.
Am ersten Weihnachtfeiertag wurde um 4:00 Uhr morgens ein Frühgottesdienst gehalten. Zuerst hat der Pfarrer eine
Andacht gehalten, dann haben die Kinder ein Krippenspiel aufgeführt und die Gemeinde hat schöne Weihnachtslieder
gesungen. Der Gastwirt Trzaska hat uns den Saal zur Verfügung gestellt. Wir hatten eine Posaunen- u. eine
Gitarrengruppe. Unter der Leitung von Herrn Willi Doormann spielten: Gottlieb Brosch, Fritz Ollech,
Gustav Rattay(Sopran), Wilhelm Pilath, Gustav Brosch(Alt), Fritz Both(Tenor) und Fritz Brosch(Bass).
In der Gitarrengruppe wirkten mit: Martha Ollech, Hedwig Ollech, Martha Lekzik, Martha Michalick und Auguste Lekzick.
Willy Doormann hat sie auf der Geige begleitet.
Kurz vor Ausbruch des 2. Weltkrieges
Bei der Aufstellung des Grenzschutzes(Regiment Buchholz), hat er als Hauptfeldwebel die
Gruppenführerkurse überwacht und selbst die fähigsten Männer dafür vorgeschlagen. Das Ausbildungspersonal hat das
Jäger-Battalion gestellt. Wir kamen zuerst ins Stadion(Waldheim), wurden da eingekleidet und dann ging es gleich
kasernenmäßig zu, theoretisch und praktisch. Jeder musste vor die Front treten und nachweisen ob er im Stande ist,
Befehle zu erteilen. Abends wurden Filme vorgeführt die uns zeigen sollten wie eine Gruppe sich im Gelände entfalten
muss. Die Exerziervorschriften hatten sich, im Verhältnis zu Kaiser Wilhelms Zeiten, etwas geändert. Damals bestand
eine Gruppe aus 8 Mann und einem Unteroffizier, jetzt aus 10 Schützen, 3 für das leichte Maschinengewehr und einem
Unteroffizier(13 Mann). Nach der Schulung folgte eine Abschlussprüfung, danach ein gemütliches Beisammensein. Aus
Rohmanen haben folgende Männer die Prüfung bestanden: Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy, Gustav Rattay und
Gustav Deptolla. Unsere Uniformen waren alle zu klein und es gab viel zu lachen bei der Anprobe.
Die erste Übung habe ich mit Emil Rosowski, in Lenzinen gemacht. Der Gutsbesitzer Marzinzick hat seine Scheune als
Unterkunft zur Verfügung gestellt. Er war im Range eines Hauptfeldwebels. In seinem haus war die Schreibstube
untergebracht, die er selbst verwaltete. Ein Lastauto hatte Uniformen aus der Kaserne in Ortelsburg geholt, jeder
musste eine Uniform anlegen und dann wurde solange getauscht bis alle eine passende gefunden hatten. An den Namen des
Kompanieführers kann ich mich nicht mehr erinnern. 1935 wurden wir zu einer Übung in die Dragonerkaserne nach Lyk
einberufen. Die Gruppenführer, Zugführer, und Kompanieführer die schon Frontberührung im dem Ersten Weltkrieg hatten,
mussten eine Woche früher anreisen. Die Übungen waren auf 6 Wochen angelegt. Die meisten der einberufenen waren noch
nie mit dem Wehrdienst in Berührung gekommen. Jeder Gruppenführer bekam 13 Mann zugeteilt.
Unser Zugführer war Leutnant Neumann, Kompanieführer Oberleutnant Rutschko, Battalions-Kommandeur Major Gröning
(Regiment Buchholz). Hier ging es wieder Kasernenmäßig voran. Das Bataillon wurde hier vereidigt. Jeden zweiten
Sonntag durften unsere Frauen uns besuchen. Ein Jahr später wurden wir wieder zu einer Übung einberufen, auf den
Truppenübungsplatz nach Arys. Jeder Gruppenführer hatte den Auftrag die Gruppe zu entfalten, und auf bewegliche
Figuren zu schießen. Diese Übung musste später mit scharfer Munition wiederholt werden. Jedes Maschinengewehr bekam
50 Schuss, jeder Schütze 20 Schuss zugeteilt. Nach dem Abschießen wurden die Treffer gezählt und dem Kommandierenden
Bericht erstattet. In einiger Entfernung spaziert ein Storch umher, der gar nicht bemerkt hatte dass geschossen wurde,
was bei den Kameraden ein großes Gelächter hervorrief.
Nach der Übung wurde uns gesagt das jeder Gruppenführer eine arische Abstammung nachweisen sollte. Ich konnte in den
Rheinsweiner Kirchenbüchern meine Vorfahren aus Gellen, bis zum Jahr 1732 zurück, nachweisen und wurde zum
Unteroffizier befördert. Aus unserem Dorf wurden auch, Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy und Gustav Deptolla
befördert. Zwischendurch mussten wir schon mal in die Radfahrer-Kaserne nach Ortelsburg, Gewehre empfangen und im
Gelände üben. Am 31 Juli 1939 wurde mir von einem Soldaten ein Schreiben übereicht, das mich aufforderte, am 1. August
um 6:00 Uhr, bei der 3. Kompanie, des 2. Infanterieregiments zu erscheinen.
Um 5:30 hat mich meine Schwester in die Kaserne gebracht. Auf der Schreibstube erklärte mir der Hauptfeldwebel,
dass mir ab sofort der Dienstgrad eines Sanitäters zugewiesen wird, ich mich in der Kammer einzukleiden hätte und mir
in der Handwerkerstube die entsprechenden Schulterklappen annähen lassen sollte. Die aktiven Sanitäter wurden den
Feldlazaretten zugewiesen und wir kamen an ihre Stelle. Unser Bataillon wurde nach Schodmak zum Bunker bauen und
Stacheldraht verlegen eingeteilt. Wir zogen in Begleitung einer Musikkapelle bis zur Kreuzung am Krankenhaus, dann
weiter zu unserem Bestimmungsort, gefolgt von einer Gulaschkanone die in den nächsten Tagen für unsere Verpflegung
sorgen sollte.
Am 14 August haben wir die Jägerkaserne, begleitet von einer Musikkapelle endgültig verlassen und zogen zuerst durch
Ortelsburg, dann über Lehmanen ins Feldmanöver, hinter Rohmanen. Dort entfaltete sich das Bataillon im Gelände, die
Verwundetensammelstelle wurde auf dem Hof des Bauern Friedrich Neumann eingerichtet. Gegen Abend wurde zu Sammeln
geblasen und Biwak bezogen, wobei unsere 3.Kompanie, in einem kleinen Wallt, in der Nähe von Otto Nickels Gehöft
Stellung bezogen hatte. Die 2. und 4. Kompanie hatte sich in der Nähe vom Abbau Pallasch niedergelassen. Die Frau
Nickel hat am Abend ein Mädel in Dorf geschickt um meiner Frau Bescheid zu sagen, wo wir uns zurzeit befinden. Meine
Frau ist dann noch gekommen um sich von mir zu verabschieden, weil wir am nächsten Morgen um 3:00 Uhr Zelte abbrechen
und um 4:00 Uhr in Richtung Kaspersguth marschieren sollten.
Wir sind dann über Achodden, Seelonken, Lehmanen, Ortelsburg, bis nach Grammen und Schützendorf marschiert, wo wir an
einem See Biwak bezogen haben. Es wurde immer gesagt, wir kommen zum Tannenberg-Denkmal bei Hohenstein, wo ein Reichs
Kriegervereinsfest stattfinden sollte. Es wurden auch schon Vorkommandos aufgestellt, doch dann kamen wir nach Orlau
und Lahna-Mühle, da wo die Alle entspringt haben wir 2 Tage biwakiert. Unser Kompanieführer hat uns nach Waplitz auf
den Soldatenfriedhof des Ersten Weltkrieges geführt und uns erklärt wie das Jägerbataillon sich 1914 hier entfaltet
hat und aufgerieben wurde. Dann mussten wir in der Nähe von Gut Koslau über einen Fluss und bezogen in einem Waldstück,
vorbereitete Stellungen in der Nähe der polnischen Grenze. Herr und Frau Thalmann haben uns jeden Tag, bis zur Grenze,
mit Brötchen und Getränken versorgt. Es wurde scharfe Munition ausgegeben, weil wir am nächsten Morgen um 4:00 Uhr die
polnische Grenze überschreiten sollten.
Am nächsten Morgen um 10 Minuten vor 4:00 Uhr kam der Befehl; scharfe Munition abgeben, alles zurück in ein 6 Kilometer
entferntes Dorf, wo wir auch einquartiert wurden. Das alles geschah’ eine Woche vor dem 1. September 1939. Es wurde
gesagt dass der Führer dem polnischen Präsidenten Rid-Szmigly, ein Ultimatum gestellt hat und es wahrscheinlich nicht
zum Krieg mit Polen kommt. Genau nach 5 Tagen kehrten wir wieder in die gleichen Stellungen zurück, es wurde wieder
scharfe Munition ausgegeben und am nächsten Morgen um 4:00 Uhr überschritten wir die polnische Grenze.
“Der 2. Weltkrieg.”
Der erste Einsatz in Polen
Wir kamen zuerst in ein Dorf in dem sich nur alte Menschen befanden. Auf unsere Frage wo denn die Bewohner wären sagte
man uns dass alle geflohen sind, weil erzählt wurde, die Deutschen würden alle Polen misshandeln und verstümmeln. Ich
habe ihnen daraufhin gesagt dass uns, unter Androhung von Strafe verboten wurde, einem Zivilisten etwas anzutun. Das
Vieh, die Schweine und Hunde des Dorfes liefen frei herum und die Soldaten fingen an auf die Hunde zu schießen, bis
gesagt wurde es seien Meldehunde im Dienste der Deutschen Wehrmacht und dieser Unfug der eigenen Truppe schaden würde,
weil etwaige Querschläger eigene Kameraden verletzen könnten. Wir gingen weiter auf polnischer Seite entlang der Grenze,
bis wir am Nachmittag die ersten Vorposten der Festung Mlawa erreichten, da befanden wir uns plötzlich im Feuerhagel
polnischer Festungsflack.
Am nächsten Morgen hatte ich schon 3 Verwundete und wusste nicht wo sich eine Verwundeten Sammelstelle befindet. Ich
suchte den Bataillonsgefechtstand auf der sich auf einer Anhöhe befand. Ich habe unseren Oberstabsarzt gefragt wo denn
die Verwundetensammelstelle wäre. Er rief beim Tross an, wo er die Auskunft erhielt, das sich vor dem Dorf ein Bunker
befindet in dem man die Verwundeten sammeln sollte, die dann von Sanitätsautos abgeholt würden, weil das Dorf unter
Artilleriebeschuss stand. Am Sonnabend haben unsere Flieger die Bunkerstellungen bombardiert, konnten aber, trotz guter
Treffer nicht viel ausrichten, die Bunker wurden nur etwas angekratzt.
Der Beschuss unserer vordersten Linien ging mit unverminderter Heftigkeit weiter. Am Sonntag verkündete eine große
Staubwolke die Ankunft unserer Panzer, doch sie kamen nur bis zur Panzersperre und mussten wieder abdrehen ohne den
Polen einen schaden zuzufügen. Ein Panzer bekam einen Volltreffer, der Fahrer konnte noch umkehren. Er blutete am Kopf
und der Schütze war so eingeklemmt, das wir ihn nur mit einem Seil unter den Armen, durch die Luke nach oben ziehen
konnten. Ob er seine Verwundung überlebt hat ist mir nicht bekannt, denn in der Nacht wurden Panzergeschütze nach
vorne in Stellung gebracht, die direkt in die Schießscharten der Bunker geschossen und so die Verteidiger vertrieben
haben. Daraufhin sind wir weiter vorgerückt. Auf einer Wiese war ein tiefer Graben ausgehoben und mit Ästen getarnt,
da war ein Panzer hinein gefahren, so dass nur das Hinterteil herausragte und er sich nicht aus eigner Kraft befreien
konnte. In der Luft waren Flieger die Brandbomben abwarfen, ich habe mich auf den Boden geworfen weil ich dachte die
würden explodieren, aber sie zischten nur, so das Stoppeln und Graß rings herum in Brand gerieten.
Bei den Kampfhandlungen gab es mehrere Verwundete, denen ich gerade Verbände anlegen wollte, als unser Hauptmann zur
Trillerpfeife griff um mir klar zu machen, dass ich ihm folgen sollte. Die Polen fingen an zu schreien, ich sollte
sie ins Lazarett bringen denn hier im Wald würde sie niemand finden. Ich setzte mich aufs Fahrrad und folgte unserem
Kompanieführer, der mir sagte ich soll immer bei der kämpfenden Truppe bleiben, denn hinter der Front sind die
Sanitätsabteilungen, die werden die Verwundeten schon versorgen. Der Vormarsch dauerte bis in die späte Nacht. Auf
einem Gehöft, das nach allen Seiten durch Feldwachen abgesichert wurde, machten wir endlich Rast. Wir haben
Getreidegarben auf dem Hof ausgebreitet und uns zur Ruhe gelegt, als plötzlich um Mitternacht Leuchtraketen den Himmel
erhellten und Maschinengewehrfeuer uns aus dem Schlaf schreckte. Ein par polnische Soldaten hatten das Feuer eröffnet,
aber sich kurz darauf ergeben.
Die Narew-Überquerung
Als es hell wurde ging der Vormarsch weiter. Es wurde uns untersagt Tagebuch zu führen, darum
weiß ich nicht wie die Orte hießen, durch die wir marschiert sind. Als wir durch ein sumpfiges Gelände vor drangen
stand auf einer Anhöhe am Horizont, die polnische Artillerie, die uns sofort unter Beschuss nahm. Unser Hauptmann war
der Meinung dass wir schon in der Nähe des Flusses Narew sein müssten, als aus den Sträuchern ein mit Schlauchboten
beladenes Lastauto auftauchte. Wir wurden aufgefordert mit je 6 Mann ein Schlauchboot zu nehmen, an einem Aggregat
der daneben stand mit Luft zu füllen und zu Wasser zu lassen. In einer Stunde war das ganze Bataillon über die Narew,
wo der Vormarsch fortgesetzt wurde. In einem Dorf überraschte uns die polnische Kavallerie und fing sofort mit
Maschinengewehren zu schießen an. Da kam der Befehl: Alles wieder zurück. Es ging noch schneller als auf der Hinfahrt.
Wir sind erst einige Kilometer am Fluss entlang gegangen und haben dann zum zweiten Mal rüber gesetzt.
Die Gehöfte im Dorf standen alle in Brand. Auf einem waren viele Bienestöcke. 2 Kameraden wollten den Stöcken Waben
entnehmen, doch die Bienen durch das Feuer aufgeschreckt, überfielen sie sofort und stachen derart zu das sie nicht
mehr wieder zu erkennen waren. Ich habe die Einstichstellen mit Salmiak betupft, mehr konnte ich nicht tun. Wir mussten
auf unserem Vormarsch durch einen Wald der in Flammen stand, so dass man kaum atmen konnte. Es ging weiter in Richtung
Minsk und Warschau, wo schon die Sowjetische Armee durchgegangen war, die Pferde und Vieh von einem Gut mitgenommen
hatten. In einem Wald stießen wir unverhofft auf ein Kloster, in dem wir einige Gefangene machten. Dann trafen wir auf
eine gute Straße die nach Grochow ging.
Als wir dort einmarschierten wurden wir aus den oberen Stockwerken beschossen, so dass wir, um uns zu schützen, nur an
den Hauswänden entlang gehen konnten. Wir haben jedes Haus nach Feinden durchsucht. Vor einem Haus stand ein Hund der
niemanden reinlassen wollte, solange bis ihn eine Kugel traf. Die polnische Artillerie feuerte von Warschau aus, um
unseren Vormarsch zu stoppen. Wir hatten uns gerade eingegraben als plötzlich deutsche Flieger am Himmel erschienen,
die unsere Stellungen mit Bomben bewarfen und dabei viel Unheil anrichteten. Wir haben sofort Fliegertücher
ausgebreitet und Leuchtraketen abgeschossen. Da ich in dem Graben, den ich kurz zuvor ausgehoben hatte, sofort in
Deckung gegangen bin ist mir zum Glück nichts passiert. Unter den anderen Kameraden gab es viele Verwundete, so dass
ich nicht wusste wem ich zuerst helfen sollte.
Der Oberstabsarzt hat mich sofort tatkräftig unterstützt, so das bald alle Verwundeten versorgt waren, außer einem,
dem ein Bombensplitter den Arm abgerissen hat. Ich habe im 3 große Verbandspäckchen auf die Wunde gelegt, doch die
Blutung ließ sich trotzdem nicht stoppen, so dass er eine Stunde später auf der Krankensammelstelle verstarb. Wir
haben danach in einem Tomatenfeld einen Graben ausgehoben und eine neue Abwehrstellung bezogen. Die Gruppe Schwarz
bekam den Auftrag nach etwaigen versprengten polnischen Verbänden Ausschau zu halten, als sie unerwartet aus einer
Häuserreihe mit Maschinengewehrsalven überschüttet wurden. Der Gruppenführer und noch ein Soldat wurden dabei tödlich
verwundet. Danach wurde noch ein weiter Stoßtrupp, unter der Führung von Leutnant Briskorn, der sich dazu freiwillig
gemeldet hatte, hinaus geschickt um den Gruppenführer und den anderen Toten zu bergen.
Bei diesem Unternehmen, das erfolglos ausging, weil die Toten schon verscharrt waren, durchschlug eine Kugel den
Stahlhelm von Leutnant Briskorn, der auch sofort tot war. Alle Toten wurden später, an der Kirchenmauer in Grochow, in
Särgen beigesetzt: Hauptmann Schönwald sagte, das sie nach dem Kriege auf den Heldenfriedhof nach Ortelsburg überführt
werden. Drei Tage lagen wir bei Grochow in Stellungen, waren dem polnischen Maschinengewehrfeuer sowie den Bomben
deutscher Flugzeuge ausgesetzt. In der Nacht musste ich zu einem Verwundeten in die vorderste Linie und habe den
Rückweg nicht mehr finden können, als plötzlich Gewehrfeuer aufflammte habe ich in den Ruinen Schutz gesucht. Erst im
Morgengrauen konnte ich mich wieder orientieren und zu meinem Unterstand zurückfinden.
Warschau wurde tagelang bombardiert und stand auch unter Artilleriebeschuss. Aus dunklen Rauchwolken kamen oft ganze
Bündel von Papier angeflogen. Die Verwundeten kamen oft auf Krücken zu unserem Unterstand, ich habe sie dann zur
Krankensammelstelle hingeführt. Wir haben auch polnische Zivilpersonen betreut, die während der Kampfhandlungen
verwundet wurden. Als einmal 2 Jungen vorbeiliefen hat einer ihnen nachgerufen sie sollten seiner Frau Bescheid sagen,
er wäre auf der Krankensammelstelle an der Kirche. Als wir dort ankamen war seine Frau, mit einem Kind auf dem Arm,
schon da.
Nach der Kapitulation von Warschau, gingen wir über Sokolow zum Bug und haben dort Quartier bezogen. Der Russe hatte
sich bereits hinter den Fluss zurückgezogen, hatte alles Vieh und Pferde mitgenommen. Dort erreichte mich ein Telegramm
von zu Hause, dass meine Tochter gestorben ist. Es sprach sich auch herum dass verschiedene Heimaturlaub bekommen haben,
ich durfte auch für 14 Tage heim. Wir fuhren mit Lastautos nach Allenstein in die neue Reiterkaserne, zum
Ersatzbatallion, da haben wir unsere Gewehre und Munition abgeben, dann durften wir, jeder in seinen Heimatort
weiterfahren.
Als wir unsere Quartiere am Bug verlassen haben war sehr viel Schnee gefallen. Hier in Ortelsburg fanden wir die
gleiche Wetterlage vor, aber nach 3 Tagen war alles wieder weggetaut und wir konnten die Kartoffelernte, die durch den
frühen Wintereinbruch gestoppt wurde, zu Ende bringen. Ein Tag bevor ich zu Hause angekommen bin wurde die Tochter
beerdigt. Nach 14 Tagen mussten wir uns in Allenstein melden, Gewehre empfangen und wieder zurück zur Division an den
Bug 150 Kilometer hinter Warschau. Die elfte Division, zu der wir auch gehörten sollte in den Westen Deutschlands
verlegt werden und war schon unterwegs zur Verladestation Skiernewice 50 Kilometer vor Warschau.
Mein Dienst als Sanitätsunteroffizier
Unser Bataillon kam in das Städtchen Burscheid, im Kreis Opladen, wo wir in Privatquartieren
untergebracht wurden. Nach 3 Monaten, im Januar 1940, wurden wir nach Solingen verlegt, wo wir bis zum
Frankreichfeldzug stationiert waren. Wir mussten an Feldübungen teilnehmen, wie andere die in Kasernen untergebracht
waren. Während dieser Zeit musste jeder seine Zähne in Ordnung bringen lassen. Jeden Tag fuhren 20 Mann in die
Cäzilienstraße nach Köln, zur Zahnklinik. Im Rheinland wurde unsere Division neu aufgestellt. Ausfälle durch den
Polenfeldzug wurden durch neue Soldaten ergänzt. Ich kam nun zum Ersatzbatallion, war der Älteste in der ganzen
Kompanie. Als der Frankreichfeldzug losging wurde unser Ersatzbatallion mit den noch vorhandenen Verwundeten, in die
neue Reiterkaserne, nach Allenstein verlegt.
Meine Frau hat, mit Unterstützung der Bauernschaft, einen Antrag gestellt, daraufhin wurde ich zur Frühjahrsbestellung,
beurlaubt und später bis auf weiteres vom Militärdienst freigestellt. Als der Russlandfeldzug losging wurde ich von der
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg, für 14 Tage einberufen. Ich war seit 1922, Mitglied der freiwilligen
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg und habe jedes Jahr an Übungen teilgenommen. Jede Bereitschaft musste etliche Leute
stellen. Von Rohmanen wurden Emil Rosowski, Johann Dembek, und ich, zur Krankensammelstelle Wirballen, in Litauen,
abkommandiert. Dorthin kamen Lazarettzüge aus Russland mit der Breitspurbahn. Die Verwundeten wurden frisch verbunden
und auf Waggon mit Normalspur verladen und nach Deutschland gebracht.
Als die 14 Tage vergangen waren wollten wir wieder nach Haus zurück, doch man wollte uns nicht entlassen. Stattdessen
wurden wir dem Wehrkreisamt Königsberg zugeteilt, neu eingekleidet und zur Aushilfe ins Lazarett nach Gumbinnen
abkommandiert. Mehr als ein Jahr war ich in den Urlauber-Baracken, habe dort Krankenstube betreut. Später, bis zum
Dezember 1944, war ich im Reserve-Lazarett 4, in Königsberg tätig. Dort habe ich auch die Luftangriffe der Engländer,
vom 25 bis 26. August 1944 miterlebt.
Wir sollten gerade einen Lazarettzug in Rotenstein entladen, als plötzlich die Sirenen ertönten - Fliegeralarm. Im
gleichen Moment waren die ersten Flugzeuge auch schon da, zuerst warfen sie „Tannenbäume” und danach Foßforkanister ab.
Die Omnibusse standen schon zur Abfahrt bereit als es losging. Wir haben die Verwundeten schnell in den
Luftschutzkeller getragen, haben die Betten von den Fenstern weggerückt damit die Verwundeten nicht von den
Glasssplittern verletzt wurden. Im Kasernenhof brannten die Fosforkanister lichterloh. Unsere Unterkunft, die sich in
einer Baracke befand ist völlig abgebrannt, mit dem Wenigen was wir unser Eigen nannten. Am nächsten Tag wurden wir neu
eingekleidet und am 29. bis 30. kamen die englischen Bomber wieder, sie setzten genau da ihr Zerstörungswerk fort wo
sie vor 3 Tagen aufgehört hatten.
Anfang Dezember 1944 musste ich mich nach Stablack melden und musste dann zur Sanitätsabteilung 1, nach Gernau, das
liegt zwischen Lodz und Warschau. Vormittags hatten wir Felddienstübungen und nachmittags theoretischen Unterricht.
Jeden Tag wurden Gruppen zusammengestellt und zu anderen Einheiten abkommandiert. Ich kam zu einer Panzerabteilung, wo
wir an einem Morgen plötzlich auf dem Kasernenhof antreten mussten und zu unserer Überraschung mit der Nachricht
konfrontiert wurden, dass der Russe an mehreren Frontabschnitten durchgebrochen war. Wir bekamen sofort einen
Marschbefehl in Richtung Lodz, wo das Stadtbild noch intakt war, selbst die Straßenbahnen fuhren noch. In der Nacht
haben russische Flugzeuge die Stadt bombardiert. Die Kaserne in der wir untergebracht waren hatte keine
Luftschutzkeller, aber zum Glück blieben wir von Bombentreffern verschont. Am nächsten morgen bot sich uns ein Bild der
Verwüstung. Die entgleisten Straßenbahnwagen, sowie andere Fahrzeuge blockierten die Straßen. Die Älteren unter uns
bekamen Fahrscheine für einen Transportzug, der bereit hinter Lodz abfahrbereit, unter Dampf stehen sollte. Als
russische Panzer in den Straßen auftauchten, verbrannte die Schreibstube unsere Wehrpässe und andere wichtige
Dokumente. Wir liefen zu der Station auf der unser Transportzug bereitstehen sollte, aber da war kein Zug mehr zu sehen
und wir setzten unseren Rückzug zu Fuß fort.
Der Rückzug und Zusammenbruch der Ostfront
In Dobroschin, einer Stadt in Polen, wurde gerade ein Lazarettzug verladen, doch wir kamen nicht
mehr zum Einsatz, weil die russische Infanterie uns schon auf den Fersen war. Es ging weiter über den Fluss Bober,
Sagan, bis nach Glogau an der Oder. Dort wurden wir der 29. motorisierten Sanitätskompanie zugeteilt. Im
Garnisonslazarett wurden noch Operationen durchgeführt. Unsere Division hatte ihr eigenes Feldlazarett, so dass wir den
Befehl zu Weiterfahrt erhielten und noch unbeschadet die Oderbrücke passieren konnten, denn Glogau wurde zur Festung
erklärt. Wir haben 2 Pferdewagen organisiert und mit Verbänden, sowie medizinischen Instrumenten beladen. So kamen wir
bis nach Lübbenau im Spreewald, wo wir in einem Schloss, in zuvor ein Museum war, unser Lazarett untergebracht haben.
Weil die Amerikaner Cottbus bombardiert hatten, wurden die Verwundeten zu uns nach Lübbenau gebracht. Hier haben wir
Tag und Nacht gearbeitet, um die vielen Verwundeten, aus den schweren Kämpfen bei Grünberg und Sagan zu versorgen. Die
Soldaten von der Abwehrfront kamen schon mit abgestorbenen Armen oder Beinen bei uns an, weil in vorderster Linie keine
Frontlazarette mehr vorhanden waren; es mussten viele Amputationen durchgeführt werden. Als für unsere Pferde kein Heu
mehr vorhanden war, schickte mich unser Hauptfeldwebel, zu einem Bauern in den Spreewald, mit dem Auftrag, Futter zu
besorgen. Mit noch zwei Mann fuhren mit zwei Kähnen, zuerst den Hauptstrom entlang und dann in einen Nebenarm; da haben
wir die Boote beladen und brachten das Heu nach Lübbenau.
Als wir uns bei unser Einheit zurück melden wollten, war alles schon marschbereit. Ich bin schnell in einen Bus
eingestiegen der sofort losfuhr, weil russische Verbände schon in sichtweite waren. Russische Flugzeuge kreisten über
den Dächern und nahmen, mit ihren Bordwaffen jeden unter Beschuss, der sich irgendwo blicken ließ. Wir konnten nur
durch den Wald, oder in der Nacht vorwärts kommen, denn wenn ein Auto auf der Landstraße fuhr, war alsbald ein Flugzeug
hinter ihm her und schoss es in Brand. Als wir nach Tagen am Ufer der Elbe ankamen, war bereits eine Ponton-Brücke
erstellt worden, welche die zerstörte Brücke ersetzen sollte.
Durch die vielen Fahrzeuge waren in den Sand tiefe Spuren gefahren, so dass andere Fahrzeuge unsere Busse ins
Schlepptau nehmen mussten, weil wir mit eigener Kraft nicht mehr weiterkamen. Beiderseits der Trasse standen
Flüchtlingswagen, in der der Hoffnung die Brücke passieren zu können, doch SS-Polizei verhinderte das die Gespanne den
militärischen Rückzug zum Stillstand brachten. Es gelang uns die Elbe zu überqueren, um in einem Waldstück Schutz vor
feindlichen Fliegern zu suchen.
Als wir unsere Busse und Autos gut getarnt hatten, hat unser Bataillonschef die anwesenden Parteigrößen zu sich
gerufen und ihnen erklärt das wir eine Einheit des Roten Kreuzes sind und nach internationalem Recht keine Waffen
besitzen dürfen. Nach langer, erregter Diskussion wurde beschlossen einen Graben auszuheben und alles im Sand zu
verscharren. Als wir dann weiter, durch die Dörfer fuhren, sahen wir schon viele weiße Bettlaken, als Zeichen der
Kapitulation, aus den Fenstern hängen. Es wurde uns erzählt dass der Bürgermeister von der SS erschossen wurde, weil
er die Bevölkerung zu diesem Schritt ermutigt hatte. Jetzt waren hinter uns die Russen und vor uns schon die Amerikaner.
Amerikanische Panzer fuhren umher und schossen wild durch die Gegend, ohne ein Ziel anzuvisieren. Niemand wollte sich
dem Russen ergeben, doch der Weg der zu den Amerikanern führte, war durch abgesägte Bäume blockiert. Wir sind schnell
in das nächste Dorf gegangen, haben uns Sägen und Äxte besorgt, die Bäume durchgesägt und in den Straßengraben
geworfen.
“ Nach dem Ende des 2. Weltkrieges.”
In amerikanische Kriegsgefangenschaft
Dann fuhren wir unter internationaler Flagge an eine Mulde Brücke, vor der zwei amerikanische Soldaten, mit Zigarren,
zur Hälfte im Mund, standen. Sie rauchten und kauten gleichzeitig. Wir mussten auf einen freien Platz fahren, alle
aussteigen und rechts wieder antreten. Wäschebeutel und Tornister mussten wir abstellen; danach wurden wir nach Waffen
durchsucht, Wertsachen, Uhren und Messer wurden uns gleich abgenommen. Als wir anschließend an unserem Gepäck
vorbeigingen durfte niemand was mitnehmen. Als ich gebückt, nach meinem Wäschebeutel greifen wollte, in dem sich noch
3 Konservendosen und ein Brot befanden, bekam ich einen Fußtritt ins Gesicht, so dass mir ein Zahn ausgeschlagen wurde.
Wir wurden dann in einem Garten zusammen getrieben und gefragt ob jemand bei der SS gedient hat. Nachdem wir in Reihe
und Glied angetreten waren, mussten wir den Oberkörper freimachen und die Arme anheben. Es wurde nach SS-Zeichen
gesucht, die gewöhnlich unter dem Oberarm eintätowiert waren. Nachdem wir Grimma bei Leipzig, wo wir in amerikanische
Gefangenschaft geraten waren, verlassen hatten, mussten wir durch ganz Thüringen bis Hersfeld, an der Grenze zu Hessen,
marschieren. In Hersfeld wurden wir auf große Lastautos verladen, die von farbigen Soldaten gefahren wurden. Man hat
uns mit Stöcken hinauf getrieben, solange bis das Auto so voll war das man kaum stehen konnte. Die Soldaten fuhren, für
diese Straßenverhältnisse, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Wenn die Straße eine scharfe Kurve hatte, flogen
wir alle übereinander und mussten erst mit viel Kraftanstrengung auf die Beine kommen um diese Fahrt zu überstehen.
Da die Straßenränder in dieser Gegend mit Obstbäumen bepflanzt sind und deren Äste sehr niedrig hängen, hätten die
uns die Köpfe abgerissen, wenn wir uns nicht ständig geduckt hätten. Unsere Fahrt endete in Bad Kreuznach, in der Pfalz,
wo wir in ein Lager, in dem sich später 130.000 Mann und 6 Generäle befanden, eingepfercht wurden. Die Unterkunft der
Generäle befand sich unter einem Zelt, alle anderen mussten die Zeit unter freiem Himmel zubringen. Die Offiziere, die
Unteroffiziere, die Mannschaften; wurden in getrennten Camps untergebracht. Die Mannschaften wurden auch zur Arbeit
abkommandiert und konnten bei dieser Gelegenheit, Brot, Brötchen oder Zigarettenstummel organisieren, wogegen die
Offiziere und Unteroffiziere ihr Camp überhaupt nicht verlassen durften.
Die ersten Tage gab es kein Wasser und kein Brot, so dass die Kameraden vor Erschöpfung umfielen. Später standen wir
manchmal den ganzen Tag nach Wasser an, das von den, uns bewachenden Negern mit großen Wassertanks angefahren wurde. Am
dritten Tag bekamen wir mittags und abends etwas zu Essen; Brot bekamen wir erst nach zwei Wochen, nach dem aus der
Umgebung herbeigeholte Handwerker, Backöfen gebaut hatten. In den verschiedenen Gemeinden, die in den uns umgebenden
Weinbergen lagen, mussten sich alle Männer beim Bürgermeister melden. Als sie dann erschienen waren, wurden sie auf
bereitstehende Lastautos getrieben und zu uns ins Lager gebracht. Sie waren ohne Kopfbedeckung und ohne wärmere
Bekleidung angekommen, weil ihnen gesagt wurde, dass ihr Aufenthalt im Lager nur von kurzer Dauer sein würde. Man hat
uns, falls noch vorhanden, Decken und Mäntel abgenommen, mit der Begründung, sie würden für Kranke und Verwundete
gebraucht. Jeden Tag starben mehr als 200 Mann, die wir sofort in ein Zelt tragen mussten. In der Nacht wurden die
Toten dann mit unbekanntem Ziel, weggefahren.
Viele haben ihren Verstand verloren uns irrten im ganzen Camp ziellos umher. Als Latrinen wurden Gräben ausgehoben, in
die verschiedene Kameraden, bei der Verrichtung ihrer Notdurft, vor Schwäche hineingefallen sind und nicht mehr wieder
heraus kamen. Aus den Pfählen die, die jungen Obstbäume stützten, haben wir Krankentragen gebaut um unsere Kameraden,
bei Bedarf, zur Krankensammelstelle zu tragen. Es war in diesem Frühjahr auch sehr kalt, doch unsere Erdlöcher, die wir
zum Schutz vor Kälte und Wind, nur mit leeren Konservendosen ausgehoben hatten, durften nicht tiefer als 20 Zentimeter
sein. Nach jedem Regenguss mussten wir das Wasser ausschöpfen. Nach einem Gewitter, standen wir wiedermal, total
durchnässt in unserem Camp, als unerwartet am Horizont die Sonne hervortrat. Einer unserer Kameraden hatte noch eine
Trompete gerettet und fing, von dem Anblick völlig überwältigt, zu spielen an: "Es geht alles vorüber, es geht alles
vorbei, nach jedem Dezember, folgt wieder ein Mai". Daraufhin hob sich die Stimmung der tiefbetrübten Kriegsgefangenen,
so das Heimatlieder durch das ganze Camp erklangen, obwohl wir in den nassen Kleider herumgehen mussten, bis sie am
Körper trocken wurden.
In französischer Kriegsgefangenschaft
Nach etwa einem Monat, haben uns die Amerikaner, den Franzosen, zum Arbeitseinsatz, ausgeliefert.
Etwa 4 Kilometer von Bad Kreuznach entfernt, stand auf freier Strecke, ein Zug mit offenen Kohlenloren, auf den wir
verladen wurden. In jeden Waggon, wurde pro Person eine Tafel Schokolade und ein Päcken Zwieback rein geworfen, doch
viele Kameraden fanden nur leere Päckchen vor, weil die schon zuvor von der französischen Wachmannschaft geplündert
wurden. Wir haben uns darüber beschwert, doch die haben uns nur ausgelacht. Nachdem wir zunächst bei Mainz über den
Rhein fuhren, endete unsere Fahrt bei Paris in einem großen Zeltlager. Dort wurden wir auf andere Züge verladen, die uns
nach Südfrankreich, in ein Barackenlager, bei Mazarei, brachten.
Auf einer Zwischenstation hat man uns unter einer Pumpe, die Lokomotiven mit Wasser versorgt, abgestellt, den Kran
aufgedreht und uns anschließend ausgelacht, die Kinder Haben uns mit Steinen beworfen. Ein Wachmann kam in unseren
Waggon gekommen, hat unser Gepäck durchsucht, wenn er Tabak oder Zigaretten gefunden hat, nahm er sie mit. Die Kameraden
waren darüber so empört, dass sie vorhatten, ihn nachts unter den Waggon zu werfen. Wir haben sie gebeten dass zu
unterlassen, weil man uns in diesem Falle, alle erschießen würde.
Als wir ins Lager kamen wurden wir zuerst gezählt, dann mussten wir unser Gepäck stehen lassen und beiseite treten.
Wenn man bei der Nachkontrolle noch was in den Taschen fand, wurde das auch entwendet, selbst Esslöffel. Wir wurden
dann in drei Baracken, ohne Toiletten, eingeschlossen. Die Kameraden haben ihre Bedürfnisse in Kochgeschirre erledigt
und durch ein kleines Fenster, das sich fast unter der Decke befand, hinausgeworfen. Andere Fenster ließen sich nicht
öffnen, weil sie mit Stacheldraht zu geflochten waren. Als die Kameraden die Kochgeschirre auskippten, haben die
Wachposten geschossen und die Fenster zertrümmert. Sie waren der Meinung dass wir ausbrechen wollten. Es herrschte eine
große Hitze, in den überfüllten Baracken sind wir fast erstickt. Am nächsten Tag haben wir uns über fehlende Toilettem
beschwert, da haben sie Heringsfässer durch die Hälfte geschnitten und an der Ausgangstür hingestellt. Um bei den
überfüllten Räumen dort hinzukommen, musste man über die Köpfe der Anderen steigen. Viele hatten Fieber und Durchfall
und mussten in die Krankenstube eingeliefert werden, wo sie kurz darauf verstarben.
Besonders Raucher litten sehr an der Unterernährung, bekamen Wasser in den Beinen und waren die Ersten die verstarben.
Nach der Registrierung wurden wir auf andere Baracken verteilt. Die Zivilbevölkerung kam in die Räume und begann uns
auszuplündern. Wer noch gute Schuhe besaß musste sie ausziehen und bekam dafür die kaputten des Plünderers. Eine Woche
lang mussten wir diesen Zustand ertragen, erst als die Kameraden sich beschwerten, wurde am Eingang eine Tafel am
Eingang angebracht, dass die Zivilbevölkerung das Lager nicht betreten darf. Bis auf einige, wenige Ausnahmen wurde
diese Anweisung befolgt.
Als wir im Lager ankamen, war der französische Lagerkommandant, ein ehemaliger Kriegsgefangener, der bei einem Bauern
in Deutschland gearbeitet hatte. Dieser Bauer war jetzt als Kriegsgefangener in seinem Lager. Als er ihn erkannte, hat
er ihn gleich zum Küchendienst eingeteilt und mit dem nächsten Krankentransport nach Hause fahren lassen. Zu Mittag
bekamen wir nur gekochte Haferkörner, da schwamm alles oben, später war man dann auf Gerste umgestiegen. Als viele
daran gestorben waren, weil sie diese „Rohkost”, die nur ein Kuhmagen verträgt, nicht gegessen haben, hat man die
Körner durch eine Schrotmühle laufen lassen. Dann hat man uns Steckrüben gekocht; wir bekamen 250 Gramm Weißbrot,
etwas Quark und ein viertel Liter Magermilch. Später, als wir schon arbeiten mussten, hat man in unserem Essen einen
Kuhkopf mitgekocht, das hat dann bedeutend besser geschmeckt.
Bevor wir morgens zur Arbeit gingen, mussten wir zu Flaggenparade und abends, nach der Rückkehr, haben wir die Flagge
wieder eingeholt. Wir haben einen Kanal gereinigt, dessen Sohle 2 Meter dick mit Schlamm bedeckt war. Zuerst wurde das
Wasser abgelassen, dann haben wir, einer dem andern, den Schlamm mit der Schippe hoch gereicht. Der Letzte hat den
Schlamm, der so zäh war, dass er nicht von der Schippe wollte, oben am Rande abgelegt. Manchmal waren 10 Mann nötig um
den Höhenunterschied zu überwinden. Das Wachpersonal schoss über unsere Köpfe hinweg und rief: „schnell arbeiten”. Bei
der großen Hitze war das ein Ding der Unmöglichkeit, zumal es nichts zu Trinken gab. Auf dem Heimweg haben wir im Walde
Heilkräuter gesammelt, die man in der Küche getrocknet und als Tee zubereitet hat, den wir am nächsten tag zur Arbeit
mitnahmen, um unseren Durst zu stillen.
Unser Aufseher hatte einen Stock, an dem sich noch kurz abgeschnittene Äste befanden. Wer seiner Meinung nach, nicht
ordentlich gearbeitet hat, bekam gleich Schläge auf den Rücken. Die weißen Aufseher wurden irgendwann durch Neger
ersetzt, die uns bedeutend besser behandelt haben. Wenn irgendetwas schief ging, haben sie nichts gesagt, nur gelacht.
In den übrig gebliebenen Wassertümpeln hatten sich noch einige Aale versteckt, die wir zu fangen versuchten, was uns
auch manchmal gelang. Wir mussten ihnen das Genick brechen, damit sie uns nicht entwischen konnten. Wenn die Franzosen
bemerkten das wir Aale hatten, wurden sie uns abgenommen. Gelang es uns aber, sie ins Lager zu bringen, dann haben wir
uns eine köstliche Malzeit zubereitet.
Um sicherzustellen dass niemand geflüchtet ist, wurden wir, wenn wir abends ins Lager zurückkamen, zuerst gezählt.
Diese Zählung wurde mehrmals wiederholt, weil die Wachmannschaften sich immer wieder verzählt haben. Als einer von uns
hin ging, ihnen sagte dass alle da sind, wollten sie es nicht glauben und haben uns vor dem stehen lassen, bis es ihnen
irgendwann einfiel. uns doch das Tor zuöffnen. Einmal, als wir von der Arbeit zurückgekehrt waren, standen wir bis 23
Uhr neben der Flagge, weil uns niemand das Tor geöffnet hat. Als wir dann doch irgendwie ins Lager kamen haben wir
festgestellt, dass das ganze Wachpersonal betrunken war und niemand im Stande uns das Tor zu öffnen.
Eines Tages waren wir wieder abends zur Parole angetreten, als ein älterer Herr mit seinem Hund, am Stacheldraht
entlang, spazieren ging. Weil der Hund, unterm Stacheldraht hindurch, zu uns kam, hat ihn einer geschnappt, ihm das
Genick gebrochen und unter seiner Jacke versteckt. Der Franzose hat nach seinem Hund gerufen und gepfiffen, aber alles
vergebens, der Hund war nicht aufzufinden. Die Kameraden haben ihm gleich das Fell über die Ohren gezogen, das Fleisch
gekocht und das Fell in die Latrine geworfen. Das Fleisch wurde umgehend verspeist.
Als wir am nächsten Tag von der Arbeit zurückkehrten, war im Lager der Teufel los. Wir mussten sofort antreten und
wurden gefragt, wo der Hund geblieben ist, der Gestern Abend, mit seinem Herrchen, am Zaun entlang spazieren ging. Als
sich niemand dazu bekannte, mussten wir weiterhin stehen bleiben, während die Wachmannschaften von Baracke zu Baracke
gingen und alles durchsuchten. In einer Latrine hat man dann das Fell gefunden, was uns ein furchtbares „Donnerwetter”
einbrachte und in den nächsten Tagen, nach der Arbeit, unter dem Kommando eines Oberfeldwebels, eine Stunde
nachexerzieren.
In Südfrankreich regnet es den ganzen Sommer nicht; die Bauern haben da keine Scheunen und das Getreide wir nur in
Schobern aufgestellt und dann umgehend gedroschen. Vom Oktober bis Dezember regnete es fasst jeden Tag in Strömen.
Gesät wird nur im Frühjahr und im Herbst, weil im Sommer alles vertrocknet. Es wird viel Wein angebaut und die
Steckrübe wächst den ganzen Winter. Neben den Weinreben wurde aus Schieferplatten ein Zaun aufgestellt, um dem Wein
einen optimalen Standort zu sichern. Die Bauernwagen hatten nur zwei Räder und waren nur mit einem Pferd bespannt, das
die ganze Balance des Wagens zu halten hatte. Trotzdem haben sie soviel aufgeladen wie wir auf einen Leiterwagen. Viele
Kameraden wurden den Bauern zur Arbeit ausgeliehen. Wenn ein Bauer einen Arbeiter gebraucht hat und es wurde gefragt,
wer sich in der Landwirtschaft auskennt, da haben sich alle gemeldet. Der Bauer konnte sich dann aussuchen, wen er
mitnehmen wollte.
Wenn wir durch die Stadt zur Arbeit gingen, haben verschiedene Leute Fallobst in die Abfalleimer gelegt. Wenn das von
den Kameraden bemerkt wurde, schwenkten viele aus der Reihe, um sich etwas mit zunehmen, was von den Wachmannschaften
nicht gern gesehen wurde. Viele Kriegsgefangene hatten keine Schuhe mehr, sie haben die Füße nur mit Lumpen bewickelt.
Eines Tages kamen Kameraden aus Norwegen, die nach Deutschland entlassen werden sollten. Mann hat sie jedoch ins Lager
gesteckt und zur Arbeit eingeteilt. In Norwegen hatten sie Kleider und Stoffe eingekauft, hatten volle Seesäcke und
sogar Karren auf 2 Rädern, weil sie ja in die Heimat entlassen werden sollten. Als wir morgens zur Arbeit rausgeführt
wurden standen sie schon vor dem Lager. Wir haben ihnen zugerufen, dass sie uns etwas abgeben sollen, weil ihnen ja
sowieso alles abgenommen wird, aber sie haben uns nur ausgelacht. Als sie ins Lager Kamen mussten sie ihr Gepäck
ablegen, wurden dann wo anders hingeführt und haben es danach nie wieder gesehen.
Durch die vielen Läuse, Flöhe und Wanzen die wie im Lager hatten, kam es bei verschieden Kameraden, an den
Einstichstellen, zu eiternden Entzündungen. Um dem vorzubeugen hat man uns mit einem Pulver, das in Frankreich
hergestellt wurde, aber bei den Parasiten keine Wirkung zeigte, eingesprüht. Erst bei der Anwendung eines Mittels
amerikanischer Herkunft, war alles über Nacht verschwunden.
Der Sonntag war arbeitsfrei. Dann kam ein katholischer, französischer Pfarrer, eskortiert von 3 Mann, mit
aufgepflanztem Seitengewehr ins Lager und hat Gottesdienst gehalten. Einen evangelischen Pfarrer gab es nicht, nur
einen Baptisten Prediger. Der wurde würdevoll eingekleidet, bekam ein großes Kreuz und hat jeden Sonntag in einer
extra dafür hergerichteten Baracke Gottesdienst gehalten. Wer Theologie studiert hatte und sich meldete, wurde zu
einem Seminar geschickt und konnte sein Studium fortsetzen. Glasbläser durften das Lager auch verlassen und ihrem
erlernten Beruf wieder arbeiten.
Wer sich freiwillig, für 5 Jahre, zum Dienst in der Fremdenlegion verpflichtet hat, das waren etliche unter uns, wurde
neu eingekleidet, bekam gutes Essen und Rauchwaren soviel er wollte. Nach einem Jahr wurden, nach und nach, die
Kranken und Körperbehinderten in die Sowjetische Besatzungszone entlassen. Eine Entlassung von Kriegsgefangenen, die
in den Westzonen oder jenseits von Oder und Neise zu Hause waren, war nicht vorgesehen. Die Österreicher wurden alle,
unabhängig von ihrem Gesundheitszustand entlassen.
Ich habe Briefe nach Hause geschrieben, aber die kamen nur bis Allenstein und wurden wieder zurück geschickt. Als eine
Kommission des Roten Kreuzes aus der Schweiz unser Lager besichtigt hat, haben wir uns beschwert, das wir als
Sanitätsdienstgrade, zur Arbeit gehen müssen. Daraufhin erging ein Befehl: Wer einen vom Roten Kreuz, ausgestellten
Ausweis besitzt, gehört einem internationalen Verband an und braucht nicht zu Arbeit gehen. Aus unserem Lager hatten
sich 20 Mann gemeldet, die daraufhin Freigang, in Begleitung von zwei französischen Wachsoldaten erhielten. Als wir
gefragt wurden wo wir hin wollen, entschlossen wir uns, einen Soldatenfriedhof, auf dem unsere verstorbenen Kameraden
beerdigt waren, zu besuchen.
Da der Untergrund in dieser Gegend aus Felsen bestand, wurden die Gräben, in denen die Toten in selbst gezimmerten
Kisten nebeneinander gestellt wurden, mit Hilfe von Dynamit ausgehoben. Ein Leichenwagen, mit einem Pferd bespannt,
das mit einer schwarzen Decke abgedeckt war, wurde von einem Kutscher in angemessener Kleidung, gefahren. Der Wagen
konnte gleichzeitig 4 Kisten transportieren. Wenn wir von der Arbeit kommend, dem Leichenwagen begegneten, wurde
gehalten und mit einer Schweigeminute der Toten gedacht, bis der Wagen vorbei war. Die Zivilbevölkerung verharrte auch
im Schweigen, mit abgenommener Kopfbedeckung.
Ein Kamerad, der in Krottorf, Kreis Oschersleben, bei Magdeburg, zuhause war, sagte bei seiner Entlassung zu mir:
Sollte ich das Glück haben, meine Entlassungspapiere zu erhalten ohne eine Bleibe vorzuweisen, dann soll ich Krottorf
als Heimatadresse angeben. Auf der Krankenstube habe ich angegeben, dass sich noch ein Schrapnellsplitter, aus dem
Ersten Weltkrieg, in meiner Kreuzbeingegend befindet, er zwar verkapselt ist, aber immer noch Beschwerden verursacht.
Daraufhin wurde ich zur Entlassung vornotiert. Als bekannt wurde das ein Rückkehrertransport in die sowjetische
Besatzungszone zusammengestellt wird, habe ich mich sofort gemeldet und wurde für ein Entlassungslager in Angoleme
vorgesehen. War das eine Freude, als uns mitgeteilt wurde, wann der Rücktransport stattfindet.
In unserem Lager waren noch 2 Kameraden aus dem Kreis Ortelsburg: Ein Gustav Lumma aus Leynau und ein Alfred Moritz
aus Groß Schöndamerau. Sie mussten noch zurückbleiben und haben mir den Auftrag erteil, die Angehörigen in der Heimat
zu grüßen und ihnen die Anschrift mitzuteilen. Als wir im Entlassungslager ankamen, fragte man uns nach unserer
Heimatanschrift. Dann wurden die Entlassungspapiere angefertigt. Es wurde uns auch ein Barscheck, für die in Frankreich
geleistete Arbeit ausgehändigt, den wir bei jeder Kasse in Deutschland einlösen könnten. Ich habe ihn bis zum heutigen
Tage nicht einlösen können, obwohl ich irgendwann in der Zeitung gelesen habe, das Verrechnungschecks die den aus
französischer Kriegsgefangenschaft Entlassenen, ausgehändigt wurden, einzulösen sind.
Wir kamen zuerst nach Saar Elbe, dann in die Nähe der Zonengrenze zu Thüringen. Hier mussten wir 2 Tage warten, weil
aus der sowjetischen Besatzungszone keine Eisenbahnwagen bereitgestellt wurden. Angesichts dessen, das der Russe beim
letzten Transport die aus Frankreich kommenden Wagen kassiert und nicht mehr herausgeben wollte, bestand der Franzose
jetzt darauf, seine Wagen sofort wieder mitzunehmen. Als der sehnsüchtig erwartete Zug endlich eintraf, durften wir
umsteigen und kamen, immer noch hinter Stacheldraht, nach Erfurt. Von dort weiter ins Quarantänelager nach Prätsch an
der Elbe.
Unter Androhung von Strafe war es verboten das Lager zu verlassen, doch der Hunger zwang uns dazu, in den umliegenden
Dörfern um Lebensmittel zu betteln. Man drohte uns damit, dass Zuwiderhandlungen, mit einer 14-tägigen Verlängerung der
Quarantäne geahndet werden. Der Roggen war schon reif und wir haben, auf den umliegenden Feldern, die Ähren abgerissen,
das Korn, zwischen 2 Steinen zu Mehl zerrieben, um daraus eine Suppe zu kochen, denn von dem was unsere Lagerküche uns
bieten konnte, war es nicht möglich zu überleben. Als der Eigentümer bemerkte wer seine Roggenähren entwendet hat, kam
er ins Lager, gerade zu dem Zeitpunkt als wir mit dem Mahlen beschäftigt waren. Der Lagerkommandant, bei dem er sich
beschwerte, drohte uns zu bestrafen, wenn wir unsere „Rauzüge” nicht unmittelbar einstellen würden. Wir sagten ihm er
solle uns heimfahren lassen, da wir doch lange genug hinter Stacheldraht gesessen hätten.
Endlich wieder in Freiheit
14 Tage nach unserer Ankunft wurden uns Entlassungspapiere ausgehändigt, sowie auch Fahrscheine
zum den, von uns angegeben Heimatorten. So kam ich nach Krottof, Kreis Oschersleben, zu meinem ehemaligen
Kriegskameraden, bei dem ich einen Tag geblieben bin. Er hatte mir schon eine Stelle bei einem Bauern besorgt, der 70
Jahre alt und kinderlos war. Zum Hof, den er mit seiner Ehefrau bewirtschaftet hat, gehörten 36 Morgen Land, 2 Ochsen
und 3 Kühe. Das Ackerland bestand aus 17 Parzellen und sicherte mir einen Arbeitsplatz.
Jetzt, da ich ein Dach überm Kopf und genug zu essen hatte, fing ich an nach dem Verbleib meiner Familie zu forschen.
Bei meinem letzten Heimaturlaub hatte ich mit meiner Frau verabredet; falls wir uns in den Kriegswirren verlieren
sollten, unsere Kontaktadresse, die meiner Quartiersleute in Burscheid, Kreis Opladen, sein sollte. Ich habe zuerst
nach Rohmanen geschrieben, aber leider keine Antwort erhalten. Dann habe ich nach Burscheid geschrieben, und siehe, -
bei denen lag schon eine Anfrage meiner Frau vor, die nach mir gefragt, und ihre jetzige Anschrift hinterlassen hatte.
Ich habe dem Bauern erzählt dass meine Frau sich zurzeit, auf einem Gut, in Alt Steinhorst, im Kreis Rostock, befindet.
Er war sofort bereit uns ein Zimmer zur Verfügung zu stellen, wenn ich meine Frau nach Krottorf rüberholen wollte. Das
habe ich Ihr mitgeteilt und sie war sofort bereit ihren Wohnsitz nach Krottorf zu verlegen, denn sie wohnte dort in
einem kleinen Stübchen unterm Dach.
Im Herbst, als die Feldarbeit so ziemlich erledigt war, bin ich nach Alt Steinhorst gefahren, um meine Frau und meinen
Sohn Kurt, sowie meinen Sohn Manfred, den ich noch nicht kannte, weil er erst nach der Flucht, am 31. Januar, in Groß
Lüssewitz, geboren wurde, nach Krottorf zu holen. Meine Frau hatte schon Holz für den Winter besorgt und vom Gut, auf
dem sie im Sommer gearbeitet hatte, Mehl und Kartoffeln bekommen. Wir haben das Mehl und andere Habseligkeiten in
Kisten verpackt. Das Holz haben wir einem Bauern gegeben, der uns und unser Gepäck, mit seinem Pferdewagen, zum 14
Kilometer entfernten Bahnhof, nach Ribnitz gebracht hat. Wir sind auch gut in Krottorf angekommen, aber als wir am
nächsten Tag, unsere Kisten vom Bahnhof abholen wollten, haben wir zwar die Kisten vorgefunden, doch der gesamte Inhalt
wurde während der Bahnfahrt entwendet. Die Bahnstation in Krottorf hat die Vorkommnisse zur Kenntnis genommen und
protokolliert, aber unsere Sachen haben wir nie wieder gesehen und mussten wieder bei Null anfangen.
Im Winter musste ich auf der Genossenschaft, unentgeltlich, für die Russen Weizen einsacken. Ich hatte versucht eine
Arbeit als Zimmermann zu bekommen, doch auf dem Arbeitsamt wurde mir gesagt, ich bin Ladwirt und muss auf der
Landwirtschaft arbeiten. Da in den ersten Nachkriegsjahren, auch in der sowjetisch besetzten Zone Arbeitsplätze knapp
waren, mussten auch solche, die einen anderen Beruf erlernt hatten, jede zumutbare Arbeit annehmen. Aus der Heimat
erhielt ich einen Brief, von meiner dort noch lebenden Mutter. Sie schrieb das sie mich noch einmal sehen wollte und
ich sollte doch wieder zurück kommen; Unser Hof wäre nicht von Polen besetzt und sie wäre ganz alleine, weil der Vater
nach dem Durchzug der Front von den Russen erschlagen wurde. Daraufhin habe ich dem polnischen Konsulat in Magdeburg
mitgeteilt, dass ich in Rohmanen eine Landwirtschaft besitze, und um eine Einreisegenehmigung gebeten.
Nach 2 Monaten erhielt ich eine Postkarte, mit der Mitteilung, ich sollte mich persönlich beim Konsulat vorstellen.
Nach Aufnahme meiner Personalien, wurde mir gesagt, das ich benachrichtigt werde wenn mein Antrag genehmigt wird. Ende
Juli 1947 erhielten wir die Einreisegenehmigung nach Ostpreußen, das jetzt unter polnischer Verwaltung stand. Wir
mussten zuerst zum polnischen Konsulat in Berlin-Lichterfelde, wo wir umgeben von einer Trümmerlandschaft, gewartet
haben, bis alle Untersuchungen und Formalitäten erledigt waren.
“ Wieder zurück in Ostpreußen.”
Der schwere Wiederaufbau nach dem Kriege
Dann fuhren wir über Frankfurt/Oder, Posen, Thorn, Allenstein, nach Ortelsburg, wo wir am 2. August 1947 ankamen. Mit
einem zweirädrigen Karren, den ich mir von einem noch in Ortelsburg lebenden Bekanten ausgeliehen hatte und meinem
Sohn Manfred im Kinderwagen fuhren wir nach Rohmanen. Meine Mutter war inzwischen verstorben und auf dem Hof war nur
meine, inzwischen aus Russischer Gefangenschaft wiedergekehrte Schwester, Frieda Pelkowski.

Es war alles ausgeplündert; kein Vieh, keine Maschinen und der ganze Hof mit kniehohem Graß überwachsen. Nur schmale
Trampelpfade, vom Haus zum Holzschuppen und zum Klo, durchkreuzten das satte Grün. Ich habe das Gras auf dem Hof mit
einer Sense, die ich noch gefunden habe, abgemäht, damit der Hof nicht so verwahrlost aussah. Am nächsten Tag habe ich
mich bei der Polizei in Ortelsburg angemeldet, wo ich auch ein Startgeld von 100 Zloty erhielt und Gepäckstücke, die
ich in Krottorf aufgegeben, am Bahnhof abgeholt. Es hat mich sehr gewundert das, das Gepäck überhaupt angekommen ist.
Da man von der Landwirtschaft nicht Leben konnte, habe ich mich in den nächsten Tagen, bei der jetzt polnischen Bahn,
um Arbeit beworben und wurde auch angenommen. Wenn wir unseren Monatslohn bekamen, saß immer einer am Tisch, der von
uns 100 Zloty für den Wiederaufbau von Warschau verlangte. Wenn ich dran war, riefen die Anderen, ich hätte Warschau
zerstört und müsste deshalb 200 Zloty abgeben. Nach 3 Jahren kam eine Verfügung, die besagte, dass wer länger als 1
Jahr bei der Bahn beschäftigt ist, angestellt werden muss. Um diese Bestimmung zu umgehen hat man mich entlassen und
eine Woche später wieder eingestellt.
Als ich vor Ablauf des nächsten Jahres, aus dem gleichen Grunde wieder entlassen wurde, habe ich mich bei der
Stadtverwaltung in Ortelsburg(jetzt Szczytno)beworben, wo ich zuerst im Gaswerk als Heizer und später auf Baustellen
als Zimmermann gearbeitet habe. Wir haben durch den Krieg beschädigte Häuser repariert, in den ehemals touristischen
Zentren einige Ausbesserungen an den Einrichtungen durchgeführt, eine Ziegelei wieder in Betrieb gesetzt und andere
anfallende Arbeiten verrichtet. Im Dach des Rathausturmes war während der Kämpfe eine Granate eingeschlagen, die, die
Dachlatten und die Verschalung zerstört hatte. Da wir, unter schwersten Bedingungen, den Schaden repariert haben,
wurde uns eine Höhenzulage versprochen, die wir aber nicht bekommen haben.
Aus Verärgerung darüber habe ich bei der Stadtverwaltung gekündigt und bei einer Wiederaufbaufirma unter der Leitung
von Bauingenieur Laskowski wieder angefangen, wo ich bis 1954, als Zimmermann beschäftigt war. Ab da habe ich mich
nur um meinen Hof gekümmert, der wegen meiner Arbeitsstellen, gezwungenermaßen, sehr vernachlässigt wurde. Als wir
1947 zurückkamen, brachten wir unseren Sohn Manfred noch im Kinderwagen. Den hat meine Frau zum Markt gebracht,
verkauft, und dafür eine Ziege erworben, die dank guter Pflege, uns täglich mit 4 Liter Milch versorgte. Das war der
erste Baustein zum Wiederaufbau, unserer durch den Krieg zerstörten, und danach ausgeplünderten Landwirtschaft.
Während meiner Arbeit bei der Bahn haben wir uns eine Kuh gekauft, die nach einem halben Jahr, wegen nicht bezahlter
Grundsteuer, vom Gerichtsvollzieher gepfändet wurde. Man hat uns die Kuh weggenommen und bei einem Arbeiter, der in
der Ernst-Mey-Straße in Ortelsburg wohnte und sie wegen nicht vorhandener Futtermittel, nur mit Kartoffelkraut
gefüttert hat, untergestellt. Als ich bei der Bahn meinen Monatslohn bekommen habe, bin ich zur Gmina gegangen, habe
eine Rate angezahlt und durfte dann die Kuh wieder mit nach Hause nehmen. Durch die schlechte Ernährung war die Kuh
stark abgemagert und lieferte nur die Hälfte der ursprünglichen Milchleistung.
Später habe ich ein Pferd auf Abzahlung bekommen, das 140.000 alte Zloty gekostet hat. Die Stute war schwach und unser
Feld sehr hügelig, so dass man nur bergab pflügen konnte, was sehr beschwerlich war, bergauf ging es immer im Leerlauf.
Später habe ich die schweren Böden mit dem Traktor umpflügen, und in den letzten Jahren auch mit dem Binder mähen
lassen. Von der Stute habe ich 2 schöne Fohlen gezogen; ein davon habe ich bei der Ausreise in die Bundesrepublik
mitgebracht und bei der Viehverwertungs-Genossenschaft in Göttingen verkauft. In den ersten Nachkriegsjahren als noch
wenig Land bestellt wurde, breiteten sich auf den nicht beackerten Flächen, Wildkräuter aus. Disteln und andere
Schnellwachsende, erreichten manchmal eine Höhe von 2 Meter, besonders auf den schweren Böden.
Es hat viel Schweiß gekostet ehe man den Acker soweit hatte, das er auch befriedigende Erträge abwarf. Die
Währungsreform von 1950, hat unser weiniges Geld das wir schon gespart hatten, wieder vernichtet. Ich hatte 2 Pferde,
1 Fohlen, 2 Kühe und Schweine, als ich wieder aufgefordert wurde nicht bezahlte Grundsteuern nachzuzahlen. Als ich
nicht bezahlen konnte, hat der Vollziehungsbeamte, ein Fohlen, eine Kuh und ein Schwein gepfändet. Es gelang mir jedoch
nach längeren Verhandlungen, ohne größere Verluste, alles zu regeln. Später kam eine Verfügung, die besagte; wenn
jemand auf seinem Hof nur eine Kuh und ein Pferd hatte, durften sie nicht gepfändet werden. Einige haben ihr Inventar
dieser Verfügung angepasst und dadurch die Zahlung von Grundsteuer umgangen.

Wer seine Steuern pünktlich bezahlt und sein Kontingent an landwirtschaftlichen Produkten fristgerecht abgeliefert hat,
der konnte seine, darüber hinaus erwirtschafteten Produkte zu marktgerechten Preisen verkaufen. Für eine hochtragende
Sterke, mindestens 400 kg schwer, die auf ein staatliches Gut verkauft wurde, konnte man bis zu 12000 Zloty bekommen.
Unsere Böden waren kalkarm, doch durch den Einsatz von Kalk und Kunstdünger konnte man den Ertrag erheblich steigern.
Kalk und Kunstdünger konnte man bei der Genossenschaft(GS) bestellen, der dann auch direkt auf den Hof geliefert wurde.
Kalk wurde geliefert und gleich auf dem Feld ausgestreut. In den 1960ger Jahren waren alle Ackerflächen der Rohmaner
Felder bestellt.
Die nach dem Krieg zurückgebliebenen deutschen Bauernfamilien, aber auch die Polen, die während des Krieges beim Bauern
in Deutschland gearbeitet haben, versuchten mit teils bescheidenen, oder auch zusammen gesuchten, landwirtschaftlichen
Geräten, die bäuerlichen Betriebe aufrecht zu erhalten. Nach den schweren Anfängen in den ersten Nachkriegsjahren
erzielten sie schließlich einen beachtlichen Erfolg, der sich in wogenden Kornfeldern, sowie in grünen Wiesen auf
denen gut genährtes Vieh weidete, widerspiegelte.
Ein schwerer Einschnitt in meinem Leben.
Am 11. Mai 1956 verstarb nach langer schwerer Krankheit, meine liebe Ehefrau Marta Rattay,
geborene Brosch. Ein Jahr zuvor war schon mein Schwiegervater Gottlib Brosch verstorben. Die schweren Bedingungen
unter denen wir nach Kriegende leben mussten, haben ihrer bereits angegriffenen Gesundheit sehr zugesetzt. Sie
verstarb mit 44 Jahren und hinterließ in unserer Familie eine große Lücke, die nicht mehr zu Überbrücken war. Wir
haben sie unter großer Anteilnahme der noch verbliebenen deutschen Bevölkerung zu Grabe getragen und auf dem Rohmaner
Friedhof beigesetzt. Die Arbeit die sie sonst verrichtet hatte fiel jetzt auf mich und meine Söhne zurück. Meine
Schwester Frieda Pelkowski half auch wo sie nur konnte. Wir waren auf die Unterstützung durch Nachbarn und Freunde
angewiesen, die uns immer wenn es nötig war, tatkräftig unterstützt haben. Im laufe der Zeit haben wir wieder zum
Alltag zurück gefunden, haben sie noch etliche Jahre auf dem Friedhof besuchen können, bis wir, bedingt durch unsere
Ausreise uns endgültig von ihr trennen mussten.
Der endgültige Abschied von Ostpreußen
Ab 1956 begannen, durch die Vermittlung des Deutschen Roten Kreuzes, die ersten Ausreisen in die
Bundesrepublik Deutschland. Zuerst waren es Kinder die zu ihren Eltern ausreisen durften, Familien deren Väter aus der
Kriegsgefangenschaft in den Westen Deutschlands entlassen wurden und andere durch den Krieg getrennte
Familienangehörige. Ab 1960 erhöhte sich die Zahl der Ausreisewilligen aus dem polnisch besetzten Ostpreußen. Es setzte
sich die Überzeugung durch, dass unsere Angestammte Heimat, uns für die Zukunft keine Perspektive mehr bieten konnte.
Meistens wurden die Anträge, die wir an die Passabteilung in Allenstein stellen mussten, um einen Ausreisepass zu
bekommen, negativ beschieden. Nach mehrmaligen Versuchen gelang es dann doch, diese begehrte Ausreiseberechtigung in
Empfang zu nehmen. Die Enttäuschung der Zurückgebliebenen war groß, wenn wieder mal Verwandte oder Nachbarn, den Weg
in Richtung Bahnhof einschlugen.
Um einen Reisepass zu beantragen, musste man zuerst eine Einladung von Verwandten aus der Bundesrepublik vorlegen, in
der, diese sich verpflichten mussten, für Unterkunft und Verpflegung der Eingeladenen zu sorgen. Diese Einladung
musste durch ein Amt in der Bundesrepublik beglaubigt werden. Außerdem mussten die Kosten für die Bahnfahrt, ab
polnischer Grenze, bis zum Zielort, beim polnischen Reisebüro ORBIS, in Warschau, in DM eingezahlt werden.
Unseren ersten Ausreiseantrag haben wir 1964, bei der Kommandantur der polnischen Miliz in Allenstein eingereicht, der
nach einer gewissen Zeitspanne, ohne eine uns verständliche Begründung zu nennen, abgelehnt wurde. Gegen diese
Ablehnung wurde ein Widerspruch zugelassen, den wir sofort einreichten. Nach einer weiteren Zeitspanne erhielten wir
wieder eine Ablehnung, gegen die kein Widerspruch mehr zulässig war. Wer seine Ausreiseabsicht nicht aufgeben wollte,
musste einen neuen Antrag stellen. Es gab Familien die schon 10 Mal einen Ausreiseantrag gestellt hatten und immer
wieder abgewiesen wurden. Da meine Söhne, nicht die Absicht hatten in Rohmanen zu bleiben und ich nach 2 Weltkriegen,
an denen ich teilgenommen, die schwere Arbeit auf der Landwirtschaft, nicht aus eigener Kraft schaffen würde, haben wir
1966 wieder einen Antrag gestellt, der prompt abgelehnt wurde. Der Widerspruch auf diese Ablehnung wurde auch negativ
beantwortet, so dass wir 1968 wieder einen Antrag eingereicht haben.
Weil das Passamt in Allenstein lange nichts von sich hören ließ, hegten wir schon die Hoffnung das es jetzt klappen
würde und waren sehr enttäuscht als wieder eine Absage kam. In der Zwischenzeit sind viele Nachbarn und Bekannte aus
Rohmanen, sowie aus der näheren Umgebung, ausgereist und das Häuflein der noch verbliebenen Deutschen, wurde immer
kleiner. Die Motivation, die uns in früheren Jahren, über so manche schwierige Lage hinweg geholfen hat, ist einer
hoffnungslosen Resignation gewichen. Man war davon überzeugt, dass unser Leben, in unser Angestammten Heimat, keine
Zukunftsperspektive mehr haben konnte und wenn wir keine Ausreisegenehmigung bekommen, wir eines Tages die letzten
Deutschen in der ganzen Umgebung sein werden.
Die Ausreise-Heimat ade
Wir hatten die Hoffnung schon aufgegeben, als am 30. April 1969, der Briefträger unseren Hof
betrat und mir einen Brief überreichte, in dem uns das Passamt in Allenstein mitteilte, dass unsere Ausreise in die
Bundesrepublik Deutschland, genehmigt worden ist. Wir müssten, nach Aushändigung der Reisepapiere, den Geltungsbereich
der Volksrepublik Polen, innerhalb von 3 Monaten verlassen. Wir waren zuerst geschockt, über den Hinweis, das wir
unsere Heimat in 3 Monaten verlassen müssen, aber dann stellte sich die Zukunftsperspektive wieder ein und wir gingen,
wie von einem schweren Ballast befreit und gut gelaunt unser weiteren Tätigkeit nach.
Als der Briefträger unseren Hof betrat, waren ich und mein Sohn Kurt gerade dabei eine Fuhre Mist zu laden. Wir hatten
den Wagen gerade halb geladen und haben nach der frohen Kunde nicht mehr weiter gemacht, sondern die Pferde vorgespannt
und den Mist aufs Feld gefahren, damit wir den Wagen für alle Fälle frei hatten. Das war die letzte Tätigkeit für
unsere Landwirtschaft in Ostpreußen.
Die Nachricht von unserer Ausreise verbreitete sich, ohne dass wir darüber gesprochen haben, wie ein Lauffeuer.
Alsbald kamen Leute aus dem Dorf, die sich für das Vieh und für diverse Landwirtschaftliche Geräte interessierten.
Etliche wollten bestimmte Sachen sofort kaufen, andere haben nur zurücklegen lassen und wollten später kommen und
bezahlen, haben es aber dann doch nicht genommen.

Wenn man eine Landwirtschaft hatte, konnte man 2 Pferde, 2 Rinder, 3 Schweine, 5 Schafe und 10 Hühner, in einem
geschlossenen Viehwaggon, in die Bundesrepublik mitnehmen. Jeden Tag war man unterwegs, von einer Behörde zur Andern.
Die Aushändigung der Reisepapiere erfolgte nur nach Vorlage bestimmter Bescheinigungen: Es mussten alle Steuern bezahlt
sein, das Kontingent landwirtschaftlicher Erzeugnisse musste abgeliefert sein, je eine Bescheinigung vom Katasteramt
und vom Notar musste vorgelegt werden, das man dem polnischen Staat das Grundstück abgetreten hat. Die Gebühren für
die notarielle Beglaubigung mussten wir selbst bezahlen. Wenn man alle Bescheinigungen beisammen hatte, bekam man bei
der Kreisverwaltung eine Gesamtbescheinigung. Mit dieser Bescheinigung konnte man nach Allenstein, zur
Polizeikommandantur fahren, wo man nach dem schriftlichen Verzicht auf die polnische Staatsangehörigkeit, einen
Reisepass ausgehändigt bekam, der den Inhaber zum Grenzübertritt berechtigte, aber nicht zur Wiedereinreise.
Wir haben 2 Pferde, eine Sterke, einen Ochsen, 5 Schafe, 2 Schweine und 10 Hühner mitgenommen. Über die Schutzimpfung
der Rinder musste man eine, vom Kreistierarzt beglaubigte Bescheinigung vorweisen. Ich habe 5 Schafsböcke gekauft, die
ich in der Zwischenzeit, hinter der Scheune, zum Weiden angekettet hatte. Einer von denen hat sich losgerissen und
seinen Nachbarn getötet. Das Fleisch konnten wir noch verkaufen, mussten aber dafür einen anderen Schafsbock kaufen.
Innerhalb von 3 Monaten mussten wir alles regeln und zwei Tage vor der Abfahrt einen Eisenbahnwagen, bei der
Eisenbahndirektion in Allenstein bestellen. Reservierungen bei den polnischen Behörden waren meist immer mit
Schmiergeld verbunden, weil man sonst nie sicher sein konnte dass diese Vereinbarungen auch eingehalten werden. Schon
2 Wochen vor unserer Abfahrt, gab es in Ortelsburg keine alkoholischen Getränke zu kaufen. Meine Söhne mussten mit dem
Motorrad die umliegenden Dörfer abfahren, damit wir für die Reise einen Vorrat anlegen konnten; denn Wodka war zu der
Zeit, in Polen, wie eine zweite Währung.
Am 25. Juli haben wir zusammen, mit meinem Neffen Siegfried Brosch, unseren sonstigen Hausrat, der in Kisten verpackt
war, in einen Eisenbahnwagen, auf dem Allensteiner Bahnhof verladen. Alles musste zuerst durch den Zoll, wo die
Federbetten gewogen wurden und über das erlaubte hinausgehende Kissen, verzollt werden mussten. Dasselbe galt auch für
Fleisch und Räucherwaren.
Am 26. Juli, unserem Verladetag, kam der Eisenbahnwagen aus Allenstein, erst um 11 Uhr auf dem Ortelsburger Bahnhof an.
Die Rinder hatten wir zu Fuß, zum Bahnhof gebracht; Schweine, Schafe und Hühner auf dem Pferdewagen. Im Eisenbahnwagen
mussten, mit Hilfe von Brettern und Bohlen, Boxen für die verschiedenen Tiere erstellt werden. Jedes Pferd und jedes
Rind in eine Bucht. Die Schafe zwischen die Pferde, die Schweine zwischen die Rinder und die Hühner in einem Käfig,
unter der Decke über den Rindern. Die Hühner hatten unterwegs Eier gelegt, somit hatten wir jeden Tag frische
Verpflegung. Bei der Fahrt im Viehwagen, begleitete mich mein Sohn Manfred. Als die Lokomotive nahte, um den Wagen
abzuholen, wurden noch schnell die restlichen Sachen hinein geworfen und so mache Abschiedsträne rollte dann die Wange
hinab.
Unsere Nachbarn, Deutsche und Polen, halfen uns beim Verladen des lebendigen Inventars. Jetzt erinnerte ich mich
plötzlich, an die oft auch schönen, Ereignisse der letzten 22 Jahre. Einer Zeit, in der das Zusammenleben von
Deutschen und Polen, von Jahr zu Jahr, besser wurde. Man half sich beim einbringen der Getreideernte, beim Dreschen
des Getreides, bei der Kartoffelernte und bei anderen Arbeiten, wo viele Menschen zupacken mussten. Es war eine
Dorfgemeinschaft, in schweren Zeiten geboren; jeder half jedem wenn Hilfe nötig war. Es wurde mir plötzlich bewusst,
das jetzt ein Lebensabschnitt zu Ende ging, zu dem ich nicht mehr zurückkehren konnte. Unsere Existenzgrundlage war
jetzt ein Eisenbahnwagen auf einem Schienenstrang, dessen Ende irgendwo in weiter Ferne lag. Obwohl, von langer Hand
vorbereitet, war dieser Moment voller Wehmut.
Doch als der Zug sich plötzlich, in Bewegung setzte, war ich sofort wieder in der Gegenwart. Menschen, mit denen man
Jahrzehnte lang, in gutem Einvernehmen zusammen gelebt hat, blieben plötzlich am Bahnsteig zurück und die Entfernung
zwischen ihnen und mir vergrößerte sich mit jeder Sekunde, bis sie letztendlich aus meinem Blickfeld verschwanden.
Es war ein heißer Julitag, als wir unsere Reise gen Westen antraten. Für die Schweine, die besonders unter der Hitze
zu leiden hatten, haben wir 10 Flaschen Essig mitgenommen und sie von Zeit zu Zeit besprenkelt, damit sie besser atmen
konnten. Für die anderen Tiere war reichlich Heu und Hafer vorhanden. Eine großes Fas und zwei Milchkannen waren mit
Wasser gefüllt, die wir auf den an der Strecke liegenden Bahnstationen, bei Bedarf wieder nachgefüllt haben.
Da der Kreistierarzt nicht in seinem Büro war, konnten wir die Impfbescheinigung für das Vieh, nicht rechtzeitig
herbeischaffen. Der Zug setzte sich in Bewegung und die Bescheinigung war immer noch nicht da. Als die Bescheinigung
dann eingetroffen, wir aber schon unterwegs waren, ist mein Sohn Kurt mit dem Motorrad hinterher gefahren und hat uns
in Passenheim, wo der Zug noch andere Wagen angehängt bekam, die Impfbescheinigung übergeben. Wir waren sehr froh das
er es noch geschafft hat, denn in solch einer Situation fühlt man sich sicherer wenn man alle Bescheinigungen bei sich
hat. Auf der Rückfahrt, mit dem Motorrad hatte er noch eine Panne, musste das Motorrad stehen lassen und per Anhalter
nach Hause fahren. Am nächsten Tag kam er mit Siegfried Deptolla, der das Motorrad wieder flott machte und brachte es
wieder nach Rohmanen zurück.
Die Fahrt mit dem Viehwagen, gen Westen
Von Ortelsburg bis Allenstein(45 km) hat unser Zug 4 Stunden gebraucht, weil auf jedem Bahnhof
gehalten wurde, um neue Wagen anzuhängen. Nachdem wir in Allenstein angekommen waren, kam ein Rangierer und fragte
nach unserem Ziel. Als wir ihm mitteilten, das wir in die Bundesrepublik Deutschland wollen, sagte er nur: „In 10
Minuten fährt ein Zug los. Wenn ich von euch 500 Zloty und einen Liter Wodka bekomme, werde euch sofort anhängen,
andernfalls kommt ihr auf ein Nebengleis und müsst dann auf den nächsten Zug warten. Es blieb uns nichts anderes übrig
als seiner Forderung nachzukommen, denn über derartige Erpressungen hat man bereits von Anderen, die vor uns ausgereist
sind, gehört. Wir wurden auch sofort angehängt und fuhren dann die ganze Nacht, an Osterode, und Thorn vorbei bis
Gnesen. Dort wurde wieder rangiert.
Von einer Anhöhe wurden die einzelnen Wagen auf verschiedene Gleise verteilt und zu neuen Zügen zusammengestellt. Der
Aufprall der ungebremsten Wagen erzeugte eine derartige Erschütterung, dass manche Bretter an den Boxen geborsten waren.
Von Gnesen ging es dann in einem Zuge durch bis zur Grenzstation Reppen(Rzepin). Dort mussten wir zum Zollamt, wo
unsere Ausfuhrpapiere durch die Zollbeamten, und durch einen Tierarzt geprüft wurden. Bis Reppen(Rzepin) haben wir für
den Eisenbahnwagen 900 Zloty bezahlt; hier mussten wir noch einmal 650 Zloty bezahlen. Bei der Wagenkontrolle erklärte
uns ein Bahnbeamter das unser Wagen, sich nicht für den internationalen Transport eignet und wir deshalb den Inhalt in
einen Anderen umladen müssen, der irgendwann, auf dem Nebengleis bereitgestellt wird. Nach langer Verhandlung, sowie
einer Zulage von 500 Zloty und einem Liter Wodka haben wir ihn davon überzeugt, das der Wagen sich doch für die
Weiterfahrt eignet.
In der Nacht war Schichtwechsel, der unseren Wagen wieder abgehängt hat, weil er angeblich von der Reichsbahn der DDR,
wegen technischer Mängel nicht weiterbefördert würde. Wir mussten unsere Verhandlung vom Vorabend wiederholen, die mit
der Zusage endete, dass wir am frühen Morgen, über die Grenze auf DDR Gebiet, gebracht werden. Um 5 Uhr morgens kam
eine Lokomotive, die uns den letzten Abschnitt bis über die Grenze bringen sollte. Als der Zug hat noch einmal anhielt,
kamen polnische Grenzbeamte und Soldaten in den Wagen. Sie durchsuchten ihn und fragten, ob wir noch polnisches Geld
oder einen Grundbuchauszug bei uns hätten. Wir zeigten ihnen 800 Zloty, die sie uns, nach Ausstellung einer Quittung
über 500 Zloty, abnahmen. Die Grundbuchauszüge habe ich, im Stroh versteckt, dem Ochsen vor die Füße gelegt. Falls
jemand da suchen sollte, hätte ich gesagt, das das Tier bösartig veranlagt ist, und ich für seine Sicherheit nicht
garantieren könnte, deshalb sollte er vorsichtig sein.
Als die Grenzkontrolle den Zug verlassen hatte, setzte sich die Lokomotive wieder in Bewegung und überquerte nach
kurzer Zeit die Oderbrücke. Auf einer eingezäunten Fläche, jenseits der Grenze, hat man uns abgestellt hat und die
Lokomotive fuhr zurück auf polnisches Gebiet. Vor und hinter uns waren die Tore verschlossen. Auf den Wachtürmen,
links und Rechts von uns, standen Posten mit einem Gewehr im Anschlag. Vier Grenzbeamte der DDR, jeder mit einer
Leiter in der Hand, sowie ein Schäferhund, kamen zu unserem Wagen. Sie öffneten die Schiebetüre, stellten die Leiter
davor und ließen den Hund in den Wagen springen, der nur etwas herum schnupperte und wieder heraussprang. 2 Beamte
haben dann anschließend, die Papiere kontrolliert und das Inventar gezählt.
Nach einiger Zeit wurden wir an einen Güterzug der Reichsbahn angehängt und fuhren von Frankfurt an der Oder, vorbei
an Berlin, Ellingen und Nordhausen, über die Grenze zur Bundesrepublik bis Herzberg. Hier hat ein Zollbeamter der
Bundesrepublik, die Formalitäten erledigt und ein Tierarzt die Pferde, Rinder und Schweine gründlich untersucht. Ich
musste ihnen die Mäuler aufhalten und die Füße hochheben. Danach hat uns die Lokomotive zu einer Wasserzapfstelle
gebracht, wo wir die Tiere tränken und unsere Behälter mit Wasser auffüllen konnten. Anschließen fuhren wir über
Northeim nach Göttingen, zur Viehverwertungsgenossenschaft, die zuvor von unserer Ankunft in Kenntnis gesetzt wurde.
Der Ochse, die Sterke und die Schweine wurden, in Göttingen zum Schlachthof gebracht; die Pferde kamen nach Hannover
und die Schafsböcke nach Kassel. Wir waren mit dem Viehtransport 5 Tage unterwegs; hatten so manche Klippe umschifft
und Schwierigkeiten gemeistert, die im normalen Leben nicht vorkommen.
Wir wurden mit einem PKW, ins Durchgangslager Friedland bei Göttingen gefahren, wo mein Sohn Kurt, meine Schwester
Frieda Pelkowski und Siegfried Brosch mit Familie, die am 30 Juli, um 14 Uhr, von Warschau mit dem Zug abgefahren, und
hier am 31. Juli in den Morgenstunden eingetroffen sind, schon auf uns gewartet haben. In Friedland hat man uns mit
Familie Siegfried Brosch in einem Raum untergebracht, wir wurden registriert und erhielten 20 DM Überbrückungsgeld,
pro Person. Da wir erst am Freitag in Friedland eingetroffen sind, mussten wir hier über das Wochenende bleiben,
obwohl die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der Regel nur 3 bis 4 Tage beträgt.
Um einen Antrag für die Ausreise stellen zu können, brauchten wir eine Einladung von in der Bundesrepublik lebenden
Verwandten. Diese Einladung hat uns mein Bruder, Ernst Rattay, aus Ingelheim am Rhein zugeschickt. Ingelheim liegt im
Bundesland Rheinland-Pfalz. Das Geld für die Bahnfahrt, hat uns, Frieda Schellin, geb. Nickel, aus Duisburg, die
Tochter unseres Nachbarn, überwiesen. In Friedland wurden wir registriert. Im Registrierschein, war als unser
nächster Aufenthaltsort in der Bundesrepublik, das Durchgangslager Osthofen bei Worms, das alle Aussiedler für
Rheinland-Pfalz aufnehmen musste, eingetragen. Die Eintragung erfolgte deshalb, weil der Ort aus dem uns unsere
Einladung zugeschickt wurde, sich auch in Rheinland-Pfalz befand.
Da ich nach dem Polenfeldzug, als Soldat, ein Jahr im Kreis Opladen, im Rheinland gewesen bin, wäre ich sehr gerne in
diese Gegend gezogen, denn die Erinnerung an die schönen Tage die ich dort verlebt habe war in mir immer noch wach.
Ich versuchte die Eintragung in unseren Regiestierscheinen ändern zu lassen, was nach einigen, vielleicht auch
berechtigten Einwänden, am 4. August, vom Beauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen, genehmigt wurde. Anstelle von
Rheinlad-Pfalz stand da jetzt Nordrhein-Westfalen und am 7. August, fuhren wir, noch mit anderen Aussiedlern, ins
Durchgangslager Unna-Massen, am östlichen Rande des Ruhrgebietes gelegen. Hier wurden wir in einem Zimmer untergebracht
und konnten unser Essen in einer Gemeinschaftsküche zubereiten.
Am 8. August wurden wir in Unna-Massen, als Bürger der Bundesrepublik Deutschland registriert, erhielten
Einhundert DM Begrüßungsgeld, den Vertriebenen Ausweis -A -und 4 Wochen später den Bundespersonalausweis. In
Unna-Massen haben wir mehr als 4 Monate verbracht, weil mein Sohn Kurt, wegen fehlender Berufsausbildung, in Unna, an
einem Grundlehrgang für Metallarbeiter teilgenommen hat, der vom Arbeitsamt finanziert wurde. Am 11 Dezember 1969 sind
wir endlich an unserem vorläufigen Wohnsitz, im Durchgangswohnheim, an der Elisabethstraße 13, in Velbert angekommen.
Ab dem 5. Januar 1970 konnten meine Söhne, in der Zahnradfabrik Reining, in Velbert ihrer geregelten Arbeit nachgehen.
Von Bau- und Sparverein in Velbert wurde uns am 20. Juni 1970, unsere erste Wohnung zugewiesen.
Velbert im Februar 1972
gezeichnet: Gustav Rattay
Am nächsten Tag kam unser Kompanieführer, im Range eines Hauptmanns, zu Pferde angeritten. Er begrüßte uns mit;
Guten Morgen Kameraden, wir antworteten ihm mit; Guten Morgen Herr Hauptmann. Er hat dann die Front abgeschritten und
jeder musste sich mit seinem Namen vorstellen. Um 5 Uhr wurde geweckt, 6 Uhr Kaffee holen, 7-8 Uhr Unterricht, 8-11
Uhr exerzieren auf dem Kasernenhof. Um 11.30 blies der Trompeter zur Mittagspause. Die erste Zeit war noch alles
ziemlich gemütlich aber dann wurde es von Tag zu Tag strenger. Um 10 Uhr abends war Zapfenstreich, dann ging der
Unteroffizier vom Dienst von Stube zu Stube, der Stubenälteste musste die Anwesenheit aller Rekruten melden; zum
Beispiel: Stube 56 belegt mit 14 Mann, alle zu Haus. Wir mussten in 2 Reihen antreten, mit Drillichanzug bekleidet
und in Pantoffeln, ein tadelloses Aussehen präsentieren. Der Diensthabende Unteroffizier prüfte ob alle
vorschriftsmäßig angezogen, gewaschen, gekämmt und ob alle Knöpfe an der Jacke geschlossen waren. Als er bei einem
Rekruten einen offenen Knopf erspähte, hat er uns gefragt, ob jemand ein Taschenmesser bei sich hat.
Wir ahnten nicht Gutes, darum haben wir uns ganz still verhalten und nichts gesagt. Da sagte der U.v.D. plötzlich:
”Wenn niemand von euch ein Messer bei sich hat, dann habe ich ein”. Er zog sein Messer aus der Tasche und fing an, bei
dem Rekruten die Knöpfe abzuschneiden. Als die Knöpfe zu Boden purzelten, brachen wir in lautes Gelächter aus. Das hat
ihn so in Rage gebracht, das unser unwürdiges Benehmen, zuerst mit einem „Donnerwetter” bestraft wurde. Dann schrie
er: ”In den Korridor marsch, marsch, die Treppen runter bis auf den Hof”. Als wir unten angekommen waren hieß es
wieder; "Zurück auf die Stube in der 3. Etage”. Jemand hat mir bei dem Durcheinander, von hinten in den Pantoffel
getreten, so das er auseinander gerissen wurde. Ich bin dann nur mit einem Pantoffel und einem Socken die Treppen rauf
und runter gelaufen. So wurden wir 3-mal hinunter und wieder hinauf gejagt.
Danach ließ er uns wieder antreten und hat mit einer Taschenlampe unter den Betten geleuchtet. Plötzlich schrie er
wieder los: "Das nennt ihr Fegen? wenn ihr mit dem Besen nicht fegen könnt, dann mühst ihr das mit eueren Bäuchen tun.
Marsch, marsch unter die Betten” . Als wir schon alle am Schlafen waren, kam der U.v.D. wieder und hat nachgesehen ob
alle Schränke abgeschlossen waren. Ein Kamerad hatte seinen Schlüssel verloren, deshalb hat er das Schoß nur so
eingehängt. Als der U.v.D. das bemerkte hat er die Türe aufgerissen, die ganzen Sachen aus dem Schrank, quer durch die
Stube verteilt und war dann endlich gegangen.
Die Anziehsachen mussten, fein sauber gefaltet, auf dem Stuhl liegen; da drauf die Socken und die Pantoffeln unter dem
Stuhl. Die Stühle mussten in einer Reihe ausgerichtet sein; die Hosenträger im Schrank einschlossen und der Brustbeutel
mit Geld auf dem Hals tragen werden. Morgens wurden wir geweckt und kamen zuerst in den Waschraum. Jeder musste seinen
entblößten Oberkörper mit kaltem Wasser abreiben. Da draußen strenger Frost herrschte war es im Waschraum auch sehr
kalt, so das manche ihr Hemd anbehielten. Der UvD hat dann bei seinem Kontrollgang alle Verweigerer aufgeschrieben
und ihnen befohlen in 30 Minuten mit einem Besen in der Hand auf der Schreibstube zu erscheinen. Einige mussten den
Kasernenhof fegen, andere die zugefrorenen Latrinen enteisen und reinigen. Während unserer Ausbildungszeit durften wir
die Kaserne nicht verlassen. Wenn man Stuben- oder Frühdienst hatte, blieb keine Zeit zum Frühstücken.
Nach 6 Wochen wurden wir in der Grollmann Kaserne vereidigt. Die Regimentskapelle spielte "Heil dir im Siegerkranz",
danach folgten 3 Strophen des Deutschlandliedes. Vor der Vereidigung wurden die Rekruten gefragt wer keine deutsche
Staatsangehörigkeit besitzt. Es sind dann Luxemburger und auch noch welche aus anderen Ländern hervorgetreten. Sie
wurden gefragt ob sie die deutsche Staatsangehörigkeit annehmen wollen. Die das abgelehnt haben wurden auf die
Schreibstube gerufen und sofort aus dem Militärdienst entlassen. Nach der Vereidigung erfolgte ein Kirchgang, danach
konnte man einen Stadturlaub beantragen. Nach dem Mittagessen mussten alle, die einen Urlaubschein beantragt hatten
vor der Kaserne antreten. Der Hauptfeldwebel prüfte dann ob an der Uniform alle Knöpfe blank geputzt waren, die Stiefel
glänzten und der Rekrut auch vorschriftsmäßig grüßen konnte. Wer diese Anforderungen nicht erfüllen konnte musste
seinen Urlaubschein wieder abgeben und zurück auf sein Zimmer gehen.
Wenn man die Kaserne für eine gewisse Zeit verlassen wollte, mussten zuerst der Korporal, dann der Hauptfeldwebel und
letzt endlich der Hauptmann, seine Zustimmung erteilen. Es wurde geprüft; ob die Ausgeh-Uniform sitzt, alle Knöpfe
blank geputzt sind und der Helm so blank ist das man sich darin spiegeln kann. Unser Hauptmann war in Zivil,
Bürgermeister von Osterode. Er war sehr stolz wenn er seine Kompanie, in Parade Uniform und mit einem fröhlichen Lied
auf den Lippen, durch seine Stadt führen durfte.
Als wir eines Tages zum etwa 6 Kilometer entfernten Schießstand marschieren sollten, war es sehr kalt und glatt. Der
Hauptmann ritt durch das große Tor, wir aber sind durch das kleine Tor gegangen und haben eine steil bergab führende
Abkürzung gewählt. Die Zug- und Gruppenführer gingen voraus und wir im Gänsemarsch hinterher. Ein Kamerad hat sich auf
den Gewehrkolben gesetzt und ist darauf den Berg hinunter gerutscht. Als die Anderen das sahen haben sie es ihm
nachgemacht und hatten einen Riesenspaß. Da kam der Hauptmann plötzlich im Galopp angeritten; ließ alles anhalten und
hat zuerst die Zugführer ausgeschimpft, dann anschließend die ganze Kompanie. Er sagte: „Wie könnt ihr es wagen, so
mit eueren Gewehren umgehen. Ein Gewehr soll man wie seine Braut behandeln und nicht wie einen Straßenbesen”. Zur
Strafe mussten wir, links und rechts der Straße, in zwei Reihen antreten und durch den verschneiten Straßengraben
robben. Die Herrn Zug- und Gruppenführer durften die Straße benutzen und erteilten uns nur Befehle, wie: hinlegen,
nach rechts schwenken, nach links schwenken, einzeln vorarbeiten und sammeln. Als wir dann abgekämpft, in Linien zu
2 Glieder angetreten waren, ging es mit Gesang zum Schießstand.
Auf dem Schießstand angekommen, erhielten wir zuerst eine praktische Unterweisung, für den Gebrauch von Schusswaffen.
Wir mussten solange mit einem nicht geladenen Gewehr üben, bis wir unserem Vorgesetzten beweisen konnten, dass wir
alles im Griff haben. Daraufhin wurden jedem 10 Patronen zugeteilt, so das er unter der Aufsicht eines Unteroffiziers
mit den Schießübungen beginnen konnte. Der Unteroffizier hat die Position der Einschüsse, auf der Scheibe, in einem
Buch eingetragen und nach Beendigung der Übung dem Hauptmann Bericht erstattet, ob der Schütze seine Aufgabe erfüllt
hat oder nicht. Nach dem Schießen wurden die Gewehre zu Pyramiden zusammengestellt. Diejenigen die ihre Aufgabe nicht
erfüllt haben, mussten rund um die Zielscheibe, die Bleikugeln aufsammeln.
Seit unserer Einberufung hatten wir noch keinen Heimaturlaub. Urlaub bekamen nur die, die ihren Heimatort zu Fuß
erreichen konnten. Wegen der vielen Truppentransporte die täglich von Ost nach West unterwegs waren durften wir die
Eisenbahn nicht benutzen. Einmal wurde uns gesagt; wenn jemand gut schießen kann der bekommt Heimaturlaub, aber auch
das war nur ein leeres Versprechen.
Danach ließ er uns wieder antreten und hat mit einer Taschenlampe unter den Betten geleuchtet. Plötzlich schrie er
wieder los: "Das nennt ihr Fegen? wenn ihr mit dem Besen nicht fegen könnt, dann mühst ihr das mit eueren Bäuchen tun.
Marsch, marsch unter die Betten” . Als wir schon alle am Schlafen waren, kam der U.v.D. wieder und hat nachgesehen ob
alle Schränke abgeschlossen waren. Ein Kamerad hatte seinen Schlüssel verloren, deshalb hat er das Schoß nur so
eingehängt. Als der U.v.D. das bemerkte hat er die Türe aufgerissen, die ganzen Sachen aus dem Schrank, quer durch die
Stube verteilt und war dann endlich gegangen.
Die Anziehsachen mussten, fein sauber gefaltet, auf dem Stuhl liegen; da drauf die Socken und die Pantoffeln unter dem
Stuhl. Die Stühle mussten in einer Reihe ausgerichtet sein; die Hosenträger im Schrank einschlossen und der Brustbeutel
mit Geld auf dem Hals tragen werden. Morgens wurden wir geweckt und kamen zuerst in den Waschraum. Jeder musste seinen
entblößten Oberkörper mit kaltem Wasser abreiben. Da draußen strenger Frost herrschte war es im Waschraum auch sehr
kalt, so das manche ihr Hemd anbehielten. Der UvD hat dann bei seinem Kontrollgang alle Verweigerer aufgeschrieben
und ihnen befohlen in 30 Minuten mit einem Besen in der Hand auf der Schreibstube zu erscheinen. Einige mussten den
Kasernenhof fegen, andere die zugefrorenen Latrinen enteisen und reinigen. Während unserer Ausbildungszeit durften wir
die Kaserne nicht verlassen. Wenn man Stuben- oder Frühdienst hatte, blieb keine Zeit zum Frühstücken.
Nach 6 Wochen wurden wir in der Grollmann Kaserne vereidigt. Die Regimentskapelle spielte "Heil dir im Siegerkranz",
danach folgten 3 Strophen des Deutschlandliedes. Vor der Vereidigung wurden die Rekruten gefragt wer keine deutsche
Staatsangehörigkeit besitzt. Es sind dann Luxemburger und auch noch welche aus anderen Ländern hervorgetreten. Sie
wurden gefragt ob sie die deutsche Staatsangehörigkeit annehmen wollen. Die das abgelehnt haben wurden auf die
Schreibstube gerufen und sofort aus dem Militärdienst entlassen. Nach der Vereidigung erfolgte ein Kirchgang, danach
konnte man einen Stadturlaub beantragen. Nach dem Mittagessen mussten alle, die einen Urlaubschein beantragt hatten
vor der Kaserne antreten. Der Hauptfeldwebel prüfte dann ob an der Uniform alle Knöpfe blank geputzt waren, die Stiefel
glänzten und der Rekrut auch vorschriftsmäßig grüßen konnte. Wer diese Anforderungen nicht erfüllen konnte musste
seinen Urlaubschein wieder abgeben und zurück auf sein Zimmer gehen.
Wenn man die Kaserne für eine gewisse Zeit verlassen wollte, mussten zuerst der Korporal, dann der Hauptfeldwebel und
letzt endlich der Hauptmann, seine Zustimmung erteilen. Es wurde geprüft; ob die Ausgeh-Uniform sitzt, alle Knöpfe
blank geputzt sind und der Helm so blank ist das man sich darin spiegeln kann. Unser Hauptmann war in Zivil,
Bürgermeister von Osterode. Er war sehr stolz wenn er seine Kompanie, in Parade Uniform und mit einem fröhlichen Lied
auf den Lippen, durch seine Stadt führen durfte.
Als wir eines Tages zum etwa 6 Kilometer entfernten Schießstand marschieren sollten, war es sehr kalt und glatt. Der
Hauptmann ritt durch das große Tor, wir aber sind durch das kleine Tor gegangen und haben eine steil bergab führende
Abkürzung gewählt. Die Zug- und Gruppenführer gingen voraus und wir im Gänsemarsch hinterher. Ein Kamerad hat sich auf
den Gewehrkolben gesetzt und ist darauf den Berg hinunter gerutscht. Als die Anderen das sahen haben sie es ihm
nachgemacht und hatten einen Riesenspaß. Da kam der Hauptmann plötzlich im Galopp angeritten; ließ alles anhalten und
hat zuerst die Zugführer ausgeschimpft, dann anschließend die ganze Kompanie. Er sagte: „Wie könnt ihr es wagen, so
mit eueren Gewehren umgehen. Ein Gewehr soll man wie seine Braut behandeln und nicht wie einen Straßenbesen”. Zur
Strafe mussten wir, links und rechts der Straße, in zwei Reihen antreten und durch den verschneiten Straßengraben
robben. Die Herrn Zug- und Gruppenführer durften die Straße benutzen und erteilten uns nur Befehle, wie: hinlegen,
nach rechts schwenken, nach links schwenken, einzeln vorarbeiten und sammeln. Als wir dann abgekämpft, in Linien zu
2 Glieder angetreten waren, ging es mit Gesang zum Schießstand.
Auf dem Schießstand angekommen, erhielten wir zuerst eine praktische Unterweisung, für den Gebrauch von Schusswaffen.
Wir mussten solange mit einem nicht geladenen Gewehr üben, bis wir unserem Vorgesetzten beweisen konnten, dass wir
alles im Griff haben. Daraufhin wurden jedem 10 Patronen zugeteilt, so das er unter der Aufsicht eines Unteroffiziers
mit den Schießübungen beginnen konnte. Der Unteroffizier hat die Position der Einschüsse, auf der Scheibe, in einem
Buch eingetragen und nach Beendigung der Übung dem Hauptmann Bericht erstattet, ob der Schütze seine Aufgabe erfüllt
hat oder nicht. Nach dem Schießen wurden die Gewehre zu Pyramiden zusammengestellt. Diejenigen die ihre Aufgabe nicht
erfüllt haben, mussten rund um die Zielscheibe, die Bleikugeln aufsammeln.
Seit unserer Einberufung hatten wir noch keinen Heimaturlaub. Urlaub bekamen nur die, die ihren Heimatort zu Fuß
erreichen konnten. Wegen der vielen Truppentransporte die täglich von Ost nach West unterwegs waren durften wir die
Eisenbahn nicht benutzen. Einmal wurde uns gesagt; wenn jemand gut schießen kann der bekommt Heimaturlaub, aber auch
das war nur ein leeres Versprechen.
Nach 6 Wochen wurden wir in der Grollmann Kaserne vereidigt. Die Regimentskapelle spielte "Heil dir im Siegerkranz",
danach folgten 3 Strophen des Deutschlandliedes. Vor der Vereidigung wurden die Rekruten gefragt wer keine deutsche
Staatsangehörigkeit besitzt. Es sind dann Luxemburger und auch noch welche aus anderen Ländern hervorgetreten. Sie
wurden gefragt ob sie die deutsche Staatsangehörigkeit annehmen wollen. Die das abgelehnt haben wurden auf die
Schreibstube gerufen und sofort aus dem Militärdienst entlassen. Nach der Vereidigung erfolgte ein Kirchgang, danach
konnte man einen Stadturlaub beantragen. Nach dem Mittagessen mussten alle, die einen Urlaubschein beantragt hatten
vor der Kaserne antreten. Der Hauptfeldwebel prüfte dann ob an der Uniform alle Knöpfe blank geputzt waren, die Stiefel
glänzten und der Rekrut auch vorschriftsmäßig grüßen konnte. Wer diese Anforderungen nicht erfüllen konnte musste
seinen Urlaubschein wieder abgeben und zurück auf sein Zimmer gehen.
Wenn man die Kaserne für eine gewisse Zeit verlassen wollte, mussten zuerst der Korporal, dann der Hauptfeldwebel und
letzt endlich der Hauptmann, seine Zustimmung erteilen. Es wurde geprüft; ob die Ausgeh-Uniform sitzt, alle Knöpfe
blank geputzt sind und der Helm so blank ist das man sich darin spiegeln kann. Unser Hauptmann war in Zivil,
Bürgermeister von Osterode. Er war sehr stolz wenn er seine Kompanie, in Parade Uniform und mit einem fröhlichen Lied
auf den Lippen, durch seine Stadt führen durfte.
Als wir eines Tages zum etwa 6 Kilometer entfernten Schießstand marschieren sollten, war es sehr kalt und glatt. Der
Hauptmann ritt durch das große Tor, wir aber sind durch das kleine Tor gegangen und haben eine steil bergab führende
Abkürzung gewählt. Die Zug- und Gruppenführer gingen voraus und wir im Gänsemarsch hinterher. Ein Kamerad hat sich auf
den Gewehrkolben gesetzt und ist darauf den Berg hinunter gerutscht. Als die Anderen das sahen haben sie es ihm
nachgemacht und hatten einen Riesenspaß. Da kam der Hauptmann plötzlich im Galopp angeritten; ließ alles anhalten und
hat zuerst die Zugführer ausgeschimpft, dann anschließend die ganze Kompanie. Er sagte: „Wie könnt ihr es wagen, so
mit eueren Gewehren umgehen. Ein Gewehr soll man wie seine Braut behandeln und nicht wie einen Straßenbesen”. Zur
Strafe mussten wir, links und rechts der Straße, in zwei Reihen antreten und durch den verschneiten Straßengraben
robben. Die Herrn Zug- und Gruppenführer durften die Straße benutzen und erteilten uns nur Befehle, wie: hinlegen,
nach rechts schwenken, nach links schwenken, einzeln vorarbeiten und sammeln. Als wir dann abgekämpft, in Linien zu
2 Glieder angetreten waren, ging es mit Gesang zum Schießstand.
Auf dem Schießstand angekommen, erhielten wir zuerst eine praktische Unterweisung, für den Gebrauch von Schusswaffen.
Wir mussten solange mit einem nicht geladenen Gewehr üben, bis wir unserem Vorgesetzten beweisen konnten, dass wir
alles im Griff haben. Daraufhin wurden jedem 10 Patronen zugeteilt, so das er unter der Aufsicht eines Unteroffiziers
mit den Schießübungen beginnen konnte. Der Unteroffizier hat die Position der Einschüsse, auf der Scheibe, in einem
Buch eingetragen und nach Beendigung der Übung dem Hauptmann Bericht erstattet, ob der Schütze seine Aufgabe erfüllt
hat oder nicht. Nach dem Schießen wurden die Gewehre zu Pyramiden zusammengestellt. Diejenigen die ihre Aufgabe nicht
erfüllt haben, mussten rund um die Zielscheibe, die Bleikugeln aufsammeln.
Seit unserer Einberufung hatten wir noch keinen Heimaturlaub. Urlaub bekamen nur die, die ihren Heimatort zu Fuß
erreichen konnten. Wegen der vielen Truppentransporte die täglich von Ost nach West unterwegs waren durften wir die
Eisenbahn nicht benutzen. Einmal wurde uns gesagt; wenn jemand gut schießen kann der bekommt Heimaturlaub, aber auch
das war nur ein leeres Versprechen.
Als wir eines Tages zum etwa 6 Kilometer entfernten Schießstand marschieren sollten, war es sehr kalt und glatt. Der
Hauptmann ritt durch das große Tor, wir aber sind durch das kleine Tor gegangen und haben eine steil bergab führende
Abkürzung gewählt. Die Zug- und Gruppenführer gingen voraus und wir im Gänsemarsch hinterher. Ein Kamerad hat sich auf
den Gewehrkolben gesetzt und ist darauf den Berg hinunter gerutscht. Als die Anderen das sahen haben sie es ihm
nachgemacht und hatten einen Riesenspaß. Da kam der Hauptmann plötzlich im Galopp angeritten; ließ alles anhalten und
hat zuerst die Zugführer ausgeschimpft, dann anschließend die ganze Kompanie. Er sagte: „Wie könnt ihr es wagen, so
mit eueren Gewehren umgehen. Ein Gewehr soll man wie seine Braut behandeln und nicht wie einen Straßenbesen”. Zur
Strafe mussten wir, links und rechts der Straße, in zwei Reihen antreten und durch den verschneiten Straßengraben
robben. Die Herrn Zug- und Gruppenführer durften die Straße benutzen und erteilten uns nur Befehle, wie: hinlegen,
nach rechts schwenken, nach links schwenken, einzeln vorarbeiten und sammeln. Als wir dann abgekämpft, in Linien zu
2 Glieder angetreten waren, ging es mit Gesang zum Schießstand.
Auf dem Schießstand angekommen, erhielten wir zuerst eine praktische Unterweisung, für den Gebrauch von Schusswaffen.
Wir mussten solange mit einem nicht geladenen Gewehr üben, bis wir unserem Vorgesetzten beweisen konnten, dass wir
alles im Griff haben. Daraufhin wurden jedem 10 Patronen zugeteilt, so das er unter der Aufsicht eines Unteroffiziers
mit den Schießübungen beginnen konnte. Der Unteroffizier hat die Position der Einschüsse, auf der Scheibe, in einem
Buch eingetragen und nach Beendigung der Übung dem Hauptmann Bericht erstattet, ob der Schütze seine Aufgabe erfüllt
hat oder nicht. Nach dem Schießen wurden die Gewehre zu Pyramiden zusammengestellt. Diejenigen die ihre Aufgabe nicht
erfüllt haben, mussten rund um die Zielscheibe, die Bleikugeln aufsammeln.
Seit unserer Einberufung hatten wir noch keinen Heimaturlaub. Urlaub bekamen nur die, die ihren Heimatort zu Fuß
erreichen konnten. Wegen der vielen Truppentransporte die täglich von Ost nach West unterwegs waren durften wir die
Eisenbahn nicht benutzen. Einmal wurde uns gesagt; wenn jemand gut schießen kann der bekommt Heimaturlaub, aber auch
das war nur ein leeres Versprechen.
Seit unserer Einberufung hatten wir noch keinen Heimaturlaub. Urlaub bekamen nur die, die ihren Heimatort zu Fuß erreichen konnten. Wegen der vielen Truppentransporte die täglich von Ost nach West unterwegs waren durften wir die Eisenbahn nicht benutzen. Einmal wurde uns gesagt; wenn jemand gut schießen kann der bekommt Heimaturlaub, aber auch das war nur ein leeres Versprechen.
Der beste Tag war des Kaisers Geburtstag. Am 27. Januar mussten alle in der Grollmann Kaserne
antreten, der Battalions-Kommandeur beendete seine Laudatio mit den Worten: Seine Majestät, unser Kaiser und König
Wilhelm II, erlebe hoch, hoch, hoch. Dann spielte die Regimentskapelle: Heil dir im Siegerkranz, Herrscher des
Vaterlands, Heil Kaiser dir. Danach folgten 3 Strophen des Deutschlandliedes und anschließend fand ein Gottesdienst
statt. Anschließend gab es ein vorzügliches Mittagessen, Schweinebraten, ein Stück Wurst auf die Faust und Biermarken,
die man in der Kantine gegen gutes Bier einlösen konnte, danach Urlaub bis zum Wecken, ohne Urlaubschein. Mein Vater
und die Mutter eines Kameraden waren schon morgens angekommen, konnten uns aber nicht finden, wurden von einer Kaserne
in die andere geschickt. Erst als wir mit Musik, von der Kirche zurück zur Kaserne marschiert sind habe ich sie
zufällig entdeckt. Als sie mich auch erkannt haben, sind sie nachgekommen. Da war die Freude groß: Der Vater hatte
einen großen Koffer auf einem Krückstock über die Schulter getragen. Ich ging gleich zur Wache und habe sie angemeldet,
sie sind dann bis zum Abend geblieben. Es war einer der schönsten Tage in der Grollmann-Kaserne in Osterode.
Alle 10 Tage bekamen wir Sold. Vor der Auszahlung mussten wir antreten, jeder wurde gefragt ob noch Restgeld vom
letzten Sold vorhanden war. Dann bekam jeder 3,30 Mark, davon musste man noch Sidol für das Koppelschloss und
Schuhkreme für die Stiefel kaufen. Wer geraucht hat und nichts von zu Hause bekam war schlimm dran. Beim Militär bekam
man nicht nur die Ausbildung an der Waffe beigebracht, man lernte auch putzen, nähen, Strümpfe stopfen und vieles
Andere. Man bekam einen beschädigten Strumpf, der musste aufgeribbelt werden, mit der Wolle konnte man dann andere
Strümpfe stopfen oder Kleidungsstücke mit Namen kennzeichnen. wer das nicht konnte, der musste seinen Kameraden
Zigaretten oder Geld geben die das dann für ihn erledigten.
Verschiedene Kameraden gingen nach dem Dienst noch in die Stadt. Um 21:45 Uhr wurde zum Zapfenstreich geblasen, dann
musste man schnell zurück in die Kaserne, weil um 22:00 Uhr der Wachhabende von Bett zu Bett ging und prüfte ob auch
alle anwesend waren. Zwei mal pro Woche fanden Gewaltmärsche statt, mit vollem Gepäck im Tornister. Am Ende der
Marschkolonne fuhr dann ein Pferdewagen, wenn der Feldarzt bei jemandem einen Erschöpfungszustand feststellte, der
durfte dann aufsitzen. Am Sonnabend wurden auf dem großen Exerzierplatz Felddienstübungen durchgeführt, es befand sich
dort ein großer Hügel, den wir immer wieder erstürmen mussten. Am Nachmittag war Revierreinigen angesagt, wir mussten
dann die Tische schrubben, auf einen Tisch wurde Sand mit etwas Wasser gestreut, der nächste Tisch wurde mit der den
Beinen nach oben drauf gelegt und solange hin und her geschoben bis beide sauber waren. Mit den Stühlen geschah das
Gleiche. Dann wurde der Fußboden in der Stube geschrubbt, die Schränke abgewaschen, Staub geputzt, zuletzt kamen Flur
und Treppe dran.
Für die Arbeit war eine Stunde angesetzt, wenn jemand zu früh fertig war erregte er den Argwohn des Diensthabenden
Korporals, der prüfte dann alles genau, fand natürlich immer etwas das nicht seinen Erwartungen entsprach. Der
Übereifrige musste dann Nacharbeiten bis die Stunde um war. Eine Stunde war für Gewehr reinigen und Unterricht an der
Waffe vorgesehen.
Im Februar wurden wir neu eingekleidet; Schnürschuhe, Koppel, alles gelbes Leder mussten wir mit Lederschwärze
behandeln. 2 Wolldecken, Uniform und Helm in feldgrau, da brauchten wir die Knöpfe nicht mehr zu putzen. Die neuen
Gewehre mussten zuerst eingeschossen werden. Es wurden 90 scharfe Patronen und Marschverpflegung ausgegeben, danach
mussten wir mit vollem Gepäck zum Appell antreten. Man konnte kaum gerade stehen, weil der Tornister einen in die Knie
zwang. Der Major, der die Aufstellung besichtigte rief >Brust raus<, dann informierte er uns dass wir ins
Feldrekrutendepot und in Feindesland kommen. Urlaub bekam niemand. Ich habe ein Telegramm nach Hause geschickt, mit
der Nachricht dass wir bald abrücken werden. Einen Tag vor dem ausrücken hat mich meine Mutter noch besucht, sie hat
mir vieles mitgebracht. Alles konnte ich nicht mitnehmen, weil es nicht gestattet war anderes Gepäck bei sich zu haben
als dem Soldaten zustand.
Abmarsch zum Fronteinsatz
Am nächsten Tag hat uns die Regimentskapelle mit Musik zum Bahnhof gebracht. Von Osterode ging
es über Thorn, Posen,
Annaberg, Warschau, Brestlitowsk ins Pruschana-Lager. Das war eine russische Artillerie-Kaserne, in der 2 deutsche,
3 österreichische Bataillone und eine Offiziersschule untergebracht waren. Ein Bataillon das waren wir 18 und 19
jährige, die Anderen waren Männer bis 45 Jahre. Als wir in Osterode abfuhren lag Schnee, in Annaberg/Schlesien waren
die Kühe auf der Weide und im Pruschana-Lager lag der Schnee wieder einen Meter hoch. Drei Kilometer vor unserem vor
unserem Lager war die Bahnfahrt zu Ende. Mit den schweren Tornistern waren viele überfordert, wir mussten immer wieder
warten bis alle nachkamen. Unsere Unterkünfte das waren Baracken die den Russen als Pferdeställe gedient hatten. In
jeder Baracke wurde eine Kompanie mit Schreibstube untergebracht, die nur durch ein Zelt abgegrenzt war.
Wir haben aus Brettern Doppelbetten hergestellt, in jeder Baracke war ein Ziegelofen. Unsere neuen Uniformen und die
scharfe Munition mussten wir abgeben und bekamen dafür alte Bekleidung, sowie Ecksezierpatronen. Hier ging es wieder
Kasernenmäßig zu, das jüngere Bataillon bekam besseres Essen, doppelte Portionen und nach dem Essen 2 Stunden Bettruhe.
Wenn jemand die Bettruhe nicht einhielt und dabei erwischt wurde wusste zur Strafe Holz hacken oder Schnee schaufeln.
Zwei Wochen war Frost bis minus 40 Grad, da hatten wir keinen Unterricht im Freien, alle Aktivitäten fanden in der
Baracke statt, die nur mit nassem Holz beheizt wurde und dem entsprechend war auch die Temperatur im Inneren. Um
Brennmaterial für die Küche zu besorgen mussten wir ins nächste Dorf gehen und von zerfallenen Häusern Holz holen.
Als endlich das Tauwetter einsetzte verwandelte sich die Gegend um Baranowitschi in ein unüberwindbares Sumpfgelände.
Wir wurden mit anderen Einheiten die aus Frankreich zu uns verlegt wurden, zusammengelegt. Wenn jemand nachweisen
konnte dass er Landwirt ist und mehr als 100 Morgen Ackerland besitzt, konnte er einen Urlaub zur Frühjahrsbestellung
beantragen. Ein Gottlieb Piotrowski aus Plohsen hat seinen Urlaub bewilligt bekommen und durfte für 14 Tage nach Hause.
Wenn von der unweit entfernten Front Kanonendonner zuhören war und Alarm ausgerufen wurde, dachten wir es geht los.
Obwohl wir als Reserve aufgestellt waren mussten wir allzeit einsatzbereit sein. Wir haben auch Bunker und Stollen
gebaut, Schützengräben ausgeworfen und mit scharfen Handgranaten exerziert.
Als Gottlieb Piotrowski nach 2 Wochen zurückkam waren wir schon in Alarmbereitschaft und sind dann auch 2 Tage später
ausgerückt. Kamerad Piotrowski hatte mir noch ein großes Paket von zu Hause mitgebracht.
Italien hat Deutschland und Österreich den Krieg erklärt.
Zuerst sind drei Bataillone Österreicher ausgerückt, dann die Deutschen hinterher. Bis zum
Bahnhof Linowa wurden wir von einer Musikkapelle begleitet, dann ging es per Eisenbahn ab nach Baranowitsche. Dort
wurden wir der, an der Westfront aufgeriebenen, 15ten Reserve Division zugeteilt. Es wurde uns gesagt das Kameraden
aus der Heimat gleichen Gruppen zugeordnet werden können. Ich hatte einen Freund aus meinem Dorf, Gustav Spektor,
einen aus Groß Schöndamrau, Wilhelm Lukas und einen aus Ortelsburg, Karl Schlensack, wir kamen zu zusammen in eine
Kompanie. Zuerst waren wir in einem Kinosaal einquartiert, haben jeden Tag Schützengräben ausgehoben und Feldübungen
gemacht. Es war ein sumpfiges Gelände, so dass die Soldaten wegen den vielen Mücken, Netze auf den Köpfen tragen
mussten. Nach einem Gewitter wurde es plötzlich unerträglich. Die Mücken hatten meinen Freund so zerstochen dass sein
Gesicht dermaßen angeschwollen war und ich ihn gar nicht wieder erkannt habe.
Von Baranowitsche wurden wir wieder auf die Eisenbahn verladen, die uns mit unbekanntem Ziel Richtung Osten fuhr.
Nachdem wir unterwegs einmal zum Essenfassen gehalten haben, kamen wir in der Nacht in Krakau an. In der nächsten
Nacht befanden wir uns schon in den Karpaten, wo wir die Hügelketten zu Fuß überqueren mussten, die Fahrzeuge fuhren
um die Berge herum und wir mussten manchmal 2 Stunden warten bis sie uns wieder eingeholt hatten. So ging es immer
weiter bis wir auf einen Berg kamen wo wir Zelte aufgebaut und Biwak bezogen haben. Dort stießen wir auf türkische
Einheiten die auf Mauleseln Munition und Verpflegung über die Berge transportiert haben. Die Esel hatten ein Gestell
auf dem Rücken, auf jeder Seite eine Fass mit Wasser oder Kisten mit Proviant. Ihre Artillerie wurde von 6 Mauleseln
gezogen, während die Offiziere, ohne Sattel, ohne Zaumzeug, nur mit einem Hanfseil ausgerüstet, daher kamen.
Die Mannschaften marschierten wie es jeder für richtig hielt, mit aufgekrempelten Ärmeln, das Gewehr über den Tornister
gelegt, wie die Wilddiebe. Im Gegensatz dazu herrschte bei uns strenge Disziplin, wen jemand aus der Reihe ging kam
sofort der Kompanieführer angeritten, hat uns angeschrieen, uns klar gemacht dass wir keine Türken seien und nur auf
höheren Befehl etwas an der Marschordnung ändern dürften, wer dagegen verstoße, müsste mit einem 3tägigen Arrest
rechnen. Wir haben hinter der der Front Gewaltmärsche durchgeführt die dem Feind große Truppenaufmärsche vortäuschen
sollten.
Wir lagen in einem Buchenwald in Bereitschaft. Überläufer berichteten dass auf russischer Seite eine Großoffensive
vorbereitet wird. In einer Nacht wurde plötzlich Alarm geschlagen, der Russe war zu einem Angriff mit Gasgranaten
übergegangen. Wir lagen unter Zelten und hatten die Gasmasken gar nicht bei uns, sondern nur etwas abseits liegen. In
der Dunkelheit hat mach einer keine Gasmaske mehr gefunden. Es war ein fürchterliches Durcheinander. Dabei war es
unsere Pflicht die Maske immer an dem Tragriemen über dem Hals zu tragen, mit halb geöffnetem Deckel. Uns hat es zum
Glück nicht so stark betroffen weil wir auf einer Anhöhe lagen und die Gaswolken sich im Tal verteilten. Wir wurden in
höchste Alarmbereitschaft versetzt weil der Russe die österreichische Front durchbrochen hatte.
Eigentlich sollten wir noch an einer Gulaschkanone Essen fassen, aber es blieb uns dazu keine Zeit mehr. Der
Kompanieführer befahl uns die Zelte abzubrechen, auf den Tornister aufzurollen und in fünf Minuten marschbereit zu
sein. Die Kanoniere befanden sich schon in der Batteriestellung, luden die Granaten, die sofort abgefeuert wurden. Der
Battalions-Kommandeur versammelte die Kompanieführer und erteilte ihnen die Angriffsbefehle. Derweil sollten wir in
einem Eichenwal der schon mit Granattrichter übersät war, Deckung suchen. Bald hatten wir die Verbindung zu unserem
Batteriestab verloren. Wir warfen unsere Tornister auf einen Haufen, schwärmten unverzüglich, nur mit Sturmgepäck
ausgerüstet, 4 Handgranaten im Brotbeutel, zum Angriff aus. Wir robbten uns einzeln voran. Weil der Russe unsere
Stellungen schon überrannt hatte war jeder auf sich selbst angewiesen. Mann hörte kein Kommando mehr weil der Russe
inzwischen den Rückzug angetreten hatte, um sich auf einer Bergspitze zu verschanzen, von der er uns mit
Flachbahngeschützen beschoss. Irgendwann befanden wir uns in einem Schützengraben, wo ein Leutnant und 17 Mann aus
unserer Division die Stellung hielten. Unter Androhung von Gewalt befahl er uns den Graben sofort zu verlassen und am
Gegenangriff teilzunehmen. Wir sprangen über den Stacheldraht, duckten uns aber sofort im nächsten Graben damit das
mörderische Maschinengewehrfeuer uns nicht hinwegfegte.
Dort blieben wir bis zum Eintritt der Dunkelheit liegen. Wir konnten unsere Waffen nicht mehr einsetzen weil der Sand
die Gewehrschlösser blockiert hatte. Als es Nacht wurde herrschte ein gespenstische Stille. Wir krochen aus dem
Schützengraben und lauschten nach irgendeinem Lebenszeichen von anderen Kameraden. Dann hörten wir irgendwelche Laute
die wir nicht genau zuordnen konnten. Sie kamen aus einem Holzbunker ganz in der Nähe. Wir näherten uns ganz
vorsichtig, als plötzlich eine Schar österreichischer Soldaten herausstürmte. An unseren Stahlhelmen erkannten sie
dass wir Deutsche sind. Bald danach trafen wir auch auf 69 deutsche Soldaten die zu unserer Division gehörten. Dann
kam ein Hauptmann der uns mit Vorwürfen überschüttete, wir seien Feiglinge, wir hätten uns von unserer Einheit entfernt.
Wir haben ihm den Vorgang geschildert, aber ließ nicht mit sich reden und sagte nur dass wir bestraft werden und nichts
zu essen bekommen. Wir wurden einer Maschinengewehr Einheit zugeteilt welche die vorderste Stellung verteidigen
musste. Wir hatten einen Stollen mit 2 Ausgängen.
Die Russen haben bemerkt das sich etwas bewegte und haben uns unverzüglich mit Artilleriefeuer belegt. Schon die
dritte Granate war ein Volltreffer. Vier Kameraden waren sofort tot, ich bekam mit einem Stollenbrett in den Rücken
der sofort blau und grün angelaufen war. Ich schaute nach oben, alles war verschüttet. Ich wusste nicht das da noch
ein Ausgang war, doch die Kameraden die hier in Stellung waren haben mir geholfen das Freie zu erreichen. Ich habe
mich am nächsten Tag krank gemeldet, dachte 2 Tage Schonung zu bekommen, aber der Sanitäter hat mir nur den Rücken mit
Spiritus eingerieben und mich wieder, zurück zu unserer Kompanie geschickt. Sie bestand nur noch aus 3 Gruppen, die in
einem Stollen, der in einen Berg gehauen war, Stellung bezogen hatten. Wir konnten uns hier wenigstens waschen, an
einer Quelle die aus dem Felsen sprudelte. Wir waren nicht mehr einsatzfähig und mussten durch andere Truppenteile
verstärkt werden.
Beim Essen holen musste man auch das Gewehr bei sich haben, es wurde erzählt dass hier der braune Bär herumwandert.
Ich habe keinen gesehen, nur das die Toten ausgescharrt wurden und verstümmelt herumlagen. Nach einigen Wochen haben
die Deutschen eine Gegenoffensive gestartet, von den Bergen herunter, über den Fluss Zlota Lipa, bis zu einer Stadt
die Brzezany hieß. 2 Tage später wurden wir auch eingesetzt, bei großer Hitze ging es in Dauermärschen vorwärts, man
durfte aus den Flüssen kein Wasser trinken, weil es mit Petroleum verseucht war. Nur wenn es dunkel wurde machten wir
halt, dann mussten wir Gräben ausheben um vor Überraschungen sicher zu sein.
Links von uns war Tarnopol und rechts Rumänien. Wenn es nach einer Ruhepause wieder losging dann war es am schlimmsten,
man ging wie auf Nägel, weil die Füße die Strapazen nicht so ohne weiteres wegsteckten. Im Dorf wurde niemals Rast
gemacht, denn da waren immer Brunnen, zu denen alle hinstürmten. Später wurden Melder vorausgeschickt, die von den
Dorfbewohnern Wasser in Eimern am Weg raussetzen ließen, damit die Soldaten Ihren Durst löschen konnten. Ein Soldat hat
gleich den ganzen Eimer mitgenommen und ihn dann als er leer war, irgendwo am Wegrand stehen lassen. Der Kompanieführer
kam angeritten, hat ihn ausgeschimpft und gedroht, ihn mit 3 Tagen Arrest zu bestrafen. Wir gehörten zur Südarmee
welche von Graf Bothmer befehligt wurde.
Die Stellungen waren schlecht ausgebaut, abends mussten wir, von der 2 Kilometer hinter der Front liegenden Feldküche,
Essen und andren Proviant holen. Ich war der Jüngste der Gruppe, musste immer 9 Kochgeschirre tragen, Brot und Post
habe ich in 2 Sandsäcke, die ich über der Schulter hängen hatte, verstaut. Wenn wir unterwegs waren wurde der
Laufgraben immer beschossen. Einmal schlug eine Granate am Schützengrabenrand ein und hat mich halb verschütte, die
Kochgeschirre aus den Händen gerissen, so dass ich ohne Verpflegung im vorderen Graben ankam. Nach drei Wochen sollten
wir abgelöst werden Es hat jeden Tag geregnet, wir haben unsere Mäntel angezogen und uns mit Zelten bedeckt. Nach dem
wir abgelöst wurden kamen wir in ein Dorf dass von Juden bewohnt war. Die Bewohner waren froh dass wir keine Kosaken
waren, mit denen hatten sie vor ein par Tagen schon schlechte Erfahrung gemacht, die hatten ihnen beim Abzug Vieh und
Pferde weggenommen.
Der Boden war sehr fruchtbar, es wurden Hanf, Weizen, Hafer, Mais, Bohnen, Roggen und Kartoffeln angebaut. Die
Bewohner waren gerade mit der Ernte beschäftigt. Die Häuser waren nur aus Holz und Stroh erbaut. Die Leute lebten in
sehr ärmlichen Verhältnissen. Ich hatte mir in unserer Kantine für 20 Pfennig ein Taschenmesser gekauft, das hat mir
ein Bauer für 6 Eier und 2 Pfund Brot abgekauft, daraus hat er sich dann ein Rasiermesser geschliffen. Wenn unser
Versorgungstross auf denn holperigen Wegen nicht nachkam, haben im Dorf auch Verpflegung eingekauft. Die Leute hatten
Angst dass wir nicht bezahlen werden, doch wir bekamen meistens pünktlich unseren Wehrsold ausgezahlt und konnten uns
so manches genehmigen. Um unser Marschgepäck zu erleichtern haben wir so manches aus dem Tornister weg geworfen.
Unweit eines Dorfes wurde halt gemacht, wir sollten Zelte aufschlagen, doch niemand hatte mehr Zeltstöcke im Tornister,
alles war unterwegs liegen geblieben. Der Zugführer befahl uns ins Dorf zugehen und Stöcke zu besorgen. In einer
Scheune stießen wir auf eine Hühnerschar, mit den Stöcken haben wir einige Hühner erlegt, in einem Hanffeld gerupft
und dann im Eiltempo zurück zu unserer Truppe. Als wir ankamen war die Kompanie schon marschbereit, es gleich weiter,
mit dem Huhn im Tornister. Bei der nächsten Rast haben wir die Hühner ausgenommen und Holz besorgt um sie zu kochen,
doch wir mussten schnell wieder weiter marschieren und erst nach 2 Tagen konnten wir uns mit den Hühnern befassen,
leider waren die so alt das sie nicht gar wurden. Das Fleisch mussten wir wegwerfen, nur die Suppe konnten wir noch
gebrauchen.
Meine Verwundung am Pruth.
Wir befanden uns 8 km vor der russischen Grenze. Der Kompanieführer hatte uns informiert das
wir hier zum Einsatz kommen. Wir bekamen noch ein Mittagessen aus der Gulaschkanone, konnten unsere Feldflaschen mit
Tee, der mit Rum angereichert war, auffüllen, Munition und Handgranaten in Empfang nehmen und dann ging es zum Einsatz.
Um 3 Uhr begann das ganze Bataillon auszuschwärmen, sofort hat uns der Russen entdeckt und begann uns mit Artillerie
zu beschießen, je weiter wir vorrückten desto heftiger.
Bis zu einem Eisenbahndamm hatten wir gute Deckung, doch wir sollten den dahinter fließenden Fluss überqueren. Doch
plötzlich explodierte über meinem Kopf eine Schrapnellkugel, der Stahlhelm wurde mir vom Kopf gerissen, Tornister und
Koppel flogen auch weg, ich lag auf der Erde und wusste gar nicht was passiert war. Plötzlich fing Blut aus der
Kreuzbeingegend zu rieseln, aus dem rechten Oberschenkel auch. Gleich nebenan war ein Granattrichter, dort habe ich
Schutz gesucht. In der rechten Rockecke hatte man immer ein großes Verbandspäckchen, das habe ich herausgenommen und
auf die Wunde gedrückt, doch das Blut floss mir bis in den Stiefel. Links und rechts von mir schlugen Granaten ein,
dicke Erdbrocken und Schlamm fielen auf mich herab, doch in meinem Erdloch war ich vor Maschinengewehrsalven geschützt.
Der ganze Rücken war angeschwollen und ich konnte mich überhaupt nicht bewegen.
Die Deutschen mussten die Stellung den Russen überlassen, einer hatte mich entdeckt, da ich aber so blutverschmiert da
lag, hat er bestimmt gemeint ich wäre nicht mehr am leben und ist weitergegangen. Nach zwei Stunden habe ich gehört
das die Russen sich wieder zurückzogen, danach herrschte eine gespenstische Stille. Als es dunkel wurde kamen deutsche
Sanitäter mit Spürhunden und haben die Verwundeten aufgesammelt. Ich wurde auf eine Trage gelegt, lag gebeugt und
konnte mich nicht rühren weil der blutverschmierte Rücken völlig verkrustet war. Ein Pferdegespann konnte nur vier
Tragen befördern, die Fahrt über Ackerfurchen war eine Tortur, ich habe nicht geglaubt das ich es überleben werde. In
einer Dorfkirche wurden wir dann ausgeladen und zu den etwa 50 Verwundeten gelegt die da schon lagen.
Mich haben sie zu den Bauchschüssen gelegt, weil ich einen Nervenschock hatte und am ganzen Körper gezittert habe. Zu
trinken bekam ich nichts, nur einen feuchten Lappen in den Mund. Ich sollte gleich operiert werden, aber es kamen
immer mehr Verwundete, so bekam ich nur eine Tetanusspritze, wurde verbunden und für den Weitertransport ins Hinterland
vorbereitet. Im Morgengrauen wurden wir auf Lastautos verladen, die aus auf ein Landgut brachten, wo wir in einem
Pferdestall untergebracht wurden. Die Fahrer fuhren so schnell über die Granatlöcher, das wir vor Schmerzen geschrieen
haben. Wir baten sie langsamer zu fahren, aber die bekamen es in ihrem Führerhaus nicht mit, erst alt ein Verwundeter,
der einen Krückstock bei sich hatte von hinten die Scheibe einschlug wurde die Fahrt erträglich. Lastautos, die
Munition und Verpflegung an die Front transportiert hatten, brachten in den nächsten Tagen immer wieder Verwundete
ins Hinterland. Die Deutschen hatten an diesem Fronabschnitt hohe Verluste zu beklagen. Wir können von Glück reden
dass wir dem Höllenfeuer überhaupt entkommen sind.
Wir wurden mit Lastautos, die ein Feldlazarett uns geschickt hatte, bis nach Lemberg befördert. da wurden wir gewaschen,
rasiert und frisch verbunden. Auf einem Nebengleis stand ein Lazarettzug, in dem wurden wir anschließend in frisch
bezogenen Betten untergebracht. Der Zug brachte uns über Annaberg nach Freiburg in Sachsen, eine Stunde hinter Dresden.
Hier wurden wir auf Tragen gebettet und mit einem Möbelwagen in ein Reservelazarett transportiert.
Im Heimatlazarett.
Als ich am nächsten Tag aufwachte und das schöne Bett sah in dem ich lag, dachte ich dass ich
im Himmel bin. Ich dankte meinem Herrgott das er mich bis zu diesem Ort begleitet hat. Am Nachmittag kamen Schulkinder
mit Geschenken und haben uns schöne Lieder vorgesungen. Anhand von Röntgenaufnahmen wurde in den nächsten Tagen
festgestellt dass bei mir ein Schrapnellsplitter an der Wirbelsäule in die Kreuzbeingegend eingedrungen war. Ich wurde
jeden Tag in Salzwasser gebadet und bekam wieder volle Verpflegung, da mein Magen zum Glück nicht verletzt war. Auf
dem Transport bekam ich nur Suppe und bei Bedarf einen feuchten Lappen auf die Lippen. Ich bin von 62 auf 43 Kilogramm
abgemagert, gehen konnte ich wegen dem Nervenschock den ich bei der Verwundung erlitten hatte auch noch nicht. Die
Wunde am rechten Oberschenkel war nur ein Streifschuss und wurde mit einem Schutzverband versorgt.
In den nächsten Tagen habe ich einen Brief nach Hause geschrieben und mitgeteilt wo ich mich zurzeit befinde. Meine
Eltern schickten mir ein Paket mit Lebensmitteln, jetzt konnte ich essen was ich wollte. Das Essen im Lazarett war
nicht besonders, jeden Tag nur Kohlblätter. Der weg zu den Toiletten führte durch einen Gemüsegarten. Die gehfähigen
Kameraden haben den ganzen Kohlrabi aufgegessen, so dass schließlich Wachposten aufgestellt werden mussten. Sechs
Wochen lang konnte ich mich nur auf allen Vieren fortbewegen, denn sobald ich mich aufrichtete wurde es mir
schwindelig und ich musste zurück ins Bett.
Als ich wieder bei Kräften war habe ich meinen Eltern mitgeteilt das ich mich in ein Lazarett in ihrer Nähe verlegen
lassen will. Der Chefarzt hatte mir zugesichert, wenn die Möglichkeit besteht in Ortelsburg unterzukommen, wird er dem
zustimmen. Meine Mutter hat daraufhin, in Ortelsburg, beim Lazarettinspektor Zantopf nachgefragt und er hat angedeutet
das sie mich aufnehmen können. Daraufhin bekam ich die Krankenpapiere und einen Fahrschein nach Ortelsburg. Da ich als
Soldat nie Heimaturlaub hatte, beschloss ich zuerst meine Eltern zu besuchen. Ich fühlte mich noch sehr schwach, habe
nach jedem Kilometer Rast gemacht, aber letztendlich war ich wieder daheim bei meinen Eltern. Die Wiedersehensfreude
war sehr groß. Ich bin am 30 Juli verwundet worden und am gleichen Tag wurde mein ältester Bruder beerdigt. Er bekam
den Splitter einer Gasgranate ins rechte Bein und ist an einer Blutvergiftung verstorben.
Am nächsten Tag brachte mich mein Vater ins Garnisonslazarett nach Ortelsburg. Ich wurde jeden Tag gebadet und massiert,
weil die Rückenhaut am Knochen angewachsen war konnte ich mich nicht schmerzfrei bücken. In Ortelsburg verbrachte ich
noch sechs Wochen, bis Ende Oktober, da wurde es schon ziemlich kalt und in unserer Barackenunterkunft ziemlich
ungemütlich. Kohlen und anderes Brennmaterial lagen im Hof auf Halde, aber es war verboten zu heizen. Kameraden die in
der Nähe zu Hause waren konnten Sonntagsurlaub beantragen.
Einer von ihnen brachte von zuhause Brennholz mit und entzündete damit im Ofen ein wärmendes Feuer, andere holten vom
Hof Kohlen, so dass der Ofen in kurzer Zeit glühend heiß wurde und die Gefahr bestand das die Betten Feuer fangen
würden. Wir hatten die Betten schon weg gerückt, da kam der Feldwebel herein und fragte wer das Feuer im Ofen
angezündet hat, doch niemand fühlte sich angesprochen. Der Feldwebel hatte den Vorfall dem Stabsarzt gemeldet, als der
am nächsten Morgen zur Visite kam, war seine erste Frage: ”Wer hat gestern Abend das Feuer im Ofen angezündet”. Als
sich niemand meldete, schrie er uns an: ”Morgen wird alles entlassen, zum Ersatzbatallion, in Diez an der Lahn! Wer
gehen kann, sofort zur Schreibstube, Krankenpapiere und Fahrscheine abholen”. Er erinnerte uns noch daran am nächsten
Tag pünktlich am Bahnhof zu sein, weil eine Verspätung unangenehme Folgen für uns haben würde. Das war das Ende der
schönen Erholungsphase. Ich blieb noch eine Nacht zu Hause und bin dann am nächsten Tag von dort zum Bahnhof gegangen.
Wieder Kriegsverwendungsfähig.
Als wir am nächsten Tag in Diez angekommen waren, wurde ich gefragt ob ich aus dem Heimaturlaub
käme, als ich das verneinte wurden mir 2 Tage genehmigt und 14 Tage Genesungsurlaub dazu. Wieder zurück im
Ersatzbatallion bestand unsere Tätigkeit aus Wache schieben und Kartoffel schälen. Nach einem Monat wurden wir von
einem Generalarzt untersucht, er hat mich für nicht einsatzfähig befunden weil ich noch den Steckschuss im Rücken
hatte und das linke Bein 10 Zentimeter dünner war. Jetzt fing das Kasernenleben wieder von vorne an. Wachdienst,
Gewehr laden, sichern, Ehrenbezeugung, Einzelmarsch und Appell. Wer nicht weit nach Hause hatte bekam zu Weihnachten
Urlaub. Ich hatte zu Heiligabend und Silvester Torwache, denn nach Ostpreußen wurde niemand beurlaubt.
Nach Neujahr 1918 wurden wir neu eingekleidet und kamen nach Köln zur Baukompanie. Mit Musik wurden wir zum Bahnhof
gebracht. In Köln wurden wir noch mit Soldaten die von andern Truppenteilen dorthin verlegt wurden in einem großen
Kinosaal, im Stadtteil Edengarten untergebracht. Wir brauchten keinen Dienst zu machen und konnten zu Heilige Drei
Könige den Gottesdienst im Dom besuchen. Kameraden die aus irgendwelchen Gründen im Arrest saßen wurden gefragt ob sie
auch am Gottesdienst teilnehmen möchten, dann würde ihnen die Strafe erlassen. Fast alle haben dem zugestimmt. Einige
Tage später wurden wir wieder auf einen Transportzug verladen, der uns über Herbestal, Antwerpen nach Brügge in Belgien
brachte. Hier mussten wir den Zug kurzfristig verlassen und einen Luftschutzkeller aufsuchen, weil Fliegeralarm
gemeldet wurde. Danach ging es wieder weiter nach Turut, Kortemark, Hauseme, Kautremollen, Zaren, Zarenlinde. Dort
wurden wir in verschiedene Gruppen aufgeteilt und einer Pionierkompanie auf dem Pionierpark Struwendorf zugewiesen.
Wir haben hinter Klerken Bunker für schwere Maschinengewehre gebaut. Unsere Arbeit konnten wir nur bei Nebel verrichten,
denn bei Sonnenschein waren wir sofort dem Beschuss der feindlichen Artillerie ausgesetzt. eine Kleinbahn die Munition
und Stacheldraht an die Front brachte war dem Beschuss besonders ausgesetzt. Die Gleise, von schweren Geschossen
zerfetzt, mussten immer wieder hergerichtet werden, damit der Nachschub aufrechterhalten werden konnte. Später haben
wir am Kemelberg bei Armentier, eine Brücke über die Lys gebaut. Um in dem Sumpfgelände einen Untergrund dafür zu
schaffen, mussten wir 10 bis 12 Meter lange Pfähle in den Boden rammen. Ein Feldwebel gab immer den Befehl: „Hoch den
Bär, noch viel mehr, dass man sieht, wie er zieht, denn dieser Pfahl, glatt wie ein Aal, durch Fels und Stein, durch
Wasser und Sand, fürs Vaterland”. Jedes mal mussten wir den Bär an Schnüren hochziehen und dann wieder herunterlassen.
Wenn es manchmal, trotz vieler Mühe nicht mehr weiter ging wurde der Pfahl auf eine bestimmte Länge abgeschnitten.
Nach Fertigstellung der Brücke kamen wir in die Siegfriedstellung bei Kambrei, zum Bau eines Bataillons-Gefechtstandes.
Da der Boden kreidehaltig war, mussten wir die großen Stücke von Hand zu Hand reichen, den Schutt haben wir dann mit
Sandsäcken aus der Baugrube gehoben und mit Ästen getarnt, damit der Stand nicht von feindlichen Fliegern entdeckt
werden konnte. Alle acht Stunden wechselte die Arbeitsgruppe. Wir mussten von der Baustelle durch das Gelände robben,
denn aufrecht gehend war man dem Beschuss der feindlichen Scharfschützen ausgesetzt, die von einem Fesselballon aus
informiert wurden der über den feindlichen Linien stand.
Der Wechsel war mit einem großen Risiko verbunden, und wurde wenn Möglich bei Dunkelheit vollzogen. Um vor
Überraschungen sicher zu sein haben wir spanische Reiter (Stacheldrahtverhaue) gebaut und vor die ersten Gräben
gestellt, die dann oft in der Nacht von den Franzosen geklaut, und dann vor ihren eigenen Linien wieder aufbaut wurden.
Wir hatten aus Bohlen eine Brücke auf Rädern gebaut, die dann in den Graben geschoben wurde, damit die Artillerie und
andere Fahrzeuge über die Schützengräben kamen. Weil um vier Uhr morgens der Beschuss mit Gasgranaten begann, mussten
wir Gasmasken aufsetzen, danach haben feindliche Flieger unsere Munitionskolonne bombardiert und total aufgerieben.
Es wurde auch eine Marinedivision eingesetzt, die bis dahin dem Küstenschutz gedient hatte und jetzt ihren ersten
Einsatz hatte.
Wir sind zuerst ein ganzes Stück in Richtung Amiens vorangekommen, doch dann blieb unser Angriff in den zuvor von
Engländern besetzten Stellungen, stecken. Da die Engländer ihre Stellungen fluchtartig verlassen hatten, fiel ihr
ganzer Proviant in unsere Hände; Schokolade, Weißbrot, Flaschenwein. Die erste Nacht haben wir in einem runden Zelt
verbracht, weil ich mir durch den starken Wind, der da herrschte eine Angina zugezogen hatte, die mit hohem Fieber
verbunden war, konnte ich die vielen Köstlichkeiten überhaupt nicht genießen.
An eine ärztliche Versorgung war überhaupt nicht zu denken, denn es mussten zuerst die vielen Granatlöcher eingeebnet
werden damit die vielen Fahrzeuge und Geschütze wieder weiter fahren konnten. Auch eine Bahnlinie musste repariert
werden, damit die großen Geschütze in Stellung gebracht werden konnten, dabei wurden auch die vielen Kriegsgefangenen,
die bei dieser Offensive gemacht wurden, eingesetzt. Als die Offensive dann schließlich scheiterte, wurden wir an die
Somme verlegt. Da habe ich die Ortelsburger Jäger, die aus Italien an die Westfront verlegt wurden, zum ersten Mal im
Einsatz gesehen.
Unser nächster Einsatzort waren dann Stellungen hinter Laon. Hier wurden die Vorbereitungen zu einer neuen Offensive
getroffen. Feindliche Flieger versuchten uns Tag und Nacht daran zu hindern die Aufmarschwege instand zu halten. Als
die Offensive dann endlich losging, hatten wir die Order eine Brücke über die Oise mit Bohlen und Balken zu verstärken.
Gleich am Anfang der Offensive mussten wir Gasmasken anlegen, um für alle Fälle gewappnet zu sein. Nur die Artillerie
und Kraftfahrzeuge durften die Landstraße benutzen, die Infanterie ging immer im Straßengraben und wurde von einer
Seite von Kopf bis Fuß mit Dreck bespritzt. Die Franzosen und Engländer haben hier schon Panzer eingesetzt, die von
Truppen aus den Kolonien gefahren wurden. Die Australier gingen mit umgekrempelten Ärmeln hinter den Panzern her.
Die letzte Offensive des Ersten Weltkrieges.
Zum Jahresende 1917 hatten noch 153 deutsche 175 alliierten Divisionen gegenübergestanden.
Zur Vorbereitung der Offensive ließ Ludendorff 39 Divisionen aus dem Osten und aus Italien heranziehen. Er ließ
spezielle Angriffsdivisionen formieren, die durch intensive Ausbildung auf den beabsichtigten, schnellen Vormarsch
vorbereitet wurden. 6608 Geschütze, 3500 Minenwerfer und 1070 Flugzeuge wurden hinter dem vorgesehenen
Angriffsabschnitt konzentriert. Den Ausbildungsbefehlen Ludendorffs, die bis zu den Kompanieführern herab verteilt
wurden, konnte man entnehmen, dass der Versuch, den Krieg mit einem mächtigen Schlag zu entscheiden schon in der
nächsten Zeit gewagt werden sollte. Wir übten die fast vergessenen Formen des Schützengefechts und des
Bewegungskrieges, auch wurde eifrig mit Gewehr und Maschinengewehr geschossen. Wir hegten keinen Zweifel daran, dass
der große Plan gelingen würde.
Den ganzen Winter 1917/18 über plante der Generalquartiermeister Ludendorff die deutsche Offensive. Zwar hatten die
Vereinigten Staaten von Amerika dem Deutschen Reich am 6. April 1917 den Krieg erklärt, aber vor dem Sommer des
Jahres 1918 war mit dem Auftreten von US-Truppen in relevanter Größenordnung nicht zu rechnen. Der deutschen Führung
blieb nur ein schmales Zeitfenster, um die Niederlage und den zu erwartenden Diktatfrieden abzuwenden. Ypern,
Armentieres, Arras, Cambrai oder Verdun wurden ernsthaft als Schauplätze erwogen. Ludendorf entschied sich für einen
Angriff zwischen Cambrai und La Fere – genau an der Nahtstelle zwischen der Französischen Armee und dem britischen
Expeditionscorps.
Der Fluss Somme bildete die Grenze zwischen Franzosen und Briten. Die Briten – nicht die Franzosen – sollten das Ziel
des Vorstoßes werden. Ihre Stellungen waren nur 130 Kilometer von der Kanalküste entfernt. Beim erreichen der
Sommemündung wäre die gesamte britische Armee eingeschlossen gewesen, denn hinter ihnen lag die Straße von Dover.
Am 21. März 1918 begann die letzte entscheidende Offensive des deutschen Westheeres im Ersten Weltkrieg. Der
Angriffsstreifen war 75 Kilometer breit. Dort hatte Ludendorff 43 Angriffsdivisionen konzentriert, dahinter 30
weitere Reservedivisionen, ihnen standen lediglich 26 britische Divisionen gegenüber. „Michael“ – so der Deckname der
„Kaiserschlacht“ – lief dank Ludendorffs akribischer Vorbereitung gut an. Der britische Oberbefehlshaber General
Douglas Haig erkannte die Chance, welche die Deutschen in dieser Situation hatten. Wollten die Deutschen diese Chance
nutzen, mussten sie darauf verzichten die Somme zu überschreiten, wo sie auf die französischen Reserven treffen und
sich von der Küste entfernen würden. Genau diesen Fehler begingen jedoch die Deutschen.
Am dritten Tag überschritt der linke Flügel mit der 18. Armee die Somme. Ludendorf stellte die Taktik über die
Strategie, wie er das bei Tannenberg und der Schlacht an den Masurischen Seen auch schon getan hatte. Ludendorffs
Befehl an die 18. Armee vom Abend des 22. März 1918 lautete: „Jetzt gilt es den Sieg auszunutzen, den Feind nicht zum
Stehen kommen zu lassen, Somme und Crozat-Kanal zu überschreiten, bevor feindliche Verstärkungen wirksam werden“.
Was Haig befürchtet hatte, trat nicht ein. Die deutsche Offensive Lief weiter Richtung Süden und lief sich schließlich
tot. Am 31 März war Ludendorff zu der Erkenntnis gekommen, dass „Michael“ gescheitert war. Am 5. April wurde die
Einstellung der Offensive befohlen. Im Hochsommer waren die US-Truppen in Frankreich angekommen und gingen mit den
Franzosen zum Angriff vor. Nur mühsam konnten Hindenburg und Ludendorf den Zusammenhalt der Front waren. Am 24. Oktober
1918 forderte US-Präsident Woodrow Wilson die bedingungslose Kapitulation, am 11.Nuvember Wurde der Waffenstillstand
von Compiegne unterzeichnet.
Zusammenbruch der Westfront und Waffenstillstand .
Als die Offensive dann letztendlich gescheitert war, wurden wir auf Eisenbahnwaggon verladen, in
eine Stellung vor Verdun gebracht und der siebenten bayerischen Division zugeteilt. Als wir ausgeladen wurden nahm der
Franzose den Bahnhof unter Beschuss. Eine Granate traf einen Waggon der mit Seifenpulver beladen war, so dass der ganze
Bahnhof aussah als wäre gerade Neuschnee gefallen. Wir gingen auf die Suche nach Kartoffeln. Als ich mit einem Sack,
vollbeladen die Böschung runter ging um zur Feldküche zu gelangen, schlug unweit von mir eine Granate ein und riss mir
den Sack vom Rücken. Ich bin mit dem Schrecken davon gekommen, mir war nichts passiert.
Der Bahnhof war menschenleer, nur ein par Kaninchen liefen verschreckt durch die Gegend und einigen Kameraden gelang
es welche einzufangen. Am nächsten Tag gelang es uns endlich die Feldküche zu erreichen. Als wir gerade beim Essen
fassen waren, schlug unweit eine Granate ein so dass Pflastersteine das Dach durchschlugen und wir das Weite suchen
mussten. und wir wieder nichts zu Essen bekamen. Ein Friseur aus unserer Kompanie fuhr immer ins Hinterland um uns
mit Proviant zu versorgen. Als er 14 Tage vor dem Zusammenbruch wieder mal zurückkam erzählte er uns schon das der
Krieg nicht mehr lange dauern würde, weil Kaiser Wilhelm mit Frack und Zylinder bekleidet, Deutschland verlassen und
ins Ausland gehen würde. In unserer Einheit hatten wir auch einen Juden der glaubte dass er sich alles erlauben darf.
Eines Morgens ging er in die Küche, als er keinen Koch vorfand stieg er auf die Gulaschkanone und hob den Deckel vom
Kessel in dem der Kaffee kochte an. Der kochende Kaffee verbrühte seine Füße so sehr das er sofort ins Lazarett musste,
für ihn war der Krieg somit zuende. Es kam noch ein Erlass, das Kameraden die 2 Jahre aktiv gedient hatten und
Gefreiter waren sofort zum Sergeanten befördert wurden. Für den 11. November 1918 war ein Waffenstillstand vereinbart
und ab 11 Uhr sollte nicht mehr geschossen werden. Wir hatten unsere Kopfkissen aufgetrennt und eine Kissenschlacht
veranstaltet, um auf diese Art und Weise unserer Freude Ausdruck zu verleihen. Als die Federn durch die Luft flogen
brachen wir in Tränen aus.
In jeder Kompanie wurde ein Soldatenrat gewählt, der aus drei Mann bestand. Wenn der Kompanieführer jemanden bestrafen
wollte, musste er erst den Soldatenrat fragen, der die Strafe befürworten, aber auch ablehnen konnte. Die Offiziere
durften keine Achselstücke mehr tragen, was für sie einer Degradierung gleich kam. Wir waren in einem Dorf
einquartiert und morgens zum Appell angetreten, als einer vom Soldatenrat sich stockbesoffen vor den auf dem Pferd
sitzenden Kompanieführer stellte und schrie: „Alles hört auf mein Kommando”. Der Kompaniechef war wie vom Blitz
getroffen, ihm versagte die Stimme. Wir sahen ein das dies nicht so weiter gehen kann und wählten einen neuen
Soldatenrat. Unser Rückzug begann bei Konflanz, einer Vorfestung von Metz und führte uns zunächst über die
luxemburgische Grenze, wo wir in einem Ort einquartiert wurden. Als wir für die Küche Holz aus dem Wald holen gingen,
entschieden wir uns eine Eiche abzusägen, ohne uns dessen bewusst zu sein, in welchem Forst wir uns befanden. Als wir
beim fällen waren fielen plötzlich Schüsse, die wir auch sofort erwiderten, bis uns ein Elsässer der sich in unserer
Kompanie befand aufklärte: „Kameraden, wir befinden uns hier auf Luxemburgischem Hoheitsgebiet”.
Wir sind dann weiter durch das Fürstentum Birkenfeld marschiert, wo das Städtchen Merzig für uns geflaggt hatte. Das
Elsass haben wir auch noch kurz gestreift. Wo wir bei einem Bauern, der uns kein Stroh für das Nachtlager geben wollte,
einquartiert wurden. Daraufhin gingen wir in die Scheune und haben uns selbst was besorgt. Wir haben dann noch erfahren,
sie hätten ein Schwein geschlachtet und warteten auf den Einzug der Franzosen. Als wir uns 1917, an der Ostfront, in
den in Karpaten, im Einsatz befanden, waren unter uns auch viele Elsässer. Sie durften ihre Heimatpost nicht in
französischer Sprache schreiben, mussten ihre Briefe offen auf der Schreibstube abgeben, wo sie zuerst kontrolliert
und dann abgeschickt wurden. Als ich in einer Nacht, mit einem Elsässer auf einem Vorposten Wache schieben musste,
wollte er mich überreden zum Russen überzulaufen. Als ich darauf nicht eingehen wollte verschwand er plötzlich in der
Dunkelheit und ich habe ihn nie wieder gesehen.
Wir sind dann weiter Richtung Worms und Ludwighafen gezogen, dort wurden wir bei einem Mühlenbesitzer einquartiert,
ein Unteroffizier und vier Mann. Obwohl wir verlaust und verdreckt waren bestand die Müllerin darauf das wir in ihren
Betten übernachteten. „Wenn alles durch ist”, sagte sie, „werde ich alles gründlich reinigen”. Der Müller brachte uns
eine Gießkanne voll Wein und sagte wir sollen es uns Schmecken lassen. Wir haben reichlich davon Gebrauch gemacht, so
dass ich gar nicht weiß wie ich ins Bett kam. Das war meine Erinnerung an die Pfalz. Manchmal waren wir auch 2 Tage im
Quartier.
Vor dem Weitemarsch wurde uns immer gesagt welche Truppe die Vorhut und welche Truppe die Nachhut übernehmen sollte.
Die Nachhut hielt immer Verbindung zu den nachrückenden Franzosen und man muss staunen wie alles reibungslos, ohne
Zwischenfälle von statten ging, was wir in erster Linie dem General-Feldmarschall Paul von Hindenburg zu verdanken
haben, der den Rückzug an der Westfront koordiniert hat.
In Köln angekommen, erhielten wir im Volkshaus unsere Entlassungspapiere, Eisenbahnfahrscheine, Reisepässe,
unterschrieben von Oberstleutnant Mann. Wir mussten Köln umgehend verlassen, weil schon am nächsten Tag die
französischen Besatzungstruppen in einmarschieren sollten. Wir fuhren mit einem Zug der bis Allenstein fuhr, dort
wurden unsere Papiere vom Soldatenrat kontrolliert. Die jüngren Jahrgänge wurden festgehalten, zu neuen Einheiten
zusammengestellt und zur Sicherung der Ostgrenze gegen die Bolschewisten abkommandiert. Ich hatte gesagt das ich noch
einen Schrapnellsplitter in der Kreuzbeingegend habe und durfte daraufhin nach Hause fahren.
Kaum in Ortelsburg angekommen fiel ich wieder dem Soldatenrat in die Hände. Sie haben alles durchsucht, haben mir mein
Seitengewehr und eine Decke abgenommen, aber ich durfte weiter und bin dann kurz vor Weihnachten 1918 auf dem
elterlichen Hof angekommen. Schon auf dem Hof habe ich meine Kleider vom Leib gerissen, weil vor Läusen und anderem
Ungeziefer nicht mehr aushalten konnte und mich erst gründlich gewaschen bevor ich das elterliche Haus betreten habe.
Die Freude über das Wiedersehen war sehr groß.
“ Unser Leben zwischen den beiden Weltkriegen.”
Endlich wieder zurück in der Heimat
Rohmanen war durch die Kampfhandlungen 1914/15 zu einem drittel zerstört worden, aber schon
wieder im Aufbau. Die Firma Grzella aus Ortelsburg hatte die Bauarbeiten übernommen. Unter der Aufsicht von Polier
Karl Kontor wurden die Dachstühle errichtet. Ich habe mich, nach kurzer Erholungspause, auch als Zimmermanngehilfe am
Wiederaufbau beteiligt. Die Firma Grzella hat das Material geliefert und auch unsere Löhne gezahlt. Wegen meinem
Steckschuss bin ich dem VDK beigetreten und habe mit dessen Hilfe eine Rente beantragt die mir auch bewilligt wurde.
Nach vier Jahren wurde ich nach Allenstein zur Nachuntersuchung vorgeladen. Die ärztliche Untersuchung hatte ergeben,
das Geschoß sei verkapselt, und nur das linke Bein etwas in Mitleidenschaft gezogen. Daraufhin wurde die Rentenzahlung
eingestellt.
Der Stellmacher Adam Ornowski war im Krieg als Sanitäter eingesetzt und hatte auf Grund seiner Erfahrungen,
 Beziehungen zum medizinischen Dienst in Ortelsburg aufgebaut. Es wurden dort Lehrgänge in Erster Hilfe angeboten,
die von Prof. Dr. Kutz geleitet wurden. Adam Ornowski hat dafür gesorgt das einige junge Männer aus Rohmanen daran
teilnehmen konnten. Adam Ornowski, August Linka, Emil Rosowski, Johann Dembek, Emil Baschek und ich sind dann dem
Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes beigetreten und mussten jeden Sonntag am Lehrgang teilnehmen. Unser
Gruppenführer war Kreisobersekretär Albrecht, Landrat von Poser, als unser Ehrenvorsitzender, hat viel zu unserer
finanziellen Unterstützung beigetragen und hat dafür gesorgt dass die Bereitschaft eingekleidet wurde.
Beziehungen zum medizinischen Dienst in Ortelsburg aufgebaut. Es wurden dort Lehrgänge in Erster Hilfe angeboten,
die von Prof. Dr. Kutz geleitet wurden. Adam Ornowski hat dafür gesorgt das einige junge Männer aus Rohmanen daran
teilnehmen konnten. Adam Ornowski, August Linka, Emil Rosowski, Johann Dembek, Emil Baschek und ich sind dann dem
Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes beigetreten und mussten jeden Sonntag am Lehrgang teilnehmen. Unser
Gruppenführer war Kreisobersekretär Albrecht, Landrat von Poser, als unser Ehrenvorsitzender, hat viel zu unserer
finanziellen Unterstützung beigetragen und hat dafür gesorgt dass die Bereitschaft eingekleidet wurde.
In jedem Dorf wurde eine Unfallstelle eingerichtet, mit einem Verbandskasten und mit Verbandsmaterial für die erste
Hilfe ausgerüstet. Die Unfallstelle in Rohmanen, die am Haus von der Straßenseite, durch eine Tafel mit einem roten
Kreuz gekennzeichnet war, hatte ich zu verantworten. An Sonntagen wurden wir an Badestellen und bei Fußballspielen
eingesetzt, haben viele Übungen bei Waldbränden durchgeführt und auch Ausflüge nach Rudzany am Niedersee gemacht. Bei
der Einweihung des Tannenbergdenkmals in der Nähe von Hohenstein kamen wir an Straßenkreuzungen zum Einsatz.
Rohmanen hatte auch eine freiwillige Feuerwehr. Bis zum ersten Weltkrieg hat Friedrich Biella als Brandmeister das
Kommando gehabt. Er war aktiver Unteroffizier, hatte gute Führungsqualitäten und die Männer, die allesamt aus dem
aktiven Militärdienst stammten hatten zu ihm ein großes Vertrauen. Nach dem Krieg wollten diese Männer,
(Friedrich Nickel, Friedrich Willam, Julius Wittkowski, Jakob Janowski, Johann Gloddek, Gustav Bednarz), nicht mehr
weitermachen. Friedrich Biella, der inzwischen zum Gemeindevorsteher gewählt wurde, hat sich dann auf einer
Gemeinderatsitzung vorgeschlagen, für die Freiwillige Feuerwehr jüngere Kräfte anzuwerben.
Zum Brandmeister hat er Herrn Wilhelm Pilath vorgeschlagen. Der wurde dann nach Königsberg zur Fortbildung geschickt.
Der Feuerwehr gehörten nun folgende Personen an: Wilhelm Pilath(Brandmeister), August Linka(Stellvertreter), Gustav
Deptolla, Julius Matzey, Johann Dembek, Willy Willam, Gustav Rattay. Der Kreisbrandmeister war Heinrich Thalmann aus
Ortelsburg, sein Stellvertreter war Kreisobersekretär Salzmann. Der Bezirks-Kommissar bei der Ostpreußischen
Feuersozität War Herr Ernst Trzaska. Er hat dafür gesorgt das die Wehr uniformiert und mit Löschgeräten ausgerüstet
wurde. Da die alten Schläuche schon sehr marode waren, wurden sie durch moderne ersetzt, deren Kupplungen auch mit der
Motorspritze übereinstimmten.
Ernst Trzaska hat bei der Feuersozität und beim Landratsamt Finanzmittel beantragt und auch genehmigt bekommen. Der
Schneidermeister Wilhelm Baran wurde beauftragt Tuch und Drillichanzüge nach Maas zu schneidern. Er hat uns
Stoffmuster vorgelegt aus denen wir wählen sollten. Feuerwehrhelme haben wir auch bekommen. Die Gemeinde musste
Finanzmittel bereitstellen, einen Prozentsatz vom Gemeindebudget. Im Brandfall mussten für den Spritzenwagen Pferde
zur Verfügung stehen, von Willy Willam, Gustav Rattay, Julius Matzey und Gustav Dorka, weil sie in der Nähe des
Spritzenhauses wohnten. Am Spritzenhaus wurde ein großer Baum mit Querleisten aufgestellt, wo nach jedem Brand oder
einer größeren Übung die Schläuche zum trocknen aufgehängt wurden.
Der Kreisbrandmeister hat mindestens 2-3-mal im Jahr die Wehren besichtigt. Das ganze Dorf war dann auf den Beinen,
die Bauern mit Pferden, und andere Dorfbewohner mit Eimern und Spaten, wurden dann in verschiedene Gruppen eingeteilt.
Erst hat die Wehr sämtliche Aufstellungen am Gerät geübt; Grundstellung Fahrstellung und Marschstellung. Dann wurde
ein Brand angekündigt, die Feuerwehr mit der Spritze an den Brunnen, die Gruppen dort wohin sie beordert wurden, die
Bauern brachten mit den Wasserkiwen Wasser aus dem Brunnen zum Brandort. Wenn das Wasser im Brunnen alle wurde hat
man den Saugkorb in die Kiewen gelegt und dort Wasser entnommen. Die Wassergruppe ging mit Eimern zum Dorfteich, holte
Wasser und füllte damit die leeren Kiewen.
Der Löschtrupp ging mit Feuerhaken und Löschpatschen auf die umliegenden Gehöfte und versuchte das vermeintliche Feuer
von ihnen fernzuhalten. Nach dem Alarm wurde wieder am Spritzenhaus angetreten. Die Gruppenführer mussten angeben ob
ihre Gruppe auch vollständig erschienen war, denn Übungen wurden nur vor, oder nach der Feldarbeit durchgeführt, so
dass niemand eine Entschuldigung vorbringen konnte. Wer ohne begründete Entschuldigung nicht anwesend war erhielt eine
Verwarnung. Der Kreisbrandmeister erklärte dann welche Handgriffe den Vorschriften entsprachen und welche nicht. Die
Schläuche wurden noch schnell zum Trocknen aufgehängt. Anschließend gingen wir alle in den Gasthof Trzaska, haben über
vorhandene Mängel diskutiert, Verbesserungsvorschläge unterbreitet und zwischendurch den Durst gelöscht. Der
Kreisbrandmeister ist dann, nach einer kurzen Verabschiedung, ins nächste Dorf gefahren, weil er an einem Tag mehrere
Feuerwehren betreuen musste.
Der Rohmaner Dorffriedhof

Einen Kilometer vom Ende des Dorfes entfernt, auf der rechten Seite der Landstraße in Richtung
Ortelsburg, befand sich der Rohmaner Dorffriedhof. Wann dieser Friedhof angelegt wurde entzieht sich meiner Kenntnis.
Nach Aussagen älterer Dorfbewohner soll davor auch schon eine Ruhestätte vorhanden gewesen sein, und
zwar auf der linken Straßenseite gegenüber dem jetzigen Friedhof. An dieser Stelle befand sich bis in die
Nachkriegszeit ein kleiner Brunnen, aus dem die Dorfbewohner, das Wasser zum begießen der Grabbepflanzung auf den
Gräbern ihrer verstorbenen Angehörigen holten. Der Friedhof war in einer Hanglage angelegt, wahrscheinlich weil diese
Parzelle für eine landwirtschaftliche Nutzung nicht geeignet war. Um das Gräberfeld vor herumstreunenden Tieren oder
von der Weide entlaufenen Kühen zu schützen, hat man das ganze Gelände mit einem Holzzaun umgeben. Der Zugang befand
sich von der Straßenseite. Unter einem Torbogen hindurch wurden die Verstorbenen zu Grabe getragen. Die Gräber der
einzelnen Familien waren nebeneinander angelegt, mache, wie zum Beispiel die der Familie Trzaska, sogar mit einem
schmiedeeisernen Zaun eingefasst.
Nach dem 2. Weltkrieg verfiel der Friedhof immer mehr. Die nötigen Finanzmittel für die Pflege der Einfriedung konnten
von den restlichen noch verbliebenen Deutschen nicht mehr aufgebracht werden. An den gepflegten Gräbern konnte man noch
erkennen dass es Verwandte von noch in Rohmanen wohnenden Deutschen waren, oder von bereits im Westen Deutschlands
lebenden, die ihre noch in Rohmanen wohnenden Nachbarn damit beauftragt hatten. Die übrigen Gräber wurden von Jahr zu
Jahr immer mehr von Wildkräutern überwuchert und schließlich auch von Sträuchern und schnell wachsenden Bäumen.
In den späteren Jahren konnte man nicht mehr erkennen dass dort vor Jahren Tote zur letzten Ruhe gebettet wurden. Die
Natur holte sich das ganze Gelände zurück und nur unter großen Schwierigkeiten konnten Besucher aus dem Westen das
Friedhofsgelände noch betreten.
Das Gasthaus Trzaska

Nach dem ersten Weltkrieg hat der Gastwirt Friedrich Trzaska neben dem Gasthof einen großen Saal
für Festlichkeiten und Vereinsfeiern gebaut, in dem schon mal Feuerwehrfeste veranstaltet wurden. Ernst Trzaska war
Feuerkommissar bei der Ostpreußischen Feuersozität. Erich Trzaska war Vollziehungsbeamter beim Amtsgericht in
Ortelsburg. Unser Feuerkommissar war uns beim organisieren der Veranstaltungen sehr behilflich, hat uns den Saal, die
Musik und die Theaterstücke besorgt und die Feuerwehren aus den Nachbardörfern eingeladen.
Zu Manöverzeiten, vor dem 2. Weltkrieg und dann auch während des Krieges, waren im Gasthof Soldaten, meist im Range
eines Offiziers, einquartiert. Fräulein Mariechen Trzaska hat die Poststelle im Dorf betreut. Nachdem ich 1939 zum
Militär eingezogen wurde, hat sie, nach einer Schulung im Ortelsburger Krankenhaus, auch die Unfallmeldestelle
übernommen. Nach dem Krieg, pflegte sie mit vielen Bekannten, die bereits in der Bundesrepublik wohnten, einen regen
Briefwechsel. Auf dem Rohmaner Friedhof hat sie viele Gräber, im Auftrag von Angehörigen, die auf Grund ihrer
Abwesenheit, dazu nicht mehr in der Lage waren, gepflegt. Der Bauunternehmer Kurnitzki aus Ortelsburg, äußerte die
Bitte, sie möchte ihm doch ein Blatt vom Rosenstrauch, der auf dem Grab seiner Eltern steht, in den Brief legen. Als
sie uns den Brief vorgelesen hat, waren wir zu Tränen Gerührt. Sie hat als Letzte aus ihrer Familie, bis zu ihrem Tod
im Jahre 1960, in Rohmanen, im Gebäude der Gastwirtschaft gewohnt und ist auf dem Rohmaner Friedhof beerdigt worden.
Fleisch und Wurstwaren Karl Pelkowski
Im Jahr 1931 hat der Fleischermeister Karl Pelkowski, aus Grammen, direkt neben unserem Hof ein
Anwesen gekauft und dort eine Fleischerei eingerichtet. Er war mit meiner Schwester Frieda, verheiratet. Am Anfang hat
er die Schweine noch auf seinem Hof geschlachtet, später dann im Ortelsburger Schlachthof. Jede Woche fuhr er 2-mal,
mit dem Pferdewagen(Einspänner), nach Ortelsburg zum Wochenmarkt, wo er seine Fleisch und Wurstwaren zu Verkauf anbot.
Am Tag davor, wenn er die Wurst gekocht hat, kamen viele Rohmaner mit Kannen oder anderen Gefäßen, wegen der guten
Wurstsuppe, die er umsonst unter die Leute verteilte. Als Karl Pelkowski, Ende August 1939 zum Militär eingezogen
wurde, hat seine Frau das Pferd verkauft und den Beitrieb stillgelegt. Am Haus hing, immer noch die Tafel mit der
Aufschrift: Karl Pelkowski, Fleisch und Wurstwaren. Ein Witzbold hat irgendwann darunter geschrieben; „Fleisch und
Wurst waren einmal”, drauf hin hat Frau Pelkowski die Tafel entfernen lassen. Karl Pelkowski ist im Mai 1946 in
französischer Gefangenschaft verstorben. Seine Ehefrau Frieda, verstarb an ihrem 85. Geburtstag in Mettmann bei
Düsseldorf.
Die steinreichen Rohmaner Felder
Die letzte Eiszeit hat bei der Schmelze, auf der Rohmaner Feldgemarkung viele Steine und
Granitblöcke zurück gelassen. Überirdisch, aber besonders unter der Erde, gab es viele kleine, aber auch große Steine,
die, den Bauern, beim Pflügen und anderen Feldarbeiten sehr viel Schweiß, abverlangten. In einer Kiesgrube, auf dem
Feld des Bauern August Radek, lag ein Granitblock, von schätzungsweise 100 cbm. Vor etwa 80 Jahren, als man für diese
Steine noch keine Verwendung hatte, griffen die Bauern zu einer „List”. Weil er sonst nicht pflügen konnte, hat mancher
seinem Nachbarn, die Steine in der Nacht auf dessen Feld abgeladen. Als diese Tätigkeit unter Strafe gestellt wurde,
hat man die Steine in Schluchten gekippt und mit Mutterboden zugeschüttet. In späteren Jahren kam diese jedoch beim
pflügen wieder an die Oberfläche. Dann hat man aber schon Steine für den Straßenbau gebraucht und konnte sie so zu Geld
machen. Besonders im Raum südlich von Ortelsburg, bis zur polnischen Grenze, wo Steine eine Rarität waren, kamen sie
jetzt zum Einsatz. Auch beim Bau von Häusern, besonders für die Fundamente, wurden sie eingesetzt, weil auf diese
Weise viel Ziegeln eingespart wurden. Die Firma Gribienski aus Ortelsburg hat die großen Steine mit Dynamit gesprengt
und auf diese Weise die weitere Verarbeitung erleichtert.
Die Steine welche beim Pflügen aus dem Boden geholt wurden, hat man am Feldrand auf große Haufen zusammen getragen.
Wenn die Feldarbeit beendet war, sowie auch in den Wintermonaten, waren wir jeden Tag mit Steinen unterwegs. Wir sind
vorwiegend am Abend los gefahren, weil unter der schweren Last die Wagenachsen so heiß wurden und die Gefahr bestand,
das durch die Dehnung, die Räder blockiert würden. Bei einer Fahrt konnte man bis zu 24 Reichsmark verdienen, wogegen
1 Zentner Roggen für 8 bis 9 Reichsmark zu haben war. Ich bin selbst, mit dem Pferdewagen bis Fürstenwalde, Radostowen,
Luka, Altkirchen, Höhenwerder, ja sogar bis Friedrichshof gefahren.
In Rohmanen wurden auch rote Ziegeln gebrannt. Viele Häuser wurden, mit Ziegeln erbaut, die nur wenige 100 Meter von
der Baustelle entfernt hergestellt wurden. Der Lehn wurde auf den Feldern in der näheren Umgebung entnommen, dann von
Ochsen solange getreten, bis er so geschmeidig war, das er sich in Formen einstreichen ließ. Wenn die Ziegel in der
Form trocken war, wurde sie entnommen und in einem Brennofen gestapelt. Um einen Ofen richtig anzufeuern, brauchte man
12 Raummeter Holz, das im Zeitraum von ein par Tagen verheizt wurde. Der Fischer Karl Glitza hatte schon eine
Knetmaschine, die von einem Pferd angetrieben wurde, das mit verbundenen Augen, den ganzen Tag in die Runde ging.
Im Dorf waren auch vier Kalköfen, in denen so genannte Kalksteine, die sich an gewissen Stellen, im Erdboden befanden,
gebrannt wurden. Nach dem Brennen wurden die Steine mit Wasser abgelöscht und die daraus entstandne Masse diente, nach
dem Beimischen einer gewissen Menge Sand, dann als Bindemittel beim Häuserbau. Das Gerichtsgebäude und das
Lehrerseminar in Ortelsburg wurden mit Kalk, aus dem Rohmaner Brennöfen erbaut. Auch zum Bau einer Eisenbahnbrücke, auf
der, der Zug, den Sawitzfluß, von Ortelsburg nach Allenstein überquerte, hat mein Großvater, mit einem Ochsengespann,
Kalk gefahren.
Hinter der Scheune, beim Bauern Johann Dembek hat man Tonerde gefördert, aus der man mit Hilfe einer Formerscheibe,
die von einem Arbeiter mit Muskelkraft(Fußbetrieb) angetrieben wurde, schöne Krüge, Schalen und Vasen geformt hat.
Die Töpferware wurde, nachdem sie trocken genug war, auch in einem Ofen gebrannt, anschließend mit einer Lasur
überzogen und wieder gebrannt. Es wurden auch Kacheln zum Bau von Kachelöfen hergestellt, die mit verschiedenen
Ornamenten versehen, die Wohnstuben unserer Vorfahren schmückten. So haben unsere Großväter ihr Leben gemeistert und
nach und nach, unsere Dörfer aus der Rückständigkeit in die Neuzeit geführt.
Das gesellschaftliche Leben nach dem 1. Weltkrieg

Als der Lehrer Alfred Dorka, ein Frontkämpfer des Ersten Weltkrieges und ein Sportsmann, als
zweite Lehrkraft an der Rohmaner Schule angestellt wurde, hat er die Sitten und Gebräuche aus früherer Zeit wieder zum
Leben erweckt. Zuerst hat er die Jugend zusammen gerufen, einen Jugendverein und einen Fußballclub, gegründet. Zum
Vorsitzenden des Fußballclubs wurde Johann Gloddek berufen, der ihn auch geleitet hat. Bauer Wilhelm Spittka, der am
Rohmaner See wohnte, stellte Land für einen Sportplatz unentgeltlich zur Verfügung. Lehrer Alfred Dorka hat am
Rohmaner See eine Badestelle ausgesucht und ein Sprungbrett bauen lassen. An jedem Sonnabend im Sommer, bevor die
Sonne unterging, versammelte sich die gestammte Jugend des Dorfes an der Badestelle am See. Es wurde gebadet,
Heimatlieder gesungen, gespielt, im Fackelschein eines großen Biwakfeuers, bis in die späte Nacht hinein. Der Fischer
Karl Glitza hat uns Kähne zur Verfügung gestellt, mit denen wir auf den See hinausgepaddelt sind, dabei hatten wir viel
Spaß, was wiederum den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft gefördert hat. Ich habe mit meiner Mandoline den Gesang von
Volks- und Heimatliedern begleitet.
Der Rohmaner See liegt in einem Tal, dessen Hänge zu beiden Seiten mit Kiefern und Tannen bewaldet sind. Wenn man
gesungen oder Musiziert hat, hallte es von den Hängen zurück. Die Ufer waren mit Kalmus und Schilf bewachsen, was für
die Fischaufzucht von Vorteil war. Wenn man an einem sonnigen, windstillen Tag, am Seeufer spazieren ging, traf man
oft auf Flachstellen, an denen sich die Fischbrut im Sonnenlicht wärmte, wie ein Mückenschwarm. Im See befanden sich
folgende Fische: Karpfen, Hechte, Schleie, Barsche Plötze, Rotaugen, Aale und Krebse. Am Sonntagmorgen brachten viele
Rohmaner ihre Pferde zum See um sie zu baden.
Es wurden dort, unter der Aufsicht von Lehrer Dorka, auch viele Jugendfeste mit Theatervorführungen veranstaltet, zu
denen er selbst die Vorlagen organisiert hat. Der am See wohnende Bauer Johann Nadrowski, hat uns ein Scheunentor, als
Tanzboden zur Verfügung gestellt. Der Zimmermann Wilhelm Wittek hat uns eine Windmühle gebaut, die am auf dem Boden
liegenden Scheunentor aufgestellt wurde, dazu kamen Noch Tannen und Fichten, die das Ganze wie ein Bühnenbild
erscheinen ließen. Es wunden viele Bühnenstücke aufgeführt, unter anderen >Alte Weiber werden jung gemahlen<. Dazu bot
die Windmühle die entsprechende Kulisse.
Nach der Vorführung wurde der Boden aufgeräumt, um dann als Tanzdiele zur Verfügung zu stehen. Der Gastwirt Trzaska
hatte Tische und Bänke aufgestellt, Speisen und Getränke angeboten, so dass sich die die Veranstaltung bis in die
späte Nacht hinein zog. Es waren auch Leute aus Ortelsburg und anderen Nachbardörfern dabei. Im Winter hat Lehrer
Dorka eine Kreisrodelbahn eingerichtet, die von Zeit zu Zeit mit Wasser besprengt wurde, um die Gleitfähigkeit zu
verbessern. Von einer Anhöhe ging hinunter bis auf den halben See, was für alle ein großes Vergnügen war. Es kamen
Lehrer mit Schulklassen aus der näheren Umgebung um hier zu Rodeln.
Als Herr Lehrer Jobski als Hauptlehrer nach Rohmanen kam hat er mit dem Bürgermeister und der Gemeindeverwaltung
beschlossen, in der Nähe des Dorfes, auf einem zur Schule gehörenden Grundstück, einen Sportplatz anzulegen. Dafür
wurde gleich hinter den Gärten, 6 Morgen Ackerland abgetrennt, und nach Feierabend hat Lehrer Dorka mit den
Jugendlichen eingeebnet und gleich nebenan einen Graben für Schützenstand und Kugelfang ausgehoben. Am Sonntagvormittag
wurde Fußball gespielt und um 15:00 Uhr war Kleinkalieberschießen angesagt. Es musste auch ein kleiner Beitrag erhoben
werden, um Munition kaufen zu können. Eine Büchse konnten wir aus beim Kleinkalieberverein in Ortelsburg ausleihen.
Nach Hitlers Machtergreifung
Als Adolf Hitler an die Macht kam wurde die SA gegründet. Der Bürgermeister Michael Kownatzki
wurde zum Gruppenführer ernannt und folgende Männer haben sich freiwillig gemeldet: Wilhelm Matzey, Johann Gloddek,
Gustav Nadrowski, August Buttler, Karl Baran, Emil Nickel, Wilhelm Jaschinski, Emil Bork, Ernst Rattay und Gustav Bach.
Bei Versammlungen war die SA in Uniform angetreten um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Wer versucht hat Unruhe zu
stiften, egal aus welchem Grunde, wurde aufgefordert den Saal zu verlassen, andernfalls wurde er mit Gewalt entfernt.
Herr Lehrer Jobski wurde zum politischen Leiter ernannt, seine Frau hat die NS-Frauenschaft gegründet, Lehrer Dorka
die HJ, und so bekam die Dorfgemeinschaft, nach und nach ein anderes Gesicht. Der Sportplatz und der Schützenstand
wurden jetzt mehr als früher in den Mittelpunkt gestellt. Nach der Feldarbeit hat der Bürgermeister Fuhrwerke bestellt
und den Sportplatz noch besser herrichten lassen.
Der Bauer Wilhelm Both wurde zum Ortsbauernführer ernannt, mit der Aufgabe alles Land für den Anbau von Getreide und
Futtermittel bereitzustellen, oder wenn das nicht möglich war mit Wald aufzuforsten. Durch den Einsatz von Kunstdüngern
sollten größere Erträge aus dem Boden geholt werden, um den Viehbestand zu vergrößern und mehr Milch und Butter zu
produzieren. Deutschland sollte im Stande sein sich selbst zu selbst zu ernähren, ohne auf Importe angewiesen zu sein.
Frau Jobski hat, innerhalb der der NS-Frauenschaft, mit Hilfe von Fachkräften aus Ortelsburg, Lehrgänge veranstaltet,
auf denen man Backen und Nähen lernte. Auf den Bauernhöfen befand sich auch immer mehr Rassegeflügel, das eine erhöhte
Produktion von Eiern und Geflügelfleisch sicherstellen sollte.
Die Rohmaner Bauern hatten, außer in der Landwirtschaft, noch andere Verdienstmöglichkeiten in der Kreisstadt. In
Ortelsburg wurden vier Sägewerke betrieben, die mit Langholz aus dem Walde versorgt werden mussten. Wir haben eine
Kiefer von über 8 Festmeter angefahren, der wir zuerst 6 Meter Spitze abschneiden mussten, um diese Last überhaupt
auf den Wagen zu bekommen. Sechs Pferde musste angespannt werden um den Wagen zur befestigten Straße zu bringen.
Fichten und Tannen wuchsen bis zu einer Länge von 30 Metern. Auch beim Transport von Ziegel, von der Ziegelei zum
Bahnhof, konnte man gutes Geld verdienen.
Im Jahr 1934 wurde Rohmanen an das überregionale Stromnetz angeschlossen und schaffte auf diese Weise den Sprung von
der Petroleumlampe zur Glühbirne. Neben dem Grundstück von Karl Pietzonka wurde ein Transformatorhäuschen errichtet,
in dem der ankommende Strom von einer Hochspannung auf eine Verbrauchsspannung transformiert wurde. Es gab schon eine
Überlandleitung, die aus Richtung Ortelsburg kommend, quer über die Felder, in Richtung Neu Keykuth weiter ging.
Durch eine Zwischenspanne wurde der Transformator, mit der Hauptleitung auf Kownatzkis Feld verbunden.
Ein Stromanschluss konnte die Arbeit im Haus und Hof auf vielfältige Weise erleichtern, doch nur die besser gestellten
Bauern, sowie noch manche Pensionäre, die ein festes Einkommen hatten, konnten sich dass leisten. Weil nur wenige an
der Elektrifizierung teilnahmen, war ein Stromanschluss mit hohen Kosten verbunden. Nur Gustav Pietzonka, Gasthof
Trzaska, Friedrich Nickel, die Schule und Wilhelm Both, wurden in der ersten Phase erfasst.
Im Jahr 1952 wurde von den polnischen Behörden die zweite Stufe der Elektrifizierung eingeleitet, in der alle im Dorf
stehen Gebäude erfasst wurden. Am Anfang wurden nur Leitungen für Lichtstrom gelegt und auch nur 3 Lichtstellen pro
Haushalt bewilligt. Doch im nachfolgenden Zeitraum wurden dann, wenn Material vorhanden war, weitere Lichtpunkte
angelegt. 1952, am zweiten Wochenende im Advent, wurden dann die Leitungen geschaltet und alle waren von der
plötzlichen Helligkeit sehr begeistert. Wenn man Glühbirnen auswechseln wollte musste man am Anfang weite Wege
zurücklegen, um welche zu bekommen. In den 60ger Jahren wurden dann immer mehr Starkstromleitungen gelegt, weil die
Bauern elektrische Geräte kaufen konnten. Ende der 60ger wurden auch die Abbauten an das Stromnetz angeschlossen.
Das Urnengrab auf unserem Feld
Auf unserem Feld, in Richtung Seelonken, bin ich oft beim pflügen gegen Steine gestoßen, manchmal
rissen sogar die Stränge am Pferdegeschirr. Eines Tages nahm ich einen Spaten, Brechstange und einen langen Baum, um
der Sache auf den Grund zu gehen. Als ich eine Menge Sand ausgehoben hatte stieß ich auf eine steile, aus Steinen
errichtete Wand, die ich auch mit dem Baum nicht aus der Fassung bringen konnte. Ich habe den ganzen Vormittag gegraben,
konnte jedoch nicht unter die Steine kommen. Einige Tage später hatten wir in der Schule eine Bauernversammlung, da
habe ich Herrn Biella und Herrn Lehrer Dorka von meinem Fund berichtet. Am nächsten Morgen kam der Lehrer Dorka mit der
ganzen Schulklasse, mit Spaten und Sieben ausgerüstet auf unser Feld und fingen an die ausgehobene Erde zu sieben.
Lehrer Dorka benachrichtigte daraufhin den Leiter des Ortelsburger Heimatmuseums, der am nächsten Morgen vorbei kam um
sich die Fundstelle genau anzusehen. Er beauftragte ihn 4 Mann zu besorgen, um die Steine ringsum frei zu schaufeln.
Zwischen den Steinen durften wir die Erde nur mit Esslöffeln ausheben. Als es plötzlich zu regnen anfing hat Lehrer
Dorka die Brauerei Daum, in Ortelsburg angerufen, die uns über der Fundstelle ein Zelt errichtet haben, damit wir
ungestört weiterarbeiten konnten. Wir fanden 8 flache und 8 hohe Urnen zu beiden Seiten am Körper. Die Urnen wurden in
Gipsbinden eingewickelt und ins Heimatmuseum nach Ortelsburg gebracht, wo sie durch einen Fachmann, der extra aus einem
Königsberger Museum angereist war. Nach Reinigung der Urnen hat er festgestellt, das die Grabstätte etwa 2000 Jahre vor
Christi Geburt angelegt wurde und ein Doppelgrab war, in dem ein Toter liegend und einer in Hochstellung beigesetzt
wurde.
Die Nachricht von der Fundstelle verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Es erschienen viele Schaulustige, ganze
Schulklassen aus der Umgebung, mit Autos und zu Fuß. Durch die vielen Menschen wurden die bestellten Ackerflächen auf
unserem Feld sehr in Mitleidenschaft gezogen, eine Entschädigung haben wir nicht erhalten. Das Grab wurde vor dem
Heimatmuseum in Ortelsburg wieder so aufgebaut wie man es auf unserem Feld vorgefunden hat. Für den Transport der
Steine wurde ich entlohnt. Die Urnen hat das Königsberger Museum an sich genommen und wollte sie nicht wieder hergeben,
weil die solch einen Fund noch nicht in ihrer Sammlung hatten.
Sonnenwendfeuer
Am 24 Juni fand eine Sonnenwendfeier statt. Ein Brauch der an die alten Germanen erinnern sollte.
Der Lehrer Dorka hat den Bürgermeister beauftragt 2 Fuhrwerke in den Wald zu schicken, die Holz und alten Reisig holen
und auf dem großen Schulberg abladen sollten. Das Straßenbauamt hat uns Teertonnen zur Verfügung gestellt. Die ganze
Dorfgemeinschaft wurde eingeladen, am Abend, nach der Feldarbeit, an der Sonnenwendfeier teilzunehmen. Lehrer Dorka
hielt zuerst eine Ansprache, in der er anschaulich erklärte wie unsere Vorfahren in grauer Vorzeit gefeiert haben.
Nach dem offiziellen Teil wurden das Holz und die Teertonnen angezündet, es wurden Heimatlieder gesungen, wie: Wild
flutet der See, drauf schaukelt der Schiffer den schwankenden Kahn, Schaum wälzt er wie Schnee, von grausiger Mitte
zum Ufer heran, wild fluten die Wellen auf Vaterlands See, wie schön, oh trag mich auf Spiegel zu Hügel, Masovias See.
Masovia Land, mein Heimatland, Masovia es lebe mein Vaterland.
Lehrer Alfred Dorka und sein Wirken für Rohmanen.

Friedrich Biella hatte auf seinem Feld einen Granitstein mit einer geraden Seite, den haben wir
mit viel Schweiß an den Dorfteich transportiert und auf einer Erhöhung abgelegt. Der Stein sollte zum Denkmahl für die
Gefallenen des Ersten Weltkrieges umgestaltet werden. Da zu Wenige daran ein Interesse zeigten, wurde diese Idee fallen
gelassen und der Stein irgendwann ins Wasser gerollt. Der Lehrer Dorka war viele Jahre in Rohmanen tätig, dort hat er
später seine ehemalige Schülerin, Lotte Biella geheiratet. Er hat sich sehr für die Entwicklung des Dorfes interessiert,
war bei jeder Gemeindeversammlung anwesend und hat auf Schwachstellen hingewiesen die den Fortschritt behinderten.
Gemeinsam mit den Schülern hat er den Ehrenfriedhof für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges gepflegt, an der
Wegegablung nach Eichtal und zu Ehren des Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg eine Eiche gepflanzt.
Zum Advent hat Lehrer Dorka mit der Jugend einen Adventstern, in verschiedenen Farben gebastelt.
Der Stern wurde auf einer 2 Meter langen Stange befestigt, in der Mitte wurde ein Wachslicht angezündet, am Stern
wurde eine Schnur angebracht, wenn man daran zog rollte der Stern hin und her. Am ersten Wochenende im Advent
versammelten sich jung und alt, um den Stern durch das Dorf zu tragen. Alle schlossen sich dem vorausgehenden
Sternträger an, der den Stern durch die Hauptstraße und die angrenzenden Wege trug. Dieser Sternmarsch wurde an den
folgenden Adventwochenenden wiederholt.
Am ersten Weihnachtfeiertag wurde um 4:00 Uhr morgens ein Frühgottesdienst gehalten. Zuerst hat der Pfarrer eine
Andacht gehalten, dann haben die Kinder ein Krippenspiel aufgeführt und die Gemeinde hat schöne Weihnachtslieder
gesungen. Der Gastwirt Trzaska hat uns den Saal zur Verfügung gestellt. Wir hatten eine Posaunen- u. eine
Gitarrengruppe. Unter der Leitung von Herrn Willi Doormann spielten: Gottlieb Brosch, Fritz Ollech,
Gustav Rattay(Sopran), Wilhelm Pilath, Gustav Brosch(Alt), Fritz Both(Tenor) und Fritz Brosch(Bass).
In der Gitarrengruppe wirkten mit: Martha Ollech, Hedwig Ollech, Martha Lekzik, Martha Michalick und Auguste Lekzick.
Willy Doormann hat sie auf der Geige begleitet.
Kurz vor Ausbruch des 2. Weltkrieges
Bei der Aufstellung des Grenzschutzes(Regiment Buchholz), hat er als Hauptfeldwebel die
Gruppenführerkurse überwacht und selbst die fähigsten Männer dafür vorgeschlagen. Das Ausbildungspersonal hat das
Jäger-Battalion gestellt. Wir kamen zuerst ins Stadion(Waldheim), wurden da eingekleidet und dann ging es gleich
kasernenmäßig zu, theoretisch und praktisch. Jeder musste vor die Front treten und nachweisen ob er im Stande ist,
Befehle zu erteilen. Abends wurden Filme vorgeführt die uns zeigen sollten wie eine Gruppe sich im Gelände entfalten
muss. Die Exerziervorschriften hatten sich, im Verhältnis zu Kaiser Wilhelms Zeiten, etwas geändert. Damals bestand
eine Gruppe aus 8 Mann und einem Unteroffizier, jetzt aus 10 Schützen, 3 für das leichte Maschinengewehr und einem
Unteroffizier(13 Mann). Nach der Schulung folgte eine Abschlussprüfung, danach ein gemütliches Beisammensein. Aus
Rohmanen haben folgende Männer die Prüfung bestanden: Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy, Gustav Rattay und
Gustav Deptolla. Unsere Uniformen waren alle zu klein und es gab viel zu lachen bei der Anprobe.
Die erste Übung habe ich mit Emil Rosowski, in Lenzinen gemacht. Der Gutsbesitzer Marzinzick hat seine Scheune als
Unterkunft zur Verfügung gestellt. Er war im Range eines Hauptfeldwebels. In seinem haus war die Schreibstube
untergebracht, die er selbst verwaltete. Ein Lastauto hatte Uniformen aus der Kaserne in Ortelsburg geholt, jeder
musste eine Uniform anlegen und dann wurde solange getauscht bis alle eine passende gefunden hatten. An den Namen des
Kompanieführers kann ich mich nicht mehr erinnern. 1935 wurden wir zu einer Übung in die Dragonerkaserne nach Lyk
einberufen. Die Gruppenführer, Zugführer, und Kompanieführer die schon Frontberührung im dem Ersten Weltkrieg hatten,
mussten eine Woche früher anreisen. Die Übungen waren auf 6 Wochen angelegt. Die meisten der einberufenen waren noch
nie mit dem Wehrdienst in Berührung gekommen. Jeder Gruppenführer bekam 13 Mann zugeteilt.
Unser Zugführer war Leutnant Neumann, Kompanieführer Oberleutnant Rutschko, Battalions-Kommandeur Major Gröning
(Regiment Buchholz). Hier ging es wieder Kasernenmäßig voran. Das Bataillon wurde hier vereidigt. Jeden zweiten
Sonntag durften unsere Frauen uns besuchen. Ein Jahr später wurden wir wieder zu einer Übung einberufen, auf den
Truppenübungsplatz nach Arys. Jeder Gruppenführer hatte den Auftrag die Gruppe zu entfalten, und auf bewegliche
Figuren zu schießen. Diese Übung musste später mit scharfer Munition wiederholt werden. Jedes Maschinengewehr bekam
50 Schuss, jeder Schütze 20 Schuss zugeteilt. Nach dem Abschießen wurden die Treffer gezählt und dem Kommandierenden
Bericht erstattet. In einiger Entfernung spaziert ein Storch umher, der gar nicht bemerkt hatte dass geschossen wurde,
was bei den Kameraden ein großes Gelächter hervorrief.
Nach der Übung wurde uns gesagt das jeder Gruppenführer eine arische Abstammung nachweisen sollte. Ich konnte in den
Rheinsweiner Kirchenbüchern meine Vorfahren aus Gellen, bis zum Jahr 1732 zurück, nachweisen und wurde zum
Unteroffizier befördert. Aus unserem Dorf wurden auch, Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy und Gustav Deptolla
befördert. Zwischendurch mussten wir schon mal in die Radfahrer-Kaserne nach Ortelsburg, Gewehre empfangen und im
Gelände üben. Am 31 Juli 1939 wurde mir von einem Soldaten ein Schreiben übereicht, das mich aufforderte, am 1. August
um 6:00 Uhr, bei der 3. Kompanie, des 2. Infanterieregiments zu erscheinen.
Um 5:30 hat mich meine Schwester in die Kaserne gebracht. Auf der Schreibstube erklärte mir der Hauptfeldwebel,
dass mir ab sofort der Dienstgrad eines Sanitäters zugewiesen wird, ich mich in der Kammer einzukleiden hätte und mir
in der Handwerkerstube die entsprechenden Schulterklappen annähen lassen sollte. Die aktiven Sanitäter wurden den
Feldlazaretten zugewiesen und wir kamen an ihre Stelle. Unser Bataillon wurde nach Schodmak zum Bunker bauen und
Stacheldraht verlegen eingeteilt. Wir zogen in Begleitung einer Musikkapelle bis zur Kreuzung am Krankenhaus, dann
weiter zu unserem Bestimmungsort, gefolgt von einer Gulaschkanone die in den nächsten Tagen für unsere Verpflegung
sorgen sollte.
Am 14 August haben wir die Jägerkaserne, begleitet von einer Musikkapelle endgültig verlassen und zogen zuerst durch
Ortelsburg, dann über Lehmanen ins Feldmanöver, hinter Rohmanen. Dort entfaltete sich das Bataillon im Gelände, die
Verwundetensammelstelle wurde auf dem Hof des Bauern Friedrich Neumann eingerichtet. Gegen Abend wurde zu Sammeln
geblasen und Biwak bezogen, wobei unsere 3.Kompanie, in einem kleinen Wallt, in der Nähe von Otto Nickels Gehöft
Stellung bezogen hatte. Die 2. und 4. Kompanie hatte sich in der Nähe vom Abbau Pallasch niedergelassen. Die Frau
Nickel hat am Abend ein Mädel in Dorf geschickt um meiner Frau Bescheid zu sagen, wo wir uns zurzeit befinden. Meine
Frau ist dann noch gekommen um sich von mir zu verabschieden, weil wir am nächsten Morgen um 3:00 Uhr Zelte abbrechen
und um 4:00 Uhr in Richtung Kaspersguth marschieren sollten.
Wir sind dann über Achodden, Seelonken, Lehmanen, Ortelsburg, bis nach Grammen und Schützendorf marschiert, wo wir an
einem See Biwak bezogen haben. Es wurde immer gesagt, wir kommen zum Tannenberg-Denkmal bei Hohenstein, wo ein Reichs
Kriegervereinsfest stattfinden sollte. Es wurden auch schon Vorkommandos aufgestellt, doch dann kamen wir nach Orlau
und Lahna-Mühle, da wo die Alle entspringt haben wir 2 Tage biwakiert. Unser Kompanieführer hat uns nach Waplitz auf
den Soldatenfriedhof des Ersten Weltkrieges geführt und uns erklärt wie das Jägerbataillon sich 1914 hier entfaltet
hat und aufgerieben wurde. Dann mussten wir in der Nähe von Gut Koslau über einen Fluss und bezogen in einem Waldstück,
vorbereitete Stellungen in der Nähe der polnischen Grenze. Herr und Frau Thalmann haben uns jeden Tag, bis zur Grenze,
mit Brötchen und Getränken versorgt. Es wurde scharfe Munition ausgegeben, weil wir am nächsten Morgen um 4:00 Uhr die
polnische Grenze überschreiten sollten.
Am nächsten Morgen um 10 Minuten vor 4:00 Uhr kam der Befehl; scharfe Munition abgeben, alles zurück in ein 6 Kilometer
entferntes Dorf, wo wir auch einquartiert wurden. Das alles geschah’ eine Woche vor dem 1. September 1939. Es wurde
gesagt dass der Führer dem polnischen Präsidenten Rid-Szmigly, ein Ultimatum gestellt hat und es wahrscheinlich nicht
zum Krieg mit Polen kommt. Genau nach 5 Tagen kehrten wir wieder in die gleichen Stellungen zurück, es wurde wieder
scharfe Munition ausgegeben und am nächsten Morgen um 4:00 Uhr überschritten wir die polnische Grenze.
“Der 2. Weltkrieg.”
Der erste Einsatz in Polen
Wir kamen zuerst in ein Dorf in dem sich nur alte Menschen befanden. Auf unsere Frage wo denn die Bewohner wären sagte
man uns dass alle geflohen sind, weil erzählt wurde, die Deutschen würden alle Polen misshandeln und verstümmeln. Ich
habe ihnen daraufhin gesagt dass uns, unter Androhung von Strafe verboten wurde, einem Zivilisten etwas anzutun. Das
Vieh, die Schweine und Hunde des Dorfes liefen frei herum und die Soldaten fingen an auf die Hunde zu schießen, bis
gesagt wurde es seien Meldehunde im Dienste der Deutschen Wehrmacht und dieser Unfug der eigenen Truppe schaden würde,
weil etwaige Querschläger eigene Kameraden verletzen könnten. Wir gingen weiter auf polnischer Seite entlang der Grenze,
bis wir am Nachmittag die ersten Vorposten der Festung Mlawa erreichten, da befanden wir uns plötzlich im Feuerhagel
polnischer Festungsflack.
Am nächsten Morgen hatte ich schon 3 Verwundete und wusste nicht wo sich eine Verwundeten Sammelstelle befindet. Ich
suchte den Bataillonsgefechtstand auf der sich auf einer Anhöhe befand. Ich habe unseren Oberstabsarzt gefragt wo denn
die Verwundetensammelstelle wäre. Er rief beim Tross an, wo er die Auskunft erhielt, das sich vor dem Dorf ein Bunker
befindet in dem man die Verwundeten sammeln sollte, die dann von Sanitätsautos abgeholt würden, weil das Dorf unter
Artilleriebeschuss stand. Am Sonnabend haben unsere Flieger die Bunkerstellungen bombardiert, konnten aber, trotz guter
Treffer nicht viel ausrichten, die Bunker wurden nur etwas angekratzt.
Der Beschuss unserer vordersten Linien ging mit unverminderter Heftigkeit weiter. Am Sonntag verkündete eine große
Staubwolke die Ankunft unserer Panzer, doch sie kamen nur bis zur Panzersperre und mussten wieder abdrehen ohne den
Polen einen schaden zuzufügen. Ein Panzer bekam einen Volltreffer, der Fahrer konnte noch umkehren. Er blutete am Kopf
und der Schütze war so eingeklemmt, das wir ihn nur mit einem Seil unter den Armen, durch die Luke nach oben ziehen
konnten. Ob er seine Verwundung überlebt hat ist mir nicht bekannt, denn in der Nacht wurden Panzergeschütze nach
vorne in Stellung gebracht, die direkt in die Schießscharten der Bunker geschossen und so die Verteidiger vertrieben
haben. Daraufhin sind wir weiter vorgerückt. Auf einer Wiese war ein tiefer Graben ausgehoben und mit Ästen getarnt,
da war ein Panzer hinein gefahren, so dass nur das Hinterteil herausragte und er sich nicht aus eigner Kraft befreien
konnte. In der Luft waren Flieger die Brandbomben abwarfen, ich habe mich auf den Boden geworfen weil ich dachte die
würden explodieren, aber sie zischten nur, so das Stoppeln und Graß rings herum in Brand gerieten.
Bei den Kampfhandlungen gab es mehrere Verwundete, denen ich gerade Verbände anlegen wollte, als unser Hauptmann zur
Trillerpfeife griff um mir klar zu machen, dass ich ihm folgen sollte. Die Polen fingen an zu schreien, ich sollte
sie ins Lazarett bringen denn hier im Wald würde sie niemand finden. Ich setzte mich aufs Fahrrad und folgte unserem
Kompanieführer, der mir sagte ich soll immer bei der kämpfenden Truppe bleiben, denn hinter der Front sind die
Sanitätsabteilungen, die werden die Verwundeten schon versorgen. Der Vormarsch dauerte bis in die späte Nacht. Auf
einem Gehöft, das nach allen Seiten durch Feldwachen abgesichert wurde, machten wir endlich Rast. Wir haben
Getreidegarben auf dem Hof ausgebreitet und uns zur Ruhe gelegt, als plötzlich um Mitternacht Leuchtraketen den Himmel
erhellten und Maschinengewehrfeuer uns aus dem Schlaf schreckte. Ein par polnische Soldaten hatten das Feuer eröffnet,
aber sich kurz darauf ergeben.
Die Narew-Überquerung
Als es hell wurde ging der Vormarsch weiter. Es wurde uns untersagt Tagebuch zu führen, darum
weiß ich nicht wie die Orte hießen, durch die wir marschiert sind. Als wir durch ein sumpfiges Gelände vor drangen
stand auf einer Anhöhe am Horizont, die polnische Artillerie, die uns sofort unter Beschuss nahm. Unser Hauptmann war
der Meinung dass wir schon in der Nähe des Flusses Narew sein müssten, als aus den Sträuchern ein mit Schlauchboten
beladenes Lastauto auftauchte. Wir wurden aufgefordert mit je 6 Mann ein Schlauchboot zu nehmen, an einem Aggregat
der daneben stand mit Luft zu füllen und zu Wasser zu lassen. In einer Stunde war das ganze Bataillon über die Narew,
wo der Vormarsch fortgesetzt wurde. In einem Dorf überraschte uns die polnische Kavallerie und fing sofort mit
Maschinengewehren zu schießen an. Da kam der Befehl: Alles wieder zurück. Es ging noch schneller als auf der Hinfahrt.
Wir sind erst einige Kilometer am Fluss entlang gegangen und haben dann zum zweiten Mal rüber gesetzt.
Die Gehöfte im Dorf standen alle in Brand. Auf einem waren viele Bienestöcke. 2 Kameraden wollten den Stöcken Waben
entnehmen, doch die Bienen durch das Feuer aufgeschreckt, überfielen sie sofort und stachen derart zu das sie nicht
mehr wieder zu erkennen waren. Ich habe die Einstichstellen mit Salmiak betupft, mehr konnte ich nicht tun. Wir mussten
auf unserem Vormarsch durch einen Wald der in Flammen stand, so dass man kaum atmen konnte. Es ging weiter in Richtung
Minsk und Warschau, wo schon die Sowjetische Armee durchgegangen war, die Pferde und Vieh von einem Gut mitgenommen
hatten. In einem Wald stießen wir unverhofft auf ein Kloster, in dem wir einige Gefangene machten. Dann trafen wir auf
eine gute Straße die nach Grochow ging.
Als wir dort einmarschierten wurden wir aus den oberen Stockwerken beschossen, so dass wir, um uns zu schützen, nur an
den Hauswänden entlang gehen konnten. Wir haben jedes Haus nach Feinden durchsucht. Vor einem Haus stand ein Hund der
niemanden reinlassen wollte, solange bis ihn eine Kugel traf. Die polnische Artillerie feuerte von Warschau aus, um
unseren Vormarsch zu stoppen. Wir hatten uns gerade eingegraben als plötzlich deutsche Flieger am Himmel erschienen,
die unsere Stellungen mit Bomben bewarfen und dabei viel Unheil anrichteten. Wir haben sofort Fliegertücher
ausgebreitet und Leuchtraketen abgeschossen. Da ich in dem Graben, den ich kurz zuvor ausgehoben hatte, sofort in
Deckung gegangen bin ist mir zum Glück nichts passiert. Unter den anderen Kameraden gab es viele Verwundete, so dass
ich nicht wusste wem ich zuerst helfen sollte.
Der Oberstabsarzt hat mich sofort tatkräftig unterstützt, so das bald alle Verwundeten versorgt waren, außer einem,
dem ein Bombensplitter den Arm abgerissen hat. Ich habe im 3 große Verbandspäckchen auf die Wunde gelegt, doch die
Blutung ließ sich trotzdem nicht stoppen, so dass er eine Stunde später auf der Krankensammelstelle verstarb. Wir
haben danach in einem Tomatenfeld einen Graben ausgehoben und eine neue Abwehrstellung bezogen. Die Gruppe Schwarz
bekam den Auftrag nach etwaigen versprengten polnischen Verbänden Ausschau zu halten, als sie unerwartet aus einer
Häuserreihe mit Maschinengewehrsalven überschüttet wurden. Der Gruppenführer und noch ein Soldat wurden dabei tödlich
verwundet. Danach wurde noch ein weiter Stoßtrupp, unter der Führung von Leutnant Briskorn, der sich dazu freiwillig
gemeldet hatte, hinaus geschickt um den Gruppenführer und den anderen Toten zu bergen.
Bei diesem Unternehmen, das erfolglos ausging, weil die Toten schon verscharrt waren, durchschlug eine Kugel den
Stahlhelm von Leutnant Briskorn, der auch sofort tot war. Alle Toten wurden später, an der Kirchenmauer in Grochow, in
Särgen beigesetzt: Hauptmann Schönwald sagte, das sie nach dem Kriege auf den Heldenfriedhof nach Ortelsburg überführt
werden. Drei Tage lagen wir bei Grochow in Stellungen, waren dem polnischen Maschinengewehrfeuer sowie den Bomben
deutscher Flugzeuge ausgesetzt. In der Nacht musste ich zu einem Verwundeten in die vorderste Linie und habe den
Rückweg nicht mehr finden können, als plötzlich Gewehrfeuer aufflammte habe ich in den Ruinen Schutz gesucht. Erst im
Morgengrauen konnte ich mich wieder orientieren und zu meinem Unterstand zurückfinden.
Warschau wurde tagelang bombardiert und stand auch unter Artilleriebeschuss. Aus dunklen Rauchwolken kamen oft ganze
Bündel von Papier angeflogen. Die Verwundeten kamen oft auf Krücken zu unserem Unterstand, ich habe sie dann zur
Krankensammelstelle hingeführt. Wir haben auch polnische Zivilpersonen betreut, die während der Kampfhandlungen
verwundet wurden. Als einmal 2 Jungen vorbeiliefen hat einer ihnen nachgerufen sie sollten seiner Frau Bescheid sagen,
er wäre auf der Krankensammelstelle an der Kirche. Als wir dort ankamen war seine Frau, mit einem Kind auf dem Arm,
schon da.
Nach der Kapitulation von Warschau, gingen wir über Sokolow zum Bug und haben dort Quartier bezogen. Der Russe hatte
sich bereits hinter den Fluss zurückgezogen, hatte alles Vieh und Pferde mitgenommen. Dort erreichte mich ein Telegramm
von zu Hause, dass meine Tochter gestorben ist. Es sprach sich auch herum dass verschiedene Heimaturlaub bekommen haben,
ich durfte auch für 14 Tage heim. Wir fuhren mit Lastautos nach Allenstein in die neue Reiterkaserne, zum
Ersatzbatallion, da haben wir unsere Gewehre und Munition abgeben, dann durften wir, jeder in seinen Heimatort
weiterfahren.
Als wir unsere Quartiere am Bug verlassen haben war sehr viel Schnee gefallen. Hier in Ortelsburg fanden wir die
gleiche Wetterlage vor, aber nach 3 Tagen war alles wieder weggetaut und wir konnten die Kartoffelernte, die durch den
frühen Wintereinbruch gestoppt wurde, zu Ende bringen. Ein Tag bevor ich zu Hause angekommen bin wurde die Tochter
beerdigt. Nach 14 Tagen mussten wir uns in Allenstein melden, Gewehre empfangen und wieder zurück zur Division an den
Bug 150 Kilometer hinter Warschau. Die elfte Division, zu der wir auch gehörten sollte in den Westen Deutschlands
verlegt werden und war schon unterwegs zur Verladestation Skiernewice 50 Kilometer vor Warschau.
Mein Dienst als Sanitätsunteroffizier
Unser Bataillon kam in das Städtchen Burscheid, im Kreis Opladen, wo wir in Privatquartieren
untergebracht wurden. Nach 3 Monaten, im Januar 1940, wurden wir nach Solingen verlegt, wo wir bis zum
Frankreichfeldzug stationiert waren. Wir mussten an Feldübungen teilnehmen, wie andere die in Kasernen untergebracht
waren. Während dieser Zeit musste jeder seine Zähne in Ordnung bringen lassen. Jeden Tag fuhren 20 Mann in die
Cäzilienstraße nach Köln, zur Zahnklinik. Im Rheinland wurde unsere Division neu aufgestellt. Ausfälle durch den
Polenfeldzug wurden durch neue Soldaten ergänzt. Ich kam nun zum Ersatzbatallion, war der Älteste in der ganzen
Kompanie. Als der Frankreichfeldzug losging wurde unser Ersatzbatallion mit den noch vorhandenen Verwundeten, in die
neue Reiterkaserne, nach Allenstein verlegt.
Meine Frau hat, mit Unterstützung der Bauernschaft, einen Antrag gestellt, daraufhin wurde ich zur Frühjahrsbestellung,
beurlaubt und später bis auf weiteres vom Militärdienst freigestellt. Als der Russlandfeldzug losging wurde ich von der
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg, für 14 Tage einberufen. Ich war seit 1922, Mitglied der freiwilligen
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg und habe jedes Jahr an Übungen teilgenommen. Jede Bereitschaft musste etliche Leute
stellen. Von Rohmanen wurden Emil Rosowski, Johann Dembek, und ich, zur Krankensammelstelle Wirballen, in Litauen,
abkommandiert. Dorthin kamen Lazarettzüge aus Russland mit der Breitspurbahn. Die Verwundeten wurden frisch verbunden
und auf Waggon mit Normalspur verladen und nach Deutschland gebracht.
Als die 14 Tage vergangen waren wollten wir wieder nach Haus zurück, doch man wollte uns nicht entlassen. Stattdessen
wurden wir dem Wehrkreisamt Königsberg zugeteilt, neu eingekleidet und zur Aushilfe ins Lazarett nach Gumbinnen
abkommandiert. Mehr als ein Jahr war ich in den Urlauber-Baracken, habe dort Krankenstube betreut. Später, bis zum
Dezember 1944, war ich im Reserve-Lazarett 4, in Königsberg tätig. Dort habe ich auch die Luftangriffe der Engländer,
vom 25 bis 26. August 1944 miterlebt.
Wir sollten gerade einen Lazarettzug in Rotenstein entladen, als plötzlich die Sirenen ertönten - Fliegeralarm. Im
gleichen Moment waren die ersten Flugzeuge auch schon da, zuerst warfen sie „Tannenbäume” und danach Foßforkanister ab.
Die Omnibusse standen schon zur Abfahrt bereit als es losging. Wir haben die Verwundeten schnell in den
Luftschutzkeller getragen, haben die Betten von den Fenstern weggerückt damit die Verwundeten nicht von den
Glasssplittern verletzt wurden. Im Kasernenhof brannten die Fosforkanister lichterloh. Unsere Unterkunft, die sich in
einer Baracke befand ist völlig abgebrannt, mit dem Wenigen was wir unser Eigen nannten. Am nächsten Tag wurden wir neu
eingekleidet und am 29. bis 30. kamen die englischen Bomber wieder, sie setzten genau da ihr Zerstörungswerk fort wo
sie vor 3 Tagen aufgehört hatten.
Anfang Dezember 1944 musste ich mich nach Stablack melden und musste dann zur Sanitätsabteilung 1, nach Gernau, das
liegt zwischen Lodz und Warschau. Vormittags hatten wir Felddienstübungen und nachmittags theoretischen Unterricht.
Jeden Tag wurden Gruppen zusammengestellt und zu anderen Einheiten abkommandiert. Ich kam zu einer Panzerabteilung, wo
wir an einem Morgen plötzlich auf dem Kasernenhof antreten mussten und zu unserer Überraschung mit der Nachricht
konfrontiert wurden, dass der Russe an mehreren Frontabschnitten durchgebrochen war. Wir bekamen sofort einen
Marschbefehl in Richtung Lodz, wo das Stadtbild noch intakt war, selbst die Straßenbahnen fuhren noch. In der Nacht
haben russische Flugzeuge die Stadt bombardiert. Die Kaserne in der wir untergebracht waren hatte keine
Luftschutzkeller, aber zum Glück blieben wir von Bombentreffern verschont. Am nächsten morgen bot sich uns ein Bild der
Verwüstung. Die entgleisten Straßenbahnwagen, sowie andere Fahrzeuge blockierten die Straßen. Die Älteren unter uns
bekamen Fahrscheine für einen Transportzug, der bereit hinter Lodz abfahrbereit, unter Dampf stehen sollte. Als
russische Panzer in den Straßen auftauchten, verbrannte die Schreibstube unsere Wehrpässe und andere wichtige
Dokumente. Wir liefen zu der Station auf der unser Transportzug bereitstehen sollte, aber da war kein Zug mehr zu sehen
und wir setzten unseren Rückzug zu Fuß fort.
Der Rückzug und Zusammenbruch der Ostfront
In Dobroschin, einer Stadt in Polen, wurde gerade ein Lazarettzug verladen, doch wir kamen nicht
mehr zum Einsatz, weil die russische Infanterie uns schon auf den Fersen war. Es ging weiter über den Fluss Bober,
Sagan, bis nach Glogau an der Oder. Dort wurden wir der 29. motorisierten Sanitätskompanie zugeteilt. Im
Garnisonslazarett wurden noch Operationen durchgeführt. Unsere Division hatte ihr eigenes Feldlazarett, so dass wir den
Befehl zu Weiterfahrt erhielten und noch unbeschadet die Oderbrücke passieren konnten, denn Glogau wurde zur Festung
erklärt. Wir haben 2 Pferdewagen organisiert und mit Verbänden, sowie medizinischen Instrumenten beladen. So kamen wir
bis nach Lübbenau im Spreewald, wo wir in einem Schloss, in zuvor ein Museum war, unser Lazarett untergebracht haben.
Weil die Amerikaner Cottbus bombardiert hatten, wurden die Verwundeten zu uns nach Lübbenau gebracht. Hier haben wir
Tag und Nacht gearbeitet, um die vielen Verwundeten, aus den schweren Kämpfen bei Grünberg und Sagan zu versorgen. Die
Soldaten von der Abwehrfront kamen schon mit abgestorbenen Armen oder Beinen bei uns an, weil in vorderster Linie keine
Frontlazarette mehr vorhanden waren; es mussten viele Amputationen durchgeführt werden. Als für unsere Pferde kein Heu
mehr vorhanden war, schickte mich unser Hauptfeldwebel, zu einem Bauern in den Spreewald, mit dem Auftrag, Futter zu
besorgen. Mit noch zwei Mann fuhren mit zwei Kähnen, zuerst den Hauptstrom entlang und dann in einen Nebenarm; da haben
wir die Boote beladen und brachten das Heu nach Lübbenau.
Als wir uns bei unser Einheit zurück melden wollten, war alles schon marschbereit. Ich bin schnell in einen Bus
eingestiegen der sofort losfuhr, weil russische Verbände schon in sichtweite waren. Russische Flugzeuge kreisten über
den Dächern und nahmen, mit ihren Bordwaffen jeden unter Beschuss, der sich irgendwo blicken ließ. Wir konnten nur
durch den Wald, oder in der Nacht vorwärts kommen, denn wenn ein Auto auf der Landstraße fuhr, war alsbald ein Flugzeug
hinter ihm her und schoss es in Brand. Als wir nach Tagen am Ufer der Elbe ankamen, war bereits eine Ponton-Brücke
erstellt worden, welche die zerstörte Brücke ersetzen sollte.
Durch die vielen Fahrzeuge waren in den Sand tiefe Spuren gefahren, so dass andere Fahrzeuge unsere Busse ins
Schlepptau nehmen mussten, weil wir mit eigener Kraft nicht mehr weiterkamen. Beiderseits der Trasse standen
Flüchtlingswagen, in der der Hoffnung die Brücke passieren zu können, doch SS-Polizei verhinderte das die Gespanne den
militärischen Rückzug zum Stillstand brachten. Es gelang uns die Elbe zu überqueren, um in einem Waldstück Schutz vor
feindlichen Fliegern zu suchen.
Als wir unsere Busse und Autos gut getarnt hatten, hat unser Bataillonschef die anwesenden Parteigrößen zu sich
gerufen und ihnen erklärt das wir eine Einheit des Roten Kreuzes sind und nach internationalem Recht keine Waffen
besitzen dürfen. Nach langer, erregter Diskussion wurde beschlossen einen Graben auszuheben und alles im Sand zu
verscharren. Als wir dann weiter, durch die Dörfer fuhren, sahen wir schon viele weiße Bettlaken, als Zeichen der
Kapitulation, aus den Fenstern hängen. Es wurde uns erzählt dass der Bürgermeister von der SS erschossen wurde, weil
er die Bevölkerung zu diesem Schritt ermutigt hatte. Jetzt waren hinter uns die Russen und vor uns schon die Amerikaner.
Amerikanische Panzer fuhren umher und schossen wild durch die Gegend, ohne ein Ziel anzuvisieren. Niemand wollte sich
dem Russen ergeben, doch der Weg der zu den Amerikanern führte, war durch abgesägte Bäume blockiert. Wir sind schnell
in das nächste Dorf gegangen, haben uns Sägen und Äxte besorgt, die Bäume durchgesägt und in den Straßengraben
geworfen.
“ Nach dem Ende des 2. Weltkrieges.”
In amerikanische Kriegsgefangenschaft
Dann fuhren wir unter internationaler Flagge an eine Mulde Brücke, vor der zwei amerikanische Soldaten, mit Zigarren,
zur Hälfte im Mund, standen. Sie rauchten und kauten gleichzeitig. Wir mussten auf einen freien Platz fahren, alle
aussteigen und rechts wieder antreten. Wäschebeutel und Tornister mussten wir abstellen; danach wurden wir nach Waffen
durchsucht, Wertsachen, Uhren und Messer wurden uns gleich abgenommen. Als wir anschließend an unserem Gepäck
vorbeigingen durfte niemand was mitnehmen. Als ich gebückt, nach meinem Wäschebeutel greifen wollte, in dem sich noch
3 Konservendosen und ein Brot befanden, bekam ich einen Fußtritt ins Gesicht, so dass mir ein Zahn ausgeschlagen wurde.
Wir wurden dann in einem Garten zusammen getrieben und gefragt ob jemand bei der SS gedient hat. Nachdem wir in Reihe
und Glied angetreten waren, mussten wir den Oberkörper freimachen und die Arme anheben. Es wurde nach SS-Zeichen
gesucht, die gewöhnlich unter dem Oberarm eintätowiert waren. Nachdem wir Grimma bei Leipzig, wo wir in amerikanische
Gefangenschaft geraten waren, verlassen hatten, mussten wir durch ganz Thüringen bis Hersfeld, an der Grenze zu Hessen,
marschieren. In Hersfeld wurden wir auf große Lastautos verladen, die von farbigen Soldaten gefahren wurden. Man hat
uns mit Stöcken hinauf getrieben, solange bis das Auto so voll war das man kaum stehen konnte. Die Soldaten fuhren, für
diese Straßenverhältnisse, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Wenn die Straße eine scharfe Kurve hatte, flogen
wir alle übereinander und mussten erst mit viel Kraftanstrengung auf die Beine kommen um diese Fahrt zu überstehen.
Da die Straßenränder in dieser Gegend mit Obstbäumen bepflanzt sind und deren Äste sehr niedrig hängen, hätten die
uns die Köpfe abgerissen, wenn wir uns nicht ständig geduckt hätten. Unsere Fahrt endete in Bad Kreuznach, in der Pfalz,
wo wir in ein Lager, in dem sich später 130.000 Mann und 6 Generäle befanden, eingepfercht wurden. Die Unterkunft der
Generäle befand sich unter einem Zelt, alle anderen mussten die Zeit unter freiem Himmel zubringen. Die Offiziere, die
Unteroffiziere, die Mannschaften; wurden in getrennten Camps untergebracht. Die Mannschaften wurden auch zur Arbeit
abkommandiert und konnten bei dieser Gelegenheit, Brot, Brötchen oder Zigarettenstummel organisieren, wogegen die
Offiziere und Unteroffiziere ihr Camp überhaupt nicht verlassen durften.
Die ersten Tage gab es kein Wasser und kein Brot, so dass die Kameraden vor Erschöpfung umfielen. Später standen wir
manchmal den ganzen Tag nach Wasser an, das von den, uns bewachenden Negern mit großen Wassertanks angefahren wurde. Am
dritten Tag bekamen wir mittags und abends etwas zu Essen; Brot bekamen wir erst nach zwei Wochen, nach dem aus der
Umgebung herbeigeholte Handwerker, Backöfen gebaut hatten. In den verschiedenen Gemeinden, die in den uns umgebenden
Weinbergen lagen, mussten sich alle Männer beim Bürgermeister melden. Als sie dann erschienen waren, wurden sie auf
bereitstehende Lastautos getrieben und zu uns ins Lager gebracht. Sie waren ohne Kopfbedeckung und ohne wärmere
Bekleidung angekommen, weil ihnen gesagt wurde, dass ihr Aufenthalt im Lager nur von kurzer Dauer sein würde. Man hat
uns, falls noch vorhanden, Decken und Mäntel abgenommen, mit der Begründung, sie würden für Kranke und Verwundete
gebraucht. Jeden Tag starben mehr als 200 Mann, die wir sofort in ein Zelt tragen mussten. In der Nacht wurden die
Toten dann mit unbekanntem Ziel, weggefahren.
Viele haben ihren Verstand verloren uns irrten im ganzen Camp ziellos umher. Als Latrinen wurden Gräben ausgehoben, in
die verschiedene Kameraden, bei der Verrichtung ihrer Notdurft, vor Schwäche hineingefallen sind und nicht mehr wieder
heraus kamen. Aus den Pfählen die, die jungen Obstbäume stützten, haben wir Krankentragen gebaut um unsere Kameraden,
bei Bedarf, zur Krankensammelstelle zu tragen. Es war in diesem Frühjahr auch sehr kalt, doch unsere Erdlöcher, die wir
zum Schutz vor Kälte und Wind, nur mit leeren Konservendosen ausgehoben hatten, durften nicht tiefer als 20 Zentimeter
sein. Nach jedem Regenguss mussten wir das Wasser ausschöpfen. Nach einem Gewitter, standen wir wiedermal, total
durchnässt in unserem Camp, als unerwartet am Horizont die Sonne hervortrat. Einer unserer Kameraden hatte noch eine
Trompete gerettet und fing, von dem Anblick völlig überwältigt, zu spielen an: "Es geht alles vorüber, es geht alles
vorbei, nach jedem Dezember, folgt wieder ein Mai". Daraufhin hob sich die Stimmung der tiefbetrübten Kriegsgefangenen,
so das Heimatlieder durch das ganze Camp erklangen, obwohl wir in den nassen Kleider herumgehen mussten, bis sie am
Körper trocken wurden.
In französischer Kriegsgefangenschaft
Nach etwa einem Monat, haben uns die Amerikaner, den Franzosen, zum Arbeitseinsatz, ausgeliefert.
Etwa 4 Kilometer von Bad Kreuznach entfernt, stand auf freier Strecke, ein Zug mit offenen Kohlenloren, auf den wir
verladen wurden. In jeden Waggon, wurde pro Person eine Tafel Schokolade und ein Päcken Zwieback rein geworfen, doch
viele Kameraden fanden nur leere Päckchen vor, weil die schon zuvor von der französischen Wachmannschaft geplündert
wurden. Wir haben uns darüber beschwert, doch die haben uns nur ausgelacht. Nachdem wir zunächst bei Mainz über den
Rhein fuhren, endete unsere Fahrt bei Paris in einem großen Zeltlager. Dort wurden wir auf andere Züge verladen, die uns
nach Südfrankreich, in ein Barackenlager, bei Mazarei, brachten.
Auf einer Zwischenstation hat man uns unter einer Pumpe, die Lokomotiven mit Wasser versorgt, abgestellt, den Kran
aufgedreht und uns anschließend ausgelacht, die Kinder Haben uns mit Steinen beworfen. Ein Wachmann kam in unseren
Waggon gekommen, hat unser Gepäck durchsucht, wenn er Tabak oder Zigaretten gefunden hat, nahm er sie mit. Die Kameraden
waren darüber so empört, dass sie vorhatten, ihn nachts unter den Waggon zu werfen. Wir haben sie gebeten dass zu
unterlassen, weil man uns in diesem Falle, alle erschießen würde.
Als wir ins Lager kamen wurden wir zuerst gezählt, dann mussten wir unser Gepäck stehen lassen und beiseite treten.
Wenn man bei der Nachkontrolle noch was in den Taschen fand, wurde das auch entwendet, selbst Esslöffel. Wir wurden
dann in drei Baracken, ohne Toiletten, eingeschlossen. Die Kameraden haben ihre Bedürfnisse in Kochgeschirre erledigt
und durch ein kleines Fenster, das sich fast unter der Decke befand, hinausgeworfen. Andere Fenster ließen sich nicht
öffnen, weil sie mit Stacheldraht zu geflochten waren. Als die Kameraden die Kochgeschirre auskippten, haben die
Wachposten geschossen und die Fenster zertrümmert. Sie waren der Meinung dass wir ausbrechen wollten. Es herrschte eine
große Hitze, in den überfüllten Baracken sind wir fast erstickt. Am nächsten Tag haben wir uns über fehlende Toilettem
beschwert, da haben sie Heringsfässer durch die Hälfte geschnitten und an der Ausgangstür hingestellt. Um bei den
überfüllten Räumen dort hinzukommen, musste man über die Köpfe der Anderen steigen. Viele hatten Fieber und Durchfall
und mussten in die Krankenstube eingeliefert werden, wo sie kurz darauf verstarben.
Besonders Raucher litten sehr an der Unterernährung, bekamen Wasser in den Beinen und waren die Ersten die verstarben.
Nach der Registrierung wurden wir auf andere Baracken verteilt. Die Zivilbevölkerung kam in die Räume und begann uns
auszuplündern. Wer noch gute Schuhe besaß musste sie ausziehen und bekam dafür die kaputten des Plünderers. Eine Woche
lang mussten wir diesen Zustand ertragen, erst als die Kameraden sich beschwerten, wurde am Eingang eine Tafel am
Eingang angebracht, dass die Zivilbevölkerung das Lager nicht betreten darf. Bis auf einige, wenige Ausnahmen wurde
diese Anweisung befolgt.
Als wir im Lager ankamen, war der französische Lagerkommandant, ein ehemaliger Kriegsgefangener, der bei einem Bauern
in Deutschland gearbeitet hatte. Dieser Bauer war jetzt als Kriegsgefangener in seinem Lager. Als er ihn erkannte, hat
er ihn gleich zum Küchendienst eingeteilt und mit dem nächsten Krankentransport nach Hause fahren lassen. Zu Mittag
bekamen wir nur gekochte Haferkörner, da schwamm alles oben, später war man dann auf Gerste umgestiegen. Als viele
daran gestorben waren, weil sie diese „Rohkost”, die nur ein Kuhmagen verträgt, nicht gegessen haben, hat man die
Körner durch eine Schrotmühle laufen lassen. Dann hat man uns Steckrüben gekocht; wir bekamen 250 Gramm Weißbrot,
etwas Quark und ein viertel Liter Magermilch. Später, als wir schon arbeiten mussten, hat man in unserem Essen einen
Kuhkopf mitgekocht, das hat dann bedeutend besser geschmeckt.
Bevor wir morgens zur Arbeit gingen, mussten wir zu Flaggenparade und abends, nach der Rückkehr, haben wir die Flagge
wieder eingeholt. Wir haben einen Kanal gereinigt, dessen Sohle 2 Meter dick mit Schlamm bedeckt war. Zuerst wurde das
Wasser abgelassen, dann haben wir, einer dem andern, den Schlamm mit der Schippe hoch gereicht. Der Letzte hat den
Schlamm, der so zäh war, dass er nicht von der Schippe wollte, oben am Rande abgelegt. Manchmal waren 10 Mann nötig um
den Höhenunterschied zu überwinden. Das Wachpersonal schoss über unsere Köpfe hinweg und rief: „schnell arbeiten”. Bei
der großen Hitze war das ein Ding der Unmöglichkeit, zumal es nichts zu Trinken gab. Auf dem Heimweg haben wir im Walde
Heilkräuter gesammelt, die man in der Küche getrocknet und als Tee zubereitet hat, den wir am nächsten tag zur Arbeit
mitnahmen, um unseren Durst zu stillen.
Unser Aufseher hatte einen Stock, an dem sich noch kurz abgeschnittene Äste befanden. Wer seiner Meinung nach, nicht
ordentlich gearbeitet hat, bekam gleich Schläge auf den Rücken. Die weißen Aufseher wurden irgendwann durch Neger
ersetzt, die uns bedeutend besser behandelt haben. Wenn irgendetwas schief ging, haben sie nichts gesagt, nur gelacht.
In den übrig gebliebenen Wassertümpeln hatten sich noch einige Aale versteckt, die wir zu fangen versuchten, was uns
auch manchmal gelang. Wir mussten ihnen das Genick brechen, damit sie uns nicht entwischen konnten. Wenn die Franzosen
bemerkten das wir Aale hatten, wurden sie uns abgenommen. Gelang es uns aber, sie ins Lager zu bringen, dann haben wir
uns eine köstliche Malzeit zubereitet.
Um sicherzustellen dass niemand geflüchtet ist, wurden wir, wenn wir abends ins Lager zurückkamen, zuerst gezählt.
Diese Zählung wurde mehrmals wiederholt, weil die Wachmannschaften sich immer wieder verzählt haben. Als einer von uns
hin ging, ihnen sagte dass alle da sind, wollten sie es nicht glauben und haben uns vor dem stehen lassen, bis es ihnen
irgendwann einfiel. uns doch das Tor zuöffnen. Einmal, als wir von der Arbeit zurückgekehrt waren, standen wir bis 23
Uhr neben der Flagge, weil uns niemand das Tor geöffnet hat. Als wir dann doch irgendwie ins Lager kamen haben wir
festgestellt, dass das ganze Wachpersonal betrunken war und niemand im Stande uns das Tor zu öffnen.
Eines Tages waren wir wieder abends zur Parole angetreten, als ein älterer Herr mit seinem Hund, am Stacheldraht
entlang, spazieren ging. Weil der Hund, unterm Stacheldraht hindurch, zu uns kam, hat ihn einer geschnappt, ihm das
Genick gebrochen und unter seiner Jacke versteckt. Der Franzose hat nach seinem Hund gerufen und gepfiffen, aber alles
vergebens, der Hund war nicht aufzufinden. Die Kameraden haben ihm gleich das Fell über die Ohren gezogen, das Fleisch
gekocht und das Fell in die Latrine geworfen. Das Fleisch wurde umgehend verspeist.
Als wir am nächsten Tag von der Arbeit zurückkehrten, war im Lager der Teufel los. Wir mussten sofort antreten und
wurden gefragt, wo der Hund geblieben ist, der Gestern Abend, mit seinem Herrchen, am Zaun entlang spazieren ging. Als
sich niemand dazu bekannte, mussten wir weiterhin stehen bleiben, während die Wachmannschaften von Baracke zu Baracke
gingen und alles durchsuchten. In einer Latrine hat man dann das Fell gefunden, was uns ein furchtbares „Donnerwetter”
einbrachte und in den nächsten Tagen, nach der Arbeit, unter dem Kommando eines Oberfeldwebels, eine Stunde
nachexerzieren.
In Südfrankreich regnet es den ganzen Sommer nicht; die Bauern haben da keine Scheunen und das Getreide wir nur in
Schobern aufgestellt und dann umgehend gedroschen. Vom Oktober bis Dezember regnete es fasst jeden Tag in Strömen.
Gesät wird nur im Frühjahr und im Herbst, weil im Sommer alles vertrocknet. Es wird viel Wein angebaut und die
Steckrübe wächst den ganzen Winter. Neben den Weinreben wurde aus Schieferplatten ein Zaun aufgestellt, um dem Wein
einen optimalen Standort zu sichern. Die Bauernwagen hatten nur zwei Räder und waren nur mit einem Pferd bespannt, das
die ganze Balance des Wagens zu halten hatte. Trotzdem haben sie soviel aufgeladen wie wir auf einen Leiterwagen. Viele
Kameraden wurden den Bauern zur Arbeit ausgeliehen. Wenn ein Bauer einen Arbeiter gebraucht hat und es wurde gefragt,
wer sich in der Landwirtschaft auskennt, da haben sich alle gemeldet. Der Bauer konnte sich dann aussuchen, wen er
mitnehmen wollte.
Wenn wir durch die Stadt zur Arbeit gingen, haben verschiedene Leute Fallobst in die Abfalleimer gelegt. Wenn das von
den Kameraden bemerkt wurde, schwenkten viele aus der Reihe, um sich etwas mit zunehmen, was von den Wachmannschaften
nicht gern gesehen wurde. Viele Kriegsgefangene hatten keine Schuhe mehr, sie haben die Füße nur mit Lumpen bewickelt.
Eines Tages kamen Kameraden aus Norwegen, die nach Deutschland entlassen werden sollten. Mann hat sie jedoch ins Lager
gesteckt und zur Arbeit eingeteilt. In Norwegen hatten sie Kleider und Stoffe eingekauft, hatten volle Seesäcke und
sogar Karren auf 2 Rädern, weil sie ja in die Heimat entlassen werden sollten. Als wir morgens zur Arbeit rausgeführt
wurden standen sie schon vor dem Lager. Wir haben ihnen zugerufen, dass sie uns etwas abgeben sollen, weil ihnen ja
sowieso alles abgenommen wird, aber sie haben uns nur ausgelacht. Als sie ins Lager Kamen mussten sie ihr Gepäck
ablegen, wurden dann wo anders hingeführt und haben es danach nie wieder gesehen.
Durch die vielen Läuse, Flöhe und Wanzen die wie im Lager hatten, kam es bei verschieden Kameraden, an den
Einstichstellen, zu eiternden Entzündungen. Um dem vorzubeugen hat man uns mit einem Pulver, das in Frankreich
hergestellt wurde, aber bei den Parasiten keine Wirkung zeigte, eingesprüht. Erst bei der Anwendung eines Mittels
amerikanischer Herkunft, war alles über Nacht verschwunden.
Der Sonntag war arbeitsfrei. Dann kam ein katholischer, französischer Pfarrer, eskortiert von 3 Mann, mit
aufgepflanztem Seitengewehr ins Lager und hat Gottesdienst gehalten. Einen evangelischen Pfarrer gab es nicht, nur
einen Baptisten Prediger. Der wurde würdevoll eingekleidet, bekam ein großes Kreuz und hat jeden Sonntag in einer
extra dafür hergerichteten Baracke Gottesdienst gehalten. Wer Theologie studiert hatte und sich meldete, wurde zu
einem Seminar geschickt und konnte sein Studium fortsetzen. Glasbläser durften das Lager auch verlassen und ihrem
erlernten Beruf wieder arbeiten.
Wer sich freiwillig, für 5 Jahre, zum Dienst in der Fremdenlegion verpflichtet hat, das waren etliche unter uns, wurde
neu eingekleidet, bekam gutes Essen und Rauchwaren soviel er wollte. Nach einem Jahr wurden, nach und nach, die
Kranken und Körperbehinderten in die Sowjetische Besatzungszone entlassen. Eine Entlassung von Kriegsgefangenen, die
in den Westzonen oder jenseits von Oder und Neise zu Hause waren, war nicht vorgesehen. Die Österreicher wurden alle,
unabhängig von ihrem Gesundheitszustand entlassen.
Ich habe Briefe nach Hause geschrieben, aber die kamen nur bis Allenstein und wurden wieder zurück geschickt. Als eine
Kommission des Roten Kreuzes aus der Schweiz unser Lager besichtigt hat, haben wir uns beschwert, das wir als
Sanitätsdienstgrade, zur Arbeit gehen müssen. Daraufhin erging ein Befehl: Wer einen vom Roten Kreuz, ausgestellten
Ausweis besitzt, gehört einem internationalen Verband an und braucht nicht zu Arbeit gehen. Aus unserem Lager hatten
sich 20 Mann gemeldet, die daraufhin Freigang, in Begleitung von zwei französischen Wachsoldaten erhielten. Als wir
gefragt wurden wo wir hin wollen, entschlossen wir uns, einen Soldatenfriedhof, auf dem unsere verstorbenen Kameraden
beerdigt waren, zu besuchen.
Da der Untergrund in dieser Gegend aus Felsen bestand, wurden die Gräben, in denen die Toten in selbst gezimmerten
Kisten nebeneinander gestellt wurden, mit Hilfe von Dynamit ausgehoben. Ein Leichenwagen, mit einem Pferd bespannt,
das mit einer schwarzen Decke abgedeckt war, wurde von einem Kutscher in angemessener Kleidung, gefahren. Der Wagen
konnte gleichzeitig 4 Kisten transportieren. Wenn wir von der Arbeit kommend, dem Leichenwagen begegneten, wurde
gehalten und mit einer Schweigeminute der Toten gedacht, bis der Wagen vorbei war. Die Zivilbevölkerung verharrte auch
im Schweigen, mit abgenommener Kopfbedeckung.
Ein Kamerad, der in Krottorf, Kreis Oschersleben, bei Magdeburg, zuhause war, sagte bei seiner Entlassung zu mir:
Sollte ich das Glück haben, meine Entlassungspapiere zu erhalten ohne eine Bleibe vorzuweisen, dann soll ich Krottorf
als Heimatadresse angeben. Auf der Krankenstube habe ich angegeben, dass sich noch ein Schrapnellsplitter, aus dem
Ersten Weltkrieg, in meiner Kreuzbeingegend befindet, er zwar verkapselt ist, aber immer noch Beschwerden verursacht.
Daraufhin wurde ich zur Entlassung vornotiert. Als bekannt wurde das ein Rückkehrertransport in die sowjetische
Besatzungszone zusammengestellt wird, habe ich mich sofort gemeldet und wurde für ein Entlassungslager in Angoleme
vorgesehen. War das eine Freude, als uns mitgeteilt wurde, wann der Rücktransport stattfindet.
In unserem Lager waren noch 2 Kameraden aus dem Kreis Ortelsburg: Ein Gustav Lumma aus Leynau und ein Alfred Moritz
aus Groß Schöndamerau. Sie mussten noch zurückbleiben und haben mir den Auftrag erteil, die Angehörigen in der Heimat
zu grüßen und ihnen die Anschrift mitzuteilen. Als wir im Entlassungslager ankamen, fragte man uns nach unserer
Heimatanschrift. Dann wurden die Entlassungspapiere angefertigt. Es wurde uns auch ein Barscheck, für die in Frankreich
geleistete Arbeit ausgehändigt, den wir bei jeder Kasse in Deutschland einlösen könnten. Ich habe ihn bis zum heutigen
Tage nicht einlösen können, obwohl ich irgendwann in der Zeitung gelesen habe, das Verrechnungschecks die den aus
französischer Kriegsgefangenschaft Entlassenen, ausgehändigt wurden, einzulösen sind.
Wir kamen zuerst nach Saar Elbe, dann in die Nähe der Zonengrenze zu Thüringen. Hier mussten wir 2 Tage warten, weil
aus der sowjetischen Besatzungszone keine Eisenbahnwagen bereitgestellt wurden. Angesichts dessen, das der Russe beim
letzten Transport die aus Frankreich kommenden Wagen kassiert und nicht mehr herausgeben wollte, bestand der Franzose
jetzt darauf, seine Wagen sofort wieder mitzunehmen. Als der sehnsüchtig erwartete Zug endlich eintraf, durften wir
umsteigen und kamen, immer noch hinter Stacheldraht, nach Erfurt. Von dort weiter ins Quarantänelager nach Prätsch an
der Elbe.
Unter Androhung von Strafe war es verboten das Lager zu verlassen, doch der Hunger zwang uns dazu, in den umliegenden
Dörfern um Lebensmittel zu betteln. Man drohte uns damit, dass Zuwiderhandlungen, mit einer 14-tägigen Verlängerung der
Quarantäne geahndet werden. Der Roggen war schon reif und wir haben, auf den umliegenden Feldern, die Ähren abgerissen,
das Korn, zwischen 2 Steinen zu Mehl zerrieben, um daraus eine Suppe zu kochen, denn von dem was unsere Lagerküche uns
bieten konnte, war es nicht möglich zu überleben. Als der Eigentümer bemerkte wer seine Roggenähren entwendet hat, kam
er ins Lager, gerade zu dem Zeitpunkt als wir mit dem Mahlen beschäftigt waren. Der Lagerkommandant, bei dem er sich
beschwerte, drohte uns zu bestrafen, wenn wir unsere „Rauzüge” nicht unmittelbar einstellen würden. Wir sagten ihm er
solle uns heimfahren lassen, da wir doch lange genug hinter Stacheldraht gesessen hätten.
Endlich wieder in Freiheit
14 Tage nach unserer Ankunft wurden uns Entlassungspapiere ausgehändigt, sowie auch Fahrscheine
zum den, von uns angegeben Heimatorten. So kam ich nach Krottof, Kreis Oschersleben, zu meinem ehemaligen
Kriegskameraden, bei dem ich einen Tag geblieben bin. Er hatte mir schon eine Stelle bei einem Bauern besorgt, der 70
Jahre alt und kinderlos war. Zum Hof, den er mit seiner Ehefrau bewirtschaftet hat, gehörten 36 Morgen Land, 2 Ochsen
und 3 Kühe. Das Ackerland bestand aus 17 Parzellen und sicherte mir einen Arbeitsplatz.
Jetzt, da ich ein Dach überm Kopf und genug zu essen hatte, fing ich an nach dem Verbleib meiner Familie zu forschen.
Bei meinem letzten Heimaturlaub hatte ich mit meiner Frau verabredet; falls wir uns in den Kriegswirren verlieren
sollten, unsere Kontaktadresse, die meiner Quartiersleute in Burscheid, Kreis Opladen, sein sollte. Ich habe zuerst
nach Rohmanen geschrieben, aber leider keine Antwort erhalten. Dann habe ich nach Burscheid geschrieben, und siehe, -
bei denen lag schon eine Anfrage meiner Frau vor, die nach mir gefragt, und ihre jetzige Anschrift hinterlassen hatte.
Ich habe dem Bauern erzählt dass meine Frau sich zurzeit, auf einem Gut, in Alt Steinhorst, im Kreis Rostock, befindet.
Er war sofort bereit uns ein Zimmer zur Verfügung zu stellen, wenn ich meine Frau nach Krottorf rüberholen wollte. Das
habe ich Ihr mitgeteilt und sie war sofort bereit ihren Wohnsitz nach Krottorf zu verlegen, denn sie wohnte dort in
einem kleinen Stübchen unterm Dach.
Im Herbst, als die Feldarbeit so ziemlich erledigt war, bin ich nach Alt Steinhorst gefahren, um meine Frau und meinen
Sohn Kurt, sowie meinen Sohn Manfred, den ich noch nicht kannte, weil er erst nach der Flucht, am 31. Januar, in Groß
Lüssewitz, geboren wurde, nach Krottorf zu holen. Meine Frau hatte schon Holz für den Winter besorgt und vom Gut, auf
dem sie im Sommer gearbeitet hatte, Mehl und Kartoffeln bekommen. Wir haben das Mehl und andere Habseligkeiten in
Kisten verpackt. Das Holz haben wir einem Bauern gegeben, der uns und unser Gepäck, mit seinem Pferdewagen, zum 14
Kilometer entfernten Bahnhof, nach Ribnitz gebracht hat. Wir sind auch gut in Krottorf angekommen, aber als wir am
nächsten Tag, unsere Kisten vom Bahnhof abholen wollten, haben wir zwar die Kisten vorgefunden, doch der gesamte Inhalt
wurde während der Bahnfahrt entwendet. Die Bahnstation in Krottorf hat die Vorkommnisse zur Kenntnis genommen und
protokolliert, aber unsere Sachen haben wir nie wieder gesehen und mussten wieder bei Null anfangen.
Im Winter musste ich auf der Genossenschaft, unentgeltlich, für die Russen Weizen einsacken. Ich hatte versucht eine
Arbeit als Zimmermann zu bekommen, doch auf dem Arbeitsamt wurde mir gesagt, ich bin Ladwirt und muss auf der
Landwirtschaft arbeiten. Da in den ersten Nachkriegsjahren, auch in der sowjetisch besetzten Zone Arbeitsplätze knapp
waren, mussten auch solche, die einen anderen Beruf erlernt hatten, jede zumutbare Arbeit annehmen. Aus der Heimat
erhielt ich einen Brief, von meiner dort noch lebenden Mutter. Sie schrieb das sie mich noch einmal sehen wollte und
ich sollte doch wieder zurück kommen; Unser Hof wäre nicht von Polen besetzt und sie wäre ganz alleine, weil der Vater
nach dem Durchzug der Front von den Russen erschlagen wurde. Daraufhin habe ich dem polnischen Konsulat in Magdeburg
mitgeteilt, dass ich in Rohmanen eine Landwirtschaft besitze, und um eine Einreisegenehmigung gebeten.
Nach 2 Monaten erhielt ich eine Postkarte, mit der Mitteilung, ich sollte mich persönlich beim Konsulat vorstellen.
Nach Aufnahme meiner Personalien, wurde mir gesagt, das ich benachrichtigt werde wenn mein Antrag genehmigt wird. Ende
Juli 1947 erhielten wir die Einreisegenehmigung nach Ostpreußen, das jetzt unter polnischer Verwaltung stand. Wir
mussten zuerst zum polnischen Konsulat in Berlin-Lichterfelde, wo wir umgeben von einer Trümmerlandschaft, gewartet
haben, bis alle Untersuchungen und Formalitäten erledigt waren.
“ Wieder zurück in Ostpreußen.”
Der schwere Wiederaufbau nach dem Kriege
Dann fuhren wir über Frankfurt/Oder, Posen, Thorn, Allenstein, nach Ortelsburg, wo wir am 2. August 1947 ankamen. Mit
einem zweirädrigen Karren, den ich mir von einem noch in Ortelsburg lebenden Bekanten ausgeliehen hatte und meinem
Sohn Manfred im Kinderwagen fuhren wir nach Rohmanen. Meine Mutter war inzwischen verstorben und auf dem Hof war nur
meine, inzwischen aus Russischer Gefangenschaft wiedergekehrte Schwester, Frieda Pelkowski.

Es war alles ausgeplündert; kein Vieh, keine Maschinen und der ganze Hof mit kniehohem Graß überwachsen. Nur schmale
Trampelpfade, vom Haus zum Holzschuppen und zum Klo, durchkreuzten das satte Grün. Ich habe das Gras auf dem Hof mit
einer Sense, die ich noch gefunden habe, abgemäht, damit der Hof nicht so verwahrlost aussah. Am nächsten Tag habe ich
mich bei der Polizei in Ortelsburg angemeldet, wo ich auch ein Startgeld von 100 Zloty erhielt und Gepäckstücke, die
ich in Krottorf aufgegeben, am Bahnhof abgeholt. Es hat mich sehr gewundert das, das Gepäck überhaupt angekommen ist.
Da man von der Landwirtschaft nicht Leben konnte, habe ich mich in den nächsten Tagen, bei der jetzt polnischen Bahn,
um Arbeit beworben und wurde auch angenommen. Wenn wir unseren Monatslohn bekamen, saß immer einer am Tisch, der von
uns 100 Zloty für den Wiederaufbau von Warschau verlangte. Wenn ich dran war, riefen die Anderen, ich hätte Warschau
zerstört und müsste deshalb 200 Zloty abgeben. Nach 3 Jahren kam eine Verfügung, die besagte, dass wer länger als 1
Jahr bei der Bahn beschäftigt ist, angestellt werden muss. Um diese Bestimmung zu umgehen hat man mich entlassen und
eine Woche später wieder eingestellt.
Als ich vor Ablauf des nächsten Jahres, aus dem gleichen Grunde wieder entlassen wurde, habe ich mich bei der
Stadtverwaltung in Ortelsburg(jetzt Szczytno)beworben, wo ich zuerst im Gaswerk als Heizer und später auf Baustellen
als Zimmermann gearbeitet habe. Wir haben durch den Krieg beschädigte Häuser repariert, in den ehemals touristischen
Zentren einige Ausbesserungen an den Einrichtungen durchgeführt, eine Ziegelei wieder in Betrieb gesetzt und andere
anfallende Arbeiten verrichtet. Im Dach des Rathausturmes war während der Kämpfe eine Granate eingeschlagen, die, die
Dachlatten und die Verschalung zerstört hatte. Da wir, unter schwersten Bedingungen, den Schaden repariert haben,
wurde uns eine Höhenzulage versprochen, die wir aber nicht bekommen haben.
Aus Verärgerung darüber habe ich bei der Stadtverwaltung gekündigt und bei einer Wiederaufbaufirma unter der Leitung
von Bauingenieur Laskowski wieder angefangen, wo ich bis 1954, als Zimmermann beschäftigt war. Ab da habe ich mich
nur um meinen Hof gekümmert, der wegen meiner Arbeitsstellen, gezwungenermaßen, sehr vernachlässigt wurde. Als wir
1947 zurückkamen, brachten wir unseren Sohn Manfred noch im Kinderwagen. Den hat meine Frau zum Markt gebracht,
verkauft, und dafür eine Ziege erworben, die dank guter Pflege, uns täglich mit 4 Liter Milch versorgte. Das war der
erste Baustein zum Wiederaufbau, unserer durch den Krieg zerstörten, und danach ausgeplünderten Landwirtschaft.
Während meiner Arbeit bei der Bahn haben wir uns eine Kuh gekauft, die nach einem halben Jahr, wegen nicht bezahlter
Grundsteuer, vom Gerichtsvollzieher gepfändet wurde. Man hat uns die Kuh weggenommen und bei einem Arbeiter, der in
der Ernst-Mey-Straße in Ortelsburg wohnte und sie wegen nicht vorhandener Futtermittel, nur mit Kartoffelkraut
gefüttert hat, untergestellt. Als ich bei der Bahn meinen Monatslohn bekommen habe, bin ich zur Gmina gegangen, habe
eine Rate angezahlt und durfte dann die Kuh wieder mit nach Hause nehmen. Durch die schlechte Ernährung war die Kuh
stark abgemagert und lieferte nur die Hälfte der ursprünglichen Milchleistung.
Später habe ich ein Pferd auf Abzahlung bekommen, das 140.000 alte Zloty gekostet hat. Die Stute war schwach und unser
Feld sehr hügelig, so dass man nur bergab pflügen konnte, was sehr beschwerlich war, bergauf ging es immer im Leerlauf.
Später habe ich die schweren Böden mit dem Traktor umpflügen, und in den letzten Jahren auch mit dem Binder mähen
lassen. Von der Stute habe ich 2 schöne Fohlen gezogen; ein davon habe ich bei der Ausreise in die Bundesrepublik
mitgebracht und bei der Viehverwertungs-Genossenschaft in Göttingen verkauft. In den ersten Nachkriegsjahren als noch
wenig Land bestellt wurde, breiteten sich auf den nicht beackerten Flächen, Wildkräuter aus. Disteln und andere
Schnellwachsende, erreichten manchmal eine Höhe von 2 Meter, besonders auf den schweren Böden.
Es hat viel Schweiß gekostet ehe man den Acker soweit hatte, das er auch befriedigende Erträge abwarf. Die
Währungsreform von 1950, hat unser weiniges Geld das wir schon gespart hatten, wieder vernichtet. Ich hatte 2 Pferde,
1 Fohlen, 2 Kühe und Schweine, als ich wieder aufgefordert wurde nicht bezahlte Grundsteuern nachzuzahlen. Als ich
nicht bezahlen konnte, hat der Vollziehungsbeamte, ein Fohlen, eine Kuh und ein Schwein gepfändet. Es gelang mir jedoch
nach längeren Verhandlungen, ohne größere Verluste, alles zu regeln. Später kam eine Verfügung, die besagte; wenn
jemand auf seinem Hof nur eine Kuh und ein Pferd hatte, durften sie nicht gepfändet werden. Einige haben ihr Inventar
dieser Verfügung angepasst und dadurch die Zahlung von Grundsteuer umgangen.

Wer seine Steuern pünktlich bezahlt und sein Kontingent an landwirtschaftlichen Produkten fristgerecht abgeliefert hat,
der konnte seine, darüber hinaus erwirtschafteten Produkte zu marktgerechten Preisen verkaufen. Für eine hochtragende
Sterke, mindestens 400 kg schwer, die auf ein staatliches Gut verkauft wurde, konnte man bis zu 12000 Zloty bekommen.
Unsere Böden waren kalkarm, doch durch den Einsatz von Kalk und Kunstdünger konnte man den Ertrag erheblich steigern.
Kalk und Kunstdünger konnte man bei der Genossenschaft(GS) bestellen, der dann auch direkt auf den Hof geliefert wurde.
Kalk wurde geliefert und gleich auf dem Feld ausgestreut. In den 1960ger Jahren waren alle Ackerflächen der Rohmaner
Felder bestellt.
Die nach dem Krieg zurückgebliebenen deutschen Bauernfamilien, aber auch die Polen, die während des Krieges beim Bauern
in Deutschland gearbeitet haben, versuchten mit teils bescheidenen, oder auch zusammen gesuchten, landwirtschaftlichen
Geräten, die bäuerlichen Betriebe aufrecht zu erhalten. Nach den schweren Anfängen in den ersten Nachkriegsjahren
erzielten sie schließlich einen beachtlichen Erfolg, der sich in wogenden Kornfeldern, sowie in grünen Wiesen auf
denen gut genährtes Vieh weidete, widerspiegelte.
Ein schwerer Einschnitt in meinem Leben.
Am 11. Mai 1956 verstarb nach langer schwerer Krankheit, meine liebe Ehefrau Marta Rattay,
geborene Brosch. Ein Jahr zuvor war schon mein Schwiegervater Gottlib Brosch verstorben. Die schweren Bedingungen
unter denen wir nach Kriegende leben mussten, haben ihrer bereits angegriffenen Gesundheit sehr zugesetzt. Sie
verstarb mit 44 Jahren und hinterließ in unserer Familie eine große Lücke, die nicht mehr zu Überbrücken war. Wir
haben sie unter großer Anteilnahme der noch verbliebenen deutschen Bevölkerung zu Grabe getragen und auf dem Rohmaner
Friedhof beigesetzt. Die Arbeit die sie sonst verrichtet hatte fiel jetzt auf mich und meine Söhne zurück. Meine
Schwester Frieda Pelkowski half auch wo sie nur konnte. Wir waren auf die Unterstützung durch Nachbarn und Freunde
angewiesen, die uns immer wenn es nötig war, tatkräftig unterstützt haben. Im laufe der Zeit haben wir wieder zum
Alltag zurück gefunden, haben sie noch etliche Jahre auf dem Friedhof besuchen können, bis wir, bedingt durch unsere
Ausreise uns endgültig von ihr trennen mussten.
Der endgültige Abschied von Ostpreußen
Ab 1956 begannen, durch die Vermittlung des Deutschen Roten Kreuzes, die ersten Ausreisen in die
Bundesrepublik Deutschland. Zuerst waren es Kinder die zu ihren Eltern ausreisen durften, Familien deren Väter aus der
Kriegsgefangenschaft in den Westen Deutschlands entlassen wurden und andere durch den Krieg getrennte
Familienangehörige. Ab 1960 erhöhte sich die Zahl der Ausreisewilligen aus dem polnisch besetzten Ostpreußen. Es setzte
sich die Überzeugung durch, dass unsere Angestammte Heimat, uns für die Zukunft keine Perspektive mehr bieten konnte.
Meistens wurden die Anträge, die wir an die Passabteilung in Allenstein stellen mussten, um einen Ausreisepass zu
bekommen, negativ beschieden. Nach mehrmaligen Versuchen gelang es dann doch, diese begehrte Ausreiseberechtigung in
Empfang zu nehmen. Die Enttäuschung der Zurückgebliebenen war groß, wenn wieder mal Verwandte oder Nachbarn, den Weg
in Richtung Bahnhof einschlugen.
Um einen Reisepass zu beantragen, musste man zuerst eine Einladung von Verwandten aus der Bundesrepublik vorlegen, in
der, diese sich verpflichten mussten, für Unterkunft und Verpflegung der Eingeladenen zu sorgen. Diese Einladung
musste durch ein Amt in der Bundesrepublik beglaubigt werden. Außerdem mussten die Kosten für die Bahnfahrt, ab
polnischer Grenze, bis zum Zielort, beim polnischen Reisebüro ORBIS, in Warschau, in DM eingezahlt werden.
Unseren ersten Ausreiseantrag haben wir 1964, bei der Kommandantur der polnischen Miliz in Allenstein eingereicht, der
nach einer gewissen Zeitspanne, ohne eine uns verständliche Begründung zu nennen, abgelehnt wurde. Gegen diese
Ablehnung wurde ein Widerspruch zugelassen, den wir sofort einreichten. Nach einer weiteren Zeitspanne erhielten wir
wieder eine Ablehnung, gegen die kein Widerspruch mehr zulässig war. Wer seine Ausreiseabsicht nicht aufgeben wollte,
musste einen neuen Antrag stellen. Es gab Familien die schon 10 Mal einen Ausreiseantrag gestellt hatten und immer
wieder abgewiesen wurden. Da meine Söhne, nicht die Absicht hatten in Rohmanen zu bleiben und ich nach 2 Weltkriegen,
an denen ich teilgenommen, die schwere Arbeit auf der Landwirtschaft, nicht aus eigener Kraft schaffen würde, haben wir
1966 wieder einen Antrag gestellt, der prompt abgelehnt wurde. Der Widerspruch auf diese Ablehnung wurde auch negativ
beantwortet, so dass wir 1968 wieder einen Antrag eingereicht haben.
Weil das Passamt in Allenstein lange nichts von sich hören ließ, hegten wir schon die Hoffnung das es jetzt klappen
würde und waren sehr enttäuscht als wieder eine Absage kam. In der Zwischenzeit sind viele Nachbarn und Bekannte aus
Rohmanen, sowie aus der näheren Umgebung, ausgereist und das Häuflein der noch verbliebenen Deutschen, wurde immer
kleiner. Die Motivation, die uns in früheren Jahren, über so manche schwierige Lage hinweg geholfen hat, ist einer
hoffnungslosen Resignation gewichen. Man war davon überzeugt, dass unser Leben, in unser Angestammten Heimat, keine
Zukunftsperspektive mehr haben konnte und wenn wir keine Ausreisegenehmigung bekommen, wir eines Tages die letzten
Deutschen in der ganzen Umgebung sein werden.
Die Ausreise-Heimat ade
Wir hatten die Hoffnung schon aufgegeben, als am 30. April 1969, der Briefträger unseren Hof
betrat und mir einen Brief überreichte, in dem uns das Passamt in Allenstein mitteilte, dass unsere Ausreise in die
Bundesrepublik Deutschland, genehmigt worden ist. Wir müssten, nach Aushändigung der Reisepapiere, den Geltungsbereich
der Volksrepublik Polen, innerhalb von 3 Monaten verlassen. Wir waren zuerst geschockt, über den Hinweis, das wir
unsere Heimat in 3 Monaten verlassen müssen, aber dann stellte sich die Zukunftsperspektive wieder ein und wir gingen,
wie von einem schweren Ballast befreit und gut gelaunt unser weiteren Tätigkeit nach.
Als der Briefträger unseren Hof betrat, waren ich und mein Sohn Kurt gerade dabei eine Fuhre Mist zu laden. Wir hatten
den Wagen gerade halb geladen und haben nach der frohen Kunde nicht mehr weiter gemacht, sondern die Pferde vorgespannt
und den Mist aufs Feld gefahren, damit wir den Wagen für alle Fälle frei hatten. Das war die letzte Tätigkeit für
unsere Landwirtschaft in Ostpreußen.
Die Nachricht von unserer Ausreise verbreitete sich, ohne dass wir darüber gesprochen haben, wie ein Lauffeuer.
Alsbald kamen Leute aus dem Dorf, die sich für das Vieh und für diverse Landwirtschaftliche Geräte interessierten.
Etliche wollten bestimmte Sachen sofort kaufen, andere haben nur zurücklegen lassen und wollten später kommen und
bezahlen, haben es aber dann doch nicht genommen.

Wenn man eine Landwirtschaft hatte, konnte man 2 Pferde, 2 Rinder, 3 Schweine, 5 Schafe und 10 Hühner, in einem
geschlossenen Viehwaggon, in die Bundesrepublik mitnehmen. Jeden Tag war man unterwegs, von einer Behörde zur Andern.
Die Aushändigung der Reisepapiere erfolgte nur nach Vorlage bestimmter Bescheinigungen: Es mussten alle Steuern bezahlt
sein, das Kontingent landwirtschaftlicher Erzeugnisse musste abgeliefert sein, je eine Bescheinigung vom Katasteramt
und vom Notar musste vorgelegt werden, das man dem polnischen Staat das Grundstück abgetreten hat. Die Gebühren für
die notarielle Beglaubigung mussten wir selbst bezahlen. Wenn man alle Bescheinigungen beisammen hatte, bekam man bei
der Kreisverwaltung eine Gesamtbescheinigung. Mit dieser Bescheinigung konnte man nach Allenstein, zur
Polizeikommandantur fahren, wo man nach dem schriftlichen Verzicht auf die polnische Staatsangehörigkeit, einen
Reisepass ausgehändigt bekam, der den Inhaber zum Grenzübertritt berechtigte, aber nicht zur Wiedereinreise.
Wir haben 2 Pferde, eine Sterke, einen Ochsen, 5 Schafe, 2 Schweine und 10 Hühner mitgenommen. Über die Schutzimpfung
der Rinder musste man eine, vom Kreistierarzt beglaubigte Bescheinigung vorweisen. Ich habe 5 Schafsböcke gekauft, die
ich in der Zwischenzeit, hinter der Scheune, zum Weiden angekettet hatte. Einer von denen hat sich losgerissen und
seinen Nachbarn getötet. Das Fleisch konnten wir noch verkaufen, mussten aber dafür einen anderen Schafsbock kaufen.
Innerhalb von 3 Monaten mussten wir alles regeln und zwei Tage vor der Abfahrt einen Eisenbahnwagen, bei der
Eisenbahndirektion in Allenstein bestellen. Reservierungen bei den polnischen Behörden waren meist immer mit
Schmiergeld verbunden, weil man sonst nie sicher sein konnte dass diese Vereinbarungen auch eingehalten werden. Schon
2 Wochen vor unserer Abfahrt, gab es in Ortelsburg keine alkoholischen Getränke zu kaufen. Meine Söhne mussten mit dem
Motorrad die umliegenden Dörfer abfahren, damit wir für die Reise einen Vorrat anlegen konnten; denn Wodka war zu der
Zeit, in Polen, wie eine zweite Währung.
Am 25. Juli haben wir zusammen, mit meinem Neffen Siegfried Brosch, unseren sonstigen Hausrat, der in Kisten verpackt
war, in einen Eisenbahnwagen, auf dem Allensteiner Bahnhof verladen. Alles musste zuerst durch den Zoll, wo die
Federbetten gewogen wurden und über das erlaubte hinausgehende Kissen, verzollt werden mussten. Dasselbe galt auch für
Fleisch und Räucherwaren.
Am 26. Juli, unserem Verladetag, kam der Eisenbahnwagen aus Allenstein, erst um 11 Uhr auf dem Ortelsburger Bahnhof an.
Die Rinder hatten wir zu Fuß, zum Bahnhof gebracht; Schweine, Schafe und Hühner auf dem Pferdewagen. Im Eisenbahnwagen
mussten, mit Hilfe von Brettern und Bohlen, Boxen für die verschiedenen Tiere erstellt werden. Jedes Pferd und jedes
Rind in eine Bucht. Die Schafe zwischen die Pferde, die Schweine zwischen die Rinder und die Hühner in einem Käfig,
unter der Decke über den Rindern. Die Hühner hatten unterwegs Eier gelegt, somit hatten wir jeden Tag frische
Verpflegung. Bei der Fahrt im Viehwagen, begleitete mich mein Sohn Manfred. Als die Lokomotive nahte, um den Wagen
abzuholen, wurden noch schnell die restlichen Sachen hinein geworfen und so mache Abschiedsträne rollte dann die Wange
hinab.
Unsere Nachbarn, Deutsche und Polen, halfen uns beim Verladen des lebendigen Inventars. Jetzt erinnerte ich mich
plötzlich, an die oft auch schönen, Ereignisse der letzten 22 Jahre. Einer Zeit, in der das Zusammenleben von
Deutschen und Polen, von Jahr zu Jahr, besser wurde. Man half sich beim einbringen der Getreideernte, beim Dreschen
des Getreides, bei der Kartoffelernte und bei anderen Arbeiten, wo viele Menschen zupacken mussten. Es war eine
Dorfgemeinschaft, in schweren Zeiten geboren; jeder half jedem wenn Hilfe nötig war. Es wurde mir plötzlich bewusst,
das jetzt ein Lebensabschnitt zu Ende ging, zu dem ich nicht mehr zurückkehren konnte. Unsere Existenzgrundlage war
jetzt ein Eisenbahnwagen auf einem Schienenstrang, dessen Ende irgendwo in weiter Ferne lag. Obwohl, von langer Hand
vorbereitet, war dieser Moment voller Wehmut.
Doch als der Zug sich plötzlich, in Bewegung setzte, war ich sofort wieder in der Gegenwart. Menschen, mit denen man
Jahrzehnte lang, in gutem Einvernehmen zusammen gelebt hat, blieben plötzlich am Bahnsteig zurück und die Entfernung
zwischen ihnen und mir vergrößerte sich mit jeder Sekunde, bis sie letztendlich aus meinem Blickfeld verschwanden.
Es war ein heißer Julitag, als wir unsere Reise gen Westen antraten. Für die Schweine, die besonders unter der Hitze
zu leiden hatten, haben wir 10 Flaschen Essig mitgenommen und sie von Zeit zu Zeit besprenkelt, damit sie besser atmen
konnten. Für die anderen Tiere war reichlich Heu und Hafer vorhanden. Eine großes Fas und zwei Milchkannen waren mit
Wasser gefüllt, die wir auf den an der Strecke liegenden Bahnstationen, bei Bedarf wieder nachgefüllt haben.
Da der Kreistierarzt nicht in seinem Büro war, konnten wir die Impfbescheinigung für das Vieh, nicht rechtzeitig
herbeischaffen. Der Zug setzte sich in Bewegung und die Bescheinigung war immer noch nicht da. Als die Bescheinigung
dann eingetroffen, wir aber schon unterwegs waren, ist mein Sohn Kurt mit dem Motorrad hinterher gefahren und hat uns
in Passenheim, wo der Zug noch andere Wagen angehängt bekam, die Impfbescheinigung übergeben. Wir waren sehr froh das
er es noch geschafft hat, denn in solch einer Situation fühlt man sich sicherer wenn man alle Bescheinigungen bei sich
hat. Auf der Rückfahrt, mit dem Motorrad hatte er noch eine Panne, musste das Motorrad stehen lassen und per Anhalter
nach Hause fahren. Am nächsten Tag kam er mit Siegfried Deptolla, der das Motorrad wieder flott machte und brachte es
wieder nach Rohmanen zurück.
Die Fahrt mit dem Viehwagen, gen Westen
Von Ortelsburg bis Allenstein(45 km) hat unser Zug 4 Stunden gebraucht, weil auf jedem Bahnhof
gehalten wurde, um neue Wagen anzuhängen. Nachdem wir in Allenstein angekommen waren, kam ein Rangierer und fragte
nach unserem Ziel. Als wir ihm mitteilten, das wir in die Bundesrepublik Deutschland wollen, sagte er nur: „In 10
Minuten fährt ein Zug los. Wenn ich von euch 500 Zloty und einen Liter Wodka bekomme, werde euch sofort anhängen,
andernfalls kommt ihr auf ein Nebengleis und müsst dann auf den nächsten Zug warten. Es blieb uns nichts anderes übrig
als seiner Forderung nachzukommen, denn über derartige Erpressungen hat man bereits von Anderen, die vor uns ausgereist
sind, gehört. Wir wurden auch sofort angehängt und fuhren dann die ganze Nacht, an Osterode, und Thorn vorbei bis
Gnesen. Dort wurde wieder rangiert.
Von einer Anhöhe wurden die einzelnen Wagen auf verschiedene Gleise verteilt und zu neuen Zügen zusammengestellt. Der
Aufprall der ungebremsten Wagen erzeugte eine derartige Erschütterung, dass manche Bretter an den Boxen geborsten waren.
Von Gnesen ging es dann in einem Zuge durch bis zur Grenzstation Reppen(Rzepin). Dort mussten wir zum Zollamt, wo
unsere Ausfuhrpapiere durch die Zollbeamten, und durch einen Tierarzt geprüft wurden. Bis Reppen(Rzepin) haben wir für
den Eisenbahnwagen 900 Zloty bezahlt; hier mussten wir noch einmal 650 Zloty bezahlen. Bei der Wagenkontrolle erklärte
uns ein Bahnbeamter das unser Wagen, sich nicht für den internationalen Transport eignet und wir deshalb den Inhalt in
einen Anderen umladen müssen, der irgendwann, auf dem Nebengleis bereitgestellt wird. Nach langer Verhandlung, sowie
einer Zulage von 500 Zloty und einem Liter Wodka haben wir ihn davon überzeugt, das der Wagen sich doch für die
Weiterfahrt eignet.
In der Nacht war Schichtwechsel, der unseren Wagen wieder abgehängt hat, weil er angeblich von der Reichsbahn der DDR,
wegen technischer Mängel nicht weiterbefördert würde. Wir mussten unsere Verhandlung vom Vorabend wiederholen, die mit
der Zusage endete, dass wir am frühen Morgen, über die Grenze auf DDR Gebiet, gebracht werden. Um 5 Uhr morgens kam
eine Lokomotive, die uns den letzten Abschnitt bis über die Grenze bringen sollte. Als der Zug hat noch einmal anhielt,
kamen polnische Grenzbeamte und Soldaten in den Wagen. Sie durchsuchten ihn und fragten, ob wir noch polnisches Geld
oder einen Grundbuchauszug bei uns hätten. Wir zeigten ihnen 800 Zloty, die sie uns, nach Ausstellung einer Quittung
über 500 Zloty, abnahmen. Die Grundbuchauszüge habe ich, im Stroh versteckt, dem Ochsen vor die Füße gelegt. Falls
jemand da suchen sollte, hätte ich gesagt, das das Tier bösartig veranlagt ist, und ich für seine Sicherheit nicht
garantieren könnte, deshalb sollte er vorsichtig sein.
Als die Grenzkontrolle den Zug verlassen hatte, setzte sich die Lokomotive wieder in Bewegung und überquerte nach
kurzer Zeit die Oderbrücke. Auf einer eingezäunten Fläche, jenseits der Grenze, hat man uns abgestellt hat und die
Lokomotive fuhr zurück auf polnisches Gebiet. Vor und hinter uns waren die Tore verschlossen. Auf den Wachtürmen,
links und Rechts von uns, standen Posten mit einem Gewehr im Anschlag. Vier Grenzbeamte der DDR, jeder mit einer
Leiter in der Hand, sowie ein Schäferhund, kamen zu unserem Wagen. Sie öffneten die Schiebetüre, stellten die Leiter
davor und ließen den Hund in den Wagen springen, der nur etwas herum schnupperte und wieder heraussprang. 2 Beamte
haben dann anschließend, die Papiere kontrolliert und das Inventar gezählt.
Nach einiger Zeit wurden wir an einen Güterzug der Reichsbahn angehängt und fuhren von Frankfurt an der Oder, vorbei
an Berlin, Ellingen und Nordhausen, über die Grenze zur Bundesrepublik bis Herzberg. Hier hat ein Zollbeamter der
Bundesrepublik, die Formalitäten erledigt und ein Tierarzt die Pferde, Rinder und Schweine gründlich untersucht. Ich
musste ihnen die Mäuler aufhalten und die Füße hochheben. Danach hat uns die Lokomotive zu einer Wasserzapfstelle
gebracht, wo wir die Tiere tränken und unsere Behälter mit Wasser auffüllen konnten. Anschließen fuhren wir über
Northeim nach Göttingen, zur Viehverwertungsgenossenschaft, die zuvor von unserer Ankunft in Kenntnis gesetzt wurde.
Der Ochse, die Sterke und die Schweine wurden, in Göttingen zum Schlachthof gebracht; die Pferde kamen nach Hannover
und die Schafsböcke nach Kassel. Wir waren mit dem Viehtransport 5 Tage unterwegs; hatten so manche Klippe umschifft
und Schwierigkeiten gemeistert, die im normalen Leben nicht vorkommen.
Wir wurden mit einem PKW, ins Durchgangslager Friedland bei Göttingen gefahren, wo mein Sohn Kurt, meine Schwester
Frieda Pelkowski und Siegfried Brosch mit Familie, die am 30 Juli, um 14 Uhr, von Warschau mit dem Zug abgefahren, und
hier am 31. Juli in den Morgenstunden eingetroffen sind, schon auf uns gewartet haben. In Friedland hat man uns mit
Familie Siegfried Brosch in einem Raum untergebracht, wir wurden registriert und erhielten 20 DM Überbrückungsgeld,
pro Person. Da wir erst am Freitag in Friedland eingetroffen sind, mussten wir hier über das Wochenende bleiben,
obwohl die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der Regel nur 3 bis 4 Tage beträgt.
Um einen Antrag für die Ausreise stellen zu können, brauchten wir eine Einladung von in der Bundesrepublik lebenden
Verwandten. Diese Einladung hat uns mein Bruder, Ernst Rattay, aus Ingelheim am Rhein zugeschickt. Ingelheim liegt im
Bundesland Rheinland-Pfalz. Das Geld für die Bahnfahrt, hat uns, Frieda Schellin, geb. Nickel, aus Duisburg, die
Tochter unseres Nachbarn, überwiesen. In Friedland wurden wir registriert. Im Registrierschein, war als unser
nächster Aufenthaltsort in der Bundesrepublik, das Durchgangslager Osthofen bei Worms, das alle Aussiedler für
Rheinland-Pfalz aufnehmen musste, eingetragen. Die Eintragung erfolgte deshalb, weil der Ort aus dem uns unsere
Einladung zugeschickt wurde, sich auch in Rheinland-Pfalz befand.
Da ich nach dem Polenfeldzug, als Soldat, ein Jahr im Kreis Opladen, im Rheinland gewesen bin, wäre ich sehr gerne in
diese Gegend gezogen, denn die Erinnerung an die schönen Tage die ich dort verlebt habe war in mir immer noch wach.
Ich versuchte die Eintragung in unseren Regiestierscheinen ändern zu lassen, was nach einigen, vielleicht auch
berechtigten Einwänden, am 4. August, vom Beauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen, genehmigt wurde. Anstelle von
Rheinlad-Pfalz stand da jetzt Nordrhein-Westfalen und am 7. August, fuhren wir, noch mit anderen Aussiedlern, ins
Durchgangslager Unna-Massen, am östlichen Rande des Ruhrgebietes gelegen. Hier wurden wir in einem Zimmer untergebracht
und konnten unser Essen in einer Gemeinschaftsküche zubereiten.
Am 8. August wurden wir in Unna-Massen, als Bürger der Bundesrepublik Deutschland registriert, erhielten
Einhundert DM Begrüßungsgeld, den Vertriebenen Ausweis -A -und 4 Wochen später den Bundespersonalausweis. In
Unna-Massen haben wir mehr als 4 Monate verbracht, weil mein Sohn Kurt, wegen fehlender Berufsausbildung, in Unna, an
einem Grundlehrgang für Metallarbeiter teilgenommen hat, der vom Arbeitsamt finanziert wurde. Am 11 Dezember 1969 sind
wir endlich an unserem vorläufigen Wohnsitz, im Durchgangswohnheim, an der Elisabethstraße 13, in Velbert angekommen.
Ab dem 5. Januar 1970 konnten meine Söhne, in der Zahnradfabrik Reining, in Velbert ihrer geregelten Arbeit nachgehen.
Von Bau- und Sparverein in Velbert wurde uns am 20. Juni 1970, unsere erste Wohnung zugewiesen.
Velbert im Februar 1972
gezeichnet: Gustav Rattay
Verschiedene Kameraden gingen nach dem Dienst noch in die Stadt. Um 21:45 Uhr wurde zum Zapfenstreich geblasen, dann
musste man schnell zurück in die Kaserne, weil um 22:00 Uhr der Wachhabende von Bett zu Bett ging und prüfte ob auch
alle anwesend waren. Zwei mal pro Woche fanden Gewaltmärsche statt, mit vollem Gepäck im Tornister. Am Ende der
Marschkolonne fuhr dann ein Pferdewagen, wenn der Feldarzt bei jemandem einen Erschöpfungszustand feststellte, der
durfte dann aufsitzen. Am Sonnabend wurden auf dem großen Exerzierplatz Felddienstübungen durchgeführt, es befand sich
dort ein großer Hügel, den wir immer wieder erstürmen mussten. Am Nachmittag war Revierreinigen angesagt, wir mussten
dann die Tische schrubben, auf einen Tisch wurde Sand mit etwas Wasser gestreut, der nächste Tisch wurde mit der den
Beinen nach oben drauf gelegt und solange hin und her geschoben bis beide sauber waren. Mit den Stühlen geschah das
Gleiche. Dann wurde der Fußboden in der Stube geschrubbt, die Schränke abgewaschen, Staub geputzt, zuletzt kamen Flur
und Treppe dran.
Für die Arbeit war eine Stunde angesetzt, wenn jemand zu früh fertig war erregte er den Argwohn des Diensthabenden
Korporals, der prüfte dann alles genau, fand natürlich immer etwas das nicht seinen Erwartungen entsprach. Der
Übereifrige musste dann Nacharbeiten bis die Stunde um war. Eine Stunde war für Gewehr reinigen und Unterricht an der
Waffe vorgesehen.
Im Februar wurden wir neu eingekleidet; Schnürschuhe, Koppel, alles gelbes Leder mussten wir mit Lederschwärze
behandeln. 2 Wolldecken, Uniform und Helm in feldgrau, da brauchten wir die Knöpfe nicht mehr zu putzen. Die neuen
Gewehre mussten zuerst eingeschossen werden. Es wurden 90 scharfe Patronen und Marschverpflegung ausgegeben, danach
mussten wir mit vollem Gepäck zum Appell antreten. Man konnte kaum gerade stehen, weil der Tornister einen in die Knie
zwang. Der Major, der die Aufstellung besichtigte rief >Brust raus<, dann informierte er uns dass wir ins
Feldrekrutendepot und in Feindesland kommen. Urlaub bekam niemand. Ich habe ein Telegramm nach Hause geschickt, mit
der Nachricht dass wir bald abrücken werden. Einen Tag vor dem ausrücken hat mich meine Mutter noch besucht, sie hat
mir vieles mitgebracht. Alles konnte ich nicht mitnehmen, weil es nicht gestattet war anderes Gepäck bei sich zu haben
als dem Soldaten zustand.
Im Februar wurden wir neu eingekleidet; Schnürschuhe, Koppel, alles gelbes Leder mussten wir mit Lederschwärze behandeln. 2 Wolldecken, Uniform und Helm in feldgrau, da brauchten wir die Knöpfe nicht mehr zu putzen. Die neuen Gewehre mussten zuerst eingeschossen werden. Es wurden 90 scharfe Patronen und Marschverpflegung ausgegeben, danach mussten wir mit vollem Gepäck zum Appell antreten. Man konnte kaum gerade stehen, weil der Tornister einen in die Knie zwang. Der Major, der die Aufstellung besichtigte rief >Brust raus<, dann informierte er uns dass wir ins Feldrekrutendepot und in Feindesland kommen. Urlaub bekam niemand. Ich habe ein Telegramm nach Hause geschickt, mit der Nachricht dass wir bald abrücken werden. Einen Tag vor dem ausrücken hat mich meine Mutter noch besucht, sie hat mir vieles mitgebracht. Alles konnte ich nicht mitnehmen, weil es nicht gestattet war anderes Gepäck bei sich zu haben als dem Soldaten zustand.
Am nächsten Tag hat uns die Regimentskapelle mit Musik zum Bahnhof gebracht. Von Osterode ging
es über Thorn, Posen,
Annaberg, Warschau, Brestlitowsk ins Pruschana-Lager. Das war eine russische Artillerie-Kaserne, in der 2 deutsche,
3 österreichische Bataillone und eine Offiziersschule untergebracht waren. Ein Bataillon das waren wir 18 und 19
jährige, die Anderen waren Männer bis 45 Jahre. Als wir in Osterode abfuhren lag Schnee, in Annaberg/Schlesien waren
die Kühe auf der Weide und im Pruschana-Lager lag der Schnee wieder einen Meter hoch. Drei Kilometer vor unserem vor
unserem Lager war die Bahnfahrt zu Ende. Mit den schweren Tornistern waren viele überfordert, wir mussten immer wieder
warten bis alle nachkamen. Unsere Unterkünfte das waren Baracken die den Russen als Pferdeställe gedient hatten. In
jeder Baracke wurde eine Kompanie mit Schreibstube untergebracht, die nur durch ein Zelt abgegrenzt war.
Wir haben aus Brettern Doppelbetten hergestellt, in jeder Baracke war ein Ziegelofen. Unsere neuen Uniformen und die
scharfe Munition mussten wir abgeben und bekamen dafür alte Bekleidung, sowie Ecksezierpatronen. Hier ging es wieder
Kasernenmäßig zu, das jüngere Bataillon bekam besseres Essen, doppelte Portionen und nach dem Essen 2 Stunden Bettruhe.
Wenn jemand die Bettruhe nicht einhielt und dabei erwischt wurde wusste zur Strafe Holz hacken oder Schnee schaufeln.
Zwei Wochen war Frost bis minus 40 Grad, da hatten wir keinen Unterricht im Freien, alle Aktivitäten fanden in der
Baracke statt, die nur mit nassem Holz beheizt wurde und dem entsprechend war auch die Temperatur im Inneren. Um
Brennmaterial für die Küche zu besorgen mussten wir ins nächste Dorf gehen und von zerfallenen Häusern Holz holen.
Als endlich das Tauwetter einsetzte verwandelte sich die Gegend um Baranowitschi in ein unüberwindbares Sumpfgelände.
Wir wurden mit anderen Einheiten die aus Frankreich zu uns verlegt wurden, zusammengelegt. Wenn jemand nachweisen
konnte dass er Landwirt ist und mehr als 100 Morgen Ackerland besitzt, konnte er einen Urlaub zur Frühjahrsbestellung
beantragen. Ein Gottlieb Piotrowski aus Plohsen hat seinen Urlaub bewilligt bekommen und durfte für 14 Tage nach Hause.
Wenn von der unweit entfernten Front Kanonendonner zuhören war und Alarm ausgerufen wurde, dachten wir es geht los.
Obwohl wir als Reserve aufgestellt waren mussten wir allzeit einsatzbereit sein. Wir haben auch Bunker und Stollen
gebaut, Schützengräben ausgeworfen und mit scharfen Handgranaten exerziert.
Als Gottlieb Piotrowski nach 2 Wochen zurückkam waren wir schon in Alarmbereitschaft und sind dann auch 2 Tage später
ausgerückt. Kamerad Piotrowski hatte mir noch ein großes Paket von zu Hause mitgebracht.
Italien hat Deutschland und Österreich den Krieg erklärt.
Zuerst sind drei Bataillone Österreicher ausgerückt, dann die Deutschen hinterher. Bis zum
Bahnhof Linowa wurden wir von einer Musikkapelle begleitet, dann ging es per Eisenbahn ab nach Baranowitsche. Dort
wurden wir der, an der Westfront aufgeriebenen, 15ten Reserve Division zugeteilt. Es wurde uns gesagt das Kameraden
aus der Heimat gleichen Gruppen zugeordnet werden können. Ich hatte einen Freund aus meinem Dorf, Gustav Spektor,
einen aus Groß Schöndamrau, Wilhelm Lukas und einen aus Ortelsburg, Karl Schlensack, wir kamen zu zusammen in eine
Kompanie. Zuerst waren wir in einem Kinosaal einquartiert, haben jeden Tag Schützengräben ausgehoben und Feldübungen
gemacht. Es war ein sumpfiges Gelände, so dass die Soldaten wegen den vielen Mücken, Netze auf den Köpfen tragen
mussten. Nach einem Gewitter wurde es plötzlich unerträglich. Die Mücken hatten meinen Freund so zerstochen dass sein
Gesicht dermaßen angeschwollen war und ich ihn gar nicht wieder erkannt habe.
Von Baranowitsche wurden wir wieder auf die Eisenbahn verladen, die uns mit unbekanntem Ziel Richtung Osten fuhr.
Nachdem wir unterwegs einmal zum Essenfassen gehalten haben, kamen wir in der Nacht in Krakau an. In der nächsten
Nacht befanden wir uns schon in den Karpaten, wo wir die Hügelketten zu Fuß überqueren mussten, die Fahrzeuge fuhren
um die Berge herum und wir mussten manchmal 2 Stunden warten bis sie uns wieder eingeholt hatten. So ging es immer
weiter bis wir auf einen Berg kamen wo wir Zelte aufgebaut und Biwak bezogen haben. Dort stießen wir auf türkische
Einheiten die auf Mauleseln Munition und Verpflegung über die Berge transportiert haben. Die Esel hatten ein Gestell
auf dem Rücken, auf jeder Seite eine Fass mit Wasser oder Kisten mit Proviant. Ihre Artillerie wurde von 6 Mauleseln
gezogen, während die Offiziere, ohne Sattel, ohne Zaumzeug, nur mit einem Hanfseil ausgerüstet, daher kamen.
Die Mannschaften marschierten wie es jeder für richtig hielt, mit aufgekrempelten Ärmeln, das Gewehr über den Tornister
gelegt, wie die Wilddiebe. Im Gegensatz dazu herrschte bei uns strenge Disziplin, wen jemand aus der Reihe ging kam
sofort der Kompanieführer angeritten, hat uns angeschrieen, uns klar gemacht dass wir keine Türken seien und nur auf
höheren Befehl etwas an der Marschordnung ändern dürften, wer dagegen verstoße, müsste mit einem 3tägigen Arrest
rechnen. Wir haben hinter der der Front Gewaltmärsche durchgeführt die dem Feind große Truppenaufmärsche vortäuschen
sollten.
Wir lagen in einem Buchenwald in Bereitschaft. Überläufer berichteten dass auf russischer Seite eine Großoffensive
vorbereitet wird. In einer Nacht wurde plötzlich Alarm geschlagen, der Russe war zu einem Angriff mit Gasgranaten
übergegangen. Wir lagen unter Zelten und hatten die Gasmasken gar nicht bei uns, sondern nur etwas abseits liegen. In
der Dunkelheit hat mach einer keine Gasmaske mehr gefunden. Es war ein fürchterliches Durcheinander. Dabei war es
unsere Pflicht die Maske immer an dem Tragriemen über dem Hals zu tragen, mit halb geöffnetem Deckel. Uns hat es zum
Glück nicht so stark betroffen weil wir auf einer Anhöhe lagen und die Gaswolken sich im Tal verteilten. Wir wurden in
höchste Alarmbereitschaft versetzt weil der Russe die österreichische Front durchbrochen hatte.
Eigentlich sollten wir noch an einer Gulaschkanone Essen fassen, aber es blieb uns dazu keine Zeit mehr. Der
Kompanieführer befahl uns die Zelte abzubrechen, auf den Tornister aufzurollen und in fünf Minuten marschbereit zu
sein. Die Kanoniere befanden sich schon in der Batteriestellung, luden die Granaten, die sofort abgefeuert wurden. Der
Battalions-Kommandeur versammelte die Kompanieführer und erteilte ihnen die Angriffsbefehle. Derweil sollten wir in
einem Eichenwal der schon mit Granattrichter übersät war, Deckung suchen. Bald hatten wir die Verbindung zu unserem
Batteriestab verloren. Wir warfen unsere Tornister auf einen Haufen, schwärmten unverzüglich, nur mit Sturmgepäck
ausgerüstet, 4 Handgranaten im Brotbeutel, zum Angriff aus. Wir robbten uns einzeln voran. Weil der Russe unsere
Stellungen schon überrannt hatte war jeder auf sich selbst angewiesen. Mann hörte kein Kommando mehr weil der Russe
inzwischen den Rückzug angetreten hatte, um sich auf einer Bergspitze zu verschanzen, von der er uns mit
Flachbahngeschützen beschoss. Irgendwann befanden wir uns in einem Schützengraben, wo ein Leutnant und 17 Mann aus
unserer Division die Stellung hielten. Unter Androhung von Gewalt befahl er uns den Graben sofort zu verlassen und am
Gegenangriff teilzunehmen. Wir sprangen über den Stacheldraht, duckten uns aber sofort im nächsten Graben damit das
mörderische Maschinengewehrfeuer uns nicht hinwegfegte.
Dort blieben wir bis zum Eintritt der Dunkelheit liegen. Wir konnten unsere Waffen nicht mehr einsetzen weil der Sand
die Gewehrschlösser blockiert hatte. Als es Nacht wurde herrschte ein gespenstische Stille. Wir krochen aus dem
Schützengraben und lauschten nach irgendeinem Lebenszeichen von anderen Kameraden. Dann hörten wir irgendwelche Laute
die wir nicht genau zuordnen konnten. Sie kamen aus einem Holzbunker ganz in der Nähe. Wir näherten uns ganz
vorsichtig, als plötzlich eine Schar österreichischer Soldaten herausstürmte. An unseren Stahlhelmen erkannten sie
dass wir Deutsche sind. Bald danach trafen wir auch auf 69 deutsche Soldaten die zu unserer Division gehörten. Dann
kam ein Hauptmann der uns mit Vorwürfen überschüttete, wir seien Feiglinge, wir hätten uns von unserer Einheit entfernt.
Wir haben ihm den Vorgang geschildert, aber ließ nicht mit sich reden und sagte nur dass wir bestraft werden und nichts
zu essen bekommen. Wir wurden einer Maschinengewehr Einheit zugeteilt welche die vorderste Stellung verteidigen
musste. Wir hatten einen Stollen mit 2 Ausgängen.
Die Russen haben bemerkt das sich etwas bewegte und haben uns unverzüglich mit Artilleriefeuer belegt. Schon die
dritte Granate war ein Volltreffer. Vier Kameraden waren sofort tot, ich bekam mit einem Stollenbrett in den Rücken
der sofort blau und grün angelaufen war. Ich schaute nach oben, alles war verschüttet. Ich wusste nicht das da noch
ein Ausgang war, doch die Kameraden die hier in Stellung waren haben mir geholfen das Freie zu erreichen. Ich habe
mich am nächsten Tag krank gemeldet, dachte 2 Tage Schonung zu bekommen, aber der Sanitäter hat mir nur den Rücken mit
Spiritus eingerieben und mich wieder, zurück zu unserer Kompanie geschickt. Sie bestand nur noch aus 3 Gruppen, die in
einem Stollen, der in einen Berg gehauen war, Stellung bezogen hatten. Wir konnten uns hier wenigstens waschen, an
einer Quelle die aus dem Felsen sprudelte. Wir waren nicht mehr einsatzfähig und mussten durch andere Truppenteile
verstärkt werden.
Beim Essen holen musste man auch das Gewehr bei sich haben, es wurde erzählt dass hier der braune Bär herumwandert.
Ich habe keinen gesehen, nur das die Toten ausgescharrt wurden und verstümmelt herumlagen. Nach einigen Wochen haben
die Deutschen eine Gegenoffensive gestartet, von den Bergen herunter, über den Fluss Zlota Lipa, bis zu einer Stadt
die Brzezany hieß. 2 Tage später wurden wir auch eingesetzt, bei großer Hitze ging es in Dauermärschen vorwärts, man
durfte aus den Flüssen kein Wasser trinken, weil es mit Petroleum verseucht war. Nur wenn es dunkel wurde machten wir
halt, dann mussten wir Gräben ausheben um vor Überraschungen sicher zu sein.
Links von uns war Tarnopol und rechts Rumänien. Wenn es nach einer Ruhepause wieder losging dann war es am schlimmsten,
man ging wie auf Nägel, weil die Füße die Strapazen nicht so ohne weiteres wegsteckten. Im Dorf wurde niemals Rast
gemacht, denn da waren immer Brunnen, zu denen alle hinstürmten. Später wurden Melder vorausgeschickt, die von den
Dorfbewohnern Wasser in Eimern am Weg raussetzen ließen, damit die Soldaten Ihren Durst löschen konnten. Ein Soldat hat
gleich den ganzen Eimer mitgenommen und ihn dann als er leer war, irgendwo am Wegrand stehen lassen. Der Kompanieführer
kam angeritten, hat ihn ausgeschimpft und gedroht, ihn mit 3 Tagen Arrest zu bestrafen. Wir gehörten zur Südarmee
welche von Graf Bothmer befehligt wurde.
Die Stellungen waren schlecht ausgebaut, abends mussten wir, von der 2 Kilometer hinter der Front liegenden Feldküche,
Essen und andren Proviant holen. Ich war der Jüngste der Gruppe, musste immer 9 Kochgeschirre tragen, Brot und Post
habe ich in 2 Sandsäcke, die ich über der Schulter hängen hatte, verstaut. Wenn wir unterwegs waren wurde der
Laufgraben immer beschossen. Einmal schlug eine Granate am Schützengrabenrand ein und hat mich halb verschütte, die
Kochgeschirre aus den Händen gerissen, so dass ich ohne Verpflegung im vorderen Graben ankam. Nach drei Wochen sollten
wir abgelöst werden Es hat jeden Tag geregnet, wir haben unsere Mäntel angezogen und uns mit Zelten bedeckt. Nach dem
wir abgelöst wurden kamen wir in ein Dorf dass von Juden bewohnt war. Die Bewohner waren froh dass wir keine Kosaken
waren, mit denen hatten sie vor ein par Tagen schon schlechte Erfahrung gemacht, die hatten ihnen beim Abzug Vieh und
Pferde weggenommen.
Der Boden war sehr fruchtbar, es wurden Hanf, Weizen, Hafer, Mais, Bohnen, Roggen und Kartoffeln angebaut. Die
Bewohner waren gerade mit der Ernte beschäftigt. Die Häuser waren nur aus Holz und Stroh erbaut. Die Leute lebten in
sehr ärmlichen Verhältnissen. Ich hatte mir in unserer Kantine für 20 Pfennig ein Taschenmesser gekauft, das hat mir
ein Bauer für 6 Eier und 2 Pfund Brot abgekauft, daraus hat er sich dann ein Rasiermesser geschliffen. Wenn unser
Versorgungstross auf denn holperigen Wegen nicht nachkam, haben im Dorf auch Verpflegung eingekauft. Die Leute hatten
Angst dass wir nicht bezahlen werden, doch wir bekamen meistens pünktlich unseren Wehrsold ausgezahlt und konnten uns
so manches genehmigen. Um unser Marschgepäck zu erleichtern haben wir so manches aus dem Tornister weg geworfen.
Unweit eines Dorfes wurde halt gemacht, wir sollten Zelte aufschlagen, doch niemand hatte mehr Zeltstöcke im Tornister,
alles war unterwegs liegen geblieben. Der Zugführer befahl uns ins Dorf zugehen und Stöcke zu besorgen. In einer
Scheune stießen wir auf eine Hühnerschar, mit den Stöcken haben wir einige Hühner erlegt, in einem Hanffeld gerupft
und dann im Eiltempo zurück zu unserer Truppe. Als wir ankamen war die Kompanie schon marschbereit, es gleich weiter,
mit dem Huhn im Tornister. Bei der nächsten Rast haben wir die Hühner ausgenommen und Holz besorgt um sie zu kochen,
doch wir mussten schnell wieder weiter marschieren und erst nach 2 Tagen konnten wir uns mit den Hühnern befassen,
leider waren die so alt das sie nicht gar wurden. Das Fleisch mussten wir wegwerfen, nur die Suppe konnten wir noch
gebrauchen.
Meine Verwundung am Pruth.
Wir befanden uns 8 km vor der russischen Grenze. Der Kompanieführer hatte uns informiert das
wir hier zum Einsatz kommen. Wir bekamen noch ein Mittagessen aus der Gulaschkanone, konnten unsere Feldflaschen mit
Tee, der mit Rum angereichert war, auffüllen, Munition und Handgranaten in Empfang nehmen und dann ging es zum Einsatz.
Um 3 Uhr begann das ganze Bataillon auszuschwärmen, sofort hat uns der Russen entdeckt und begann uns mit Artillerie
zu beschießen, je weiter wir vorrückten desto heftiger.
Bis zu einem Eisenbahndamm hatten wir gute Deckung, doch wir sollten den dahinter fließenden Fluss überqueren. Doch
plötzlich explodierte über meinem Kopf eine Schrapnellkugel, der Stahlhelm wurde mir vom Kopf gerissen, Tornister und
Koppel flogen auch weg, ich lag auf der Erde und wusste gar nicht was passiert war. Plötzlich fing Blut aus der
Kreuzbeingegend zu rieseln, aus dem rechten Oberschenkel auch. Gleich nebenan war ein Granattrichter, dort habe ich
Schutz gesucht. In der rechten Rockecke hatte man immer ein großes Verbandspäckchen, das habe ich herausgenommen und
auf die Wunde gedrückt, doch das Blut floss mir bis in den Stiefel. Links und rechts von mir schlugen Granaten ein,
dicke Erdbrocken und Schlamm fielen auf mich herab, doch in meinem Erdloch war ich vor Maschinengewehrsalven geschützt.
Der ganze Rücken war angeschwollen und ich konnte mich überhaupt nicht bewegen.
Die Deutschen mussten die Stellung den Russen überlassen, einer hatte mich entdeckt, da ich aber so blutverschmiert da
lag, hat er bestimmt gemeint ich wäre nicht mehr am leben und ist weitergegangen. Nach zwei Stunden habe ich gehört
das die Russen sich wieder zurückzogen, danach herrschte eine gespenstische Stille. Als es dunkel wurde kamen deutsche
Sanitäter mit Spürhunden und haben die Verwundeten aufgesammelt. Ich wurde auf eine Trage gelegt, lag gebeugt und
konnte mich nicht rühren weil der blutverschmierte Rücken völlig verkrustet war. Ein Pferdegespann konnte nur vier
Tragen befördern, die Fahrt über Ackerfurchen war eine Tortur, ich habe nicht geglaubt das ich es überleben werde. In
einer Dorfkirche wurden wir dann ausgeladen und zu den etwa 50 Verwundeten gelegt die da schon lagen.
Mich haben sie zu den Bauchschüssen gelegt, weil ich einen Nervenschock hatte und am ganzen Körper gezittert habe. Zu
trinken bekam ich nichts, nur einen feuchten Lappen in den Mund. Ich sollte gleich operiert werden, aber es kamen
immer mehr Verwundete, so bekam ich nur eine Tetanusspritze, wurde verbunden und für den Weitertransport ins Hinterland
vorbereitet. Im Morgengrauen wurden wir auf Lastautos verladen, die aus auf ein Landgut brachten, wo wir in einem
Pferdestall untergebracht wurden. Die Fahrer fuhren so schnell über die Granatlöcher, das wir vor Schmerzen geschrieen
haben. Wir baten sie langsamer zu fahren, aber die bekamen es in ihrem Führerhaus nicht mit, erst alt ein Verwundeter,
der einen Krückstock bei sich hatte von hinten die Scheibe einschlug wurde die Fahrt erträglich. Lastautos, die
Munition und Verpflegung an die Front transportiert hatten, brachten in den nächsten Tagen immer wieder Verwundete
ins Hinterland. Die Deutschen hatten an diesem Fronabschnitt hohe Verluste zu beklagen. Wir können von Glück reden
dass wir dem Höllenfeuer überhaupt entkommen sind.
Wir wurden mit Lastautos, die ein Feldlazarett uns geschickt hatte, bis nach Lemberg befördert. da wurden wir gewaschen,
rasiert und frisch verbunden. Auf einem Nebengleis stand ein Lazarettzug, in dem wurden wir anschließend in frisch
bezogenen Betten untergebracht. Der Zug brachte uns über Annaberg nach Freiburg in Sachsen, eine Stunde hinter Dresden.
Hier wurden wir auf Tragen gebettet und mit einem Möbelwagen in ein Reservelazarett transportiert.
Im Heimatlazarett.
Als ich am nächsten Tag aufwachte und das schöne Bett sah in dem ich lag, dachte ich dass ich
im Himmel bin. Ich dankte meinem Herrgott das er mich bis zu diesem Ort begleitet hat. Am Nachmittag kamen Schulkinder
mit Geschenken und haben uns schöne Lieder vorgesungen. Anhand von Röntgenaufnahmen wurde in den nächsten Tagen
festgestellt dass bei mir ein Schrapnellsplitter an der Wirbelsäule in die Kreuzbeingegend eingedrungen war. Ich wurde
jeden Tag in Salzwasser gebadet und bekam wieder volle Verpflegung, da mein Magen zum Glück nicht verletzt war. Auf
dem Transport bekam ich nur Suppe und bei Bedarf einen feuchten Lappen auf die Lippen. Ich bin von 62 auf 43 Kilogramm
abgemagert, gehen konnte ich wegen dem Nervenschock den ich bei der Verwundung erlitten hatte auch noch nicht. Die
Wunde am rechten Oberschenkel war nur ein Streifschuss und wurde mit einem Schutzverband versorgt.
In den nächsten Tagen habe ich einen Brief nach Hause geschrieben und mitgeteilt wo ich mich zurzeit befinde. Meine
Eltern schickten mir ein Paket mit Lebensmitteln, jetzt konnte ich essen was ich wollte. Das Essen im Lazarett war
nicht besonders, jeden Tag nur Kohlblätter. Der weg zu den Toiletten führte durch einen Gemüsegarten. Die gehfähigen
Kameraden haben den ganzen Kohlrabi aufgegessen, so dass schließlich Wachposten aufgestellt werden mussten. Sechs
Wochen lang konnte ich mich nur auf allen Vieren fortbewegen, denn sobald ich mich aufrichtete wurde es mir
schwindelig und ich musste zurück ins Bett.
Als ich wieder bei Kräften war habe ich meinen Eltern mitgeteilt das ich mich in ein Lazarett in ihrer Nähe verlegen
lassen will. Der Chefarzt hatte mir zugesichert, wenn die Möglichkeit besteht in Ortelsburg unterzukommen, wird er dem
zustimmen. Meine Mutter hat daraufhin, in Ortelsburg, beim Lazarettinspektor Zantopf nachgefragt und er hat angedeutet
das sie mich aufnehmen können. Daraufhin bekam ich die Krankenpapiere und einen Fahrschein nach Ortelsburg. Da ich als
Soldat nie Heimaturlaub hatte, beschloss ich zuerst meine Eltern zu besuchen. Ich fühlte mich noch sehr schwach, habe
nach jedem Kilometer Rast gemacht, aber letztendlich war ich wieder daheim bei meinen Eltern. Die Wiedersehensfreude
war sehr groß. Ich bin am 30 Juli verwundet worden und am gleichen Tag wurde mein ältester Bruder beerdigt. Er bekam
den Splitter einer Gasgranate ins rechte Bein und ist an einer Blutvergiftung verstorben.
Am nächsten Tag brachte mich mein Vater ins Garnisonslazarett nach Ortelsburg. Ich wurde jeden Tag gebadet und massiert,
weil die Rückenhaut am Knochen angewachsen war konnte ich mich nicht schmerzfrei bücken. In Ortelsburg verbrachte ich
noch sechs Wochen, bis Ende Oktober, da wurde es schon ziemlich kalt und in unserer Barackenunterkunft ziemlich
ungemütlich. Kohlen und anderes Brennmaterial lagen im Hof auf Halde, aber es war verboten zu heizen. Kameraden die in
der Nähe zu Hause waren konnten Sonntagsurlaub beantragen.
Einer von ihnen brachte von zuhause Brennholz mit und entzündete damit im Ofen ein wärmendes Feuer, andere holten vom
Hof Kohlen, so dass der Ofen in kurzer Zeit glühend heiß wurde und die Gefahr bestand das die Betten Feuer fangen
würden. Wir hatten die Betten schon weg gerückt, da kam der Feldwebel herein und fragte wer das Feuer im Ofen
angezündet hat, doch niemand fühlte sich angesprochen. Der Feldwebel hatte den Vorfall dem Stabsarzt gemeldet, als der
am nächsten Morgen zur Visite kam, war seine erste Frage: ”Wer hat gestern Abend das Feuer im Ofen angezündet”. Als
sich niemand meldete, schrie er uns an: ”Morgen wird alles entlassen, zum Ersatzbatallion, in Diez an der Lahn! Wer
gehen kann, sofort zur Schreibstube, Krankenpapiere und Fahrscheine abholen”. Er erinnerte uns noch daran am nächsten
Tag pünktlich am Bahnhof zu sein, weil eine Verspätung unangenehme Folgen für uns haben würde. Das war das Ende der
schönen Erholungsphase. Ich blieb noch eine Nacht zu Hause und bin dann am nächsten Tag von dort zum Bahnhof gegangen.
Wieder Kriegsverwendungsfähig.
Als wir am nächsten Tag in Diez angekommen waren, wurde ich gefragt ob ich aus dem Heimaturlaub
käme, als ich das verneinte wurden mir 2 Tage genehmigt und 14 Tage Genesungsurlaub dazu. Wieder zurück im
Ersatzbatallion bestand unsere Tätigkeit aus Wache schieben und Kartoffel schälen. Nach einem Monat wurden wir von
einem Generalarzt untersucht, er hat mich für nicht einsatzfähig befunden weil ich noch den Steckschuss im Rücken
hatte und das linke Bein 10 Zentimeter dünner war. Jetzt fing das Kasernenleben wieder von vorne an. Wachdienst,
Gewehr laden, sichern, Ehrenbezeugung, Einzelmarsch und Appell. Wer nicht weit nach Hause hatte bekam zu Weihnachten
Urlaub. Ich hatte zu Heiligabend und Silvester Torwache, denn nach Ostpreußen wurde niemand beurlaubt.
Nach Neujahr 1918 wurden wir neu eingekleidet und kamen nach Köln zur Baukompanie. Mit Musik wurden wir zum Bahnhof
gebracht. In Köln wurden wir noch mit Soldaten die von andern Truppenteilen dorthin verlegt wurden in einem großen
Kinosaal, im Stadtteil Edengarten untergebracht. Wir brauchten keinen Dienst zu machen und konnten zu Heilige Drei
Könige den Gottesdienst im Dom besuchen. Kameraden die aus irgendwelchen Gründen im Arrest saßen wurden gefragt ob sie
auch am Gottesdienst teilnehmen möchten, dann würde ihnen die Strafe erlassen. Fast alle haben dem zugestimmt. Einige
Tage später wurden wir wieder auf einen Transportzug verladen, der uns über Herbestal, Antwerpen nach Brügge in Belgien
brachte. Hier mussten wir den Zug kurzfristig verlassen und einen Luftschutzkeller aufsuchen, weil Fliegeralarm
gemeldet wurde. Danach ging es wieder weiter nach Turut, Kortemark, Hauseme, Kautremollen, Zaren, Zarenlinde. Dort
wurden wir in verschiedene Gruppen aufgeteilt und einer Pionierkompanie auf dem Pionierpark Struwendorf zugewiesen.
Wir haben hinter Klerken Bunker für schwere Maschinengewehre gebaut. Unsere Arbeit konnten wir nur bei Nebel verrichten,
denn bei Sonnenschein waren wir sofort dem Beschuss der feindlichen Artillerie ausgesetzt. eine Kleinbahn die Munition
und Stacheldraht an die Front brachte war dem Beschuss besonders ausgesetzt. Die Gleise, von schweren Geschossen
zerfetzt, mussten immer wieder hergerichtet werden, damit der Nachschub aufrechterhalten werden konnte. Später haben
wir am Kemelberg bei Armentier, eine Brücke über die Lys gebaut. Um in dem Sumpfgelände einen Untergrund dafür zu
schaffen, mussten wir 10 bis 12 Meter lange Pfähle in den Boden rammen. Ein Feldwebel gab immer den Befehl: „Hoch den
Bär, noch viel mehr, dass man sieht, wie er zieht, denn dieser Pfahl, glatt wie ein Aal, durch Fels und Stein, durch
Wasser und Sand, fürs Vaterland”. Jedes mal mussten wir den Bär an Schnüren hochziehen und dann wieder herunterlassen.
Wenn es manchmal, trotz vieler Mühe nicht mehr weiter ging wurde der Pfahl auf eine bestimmte Länge abgeschnitten.
Nach Fertigstellung der Brücke kamen wir in die Siegfriedstellung bei Kambrei, zum Bau eines Bataillons-Gefechtstandes.
Da der Boden kreidehaltig war, mussten wir die großen Stücke von Hand zu Hand reichen, den Schutt haben wir dann mit
Sandsäcken aus der Baugrube gehoben und mit Ästen getarnt, damit der Stand nicht von feindlichen Fliegern entdeckt
werden konnte. Alle acht Stunden wechselte die Arbeitsgruppe. Wir mussten von der Baustelle durch das Gelände robben,
denn aufrecht gehend war man dem Beschuss der feindlichen Scharfschützen ausgesetzt, die von einem Fesselballon aus
informiert wurden der über den feindlichen Linien stand.
Der Wechsel war mit einem großen Risiko verbunden, und wurde wenn Möglich bei Dunkelheit vollzogen. Um vor
Überraschungen sicher zu sein haben wir spanische Reiter (Stacheldrahtverhaue) gebaut und vor die ersten Gräben
gestellt, die dann oft in der Nacht von den Franzosen geklaut, und dann vor ihren eigenen Linien wieder aufbaut wurden.
Wir hatten aus Bohlen eine Brücke auf Rädern gebaut, die dann in den Graben geschoben wurde, damit die Artillerie und
andere Fahrzeuge über die Schützengräben kamen. Weil um vier Uhr morgens der Beschuss mit Gasgranaten begann, mussten
wir Gasmasken aufsetzen, danach haben feindliche Flieger unsere Munitionskolonne bombardiert und total aufgerieben.
Es wurde auch eine Marinedivision eingesetzt, die bis dahin dem Küstenschutz gedient hatte und jetzt ihren ersten
Einsatz hatte.
Wir sind zuerst ein ganzes Stück in Richtung Amiens vorangekommen, doch dann blieb unser Angriff in den zuvor von
Engländern besetzten Stellungen, stecken. Da die Engländer ihre Stellungen fluchtartig verlassen hatten, fiel ihr
ganzer Proviant in unsere Hände; Schokolade, Weißbrot, Flaschenwein. Die erste Nacht haben wir in einem runden Zelt
verbracht, weil ich mir durch den starken Wind, der da herrschte eine Angina zugezogen hatte, die mit hohem Fieber
verbunden war, konnte ich die vielen Köstlichkeiten überhaupt nicht genießen.
An eine ärztliche Versorgung war überhaupt nicht zu denken, denn es mussten zuerst die vielen Granatlöcher eingeebnet
werden damit die vielen Fahrzeuge und Geschütze wieder weiter fahren konnten. Auch eine Bahnlinie musste repariert
werden, damit die großen Geschütze in Stellung gebracht werden konnten, dabei wurden auch die vielen Kriegsgefangenen,
die bei dieser Offensive gemacht wurden, eingesetzt. Als die Offensive dann schließlich scheiterte, wurden wir an die
Somme verlegt. Da habe ich die Ortelsburger Jäger, die aus Italien an die Westfront verlegt wurden, zum ersten Mal im
Einsatz gesehen.
Unser nächster Einsatzort waren dann Stellungen hinter Laon. Hier wurden die Vorbereitungen zu einer neuen Offensive
getroffen. Feindliche Flieger versuchten uns Tag und Nacht daran zu hindern die Aufmarschwege instand zu halten. Als
die Offensive dann endlich losging, hatten wir die Order eine Brücke über die Oise mit Bohlen und Balken zu verstärken.
Gleich am Anfang der Offensive mussten wir Gasmasken anlegen, um für alle Fälle gewappnet zu sein. Nur die Artillerie
und Kraftfahrzeuge durften die Landstraße benutzen, die Infanterie ging immer im Straßengraben und wurde von einer
Seite von Kopf bis Fuß mit Dreck bespritzt. Die Franzosen und Engländer haben hier schon Panzer eingesetzt, die von
Truppen aus den Kolonien gefahren wurden. Die Australier gingen mit umgekrempelten Ärmeln hinter den Panzern her.
Die letzte Offensive des Ersten Weltkrieges.
Zum Jahresende 1917 hatten noch 153 deutsche 175 alliierten Divisionen gegenübergestanden.
Zur Vorbereitung der Offensive ließ Ludendorff 39 Divisionen aus dem Osten und aus Italien heranziehen. Er ließ
spezielle Angriffsdivisionen formieren, die durch intensive Ausbildung auf den beabsichtigten, schnellen Vormarsch
vorbereitet wurden. 6608 Geschütze, 3500 Minenwerfer und 1070 Flugzeuge wurden hinter dem vorgesehenen
Angriffsabschnitt konzentriert. Den Ausbildungsbefehlen Ludendorffs, die bis zu den Kompanieführern herab verteilt
wurden, konnte man entnehmen, dass der Versuch, den Krieg mit einem mächtigen Schlag zu entscheiden schon in der
nächsten Zeit gewagt werden sollte. Wir übten die fast vergessenen Formen des Schützengefechts und des
Bewegungskrieges, auch wurde eifrig mit Gewehr und Maschinengewehr geschossen. Wir hegten keinen Zweifel daran, dass
der große Plan gelingen würde.
Den ganzen Winter 1917/18 über plante der Generalquartiermeister Ludendorff die deutsche Offensive. Zwar hatten die
Vereinigten Staaten von Amerika dem Deutschen Reich am 6. April 1917 den Krieg erklärt, aber vor dem Sommer des
Jahres 1918 war mit dem Auftreten von US-Truppen in relevanter Größenordnung nicht zu rechnen. Der deutschen Führung
blieb nur ein schmales Zeitfenster, um die Niederlage und den zu erwartenden Diktatfrieden abzuwenden. Ypern,
Armentieres, Arras, Cambrai oder Verdun wurden ernsthaft als Schauplätze erwogen. Ludendorf entschied sich für einen
Angriff zwischen Cambrai und La Fere – genau an der Nahtstelle zwischen der Französischen Armee und dem britischen
Expeditionscorps.
Der Fluss Somme bildete die Grenze zwischen Franzosen und Briten. Die Briten – nicht die Franzosen – sollten das Ziel
des Vorstoßes werden. Ihre Stellungen waren nur 130 Kilometer von der Kanalküste entfernt. Beim erreichen der
Sommemündung wäre die gesamte britische Armee eingeschlossen gewesen, denn hinter ihnen lag die Straße von Dover.
Am 21. März 1918 begann die letzte entscheidende Offensive des deutschen Westheeres im Ersten Weltkrieg. Der
Angriffsstreifen war 75 Kilometer breit. Dort hatte Ludendorff 43 Angriffsdivisionen konzentriert, dahinter 30
weitere Reservedivisionen, ihnen standen lediglich 26 britische Divisionen gegenüber. „Michael“ – so der Deckname der
„Kaiserschlacht“ – lief dank Ludendorffs akribischer Vorbereitung gut an. Der britische Oberbefehlshaber General
Douglas Haig erkannte die Chance, welche die Deutschen in dieser Situation hatten. Wollten die Deutschen diese Chance
nutzen, mussten sie darauf verzichten die Somme zu überschreiten, wo sie auf die französischen Reserven treffen und
sich von der Küste entfernen würden. Genau diesen Fehler begingen jedoch die Deutschen.
Am dritten Tag überschritt der linke Flügel mit der 18. Armee die Somme. Ludendorf stellte die Taktik über die
Strategie, wie er das bei Tannenberg und der Schlacht an den Masurischen Seen auch schon getan hatte. Ludendorffs
Befehl an die 18. Armee vom Abend des 22. März 1918 lautete: „Jetzt gilt es den Sieg auszunutzen, den Feind nicht zum
Stehen kommen zu lassen, Somme und Crozat-Kanal zu überschreiten, bevor feindliche Verstärkungen wirksam werden“.
Was Haig befürchtet hatte, trat nicht ein. Die deutsche Offensive Lief weiter Richtung Süden und lief sich schließlich
tot. Am 31 März war Ludendorff zu der Erkenntnis gekommen, dass „Michael“ gescheitert war. Am 5. April wurde die
Einstellung der Offensive befohlen. Im Hochsommer waren die US-Truppen in Frankreich angekommen und gingen mit den
Franzosen zum Angriff vor. Nur mühsam konnten Hindenburg und Ludendorf den Zusammenhalt der Front waren. Am 24. Oktober
1918 forderte US-Präsident Woodrow Wilson die bedingungslose Kapitulation, am 11.Nuvember Wurde der Waffenstillstand
von Compiegne unterzeichnet.
Zusammenbruch der Westfront und Waffenstillstand .
Als die Offensive dann letztendlich gescheitert war, wurden wir auf Eisenbahnwaggon verladen, in
eine Stellung vor Verdun gebracht und der siebenten bayerischen Division zugeteilt. Als wir ausgeladen wurden nahm der
Franzose den Bahnhof unter Beschuss. Eine Granate traf einen Waggon der mit Seifenpulver beladen war, so dass der ganze
Bahnhof aussah als wäre gerade Neuschnee gefallen. Wir gingen auf die Suche nach Kartoffeln. Als ich mit einem Sack,
vollbeladen die Böschung runter ging um zur Feldküche zu gelangen, schlug unweit von mir eine Granate ein und riss mir
den Sack vom Rücken. Ich bin mit dem Schrecken davon gekommen, mir war nichts passiert.
Der Bahnhof war menschenleer, nur ein par Kaninchen liefen verschreckt durch die Gegend und einigen Kameraden gelang
es welche einzufangen. Am nächsten Tag gelang es uns endlich die Feldküche zu erreichen. Als wir gerade beim Essen
fassen waren, schlug unweit eine Granate ein so dass Pflastersteine das Dach durchschlugen und wir das Weite suchen
mussten. und wir wieder nichts zu Essen bekamen. Ein Friseur aus unserer Kompanie fuhr immer ins Hinterland um uns
mit Proviant zu versorgen. Als er 14 Tage vor dem Zusammenbruch wieder mal zurückkam erzählte er uns schon das der
Krieg nicht mehr lange dauern würde, weil Kaiser Wilhelm mit Frack und Zylinder bekleidet, Deutschland verlassen und
ins Ausland gehen würde. In unserer Einheit hatten wir auch einen Juden der glaubte dass er sich alles erlauben darf.
Eines Morgens ging er in die Küche, als er keinen Koch vorfand stieg er auf die Gulaschkanone und hob den Deckel vom
Kessel in dem der Kaffee kochte an. Der kochende Kaffee verbrühte seine Füße so sehr das er sofort ins Lazarett musste,
für ihn war der Krieg somit zuende. Es kam noch ein Erlass, das Kameraden die 2 Jahre aktiv gedient hatten und
Gefreiter waren sofort zum Sergeanten befördert wurden. Für den 11. November 1918 war ein Waffenstillstand vereinbart
und ab 11 Uhr sollte nicht mehr geschossen werden. Wir hatten unsere Kopfkissen aufgetrennt und eine Kissenschlacht
veranstaltet, um auf diese Art und Weise unserer Freude Ausdruck zu verleihen. Als die Federn durch die Luft flogen
brachen wir in Tränen aus.
In jeder Kompanie wurde ein Soldatenrat gewählt, der aus drei Mann bestand. Wenn der Kompanieführer jemanden bestrafen
wollte, musste er erst den Soldatenrat fragen, der die Strafe befürworten, aber auch ablehnen konnte. Die Offiziere
durften keine Achselstücke mehr tragen, was für sie einer Degradierung gleich kam. Wir waren in einem Dorf
einquartiert und morgens zum Appell angetreten, als einer vom Soldatenrat sich stockbesoffen vor den auf dem Pferd
sitzenden Kompanieführer stellte und schrie: „Alles hört auf mein Kommando”. Der Kompaniechef war wie vom Blitz
getroffen, ihm versagte die Stimme. Wir sahen ein das dies nicht so weiter gehen kann und wählten einen neuen
Soldatenrat. Unser Rückzug begann bei Konflanz, einer Vorfestung von Metz und führte uns zunächst über die
luxemburgische Grenze, wo wir in einem Ort einquartiert wurden. Als wir für die Küche Holz aus dem Wald holen gingen,
entschieden wir uns eine Eiche abzusägen, ohne uns dessen bewusst zu sein, in welchem Forst wir uns befanden. Als wir
beim fällen waren fielen plötzlich Schüsse, die wir auch sofort erwiderten, bis uns ein Elsässer der sich in unserer
Kompanie befand aufklärte: „Kameraden, wir befinden uns hier auf Luxemburgischem Hoheitsgebiet”.
Wir sind dann weiter durch das Fürstentum Birkenfeld marschiert, wo das Städtchen Merzig für uns geflaggt hatte. Das
Elsass haben wir auch noch kurz gestreift. Wo wir bei einem Bauern, der uns kein Stroh für das Nachtlager geben wollte,
einquartiert wurden. Daraufhin gingen wir in die Scheune und haben uns selbst was besorgt. Wir haben dann noch erfahren,
sie hätten ein Schwein geschlachtet und warteten auf den Einzug der Franzosen. Als wir uns 1917, an der Ostfront, in
den in Karpaten, im Einsatz befanden, waren unter uns auch viele Elsässer. Sie durften ihre Heimatpost nicht in
französischer Sprache schreiben, mussten ihre Briefe offen auf der Schreibstube abgeben, wo sie zuerst kontrolliert
und dann abgeschickt wurden. Als ich in einer Nacht, mit einem Elsässer auf einem Vorposten Wache schieben musste,
wollte er mich überreden zum Russen überzulaufen. Als ich darauf nicht eingehen wollte verschwand er plötzlich in der
Dunkelheit und ich habe ihn nie wieder gesehen.
Wir sind dann weiter Richtung Worms und Ludwighafen gezogen, dort wurden wir bei einem Mühlenbesitzer einquartiert,
ein Unteroffizier und vier Mann. Obwohl wir verlaust und verdreckt waren bestand die Müllerin darauf das wir in ihren
Betten übernachteten. „Wenn alles durch ist”, sagte sie, „werde ich alles gründlich reinigen”. Der Müller brachte uns
eine Gießkanne voll Wein und sagte wir sollen es uns Schmecken lassen. Wir haben reichlich davon Gebrauch gemacht, so
dass ich gar nicht weiß wie ich ins Bett kam. Das war meine Erinnerung an die Pfalz. Manchmal waren wir auch 2 Tage im
Quartier.
Vor dem Weitemarsch wurde uns immer gesagt welche Truppe die Vorhut und welche Truppe die Nachhut übernehmen sollte.
Die Nachhut hielt immer Verbindung zu den nachrückenden Franzosen und man muss staunen wie alles reibungslos, ohne
Zwischenfälle von statten ging, was wir in erster Linie dem General-Feldmarschall Paul von Hindenburg zu verdanken
haben, der den Rückzug an der Westfront koordiniert hat.
In Köln angekommen, erhielten wir im Volkshaus unsere Entlassungspapiere, Eisenbahnfahrscheine, Reisepässe,
unterschrieben von Oberstleutnant Mann. Wir mussten Köln umgehend verlassen, weil schon am nächsten Tag die
französischen Besatzungstruppen in einmarschieren sollten. Wir fuhren mit einem Zug der bis Allenstein fuhr, dort
wurden unsere Papiere vom Soldatenrat kontrolliert. Die jüngren Jahrgänge wurden festgehalten, zu neuen Einheiten
zusammengestellt und zur Sicherung der Ostgrenze gegen die Bolschewisten abkommandiert. Ich hatte gesagt das ich noch
einen Schrapnellsplitter in der Kreuzbeingegend habe und durfte daraufhin nach Hause fahren.
Kaum in Ortelsburg angekommen fiel ich wieder dem Soldatenrat in die Hände. Sie haben alles durchsucht, haben mir mein
Seitengewehr und eine Decke abgenommen, aber ich durfte weiter und bin dann kurz vor Weihnachten 1918 auf dem
elterlichen Hof angekommen. Schon auf dem Hof habe ich meine Kleider vom Leib gerissen, weil vor Läusen und anderem
Ungeziefer nicht mehr aushalten konnte und mich erst gründlich gewaschen bevor ich das elterliche Haus betreten habe.
Die Freude über das Wiedersehen war sehr groß.
“ Unser Leben zwischen den beiden Weltkriegen.”
Endlich wieder zurück in der Heimat
Rohmanen war durch die Kampfhandlungen 1914/15 zu einem drittel zerstört worden, aber schon
wieder im Aufbau. Die Firma Grzella aus Ortelsburg hatte die Bauarbeiten übernommen. Unter der Aufsicht von Polier
Karl Kontor wurden die Dachstühle errichtet. Ich habe mich, nach kurzer Erholungspause, auch als Zimmermanngehilfe am
Wiederaufbau beteiligt. Die Firma Grzella hat das Material geliefert und auch unsere Löhne gezahlt. Wegen meinem
Steckschuss bin ich dem VDK beigetreten und habe mit dessen Hilfe eine Rente beantragt die mir auch bewilligt wurde.
Nach vier Jahren wurde ich nach Allenstein zur Nachuntersuchung vorgeladen. Die ärztliche Untersuchung hatte ergeben,
das Geschoß sei verkapselt, und nur das linke Bein etwas in Mitleidenschaft gezogen. Daraufhin wurde die Rentenzahlung
eingestellt.
Der Stellmacher Adam Ornowski war im Krieg als Sanitäter eingesetzt und hatte auf Grund seiner Erfahrungen,
 Beziehungen zum medizinischen Dienst in Ortelsburg aufgebaut. Es wurden dort Lehrgänge in Erster Hilfe angeboten,
die von Prof. Dr. Kutz geleitet wurden. Adam Ornowski hat dafür gesorgt das einige junge Männer aus Rohmanen daran
teilnehmen konnten. Adam Ornowski, August Linka, Emil Rosowski, Johann Dembek, Emil Baschek und ich sind dann dem
Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes beigetreten und mussten jeden Sonntag am Lehrgang teilnehmen. Unser
Gruppenführer war Kreisobersekretär Albrecht, Landrat von Poser, als unser Ehrenvorsitzender, hat viel zu unserer
finanziellen Unterstützung beigetragen und hat dafür gesorgt dass die Bereitschaft eingekleidet wurde.
Beziehungen zum medizinischen Dienst in Ortelsburg aufgebaut. Es wurden dort Lehrgänge in Erster Hilfe angeboten,
die von Prof. Dr. Kutz geleitet wurden. Adam Ornowski hat dafür gesorgt das einige junge Männer aus Rohmanen daran
teilnehmen konnten. Adam Ornowski, August Linka, Emil Rosowski, Johann Dembek, Emil Baschek und ich sind dann dem
Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes beigetreten und mussten jeden Sonntag am Lehrgang teilnehmen. Unser
Gruppenführer war Kreisobersekretär Albrecht, Landrat von Poser, als unser Ehrenvorsitzender, hat viel zu unserer
finanziellen Unterstützung beigetragen und hat dafür gesorgt dass die Bereitschaft eingekleidet wurde.
In jedem Dorf wurde eine Unfallstelle eingerichtet, mit einem Verbandskasten und mit Verbandsmaterial für die erste
Hilfe ausgerüstet. Die Unfallstelle in Rohmanen, die am Haus von der Straßenseite, durch eine Tafel mit einem roten
Kreuz gekennzeichnet war, hatte ich zu verantworten. An Sonntagen wurden wir an Badestellen und bei Fußballspielen
eingesetzt, haben viele Übungen bei Waldbränden durchgeführt und auch Ausflüge nach Rudzany am Niedersee gemacht. Bei
der Einweihung des Tannenbergdenkmals in der Nähe von Hohenstein kamen wir an Straßenkreuzungen zum Einsatz.
Rohmanen hatte auch eine freiwillige Feuerwehr. Bis zum ersten Weltkrieg hat Friedrich Biella als Brandmeister das
Kommando gehabt. Er war aktiver Unteroffizier, hatte gute Führungsqualitäten und die Männer, die allesamt aus dem
aktiven Militärdienst stammten hatten zu ihm ein großes Vertrauen. Nach dem Krieg wollten diese Männer,
(Friedrich Nickel, Friedrich Willam, Julius Wittkowski, Jakob Janowski, Johann Gloddek, Gustav Bednarz), nicht mehr
weitermachen. Friedrich Biella, der inzwischen zum Gemeindevorsteher gewählt wurde, hat sich dann auf einer
Gemeinderatsitzung vorgeschlagen, für die Freiwillige Feuerwehr jüngere Kräfte anzuwerben.
Zum Brandmeister hat er Herrn Wilhelm Pilath vorgeschlagen. Der wurde dann nach Königsberg zur Fortbildung geschickt.
Der Feuerwehr gehörten nun folgende Personen an: Wilhelm Pilath(Brandmeister), August Linka(Stellvertreter), Gustav
Deptolla, Julius Matzey, Johann Dembek, Willy Willam, Gustav Rattay. Der Kreisbrandmeister war Heinrich Thalmann aus
Ortelsburg, sein Stellvertreter war Kreisobersekretär Salzmann. Der Bezirks-Kommissar bei der Ostpreußischen
Feuersozität War Herr Ernst Trzaska. Er hat dafür gesorgt das die Wehr uniformiert und mit Löschgeräten ausgerüstet
wurde. Da die alten Schläuche schon sehr marode waren, wurden sie durch moderne ersetzt, deren Kupplungen auch mit der
Motorspritze übereinstimmten.
Ernst Trzaska hat bei der Feuersozität und beim Landratsamt Finanzmittel beantragt und auch genehmigt bekommen. Der
Schneidermeister Wilhelm Baran wurde beauftragt Tuch und Drillichanzüge nach Maas zu schneidern. Er hat uns
Stoffmuster vorgelegt aus denen wir wählen sollten. Feuerwehrhelme haben wir auch bekommen. Die Gemeinde musste
Finanzmittel bereitstellen, einen Prozentsatz vom Gemeindebudget. Im Brandfall mussten für den Spritzenwagen Pferde
zur Verfügung stehen, von Willy Willam, Gustav Rattay, Julius Matzey und Gustav Dorka, weil sie in der Nähe des
Spritzenhauses wohnten. Am Spritzenhaus wurde ein großer Baum mit Querleisten aufgestellt, wo nach jedem Brand oder
einer größeren Übung die Schläuche zum trocknen aufgehängt wurden.
Der Kreisbrandmeister hat mindestens 2-3-mal im Jahr die Wehren besichtigt. Das ganze Dorf war dann auf den Beinen,
die Bauern mit Pferden, und andere Dorfbewohner mit Eimern und Spaten, wurden dann in verschiedene Gruppen eingeteilt.
Erst hat die Wehr sämtliche Aufstellungen am Gerät geübt; Grundstellung Fahrstellung und Marschstellung. Dann wurde
ein Brand angekündigt, die Feuerwehr mit der Spritze an den Brunnen, die Gruppen dort wohin sie beordert wurden, die
Bauern brachten mit den Wasserkiwen Wasser aus dem Brunnen zum Brandort. Wenn das Wasser im Brunnen alle wurde hat
man den Saugkorb in die Kiewen gelegt und dort Wasser entnommen. Die Wassergruppe ging mit Eimern zum Dorfteich, holte
Wasser und füllte damit die leeren Kiewen.
Der Löschtrupp ging mit Feuerhaken und Löschpatschen auf die umliegenden Gehöfte und versuchte das vermeintliche Feuer
von ihnen fernzuhalten. Nach dem Alarm wurde wieder am Spritzenhaus angetreten. Die Gruppenführer mussten angeben ob
ihre Gruppe auch vollständig erschienen war, denn Übungen wurden nur vor, oder nach der Feldarbeit durchgeführt, so
dass niemand eine Entschuldigung vorbringen konnte. Wer ohne begründete Entschuldigung nicht anwesend war erhielt eine
Verwarnung. Der Kreisbrandmeister erklärte dann welche Handgriffe den Vorschriften entsprachen und welche nicht. Die
Schläuche wurden noch schnell zum Trocknen aufgehängt. Anschließend gingen wir alle in den Gasthof Trzaska, haben über
vorhandene Mängel diskutiert, Verbesserungsvorschläge unterbreitet und zwischendurch den Durst gelöscht. Der
Kreisbrandmeister ist dann, nach einer kurzen Verabschiedung, ins nächste Dorf gefahren, weil er an einem Tag mehrere
Feuerwehren betreuen musste.
Der Rohmaner Dorffriedhof

Einen Kilometer vom Ende des Dorfes entfernt, auf der rechten Seite der Landstraße in Richtung
Ortelsburg, befand sich der Rohmaner Dorffriedhof. Wann dieser Friedhof angelegt wurde entzieht sich meiner Kenntnis.
Nach Aussagen älterer Dorfbewohner soll davor auch schon eine Ruhestätte vorhanden gewesen sein, und
zwar auf der linken Straßenseite gegenüber dem jetzigen Friedhof. An dieser Stelle befand sich bis in die
Nachkriegszeit ein kleiner Brunnen, aus dem die Dorfbewohner, das Wasser zum begießen der Grabbepflanzung auf den
Gräbern ihrer verstorbenen Angehörigen holten. Der Friedhof war in einer Hanglage angelegt, wahrscheinlich weil diese
Parzelle für eine landwirtschaftliche Nutzung nicht geeignet war. Um das Gräberfeld vor herumstreunenden Tieren oder
von der Weide entlaufenen Kühen zu schützen, hat man das ganze Gelände mit einem Holzzaun umgeben. Der Zugang befand
sich von der Straßenseite. Unter einem Torbogen hindurch wurden die Verstorbenen zu Grabe getragen. Die Gräber der
einzelnen Familien waren nebeneinander angelegt, mache, wie zum Beispiel die der Familie Trzaska, sogar mit einem
schmiedeeisernen Zaun eingefasst.
Nach dem 2. Weltkrieg verfiel der Friedhof immer mehr. Die nötigen Finanzmittel für die Pflege der Einfriedung konnten
von den restlichen noch verbliebenen Deutschen nicht mehr aufgebracht werden. An den gepflegten Gräbern konnte man noch
erkennen dass es Verwandte von noch in Rohmanen wohnenden Deutschen waren, oder von bereits im Westen Deutschlands
lebenden, die ihre noch in Rohmanen wohnenden Nachbarn damit beauftragt hatten. Die übrigen Gräber wurden von Jahr zu
Jahr immer mehr von Wildkräutern überwuchert und schließlich auch von Sträuchern und schnell wachsenden Bäumen.
In den späteren Jahren konnte man nicht mehr erkennen dass dort vor Jahren Tote zur letzten Ruhe gebettet wurden. Die
Natur holte sich das ganze Gelände zurück und nur unter großen Schwierigkeiten konnten Besucher aus dem Westen das
Friedhofsgelände noch betreten.
Das Gasthaus Trzaska

Nach dem ersten Weltkrieg hat der Gastwirt Friedrich Trzaska neben dem Gasthof einen großen Saal
für Festlichkeiten und Vereinsfeiern gebaut, in dem schon mal Feuerwehrfeste veranstaltet wurden. Ernst Trzaska war
Feuerkommissar bei der Ostpreußischen Feuersozität. Erich Trzaska war Vollziehungsbeamter beim Amtsgericht in
Ortelsburg. Unser Feuerkommissar war uns beim organisieren der Veranstaltungen sehr behilflich, hat uns den Saal, die
Musik und die Theaterstücke besorgt und die Feuerwehren aus den Nachbardörfern eingeladen.
Zu Manöverzeiten, vor dem 2. Weltkrieg und dann auch während des Krieges, waren im Gasthof Soldaten, meist im Range
eines Offiziers, einquartiert. Fräulein Mariechen Trzaska hat die Poststelle im Dorf betreut. Nachdem ich 1939 zum
Militär eingezogen wurde, hat sie, nach einer Schulung im Ortelsburger Krankenhaus, auch die Unfallmeldestelle
übernommen. Nach dem Krieg, pflegte sie mit vielen Bekannten, die bereits in der Bundesrepublik wohnten, einen regen
Briefwechsel. Auf dem Rohmaner Friedhof hat sie viele Gräber, im Auftrag von Angehörigen, die auf Grund ihrer
Abwesenheit, dazu nicht mehr in der Lage waren, gepflegt. Der Bauunternehmer Kurnitzki aus Ortelsburg, äußerte die
Bitte, sie möchte ihm doch ein Blatt vom Rosenstrauch, der auf dem Grab seiner Eltern steht, in den Brief legen. Als
sie uns den Brief vorgelesen hat, waren wir zu Tränen Gerührt. Sie hat als Letzte aus ihrer Familie, bis zu ihrem Tod
im Jahre 1960, in Rohmanen, im Gebäude der Gastwirtschaft gewohnt und ist auf dem Rohmaner Friedhof beerdigt worden.
Fleisch und Wurstwaren Karl Pelkowski
Im Jahr 1931 hat der Fleischermeister Karl Pelkowski, aus Grammen, direkt neben unserem Hof ein
Anwesen gekauft und dort eine Fleischerei eingerichtet. Er war mit meiner Schwester Frieda, verheiratet. Am Anfang hat
er die Schweine noch auf seinem Hof geschlachtet, später dann im Ortelsburger Schlachthof. Jede Woche fuhr er 2-mal,
mit dem Pferdewagen(Einspänner), nach Ortelsburg zum Wochenmarkt, wo er seine Fleisch und Wurstwaren zu Verkauf anbot.
Am Tag davor, wenn er die Wurst gekocht hat, kamen viele Rohmaner mit Kannen oder anderen Gefäßen, wegen der guten
Wurstsuppe, die er umsonst unter die Leute verteilte. Als Karl Pelkowski, Ende August 1939 zum Militär eingezogen
wurde, hat seine Frau das Pferd verkauft und den Beitrieb stillgelegt. Am Haus hing, immer noch die Tafel mit der
Aufschrift: Karl Pelkowski, Fleisch und Wurstwaren. Ein Witzbold hat irgendwann darunter geschrieben; „Fleisch und
Wurst waren einmal”, drauf hin hat Frau Pelkowski die Tafel entfernen lassen. Karl Pelkowski ist im Mai 1946 in
französischer Gefangenschaft verstorben. Seine Ehefrau Frieda, verstarb an ihrem 85. Geburtstag in Mettmann bei
Düsseldorf.
Die steinreichen Rohmaner Felder
Die letzte Eiszeit hat bei der Schmelze, auf der Rohmaner Feldgemarkung viele Steine und
Granitblöcke zurück gelassen. Überirdisch, aber besonders unter der Erde, gab es viele kleine, aber auch große Steine,
die, den Bauern, beim Pflügen und anderen Feldarbeiten sehr viel Schweiß, abverlangten. In einer Kiesgrube, auf dem
Feld des Bauern August Radek, lag ein Granitblock, von schätzungsweise 100 cbm. Vor etwa 80 Jahren, als man für diese
Steine noch keine Verwendung hatte, griffen die Bauern zu einer „List”. Weil er sonst nicht pflügen konnte, hat mancher
seinem Nachbarn, die Steine in der Nacht auf dessen Feld abgeladen. Als diese Tätigkeit unter Strafe gestellt wurde,
hat man die Steine in Schluchten gekippt und mit Mutterboden zugeschüttet. In späteren Jahren kam diese jedoch beim
pflügen wieder an die Oberfläche. Dann hat man aber schon Steine für den Straßenbau gebraucht und konnte sie so zu Geld
machen. Besonders im Raum südlich von Ortelsburg, bis zur polnischen Grenze, wo Steine eine Rarität waren, kamen sie
jetzt zum Einsatz. Auch beim Bau von Häusern, besonders für die Fundamente, wurden sie eingesetzt, weil auf diese
Weise viel Ziegeln eingespart wurden. Die Firma Gribienski aus Ortelsburg hat die großen Steine mit Dynamit gesprengt
und auf diese Weise die weitere Verarbeitung erleichtert.
Die Steine welche beim Pflügen aus dem Boden geholt wurden, hat man am Feldrand auf große Haufen zusammen getragen.
Wenn die Feldarbeit beendet war, sowie auch in den Wintermonaten, waren wir jeden Tag mit Steinen unterwegs. Wir sind
vorwiegend am Abend los gefahren, weil unter der schweren Last die Wagenachsen so heiß wurden und die Gefahr bestand,
das durch die Dehnung, die Räder blockiert würden. Bei einer Fahrt konnte man bis zu 24 Reichsmark verdienen, wogegen
1 Zentner Roggen für 8 bis 9 Reichsmark zu haben war. Ich bin selbst, mit dem Pferdewagen bis Fürstenwalde, Radostowen,
Luka, Altkirchen, Höhenwerder, ja sogar bis Friedrichshof gefahren.
In Rohmanen wurden auch rote Ziegeln gebrannt. Viele Häuser wurden, mit Ziegeln erbaut, die nur wenige 100 Meter von
der Baustelle entfernt hergestellt wurden. Der Lehn wurde auf den Feldern in der näheren Umgebung entnommen, dann von
Ochsen solange getreten, bis er so geschmeidig war, das er sich in Formen einstreichen ließ. Wenn die Ziegel in der
Form trocken war, wurde sie entnommen und in einem Brennofen gestapelt. Um einen Ofen richtig anzufeuern, brauchte man
12 Raummeter Holz, das im Zeitraum von ein par Tagen verheizt wurde. Der Fischer Karl Glitza hatte schon eine
Knetmaschine, die von einem Pferd angetrieben wurde, das mit verbundenen Augen, den ganzen Tag in die Runde ging.
Im Dorf waren auch vier Kalköfen, in denen so genannte Kalksteine, die sich an gewissen Stellen, im Erdboden befanden,
gebrannt wurden. Nach dem Brennen wurden die Steine mit Wasser abgelöscht und die daraus entstandne Masse diente, nach
dem Beimischen einer gewissen Menge Sand, dann als Bindemittel beim Häuserbau. Das Gerichtsgebäude und das
Lehrerseminar in Ortelsburg wurden mit Kalk, aus dem Rohmaner Brennöfen erbaut. Auch zum Bau einer Eisenbahnbrücke, auf
der, der Zug, den Sawitzfluß, von Ortelsburg nach Allenstein überquerte, hat mein Großvater, mit einem Ochsengespann,
Kalk gefahren.
Hinter der Scheune, beim Bauern Johann Dembek hat man Tonerde gefördert, aus der man mit Hilfe einer Formerscheibe,
die von einem Arbeiter mit Muskelkraft(Fußbetrieb) angetrieben wurde, schöne Krüge, Schalen und Vasen geformt hat.
Die Töpferware wurde, nachdem sie trocken genug war, auch in einem Ofen gebrannt, anschließend mit einer Lasur
überzogen und wieder gebrannt. Es wurden auch Kacheln zum Bau von Kachelöfen hergestellt, die mit verschiedenen
Ornamenten versehen, die Wohnstuben unserer Vorfahren schmückten. So haben unsere Großväter ihr Leben gemeistert und
nach und nach, unsere Dörfer aus der Rückständigkeit in die Neuzeit geführt.
Das gesellschaftliche Leben nach dem 1. Weltkrieg

Als der Lehrer Alfred Dorka, ein Frontkämpfer des Ersten Weltkrieges und ein Sportsmann, als
zweite Lehrkraft an der Rohmaner Schule angestellt wurde, hat er die Sitten und Gebräuche aus früherer Zeit wieder zum
Leben erweckt. Zuerst hat er die Jugend zusammen gerufen, einen Jugendverein und einen Fußballclub, gegründet. Zum
Vorsitzenden des Fußballclubs wurde Johann Gloddek berufen, der ihn auch geleitet hat. Bauer Wilhelm Spittka, der am
Rohmaner See wohnte, stellte Land für einen Sportplatz unentgeltlich zur Verfügung. Lehrer Alfred Dorka hat am
Rohmaner See eine Badestelle ausgesucht und ein Sprungbrett bauen lassen. An jedem Sonnabend im Sommer, bevor die
Sonne unterging, versammelte sich die gestammte Jugend des Dorfes an der Badestelle am See. Es wurde gebadet,
Heimatlieder gesungen, gespielt, im Fackelschein eines großen Biwakfeuers, bis in die späte Nacht hinein. Der Fischer
Karl Glitza hat uns Kähne zur Verfügung gestellt, mit denen wir auf den See hinausgepaddelt sind, dabei hatten wir viel
Spaß, was wiederum den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft gefördert hat. Ich habe mit meiner Mandoline den Gesang von
Volks- und Heimatliedern begleitet.
Der Rohmaner See liegt in einem Tal, dessen Hänge zu beiden Seiten mit Kiefern und Tannen bewaldet sind. Wenn man
gesungen oder Musiziert hat, hallte es von den Hängen zurück. Die Ufer waren mit Kalmus und Schilf bewachsen, was für
die Fischaufzucht von Vorteil war. Wenn man an einem sonnigen, windstillen Tag, am Seeufer spazieren ging, traf man
oft auf Flachstellen, an denen sich die Fischbrut im Sonnenlicht wärmte, wie ein Mückenschwarm. Im See befanden sich
folgende Fische: Karpfen, Hechte, Schleie, Barsche Plötze, Rotaugen, Aale und Krebse. Am Sonntagmorgen brachten viele
Rohmaner ihre Pferde zum See um sie zu baden.
Es wurden dort, unter der Aufsicht von Lehrer Dorka, auch viele Jugendfeste mit Theatervorführungen veranstaltet, zu
denen er selbst die Vorlagen organisiert hat. Der am See wohnende Bauer Johann Nadrowski, hat uns ein Scheunentor, als
Tanzboden zur Verfügung gestellt. Der Zimmermann Wilhelm Wittek hat uns eine Windmühle gebaut, die am auf dem Boden
liegenden Scheunentor aufgestellt wurde, dazu kamen Noch Tannen und Fichten, die das Ganze wie ein Bühnenbild
erscheinen ließen. Es wunden viele Bühnenstücke aufgeführt, unter anderen >Alte Weiber werden jung gemahlen<. Dazu bot
die Windmühle die entsprechende Kulisse.
Nach der Vorführung wurde der Boden aufgeräumt, um dann als Tanzdiele zur Verfügung zu stehen. Der Gastwirt Trzaska
hatte Tische und Bänke aufgestellt, Speisen und Getränke angeboten, so dass sich die die Veranstaltung bis in die
späte Nacht hinein zog. Es waren auch Leute aus Ortelsburg und anderen Nachbardörfern dabei. Im Winter hat Lehrer
Dorka eine Kreisrodelbahn eingerichtet, die von Zeit zu Zeit mit Wasser besprengt wurde, um die Gleitfähigkeit zu
verbessern. Von einer Anhöhe ging hinunter bis auf den halben See, was für alle ein großes Vergnügen war. Es kamen
Lehrer mit Schulklassen aus der näheren Umgebung um hier zu Rodeln.
Als Herr Lehrer Jobski als Hauptlehrer nach Rohmanen kam hat er mit dem Bürgermeister und der Gemeindeverwaltung
beschlossen, in der Nähe des Dorfes, auf einem zur Schule gehörenden Grundstück, einen Sportplatz anzulegen. Dafür
wurde gleich hinter den Gärten, 6 Morgen Ackerland abgetrennt, und nach Feierabend hat Lehrer Dorka mit den
Jugendlichen eingeebnet und gleich nebenan einen Graben für Schützenstand und Kugelfang ausgehoben. Am Sonntagvormittag
wurde Fußball gespielt und um 15:00 Uhr war Kleinkalieberschießen angesagt. Es musste auch ein kleiner Beitrag erhoben
werden, um Munition kaufen zu können. Eine Büchse konnten wir aus beim Kleinkalieberverein in Ortelsburg ausleihen.
Nach Hitlers Machtergreifung
Als Adolf Hitler an die Macht kam wurde die SA gegründet. Der Bürgermeister Michael Kownatzki
wurde zum Gruppenführer ernannt und folgende Männer haben sich freiwillig gemeldet: Wilhelm Matzey, Johann Gloddek,
Gustav Nadrowski, August Buttler, Karl Baran, Emil Nickel, Wilhelm Jaschinski, Emil Bork, Ernst Rattay und Gustav Bach.
Bei Versammlungen war die SA in Uniform angetreten um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Wer versucht hat Unruhe zu
stiften, egal aus welchem Grunde, wurde aufgefordert den Saal zu verlassen, andernfalls wurde er mit Gewalt entfernt.
Herr Lehrer Jobski wurde zum politischen Leiter ernannt, seine Frau hat die NS-Frauenschaft gegründet, Lehrer Dorka
die HJ, und so bekam die Dorfgemeinschaft, nach und nach ein anderes Gesicht. Der Sportplatz und der Schützenstand
wurden jetzt mehr als früher in den Mittelpunkt gestellt. Nach der Feldarbeit hat der Bürgermeister Fuhrwerke bestellt
und den Sportplatz noch besser herrichten lassen.
Der Bauer Wilhelm Both wurde zum Ortsbauernführer ernannt, mit der Aufgabe alles Land für den Anbau von Getreide und
Futtermittel bereitzustellen, oder wenn das nicht möglich war mit Wald aufzuforsten. Durch den Einsatz von Kunstdüngern
sollten größere Erträge aus dem Boden geholt werden, um den Viehbestand zu vergrößern und mehr Milch und Butter zu
produzieren. Deutschland sollte im Stande sein sich selbst zu selbst zu ernähren, ohne auf Importe angewiesen zu sein.
Frau Jobski hat, innerhalb der der NS-Frauenschaft, mit Hilfe von Fachkräften aus Ortelsburg, Lehrgänge veranstaltet,
auf denen man Backen und Nähen lernte. Auf den Bauernhöfen befand sich auch immer mehr Rassegeflügel, das eine erhöhte
Produktion von Eiern und Geflügelfleisch sicherstellen sollte.
Die Rohmaner Bauern hatten, außer in der Landwirtschaft, noch andere Verdienstmöglichkeiten in der Kreisstadt. In
Ortelsburg wurden vier Sägewerke betrieben, die mit Langholz aus dem Walde versorgt werden mussten. Wir haben eine
Kiefer von über 8 Festmeter angefahren, der wir zuerst 6 Meter Spitze abschneiden mussten, um diese Last überhaupt
auf den Wagen zu bekommen. Sechs Pferde musste angespannt werden um den Wagen zur befestigten Straße zu bringen.
Fichten und Tannen wuchsen bis zu einer Länge von 30 Metern. Auch beim Transport von Ziegel, von der Ziegelei zum
Bahnhof, konnte man gutes Geld verdienen.
Im Jahr 1934 wurde Rohmanen an das überregionale Stromnetz angeschlossen und schaffte auf diese Weise den Sprung von
der Petroleumlampe zur Glühbirne. Neben dem Grundstück von Karl Pietzonka wurde ein Transformatorhäuschen errichtet,
in dem der ankommende Strom von einer Hochspannung auf eine Verbrauchsspannung transformiert wurde. Es gab schon eine
Überlandleitung, die aus Richtung Ortelsburg kommend, quer über die Felder, in Richtung Neu Keykuth weiter ging.
Durch eine Zwischenspanne wurde der Transformator, mit der Hauptleitung auf Kownatzkis Feld verbunden.
Ein Stromanschluss konnte die Arbeit im Haus und Hof auf vielfältige Weise erleichtern, doch nur die besser gestellten
Bauern, sowie noch manche Pensionäre, die ein festes Einkommen hatten, konnten sich dass leisten. Weil nur wenige an
der Elektrifizierung teilnahmen, war ein Stromanschluss mit hohen Kosten verbunden. Nur Gustav Pietzonka, Gasthof
Trzaska, Friedrich Nickel, die Schule und Wilhelm Both, wurden in der ersten Phase erfasst.
Im Jahr 1952 wurde von den polnischen Behörden die zweite Stufe der Elektrifizierung eingeleitet, in der alle im Dorf
stehen Gebäude erfasst wurden. Am Anfang wurden nur Leitungen für Lichtstrom gelegt und auch nur 3 Lichtstellen pro
Haushalt bewilligt. Doch im nachfolgenden Zeitraum wurden dann, wenn Material vorhanden war, weitere Lichtpunkte
angelegt. 1952, am zweiten Wochenende im Advent, wurden dann die Leitungen geschaltet und alle waren von der
plötzlichen Helligkeit sehr begeistert. Wenn man Glühbirnen auswechseln wollte musste man am Anfang weite Wege
zurücklegen, um welche zu bekommen. In den 60ger Jahren wurden dann immer mehr Starkstromleitungen gelegt, weil die
Bauern elektrische Geräte kaufen konnten. Ende der 60ger wurden auch die Abbauten an das Stromnetz angeschlossen.
Das Urnengrab auf unserem Feld
Auf unserem Feld, in Richtung Seelonken, bin ich oft beim pflügen gegen Steine gestoßen, manchmal
rissen sogar die Stränge am Pferdegeschirr. Eines Tages nahm ich einen Spaten, Brechstange und einen langen Baum, um
der Sache auf den Grund zu gehen. Als ich eine Menge Sand ausgehoben hatte stieß ich auf eine steile, aus Steinen
errichtete Wand, die ich auch mit dem Baum nicht aus der Fassung bringen konnte. Ich habe den ganzen Vormittag gegraben,
konnte jedoch nicht unter die Steine kommen. Einige Tage später hatten wir in der Schule eine Bauernversammlung, da
habe ich Herrn Biella und Herrn Lehrer Dorka von meinem Fund berichtet. Am nächsten Morgen kam der Lehrer Dorka mit der
ganzen Schulklasse, mit Spaten und Sieben ausgerüstet auf unser Feld und fingen an die ausgehobene Erde zu sieben.
Lehrer Dorka benachrichtigte daraufhin den Leiter des Ortelsburger Heimatmuseums, der am nächsten Morgen vorbei kam um
sich die Fundstelle genau anzusehen. Er beauftragte ihn 4 Mann zu besorgen, um die Steine ringsum frei zu schaufeln.
Zwischen den Steinen durften wir die Erde nur mit Esslöffeln ausheben. Als es plötzlich zu regnen anfing hat Lehrer
Dorka die Brauerei Daum, in Ortelsburg angerufen, die uns über der Fundstelle ein Zelt errichtet haben, damit wir
ungestört weiterarbeiten konnten. Wir fanden 8 flache und 8 hohe Urnen zu beiden Seiten am Körper. Die Urnen wurden in
Gipsbinden eingewickelt und ins Heimatmuseum nach Ortelsburg gebracht, wo sie durch einen Fachmann, der extra aus einem
Königsberger Museum angereist war. Nach Reinigung der Urnen hat er festgestellt, das die Grabstätte etwa 2000 Jahre vor
Christi Geburt angelegt wurde und ein Doppelgrab war, in dem ein Toter liegend und einer in Hochstellung beigesetzt
wurde.
Die Nachricht von der Fundstelle verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Es erschienen viele Schaulustige, ganze
Schulklassen aus der Umgebung, mit Autos und zu Fuß. Durch die vielen Menschen wurden die bestellten Ackerflächen auf
unserem Feld sehr in Mitleidenschaft gezogen, eine Entschädigung haben wir nicht erhalten. Das Grab wurde vor dem
Heimatmuseum in Ortelsburg wieder so aufgebaut wie man es auf unserem Feld vorgefunden hat. Für den Transport der
Steine wurde ich entlohnt. Die Urnen hat das Königsberger Museum an sich genommen und wollte sie nicht wieder hergeben,
weil die solch einen Fund noch nicht in ihrer Sammlung hatten.
Sonnenwendfeuer
Am 24 Juni fand eine Sonnenwendfeier statt. Ein Brauch der an die alten Germanen erinnern sollte.
Der Lehrer Dorka hat den Bürgermeister beauftragt 2 Fuhrwerke in den Wald zu schicken, die Holz und alten Reisig holen
und auf dem großen Schulberg abladen sollten. Das Straßenbauamt hat uns Teertonnen zur Verfügung gestellt. Die ganze
Dorfgemeinschaft wurde eingeladen, am Abend, nach der Feldarbeit, an der Sonnenwendfeier teilzunehmen. Lehrer Dorka
hielt zuerst eine Ansprache, in der er anschaulich erklärte wie unsere Vorfahren in grauer Vorzeit gefeiert haben.
Nach dem offiziellen Teil wurden das Holz und die Teertonnen angezündet, es wurden Heimatlieder gesungen, wie: Wild
flutet der See, drauf schaukelt der Schiffer den schwankenden Kahn, Schaum wälzt er wie Schnee, von grausiger Mitte
zum Ufer heran, wild fluten die Wellen auf Vaterlands See, wie schön, oh trag mich auf Spiegel zu Hügel, Masovias See.
Masovia Land, mein Heimatland, Masovia es lebe mein Vaterland.
Lehrer Alfred Dorka und sein Wirken für Rohmanen.

Friedrich Biella hatte auf seinem Feld einen Granitstein mit einer geraden Seite, den haben wir
mit viel Schweiß an den Dorfteich transportiert und auf einer Erhöhung abgelegt. Der Stein sollte zum Denkmahl für die
Gefallenen des Ersten Weltkrieges umgestaltet werden. Da zu Wenige daran ein Interesse zeigten, wurde diese Idee fallen
gelassen und der Stein irgendwann ins Wasser gerollt. Der Lehrer Dorka war viele Jahre in Rohmanen tätig, dort hat er
später seine ehemalige Schülerin, Lotte Biella geheiratet. Er hat sich sehr für die Entwicklung des Dorfes interessiert,
war bei jeder Gemeindeversammlung anwesend und hat auf Schwachstellen hingewiesen die den Fortschritt behinderten.
Gemeinsam mit den Schülern hat er den Ehrenfriedhof für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges gepflegt, an der
Wegegablung nach Eichtal und zu Ehren des Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg eine Eiche gepflanzt.
Zum Advent hat Lehrer Dorka mit der Jugend einen Adventstern, in verschiedenen Farben gebastelt.
Der Stern wurde auf einer 2 Meter langen Stange befestigt, in der Mitte wurde ein Wachslicht angezündet, am Stern
wurde eine Schnur angebracht, wenn man daran zog rollte der Stern hin und her. Am ersten Wochenende im Advent
versammelten sich jung und alt, um den Stern durch das Dorf zu tragen. Alle schlossen sich dem vorausgehenden
Sternträger an, der den Stern durch die Hauptstraße und die angrenzenden Wege trug. Dieser Sternmarsch wurde an den
folgenden Adventwochenenden wiederholt.
Am ersten Weihnachtfeiertag wurde um 4:00 Uhr morgens ein Frühgottesdienst gehalten. Zuerst hat der Pfarrer eine
Andacht gehalten, dann haben die Kinder ein Krippenspiel aufgeführt und die Gemeinde hat schöne Weihnachtslieder
gesungen. Der Gastwirt Trzaska hat uns den Saal zur Verfügung gestellt. Wir hatten eine Posaunen- u. eine
Gitarrengruppe. Unter der Leitung von Herrn Willi Doormann spielten: Gottlieb Brosch, Fritz Ollech,
Gustav Rattay(Sopran), Wilhelm Pilath, Gustav Brosch(Alt), Fritz Both(Tenor) und Fritz Brosch(Bass).
In der Gitarrengruppe wirkten mit: Martha Ollech, Hedwig Ollech, Martha Lekzik, Martha Michalick und Auguste Lekzick.
Willy Doormann hat sie auf der Geige begleitet.
Kurz vor Ausbruch des 2. Weltkrieges
Bei der Aufstellung des Grenzschutzes(Regiment Buchholz), hat er als Hauptfeldwebel die
Gruppenführerkurse überwacht und selbst die fähigsten Männer dafür vorgeschlagen. Das Ausbildungspersonal hat das
Jäger-Battalion gestellt. Wir kamen zuerst ins Stadion(Waldheim), wurden da eingekleidet und dann ging es gleich
kasernenmäßig zu, theoretisch und praktisch. Jeder musste vor die Front treten und nachweisen ob er im Stande ist,
Befehle zu erteilen. Abends wurden Filme vorgeführt die uns zeigen sollten wie eine Gruppe sich im Gelände entfalten
muss. Die Exerziervorschriften hatten sich, im Verhältnis zu Kaiser Wilhelms Zeiten, etwas geändert. Damals bestand
eine Gruppe aus 8 Mann und einem Unteroffizier, jetzt aus 10 Schützen, 3 für das leichte Maschinengewehr und einem
Unteroffizier(13 Mann). Nach der Schulung folgte eine Abschlussprüfung, danach ein gemütliches Beisammensein. Aus
Rohmanen haben folgende Männer die Prüfung bestanden: Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy, Gustav Rattay und
Gustav Deptolla. Unsere Uniformen waren alle zu klein und es gab viel zu lachen bei der Anprobe.
Die erste Übung habe ich mit Emil Rosowski, in Lenzinen gemacht. Der Gutsbesitzer Marzinzick hat seine Scheune als
Unterkunft zur Verfügung gestellt. Er war im Range eines Hauptfeldwebels. In seinem haus war die Schreibstube
untergebracht, die er selbst verwaltete. Ein Lastauto hatte Uniformen aus der Kaserne in Ortelsburg geholt, jeder
musste eine Uniform anlegen und dann wurde solange getauscht bis alle eine passende gefunden hatten. An den Namen des
Kompanieführers kann ich mich nicht mehr erinnern. 1935 wurden wir zu einer Übung in die Dragonerkaserne nach Lyk
einberufen. Die Gruppenführer, Zugführer, und Kompanieführer die schon Frontberührung im dem Ersten Weltkrieg hatten,
mussten eine Woche früher anreisen. Die Übungen waren auf 6 Wochen angelegt. Die meisten der einberufenen waren noch
nie mit dem Wehrdienst in Berührung gekommen. Jeder Gruppenführer bekam 13 Mann zugeteilt.
Unser Zugführer war Leutnant Neumann, Kompanieführer Oberleutnant Rutschko, Battalions-Kommandeur Major Gröning
(Regiment Buchholz). Hier ging es wieder Kasernenmäßig voran. Das Bataillon wurde hier vereidigt. Jeden zweiten
Sonntag durften unsere Frauen uns besuchen. Ein Jahr später wurden wir wieder zu einer Übung einberufen, auf den
Truppenübungsplatz nach Arys. Jeder Gruppenführer hatte den Auftrag die Gruppe zu entfalten, und auf bewegliche
Figuren zu schießen. Diese Übung musste später mit scharfer Munition wiederholt werden. Jedes Maschinengewehr bekam
50 Schuss, jeder Schütze 20 Schuss zugeteilt. Nach dem Abschießen wurden die Treffer gezählt und dem Kommandierenden
Bericht erstattet. In einiger Entfernung spaziert ein Storch umher, der gar nicht bemerkt hatte dass geschossen wurde,
was bei den Kameraden ein großes Gelächter hervorrief.
Nach der Übung wurde uns gesagt das jeder Gruppenführer eine arische Abstammung nachweisen sollte. Ich konnte in den
Rheinsweiner Kirchenbüchern meine Vorfahren aus Gellen, bis zum Jahr 1732 zurück, nachweisen und wurde zum
Unteroffizier befördert. Aus unserem Dorf wurden auch, Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy und Gustav Deptolla
befördert. Zwischendurch mussten wir schon mal in die Radfahrer-Kaserne nach Ortelsburg, Gewehre empfangen und im
Gelände üben. Am 31 Juli 1939 wurde mir von einem Soldaten ein Schreiben übereicht, das mich aufforderte, am 1. August
um 6:00 Uhr, bei der 3. Kompanie, des 2. Infanterieregiments zu erscheinen.
Um 5:30 hat mich meine Schwester in die Kaserne gebracht. Auf der Schreibstube erklärte mir der Hauptfeldwebel,
dass mir ab sofort der Dienstgrad eines Sanitäters zugewiesen wird, ich mich in der Kammer einzukleiden hätte und mir
in der Handwerkerstube die entsprechenden Schulterklappen annähen lassen sollte. Die aktiven Sanitäter wurden den
Feldlazaretten zugewiesen und wir kamen an ihre Stelle. Unser Bataillon wurde nach Schodmak zum Bunker bauen und
Stacheldraht verlegen eingeteilt. Wir zogen in Begleitung einer Musikkapelle bis zur Kreuzung am Krankenhaus, dann
weiter zu unserem Bestimmungsort, gefolgt von einer Gulaschkanone die in den nächsten Tagen für unsere Verpflegung
sorgen sollte.
Am 14 August haben wir die Jägerkaserne, begleitet von einer Musikkapelle endgültig verlassen und zogen zuerst durch
Ortelsburg, dann über Lehmanen ins Feldmanöver, hinter Rohmanen. Dort entfaltete sich das Bataillon im Gelände, die
Verwundetensammelstelle wurde auf dem Hof des Bauern Friedrich Neumann eingerichtet. Gegen Abend wurde zu Sammeln
geblasen und Biwak bezogen, wobei unsere 3.Kompanie, in einem kleinen Wallt, in der Nähe von Otto Nickels Gehöft
Stellung bezogen hatte. Die 2. und 4. Kompanie hatte sich in der Nähe vom Abbau Pallasch niedergelassen. Die Frau
Nickel hat am Abend ein Mädel in Dorf geschickt um meiner Frau Bescheid zu sagen, wo wir uns zurzeit befinden. Meine
Frau ist dann noch gekommen um sich von mir zu verabschieden, weil wir am nächsten Morgen um 3:00 Uhr Zelte abbrechen
und um 4:00 Uhr in Richtung Kaspersguth marschieren sollten.
Wir sind dann über Achodden, Seelonken, Lehmanen, Ortelsburg, bis nach Grammen und Schützendorf marschiert, wo wir an
einem See Biwak bezogen haben. Es wurde immer gesagt, wir kommen zum Tannenberg-Denkmal bei Hohenstein, wo ein Reichs
Kriegervereinsfest stattfinden sollte. Es wurden auch schon Vorkommandos aufgestellt, doch dann kamen wir nach Orlau
und Lahna-Mühle, da wo die Alle entspringt haben wir 2 Tage biwakiert. Unser Kompanieführer hat uns nach Waplitz auf
den Soldatenfriedhof des Ersten Weltkrieges geführt und uns erklärt wie das Jägerbataillon sich 1914 hier entfaltet
hat und aufgerieben wurde. Dann mussten wir in der Nähe von Gut Koslau über einen Fluss und bezogen in einem Waldstück,
vorbereitete Stellungen in der Nähe der polnischen Grenze. Herr und Frau Thalmann haben uns jeden Tag, bis zur Grenze,
mit Brötchen und Getränken versorgt. Es wurde scharfe Munition ausgegeben, weil wir am nächsten Morgen um 4:00 Uhr die
polnische Grenze überschreiten sollten.
Am nächsten Morgen um 10 Minuten vor 4:00 Uhr kam der Befehl; scharfe Munition abgeben, alles zurück in ein 6 Kilometer
entferntes Dorf, wo wir auch einquartiert wurden. Das alles geschah’ eine Woche vor dem 1. September 1939. Es wurde
gesagt dass der Führer dem polnischen Präsidenten Rid-Szmigly, ein Ultimatum gestellt hat und es wahrscheinlich nicht
zum Krieg mit Polen kommt. Genau nach 5 Tagen kehrten wir wieder in die gleichen Stellungen zurück, es wurde wieder
scharfe Munition ausgegeben und am nächsten Morgen um 4:00 Uhr überschritten wir die polnische Grenze.
“Der 2. Weltkrieg.”
Der erste Einsatz in Polen
Wir kamen zuerst in ein Dorf in dem sich nur alte Menschen befanden. Auf unsere Frage wo denn die Bewohner wären sagte
man uns dass alle geflohen sind, weil erzählt wurde, die Deutschen würden alle Polen misshandeln und verstümmeln. Ich
habe ihnen daraufhin gesagt dass uns, unter Androhung von Strafe verboten wurde, einem Zivilisten etwas anzutun. Das
Vieh, die Schweine und Hunde des Dorfes liefen frei herum und die Soldaten fingen an auf die Hunde zu schießen, bis
gesagt wurde es seien Meldehunde im Dienste der Deutschen Wehrmacht und dieser Unfug der eigenen Truppe schaden würde,
weil etwaige Querschläger eigene Kameraden verletzen könnten. Wir gingen weiter auf polnischer Seite entlang der Grenze,
bis wir am Nachmittag die ersten Vorposten der Festung Mlawa erreichten, da befanden wir uns plötzlich im Feuerhagel
polnischer Festungsflack.
Am nächsten Morgen hatte ich schon 3 Verwundete und wusste nicht wo sich eine Verwundeten Sammelstelle befindet. Ich
suchte den Bataillonsgefechtstand auf der sich auf einer Anhöhe befand. Ich habe unseren Oberstabsarzt gefragt wo denn
die Verwundetensammelstelle wäre. Er rief beim Tross an, wo er die Auskunft erhielt, das sich vor dem Dorf ein Bunker
befindet in dem man die Verwundeten sammeln sollte, die dann von Sanitätsautos abgeholt würden, weil das Dorf unter
Artilleriebeschuss stand. Am Sonnabend haben unsere Flieger die Bunkerstellungen bombardiert, konnten aber, trotz guter
Treffer nicht viel ausrichten, die Bunker wurden nur etwas angekratzt.
Der Beschuss unserer vordersten Linien ging mit unverminderter Heftigkeit weiter. Am Sonntag verkündete eine große
Staubwolke die Ankunft unserer Panzer, doch sie kamen nur bis zur Panzersperre und mussten wieder abdrehen ohne den
Polen einen schaden zuzufügen. Ein Panzer bekam einen Volltreffer, der Fahrer konnte noch umkehren. Er blutete am Kopf
und der Schütze war so eingeklemmt, das wir ihn nur mit einem Seil unter den Armen, durch die Luke nach oben ziehen
konnten. Ob er seine Verwundung überlebt hat ist mir nicht bekannt, denn in der Nacht wurden Panzergeschütze nach
vorne in Stellung gebracht, die direkt in die Schießscharten der Bunker geschossen und so die Verteidiger vertrieben
haben. Daraufhin sind wir weiter vorgerückt. Auf einer Wiese war ein tiefer Graben ausgehoben und mit Ästen getarnt,
da war ein Panzer hinein gefahren, so dass nur das Hinterteil herausragte und er sich nicht aus eigner Kraft befreien
konnte. In der Luft waren Flieger die Brandbomben abwarfen, ich habe mich auf den Boden geworfen weil ich dachte die
würden explodieren, aber sie zischten nur, so das Stoppeln und Graß rings herum in Brand gerieten.
Bei den Kampfhandlungen gab es mehrere Verwundete, denen ich gerade Verbände anlegen wollte, als unser Hauptmann zur
Trillerpfeife griff um mir klar zu machen, dass ich ihm folgen sollte. Die Polen fingen an zu schreien, ich sollte
sie ins Lazarett bringen denn hier im Wald würde sie niemand finden. Ich setzte mich aufs Fahrrad und folgte unserem
Kompanieführer, der mir sagte ich soll immer bei der kämpfenden Truppe bleiben, denn hinter der Front sind die
Sanitätsabteilungen, die werden die Verwundeten schon versorgen. Der Vormarsch dauerte bis in die späte Nacht. Auf
einem Gehöft, das nach allen Seiten durch Feldwachen abgesichert wurde, machten wir endlich Rast. Wir haben
Getreidegarben auf dem Hof ausgebreitet und uns zur Ruhe gelegt, als plötzlich um Mitternacht Leuchtraketen den Himmel
erhellten und Maschinengewehrfeuer uns aus dem Schlaf schreckte. Ein par polnische Soldaten hatten das Feuer eröffnet,
aber sich kurz darauf ergeben.
Die Narew-Überquerung
Als es hell wurde ging der Vormarsch weiter. Es wurde uns untersagt Tagebuch zu führen, darum
weiß ich nicht wie die Orte hießen, durch die wir marschiert sind. Als wir durch ein sumpfiges Gelände vor drangen
stand auf einer Anhöhe am Horizont, die polnische Artillerie, die uns sofort unter Beschuss nahm. Unser Hauptmann war
der Meinung dass wir schon in der Nähe des Flusses Narew sein müssten, als aus den Sträuchern ein mit Schlauchboten
beladenes Lastauto auftauchte. Wir wurden aufgefordert mit je 6 Mann ein Schlauchboot zu nehmen, an einem Aggregat
der daneben stand mit Luft zu füllen und zu Wasser zu lassen. In einer Stunde war das ganze Bataillon über die Narew,
wo der Vormarsch fortgesetzt wurde. In einem Dorf überraschte uns die polnische Kavallerie und fing sofort mit
Maschinengewehren zu schießen an. Da kam der Befehl: Alles wieder zurück. Es ging noch schneller als auf der Hinfahrt.
Wir sind erst einige Kilometer am Fluss entlang gegangen und haben dann zum zweiten Mal rüber gesetzt.
Die Gehöfte im Dorf standen alle in Brand. Auf einem waren viele Bienestöcke. 2 Kameraden wollten den Stöcken Waben
entnehmen, doch die Bienen durch das Feuer aufgeschreckt, überfielen sie sofort und stachen derart zu das sie nicht
mehr wieder zu erkennen waren. Ich habe die Einstichstellen mit Salmiak betupft, mehr konnte ich nicht tun. Wir mussten
auf unserem Vormarsch durch einen Wald der in Flammen stand, so dass man kaum atmen konnte. Es ging weiter in Richtung
Minsk und Warschau, wo schon die Sowjetische Armee durchgegangen war, die Pferde und Vieh von einem Gut mitgenommen
hatten. In einem Wald stießen wir unverhofft auf ein Kloster, in dem wir einige Gefangene machten. Dann trafen wir auf
eine gute Straße die nach Grochow ging.
Als wir dort einmarschierten wurden wir aus den oberen Stockwerken beschossen, so dass wir, um uns zu schützen, nur an
den Hauswänden entlang gehen konnten. Wir haben jedes Haus nach Feinden durchsucht. Vor einem Haus stand ein Hund der
niemanden reinlassen wollte, solange bis ihn eine Kugel traf. Die polnische Artillerie feuerte von Warschau aus, um
unseren Vormarsch zu stoppen. Wir hatten uns gerade eingegraben als plötzlich deutsche Flieger am Himmel erschienen,
die unsere Stellungen mit Bomben bewarfen und dabei viel Unheil anrichteten. Wir haben sofort Fliegertücher
ausgebreitet und Leuchtraketen abgeschossen. Da ich in dem Graben, den ich kurz zuvor ausgehoben hatte, sofort in
Deckung gegangen bin ist mir zum Glück nichts passiert. Unter den anderen Kameraden gab es viele Verwundete, so dass
ich nicht wusste wem ich zuerst helfen sollte.
Der Oberstabsarzt hat mich sofort tatkräftig unterstützt, so das bald alle Verwundeten versorgt waren, außer einem,
dem ein Bombensplitter den Arm abgerissen hat. Ich habe im 3 große Verbandspäckchen auf die Wunde gelegt, doch die
Blutung ließ sich trotzdem nicht stoppen, so dass er eine Stunde später auf der Krankensammelstelle verstarb. Wir
haben danach in einem Tomatenfeld einen Graben ausgehoben und eine neue Abwehrstellung bezogen. Die Gruppe Schwarz
bekam den Auftrag nach etwaigen versprengten polnischen Verbänden Ausschau zu halten, als sie unerwartet aus einer
Häuserreihe mit Maschinengewehrsalven überschüttet wurden. Der Gruppenführer und noch ein Soldat wurden dabei tödlich
verwundet. Danach wurde noch ein weiter Stoßtrupp, unter der Führung von Leutnant Briskorn, der sich dazu freiwillig
gemeldet hatte, hinaus geschickt um den Gruppenführer und den anderen Toten zu bergen.
Bei diesem Unternehmen, das erfolglos ausging, weil die Toten schon verscharrt waren, durchschlug eine Kugel den
Stahlhelm von Leutnant Briskorn, der auch sofort tot war. Alle Toten wurden später, an der Kirchenmauer in Grochow, in
Särgen beigesetzt: Hauptmann Schönwald sagte, das sie nach dem Kriege auf den Heldenfriedhof nach Ortelsburg überführt
werden. Drei Tage lagen wir bei Grochow in Stellungen, waren dem polnischen Maschinengewehrfeuer sowie den Bomben
deutscher Flugzeuge ausgesetzt. In der Nacht musste ich zu einem Verwundeten in die vorderste Linie und habe den
Rückweg nicht mehr finden können, als plötzlich Gewehrfeuer aufflammte habe ich in den Ruinen Schutz gesucht. Erst im
Morgengrauen konnte ich mich wieder orientieren und zu meinem Unterstand zurückfinden.
Warschau wurde tagelang bombardiert und stand auch unter Artilleriebeschuss. Aus dunklen Rauchwolken kamen oft ganze
Bündel von Papier angeflogen. Die Verwundeten kamen oft auf Krücken zu unserem Unterstand, ich habe sie dann zur
Krankensammelstelle hingeführt. Wir haben auch polnische Zivilpersonen betreut, die während der Kampfhandlungen
verwundet wurden. Als einmal 2 Jungen vorbeiliefen hat einer ihnen nachgerufen sie sollten seiner Frau Bescheid sagen,
er wäre auf der Krankensammelstelle an der Kirche. Als wir dort ankamen war seine Frau, mit einem Kind auf dem Arm,
schon da.
Nach der Kapitulation von Warschau, gingen wir über Sokolow zum Bug und haben dort Quartier bezogen. Der Russe hatte
sich bereits hinter den Fluss zurückgezogen, hatte alles Vieh und Pferde mitgenommen. Dort erreichte mich ein Telegramm
von zu Hause, dass meine Tochter gestorben ist. Es sprach sich auch herum dass verschiedene Heimaturlaub bekommen haben,
ich durfte auch für 14 Tage heim. Wir fuhren mit Lastautos nach Allenstein in die neue Reiterkaserne, zum
Ersatzbatallion, da haben wir unsere Gewehre und Munition abgeben, dann durften wir, jeder in seinen Heimatort
weiterfahren.
Als wir unsere Quartiere am Bug verlassen haben war sehr viel Schnee gefallen. Hier in Ortelsburg fanden wir die
gleiche Wetterlage vor, aber nach 3 Tagen war alles wieder weggetaut und wir konnten die Kartoffelernte, die durch den
frühen Wintereinbruch gestoppt wurde, zu Ende bringen. Ein Tag bevor ich zu Hause angekommen bin wurde die Tochter
beerdigt. Nach 14 Tagen mussten wir uns in Allenstein melden, Gewehre empfangen und wieder zurück zur Division an den
Bug 150 Kilometer hinter Warschau. Die elfte Division, zu der wir auch gehörten sollte in den Westen Deutschlands
verlegt werden und war schon unterwegs zur Verladestation Skiernewice 50 Kilometer vor Warschau.
Mein Dienst als Sanitätsunteroffizier
Unser Bataillon kam in das Städtchen Burscheid, im Kreis Opladen, wo wir in Privatquartieren
untergebracht wurden. Nach 3 Monaten, im Januar 1940, wurden wir nach Solingen verlegt, wo wir bis zum
Frankreichfeldzug stationiert waren. Wir mussten an Feldübungen teilnehmen, wie andere die in Kasernen untergebracht
waren. Während dieser Zeit musste jeder seine Zähne in Ordnung bringen lassen. Jeden Tag fuhren 20 Mann in die
Cäzilienstraße nach Köln, zur Zahnklinik. Im Rheinland wurde unsere Division neu aufgestellt. Ausfälle durch den
Polenfeldzug wurden durch neue Soldaten ergänzt. Ich kam nun zum Ersatzbatallion, war der Älteste in der ganzen
Kompanie. Als der Frankreichfeldzug losging wurde unser Ersatzbatallion mit den noch vorhandenen Verwundeten, in die
neue Reiterkaserne, nach Allenstein verlegt.
Meine Frau hat, mit Unterstützung der Bauernschaft, einen Antrag gestellt, daraufhin wurde ich zur Frühjahrsbestellung,
beurlaubt und später bis auf weiteres vom Militärdienst freigestellt. Als der Russlandfeldzug losging wurde ich von der
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg, für 14 Tage einberufen. Ich war seit 1922, Mitglied der freiwilligen
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg und habe jedes Jahr an Übungen teilgenommen. Jede Bereitschaft musste etliche Leute
stellen. Von Rohmanen wurden Emil Rosowski, Johann Dembek, und ich, zur Krankensammelstelle Wirballen, in Litauen,
abkommandiert. Dorthin kamen Lazarettzüge aus Russland mit der Breitspurbahn. Die Verwundeten wurden frisch verbunden
und auf Waggon mit Normalspur verladen und nach Deutschland gebracht.
Als die 14 Tage vergangen waren wollten wir wieder nach Haus zurück, doch man wollte uns nicht entlassen. Stattdessen
wurden wir dem Wehrkreisamt Königsberg zugeteilt, neu eingekleidet und zur Aushilfe ins Lazarett nach Gumbinnen
abkommandiert. Mehr als ein Jahr war ich in den Urlauber-Baracken, habe dort Krankenstube betreut. Später, bis zum
Dezember 1944, war ich im Reserve-Lazarett 4, in Königsberg tätig. Dort habe ich auch die Luftangriffe der Engländer,
vom 25 bis 26. August 1944 miterlebt.
Wir sollten gerade einen Lazarettzug in Rotenstein entladen, als plötzlich die Sirenen ertönten - Fliegeralarm. Im
gleichen Moment waren die ersten Flugzeuge auch schon da, zuerst warfen sie „Tannenbäume” und danach Foßforkanister ab.
Die Omnibusse standen schon zur Abfahrt bereit als es losging. Wir haben die Verwundeten schnell in den
Luftschutzkeller getragen, haben die Betten von den Fenstern weggerückt damit die Verwundeten nicht von den
Glasssplittern verletzt wurden. Im Kasernenhof brannten die Fosforkanister lichterloh. Unsere Unterkunft, die sich in
einer Baracke befand ist völlig abgebrannt, mit dem Wenigen was wir unser Eigen nannten. Am nächsten Tag wurden wir neu
eingekleidet und am 29. bis 30. kamen die englischen Bomber wieder, sie setzten genau da ihr Zerstörungswerk fort wo
sie vor 3 Tagen aufgehört hatten.
Anfang Dezember 1944 musste ich mich nach Stablack melden und musste dann zur Sanitätsabteilung 1, nach Gernau, das
liegt zwischen Lodz und Warschau. Vormittags hatten wir Felddienstübungen und nachmittags theoretischen Unterricht.
Jeden Tag wurden Gruppen zusammengestellt und zu anderen Einheiten abkommandiert. Ich kam zu einer Panzerabteilung, wo
wir an einem Morgen plötzlich auf dem Kasernenhof antreten mussten und zu unserer Überraschung mit der Nachricht
konfrontiert wurden, dass der Russe an mehreren Frontabschnitten durchgebrochen war. Wir bekamen sofort einen
Marschbefehl in Richtung Lodz, wo das Stadtbild noch intakt war, selbst die Straßenbahnen fuhren noch. In der Nacht
haben russische Flugzeuge die Stadt bombardiert. Die Kaserne in der wir untergebracht waren hatte keine
Luftschutzkeller, aber zum Glück blieben wir von Bombentreffern verschont. Am nächsten morgen bot sich uns ein Bild der
Verwüstung. Die entgleisten Straßenbahnwagen, sowie andere Fahrzeuge blockierten die Straßen. Die Älteren unter uns
bekamen Fahrscheine für einen Transportzug, der bereit hinter Lodz abfahrbereit, unter Dampf stehen sollte. Als
russische Panzer in den Straßen auftauchten, verbrannte die Schreibstube unsere Wehrpässe und andere wichtige
Dokumente. Wir liefen zu der Station auf der unser Transportzug bereitstehen sollte, aber da war kein Zug mehr zu sehen
und wir setzten unseren Rückzug zu Fuß fort.
Der Rückzug und Zusammenbruch der Ostfront
In Dobroschin, einer Stadt in Polen, wurde gerade ein Lazarettzug verladen, doch wir kamen nicht
mehr zum Einsatz, weil die russische Infanterie uns schon auf den Fersen war. Es ging weiter über den Fluss Bober,
Sagan, bis nach Glogau an der Oder. Dort wurden wir der 29. motorisierten Sanitätskompanie zugeteilt. Im
Garnisonslazarett wurden noch Operationen durchgeführt. Unsere Division hatte ihr eigenes Feldlazarett, so dass wir den
Befehl zu Weiterfahrt erhielten und noch unbeschadet die Oderbrücke passieren konnten, denn Glogau wurde zur Festung
erklärt. Wir haben 2 Pferdewagen organisiert und mit Verbänden, sowie medizinischen Instrumenten beladen. So kamen wir
bis nach Lübbenau im Spreewald, wo wir in einem Schloss, in zuvor ein Museum war, unser Lazarett untergebracht haben.
Weil die Amerikaner Cottbus bombardiert hatten, wurden die Verwundeten zu uns nach Lübbenau gebracht. Hier haben wir
Tag und Nacht gearbeitet, um die vielen Verwundeten, aus den schweren Kämpfen bei Grünberg und Sagan zu versorgen. Die
Soldaten von der Abwehrfront kamen schon mit abgestorbenen Armen oder Beinen bei uns an, weil in vorderster Linie keine
Frontlazarette mehr vorhanden waren; es mussten viele Amputationen durchgeführt werden. Als für unsere Pferde kein Heu
mehr vorhanden war, schickte mich unser Hauptfeldwebel, zu einem Bauern in den Spreewald, mit dem Auftrag, Futter zu
besorgen. Mit noch zwei Mann fuhren mit zwei Kähnen, zuerst den Hauptstrom entlang und dann in einen Nebenarm; da haben
wir die Boote beladen und brachten das Heu nach Lübbenau.
Als wir uns bei unser Einheit zurück melden wollten, war alles schon marschbereit. Ich bin schnell in einen Bus
eingestiegen der sofort losfuhr, weil russische Verbände schon in sichtweite waren. Russische Flugzeuge kreisten über
den Dächern und nahmen, mit ihren Bordwaffen jeden unter Beschuss, der sich irgendwo blicken ließ. Wir konnten nur
durch den Wald, oder in der Nacht vorwärts kommen, denn wenn ein Auto auf der Landstraße fuhr, war alsbald ein Flugzeug
hinter ihm her und schoss es in Brand. Als wir nach Tagen am Ufer der Elbe ankamen, war bereits eine Ponton-Brücke
erstellt worden, welche die zerstörte Brücke ersetzen sollte.
Durch die vielen Fahrzeuge waren in den Sand tiefe Spuren gefahren, so dass andere Fahrzeuge unsere Busse ins
Schlepptau nehmen mussten, weil wir mit eigener Kraft nicht mehr weiterkamen. Beiderseits der Trasse standen
Flüchtlingswagen, in der der Hoffnung die Brücke passieren zu können, doch SS-Polizei verhinderte das die Gespanne den
militärischen Rückzug zum Stillstand brachten. Es gelang uns die Elbe zu überqueren, um in einem Waldstück Schutz vor
feindlichen Fliegern zu suchen.
Als wir unsere Busse und Autos gut getarnt hatten, hat unser Bataillonschef die anwesenden Parteigrößen zu sich
gerufen und ihnen erklärt das wir eine Einheit des Roten Kreuzes sind und nach internationalem Recht keine Waffen
besitzen dürfen. Nach langer, erregter Diskussion wurde beschlossen einen Graben auszuheben und alles im Sand zu
verscharren. Als wir dann weiter, durch die Dörfer fuhren, sahen wir schon viele weiße Bettlaken, als Zeichen der
Kapitulation, aus den Fenstern hängen. Es wurde uns erzählt dass der Bürgermeister von der SS erschossen wurde, weil
er die Bevölkerung zu diesem Schritt ermutigt hatte. Jetzt waren hinter uns die Russen und vor uns schon die Amerikaner.
Amerikanische Panzer fuhren umher und schossen wild durch die Gegend, ohne ein Ziel anzuvisieren. Niemand wollte sich
dem Russen ergeben, doch der Weg der zu den Amerikanern führte, war durch abgesägte Bäume blockiert. Wir sind schnell
in das nächste Dorf gegangen, haben uns Sägen und Äxte besorgt, die Bäume durchgesägt und in den Straßengraben
geworfen.
“ Nach dem Ende des 2. Weltkrieges.”
In amerikanische Kriegsgefangenschaft
Dann fuhren wir unter internationaler Flagge an eine Mulde Brücke, vor der zwei amerikanische Soldaten, mit Zigarren,
zur Hälfte im Mund, standen. Sie rauchten und kauten gleichzeitig. Wir mussten auf einen freien Platz fahren, alle
aussteigen und rechts wieder antreten. Wäschebeutel und Tornister mussten wir abstellen; danach wurden wir nach Waffen
durchsucht, Wertsachen, Uhren und Messer wurden uns gleich abgenommen. Als wir anschließend an unserem Gepäck
vorbeigingen durfte niemand was mitnehmen. Als ich gebückt, nach meinem Wäschebeutel greifen wollte, in dem sich noch
3 Konservendosen und ein Brot befanden, bekam ich einen Fußtritt ins Gesicht, so dass mir ein Zahn ausgeschlagen wurde.
Wir wurden dann in einem Garten zusammen getrieben und gefragt ob jemand bei der SS gedient hat. Nachdem wir in Reihe
und Glied angetreten waren, mussten wir den Oberkörper freimachen und die Arme anheben. Es wurde nach SS-Zeichen
gesucht, die gewöhnlich unter dem Oberarm eintätowiert waren. Nachdem wir Grimma bei Leipzig, wo wir in amerikanische
Gefangenschaft geraten waren, verlassen hatten, mussten wir durch ganz Thüringen bis Hersfeld, an der Grenze zu Hessen,
marschieren. In Hersfeld wurden wir auf große Lastautos verladen, die von farbigen Soldaten gefahren wurden. Man hat
uns mit Stöcken hinauf getrieben, solange bis das Auto so voll war das man kaum stehen konnte. Die Soldaten fuhren, für
diese Straßenverhältnisse, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Wenn die Straße eine scharfe Kurve hatte, flogen
wir alle übereinander und mussten erst mit viel Kraftanstrengung auf die Beine kommen um diese Fahrt zu überstehen.
Da die Straßenränder in dieser Gegend mit Obstbäumen bepflanzt sind und deren Äste sehr niedrig hängen, hätten die
uns die Köpfe abgerissen, wenn wir uns nicht ständig geduckt hätten. Unsere Fahrt endete in Bad Kreuznach, in der Pfalz,
wo wir in ein Lager, in dem sich später 130.000 Mann und 6 Generäle befanden, eingepfercht wurden. Die Unterkunft der
Generäle befand sich unter einem Zelt, alle anderen mussten die Zeit unter freiem Himmel zubringen. Die Offiziere, die
Unteroffiziere, die Mannschaften; wurden in getrennten Camps untergebracht. Die Mannschaften wurden auch zur Arbeit
abkommandiert und konnten bei dieser Gelegenheit, Brot, Brötchen oder Zigarettenstummel organisieren, wogegen die
Offiziere und Unteroffiziere ihr Camp überhaupt nicht verlassen durften.
Die ersten Tage gab es kein Wasser und kein Brot, so dass die Kameraden vor Erschöpfung umfielen. Später standen wir
manchmal den ganzen Tag nach Wasser an, das von den, uns bewachenden Negern mit großen Wassertanks angefahren wurde. Am
dritten Tag bekamen wir mittags und abends etwas zu Essen; Brot bekamen wir erst nach zwei Wochen, nach dem aus der
Umgebung herbeigeholte Handwerker, Backöfen gebaut hatten. In den verschiedenen Gemeinden, die in den uns umgebenden
Weinbergen lagen, mussten sich alle Männer beim Bürgermeister melden. Als sie dann erschienen waren, wurden sie auf
bereitstehende Lastautos getrieben und zu uns ins Lager gebracht. Sie waren ohne Kopfbedeckung und ohne wärmere
Bekleidung angekommen, weil ihnen gesagt wurde, dass ihr Aufenthalt im Lager nur von kurzer Dauer sein würde. Man hat
uns, falls noch vorhanden, Decken und Mäntel abgenommen, mit der Begründung, sie würden für Kranke und Verwundete
gebraucht. Jeden Tag starben mehr als 200 Mann, die wir sofort in ein Zelt tragen mussten. In der Nacht wurden die
Toten dann mit unbekanntem Ziel, weggefahren.
Viele haben ihren Verstand verloren uns irrten im ganzen Camp ziellos umher. Als Latrinen wurden Gräben ausgehoben, in
die verschiedene Kameraden, bei der Verrichtung ihrer Notdurft, vor Schwäche hineingefallen sind und nicht mehr wieder
heraus kamen. Aus den Pfählen die, die jungen Obstbäume stützten, haben wir Krankentragen gebaut um unsere Kameraden,
bei Bedarf, zur Krankensammelstelle zu tragen. Es war in diesem Frühjahr auch sehr kalt, doch unsere Erdlöcher, die wir
zum Schutz vor Kälte und Wind, nur mit leeren Konservendosen ausgehoben hatten, durften nicht tiefer als 20 Zentimeter
sein. Nach jedem Regenguss mussten wir das Wasser ausschöpfen. Nach einem Gewitter, standen wir wiedermal, total
durchnässt in unserem Camp, als unerwartet am Horizont die Sonne hervortrat. Einer unserer Kameraden hatte noch eine
Trompete gerettet und fing, von dem Anblick völlig überwältigt, zu spielen an: "Es geht alles vorüber, es geht alles
vorbei, nach jedem Dezember, folgt wieder ein Mai". Daraufhin hob sich die Stimmung der tiefbetrübten Kriegsgefangenen,
so das Heimatlieder durch das ganze Camp erklangen, obwohl wir in den nassen Kleider herumgehen mussten, bis sie am
Körper trocken wurden.
In französischer Kriegsgefangenschaft
Nach etwa einem Monat, haben uns die Amerikaner, den Franzosen, zum Arbeitseinsatz, ausgeliefert.
Etwa 4 Kilometer von Bad Kreuznach entfernt, stand auf freier Strecke, ein Zug mit offenen Kohlenloren, auf den wir
verladen wurden. In jeden Waggon, wurde pro Person eine Tafel Schokolade und ein Päcken Zwieback rein geworfen, doch
viele Kameraden fanden nur leere Päckchen vor, weil die schon zuvor von der französischen Wachmannschaft geplündert
wurden. Wir haben uns darüber beschwert, doch die haben uns nur ausgelacht. Nachdem wir zunächst bei Mainz über den
Rhein fuhren, endete unsere Fahrt bei Paris in einem großen Zeltlager. Dort wurden wir auf andere Züge verladen, die uns
nach Südfrankreich, in ein Barackenlager, bei Mazarei, brachten.
Auf einer Zwischenstation hat man uns unter einer Pumpe, die Lokomotiven mit Wasser versorgt, abgestellt, den Kran
aufgedreht und uns anschließend ausgelacht, die Kinder Haben uns mit Steinen beworfen. Ein Wachmann kam in unseren
Waggon gekommen, hat unser Gepäck durchsucht, wenn er Tabak oder Zigaretten gefunden hat, nahm er sie mit. Die Kameraden
waren darüber so empört, dass sie vorhatten, ihn nachts unter den Waggon zu werfen. Wir haben sie gebeten dass zu
unterlassen, weil man uns in diesem Falle, alle erschießen würde.
Als wir ins Lager kamen wurden wir zuerst gezählt, dann mussten wir unser Gepäck stehen lassen und beiseite treten.
Wenn man bei der Nachkontrolle noch was in den Taschen fand, wurde das auch entwendet, selbst Esslöffel. Wir wurden
dann in drei Baracken, ohne Toiletten, eingeschlossen. Die Kameraden haben ihre Bedürfnisse in Kochgeschirre erledigt
und durch ein kleines Fenster, das sich fast unter der Decke befand, hinausgeworfen. Andere Fenster ließen sich nicht
öffnen, weil sie mit Stacheldraht zu geflochten waren. Als die Kameraden die Kochgeschirre auskippten, haben die
Wachposten geschossen und die Fenster zertrümmert. Sie waren der Meinung dass wir ausbrechen wollten. Es herrschte eine
große Hitze, in den überfüllten Baracken sind wir fast erstickt. Am nächsten Tag haben wir uns über fehlende Toilettem
beschwert, da haben sie Heringsfässer durch die Hälfte geschnitten und an der Ausgangstür hingestellt. Um bei den
überfüllten Räumen dort hinzukommen, musste man über die Köpfe der Anderen steigen. Viele hatten Fieber und Durchfall
und mussten in die Krankenstube eingeliefert werden, wo sie kurz darauf verstarben.
Besonders Raucher litten sehr an der Unterernährung, bekamen Wasser in den Beinen und waren die Ersten die verstarben.
Nach der Registrierung wurden wir auf andere Baracken verteilt. Die Zivilbevölkerung kam in die Räume und begann uns
auszuplündern. Wer noch gute Schuhe besaß musste sie ausziehen und bekam dafür die kaputten des Plünderers. Eine Woche
lang mussten wir diesen Zustand ertragen, erst als die Kameraden sich beschwerten, wurde am Eingang eine Tafel am
Eingang angebracht, dass die Zivilbevölkerung das Lager nicht betreten darf. Bis auf einige, wenige Ausnahmen wurde
diese Anweisung befolgt.
Als wir im Lager ankamen, war der französische Lagerkommandant, ein ehemaliger Kriegsgefangener, der bei einem Bauern
in Deutschland gearbeitet hatte. Dieser Bauer war jetzt als Kriegsgefangener in seinem Lager. Als er ihn erkannte, hat
er ihn gleich zum Küchendienst eingeteilt und mit dem nächsten Krankentransport nach Hause fahren lassen. Zu Mittag
bekamen wir nur gekochte Haferkörner, da schwamm alles oben, später war man dann auf Gerste umgestiegen. Als viele
daran gestorben waren, weil sie diese „Rohkost”, die nur ein Kuhmagen verträgt, nicht gegessen haben, hat man die
Körner durch eine Schrotmühle laufen lassen. Dann hat man uns Steckrüben gekocht; wir bekamen 250 Gramm Weißbrot,
etwas Quark und ein viertel Liter Magermilch. Später, als wir schon arbeiten mussten, hat man in unserem Essen einen
Kuhkopf mitgekocht, das hat dann bedeutend besser geschmeckt.
Bevor wir morgens zur Arbeit gingen, mussten wir zu Flaggenparade und abends, nach der Rückkehr, haben wir die Flagge
wieder eingeholt. Wir haben einen Kanal gereinigt, dessen Sohle 2 Meter dick mit Schlamm bedeckt war. Zuerst wurde das
Wasser abgelassen, dann haben wir, einer dem andern, den Schlamm mit der Schippe hoch gereicht. Der Letzte hat den
Schlamm, der so zäh war, dass er nicht von der Schippe wollte, oben am Rande abgelegt. Manchmal waren 10 Mann nötig um
den Höhenunterschied zu überwinden. Das Wachpersonal schoss über unsere Köpfe hinweg und rief: „schnell arbeiten”. Bei
der großen Hitze war das ein Ding der Unmöglichkeit, zumal es nichts zu Trinken gab. Auf dem Heimweg haben wir im Walde
Heilkräuter gesammelt, die man in der Küche getrocknet und als Tee zubereitet hat, den wir am nächsten tag zur Arbeit
mitnahmen, um unseren Durst zu stillen.
Unser Aufseher hatte einen Stock, an dem sich noch kurz abgeschnittene Äste befanden. Wer seiner Meinung nach, nicht
ordentlich gearbeitet hat, bekam gleich Schläge auf den Rücken. Die weißen Aufseher wurden irgendwann durch Neger
ersetzt, die uns bedeutend besser behandelt haben. Wenn irgendetwas schief ging, haben sie nichts gesagt, nur gelacht.
In den übrig gebliebenen Wassertümpeln hatten sich noch einige Aale versteckt, die wir zu fangen versuchten, was uns
auch manchmal gelang. Wir mussten ihnen das Genick brechen, damit sie uns nicht entwischen konnten. Wenn die Franzosen
bemerkten das wir Aale hatten, wurden sie uns abgenommen. Gelang es uns aber, sie ins Lager zu bringen, dann haben wir
uns eine köstliche Malzeit zubereitet.
Um sicherzustellen dass niemand geflüchtet ist, wurden wir, wenn wir abends ins Lager zurückkamen, zuerst gezählt.
Diese Zählung wurde mehrmals wiederholt, weil die Wachmannschaften sich immer wieder verzählt haben. Als einer von uns
hin ging, ihnen sagte dass alle da sind, wollten sie es nicht glauben und haben uns vor dem stehen lassen, bis es ihnen
irgendwann einfiel. uns doch das Tor zuöffnen. Einmal, als wir von der Arbeit zurückgekehrt waren, standen wir bis 23
Uhr neben der Flagge, weil uns niemand das Tor geöffnet hat. Als wir dann doch irgendwie ins Lager kamen haben wir
festgestellt, dass das ganze Wachpersonal betrunken war und niemand im Stande uns das Tor zu öffnen.
Eines Tages waren wir wieder abends zur Parole angetreten, als ein älterer Herr mit seinem Hund, am Stacheldraht
entlang, spazieren ging. Weil der Hund, unterm Stacheldraht hindurch, zu uns kam, hat ihn einer geschnappt, ihm das
Genick gebrochen und unter seiner Jacke versteckt. Der Franzose hat nach seinem Hund gerufen und gepfiffen, aber alles
vergebens, der Hund war nicht aufzufinden. Die Kameraden haben ihm gleich das Fell über die Ohren gezogen, das Fleisch
gekocht und das Fell in die Latrine geworfen. Das Fleisch wurde umgehend verspeist.
Als wir am nächsten Tag von der Arbeit zurückkehrten, war im Lager der Teufel los. Wir mussten sofort antreten und
wurden gefragt, wo der Hund geblieben ist, der Gestern Abend, mit seinem Herrchen, am Zaun entlang spazieren ging. Als
sich niemand dazu bekannte, mussten wir weiterhin stehen bleiben, während die Wachmannschaften von Baracke zu Baracke
gingen und alles durchsuchten. In einer Latrine hat man dann das Fell gefunden, was uns ein furchtbares „Donnerwetter”
einbrachte und in den nächsten Tagen, nach der Arbeit, unter dem Kommando eines Oberfeldwebels, eine Stunde
nachexerzieren.
In Südfrankreich regnet es den ganzen Sommer nicht; die Bauern haben da keine Scheunen und das Getreide wir nur in
Schobern aufgestellt und dann umgehend gedroschen. Vom Oktober bis Dezember regnete es fasst jeden Tag in Strömen.
Gesät wird nur im Frühjahr und im Herbst, weil im Sommer alles vertrocknet. Es wird viel Wein angebaut und die
Steckrübe wächst den ganzen Winter. Neben den Weinreben wurde aus Schieferplatten ein Zaun aufgestellt, um dem Wein
einen optimalen Standort zu sichern. Die Bauernwagen hatten nur zwei Räder und waren nur mit einem Pferd bespannt, das
die ganze Balance des Wagens zu halten hatte. Trotzdem haben sie soviel aufgeladen wie wir auf einen Leiterwagen. Viele
Kameraden wurden den Bauern zur Arbeit ausgeliehen. Wenn ein Bauer einen Arbeiter gebraucht hat und es wurde gefragt,
wer sich in der Landwirtschaft auskennt, da haben sich alle gemeldet. Der Bauer konnte sich dann aussuchen, wen er
mitnehmen wollte.
Wenn wir durch die Stadt zur Arbeit gingen, haben verschiedene Leute Fallobst in die Abfalleimer gelegt. Wenn das von
den Kameraden bemerkt wurde, schwenkten viele aus der Reihe, um sich etwas mit zunehmen, was von den Wachmannschaften
nicht gern gesehen wurde. Viele Kriegsgefangene hatten keine Schuhe mehr, sie haben die Füße nur mit Lumpen bewickelt.
Eines Tages kamen Kameraden aus Norwegen, die nach Deutschland entlassen werden sollten. Mann hat sie jedoch ins Lager
gesteckt und zur Arbeit eingeteilt. In Norwegen hatten sie Kleider und Stoffe eingekauft, hatten volle Seesäcke und
sogar Karren auf 2 Rädern, weil sie ja in die Heimat entlassen werden sollten. Als wir morgens zur Arbeit rausgeführt
wurden standen sie schon vor dem Lager. Wir haben ihnen zugerufen, dass sie uns etwas abgeben sollen, weil ihnen ja
sowieso alles abgenommen wird, aber sie haben uns nur ausgelacht. Als sie ins Lager Kamen mussten sie ihr Gepäck
ablegen, wurden dann wo anders hingeführt und haben es danach nie wieder gesehen.
Durch die vielen Läuse, Flöhe und Wanzen die wie im Lager hatten, kam es bei verschieden Kameraden, an den
Einstichstellen, zu eiternden Entzündungen. Um dem vorzubeugen hat man uns mit einem Pulver, das in Frankreich
hergestellt wurde, aber bei den Parasiten keine Wirkung zeigte, eingesprüht. Erst bei der Anwendung eines Mittels
amerikanischer Herkunft, war alles über Nacht verschwunden.
Der Sonntag war arbeitsfrei. Dann kam ein katholischer, französischer Pfarrer, eskortiert von 3 Mann, mit
aufgepflanztem Seitengewehr ins Lager und hat Gottesdienst gehalten. Einen evangelischen Pfarrer gab es nicht, nur
einen Baptisten Prediger. Der wurde würdevoll eingekleidet, bekam ein großes Kreuz und hat jeden Sonntag in einer
extra dafür hergerichteten Baracke Gottesdienst gehalten. Wer Theologie studiert hatte und sich meldete, wurde zu
einem Seminar geschickt und konnte sein Studium fortsetzen. Glasbläser durften das Lager auch verlassen und ihrem
erlernten Beruf wieder arbeiten.
Wer sich freiwillig, für 5 Jahre, zum Dienst in der Fremdenlegion verpflichtet hat, das waren etliche unter uns, wurde
neu eingekleidet, bekam gutes Essen und Rauchwaren soviel er wollte. Nach einem Jahr wurden, nach und nach, die
Kranken und Körperbehinderten in die Sowjetische Besatzungszone entlassen. Eine Entlassung von Kriegsgefangenen, die
in den Westzonen oder jenseits von Oder und Neise zu Hause waren, war nicht vorgesehen. Die Österreicher wurden alle,
unabhängig von ihrem Gesundheitszustand entlassen.
Ich habe Briefe nach Hause geschrieben, aber die kamen nur bis Allenstein und wurden wieder zurück geschickt. Als eine
Kommission des Roten Kreuzes aus der Schweiz unser Lager besichtigt hat, haben wir uns beschwert, das wir als
Sanitätsdienstgrade, zur Arbeit gehen müssen. Daraufhin erging ein Befehl: Wer einen vom Roten Kreuz, ausgestellten
Ausweis besitzt, gehört einem internationalen Verband an und braucht nicht zu Arbeit gehen. Aus unserem Lager hatten
sich 20 Mann gemeldet, die daraufhin Freigang, in Begleitung von zwei französischen Wachsoldaten erhielten. Als wir
gefragt wurden wo wir hin wollen, entschlossen wir uns, einen Soldatenfriedhof, auf dem unsere verstorbenen Kameraden
beerdigt waren, zu besuchen.
Da der Untergrund in dieser Gegend aus Felsen bestand, wurden die Gräben, in denen die Toten in selbst gezimmerten
Kisten nebeneinander gestellt wurden, mit Hilfe von Dynamit ausgehoben. Ein Leichenwagen, mit einem Pferd bespannt,
das mit einer schwarzen Decke abgedeckt war, wurde von einem Kutscher in angemessener Kleidung, gefahren. Der Wagen
konnte gleichzeitig 4 Kisten transportieren. Wenn wir von der Arbeit kommend, dem Leichenwagen begegneten, wurde
gehalten und mit einer Schweigeminute der Toten gedacht, bis der Wagen vorbei war. Die Zivilbevölkerung verharrte auch
im Schweigen, mit abgenommener Kopfbedeckung.
Ein Kamerad, der in Krottorf, Kreis Oschersleben, bei Magdeburg, zuhause war, sagte bei seiner Entlassung zu mir:
Sollte ich das Glück haben, meine Entlassungspapiere zu erhalten ohne eine Bleibe vorzuweisen, dann soll ich Krottorf
als Heimatadresse angeben. Auf der Krankenstube habe ich angegeben, dass sich noch ein Schrapnellsplitter, aus dem
Ersten Weltkrieg, in meiner Kreuzbeingegend befindet, er zwar verkapselt ist, aber immer noch Beschwerden verursacht.
Daraufhin wurde ich zur Entlassung vornotiert. Als bekannt wurde das ein Rückkehrertransport in die sowjetische
Besatzungszone zusammengestellt wird, habe ich mich sofort gemeldet und wurde für ein Entlassungslager in Angoleme
vorgesehen. War das eine Freude, als uns mitgeteilt wurde, wann der Rücktransport stattfindet.
In unserem Lager waren noch 2 Kameraden aus dem Kreis Ortelsburg: Ein Gustav Lumma aus Leynau und ein Alfred Moritz
aus Groß Schöndamerau. Sie mussten noch zurückbleiben und haben mir den Auftrag erteil, die Angehörigen in der Heimat
zu grüßen und ihnen die Anschrift mitzuteilen. Als wir im Entlassungslager ankamen, fragte man uns nach unserer
Heimatanschrift. Dann wurden die Entlassungspapiere angefertigt. Es wurde uns auch ein Barscheck, für die in Frankreich
geleistete Arbeit ausgehändigt, den wir bei jeder Kasse in Deutschland einlösen könnten. Ich habe ihn bis zum heutigen
Tage nicht einlösen können, obwohl ich irgendwann in der Zeitung gelesen habe, das Verrechnungschecks die den aus
französischer Kriegsgefangenschaft Entlassenen, ausgehändigt wurden, einzulösen sind.
Wir kamen zuerst nach Saar Elbe, dann in die Nähe der Zonengrenze zu Thüringen. Hier mussten wir 2 Tage warten, weil
aus der sowjetischen Besatzungszone keine Eisenbahnwagen bereitgestellt wurden. Angesichts dessen, das der Russe beim
letzten Transport die aus Frankreich kommenden Wagen kassiert und nicht mehr herausgeben wollte, bestand der Franzose
jetzt darauf, seine Wagen sofort wieder mitzunehmen. Als der sehnsüchtig erwartete Zug endlich eintraf, durften wir
umsteigen und kamen, immer noch hinter Stacheldraht, nach Erfurt. Von dort weiter ins Quarantänelager nach Prätsch an
der Elbe.
Unter Androhung von Strafe war es verboten das Lager zu verlassen, doch der Hunger zwang uns dazu, in den umliegenden
Dörfern um Lebensmittel zu betteln. Man drohte uns damit, dass Zuwiderhandlungen, mit einer 14-tägigen Verlängerung der
Quarantäne geahndet werden. Der Roggen war schon reif und wir haben, auf den umliegenden Feldern, die Ähren abgerissen,
das Korn, zwischen 2 Steinen zu Mehl zerrieben, um daraus eine Suppe zu kochen, denn von dem was unsere Lagerküche uns
bieten konnte, war es nicht möglich zu überleben. Als der Eigentümer bemerkte wer seine Roggenähren entwendet hat, kam
er ins Lager, gerade zu dem Zeitpunkt als wir mit dem Mahlen beschäftigt waren. Der Lagerkommandant, bei dem er sich
beschwerte, drohte uns zu bestrafen, wenn wir unsere „Rauzüge” nicht unmittelbar einstellen würden. Wir sagten ihm er
solle uns heimfahren lassen, da wir doch lange genug hinter Stacheldraht gesessen hätten.
Endlich wieder in Freiheit
14 Tage nach unserer Ankunft wurden uns Entlassungspapiere ausgehändigt, sowie auch Fahrscheine
zum den, von uns angegeben Heimatorten. So kam ich nach Krottof, Kreis Oschersleben, zu meinem ehemaligen
Kriegskameraden, bei dem ich einen Tag geblieben bin. Er hatte mir schon eine Stelle bei einem Bauern besorgt, der 70
Jahre alt und kinderlos war. Zum Hof, den er mit seiner Ehefrau bewirtschaftet hat, gehörten 36 Morgen Land, 2 Ochsen
und 3 Kühe. Das Ackerland bestand aus 17 Parzellen und sicherte mir einen Arbeitsplatz.
Jetzt, da ich ein Dach überm Kopf und genug zu essen hatte, fing ich an nach dem Verbleib meiner Familie zu forschen.
Bei meinem letzten Heimaturlaub hatte ich mit meiner Frau verabredet; falls wir uns in den Kriegswirren verlieren
sollten, unsere Kontaktadresse, die meiner Quartiersleute in Burscheid, Kreis Opladen, sein sollte. Ich habe zuerst
nach Rohmanen geschrieben, aber leider keine Antwort erhalten. Dann habe ich nach Burscheid geschrieben, und siehe, -
bei denen lag schon eine Anfrage meiner Frau vor, die nach mir gefragt, und ihre jetzige Anschrift hinterlassen hatte.
Ich habe dem Bauern erzählt dass meine Frau sich zurzeit, auf einem Gut, in Alt Steinhorst, im Kreis Rostock, befindet.
Er war sofort bereit uns ein Zimmer zur Verfügung zu stellen, wenn ich meine Frau nach Krottorf rüberholen wollte. Das
habe ich Ihr mitgeteilt und sie war sofort bereit ihren Wohnsitz nach Krottorf zu verlegen, denn sie wohnte dort in
einem kleinen Stübchen unterm Dach.
Im Herbst, als die Feldarbeit so ziemlich erledigt war, bin ich nach Alt Steinhorst gefahren, um meine Frau und meinen
Sohn Kurt, sowie meinen Sohn Manfred, den ich noch nicht kannte, weil er erst nach der Flucht, am 31. Januar, in Groß
Lüssewitz, geboren wurde, nach Krottorf zu holen. Meine Frau hatte schon Holz für den Winter besorgt und vom Gut, auf
dem sie im Sommer gearbeitet hatte, Mehl und Kartoffeln bekommen. Wir haben das Mehl und andere Habseligkeiten in
Kisten verpackt. Das Holz haben wir einem Bauern gegeben, der uns und unser Gepäck, mit seinem Pferdewagen, zum 14
Kilometer entfernten Bahnhof, nach Ribnitz gebracht hat. Wir sind auch gut in Krottorf angekommen, aber als wir am
nächsten Tag, unsere Kisten vom Bahnhof abholen wollten, haben wir zwar die Kisten vorgefunden, doch der gesamte Inhalt
wurde während der Bahnfahrt entwendet. Die Bahnstation in Krottorf hat die Vorkommnisse zur Kenntnis genommen und
protokolliert, aber unsere Sachen haben wir nie wieder gesehen und mussten wieder bei Null anfangen.
Im Winter musste ich auf der Genossenschaft, unentgeltlich, für die Russen Weizen einsacken. Ich hatte versucht eine
Arbeit als Zimmermann zu bekommen, doch auf dem Arbeitsamt wurde mir gesagt, ich bin Ladwirt und muss auf der
Landwirtschaft arbeiten. Da in den ersten Nachkriegsjahren, auch in der sowjetisch besetzten Zone Arbeitsplätze knapp
waren, mussten auch solche, die einen anderen Beruf erlernt hatten, jede zumutbare Arbeit annehmen. Aus der Heimat
erhielt ich einen Brief, von meiner dort noch lebenden Mutter. Sie schrieb das sie mich noch einmal sehen wollte und
ich sollte doch wieder zurück kommen; Unser Hof wäre nicht von Polen besetzt und sie wäre ganz alleine, weil der Vater
nach dem Durchzug der Front von den Russen erschlagen wurde. Daraufhin habe ich dem polnischen Konsulat in Magdeburg
mitgeteilt, dass ich in Rohmanen eine Landwirtschaft besitze, und um eine Einreisegenehmigung gebeten.
Nach 2 Monaten erhielt ich eine Postkarte, mit der Mitteilung, ich sollte mich persönlich beim Konsulat vorstellen.
Nach Aufnahme meiner Personalien, wurde mir gesagt, das ich benachrichtigt werde wenn mein Antrag genehmigt wird. Ende
Juli 1947 erhielten wir die Einreisegenehmigung nach Ostpreußen, das jetzt unter polnischer Verwaltung stand. Wir
mussten zuerst zum polnischen Konsulat in Berlin-Lichterfelde, wo wir umgeben von einer Trümmerlandschaft, gewartet
haben, bis alle Untersuchungen und Formalitäten erledigt waren.
“ Wieder zurück in Ostpreußen.”
Der schwere Wiederaufbau nach dem Kriege
Dann fuhren wir über Frankfurt/Oder, Posen, Thorn, Allenstein, nach Ortelsburg, wo wir am 2. August 1947 ankamen. Mit
einem zweirädrigen Karren, den ich mir von einem noch in Ortelsburg lebenden Bekanten ausgeliehen hatte und meinem
Sohn Manfred im Kinderwagen fuhren wir nach Rohmanen. Meine Mutter war inzwischen verstorben und auf dem Hof war nur
meine, inzwischen aus Russischer Gefangenschaft wiedergekehrte Schwester, Frieda Pelkowski.

Es war alles ausgeplündert; kein Vieh, keine Maschinen und der ganze Hof mit kniehohem Graß überwachsen. Nur schmale
Trampelpfade, vom Haus zum Holzschuppen und zum Klo, durchkreuzten das satte Grün. Ich habe das Gras auf dem Hof mit
einer Sense, die ich noch gefunden habe, abgemäht, damit der Hof nicht so verwahrlost aussah. Am nächsten Tag habe ich
mich bei der Polizei in Ortelsburg angemeldet, wo ich auch ein Startgeld von 100 Zloty erhielt und Gepäckstücke, die
ich in Krottorf aufgegeben, am Bahnhof abgeholt. Es hat mich sehr gewundert das, das Gepäck überhaupt angekommen ist.
Da man von der Landwirtschaft nicht Leben konnte, habe ich mich in den nächsten Tagen, bei der jetzt polnischen Bahn,
um Arbeit beworben und wurde auch angenommen. Wenn wir unseren Monatslohn bekamen, saß immer einer am Tisch, der von
uns 100 Zloty für den Wiederaufbau von Warschau verlangte. Wenn ich dran war, riefen die Anderen, ich hätte Warschau
zerstört und müsste deshalb 200 Zloty abgeben. Nach 3 Jahren kam eine Verfügung, die besagte, dass wer länger als 1
Jahr bei der Bahn beschäftigt ist, angestellt werden muss. Um diese Bestimmung zu umgehen hat man mich entlassen und
eine Woche später wieder eingestellt.
Als ich vor Ablauf des nächsten Jahres, aus dem gleichen Grunde wieder entlassen wurde, habe ich mich bei der
Stadtverwaltung in Ortelsburg(jetzt Szczytno)beworben, wo ich zuerst im Gaswerk als Heizer und später auf Baustellen
als Zimmermann gearbeitet habe. Wir haben durch den Krieg beschädigte Häuser repariert, in den ehemals touristischen
Zentren einige Ausbesserungen an den Einrichtungen durchgeführt, eine Ziegelei wieder in Betrieb gesetzt und andere
anfallende Arbeiten verrichtet. Im Dach des Rathausturmes war während der Kämpfe eine Granate eingeschlagen, die, die
Dachlatten und die Verschalung zerstört hatte. Da wir, unter schwersten Bedingungen, den Schaden repariert haben,
wurde uns eine Höhenzulage versprochen, die wir aber nicht bekommen haben.
Aus Verärgerung darüber habe ich bei der Stadtverwaltung gekündigt und bei einer Wiederaufbaufirma unter der Leitung
von Bauingenieur Laskowski wieder angefangen, wo ich bis 1954, als Zimmermann beschäftigt war. Ab da habe ich mich
nur um meinen Hof gekümmert, der wegen meiner Arbeitsstellen, gezwungenermaßen, sehr vernachlässigt wurde. Als wir
1947 zurückkamen, brachten wir unseren Sohn Manfred noch im Kinderwagen. Den hat meine Frau zum Markt gebracht,
verkauft, und dafür eine Ziege erworben, die dank guter Pflege, uns täglich mit 4 Liter Milch versorgte. Das war der
erste Baustein zum Wiederaufbau, unserer durch den Krieg zerstörten, und danach ausgeplünderten Landwirtschaft.
Während meiner Arbeit bei der Bahn haben wir uns eine Kuh gekauft, die nach einem halben Jahr, wegen nicht bezahlter
Grundsteuer, vom Gerichtsvollzieher gepfändet wurde. Man hat uns die Kuh weggenommen und bei einem Arbeiter, der in
der Ernst-Mey-Straße in Ortelsburg wohnte und sie wegen nicht vorhandener Futtermittel, nur mit Kartoffelkraut
gefüttert hat, untergestellt. Als ich bei der Bahn meinen Monatslohn bekommen habe, bin ich zur Gmina gegangen, habe
eine Rate angezahlt und durfte dann die Kuh wieder mit nach Hause nehmen. Durch die schlechte Ernährung war die Kuh
stark abgemagert und lieferte nur die Hälfte der ursprünglichen Milchleistung.
Später habe ich ein Pferd auf Abzahlung bekommen, das 140.000 alte Zloty gekostet hat. Die Stute war schwach und unser
Feld sehr hügelig, so dass man nur bergab pflügen konnte, was sehr beschwerlich war, bergauf ging es immer im Leerlauf.
Später habe ich die schweren Böden mit dem Traktor umpflügen, und in den letzten Jahren auch mit dem Binder mähen
lassen. Von der Stute habe ich 2 schöne Fohlen gezogen; ein davon habe ich bei der Ausreise in die Bundesrepublik
mitgebracht und bei der Viehverwertungs-Genossenschaft in Göttingen verkauft. In den ersten Nachkriegsjahren als noch
wenig Land bestellt wurde, breiteten sich auf den nicht beackerten Flächen, Wildkräuter aus. Disteln und andere
Schnellwachsende, erreichten manchmal eine Höhe von 2 Meter, besonders auf den schweren Böden.
Es hat viel Schweiß gekostet ehe man den Acker soweit hatte, das er auch befriedigende Erträge abwarf. Die
Währungsreform von 1950, hat unser weiniges Geld das wir schon gespart hatten, wieder vernichtet. Ich hatte 2 Pferde,
1 Fohlen, 2 Kühe und Schweine, als ich wieder aufgefordert wurde nicht bezahlte Grundsteuern nachzuzahlen. Als ich
nicht bezahlen konnte, hat der Vollziehungsbeamte, ein Fohlen, eine Kuh und ein Schwein gepfändet. Es gelang mir jedoch
nach längeren Verhandlungen, ohne größere Verluste, alles zu regeln. Später kam eine Verfügung, die besagte; wenn
jemand auf seinem Hof nur eine Kuh und ein Pferd hatte, durften sie nicht gepfändet werden. Einige haben ihr Inventar
dieser Verfügung angepasst und dadurch die Zahlung von Grundsteuer umgangen.

Wer seine Steuern pünktlich bezahlt und sein Kontingent an landwirtschaftlichen Produkten fristgerecht abgeliefert hat,
der konnte seine, darüber hinaus erwirtschafteten Produkte zu marktgerechten Preisen verkaufen. Für eine hochtragende
Sterke, mindestens 400 kg schwer, die auf ein staatliches Gut verkauft wurde, konnte man bis zu 12000 Zloty bekommen.
Unsere Böden waren kalkarm, doch durch den Einsatz von Kalk und Kunstdünger konnte man den Ertrag erheblich steigern.
Kalk und Kunstdünger konnte man bei der Genossenschaft(GS) bestellen, der dann auch direkt auf den Hof geliefert wurde.
Kalk wurde geliefert und gleich auf dem Feld ausgestreut. In den 1960ger Jahren waren alle Ackerflächen der Rohmaner
Felder bestellt.
Die nach dem Krieg zurückgebliebenen deutschen Bauernfamilien, aber auch die Polen, die während des Krieges beim Bauern
in Deutschland gearbeitet haben, versuchten mit teils bescheidenen, oder auch zusammen gesuchten, landwirtschaftlichen
Geräten, die bäuerlichen Betriebe aufrecht zu erhalten. Nach den schweren Anfängen in den ersten Nachkriegsjahren
erzielten sie schließlich einen beachtlichen Erfolg, der sich in wogenden Kornfeldern, sowie in grünen Wiesen auf
denen gut genährtes Vieh weidete, widerspiegelte.
Ein schwerer Einschnitt in meinem Leben.
Am 11. Mai 1956 verstarb nach langer schwerer Krankheit, meine liebe Ehefrau Marta Rattay,
geborene Brosch. Ein Jahr zuvor war schon mein Schwiegervater Gottlib Brosch verstorben. Die schweren Bedingungen
unter denen wir nach Kriegende leben mussten, haben ihrer bereits angegriffenen Gesundheit sehr zugesetzt. Sie
verstarb mit 44 Jahren und hinterließ in unserer Familie eine große Lücke, die nicht mehr zu Überbrücken war. Wir
haben sie unter großer Anteilnahme der noch verbliebenen deutschen Bevölkerung zu Grabe getragen und auf dem Rohmaner
Friedhof beigesetzt. Die Arbeit die sie sonst verrichtet hatte fiel jetzt auf mich und meine Söhne zurück. Meine
Schwester Frieda Pelkowski half auch wo sie nur konnte. Wir waren auf die Unterstützung durch Nachbarn und Freunde
angewiesen, die uns immer wenn es nötig war, tatkräftig unterstützt haben. Im laufe der Zeit haben wir wieder zum
Alltag zurück gefunden, haben sie noch etliche Jahre auf dem Friedhof besuchen können, bis wir, bedingt durch unsere
Ausreise uns endgültig von ihr trennen mussten.
Der endgültige Abschied von Ostpreußen
Ab 1956 begannen, durch die Vermittlung des Deutschen Roten Kreuzes, die ersten Ausreisen in die
Bundesrepublik Deutschland. Zuerst waren es Kinder die zu ihren Eltern ausreisen durften, Familien deren Väter aus der
Kriegsgefangenschaft in den Westen Deutschlands entlassen wurden und andere durch den Krieg getrennte
Familienangehörige. Ab 1960 erhöhte sich die Zahl der Ausreisewilligen aus dem polnisch besetzten Ostpreußen. Es setzte
sich die Überzeugung durch, dass unsere Angestammte Heimat, uns für die Zukunft keine Perspektive mehr bieten konnte.
Meistens wurden die Anträge, die wir an die Passabteilung in Allenstein stellen mussten, um einen Ausreisepass zu
bekommen, negativ beschieden. Nach mehrmaligen Versuchen gelang es dann doch, diese begehrte Ausreiseberechtigung in
Empfang zu nehmen. Die Enttäuschung der Zurückgebliebenen war groß, wenn wieder mal Verwandte oder Nachbarn, den Weg
in Richtung Bahnhof einschlugen.
Um einen Reisepass zu beantragen, musste man zuerst eine Einladung von Verwandten aus der Bundesrepublik vorlegen, in
der, diese sich verpflichten mussten, für Unterkunft und Verpflegung der Eingeladenen zu sorgen. Diese Einladung
musste durch ein Amt in der Bundesrepublik beglaubigt werden. Außerdem mussten die Kosten für die Bahnfahrt, ab
polnischer Grenze, bis zum Zielort, beim polnischen Reisebüro ORBIS, in Warschau, in DM eingezahlt werden.
Unseren ersten Ausreiseantrag haben wir 1964, bei der Kommandantur der polnischen Miliz in Allenstein eingereicht, der
nach einer gewissen Zeitspanne, ohne eine uns verständliche Begründung zu nennen, abgelehnt wurde. Gegen diese
Ablehnung wurde ein Widerspruch zugelassen, den wir sofort einreichten. Nach einer weiteren Zeitspanne erhielten wir
wieder eine Ablehnung, gegen die kein Widerspruch mehr zulässig war. Wer seine Ausreiseabsicht nicht aufgeben wollte,
musste einen neuen Antrag stellen. Es gab Familien die schon 10 Mal einen Ausreiseantrag gestellt hatten und immer
wieder abgewiesen wurden. Da meine Söhne, nicht die Absicht hatten in Rohmanen zu bleiben und ich nach 2 Weltkriegen,
an denen ich teilgenommen, die schwere Arbeit auf der Landwirtschaft, nicht aus eigener Kraft schaffen würde, haben wir
1966 wieder einen Antrag gestellt, der prompt abgelehnt wurde. Der Widerspruch auf diese Ablehnung wurde auch negativ
beantwortet, so dass wir 1968 wieder einen Antrag eingereicht haben.
Weil das Passamt in Allenstein lange nichts von sich hören ließ, hegten wir schon die Hoffnung das es jetzt klappen
würde und waren sehr enttäuscht als wieder eine Absage kam. In der Zwischenzeit sind viele Nachbarn und Bekannte aus
Rohmanen, sowie aus der näheren Umgebung, ausgereist und das Häuflein der noch verbliebenen Deutschen, wurde immer
kleiner. Die Motivation, die uns in früheren Jahren, über so manche schwierige Lage hinweg geholfen hat, ist einer
hoffnungslosen Resignation gewichen. Man war davon überzeugt, dass unser Leben, in unser Angestammten Heimat, keine
Zukunftsperspektive mehr haben konnte und wenn wir keine Ausreisegenehmigung bekommen, wir eines Tages die letzten
Deutschen in der ganzen Umgebung sein werden.
Die Ausreise-Heimat ade
Wir hatten die Hoffnung schon aufgegeben, als am 30. April 1969, der Briefträger unseren Hof
betrat und mir einen Brief überreichte, in dem uns das Passamt in Allenstein mitteilte, dass unsere Ausreise in die
Bundesrepublik Deutschland, genehmigt worden ist. Wir müssten, nach Aushändigung der Reisepapiere, den Geltungsbereich
der Volksrepublik Polen, innerhalb von 3 Monaten verlassen. Wir waren zuerst geschockt, über den Hinweis, das wir
unsere Heimat in 3 Monaten verlassen müssen, aber dann stellte sich die Zukunftsperspektive wieder ein und wir gingen,
wie von einem schweren Ballast befreit und gut gelaunt unser weiteren Tätigkeit nach.
Als der Briefträger unseren Hof betrat, waren ich und mein Sohn Kurt gerade dabei eine Fuhre Mist zu laden. Wir hatten
den Wagen gerade halb geladen und haben nach der frohen Kunde nicht mehr weiter gemacht, sondern die Pferde vorgespannt
und den Mist aufs Feld gefahren, damit wir den Wagen für alle Fälle frei hatten. Das war die letzte Tätigkeit für
unsere Landwirtschaft in Ostpreußen.
Die Nachricht von unserer Ausreise verbreitete sich, ohne dass wir darüber gesprochen haben, wie ein Lauffeuer.
Alsbald kamen Leute aus dem Dorf, die sich für das Vieh und für diverse Landwirtschaftliche Geräte interessierten.
Etliche wollten bestimmte Sachen sofort kaufen, andere haben nur zurücklegen lassen und wollten später kommen und
bezahlen, haben es aber dann doch nicht genommen.

Wenn man eine Landwirtschaft hatte, konnte man 2 Pferde, 2 Rinder, 3 Schweine, 5 Schafe und 10 Hühner, in einem
geschlossenen Viehwaggon, in die Bundesrepublik mitnehmen. Jeden Tag war man unterwegs, von einer Behörde zur Andern.
Die Aushändigung der Reisepapiere erfolgte nur nach Vorlage bestimmter Bescheinigungen: Es mussten alle Steuern bezahlt
sein, das Kontingent landwirtschaftlicher Erzeugnisse musste abgeliefert sein, je eine Bescheinigung vom Katasteramt
und vom Notar musste vorgelegt werden, das man dem polnischen Staat das Grundstück abgetreten hat. Die Gebühren für
die notarielle Beglaubigung mussten wir selbst bezahlen. Wenn man alle Bescheinigungen beisammen hatte, bekam man bei
der Kreisverwaltung eine Gesamtbescheinigung. Mit dieser Bescheinigung konnte man nach Allenstein, zur
Polizeikommandantur fahren, wo man nach dem schriftlichen Verzicht auf die polnische Staatsangehörigkeit, einen
Reisepass ausgehändigt bekam, der den Inhaber zum Grenzübertritt berechtigte, aber nicht zur Wiedereinreise.
Wir haben 2 Pferde, eine Sterke, einen Ochsen, 5 Schafe, 2 Schweine und 10 Hühner mitgenommen. Über die Schutzimpfung
der Rinder musste man eine, vom Kreistierarzt beglaubigte Bescheinigung vorweisen. Ich habe 5 Schafsböcke gekauft, die
ich in der Zwischenzeit, hinter der Scheune, zum Weiden angekettet hatte. Einer von denen hat sich losgerissen und
seinen Nachbarn getötet. Das Fleisch konnten wir noch verkaufen, mussten aber dafür einen anderen Schafsbock kaufen.
Innerhalb von 3 Monaten mussten wir alles regeln und zwei Tage vor der Abfahrt einen Eisenbahnwagen, bei der
Eisenbahndirektion in Allenstein bestellen. Reservierungen bei den polnischen Behörden waren meist immer mit
Schmiergeld verbunden, weil man sonst nie sicher sein konnte dass diese Vereinbarungen auch eingehalten werden. Schon
2 Wochen vor unserer Abfahrt, gab es in Ortelsburg keine alkoholischen Getränke zu kaufen. Meine Söhne mussten mit dem
Motorrad die umliegenden Dörfer abfahren, damit wir für die Reise einen Vorrat anlegen konnten; denn Wodka war zu der
Zeit, in Polen, wie eine zweite Währung.
Am 25. Juli haben wir zusammen, mit meinem Neffen Siegfried Brosch, unseren sonstigen Hausrat, der in Kisten verpackt
war, in einen Eisenbahnwagen, auf dem Allensteiner Bahnhof verladen. Alles musste zuerst durch den Zoll, wo die
Federbetten gewogen wurden und über das erlaubte hinausgehende Kissen, verzollt werden mussten. Dasselbe galt auch für
Fleisch und Räucherwaren.
Am 26. Juli, unserem Verladetag, kam der Eisenbahnwagen aus Allenstein, erst um 11 Uhr auf dem Ortelsburger Bahnhof an.
Die Rinder hatten wir zu Fuß, zum Bahnhof gebracht; Schweine, Schafe und Hühner auf dem Pferdewagen. Im Eisenbahnwagen
mussten, mit Hilfe von Brettern und Bohlen, Boxen für die verschiedenen Tiere erstellt werden. Jedes Pferd und jedes
Rind in eine Bucht. Die Schafe zwischen die Pferde, die Schweine zwischen die Rinder und die Hühner in einem Käfig,
unter der Decke über den Rindern. Die Hühner hatten unterwegs Eier gelegt, somit hatten wir jeden Tag frische
Verpflegung. Bei der Fahrt im Viehwagen, begleitete mich mein Sohn Manfred. Als die Lokomotive nahte, um den Wagen
abzuholen, wurden noch schnell die restlichen Sachen hinein geworfen und so mache Abschiedsträne rollte dann die Wange
hinab.
Unsere Nachbarn, Deutsche und Polen, halfen uns beim Verladen des lebendigen Inventars. Jetzt erinnerte ich mich
plötzlich, an die oft auch schönen, Ereignisse der letzten 22 Jahre. Einer Zeit, in der das Zusammenleben von
Deutschen und Polen, von Jahr zu Jahr, besser wurde. Man half sich beim einbringen der Getreideernte, beim Dreschen
des Getreides, bei der Kartoffelernte und bei anderen Arbeiten, wo viele Menschen zupacken mussten. Es war eine
Dorfgemeinschaft, in schweren Zeiten geboren; jeder half jedem wenn Hilfe nötig war. Es wurde mir plötzlich bewusst,
das jetzt ein Lebensabschnitt zu Ende ging, zu dem ich nicht mehr zurückkehren konnte. Unsere Existenzgrundlage war
jetzt ein Eisenbahnwagen auf einem Schienenstrang, dessen Ende irgendwo in weiter Ferne lag. Obwohl, von langer Hand
vorbereitet, war dieser Moment voller Wehmut.
Doch als der Zug sich plötzlich, in Bewegung setzte, war ich sofort wieder in der Gegenwart. Menschen, mit denen man
Jahrzehnte lang, in gutem Einvernehmen zusammen gelebt hat, blieben plötzlich am Bahnsteig zurück und die Entfernung
zwischen ihnen und mir vergrößerte sich mit jeder Sekunde, bis sie letztendlich aus meinem Blickfeld verschwanden.
Es war ein heißer Julitag, als wir unsere Reise gen Westen antraten. Für die Schweine, die besonders unter der Hitze
zu leiden hatten, haben wir 10 Flaschen Essig mitgenommen und sie von Zeit zu Zeit besprenkelt, damit sie besser atmen
konnten. Für die anderen Tiere war reichlich Heu und Hafer vorhanden. Eine großes Fas und zwei Milchkannen waren mit
Wasser gefüllt, die wir auf den an der Strecke liegenden Bahnstationen, bei Bedarf wieder nachgefüllt haben.
Da der Kreistierarzt nicht in seinem Büro war, konnten wir die Impfbescheinigung für das Vieh, nicht rechtzeitig
herbeischaffen. Der Zug setzte sich in Bewegung und die Bescheinigung war immer noch nicht da. Als die Bescheinigung
dann eingetroffen, wir aber schon unterwegs waren, ist mein Sohn Kurt mit dem Motorrad hinterher gefahren und hat uns
in Passenheim, wo der Zug noch andere Wagen angehängt bekam, die Impfbescheinigung übergeben. Wir waren sehr froh das
er es noch geschafft hat, denn in solch einer Situation fühlt man sich sicherer wenn man alle Bescheinigungen bei sich
hat. Auf der Rückfahrt, mit dem Motorrad hatte er noch eine Panne, musste das Motorrad stehen lassen und per Anhalter
nach Hause fahren. Am nächsten Tag kam er mit Siegfried Deptolla, der das Motorrad wieder flott machte und brachte es
wieder nach Rohmanen zurück.
Die Fahrt mit dem Viehwagen, gen Westen
Von Ortelsburg bis Allenstein(45 km) hat unser Zug 4 Stunden gebraucht, weil auf jedem Bahnhof
gehalten wurde, um neue Wagen anzuhängen. Nachdem wir in Allenstein angekommen waren, kam ein Rangierer und fragte
nach unserem Ziel. Als wir ihm mitteilten, das wir in die Bundesrepublik Deutschland wollen, sagte er nur: „In 10
Minuten fährt ein Zug los. Wenn ich von euch 500 Zloty und einen Liter Wodka bekomme, werde euch sofort anhängen,
andernfalls kommt ihr auf ein Nebengleis und müsst dann auf den nächsten Zug warten. Es blieb uns nichts anderes übrig
als seiner Forderung nachzukommen, denn über derartige Erpressungen hat man bereits von Anderen, die vor uns ausgereist
sind, gehört. Wir wurden auch sofort angehängt und fuhren dann die ganze Nacht, an Osterode, und Thorn vorbei bis
Gnesen. Dort wurde wieder rangiert.
Von einer Anhöhe wurden die einzelnen Wagen auf verschiedene Gleise verteilt und zu neuen Zügen zusammengestellt. Der
Aufprall der ungebremsten Wagen erzeugte eine derartige Erschütterung, dass manche Bretter an den Boxen geborsten waren.
Von Gnesen ging es dann in einem Zuge durch bis zur Grenzstation Reppen(Rzepin). Dort mussten wir zum Zollamt, wo
unsere Ausfuhrpapiere durch die Zollbeamten, und durch einen Tierarzt geprüft wurden. Bis Reppen(Rzepin) haben wir für
den Eisenbahnwagen 900 Zloty bezahlt; hier mussten wir noch einmal 650 Zloty bezahlen. Bei der Wagenkontrolle erklärte
uns ein Bahnbeamter das unser Wagen, sich nicht für den internationalen Transport eignet und wir deshalb den Inhalt in
einen Anderen umladen müssen, der irgendwann, auf dem Nebengleis bereitgestellt wird. Nach langer Verhandlung, sowie
einer Zulage von 500 Zloty und einem Liter Wodka haben wir ihn davon überzeugt, das der Wagen sich doch für die
Weiterfahrt eignet.
In der Nacht war Schichtwechsel, der unseren Wagen wieder abgehängt hat, weil er angeblich von der Reichsbahn der DDR,
wegen technischer Mängel nicht weiterbefördert würde. Wir mussten unsere Verhandlung vom Vorabend wiederholen, die mit
der Zusage endete, dass wir am frühen Morgen, über die Grenze auf DDR Gebiet, gebracht werden. Um 5 Uhr morgens kam
eine Lokomotive, die uns den letzten Abschnitt bis über die Grenze bringen sollte. Als der Zug hat noch einmal anhielt,
kamen polnische Grenzbeamte und Soldaten in den Wagen. Sie durchsuchten ihn und fragten, ob wir noch polnisches Geld
oder einen Grundbuchauszug bei uns hätten. Wir zeigten ihnen 800 Zloty, die sie uns, nach Ausstellung einer Quittung
über 500 Zloty, abnahmen. Die Grundbuchauszüge habe ich, im Stroh versteckt, dem Ochsen vor die Füße gelegt. Falls
jemand da suchen sollte, hätte ich gesagt, das das Tier bösartig veranlagt ist, und ich für seine Sicherheit nicht
garantieren könnte, deshalb sollte er vorsichtig sein.
Als die Grenzkontrolle den Zug verlassen hatte, setzte sich die Lokomotive wieder in Bewegung und überquerte nach
kurzer Zeit die Oderbrücke. Auf einer eingezäunten Fläche, jenseits der Grenze, hat man uns abgestellt hat und die
Lokomotive fuhr zurück auf polnisches Gebiet. Vor und hinter uns waren die Tore verschlossen. Auf den Wachtürmen,
links und Rechts von uns, standen Posten mit einem Gewehr im Anschlag. Vier Grenzbeamte der DDR, jeder mit einer
Leiter in der Hand, sowie ein Schäferhund, kamen zu unserem Wagen. Sie öffneten die Schiebetüre, stellten die Leiter
davor und ließen den Hund in den Wagen springen, der nur etwas herum schnupperte und wieder heraussprang. 2 Beamte
haben dann anschließend, die Papiere kontrolliert und das Inventar gezählt.
Nach einiger Zeit wurden wir an einen Güterzug der Reichsbahn angehängt und fuhren von Frankfurt an der Oder, vorbei
an Berlin, Ellingen und Nordhausen, über die Grenze zur Bundesrepublik bis Herzberg. Hier hat ein Zollbeamter der
Bundesrepublik, die Formalitäten erledigt und ein Tierarzt die Pferde, Rinder und Schweine gründlich untersucht. Ich
musste ihnen die Mäuler aufhalten und die Füße hochheben. Danach hat uns die Lokomotive zu einer Wasserzapfstelle
gebracht, wo wir die Tiere tränken und unsere Behälter mit Wasser auffüllen konnten. Anschließen fuhren wir über
Northeim nach Göttingen, zur Viehverwertungsgenossenschaft, die zuvor von unserer Ankunft in Kenntnis gesetzt wurde.
Der Ochse, die Sterke und die Schweine wurden, in Göttingen zum Schlachthof gebracht; die Pferde kamen nach Hannover
und die Schafsböcke nach Kassel. Wir waren mit dem Viehtransport 5 Tage unterwegs; hatten so manche Klippe umschifft
und Schwierigkeiten gemeistert, die im normalen Leben nicht vorkommen.
Wir wurden mit einem PKW, ins Durchgangslager Friedland bei Göttingen gefahren, wo mein Sohn Kurt, meine Schwester
Frieda Pelkowski und Siegfried Brosch mit Familie, die am 30 Juli, um 14 Uhr, von Warschau mit dem Zug abgefahren, und
hier am 31. Juli in den Morgenstunden eingetroffen sind, schon auf uns gewartet haben. In Friedland hat man uns mit
Familie Siegfried Brosch in einem Raum untergebracht, wir wurden registriert und erhielten 20 DM Überbrückungsgeld,
pro Person. Da wir erst am Freitag in Friedland eingetroffen sind, mussten wir hier über das Wochenende bleiben,
obwohl die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der Regel nur 3 bis 4 Tage beträgt.
Um einen Antrag für die Ausreise stellen zu können, brauchten wir eine Einladung von in der Bundesrepublik lebenden
Verwandten. Diese Einladung hat uns mein Bruder, Ernst Rattay, aus Ingelheim am Rhein zugeschickt. Ingelheim liegt im
Bundesland Rheinland-Pfalz. Das Geld für die Bahnfahrt, hat uns, Frieda Schellin, geb. Nickel, aus Duisburg, die
Tochter unseres Nachbarn, überwiesen. In Friedland wurden wir registriert. Im Registrierschein, war als unser
nächster Aufenthaltsort in der Bundesrepublik, das Durchgangslager Osthofen bei Worms, das alle Aussiedler für
Rheinland-Pfalz aufnehmen musste, eingetragen. Die Eintragung erfolgte deshalb, weil der Ort aus dem uns unsere
Einladung zugeschickt wurde, sich auch in Rheinland-Pfalz befand.
Da ich nach dem Polenfeldzug, als Soldat, ein Jahr im Kreis Opladen, im Rheinland gewesen bin, wäre ich sehr gerne in
diese Gegend gezogen, denn die Erinnerung an die schönen Tage die ich dort verlebt habe war in mir immer noch wach.
Ich versuchte die Eintragung in unseren Regiestierscheinen ändern zu lassen, was nach einigen, vielleicht auch
berechtigten Einwänden, am 4. August, vom Beauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen, genehmigt wurde. Anstelle von
Rheinlad-Pfalz stand da jetzt Nordrhein-Westfalen und am 7. August, fuhren wir, noch mit anderen Aussiedlern, ins
Durchgangslager Unna-Massen, am östlichen Rande des Ruhrgebietes gelegen. Hier wurden wir in einem Zimmer untergebracht
und konnten unser Essen in einer Gemeinschaftsküche zubereiten.
Am 8. August wurden wir in Unna-Massen, als Bürger der Bundesrepublik Deutschland registriert, erhielten
Einhundert DM Begrüßungsgeld, den Vertriebenen Ausweis -A -und 4 Wochen später den Bundespersonalausweis. In
Unna-Massen haben wir mehr als 4 Monate verbracht, weil mein Sohn Kurt, wegen fehlender Berufsausbildung, in Unna, an
einem Grundlehrgang für Metallarbeiter teilgenommen hat, der vom Arbeitsamt finanziert wurde. Am 11 Dezember 1969 sind
wir endlich an unserem vorläufigen Wohnsitz, im Durchgangswohnheim, an der Elisabethstraße 13, in Velbert angekommen.
Ab dem 5. Januar 1970 konnten meine Söhne, in der Zahnradfabrik Reining, in Velbert ihrer geregelten Arbeit nachgehen.
Von Bau- und Sparverein in Velbert wurde uns am 20. Juni 1970, unsere erste Wohnung zugewiesen.
Velbert im Februar 1972
gezeichnet: Gustav Rattay
Als endlich das Tauwetter einsetzte verwandelte sich die Gegend um Baranowitschi in ein unüberwindbares Sumpfgelände.
Wir wurden mit anderen Einheiten die aus Frankreich zu uns verlegt wurden, zusammengelegt. Wenn jemand nachweisen
konnte dass er Landwirt ist und mehr als 100 Morgen Ackerland besitzt, konnte er einen Urlaub zur Frühjahrsbestellung
beantragen. Ein Gottlieb Piotrowski aus Plohsen hat seinen Urlaub bewilligt bekommen und durfte für 14 Tage nach Hause.
Wenn von der unweit entfernten Front Kanonendonner zuhören war und Alarm ausgerufen wurde, dachten wir es geht los.
Obwohl wir als Reserve aufgestellt waren mussten wir allzeit einsatzbereit sein. Wir haben auch Bunker und Stollen
gebaut, Schützengräben ausgeworfen und mit scharfen Handgranaten exerziert.
Als Gottlieb Piotrowski nach 2 Wochen zurückkam waren wir schon in Alarmbereitschaft und sind dann auch 2 Tage später
ausgerückt. Kamerad Piotrowski hatte mir noch ein großes Paket von zu Hause mitgebracht.
Italien hat Deutschland und Österreich den Krieg erklärt.
Zuerst sind drei Bataillone Österreicher ausgerückt, dann die Deutschen hinterher. Bis zum
Bahnhof Linowa wurden wir von einer Musikkapelle begleitet, dann ging es per Eisenbahn ab nach Baranowitsche. Dort
wurden wir der, an der Westfront aufgeriebenen, 15ten Reserve Division zugeteilt. Es wurde uns gesagt das Kameraden
aus der Heimat gleichen Gruppen zugeordnet werden können. Ich hatte einen Freund aus meinem Dorf, Gustav Spektor,
einen aus Groß Schöndamrau, Wilhelm Lukas und einen aus Ortelsburg, Karl Schlensack, wir kamen zu zusammen in eine
Kompanie. Zuerst waren wir in einem Kinosaal einquartiert, haben jeden Tag Schützengräben ausgehoben und Feldübungen
gemacht. Es war ein sumpfiges Gelände, so dass die Soldaten wegen den vielen Mücken, Netze auf den Köpfen tragen
mussten. Nach einem Gewitter wurde es plötzlich unerträglich. Die Mücken hatten meinen Freund so zerstochen dass sein
Gesicht dermaßen angeschwollen war und ich ihn gar nicht wieder erkannt habe.
Von Baranowitsche wurden wir wieder auf die Eisenbahn verladen, die uns mit unbekanntem Ziel Richtung Osten fuhr.
Nachdem wir unterwegs einmal zum Essenfassen gehalten haben, kamen wir in der Nacht in Krakau an. In der nächsten
Nacht befanden wir uns schon in den Karpaten, wo wir die Hügelketten zu Fuß überqueren mussten, die Fahrzeuge fuhren
um die Berge herum und wir mussten manchmal 2 Stunden warten bis sie uns wieder eingeholt hatten. So ging es immer
weiter bis wir auf einen Berg kamen wo wir Zelte aufgebaut und Biwak bezogen haben. Dort stießen wir auf türkische
Einheiten die auf Mauleseln Munition und Verpflegung über die Berge transportiert haben. Die Esel hatten ein Gestell
auf dem Rücken, auf jeder Seite eine Fass mit Wasser oder Kisten mit Proviant. Ihre Artillerie wurde von 6 Mauleseln
gezogen, während die Offiziere, ohne Sattel, ohne Zaumzeug, nur mit einem Hanfseil ausgerüstet, daher kamen.
Die Mannschaften marschierten wie es jeder für richtig hielt, mit aufgekrempelten Ärmeln, das Gewehr über den Tornister
gelegt, wie die Wilddiebe. Im Gegensatz dazu herrschte bei uns strenge Disziplin, wen jemand aus der Reihe ging kam
sofort der Kompanieführer angeritten, hat uns angeschrieen, uns klar gemacht dass wir keine Türken seien und nur auf
höheren Befehl etwas an der Marschordnung ändern dürften, wer dagegen verstoße, müsste mit einem 3tägigen Arrest
rechnen. Wir haben hinter der der Front Gewaltmärsche durchgeführt die dem Feind große Truppenaufmärsche vortäuschen
sollten.
Wir lagen in einem Buchenwald in Bereitschaft. Überläufer berichteten dass auf russischer Seite eine Großoffensive
vorbereitet wird. In einer Nacht wurde plötzlich Alarm geschlagen, der Russe war zu einem Angriff mit Gasgranaten
übergegangen. Wir lagen unter Zelten und hatten die Gasmasken gar nicht bei uns, sondern nur etwas abseits liegen. In
der Dunkelheit hat mach einer keine Gasmaske mehr gefunden. Es war ein fürchterliches Durcheinander. Dabei war es
unsere Pflicht die Maske immer an dem Tragriemen über dem Hals zu tragen, mit halb geöffnetem Deckel. Uns hat es zum
Glück nicht so stark betroffen weil wir auf einer Anhöhe lagen und die Gaswolken sich im Tal verteilten. Wir wurden in
höchste Alarmbereitschaft versetzt weil der Russe die österreichische Front durchbrochen hatte.
Eigentlich sollten wir noch an einer Gulaschkanone Essen fassen, aber es blieb uns dazu keine Zeit mehr. Der
Kompanieführer befahl uns die Zelte abzubrechen, auf den Tornister aufzurollen und in fünf Minuten marschbereit zu
sein. Die Kanoniere befanden sich schon in der Batteriestellung, luden die Granaten, die sofort abgefeuert wurden. Der
Battalions-Kommandeur versammelte die Kompanieführer und erteilte ihnen die Angriffsbefehle. Derweil sollten wir in
einem Eichenwal der schon mit Granattrichter übersät war, Deckung suchen. Bald hatten wir die Verbindung zu unserem
Batteriestab verloren. Wir warfen unsere Tornister auf einen Haufen, schwärmten unverzüglich, nur mit Sturmgepäck
ausgerüstet, 4 Handgranaten im Brotbeutel, zum Angriff aus. Wir robbten uns einzeln voran. Weil der Russe unsere
Stellungen schon überrannt hatte war jeder auf sich selbst angewiesen. Mann hörte kein Kommando mehr weil der Russe
inzwischen den Rückzug angetreten hatte, um sich auf einer Bergspitze zu verschanzen, von der er uns mit
Flachbahngeschützen beschoss. Irgendwann befanden wir uns in einem Schützengraben, wo ein Leutnant und 17 Mann aus
unserer Division die Stellung hielten. Unter Androhung von Gewalt befahl er uns den Graben sofort zu verlassen und am
Gegenangriff teilzunehmen. Wir sprangen über den Stacheldraht, duckten uns aber sofort im nächsten Graben damit das
mörderische Maschinengewehrfeuer uns nicht hinwegfegte.
Dort blieben wir bis zum Eintritt der Dunkelheit liegen. Wir konnten unsere Waffen nicht mehr einsetzen weil der Sand
die Gewehrschlösser blockiert hatte. Als es Nacht wurde herrschte ein gespenstische Stille. Wir krochen aus dem
Schützengraben und lauschten nach irgendeinem Lebenszeichen von anderen Kameraden. Dann hörten wir irgendwelche Laute
die wir nicht genau zuordnen konnten. Sie kamen aus einem Holzbunker ganz in der Nähe. Wir näherten uns ganz
vorsichtig, als plötzlich eine Schar österreichischer Soldaten herausstürmte. An unseren Stahlhelmen erkannten sie
dass wir Deutsche sind. Bald danach trafen wir auch auf 69 deutsche Soldaten die zu unserer Division gehörten. Dann
kam ein Hauptmann der uns mit Vorwürfen überschüttete, wir seien Feiglinge, wir hätten uns von unserer Einheit entfernt.
Wir haben ihm den Vorgang geschildert, aber ließ nicht mit sich reden und sagte nur dass wir bestraft werden und nichts
zu essen bekommen. Wir wurden einer Maschinengewehr Einheit zugeteilt welche die vorderste Stellung verteidigen
musste. Wir hatten einen Stollen mit 2 Ausgängen.
Die Russen haben bemerkt das sich etwas bewegte und haben uns unverzüglich mit Artilleriefeuer belegt. Schon die
dritte Granate war ein Volltreffer. Vier Kameraden waren sofort tot, ich bekam mit einem Stollenbrett in den Rücken
der sofort blau und grün angelaufen war. Ich schaute nach oben, alles war verschüttet. Ich wusste nicht das da noch
ein Ausgang war, doch die Kameraden die hier in Stellung waren haben mir geholfen das Freie zu erreichen. Ich habe
mich am nächsten Tag krank gemeldet, dachte 2 Tage Schonung zu bekommen, aber der Sanitäter hat mir nur den Rücken mit
Spiritus eingerieben und mich wieder, zurück zu unserer Kompanie geschickt. Sie bestand nur noch aus 3 Gruppen, die in
einem Stollen, der in einen Berg gehauen war, Stellung bezogen hatten. Wir konnten uns hier wenigstens waschen, an
einer Quelle die aus dem Felsen sprudelte. Wir waren nicht mehr einsatzfähig und mussten durch andere Truppenteile
verstärkt werden.
Beim Essen holen musste man auch das Gewehr bei sich haben, es wurde erzählt dass hier der braune Bär herumwandert.
Ich habe keinen gesehen, nur das die Toten ausgescharrt wurden und verstümmelt herumlagen. Nach einigen Wochen haben
die Deutschen eine Gegenoffensive gestartet, von den Bergen herunter, über den Fluss Zlota Lipa, bis zu einer Stadt
die Brzezany hieß. 2 Tage später wurden wir auch eingesetzt, bei großer Hitze ging es in Dauermärschen vorwärts, man
durfte aus den Flüssen kein Wasser trinken, weil es mit Petroleum verseucht war. Nur wenn es dunkel wurde machten wir
halt, dann mussten wir Gräben ausheben um vor Überraschungen sicher zu sein.
Links von uns war Tarnopol und rechts Rumänien. Wenn es nach einer Ruhepause wieder losging dann war es am schlimmsten,
man ging wie auf Nägel, weil die Füße die Strapazen nicht so ohne weiteres wegsteckten. Im Dorf wurde niemals Rast
gemacht, denn da waren immer Brunnen, zu denen alle hinstürmten. Später wurden Melder vorausgeschickt, die von den
Dorfbewohnern Wasser in Eimern am Weg raussetzen ließen, damit die Soldaten Ihren Durst löschen konnten. Ein Soldat hat
gleich den ganzen Eimer mitgenommen und ihn dann als er leer war, irgendwo am Wegrand stehen lassen. Der Kompanieführer
kam angeritten, hat ihn ausgeschimpft und gedroht, ihn mit 3 Tagen Arrest zu bestrafen. Wir gehörten zur Südarmee
welche von Graf Bothmer befehligt wurde.
Die Stellungen waren schlecht ausgebaut, abends mussten wir, von der 2 Kilometer hinter der Front liegenden Feldküche,
Essen und andren Proviant holen. Ich war der Jüngste der Gruppe, musste immer 9 Kochgeschirre tragen, Brot und Post
habe ich in 2 Sandsäcke, die ich über der Schulter hängen hatte, verstaut. Wenn wir unterwegs waren wurde der
Laufgraben immer beschossen. Einmal schlug eine Granate am Schützengrabenrand ein und hat mich halb verschütte, die
Kochgeschirre aus den Händen gerissen, so dass ich ohne Verpflegung im vorderen Graben ankam. Nach drei Wochen sollten
wir abgelöst werden Es hat jeden Tag geregnet, wir haben unsere Mäntel angezogen und uns mit Zelten bedeckt. Nach dem
wir abgelöst wurden kamen wir in ein Dorf dass von Juden bewohnt war. Die Bewohner waren froh dass wir keine Kosaken
waren, mit denen hatten sie vor ein par Tagen schon schlechte Erfahrung gemacht, die hatten ihnen beim Abzug Vieh und
Pferde weggenommen.
Der Boden war sehr fruchtbar, es wurden Hanf, Weizen, Hafer, Mais, Bohnen, Roggen und Kartoffeln angebaut. Die
Bewohner waren gerade mit der Ernte beschäftigt. Die Häuser waren nur aus Holz und Stroh erbaut. Die Leute lebten in
sehr ärmlichen Verhältnissen. Ich hatte mir in unserer Kantine für 20 Pfennig ein Taschenmesser gekauft, das hat mir
ein Bauer für 6 Eier und 2 Pfund Brot abgekauft, daraus hat er sich dann ein Rasiermesser geschliffen. Wenn unser
Versorgungstross auf denn holperigen Wegen nicht nachkam, haben im Dorf auch Verpflegung eingekauft. Die Leute hatten
Angst dass wir nicht bezahlen werden, doch wir bekamen meistens pünktlich unseren Wehrsold ausgezahlt und konnten uns
so manches genehmigen. Um unser Marschgepäck zu erleichtern haben wir so manches aus dem Tornister weg geworfen.
Unweit eines Dorfes wurde halt gemacht, wir sollten Zelte aufschlagen, doch niemand hatte mehr Zeltstöcke im Tornister,
alles war unterwegs liegen geblieben. Der Zugführer befahl uns ins Dorf zugehen und Stöcke zu besorgen. In einer
Scheune stießen wir auf eine Hühnerschar, mit den Stöcken haben wir einige Hühner erlegt, in einem Hanffeld gerupft
und dann im Eiltempo zurück zu unserer Truppe. Als wir ankamen war die Kompanie schon marschbereit, es gleich weiter,
mit dem Huhn im Tornister. Bei der nächsten Rast haben wir die Hühner ausgenommen und Holz besorgt um sie zu kochen,
doch wir mussten schnell wieder weiter marschieren und erst nach 2 Tagen konnten wir uns mit den Hühnern befassen,
leider waren die so alt das sie nicht gar wurden. Das Fleisch mussten wir wegwerfen, nur die Suppe konnten wir noch
gebrauchen.
Meine Verwundung am Pruth.
Wir befanden uns 8 km vor der russischen Grenze. Der Kompanieführer hatte uns informiert das
wir hier zum Einsatz kommen. Wir bekamen noch ein Mittagessen aus der Gulaschkanone, konnten unsere Feldflaschen mit
Tee, der mit Rum angereichert war, auffüllen, Munition und Handgranaten in Empfang nehmen und dann ging es zum Einsatz.
Um 3 Uhr begann das ganze Bataillon auszuschwärmen, sofort hat uns der Russen entdeckt und begann uns mit Artillerie
zu beschießen, je weiter wir vorrückten desto heftiger.
Bis zu einem Eisenbahndamm hatten wir gute Deckung, doch wir sollten den dahinter fließenden Fluss überqueren. Doch
plötzlich explodierte über meinem Kopf eine Schrapnellkugel, der Stahlhelm wurde mir vom Kopf gerissen, Tornister und
Koppel flogen auch weg, ich lag auf der Erde und wusste gar nicht was passiert war. Plötzlich fing Blut aus der
Kreuzbeingegend zu rieseln, aus dem rechten Oberschenkel auch. Gleich nebenan war ein Granattrichter, dort habe ich
Schutz gesucht. In der rechten Rockecke hatte man immer ein großes Verbandspäckchen, das habe ich herausgenommen und
auf die Wunde gedrückt, doch das Blut floss mir bis in den Stiefel. Links und rechts von mir schlugen Granaten ein,
dicke Erdbrocken und Schlamm fielen auf mich herab, doch in meinem Erdloch war ich vor Maschinengewehrsalven geschützt.
Der ganze Rücken war angeschwollen und ich konnte mich überhaupt nicht bewegen.
Die Deutschen mussten die Stellung den Russen überlassen, einer hatte mich entdeckt, da ich aber so blutverschmiert da
lag, hat er bestimmt gemeint ich wäre nicht mehr am leben und ist weitergegangen. Nach zwei Stunden habe ich gehört
das die Russen sich wieder zurückzogen, danach herrschte eine gespenstische Stille. Als es dunkel wurde kamen deutsche
Sanitäter mit Spürhunden und haben die Verwundeten aufgesammelt. Ich wurde auf eine Trage gelegt, lag gebeugt und
konnte mich nicht rühren weil der blutverschmierte Rücken völlig verkrustet war. Ein Pferdegespann konnte nur vier
Tragen befördern, die Fahrt über Ackerfurchen war eine Tortur, ich habe nicht geglaubt das ich es überleben werde. In
einer Dorfkirche wurden wir dann ausgeladen und zu den etwa 50 Verwundeten gelegt die da schon lagen.
Mich haben sie zu den Bauchschüssen gelegt, weil ich einen Nervenschock hatte und am ganzen Körper gezittert habe. Zu
trinken bekam ich nichts, nur einen feuchten Lappen in den Mund. Ich sollte gleich operiert werden, aber es kamen
immer mehr Verwundete, so bekam ich nur eine Tetanusspritze, wurde verbunden und für den Weitertransport ins Hinterland
vorbereitet. Im Morgengrauen wurden wir auf Lastautos verladen, die aus auf ein Landgut brachten, wo wir in einem
Pferdestall untergebracht wurden. Die Fahrer fuhren so schnell über die Granatlöcher, das wir vor Schmerzen geschrieen
haben. Wir baten sie langsamer zu fahren, aber die bekamen es in ihrem Führerhaus nicht mit, erst alt ein Verwundeter,
der einen Krückstock bei sich hatte von hinten die Scheibe einschlug wurde die Fahrt erträglich. Lastautos, die
Munition und Verpflegung an die Front transportiert hatten, brachten in den nächsten Tagen immer wieder Verwundete
ins Hinterland. Die Deutschen hatten an diesem Fronabschnitt hohe Verluste zu beklagen. Wir können von Glück reden
dass wir dem Höllenfeuer überhaupt entkommen sind.
Wir wurden mit Lastautos, die ein Feldlazarett uns geschickt hatte, bis nach Lemberg befördert. da wurden wir gewaschen,
rasiert und frisch verbunden. Auf einem Nebengleis stand ein Lazarettzug, in dem wurden wir anschließend in frisch
bezogenen Betten untergebracht. Der Zug brachte uns über Annaberg nach Freiburg in Sachsen, eine Stunde hinter Dresden.
Hier wurden wir auf Tragen gebettet und mit einem Möbelwagen in ein Reservelazarett transportiert.
Im Heimatlazarett.
Als ich am nächsten Tag aufwachte und das schöne Bett sah in dem ich lag, dachte ich dass ich
im Himmel bin. Ich dankte meinem Herrgott das er mich bis zu diesem Ort begleitet hat. Am Nachmittag kamen Schulkinder
mit Geschenken und haben uns schöne Lieder vorgesungen. Anhand von Röntgenaufnahmen wurde in den nächsten Tagen
festgestellt dass bei mir ein Schrapnellsplitter an der Wirbelsäule in die Kreuzbeingegend eingedrungen war. Ich wurde
jeden Tag in Salzwasser gebadet und bekam wieder volle Verpflegung, da mein Magen zum Glück nicht verletzt war. Auf
dem Transport bekam ich nur Suppe und bei Bedarf einen feuchten Lappen auf die Lippen. Ich bin von 62 auf 43 Kilogramm
abgemagert, gehen konnte ich wegen dem Nervenschock den ich bei der Verwundung erlitten hatte auch noch nicht. Die
Wunde am rechten Oberschenkel war nur ein Streifschuss und wurde mit einem Schutzverband versorgt.
In den nächsten Tagen habe ich einen Brief nach Hause geschrieben und mitgeteilt wo ich mich zurzeit befinde. Meine
Eltern schickten mir ein Paket mit Lebensmitteln, jetzt konnte ich essen was ich wollte. Das Essen im Lazarett war
nicht besonders, jeden Tag nur Kohlblätter. Der weg zu den Toiletten führte durch einen Gemüsegarten. Die gehfähigen
Kameraden haben den ganzen Kohlrabi aufgegessen, so dass schließlich Wachposten aufgestellt werden mussten. Sechs
Wochen lang konnte ich mich nur auf allen Vieren fortbewegen, denn sobald ich mich aufrichtete wurde es mir
schwindelig und ich musste zurück ins Bett.
Als ich wieder bei Kräften war habe ich meinen Eltern mitgeteilt das ich mich in ein Lazarett in ihrer Nähe verlegen
lassen will. Der Chefarzt hatte mir zugesichert, wenn die Möglichkeit besteht in Ortelsburg unterzukommen, wird er dem
zustimmen. Meine Mutter hat daraufhin, in Ortelsburg, beim Lazarettinspektor Zantopf nachgefragt und er hat angedeutet
das sie mich aufnehmen können. Daraufhin bekam ich die Krankenpapiere und einen Fahrschein nach Ortelsburg. Da ich als
Soldat nie Heimaturlaub hatte, beschloss ich zuerst meine Eltern zu besuchen. Ich fühlte mich noch sehr schwach, habe
nach jedem Kilometer Rast gemacht, aber letztendlich war ich wieder daheim bei meinen Eltern. Die Wiedersehensfreude
war sehr groß. Ich bin am 30 Juli verwundet worden und am gleichen Tag wurde mein ältester Bruder beerdigt. Er bekam
den Splitter einer Gasgranate ins rechte Bein und ist an einer Blutvergiftung verstorben.
Am nächsten Tag brachte mich mein Vater ins Garnisonslazarett nach Ortelsburg. Ich wurde jeden Tag gebadet und massiert,
weil die Rückenhaut am Knochen angewachsen war konnte ich mich nicht schmerzfrei bücken. In Ortelsburg verbrachte ich
noch sechs Wochen, bis Ende Oktober, da wurde es schon ziemlich kalt und in unserer Barackenunterkunft ziemlich
ungemütlich. Kohlen und anderes Brennmaterial lagen im Hof auf Halde, aber es war verboten zu heizen. Kameraden die in
der Nähe zu Hause waren konnten Sonntagsurlaub beantragen.
Einer von ihnen brachte von zuhause Brennholz mit und entzündete damit im Ofen ein wärmendes Feuer, andere holten vom
Hof Kohlen, so dass der Ofen in kurzer Zeit glühend heiß wurde und die Gefahr bestand das die Betten Feuer fangen
würden. Wir hatten die Betten schon weg gerückt, da kam der Feldwebel herein und fragte wer das Feuer im Ofen
angezündet hat, doch niemand fühlte sich angesprochen. Der Feldwebel hatte den Vorfall dem Stabsarzt gemeldet, als der
am nächsten Morgen zur Visite kam, war seine erste Frage: ”Wer hat gestern Abend das Feuer im Ofen angezündet”. Als
sich niemand meldete, schrie er uns an: ”Morgen wird alles entlassen, zum Ersatzbatallion, in Diez an der Lahn! Wer
gehen kann, sofort zur Schreibstube, Krankenpapiere und Fahrscheine abholen”. Er erinnerte uns noch daran am nächsten
Tag pünktlich am Bahnhof zu sein, weil eine Verspätung unangenehme Folgen für uns haben würde. Das war das Ende der
schönen Erholungsphase. Ich blieb noch eine Nacht zu Hause und bin dann am nächsten Tag von dort zum Bahnhof gegangen.
Wieder Kriegsverwendungsfähig.
Als wir am nächsten Tag in Diez angekommen waren, wurde ich gefragt ob ich aus dem Heimaturlaub
käme, als ich das verneinte wurden mir 2 Tage genehmigt und 14 Tage Genesungsurlaub dazu. Wieder zurück im
Ersatzbatallion bestand unsere Tätigkeit aus Wache schieben und Kartoffel schälen. Nach einem Monat wurden wir von
einem Generalarzt untersucht, er hat mich für nicht einsatzfähig befunden weil ich noch den Steckschuss im Rücken
hatte und das linke Bein 10 Zentimeter dünner war. Jetzt fing das Kasernenleben wieder von vorne an. Wachdienst,
Gewehr laden, sichern, Ehrenbezeugung, Einzelmarsch und Appell. Wer nicht weit nach Hause hatte bekam zu Weihnachten
Urlaub. Ich hatte zu Heiligabend und Silvester Torwache, denn nach Ostpreußen wurde niemand beurlaubt.
Nach Neujahr 1918 wurden wir neu eingekleidet und kamen nach Köln zur Baukompanie. Mit Musik wurden wir zum Bahnhof
gebracht. In Köln wurden wir noch mit Soldaten die von andern Truppenteilen dorthin verlegt wurden in einem großen
Kinosaal, im Stadtteil Edengarten untergebracht. Wir brauchten keinen Dienst zu machen und konnten zu Heilige Drei
Könige den Gottesdienst im Dom besuchen. Kameraden die aus irgendwelchen Gründen im Arrest saßen wurden gefragt ob sie
auch am Gottesdienst teilnehmen möchten, dann würde ihnen die Strafe erlassen. Fast alle haben dem zugestimmt. Einige
Tage später wurden wir wieder auf einen Transportzug verladen, der uns über Herbestal, Antwerpen nach Brügge in Belgien
brachte. Hier mussten wir den Zug kurzfristig verlassen und einen Luftschutzkeller aufsuchen, weil Fliegeralarm
gemeldet wurde. Danach ging es wieder weiter nach Turut, Kortemark, Hauseme, Kautremollen, Zaren, Zarenlinde. Dort
wurden wir in verschiedene Gruppen aufgeteilt und einer Pionierkompanie auf dem Pionierpark Struwendorf zugewiesen.
Wir haben hinter Klerken Bunker für schwere Maschinengewehre gebaut. Unsere Arbeit konnten wir nur bei Nebel verrichten,
denn bei Sonnenschein waren wir sofort dem Beschuss der feindlichen Artillerie ausgesetzt. eine Kleinbahn die Munition
und Stacheldraht an die Front brachte war dem Beschuss besonders ausgesetzt. Die Gleise, von schweren Geschossen
zerfetzt, mussten immer wieder hergerichtet werden, damit der Nachschub aufrechterhalten werden konnte. Später haben
wir am Kemelberg bei Armentier, eine Brücke über die Lys gebaut. Um in dem Sumpfgelände einen Untergrund dafür zu
schaffen, mussten wir 10 bis 12 Meter lange Pfähle in den Boden rammen. Ein Feldwebel gab immer den Befehl: „Hoch den
Bär, noch viel mehr, dass man sieht, wie er zieht, denn dieser Pfahl, glatt wie ein Aal, durch Fels und Stein, durch
Wasser und Sand, fürs Vaterland”. Jedes mal mussten wir den Bär an Schnüren hochziehen und dann wieder herunterlassen.
Wenn es manchmal, trotz vieler Mühe nicht mehr weiter ging wurde der Pfahl auf eine bestimmte Länge abgeschnitten.
Nach Fertigstellung der Brücke kamen wir in die Siegfriedstellung bei Kambrei, zum Bau eines Bataillons-Gefechtstandes.
Da der Boden kreidehaltig war, mussten wir die großen Stücke von Hand zu Hand reichen, den Schutt haben wir dann mit
Sandsäcken aus der Baugrube gehoben und mit Ästen getarnt, damit der Stand nicht von feindlichen Fliegern entdeckt
werden konnte. Alle acht Stunden wechselte die Arbeitsgruppe. Wir mussten von der Baustelle durch das Gelände robben,
denn aufrecht gehend war man dem Beschuss der feindlichen Scharfschützen ausgesetzt, die von einem Fesselballon aus
informiert wurden der über den feindlichen Linien stand.
Der Wechsel war mit einem großen Risiko verbunden, und wurde wenn Möglich bei Dunkelheit vollzogen. Um vor
Überraschungen sicher zu sein haben wir spanische Reiter (Stacheldrahtverhaue) gebaut und vor die ersten Gräben
gestellt, die dann oft in der Nacht von den Franzosen geklaut, und dann vor ihren eigenen Linien wieder aufbaut wurden.
Wir hatten aus Bohlen eine Brücke auf Rädern gebaut, die dann in den Graben geschoben wurde, damit die Artillerie und
andere Fahrzeuge über die Schützengräben kamen. Weil um vier Uhr morgens der Beschuss mit Gasgranaten begann, mussten
wir Gasmasken aufsetzen, danach haben feindliche Flieger unsere Munitionskolonne bombardiert und total aufgerieben.
Es wurde auch eine Marinedivision eingesetzt, die bis dahin dem Küstenschutz gedient hatte und jetzt ihren ersten
Einsatz hatte.
Wir sind zuerst ein ganzes Stück in Richtung Amiens vorangekommen, doch dann blieb unser Angriff in den zuvor von
Engländern besetzten Stellungen, stecken. Da die Engländer ihre Stellungen fluchtartig verlassen hatten, fiel ihr
ganzer Proviant in unsere Hände; Schokolade, Weißbrot, Flaschenwein. Die erste Nacht haben wir in einem runden Zelt
verbracht, weil ich mir durch den starken Wind, der da herrschte eine Angina zugezogen hatte, die mit hohem Fieber
verbunden war, konnte ich die vielen Köstlichkeiten überhaupt nicht genießen.
An eine ärztliche Versorgung war überhaupt nicht zu denken, denn es mussten zuerst die vielen Granatlöcher eingeebnet
werden damit die vielen Fahrzeuge und Geschütze wieder weiter fahren konnten. Auch eine Bahnlinie musste repariert
werden, damit die großen Geschütze in Stellung gebracht werden konnten, dabei wurden auch die vielen Kriegsgefangenen,
die bei dieser Offensive gemacht wurden, eingesetzt. Als die Offensive dann schließlich scheiterte, wurden wir an die
Somme verlegt. Da habe ich die Ortelsburger Jäger, die aus Italien an die Westfront verlegt wurden, zum ersten Mal im
Einsatz gesehen.
Unser nächster Einsatzort waren dann Stellungen hinter Laon. Hier wurden die Vorbereitungen zu einer neuen Offensive
getroffen. Feindliche Flieger versuchten uns Tag und Nacht daran zu hindern die Aufmarschwege instand zu halten. Als
die Offensive dann endlich losging, hatten wir die Order eine Brücke über die Oise mit Bohlen und Balken zu verstärken.
Gleich am Anfang der Offensive mussten wir Gasmasken anlegen, um für alle Fälle gewappnet zu sein. Nur die Artillerie
und Kraftfahrzeuge durften die Landstraße benutzen, die Infanterie ging immer im Straßengraben und wurde von einer
Seite von Kopf bis Fuß mit Dreck bespritzt. Die Franzosen und Engländer haben hier schon Panzer eingesetzt, die von
Truppen aus den Kolonien gefahren wurden. Die Australier gingen mit umgekrempelten Ärmeln hinter den Panzern her.
Die letzte Offensive des Ersten Weltkrieges.
Zum Jahresende 1917 hatten noch 153 deutsche 175 alliierten Divisionen gegenübergestanden.
Zur Vorbereitung der Offensive ließ Ludendorff 39 Divisionen aus dem Osten und aus Italien heranziehen. Er ließ
spezielle Angriffsdivisionen formieren, die durch intensive Ausbildung auf den beabsichtigten, schnellen Vormarsch
vorbereitet wurden. 6608 Geschütze, 3500 Minenwerfer und 1070 Flugzeuge wurden hinter dem vorgesehenen
Angriffsabschnitt konzentriert. Den Ausbildungsbefehlen Ludendorffs, die bis zu den Kompanieführern herab verteilt
wurden, konnte man entnehmen, dass der Versuch, den Krieg mit einem mächtigen Schlag zu entscheiden schon in der
nächsten Zeit gewagt werden sollte. Wir übten die fast vergessenen Formen des Schützengefechts und des
Bewegungskrieges, auch wurde eifrig mit Gewehr und Maschinengewehr geschossen. Wir hegten keinen Zweifel daran, dass
der große Plan gelingen würde.
Den ganzen Winter 1917/18 über plante der Generalquartiermeister Ludendorff die deutsche Offensive. Zwar hatten die
Vereinigten Staaten von Amerika dem Deutschen Reich am 6. April 1917 den Krieg erklärt, aber vor dem Sommer des
Jahres 1918 war mit dem Auftreten von US-Truppen in relevanter Größenordnung nicht zu rechnen. Der deutschen Führung
blieb nur ein schmales Zeitfenster, um die Niederlage und den zu erwartenden Diktatfrieden abzuwenden. Ypern,
Armentieres, Arras, Cambrai oder Verdun wurden ernsthaft als Schauplätze erwogen. Ludendorf entschied sich für einen
Angriff zwischen Cambrai und La Fere – genau an der Nahtstelle zwischen der Französischen Armee und dem britischen
Expeditionscorps.
Der Fluss Somme bildete die Grenze zwischen Franzosen und Briten. Die Briten – nicht die Franzosen – sollten das Ziel
des Vorstoßes werden. Ihre Stellungen waren nur 130 Kilometer von der Kanalküste entfernt. Beim erreichen der
Sommemündung wäre die gesamte britische Armee eingeschlossen gewesen, denn hinter ihnen lag die Straße von Dover.
Am 21. März 1918 begann die letzte entscheidende Offensive des deutschen Westheeres im Ersten Weltkrieg. Der
Angriffsstreifen war 75 Kilometer breit. Dort hatte Ludendorff 43 Angriffsdivisionen konzentriert, dahinter 30
weitere Reservedivisionen, ihnen standen lediglich 26 britische Divisionen gegenüber. „Michael“ – so der Deckname der
„Kaiserschlacht“ – lief dank Ludendorffs akribischer Vorbereitung gut an. Der britische Oberbefehlshaber General
Douglas Haig erkannte die Chance, welche die Deutschen in dieser Situation hatten. Wollten die Deutschen diese Chance
nutzen, mussten sie darauf verzichten die Somme zu überschreiten, wo sie auf die französischen Reserven treffen und
sich von der Küste entfernen würden. Genau diesen Fehler begingen jedoch die Deutschen.
Am dritten Tag überschritt der linke Flügel mit der 18. Armee die Somme. Ludendorf stellte die Taktik über die
Strategie, wie er das bei Tannenberg und der Schlacht an den Masurischen Seen auch schon getan hatte. Ludendorffs
Befehl an die 18. Armee vom Abend des 22. März 1918 lautete: „Jetzt gilt es den Sieg auszunutzen, den Feind nicht zum
Stehen kommen zu lassen, Somme und Crozat-Kanal zu überschreiten, bevor feindliche Verstärkungen wirksam werden“.
Was Haig befürchtet hatte, trat nicht ein. Die deutsche Offensive Lief weiter Richtung Süden und lief sich schließlich
tot. Am 31 März war Ludendorff zu der Erkenntnis gekommen, dass „Michael“ gescheitert war. Am 5. April wurde die
Einstellung der Offensive befohlen. Im Hochsommer waren die US-Truppen in Frankreich angekommen und gingen mit den
Franzosen zum Angriff vor. Nur mühsam konnten Hindenburg und Ludendorf den Zusammenhalt der Front waren. Am 24. Oktober
1918 forderte US-Präsident Woodrow Wilson die bedingungslose Kapitulation, am 11.Nuvember Wurde der Waffenstillstand
von Compiegne unterzeichnet.
Zusammenbruch der Westfront und Waffenstillstand .
Als die Offensive dann letztendlich gescheitert war, wurden wir auf Eisenbahnwaggon verladen, in
eine Stellung vor Verdun gebracht und der siebenten bayerischen Division zugeteilt. Als wir ausgeladen wurden nahm der
Franzose den Bahnhof unter Beschuss. Eine Granate traf einen Waggon der mit Seifenpulver beladen war, so dass der ganze
Bahnhof aussah als wäre gerade Neuschnee gefallen. Wir gingen auf die Suche nach Kartoffeln. Als ich mit einem Sack,
vollbeladen die Böschung runter ging um zur Feldküche zu gelangen, schlug unweit von mir eine Granate ein und riss mir
den Sack vom Rücken. Ich bin mit dem Schrecken davon gekommen, mir war nichts passiert.
Der Bahnhof war menschenleer, nur ein par Kaninchen liefen verschreckt durch die Gegend und einigen Kameraden gelang
es welche einzufangen. Am nächsten Tag gelang es uns endlich die Feldküche zu erreichen. Als wir gerade beim Essen
fassen waren, schlug unweit eine Granate ein so dass Pflastersteine das Dach durchschlugen und wir das Weite suchen
mussten. und wir wieder nichts zu Essen bekamen. Ein Friseur aus unserer Kompanie fuhr immer ins Hinterland um uns
mit Proviant zu versorgen. Als er 14 Tage vor dem Zusammenbruch wieder mal zurückkam erzählte er uns schon das der
Krieg nicht mehr lange dauern würde, weil Kaiser Wilhelm mit Frack und Zylinder bekleidet, Deutschland verlassen und
ins Ausland gehen würde. In unserer Einheit hatten wir auch einen Juden der glaubte dass er sich alles erlauben darf.
Eines Morgens ging er in die Küche, als er keinen Koch vorfand stieg er auf die Gulaschkanone und hob den Deckel vom
Kessel in dem der Kaffee kochte an. Der kochende Kaffee verbrühte seine Füße so sehr das er sofort ins Lazarett musste,
für ihn war der Krieg somit zuende. Es kam noch ein Erlass, das Kameraden die 2 Jahre aktiv gedient hatten und
Gefreiter waren sofort zum Sergeanten befördert wurden. Für den 11. November 1918 war ein Waffenstillstand vereinbart
und ab 11 Uhr sollte nicht mehr geschossen werden. Wir hatten unsere Kopfkissen aufgetrennt und eine Kissenschlacht
veranstaltet, um auf diese Art und Weise unserer Freude Ausdruck zu verleihen. Als die Federn durch die Luft flogen
brachen wir in Tränen aus.
In jeder Kompanie wurde ein Soldatenrat gewählt, der aus drei Mann bestand. Wenn der Kompanieführer jemanden bestrafen
wollte, musste er erst den Soldatenrat fragen, der die Strafe befürworten, aber auch ablehnen konnte. Die Offiziere
durften keine Achselstücke mehr tragen, was für sie einer Degradierung gleich kam. Wir waren in einem Dorf
einquartiert und morgens zum Appell angetreten, als einer vom Soldatenrat sich stockbesoffen vor den auf dem Pferd
sitzenden Kompanieführer stellte und schrie: „Alles hört auf mein Kommando”. Der Kompaniechef war wie vom Blitz
getroffen, ihm versagte die Stimme. Wir sahen ein das dies nicht so weiter gehen kann und wählten einen neuen
Soldatenrat. Unser Rückzug begann bei Konflanz, einer Vorfestung von Metz und führte uns zunächst über die
luxemburgische Grenze, wo wir in einem Ort einquartiert wurden. Als wir für die Küche Holz aus dem Wald holen gingen,
entschieden wir uns eine Eiche abzusägen, ohne uns dessen bewusst zu sein, in welchem Forst wir uns befanden. Als wir
beim fällen waren fielen plötzlich Schüsse, die wir auch sofort erwiderten, bis uns ein Elsässer der sich in unserer
Kompanie befand aufklärte: „Kameraden, wir befinden uns hier auf Luxemburgischem Hoheitsgebiet”.
Wir sind dann weiter durch das Fürstentum Birkenfeld marschiert, wo das Städtchen Merzig für uns geflaggt hatte. Das
Elsass haben wir auch noch kurz gestreift. Wo wir bei einem Bauern, der uns kein Stroh für das Nachtlager geben wollte,
einquartiert wurden. Daraufhin gingen wir in die Scheune und haben uns selbst was besorgt. Wir haben dann noch erfahren,
sie hätten ein Schwein geschlachtet und warteten auf den Einzug der Franzosen. Als wir uns 1917, an der Ostfront, in
den in Karpaten, im Einsatz befanden, waren unter uns auch viele Elsässer. Sie durften ihre Heimatpost nicht in
französischer Sprache schreiben, mussten ihre Briefe offen auf der Schreibstube abgeben, wo sie zuerst kontrolliert
und dann abgeschickt wurden. Als ich in einer Nacht, mit einem Elsässer auf einem Vorposten Wache schieben musste,
wollte er mich überreden zum Russen überzulaufen. Als ich darauf nicht eingehen wollte verschwand er plötzlich in der
Dunkelheit und ich habe ihn nie wieder gesehen.
Wir sind dann weiter Richtung Worms und Ludwighafen gezogen, dort wurden wir bei einem Mühlenbesitzer einquartiert,
ein Unteroffizier und vier Mann. Obwohl wir verlaust und verdreckt waren bestand die Müllerin darauf das wir in ihren
Betten übernachteten. „Wenn alles durch ist”, sagte sie, „werde ich alles gründlich reinigen”. Der Müller brachte uns
eine Gießkanne voll Wein und sagte wir sollen es uns Schmecken lassen. Wir haben reichlich davon Gebrauch gemacht, so
dass ich gar nicht weiß wie ich ins Bett kam. Das war meine Erinnerung an die Pfalz. Manchmal waren wir auch 2 Tage im
Quartier.
Vor dem Weitemarsch wurde uns immer gesagt welche Truppe die Vorhut und welche Truppe die Nachhut übernehmen sollte.
Die Nachhut hielt immer Verbindung zu den nachrückenden Franzosen und man muss staunen wie alles reibungslos, ohne
Zwischenfälle von statten ging, was wir in erster Linie dem General-Feldmarschall Paul von Hindenburg zu verdanken
haben, der den Rückzug an der Westfront koordiniert hat.
In Köln angekommen, erhielten wir im Volkshaus unsere Entlassungspapiere, Eisenbahnfahrscheine, Reisepässe,
unterschrieben von Oberstleutnant Mann. Wir mussten Köln umgehend verlassen, weil schon am nächsten Tag die
französischen Besatzungstruppen in einmarschieren sollten. Wir fuhren mit einem Zug der bis Allenstein fuhr, dort
wurden unsere Papiere vom Soldatenrat kontrolliert. Die jüngren Jahrgänge wurden festgehalten, zu neuen Einheiten
zusammengestellt und zur Sicherung der Ostgrenze gegen die Bolschewisten abkommandiert. Ich hatte gesagt das ich noch
einen Schrapnellsplitter in der Kreuzbeingegend habe und durfte daraufhin nach Hause fahren.
Kaum in Ortelsburg angekommen fiel ich wieder dem Soldatenrat in die Hände. Sie haben alles durchsucht, haben mir mein
Seitengewehr und eine Decke abgenommen, aber ich durfte weiter und bin dann kurz vor Weihnachten 1918 auf dem
elterlichen Hof angekommen. Schon auf dem Hof habe ich meine Kleider vom Leib gerissen, weil vor Läusen und anderem
Ungeziefer nicht mehr aushalten konnte und mich erst gründlich gewaschen bevor ich das elterliche Haus betreten habe.
Die Freude über das Wiedersehen war sehr groß.
“ Unser Leben zwischen den beiden Weltkriegen.”
Endlich wieder zurück in der Heimat
Rohmanen war durch die Kampfhandlungen 1914/15 zu einem drittel zerstört worden, aber schon
wieder im Aufbau. Die Firma Grzella aus Ortelsburg hatte die Bauarbeiten übernommen. Unter der Aufsicht von Polier
Karl Kontor wurden die Dachstühle errichtet. Ich habe mich, nach kurzer Erholungspause, auch als Zimmermanngehilfe am
Wiederaufbau beteiligt. Die Firma Grzella hat das Material geliefert und auch unsere Löhne gezahlt. Wegen meinem
Steckschuss bin ich dem VDK beigetreten und habe mit dessen Hilfe eine Rente beantragt die mir auch bewilligt wurde.
Nach vier Jahren wurde ich nach Allenstein zur Nachuntersuchung vorgeladen. Die ärztliche Untersuchung hatte ergeben,
das Geschoß sei verkapselt, und nur das linke Bein etwas in Mitleidenschaft gezogen. Daraufhin wurde die Rentenzahlung
eingestellt.
Der Stellmacher Adam Ornowski war im Krieg als Sanitäter eingesetzt und hatte auf Grund seiner Erfahrungen,
 Beziehungen zum medizinischen Dienst in Ortelsburg aufgebaut. Es wurden dort Lehrgänge in Erster Hilfe angeboten,
die von Prof. Dr. Kutz geleitet wurden. Adam Ornowski hat dafür gesorgt das einige junge Männer aus Rohmanen daran
teilnehmen konnten. Adam Ornowski, August Linka, Emil Rosowski, Johann Dembek, Emil Baschek und ich sind dann dem
Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes beigetreten und mussten jeden Sonntag am Lehrgang teilnehmen. Unser
Gruppenführer war Kreisobersekretär Albrecht, Landrat von Poser, als unser Ehrenvorsitzender, hat viel zu unserer
finanziellen Unterstützung beigetragen und hat dafür gesorgt dass die Bereitschaft eingekleidet wurde.
Beziehungen zum medizinischen Dienst in Ortelsburg aufgebaut. Es wurden dort Lehrgänge in Erster Hilfe angeboten,
die von Prof. Dr. Kutz geleitet wurden. Adam Ornowski hat dafür gesorgt das einige junge Männer aus Rohmanen daran
teilnehmen konnten. Adam Ornowski, August Linka, Emil Rosowski, Johann Dembek, Emil Baschek und ich sind dann dem
Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes beigetreten und mussten jeden Sonntag am Lehrgang teilnehmen. Unser
Gruppenführer war Kreisobersekretär Albrecht, Landrat von Poser, als unser Ehrenvorsitzender, hat viel zu unserer
finanziellen Unterstützung beigetragen und hat dafür gesorgt dass die Bereitschaft eingekleidet wurde.
In jedem Dorf wurde eine Unfallstelle eingerichtet, mit einem Verbandskasten und mit Verbandsmaterial für die erste
Hilfe ausgerüstet. Die Unfallstelle in Rohmanen, die am Haus von der Straßenseite, durch eine Tafel mit einem roten
Kreuz gekennzeichnet war, hatte ich zu verantworten. An Sonntagen wurden wir an Badestellen und bei Fußballspielen
eingesetzt, haben viele Übungen bei Waldbränden durchgeführt und auch Ausflüge nach Rudzany am Niedersee gemacht. Bei
der Einweihung des Tannenbergdenkmals in der Nähe von Hohenstein kamen wir an Straßenkreuzungen zum Einsatz.
Rohmanen hatte auch eine freiwillige Feuerwehr. Bis zum ersten Weltkrieg hat Friedrich Biella als Brandmeister das
Kommando gehabt. Er war aktiver Unteroffizier, hatte gute Führungsqualitäten und die Männer, die allesamt aus dem
aktiven Militärdienst stammten hatten zu ihm ein großes Vertrauen. Nach dem Krieg wollten diese Männer,
(Friedrich Nickel, Friedrich Willam, Julius Wittkowski, Jakob Janowski, Johann Gloddek, Gustav Bednarz), nicht mehr
weitermachen. Friedrich Biella, der inzwischen zum Gemeindevorsteher gewählt wurde, hat sich dann auf einer
Gemeinderatsitzung vorgeschlagen, für die Freiwillige Feuerwehr jüngere Kräfte anzuwerben.
Zum Brandmeister hat er Herrn Wilhelm Pilath vorgeschlagen. Der wurde dann nach Königsberg zur Fortbildung geschickt.
Der Feuerwehr gehörten nun folgende Personen an: Wilhelm Pilath(Brandmeister), August Linka(Stellvertreter), Gustav
Deptolla, Julius Matzey, Johann Dembek, Willy Willam, Gustav Rattay. Der Kreisbrandmeister war Heinrich Thalmann aus
Ortelsburg, sein Stellvertreter war Kreisobersekretär Salzmann. Der Bezirks-Kommissar bei der Ostpreußischen
Feuersozität War Herr Ernst Trzaska. Er hat dafür gesorgt das die Wehr uniformiert und mit Löschgeräten ausgerüstet
wurde. Da die alten Schläuche schon sehr marode waren, wurden sie durch moderne ersetzt, deren Kupplungen auch mit der
Motorspritze übereinstimmten.
Ernst Trzaska hat bei der Feuersozität und beim Landratsamt Finanzmittel beantragt und auch genehmigt bekommen. Der
Schneidermeister Wilhelm Baran wurde beauftragt Tuch und Drillichanzüge nach Maas zu schneidern. Er hat uns
Stoffmuster vorgelegt aus denen wir wählen sollten. Feuerwehrhelme haben wir auch bekommen. Die Gemeinde musste
Finanzmittel bereitstellen, einen Prozentsatz vom Gemeindebudget. Im Brandfall mussten für den Spritzenwagen Pferde
zur Verfügung stehen, von Willy Willam, Gustav Rattay, Julius Matzey und Gustav Dorka, weil sie in der Nähe des
Spritzenhauses wohnten. Am Spritzenhaus wurde ein großer Baum mit Querleisten aufgestellt, wo nach jedem Brand oder
einer größeren Übung die Schläuche zum trocknen aufgehängt wurden.
Der Kreisbrandmeister hat mindestens 2-3-mal im Jahr die Wehren besichtigt. Das ganze Dorf war dann auf den Beinen,
die Bauern mit Pferden, und andere Dorfbewohner mit Eimern und Spaten, wurden dann in verschiedene Gruppen eingeteilt.
Erst hat die Wehr sämtliche Aufstellungen am Gerät geübt; Grundstellung Fahrstellung und Marschstellung. Dann wurde
ein Brand angekündigt, die Feuerwehr mit der Spritze an den Brunnen, die Gruppen dort wohin sie beordert wurden, die
Bauern brachten mit den Wasserkiwen Wasser aus dem Brunnen zum Brandort. Wenn das Wasser im Brunnen alle wurde hat
man den Saugkorb in die Kiewen gelegt und dort Wasser entnommen. Die Wassergruppe ging mit Eimern zum Dorfteich, holte
Wasser und füllte damit die leeren Kiewen.
Der Löschtrupp ging mit Feuerhaken und Löschpatschen auf die umliegenden Gehöfte und versuchte das vermeintliche Feuer
von ihnen fernzuhalten. Nach dem Alarm wurde wieder am Spritzenhaus angetreten. Die Gruppenführer mussten angeben ob
ihre Gruppe auch vollständig erschienen war, denn Übungen wurden nur vor, oder nach der Feldarbeit durchgeführt, so
dass niemand eine Entschuldigung vorbringen konnte. Wer ohne begründete Entschuldigung nicht anwesend war erhielt eine
Verwarnung. Der Kreisbrandmeister erklärte dann welche Handgriffe den Vorschriften entsprachen und welche nicht. Die
Schläuche wurden noch schnell zum Trocknen aufgehängt. Anschließend gingen wir alle in den Gasthof Trzaska, haben über
vorhandene Mängel diskutiert, Verbesserungsvorschläge unterbreitet und zwischendurch den Durst gelöscht. Der
Kreisbrandmeister ist dann, nach einer kurzen Verabschiedung, ins nächste Dorf gefahren, weil er an einem Tag mehrere
Feuerwehren betreuen musste.
Der Rohmaner Dorffriedhof

Einen Kilometer vom Ende des Dorfes entfernt, auf der rechten Seite der Landstraße in Richtung
Ortelsburg, befand sich der Rohmaner Dorffriedhof. Wann dieser Friedhof angelegt wurde entzieht sich meiner Kenntnis.
Nach Aussagen älterer Dorfbewohner soll davor auch schon eine Ruhestätte vorhanden gewesen sein, und
zwar auf der linken Straßenseite gegenüber dem jetzigen Friedhof. An dieser Stelle befand sich bis in die
Nachkriegszeit ein kleiner Brunnen, aus dem die Dorfbewohner, das Wasser zum begießen der Grabbepflanzung auf den
Gräbern ihrer verstorbenen Angehörigen holten. Der Friedhof war in einer Hanglage angelegt, wahrscheinlich weil diese
Parzelle für eine landwirtschaftliche Nutzung nicht geeignet war. Um das Gräberfeld vor herumstreunenden Tieren oder
von der Weide entlaufenen Kühen zu schützen, hat man das ganze Gelände mit einem Holzzaun umgeben. Der Zugang befand
sich von der Straßenseite. Unter einem Torbogen hindurch wurden die Verstorbenen zu Grabe getragen. Die Gräber der
einzelnen Familien waren nebeneinander angelegt, mache, wie zum Beispiel die der Familie Trzaska, sogar mit einem
schmiedeeisernen Zaun eingefasst.
Nach dem 2. Weltkrieg verfiel der Friedhof immer mehr. Die nötigen Finanzmittel für die Pflege der Einfriedung konnten
von den restlichen noch verbliebenen Deutschen nicht mehr aufgebracht werden. An den gepflegten Gräbern konnte man noch
erkennen dass es Verwandte von noch in Rohmanen wohnenden Deutschen waren, oder von bereits im Westen Deutschlands
lebenden, die ihre noch in Rohmanen wohnenden Nachbarn damit beauftragt hatten. Die übrigen Gräber wurden von Jahr zu
Jahr immer mehr von Wildkräutern überwuchert und schließlich auch von Sträuchern und schnell wachsenden Bäumen.
In den späteren Jahren konnte man nicht mehr erkennen dass dort vor Jahren Tote zur letzten Ruhe gebettet wurden. Die
Natur holte sich das ganze Gelände zurück und nur unter großen Schwierigkeiten konnten Besucher aus dem Westen das
Friedhofsgelände noch betreten.
Das Gasthaus Trzaska

Nach dem ersten Weltkrieg hat der Gastwirt Friedrich Trzaska neben dem Gasthof einen großen Saal
für Festlichkeiten und Vereinsfeiern gebaut, in dem schon mal Feuerwehrfeste veranstaltet wurden. Ernst Trzaska war
Feuerkommissar bei der Ostpreußischen Feuersozität. Erich Trzaska war Vollziehungsbeamter beim Amtsgericht in
Ortelsburg. Unser Feuerkommissar war uns beim organisieren der Veranstaltungen sehr behilflich, hat uns den Saal, die
Musik und die Theaterstücke besorgt und die Feuerwehren aus den Nachbardörfern eingeladen.
Zu Manöverzeiten, vor dem 2. Weltkrieg und dann auch während des Krieges, waren im Gasthof Soldaten, meist im Range
eines Offiziers, einquartiert. Fräulein Mariechen Trzaska hat die Poststelle im Dorf betreut. Nachdem ich 1939 zum
Militär eingezogen wurde, hat sie, nach einer Schulung im Ortelsburger Krankenhaus, auch die Unfallmeldestelle
übernommen. Nach dem Krieg, pflegte sie mit vielen Bekannten, die bereits in der Bundesrepublik wohnten, einen regen
Briefwechsel. Auf dem Rohmaner Friedhof hat sie viele Gräber, im Auftrag von Angehörigen, die auf Grund ihrer
Abwesenheit, dazu nicht mehr in der Lage waren, gepflegt. Der Bauunternehmer Kurnitzki aus Ortelsburg, äußerte die
Bitte, sie möchte ihm doch ein Blatt vom Rosenstrauch, der auf dem Grab seiner Eltern steht, in den Brief legen. Als
sie uns den Brief vorgelesen hat, waren wir zu Tränen Gerührt. Sie hat als Letzte aus ihrer Familie, bis zu ihrem Tod
im Jahre 1960, in Rohmanen, im Gebäude der Gastwirtschaft gewohnt und ist auf dem Rohmaner Friedhof beerdigt worden.
Fleisch und Wurstwaren Karl Pelkowski
Im Jahr 1931 hat der Fleischermeister Karl Pelkowski, aus Grammen, direkt neben unserem Hof ein
Anwesen gekauft und dort eine Fleischerei eingerichtet. Er war mit meiner Schwester Frieda, verheiratet. Am Anfang hat
er die Schweine noch auf seinem Hof geschlachtet, später dann im Ortelsburger Schlachthof. Jede Woche fuhr er 2-mal,
mit dem Pferdewagen(Einspänner), nach Ortelsburg zum Wochenmarkt, wo er seine Fleisch und Wurstwaren zu Verkauf anbot.
Am Tag davor, wenn er die Wurst gekocht hat, kamen viele Rohmaner mit Kannen oder anderen Gefäßen, wegen der guten
Wurstsuppe, die er umsonst unter die Leute verteilte. Als Karl Pelkowski, Ende August 1939 zum Militär eingezogen
wurde, hat seine Frau das Pferd verkauft und den Beitrieb stillgelegt. Am Haus hing, immer noch die Tafel mit der
Aufschrift: Karl Pelkowski, Fleisch und Wurstwaren. Ein Witzbold hat irgendwann darunter geschrieben; „Fleisch und
Wurst waren einmal”, drauf hin hat Frau Pelkowski die Tafel entfernen lassen. Karl Pelkowski ist im Mai 1946 in
französischer Gefangenschaft verstorben. Seine Ehefrau Frieda, verstarb an ihrem 85. Geburtstag in Mettmann bei
Düsseldorf.
Die steinreichen Rohmaner Felder
Die letzte Eiszeit hat bei der Schmelze, auf der Rohmaner Feldgemarkung viele Steine und
Granitblöcke zurück gelassen. Überirdisch, aber besonders unter der Erde, gab es viele kleine, aber auch große Steine,
die, den Bauern, beim Pflügen und anderen Feldarbeiten sehr viel Schweiß, abverlangten. In einer Kiesgrube, auf dem
Feld des Bauern August Radek, lag ein Granitblock, von schätzungsweise 100 cbm. Vor etwa 80 Jahren, als man für diese
Steine noch keine Verwendung hatte, griffen die Bauern zu einer „List”. Weil er sonst nicht pflügen konnte, hat mancher
seinem Nachbarn, die Steine in der Nacht auf dessen Feld abgeladen. Als diese Tätigkeit unter Strafe gestellt wurde,
hat man die Steine in Schluchten gekippt und mit Mutterboden zugeschüttet. In späteren Jahren kam diese jedoch beim
pflügen wieder an die Oberfläche. Dann hat man aber schon Steine für den Straßenbau gebraucht und konnte sie so zu Geld
machen. Besonders im Raum südlich von Ortelsburg, bis zur polnischen Grenze, wo Steine eine Rarität waren, kamen sie
jetzt zum Einsatz. Auch beim Bau von Häusern, besonders für die Fundamente, wurden sie eingesetzt, weil auf diese
Weise viel Ziegeln eingespart wurden. Die Firma Gribienski aus Ortelsburg hat die großen Steine mit Dynamit gesprengt
und auf diese Weise die weitere Verarbeitung erleichtert.
Die Steine welche beim Pflügen aus dem Boden geholt wurden, hat man am Feldrand auf große Haufen zusammen getragen.
Wenn die Feldarbeit beendet war, sowie auch in den Wintermonaten, waren wir jeden Tag mit Steinen unterwegs. Wir sind
vorwiegend am Abend los gefahren, weil unter der schweren Last die Wagenachsen so heiß wurden und die Gefahr bestand,
das durch die Dehnung, die Räder blockiert würden. Bei einer Fahrt konnte man bis zu 24 Reichsmark verdienen, wogegen
1 Zentner Roggen für 8 bis 9 Reichsmark zu haben war. Ich bin selbst, mit dem Pferdewagen bis Fürstenwalde, Radostowen,
Luka, Altkirchen, Höhenwerder, ja sogar bis Friedrichshof gefahren.
In Rohmanen wurden auch rote Ziegeln gebrannt. Viele Häuser wurden, mit Ziegeln erbaut, die nur wenige 100 Meter von
der Baustelle entfernt hergestellt wurden. Der Lehn wurde auf den Feldern in der näheren Umgebung entnommen, dann von
Ochsen solange getreten, bis er so geschmeidig war, das er sich in Formen einstreichen ließ. Wenn die Ziegel in der
Form trocken war, wurde sie entnommen und in einem Brennofen gestapelt. Um einen Ofen richtig anzufeuern, brauchte man
12 Raummeter Holz, das im Zeitraum von ein par Tagen verheizt wurde. Der Fischer Karl Glitza hatte schon eine
Knetmaschine, die von einem Pferd angetrieben wurde, das mit verbundenen Augen, den ganzen Tag in die Runde ging.
Im Dorf waren auch vier Kalköfen, in denen so genannte Kalksteine, die sich an gewissen Stellen, im Erdboden befanden,
gebrannt wurden. Nach dem Brennen wurden die Steine mit Wasser abgelöscht und die daraus entstandne Masse diente, nach
dem Beimischen einer gewissen Menge Sand, dann als Bindemittel beim Häuserbau. Das Gerichtsgebäude und das
Lehrerseminar in Ortelsburg wurden mit Kalk, aus dem Rohmaner Brennöfen erbaut. Auch zum Bau einer Eisenbahnbrücke, auf
der, der Zug, den Sawitzfluß, von Ortelsburg nach Allenstein überquerte, hat mein Großvater, mit einem Ochsengespann,
Kalk gefahren.
Hinter der Scheune, beim Bauern Johann Dembek hat man Tonerde gefördert, aus der man mit Hilfe einer Formerscheibe,
die von einem Arbeiter mit Muskelkraft(Fußbetrieb) angetrieben wurde, schöne Krüge, Schalen und Vasen geformt hat.
Die Töpferware wurde, nachdem sie trocken genug war, auch in einem Ofen gebrannt, anschließend mit einer Lasur
überzogen und wieder gebrannt. Es wurden auch Kacheln zum Bau von Kachelöfen hergestellt, die mit verschiedenen
Ornamenten versehen, die Wohnstuben unserer Vorfahren schmückten. So haben unsere Großväter ihr Leben gemeistert und
nach und nach, unsere Dörfer aus der Rückständigkeit in die Neuzeit geführt.
Das gesellschaftliche Leben nach dem 1. Weltkrieg

Als der Lehrer Alfred Dorka, ein Frontkämpfer des Ersten Weltkrieges und ein Sportsmann, als
zweite Lehrkraft an der Rohmaner Schule angestellt wurde, hat er die Sitten und Gebräuche aus früherer Zeit wieder zum
Leben erweckt. Zuerst hat er die Jugend zusammen gerufen, einen Jugendverein und einen Fußballclub, gegründet. Zum
Vorsitzenden des Fußballclubs wurde Johann Gloddek berufen, der ihn auch geleitet hat. Bauer Wilhelm Spittka, der am
Rohmaner See wohnte, stellte Land für einen Sportplatz unentgeltlich zur Verfügung. Lehrer Alfred Dorka hat am
Rohmaner See eine Badestelle ausgesucht und ein Sprungbrett bauen lassen. An jedem Sonnabend im Sommer, bevor die
Sonne unterging, versammelte sich die gestammte Jugend des Dorfes an der Badestelle am See. Es wurde gebadet,
Heimatlieder gesungen, gespielt, im Fackelschein eines großen Biwakfeuers, bis in die späte Nacht hinein. Der Fischer
Karl Glitza hat uns Kähne zur Verfügung gestellt, mit denen wir auf den See hinausgepaddelt sind, dabei hatten wir viel
Spaß, was wiederum den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft gefördert hat. Ich habe mit meiner Mandoline den Gesang von
Volks- und Heimatliedern begleitet.
Der Rohmaner See liegt in einem Tal, dessen Hänge zu beiden Seiten mit Kiefern und Tannen bewaldet sind. Wenn man
gesungen oder Musiziert hat, hallte es von den Hängen zurück. Die Ufer waren mit Kalmus und Schilf bewachsen, was für
die Fischaufzucht von Vorteil war. Wenn man an einem sonnigen, windstillen Tag, am Seeufer spazieren ging, traf man
oft auf Flachstellen, an denen sich die Fischbrut im Sonnenlicht wärmte, wie ein Mückenschwarm. Im See befanden sich
folgende Fische: Karpfen, Hechte, Schleie, Barsche Plötze, Rotaugen, Aale und Krebse. Am Sonntagmorgen brachten viele
Rohmaner ihre Pferde zum See um sie zu baden.
Es wurden dort, unter der Aufsicht von Lehrer Dorka, auch viele Jugendfeste mit Theatervorführungen veranstaltet, zu
denen er selbst die Vorlagen organisiert hat. Der am See wohnende Bauer Johann Nadrowski, hat uns ein Scheunentor, als
Tanzboden zur Verfügung gestellt. Der Zimmermann Wilhelm Wittek hat uns eine Windmühle gebaut, die am auf dem Boden
liegenden Scheunentor aufgestellt wurde, dazu kamen Noch Tannen und Fichten, die das Ganze wie ein Bühnenbild
erscheinen ließen. Es wunden viele Bühnenstücke aufgeführt, unter anderen >Alte Weiber werden jung gemahlen<. Dazu bot
die Windmühle die entsprechende Kulisse.
Nach der Vorführung wurde der Boden aufgeräumt, um dann als Tanzdiele zur Verfügung zu stehen. Der Gastwirt Trzaska
hatte Tische und Bänke aufgestellt, Speisen und Getränke angeboten, so dass sich die die Veranstaltung bis in die
späte Nacht hinein zog. Es waren auch Leute aus Ortelsburg und anderen Nachbardörfern dabei. Im Winter hat Lehrer
Dorka eine Kreisrodelbahn eingerichtet, die von Zeit zu Zeit mit Wasser besprengt wurde, um die Gleitfähigkeit zu
verbessern. Von einer Anhöhe ging hinunter bis auf den halben See, was für alle ein großes Vergnügen war. Es kamen
Lehrer mit Schulklassen aus der näheren Umgebung um hier zu Rodeln.
Als Herr Lehrer Jobski als Hauptlehrer nach Rohmanen kam hat er mit dem Bürgermeister und der Gemeindeverwaltung
beschlossen, in der Nähe des Dorfes, auf einem zur Schule gehörenden Grundstück, einen Sportplatz anzulegen. Dafür
wurde gleich hinter den Gärten, 6 Morgen Ackerland abgetrennt, und nach Feierabend hat Lehrer Dorka mit den
Jugendlichen eingeebnet und gleich nebenan einen Graben für Schützenstand und Kugelfang ausgehoben. Am Sonntagvormittag
wurde Fußball gespielt und um 15:00 Uhr war Kleinkalieberschießen angesagt. Es musste auch ein kleiner Beitrag erhoben
werden, um Munition kaufen zu können. Eine Büchse konnten wir aus beim Kleinkalieberverein in Ortelsburg ausleihen.
Nach Hitlers Machtergreifung
Als Adolf Hitler an die Macht kam wurde die SA gegründet. Der Bürgermeister Michael Kownatzki
wurde zum Gruppenführer ernannt und folgende Männer haben sich freiwillig gemeldet: Wilhelm Matzey, Johann Gloddek,
Gustav Nadrowski, August Buttler, Karl Baran, Emil Nickel, Wilhelm Jaschinski, Emil Bork, Ernst Rattay und Gustav Bach.
Bei Versammlungen war die SA in Uniform angetreten um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Wer versucht hat Unruhe zu
stiften, egal aus welchem Grunde, wurde aufgefordert den Saal zu verlassen, andernfalls wurde er mit Gewalt entfernt.
Herr Lehrer Jobski wurde zum politischen Leiter ernannt, seine Frau hat die NS-Frauenschaft gegründet, Lehrer Dorka
die HJ, und so bekam die Dorfgemeinschaft, nach und nach ein anderes Gesicht. Der Sportplatz und der Schützenstand
wurden jetzt mehr als früher in den Mittelpunkt gestellt. Nach der Feldarbeit hat der Bürgermeister Fuhrwerke bestellt
und den Sportplatz noch besser herrichten lassen.
Der Bauer Wilhelm Both wurde zum Ortsbauernführer ernannt, mit der Aufgabe alles Land für den Anbau von Getreide und
Futtermittel bereitzustellen, oder wenn das nicht möglich war mit Wald aufzuforsten. Durch den Einsatz von Kunstdüngern
sollten größere Erträge aus dem Boden geholt werden, um den Viehbestand zu vergrößern und mehr Milch und Butter zu
produzieren. Deutschland sollte im Stande sein sich selbst zu selbst zu ernähren, ohne auf Importe angewiesen zu sein.
Frau Jobski hat, innerhalb der der NS-Frauenschaft, mit Hilfe von Fachkräften aus Ortelsburg, Lehrgänge veranstaltet,
auf denen man Backen und Nähen lernte. Auf den Bauernhöfen befand sich auch immer mehr Rassegeflügel, das eine erhöhte
Produktion von Eiern und Geflügelfleisch sicherstellen sollte.
Die Rohmaner Bauern hatten, außer in der Landwirtschaft, noch andere Verdienstmöglichkeiten in der Kreisstadt. In
Ortelsburg wurden vier Sägewerke betrieben, die mit Langholz aus dem Walde versorgt werden mussten. Wir haben eine
Kiefer von über 8 Festmeter angefahren, der wir zuerst 6 Meter Spitze abschneiden mussten, um diese Last überhaupt
auf den Wagen zu bekommen. Sechs Pferde musste angespannt werden um den Wagen zur befestigten Straße zu bringen.
Fichten und Tannen wuchsen bis zu einer Länge von 30 Metern. Auch beim Transport von Ziegel, von der Ziegelei zum
Bahnhof, konnte man gutes Geld verdienen.
Im Jahr 1934 wurde Rohmanen an das überregionale Stromnetz angeschlossen und schaffte auf diese Weise den Sprung von
der Petroleumlampe zur Glühbirne. Neben dem Grundstück von Karl Pietzonka wurde ein Transformatorhäuschen errichtet,
in dem der ankommende Strom von einer Hochspannung auf eine Verbrauchsspannung transformiert wurde. Es gab schon eine
Überlandleitung, die aus Richtung Ortelsburg kommend, quer über die Felder, in Richtung Neu Keykuth weiter ging.
Durch eine Zwischenspanne wurde der Transformator, mit der Hauptleitung auf Kownatzkis Feld verbunden.
Ein Stromanschluss konnte die Arbeit im Haus und Hof auf vielfältige Weise erleichtern, doch nur die besser gestellten
Bauern, sowie noch manche Pensionäre, die ein festes Einkommen hatten, konnten sich dass leisten. Weil nur wenige an
der Elektrifizierung teilnahmen, war ein Stromanschluss mit hohen Kosten verbunden. Nur Gustav Pietzonka, Gasthof
Trzaska, Friedrich Nickel, die Schule und Wilhelm Both, wurden in der ersten Phase erfasst.
Im Jahr 1952 wurde von den polnischen Behörden die zweite Stufe der Elektrifizierung eingeleitet, in der alle im Dorf
stehen Gebäude erfasst wurden. Am Anfang wurden nur Leitungen für Lichtstrom gelegt und auch nur 3 Lichtstellen pro
Haushalt bewilligt. Doch im nachfolgenden Zeitraum wurden dann, wenn Material vorhanden war, weitere Lichtpunkte
angelegt. 1952, am zweiten Wochenende im Advent, wurden dann die Leitungen geschaltet und alle waren von der
plötzlichen Helligkeit sehr begeistert. Wenn man Glühbirnen auswechseln wollte musste man am Anfang weite Wege
zurücklegen, um welche zu bekommen. In den 60ger Jahren wurden dann immer mehr Starkstromleitungen gelegt, weil die
Bauern elektrische Geräte kaufen konnten. Ende der 60ger wurden auch die Abbauten an das Stromnetz angeschlossen.
Das Urnengrab auf unserem Feld
Auf unserem Feld, in Richtung Seelonken, bin ich oft beim pflügen gegen Steine gestoßen, manchmal
rissen sogar die Stränge am Pferdegeschirr. Eines Tages nahm ich einen Spaten, Brechstange und einen langen Baum, um
der Sache auf den Grund zu gehen. Als ich eine Menge Sand ausgehoben hatte stieß ich auf eine steile, aus Steinen
errichtete Wand, die ich auch mit dem Baum nicht aus der Fassung bringen konnte. Ich habe den ganzen Vormittag gegraben,
konnte jedoch nicht unter die Steine kommen. Einige Tage später hatten wir in der Schule eine Bauernversammlung, da
habe ich Herrn Biella und Herrn Lehrer Dorka von meinem Fund berichtet. Am nächsten Morgen kam der Lehrer Dorka mit der
ganzen Schulklasse, mit Spaten und Sieben ausgerüstet auf unser Feld und fingen an die ausgehobene Erde zu sieben.
Lehrer Dorka benachrichtigte daraufhin den Leiter des Ortelsburger Heimatmuseums, der am nächsten Morgen vorbei kam um
sich die Fundstelle genau anzusehen. Er beauftragte ihn 4 Mann zu besorgen, um die Steine ringsum frei zu schaufeln.
Zwischen den Steinen durften wir die Erde nur mit Esslöffeln ausheben. Als es plötzlich zu regnen anfing hat Lehrer
Dorka die Brauerei Daum, in Ortelsburg angerufen, die uns über der Fundstelle ein Zelt errichtet haben, damit wir
ungestört weiterarbeiten konnten. Wir fanden 8 flache und 8 hohe Urnen zu beiden Seiten am Körper. Die Urnen wurden in
Gipsbinden eingewickelt und ins Heimatmuseum nach Ortelsburg gebracht, wo sie durch einen Fachmann, der extra aus einem
Königsberger Museum angereist war. Nach Reinigung der Urnen hat er festgestellt, das die Grabstätte etwa 2000 Jahre vor
Christi Geburt angelegt wurde und ein Doppelgrab war, in dem ein Toter liegend und einer in Hochstellung beigesetzt
wurde.
Die Nachricht von der Fundstelle verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Es erschienen viele Schaulustige, ganze
Schulklassen aus der Umgebung, mit Autos und zu Fuß. Durch die vielen Menschen wurden die bestellten Ackerflächen auf
unserem Feld sehr in Mitleidenschaft gezogen, eine Entschädigung haben wir nicht erhalten. Das Grab wurde vor dem
Heimatmuseum in Ortelsburg wieder so aufgebaut wie man es auf unserem Feld vorgefunden hat. Für den Transport der
Steine wurde ich entlohnt. Die Urnen hat das Königsberger Museum an sich genommen und wollte sie nicht wieder hergeben,
weil die solch einen Fund noch nicht in ihrer Sammlung hatten.
Sonnenwendfeuer
Am 24 Juni fand eine Sonnenwendfeier statt. Ein Brauch der an die alten Germanen erinnern sollte.
Der Lehrer Dorka hat den Bürgermeister beauftragt 2 Fuhrwerke in den Wald zu schicken, die Holz und alten Reisig holen
und auf dem großen Schulberg abladen sollten. Das Straßenbauamt hat uns Teertonnen zur Verfügung gestellt. Die ganze
Dorfgemeinschaft wurde eingeladen, am Abend, nach der Feldarbeit, an der Sonnenwendfeier teilzunehmen. Lehrer Dorka
hielt zuerst eine Ansprache, in der er anschaulich erklärte wie unsere Vorfahren in grauer Vorzeit gefeiert haben.
Nach dem offiziellen Teil wurden das Holz und die Teertonnen angezündet, es wurden Heimatlieder gesungen, wie: Wild
flutet der See, drauf schaukelt der Schiffer den schwankenden Kahn, Schaum wälzt er wie Schnee, von grausiger Mitte
zum Ufer heran, wild fluten die Wellen auf Vaterlands See, wie schön, oh trag mich auf Spiegel zu Hügel, Masovias See.
Masovia Land, mein Heimatland, Masovia es lebe mein Vaterland.
Lehrer Alfred Dorka und sein Wirken für Rohmanen.

Friedrich Biella hatte auf seinem Feld einen Granitstein mit einer geraden Seite, den haben wir
mit viel Schweiß an den Dorfteich transportiert und auf einer Erhöhung abgelegt. Der Stein sollte zum Denkmahl für die
Gefallenen des Ersten Weltkrieges umgestaltet werden. Da zu Wenige daran ein Interesse zeigten, wurde diese Idee fallen
gelassen und der Stein irgendwann ins Wasser gerollt. Der Lehrer Dorka war viele Jahre in Rohmanen tätig, dort hat er
später seine ehemalige Schülerin, Lotte Biella geheiratet. Er hat sich sehr für die Entwicklung des Dorfes interessiert,
war bei jeder Gemeindeversammlung anwesend und hat auf Schwachstellen hingewiesen die den Fortschritt behinderten.
Gemeinsam mit den Schülern hat er den Ehrenfriedhof für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges gepflegt, an der
Wegegablung nach Eichtal und zu Ehren des Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg eine Eiche gepflanzt.
Zum Advent hat Lehrer Dorka mit der Jugend einen Adventstern, in verschiedenen Farben gebastelt.
Der Stern wurde auf einer 2 Meter langen Stange befestigt, in der Mitte wurde ein Wachslicht angezündet, am Stern
wurde eine Schnur angebracht, wenn man daran zog rollte der Stern hin und her. Am ersten Wochenende im Advent
versammelten sich jung und alt, um den Stern durch das Dorf zu tragen. Alle schlossen sich dem vorausgehenden
Sternträger an, der den Stern durch die Hauptstraße und die angrenzenden Wege trug. Dieser Sternmarsch wurde an den
folgenden Adventwochenenden wiederholt.
Am ersten Weihnachtfeiertag wurde um 4:00 Uhr morgens ein Frühgottesdienst gehalten. Zuerst hat der Pfarrer eine
Andacht gehalten, dann haben die Kinder ein Krippenspiel aufgeführt und die Gemeinde hat schöne Weihnachtslieder
gesungen. Der Gastwirt Trzaska hat uns den Saal zur Verfügung gestellt. Wir hatten eine Posaunen- u. eine
Gitarrengruppe. Unter der Leitung von Herrn Willi Doormann spielten: Gottlieb Brosch, Fritz Ollech,
Gustav Rattay(Sopran), Wilhelm Pilath, Gustav Brosch(Alt), Fritz Both(Tenor) und Fritz Brosch(Bass).
In der Gitarrengruppe wirkten mit: Martha Ollech, Hedwig Ollech, Martha Lekzik, Martha Michalick und Auguste Lekzick.
Willy Doormann hat sie auf der Geige begleitet.
Kurz vor Ausbruch des 2. Weltkrieges
Bei der Aufstellung des Grenzschutzes(Regiment Buchholz), hat er als Hauptfeldwebel die
Gruppenführerkurse überwacht und selbst die fähigsten Männer dafür vorgeschlagen. Das Ausbildungspersonal hat das
Jäger-Battalion gestellt. Wir kamen zuerst ins Stadion(Waldheim), wurden da eingekleidet und dann ging es gleich
kasernenmäßig zu, theoretisch und praktisch. Jeder musste vor die Front treten und nachweisen ob er im Stande ist,
Befehle zu erteilen. Abends wurden Filme vorgeführt die uns zeigen sollten wie eine Gruppe sich im Gelände entfalten
muss. Die Exerziervorschriften hatten sich, im Verhältnis zu Kaiser Wilhelms Zeiten, etwas geändert. Damals bestand
eine Gruppe aus 8 Mann und einem Unteroffizier, jetzt aus 10 Schützen, 3 für das leichte Maschinengewehr und einem
Unteroffizier(13 Mann). Nach der Schulung folgte eine Abschlussprüfung, danach ein gemütliches Beisammensein. Aus
Rohmanen haben folgende Männer die Prüfung bestanden: Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy, Gustav Rattay und
Gustav Deptolla. Unsere Uniformen waren alle zu klein und es gab viel zu lachen bei der Anprobe.
Die erste Übung habe ich mit Emil Rosowski, in Lenzinen gemacht. Der Gutsbesitzer Marzinzick hat seine Scheune als
Unterkunft zur Verfügung gestellt. Er war im Range eines Hauptfeldwebels. In seinem haus war die Schreibstube
untergebracht, die er selbst verwaltete. Ein Lastauto hatte Uniformen aus der Kaserne in Ortelsburg geholt, jeder
musste eine Uniform anlegen und dann wurde solange getauscht bis alle eine passende gefunden hatten. An den Namen des
Kompanieführers kann ich mich nicht mehr erinnern. 1935 wurden wir zu einer Übung in die Dragonerkaserne nach Lyk
einberufen. Die Gruppenführer, Zugführer, und Kompanieführer die schon Frontberührung im dem Ersten Weltkrieg hatten,
mussten eine Woche früher anreisen. Die Übungen waren auf 6 Wochen angelegt. Die meisten der einberufenen waren noch
nie mit dem Wehrdienst in Berührung gekommen. Jeder Gruppenführer bekam 13 Mann zugeteilt.
Unser Zugführer war Leutnant Neumann, Kompanieführer Oberleutnant Rutschko, Battalions-Kommandeur Major Gröning
(Regiment Buchholz). Hier ging es wieder Kasernenmäßig voran. Das Bataillon wurde hier vereidigt. Jeden zweiten
Sonntag durften unsere Frauen uns besuchen. Ein Jahr später wurden wir wieder zu einer Übung einberufen, auf den
Truppenübungsplatz nach Arys. Jeder Gruppenführer hatte den Auftrag die Gruppe zu entfalten, und auf bewegliche
Figuren zu schießen. Diese Übung musste später mit scharfer Munition wiederholt werden. Jedes Maschinengewehr bekam
50 Schuss, jeder Schütze 20 Schuss zugeteilt. Nach dem Abschießen wurden die Treffer gezählt und dem Kommandierenden
Bericht erstattet. In einiger Entfernung spaziert ein Storch umher, der gar nicht bemerkt hatte dass geschossen wurde,
was bei den Kameraden ein großes Gelächter hervorrief.
Nach der Übung wurde uns gesagt das jeder Gruppenführer eine arische Abstammung nachweisen sollte. Ich konnte in den
Rheinsweiner Kirchenbüchern meine Vorfahren aus Gellen, bis zum Jahr 1732 zurück, nachweisen und wurde zum
Unteroffizier befördert. Aus unserem Dorf wurden auch, Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy und Gustav Deptolla
befördert. Zwischendurch mussten wir schon mal in die Radfahrer-Kaserne nach Ortelsburg, Gewehre empfangen und im
Gelände üben. Am 31 Juli 1939 wurde mir von einem Soldaten ein Schreiben übereicht, das mich aufforderte, am 1. August
um 6:00 Uhr, bei der 3. Kompanie, des 2. Infanterieregiments zu erscheinen.
Um 5:30 hat mich meine Schwester in die Kaserne gebracht. Auf der Schreibstube erklärte mir der Hauptfeldwebel,
dass mir ab sofort der Dienstgrad eines Sanitäters zugewiesen wird, ich mich in der Kammer einzukleiden hätte und mir
in der Handwerkerstube die entsprechenden Schulterklappen annähen lassen sollte. Die aktiven Sanitäter wurden den
Feldlazaretten zugewiesen und wir kamen an ihre Stelle. Unser Bataillon wurde nach Schodmak zum Bunker bauen und
Stacheldraht verlegen eingeteilt. Wir zogen in Begleitung einer Musikkapelle bis zur Kreuzung am Krankenhaus, dann
weiter zu unserem Bestimmungsort, gefolgt von einer Gulaschkanone die in den nächsten Tagen für unsere Verpflegung
sorgen sollte.
Am 14 August haben wir die Jägerkaserne, begleitet von einer Musikkapelle endgültig verlassen und zogen zuerst durch
Ortelsburg, dann über Lehmanen ins Feldmanöver, hinter Rohmanen. Dort entfaltete sich das Bataillon im Gelände, die
Verwundetensammelstelle wurde auf dem Hof des Bauern Friedrich Neumann eingerichtet. Gegen Abend wurde zu Sammeln
geblasen und Biwak bezogen, wobei unsere 3.Kompanie, in einem kleinen Wallt, in der Nähe von Otto Nickels Gehöft
Stellung bezogen hatte. Die 2. und 4. Kompanie hatte sich in der Nähe vom Abbau Pallasch niedergelassen. Die Frau
Nickel hat am Abend ein Mädel in Dorf geschickt um meiner Frau Bescheid zu sagen, wo wir uns zurzeit befinden. Meine
Frau ist dann noch gekommen um sich von mir zu verabschieden, weil wir am nächsten Morgen um 3:00 Uhr Zelte abbrechen
und um 4:00 Uhr in Richtung Kaspersguth marschieren sollten.
Wir sind dann über Achodden, Seelonken, Lehmanen, Ortelsburg, bis nach Grammen und Schützendorf marschiert, wo wir an
einem See Biwak bezogen haben. Es wurde immer gesagt, wir kommen zum Tannenberg-Denkmal bei Hohenstein, wo ein Reichs
Kriegervereinsfest stattfinden sollte. Es wurden auch schon Vorkommandos aufgestellt, doch dann kamen wir nach Orlau
und Lahna-Mühle, da wo die Alle entspringt haben wir 2 Tage biwakiert. Unser Kompanieführer hat uns nach Waplitz auf
den Soldatenfriedhof des Ersten Weltkrieges geführt und uns erklärt wie das Jägerbataillon sich 1914 hier entfaltet
hat und aufgerieben wurde. Dann mussten wir in der Nähe von Gut Koslau über einen Fluss und bezogen in einem Waldstück,
vorbereitete Stellungen in der Nähe der polnischen Grenze. Herr und Frau Thalmann haben uns jeden Tag, bis zur Grenze,
mit Brötchen und Getränken versorgt. Es wurde scharfe Munition ausgegeben, weil wir am nächsten Morgen um 4:00 Uhr die
polnische Grenze überschreiten sollten.
Am nächsten Morgen um 10 Minuten vor 4:00 Uhr kam der Befehl; scharfe Munition abgeben, alles zurück in ein 6 Kilometer
entferntes Dorf, wo wir auch einquartiert wurden. Das alles geschah’ eine Woche vor dem 1. September 1939. Es wurde
gesagt dass der Führer dem polnischen Präsidenten Rid-Szmigly, ein Ultimatum gestellt hat und es wahrscheinlich nicht
zum Krieg mit Polen kommt. Genau nach 5 Tagen kehrten wir wieder in die gleichen Stellungen zurück, es wurde wieder
scharfe Munition ausgegeben und am nächsten Morgen um 4:00 Uhr überschritten wir die polnische Grenze.
“Der 2. Weltkrieg.”
Der erste Einsatz in Polen
Wir kamen zuerst in ein Dorf in dem sich nur alte Menschen befanden. Auf unsere Frage wo denn die Bewohner wären sagte
man uns dass alle geflohen sind, weil erzählt wurde, die Deutschen würden alle Polen misshandeln und verstümmeln. Ich
habe ihnen daraufhin gesagt dass uns, unter Androhung von Strafe verboten wurde, einem Zivilisten etwas anzutun. Das
Vieh, die Schweine und Hunde des Dorfes liefen frei herum und die Soldaten fingen an auf die Hunde zu schießen, bis
gesagt wurde es seien Meldehunde im Dienste der Deutschen Wehrmacht und dieser Unfug der eigenen Truppe schaden würde,
weil etwaige Querschläger eigene Kameraden verletzen könnten. Wir gingen weiter auf polnischer Seite entlang der Grenze,
bis wir am Nachmittag die ersten Vorposten der Festung Mlawa erreichten, da befanden wir uns plötzlich im Feuerhagel
polnischer Festungsflack.
Am nächsten Morgen hatte ich schon 3 Verwundete und wusste nicht wo sich eine Verwundeten Sammelstelle befindet. Ich
suchte den Bataillonsgefechtstand auf der sich auf einer Anhöhe befand. Ich habe unseren Oberstabsarzt gefragt wo denn
die Verwundetensammelstelle wäre. Er rief beim Tross an, wo er die Auskunft erhielt, das sich vor dem Dorf ein Bunker
befindet in dem man die Verwundeten sammeln sollte, die dann von Sanitätsautos abgeholt würden, weil das Dorf unter
Artilleriebeschuss stand. Am Sonnabend haben unsere Flieger die Bunkerstellungen bombardiert, konnten aber, trotz guter
Treffer nicht viel ausrichten, die Bunker wurden nur etwas angekratzt.
Der Beschuss unserer vordersten Linien ging mit unverminderter Heftigkeit weiter. Am Sonntag verkündete eine große
Staubwolke die Ankunft unserer Panzer, doch sie kamen nur bis zur Panzersperre und mussten wieder abdrehen ohne den
Polen einen schaden zuzufügen. Ein Panzer bekam einen Volltreffer, der Fahrer konnte noch umkehren. Er blutete am Kopf
und der Schütze war so eingeklemmt, das wir ihn nur mit einem Seil unter den Armen, durch die Luke nach oben ziehen
konnten. Ob er seine Verwundung überlebt hat ist mir nicht bekannt, denn in der Nacht wurden Panzergeschütze nach
vorne in Stellung gebracht, die direkt in die Schießscharten der Bunker geschossen und so die Verteidiger vertrieben
haben. Daraufhin sind wir weiter vorgerückt. Auf einer Wiese war ein tiefer Graben ausgehoben und mit Ästen getarnt,
da war ein Panzer hinein gefahren, so dass nur das Hinterteil herausragte und er sich nicht aus eigner Kraft befreien
konnte. In der Luft waren Flieger die Brandbomben abwarfen, ich habe mich auf den Boden geworfen weil ich dachte die
würden explodieren, aber sie zischten nur, so das Stoppeln und Graß rings herum in Brand gerieten.
Bei den Kampfhandlungen gab es mehrere Verwundete, denen ich gerade Verbände anlegen wollte, als unser Hauptmann zur
Trillerpfeife griff um mir klar zu machen, dass ich ihm folgen sollte. Die Polen fingen an zu schreien, ich sollte
sie ins Lazarett bringen denn hier im Wald würde sie niemand finden. Ich setzte mich aufs Fahrrad und folgte unserem
Kompanieführer, der mir sagte ich soll immer bei der kämpfenden Truppe bleiben, denn hinter der Front sind die
Sanitätsabteilungen, die werden die Verwundeten schon versorgen. Der Vormarsch dauerte bis in die späte Nacht. Auf
einem Gehöft, das nach allen Seiten durch Feldwachen abgesichert wurde, machten wir endlich Rast. Wir haben
Getreidegarben auf dem Hof ausgebreitet und uns zur Ruhe gelegt, als plötzlich um Mitternacht Leuchtraketen den Himmel
erhellten und Maschinengewehrfeuer uns aus dem Schlaf schreckte. Ein par polnische Soldaten hatten das Feuer eröffnet,
aber sich kurz darauf ergeben.
Die Narew-Überquerung
Als es hell wurde ging der Vormarsch weiter. Es wurde uns untersagt Tagebuch zu führen, darum
weiß ich nicht wie die Orte hießen, durch die wir marschiert sind. Als wir durch ein sumpfiges Gelände vor drangen
stand auf einer Anhöhe am Horizont, die polnische Artillerie, die uns sofort unter Beschuss nahm. Unser Hauptmann war
der Meinung dass wir schon in der Nähe des Flusses Narew sein müssten, als aus den Sträuchern ein mit Schlauchboten
beladenes Lastauto auftauchte. Wir wurden aufgefordert mit je 6 Mann ein Schlauchboot zu nehmen, an einem Aggregat
der daneben stand mit Luft zu füllen und zu Wasser zu lassen. In einer Stunde war das ganze Bataillon über die Narew,
wo der Vormarsch fortgesetzt wurde. In einem Dorf überraschte uns die polnische Kavallerie und fing sofort mit
Maschinengewehren zu schießen an. Da kam der Befehl: Alles wieder zurück. Es ging noch schneller als auf der Hinfahrt.
Wir sind erst einige Kilometer am Fluss entlang gegangen und haben dann zum zweiten Mal rüber gesetzt.
Die Gehöfte im Dorf standen alle in Brand. Auf einem waren viele Bienestöcke. 2 Kameraden wollten den Stöcken Waben
entnehmen, doch die Bienen durch das Feuer aufgeschreckt, überfielen sie sofort und stachen derart zu das sie nicht
mehr wieder zu erkennen waren. Ich habe die Einstichstellen mit Salmiak betupft, mehr konnte ich nicht tun. Wir mussten
auf unserem Vormarsch durch einen Wald der in Flammen stand, so dass man kaum atmen konnte. Es ging weiter in Richtung
Minsk und Warschau, wo schon die Sowjetische Armee durchgegangen war, die Pferde und Vieh von einem Gut mitgenommen
hatten. In einem Wald stießen wir unverhofft auf ein Kloster, in dem wir einige Gefangene machten. Dann trafen wir auf
eine gute Straße die nach Grochow ging.
Als wir dort einmarschierten wurden wir aus den oberen Stockwerken beschossen, so dass wir, um uns zu schützen, nur an
den Hauswänden entlang gehen konnten. Wir haben jedes Haus nach Feinden durchsucht. Vor einem Haus stand ein Hund der
niemanden reinlassen wollte, solange bis ihn eine Kugel traf. Die polnische Artillerie feuerte von Warschau aus, um
unseren Vormarsch zu stoppen. Wir hatten uns gerade eingegraben als plötzlich deutsche Flieger am Himmel erschienen,
die unsere Stellungen mit Bomben bewarfen und dabei viel Unheil anrichteten. Wir haben sofort Fliegertücher
ausgebreitet und Leuchtraketen abgeschossen. Da ich in dem Graben, den ich kurz zuvor ausgehoben hatte, sofort in
Deckung gegangen bin ist mir zum Glück nichts passiert. Unter den anderen Kameraden gab es viele Verwundete, so dass
ich nicht wusste wem ich zuerst helfen sollte.
Der Oberstabsarzt hat mich sofort tatkräftig unterstützt, so das bald alle Verwundeten versorgt waren, außer einem,
dem ein Bombensplitter den Arm abgerissen hat. Ich habe im 3 große Verbandspäckchen auf die Wunde gelegt, doch die
Blutung ließ sich trotzdem nicht stoppen, so dass er eine Stunde später auf der Krankensammelstelle verstarb. Wir
haben danach in einem Tomatenfeld einen Graben ausgehoben und eine neue Abwehrstellung bezogen. Die Gruppe Schwarz
bekam den Auftrag nach etwaigen versprengten polnischen Verbänden Ausschau zu halten, als sie unerwartet aus einer
Häuserreihe mit Maschinengewehrsalven überschüttet wurden. Der Gruppenführer und noch ein Soldat wurden dabei tödlich
verwundet. Danach wurde noch ein weiter Stoßtrupp, unter der Führung von Leutnant Briskorn, der sich dazu freiwillig
gemeldet hatte, hinaus geschickt um den Gruppenführer und den anderen Toten zu bergen.
Bei diesem Unternehmen, das erfolglos ausging, weil die Toten schon verscharrt waren, durchschlug eine Kugel den
Stahlhelm von Leutnant Briskorn, der auch sofort tot war. Alle Toten wurden später, an der Kirchenmauer in Grochow, in
Särgen beigesetzt: Hauptmann Schönwald sagte, das sie nach dem Kriege auf den Heldenfriedhof nach Ortelsburg überführt
werden. Drei Tage lagen wir bei Grochow in Stellungen, waren dem polnischen Maschinengewehrfeuer sowie den Bomben
deutscher Flugzeuge ausgesetzt. In der Nacht musste ich zu einem Verwundeten in die vorderste Linie und habe den
Rückweg nicht mehr finden können, als plötzlich Gewehrfeuer aufflammte habe ich in den Ruinen Schutz gesucht. Erst im
Morgengrauen konnte ich mich wieder orientieren und zu meinem Unterstand zurückfinden.
Warschau wurde tagelang bombardiert und stand auch unter Artilleriebeschuss. Aus dunklen Rauchwolken kamen oft ganze
Bündel von Papier angeflogen. Die Verwundeten kamen oft auf Krücken zu unserem Unterstand, ich habe sie dann zur
Krankensammelstelle hingeführt. Wir haben auch polnische Zivilpersonen betreut, die während der Kampfhandlungen
verwundet wurden. Als einmal 2 Jungen vorbeiliefen hat einer ihnen nachgerufen sie sollten seiner Frau Bescheid sagen,
er wäre auf der Krankensammelstelle an der Kirche. Als wir dort ankamen war seine Frau, mit einem Kind auf dem Arm,
schon da.
Nach der Kapitulation von Warschau, gingen wir über Sokolow zum Bug und haben dort Quartier bezogen. Der Russe hatte
sich bereits hinter den Fluss zurückgezogen, hatte alles Vieh und Pferde mitgenommen. Dort erreichte mich ein Telegramm
von zu Hause, dass meine Tochter gestorben ist. Es sprach sich auch herum dass verschiedene Heimaturlaub bekommen haben,
ich durfte auch für 14 Tage heim. Wir fuhren mit Lastautos nach Allenstein in die neue Reiterkaserne, zum
Ersatzbatallion, da haben wir unsere Gewehre und Munition abgeben, dann durften wir, jeder in seinen Heimatort
weiterfahren.
Als wir unsere Quartiere am Bug verlassen haben war sehr viel Schnee gefallen. Hier in Ortelsburg fanden wir die
gleiche Wetterlage vor, aber nach 3 Tagen war alles wieder weggetaut und wir konnten die Kartoffelernte, die durch den
frühen Wintereinbruch gestoppt wurde, zu Ende bringen. Ein Tag bevor ich zu Hause angekommen bin wurde die Tochter
beerdigt. Nach 14 Tagen mussten wir uns in Allenstein melden, Gewehre empfangen und wieder zurück zur Division an den
Bug 150 Kilometer hinter Warschau. Die elfte Division, zu der wir auch gehörten sollte in den Westen Deutschlands
verlegt werden und war schon unterwegs zur Verladestation Skiernewice 50 Kilometer vor Warschau.
Mein Dienst als Sanitätsunteroffizier
Unser Bataillon kam in das Städtchen Burscheid, im Kreis Opladen, wo wir in Privatquartieren
untergebracht wurden. Nach 3 Monaten, im Januar 1940, wurden wir nach Solingen verlegt, wo wir bis zum
Frankreichfeldzug stationiert waren. Wir mussten an Feldübungen teilnehmen, wie andere die in Kasernen untergebracht
waren. Während dieser Zeit musste jeder seine Zähne in Ordnung bringen lassen. Jeden Tag fuhren 20 Mann in die
Cäzilienstraße nach Köln, zur Zahnklinik. Im Rheinland wurde unsere Division neu aufgestellt. Ausfälle durch den
Polenfeldzug wurden durch neue Soldaten ergänzt. Ich kam nun zum Ersatzbatallion, war der Älteste in der ganzen
Kompanie. Als der Frankreichfeldzug losging wurde unser Ersatzbatallion mit den noch vorhandenen Verwundeten, in die
neue Reiterkaserne, nach Allenstein verlegt.
Meine Frau hat, mit Unterstützung der Bauernschaft, einen Antrag gestellt, daraufhin wurde ich zur Frühjahrsbestellung,
beurlaubt und später bis auf weiteres vom Militärdienst freigestellt. Als der Russlandfeldzug losging wurde ich von der
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg, für 14 Tage einberufen. Ich war seit 1922, Mitglied der freiwilligen
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg und habe jedes Jahr an Übungen teilgenommen. Jede Bereitschaft musste etliche Leute
stellen. Von Rohmanen wurden Emil Rosowski, Johann Dembek, und ich, zur Krankensammelstelle Wirballen, in Litauen,
abkommandiert. Dorthin kamen Lazarettzüge aus Russland mit der Breitspurbahn. Die Verwundeten wurden frisch verbunden
und auf Waggon mit Normalspur verladen und nach Deutschland gebracht.
Als die 14 Tage vergangen waren wollten wir wieder nach Haus zurück, doch man wollte uns nicht entlassen. Stattdessen
wurden wir dem Wehrkreisamt Königsberg zugeteilt, neu eingekleidet und zur Aushilfe ins Lazarett nach Gumbinnen
abkommandiert. Mehr als ein Jahr war ich in den Urlauber-Baracken, habe dort Krankenstube betreut. Später, bis zum
Dezember 1944, war ich im Reserve-Lazarett 4, in Königsberg tätig. Dort habe ich auch die Luftangriffe der Engländer,
vom 25 bis 26. August 1944 miterlebt.
Wir sollten gerade einen Lazarettzug in Rotenstein entladen, als plötzlich die Sirenen ertönten - Fliegeralarm. Im
gleichen Moment waren die ersten Flugzeuge auch schon da, zuerst warfen sie „Tannenbäume” und danach Foßforkanister ab.
Die Omnibusse standen schon zur Abfahrt bereit als es losging. Wir haben die Verwundeten schnell in den
Luftschutzkeller getragen, haben die Betten von den Fenstern weggerückt damit die Verwundeten nicht von den
Glasssplittern verletzt wurden. Im Kasernenhof brannten die Fosforkanister lichterloh. Unsere Unterkunft, die sich in
einer Baracke befand ist völlig abgebrannt, mit dem Wenigen was wir unser Eigen nannten. Am nächsten Tag wurden wir neu
eingekleidet und am 29. bis 30. kamen die englischen Bomber wieder, sie setzten genau da ihr Zerstörungswerk fort wo
sie vor 3 Tagen aufgehört hatten.
Anfang Dezember 1944 musste ich mich nach Stablack melden und musste dann zur Sanitätsabteilung 1, nach Gernau, das
liegt zwischen Lodz und Warschau. Vormittags hatten wir Felddienstübungen und nachmittags theoretischen Unterricht.
Jeden Tag wurden Gruppen zusammengestellt und zu anderen Einheiten abkommandiert. Ich kam zu einer Panzerabteilung, wo
wir an einem Morgen plötzlich auf dem Kasernenhof antreten mussten und zu unserer Überraschung mit der Nachricht
konfrontiert wurden, dass der Russe an mehreren Frontabschnitten durchgebrochen war. Wir bekamen sofort einen
Marschbefehl in Richtung Lodz, wo das Stadtbild noch intakt war, selbst die Straßenbahnen fuhren noch. In der Nacht
haben russische Flugzeuge die Stadt bombardiert. Die Kaserne in der wir untergebracht waren hatte keine
Luftschutzkeller, aber zum Glück blieben wir von Bombentreffern verschont. Am nächsten morgen bot sich uns ein Bild der
Verwüstung. Die entgleisten Straßenbahnwagen, sowie andere Fahrzeuge blockierten die Straßen. Die Älteren unter uns
bekamen Fahrscheine für einen Transportzug, der bereit hinter Lodz abfahrbereit, unter Dampf stehen sollte. Als
russische Panzer in den Straßen auftauchten, verbrannte die Schreibstube unsere Wehrpässe und andere wichtige
Dokumente. Wir liefen zu der Station auf der unser Transportzug bereitstehen sollte, aber da war kein Zug mehr zu sehen
und wir setzten unseren Rückzug zu Fuß fort.
Der Rückzug und Zusammenbruch der Ostfront
In Dobroschin, einer Stadt in Polen, wurde gerade ein Lazarettzug verladen, doch wir kamen nicht
mehr zum Einsatz, weil die russische Infanterie uns schon auf den Fersen war. Es ging weiter über den Fluss Bober,
Sagan, bis nach Glogau an der Oder. Dort wurden wir der 29. motorisierten Sanitätskompanie zugeteilt. Im
Garnisonslazarett wurden noch Operationen durchgeführt. Unsere Division hatte ihr eigenes Feldlazarett, so dass wir den
Befehl zu Weiterfahrt erhielten und noch unbeschadet die Oderbrücke passieren konnten, denn Glogau wurde zur Festung
erklärt. Wir haben 2 Pferdewagen organisiert und mit Verbänden, sowie medizinischen Instrumenten beladen. So kamen wir
bis nach Lübbenau im Spreewald, wo wir in einem Schloss, in zuvor ein Museum war, unser Lazarett untergebracht haben.
Weil die Amerikaner Cottbus bombardiert hatten, wurden die Verwundeten zu uns nach Lübbenau gebracht. Hier haben wir
Tag und Nacht gearbeitet, um die vielen Verwundeten, aus den schweren Kämpfen bei Grünberg und Sagan zu versorgen. Die
Soldaten von der Abwehrfront kamen schon mit abgestorbenen Armen oder Beinen bei uns an, weil in vorderster Linie keine
Frontlazarette mehr vorhanden waren; es mussten viele Amputationen durchgeführt werden. Als für unsere Pferde kein Heu
mehr vorhanden war, schickte mich unser Hauptfeldwebel, zu einem Bauern in den Spreewald, mit dem Auftrag, Futter zu
besorgen. Mit noch zwei Mann fuhren mit zwei Kähnen, zuerst den Hauptstrom entlang und dann in einen Nebenarm; da haben
wir die Boote beladen und brachten das Heu nach Lübbenau.
Als wir uns bei unser Einheit zurück melden wollten, war alles schon marschbereit. Ich bin schnell in einen Bus
eingestiegen der sofort losfuhr, weil russische Verbände schon in sichtweite waren. Russische Flugzeuge kreisten über
den Dächern und nahmen, mit ihren Bordwaffen jeden unter Beschuss, der sich irgendwo blicken ließ. Wir konnten nur
durch den Wald, oder in der Nacht vorwärts kommen, denn wenn ein Auto auf der Landstraße fuhr, war alsbald ein Flugzeug
hinter ihm her und schoss es in Brand. Als wir nach Tagen am Ufer der Elbe ankamen, war bereits eine Ponton-Brücke
erstellt worden, welche die zerstörte Brücke ersetzen sollte.
Durch die vielen Fahrzeuge waren in den Sand tiefe Spuren gefahren, so dass andere Fahrzeuge unsere Busse ins
Schlepptau nehmen mussten, weil wir mit eigener Kraft nicht mehr weiterkamen. Beiderseits der Trasse standen
Flüchtlingswagen, in der der Hoffnung die Brücke passieren zu können, doch SS-Polizei verhinderte das die Gespanne den
militärischen Rückzug zum Stillstand brachten. Es gelang uns die Elbe zu überqueren, um in einem Waldstück Schutz vor
feindlichen Fliegern zu suchen.
Als wir unsere Busse und Autos gut getarnt hatten, hat unser Bataillonschef die anwesenden Parteigrößen zu sich
gerufen und ihnen erklärt das wir eine Einheit des Roten Kreuzes sind und nach internationalem Recht keine Waffen
besitzen dürfen. Nach langer, erregter Diskussion wurde beschlossen einen Graben auszuheben und alles im Sand zu
verscharren. Als wir dann weiter, durch die Dörfer fuhren, sahen wir schon viele weiße Bettlaken, als Zeichen der
Kapitulation, aus den Fenstern hängen. Es wurde uns erzählt dass der Bürgermeister von der SS erschossen wurde, weil
er die Bevölkerung zu diesem Schritt ermutigt hatte. Jetzt waren hinter uns die Russen und vor uns schon die Amerikaner.
Amerikanische Panzer fuhren umher und schossen wild durch die Gegend, ohne ein Ziel anzuvisieren. Niemand wollte sich
dem Russen ergeben, doch der Weg der zu den Amerikanern führte, war durch abgesägte Bäume blockiert. Wir sind schnell
in das nächste Dorf gegangen, haben uns Sägen und Äxte besorgt, die Bäume durchgesägt und in den Straßengraben
geworfen.
“ Nach dem Ende des 2. Weltkrieges.”
In amerikanische Kriegsgefangenschaft
Dann fuhren wir unter internationaler Flagge an eine Mulde Brücke, vor der zwei amerikanische Soldaten, mit Zigarren,
zur Hälfte im Mund, standen. Sie rauchten und kauten gleichzeitig. Wir mussten auf einen freien Platz fahren, alle
aussteigen und rechts wieder antreten. Wäschebeutel und Tornister mussten wir abstellen; danach wurden wir nach Waffen
durchsucht, Wertsachen, Uhren und Messer wurden uns gleich abgenommen. Als wir anschließend an unserem Gepäck
vorbeigingen durfte niemand was mitnehmen. Als ich gebückt, nach meinem Wäschebeutel greifen wollte, in dem sich noch
3 Konservendosen und ein Brot befanden, bekam ich einen Fußtritt ins Gesicht, so dass mir ein Zahn ausgeschlagen wurde.
Wir wurden dann in einem Garten zusammen getrieben und gefragt ob jemand bei der SS gedient hat. Nachdem wir in Reihe
und Glied angetreten waren, mussten wir den Oberkörper freimachen und die Arme anheben. Es wurde nach SS-Zeichen
gesucht, die gewöhnlich unter dem Oberarm eintätowiert waren. Nachdem wir Grimma bei Leipzig, wo wir in amerikanische
Gefangenschaft geraten waren, verlassen hatten, mussten wir durch ganz Thüringen bis Hersfeld, an der Grenze zu Hessen,
marschieren. In Hersfeld wurden wir auf große Lastautos verladen, die von farbigen Soldaten gefahren wurden. Man hat
uns mit Stöcken hinauf getrieben, solange bis das Auto so voll war das man kaum stehen konnte. Die Soldaten fuhren, für
diese Straßenverhältnisse, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Wenn die Straße eine scharfe Kurve hatte, flogen
wir alle übereinander und mussten erst mit viel Kraftanstrengung auf die Beine kommen um diese Fahrt zu überstehen.
Da die Straßenränder in dieser Gegend mit Obstbäumen bepflanzt sind und deren Äste sehr niedrig hängen, hätten die
uns die Köpfe abgerissen, wenn wir uns nicht ständig geduckt hätten. Unsere Fahrt endete in Bad Kreuznach, in der Pfalz,
wo wir in ein Lager, in dem sich später 130.000 Mann und 6 Generäle befanden, eingepfercht wurden. Die Unterkunft der
Generäle befand sich unter einem Zelt, alle anderen mussten die Zeit unter freiem Himmel zubringen. Die Offiziere, die
Unteroffiziere, die Mannschaften; wurden in getrennten Camps untergebracht. Die Mannschaften wurden auch zur Arbeit
abkommandiert und konnten bei dieser Gelegenheit, Brot, Brötchen oder Zigarettenstummel organisieren, wogegen die
Offiziere und Unteroffiziere ihr Camp überhaupt nicht verlassen durften.
Die ersten Tage gab es kein Wasser und kein Brot, so dass die Kameraden vor Erschöpfung umfielen. Später standen wir
manchmal den ganzen Tag nach Wasser an, das von den, uns bewachenden Negern mit großen Wassertanks angefahren wurde. Am
dritten Tag bekamen wir mittags und abends etwas zu Essen; Brot bekamen wir erst nach zwei Wochen, nach dem aus der
Umgebung herbeigeholte Handwerker, Backöfen gebaut hatten. In den verschiedenen Gemeinden, die in den uns umgebenden
Weinbergen lagen, mussten sich alle Männer beim Bürgermeister melden. Als sie dann erschienen waren, wurden sie auf
bereitstehende Lastautos getrieben und zu uns ins Lager gebracht. Sie waren ohne Kopfbedeckung und ohne wärmere
Bekleidung angekommen, weil ihnen gesagt wurde, dass ihr Aufenthalt im Lager nur von kurzer Dauer sein würde. Man hat
uns, falls noch vorhanden, Decken und Mäntel abgenommen, mit der Begründung, sie würden für Kranke und Verwundete
gebraucht. Jeden Tag starben mehr als 200 Mann, die wir sofort in ein Zelt tragen mussten. In der Nacht wurden die
Toten dann mit unbekanntem Ziel, weggefahren.
Viele haben ihren Verstand verloren uns irrten im ganzen Camp ziellos umher. Als Latrinen wurden Gräben ausgehoben, in
die verschiedene Kameraden, bei der Verrichtung ihrer Notdurft, vor Schwäche hineingefallen sind und nicht mehr wieder
heraus kamen. Aus den Pfählen die, die jungen Obstbäume stützten, haben wir Krankentragen gebaut um unsere Kameraden,
bei Bedarf, zur Krankensammelstelle zu tragen. Es war in diesem Frühjahr auch sehr kalt, doch unsere Erdlöcher, die wir
zum Schutz vor Kälte und Wind, nur mit leeren Konservendosen ausgehoben hatten, durften nicht tiefer als 20 Zentimeter
sein. Nach jedem Regenguss mussten wir das Wasser ausschöpfen. Nach einem Gewitter, standen wir wiedermal, total
durchnässt in unserem Camp, als unerwartet am Horizont die Sonne hervortrat. Einer unserer Kameraden hatte noch eine
Trompete gerettet und fing, von dem Anblick völlig überwältigt, zu spielen an: "Es geht alles vorüber, es geht alles
vorbei, nach jedem Dezember, folgt wieder ein Mai". Daraufhin hob sich die Stimmung der tiefbetrübten Kriegsgefangenen,
so das Heimatlieder durch das ganze Camp erklangen, obwohl wir in den nassen Kleider herumgehen mussten, bis sie am
Körper trocken wurden.
In französischer Kriegsgefangenschaft
Nach etwa einem Monat, haben uns die Amerikaner, den Franzosen, zum Arbeitseinsatz, ausgeliefert.
Etwa 4 Kilometer von Bad Kreuznach entfernt, stand auf freier Strecke, ein Zug mit offenen Kohlenloren, auf den wir
verladen wurden. In jeden Waggon, wurde pro Person eine Tafel Schokolade und ein Päcken Zwieback rein geworfen, doch
viele Kameraden fanden nur leere Päckchen vor, weil die schon zuvor von der französischen Wachmannschaft geplündert
wurden. Wir haben uns darüber beschwert, doch die haben uns nur ausgelacht. Nachdem wir zunächst bei Mainz über den
Rhein fuhren, endete unsere Fahrt bei Paris in einem großen Zeltlager. Dort wurden wir auf andere Züge verladen, die uns
nach Südfrankreich, in ein Barackenlager, bei Mazarei, brachten.
Auf einer Zwischenstation hat man uns unter einer Pumpe, die Lokomotiven mit Wasser versorgt, abgestellt, den Kran
aufgedreht und uns anschließend ausgelacht, die Kinder Haben uns mit Steinen beworfen. Ein Wachmann kam in unseren
Waggon gekommen, hat unser Gepäck durchsucht, wenn er Tabak oder Zigaretten gefunden hat, nahm er sie mit. Die Kameraden
waren darüber so empört, dass sie vorhatten, ihn nachts unter den Waggon zu werfen. Wir haben sie gebeten dass zu
unterlassen, weil man uns in diesem Falle, alle erschießen würde.
Als wir ins Lager kamen wurden wir zuerst gezählt, dann mussten wir unser Gepäck stehen lassen und beiseite treten.
Wenn man bei der Nachkontrolle noch was in den Taschen fand, wurde das auch entwendet, selbst Esslöffel. Wir wurden
dann in drei Baracken, ohne Toiletten, eingeschlossen. Die Kameraden haben ihre Bedürfnisse in Kochgeschirre erledigt
und durch ein kleines Fenster, das sich fast unter der Decke befand, hinausgeworfen. Andere Fenster ließen sich nicht
öffnen, weil sie mit Stacheldraht zu geflochten waren. Als die Kameraden die Kochgeschirre auskippten, haben die
Wachposten geschossen und die Fenster zertrümmert. Sie waren der Meinung dass wir ausbrechen wollten. Es herrschte eine
große Hitze, in den überfüllten Baracken sind wir fast erstickt. Am nächsten Tag haben wir uns über fehlende Toilettem
beschwert, da haben sie Heringsfässer durch die Hälfte geschnitten und an der Ausgangstür hingestellt. Um bei den
überfüllten Räumen dort hinzukommen, musste man über die Köpfe der Anderen steigen. Viele hatten Fieber und Durchfall
und mussten in die Krankenstube eingeliefert werden, wo sie kurz darauf verstarben.
Besonders Raucher litten sehr an der Unterernährung, bekamen Wasser in den Beinen und waren die Ersten die verstarben.
Nach der Registrierung wurden wir auf andere Baracken verteilt. Die Zivilbevölkerung kam in die Räume und begann uns
auszuplündern. Wer noch gute Schuhe besaß musste sie ausziehen und bekam dafür die kaputten des Plünderers. Eine Woche
lang mussten wir diesen Zustand ertragen, erst als die Kameraden sich beschwerten, wurde am Eingang eine Tafel am
Eingang angebracht, dass die Zivilbevölkerung das Lager nicht betreten darf. Bis auf einige, wenige Ausnahmen wurde
diese Anweisung befolgt.
Als wir im Lager ankamen, war der französische Lagerkommandant, ein ehemaliger Kriegsgefangener, der bei einem Bauern
in Deutschland gearbeitet hatte. Dieser Bauer war jetzt als Kriegsgefangener in seinem Lager. Als er ihn erkannte, hat
er ihn gleich zum Küchendienst eingeteilt und mit dem nächsten Krankentransport nach Hause fahren lassen. Zu Mittag
bekamen wir nur gekochte Haferkörner, da schwamm alles oben, später war man dann auf Gerste umgestiegen. Als viele
daran gestorben waren, weil sie diese „Rohkost”, die nur ein Kuhmagen verträgt, nicht gegessen haben, hat man die
Körner durch eine Schrotmühle laufen lassen. Dann hat man uns Steckrüben gekocht; wir bekamen 250 Gramm Weißbrot,
etwas Quark und ein viertel Liter Magermilch. Später, als wir schon arbeiten mussten, hat man in unserem Essen einen
Kuhkopf mitgekocht, das hat dann bedeutend besser geschmeckt.
Bevor wir morgens zur Arbeit gingen, mussten wir zu Flaggenparade und abends, nach der Rückkehr, haben wir die Flagge
wieder eingeholt. Wir haben einen Kanal gereinigt, dessen Sohle 2 Meter dick mit Schlamm bedeckt war. Zuerst wurde das
Wasser abgelassen, dann haben wir, einer dem andern, den Schlamm mit der Schippe hoch gereicht. Der Letzte hat den
Schlamm, der so zäh war, dass er nicht von der Schippe wollte, oben am Rande abgelegt. Manchmal waren 10 Mann nötig um
den Höhenunterschied zu überwinden. Das Wachpersonal schoss über unsere Köpfe hinweg und rief: „schnell arbeiten”. Bei
der großen Hitze war das ein Ding der Unmöglichkeit, zumal es nichts zu Trinken gab. Auf dem Heimweg haben wir im Walde
Heilkräuter gesammelt, die man in der Küche getrocknet und als Tee zubereitet hat, den wir am nächsten tag zur Arbeit
mitnahmen, um unseren Durst zu stillen.
Unser Aufseher hatte einen Stock, an dem sich noch kurz abgeschnittene Äste befanden. Wer seiner Meinung nach, nicht
ordentlich gearbeitet hat, bekam gleich Schläge auf den Rücken. Die weißen Aufseher wurden irgendwann durch Neger
ersetzt, die uns bedeutend besser behandelt haben. Wenn irgendetwas schief ging, haben sie nichts gesagt, nur gelacht.
In den übrig gebliebenen Wassertümpeln hatten sich noch einige Aale versteckt, die wir zu fangen versuchten, was uns
auch manchmal gelang. Wir mussten ihnen das Genick brechen, damit sie uns nicht entwischen konnten. Wenn die Franzosen
bemerkten das wir Aale hatten, wurden sie uns abgenommen. Gelang es uns aber, sie ins Lager zu bringen, dann haben wir
uns eine köstliche Malzeit zubereitet.
Um sicherzustellen dass niemand geflüchtet ist, wurden wir, wenn wir abends ins Lager zurückkamen, zuerst gezählt.
Diese Zählung wurde mehrmals wiederholt, weil die Wachmannschaften sich immer wieder verzählt haben. Als einer von uns
hin ging, ihnen sagte dass alle da sind, wollten sie es nicht glauben und haben uns vor dem stehen lassen, bis es ihnen
irgendwann einfiel. uns doch das Tor zuöffnen. Einmal, als wir von der Arbeit zurückgekehrt waren, standen wir bis 23
Uhr neben der Flagge, weil uns niemand das Tor geöffnet hat. Als wir dann doch irgendwie ins Lager kamen haben wir
festgestellt, dass das ganze Wachpersonal betrunken war und niemand im Stande uns das Tor zu öffnen.
Eines Tages waren wir wieder abends zur Parole angetreten, als ein älterer Herr mit seinem Hund, am Stacheldraht
entlang, spazieren ging. Weil der Hund, unterm Stacheldraht hindurch, zu uns kam, hat ihn einer geschnappt, ihm das
Genick gebrochen und unter seiner Jacke versteckt. Der Franzose hat nach seinem Hund gerufen und gepfiffen, aber alles
vergebens, der Hund war nicht aufzufinden. Die Kameraden haben ihm gleich das Fell über die Ohren gezogen, das Fleisch
gekocht und das Fell in die Latrine geworfen. Das Fleisch wurde umgehend verspeist.
Als wir am nächsten Tag von der Arbeit zurückkehrten, war im Lager der Teufel los. Wir mussten sofort antreten und
wurden gefragt, wo der Hund geblieben ist, der Gestern Abend, mit seinem Herrchen, am Zaun entlang spazieren ging. Als
sich niemand dazu bekannte, mussten wir weiterhin stehen bleiben, während die Wachmannschaften von Baracke zu Baracke
gingen und alles durchsuchten. In einer Latrine hat man dann das Fell gefunden, was uns ein furchtbares „Donnerwetter”
einbrachte und in den nächsten Tagen, nach der Arbeit, unter dem Kommando eines Oberfeldwebels, eine Stunde
nachexerzieren.
In Südfrankreich regnet es den ganzen Sommer nicht; die Bauern haben da keine Scheunen und das Getreide wir nur in
Schobern aufgestellt und dann umgehend gedroschen. Vom Oktober bis Dezember regnete es fasst jeden Tag in Strömen.
Gesät wird nur im Frühjahr und im Herbst, weil im Sommer alles vertrocknet. Es wird viel Wein angebaut und die
Steckrübe wächst den ganzen Winter. Neben den Weinreben wurde aus Schieferplatten ein Zaun aufgestellt, um dem Wein
einen optimalen Standort zu sichern. Die Bauernwagen hatten nur zwei Räder und waren nur mit einem Pferd bespannt, das
die ganze Balance des Wagens zu halten hatte. Trotzdem haben sie soviel aufgeladen wie wir auf einen Leiterwagen. Viele
Kameraden wurden den Bauern zur Arbeit ausgeliehen. Wenn ein Bauer einen Arbeiter gebraucht hat und es wurde gefragt,
wer sich in der Landwirtschaft auskennt, da haben sich alle gemeldet. Der Bauer konnte sich dann aussuchen, wen er
mitnehmen wollte.
Wenn wir durch die Stadt zur Arbeit gingen, haben verschiedene Leute Fallobst in die Abfalleimer gelegt. Wenn das von
den Kameraden bemerkt wurde, schwenkten viele aus der Reihe, um sich etwas mit zunehmen, was von den Wachmannschaften
nicht gern gesehen wurde. Viele Kriegsgefangene hatten keine Schuhe mehr, sie haben die Füße nur mit Lumpen bewickelt.
Eines Tages kamen Kameraden aus Norwegen, die nach Deutschland entlassen werden sollten. Mann hat sie jedoch ins Lager
gesteckt und zur Arbeit eingeteilt. In Norwegen hatten sie Kleider und Stoffe eingekauft, hatten volle Seesäcke und
sogar Karren auf 2 Rädern, weil sie ja in die Heimat entlassen werden sollten. Als wir morgens zur Arbeit rausgeführt
wurden standen sie schon vor dem Lager. Wir haben ihnen zugerufen, dass sie uns etwas abgeben sollen, weil ihnen ja
sowieso alles abgenommen wird, aber sie haben uns nur ausgelacht. Als sie ins Lager Kamen mussten sie ihr Gepäck
ablegen, wurden dann wo anders hingeführt und haben es danach nie wieder gesehen.
Durch die vielen Läuse, Flöhe und Wanzen die wie im Lager hatten, kam es bei verschieden Kameraden, an den
Einstichstellen, zu eiternden Entzündungen. Um dem vorzubeugen hat man uns mit einem Pulver, das in Frankreich
hergestellt wurde, aber bei den Parasiten keine Wirkung zeigte, eingesprüht. Erst bei der Anwendung eines Mittels
amerikanischer Herkunft, war alles über Nacht verschwunden.
Der Sonntag war arbeitsfrei. Dann kam ein katholischer, französischer Pfarrer, eskortiert von 3 Mann, mit
aufgepflanztem Seitengewehr ins Lager und hat Gottesdienst gehalten. Einen evangelischen Pfarrer gab es nicht, nur
einen Baptisten Prediger. Der wurde würdevoll eingekleidet, bekam ein großes Kreuz und hat jeden Sonntag in einer
extra dafür hergerichteten Baracke Gottesdienst gehalten. Wer Theologie studiert hatte und sich meldete, wurde zu
einem Seminar geschickt und konnte sein Studium fortsetzen. Glasbläser durften das Lager auch verlassen und ihrem
erlernten Beruf wieder arbeiten.
Wer sich freiwillig, für 5 Jahre, zum Dienst in der Fremdenlegion verpflichtet hat, das waren etliche unter uns, wurde
neu eingekleidet, bekam gutes Essen und Rauchwaren soviel er wollte. Nach einem Jahr wurden, nach und nach, die
Kranken und Körperbehinderten in die Sowjetische Besatzungszone entlassen. Eine Entlassung von Kriegsgefangenen, die
in den Westzonen oder jenseits von Oder und Neise zu Hause waren, war nicht vorgesehen. Die Österreicher wurden alle,
unabhängig von ihrem Gesundheitszustand entlassen.
Ich habe Briefe nach Hause geschrieben, aber die kamen nur bis Allenstein und wurden wieder zurück geschickt. Als eine
Kommission des Roten Kreuzes aus der Schweiz unser Lager besichtigt hat, haben wir uns beschwert, das wir als
Sanitätsdienstgrade, zur Arbeit gehen müssen. Daraufhin erging ein Befehl: Wer einen vom Roten Kreuz, ausgestellten
Ausweis besitzt, gehört einem internationalen Verband an und braucht nicht zu Arbeit gehen. Aus unserem Lager hatten
sich 20 Mann gemeldet, die daraufhin Freigang, in Begleitung von zwei französischen Wachsoldaten erhielten. Als wir
gefragt wurden wo wir hin wollen, entschlossen wir uns, einen Soldatenfriedhof, auf dem unsere verstorbenen Kameraden
beerdigt waren, zu besuchen.
Da der Untergrund in dieser Gegend aus Felsen bestand, wurden die Gräben, in denen die Toten in selbst gezimmerten
Kisten nebeneinander gestellt wurden, mit Hilfe von Dynamit ausgehoben. Ein Leichenwagen, mit einem Pferd bespannt,
das mit einer schwarzen Decke abgedeckt war, wurde von einem Kutscher in angemessener Kleidung, gefahren. Der Wagen
konnte gleichzeitig 4 Kisten transportieren. Wenn wir von der Arbeit kommend, dem Leichenwagen begegneten, wurde
gehalten und mit einer Schweigeminute der Toten gedacht, bis der Wagen vorbei war. Die Zivilbevölkerung verharrte auch
im Schweigen, mit abgenommener Kopfbedeckung.
Ein Kamerad, der in Krottorf, Kreis Oschersleben, bei Magdeburg, zuhause war, sagte bei seiner Entlassung zu mir:
Sollte ich das Glück haben, meine Entlassungspapiere zu erhalten ohne eine Bleibe vorzuweisen, dann soll ich Krottorf
als Heimatadresse angeben. Auf der Krankenstube habe ich angegeben, dass sich noch ein Schrapnellsplitter, aus dem
Ersten Weltkrieg, in meiner Kreuzbeingegend befindet, er zwar verkapselt ist, aber immer noch Beschwerden verursacht.
Daraufhin wurde ich zur Entlassung vornotiert. Als bekannt wurde das ein Rückkehrertransport in die sowjetische
Besatzungszone zusammengestellt wird, habe ich mich sofort gemeldet und wurde für ein Entlassungslager in Angoleme
vorgesehen. War das eine Freude, als uns mitgeteilt wurde, wann der Rücktransport stattfindet.
In unserem Lager waren noch 2 Kameraden aus dem Kreis Ortelsburg: Ein Gustav Lumma aus Leynau und ein Alfred Moritz
aus Groß Schöndamerau. Sie mussten noch zurückbleiben und haben mir den Auftrag erteil, die Angehörigen in der Heimat
zu grüßen und ihnen die Anschrift mitzuteilen. Als wir im Entlassungslager ankamen, fragte man uns nach unserer
Heimatanschrift. Dann wurden die Entlassungspapiere angefertigt. Es wurde uns auch ein Barscheck, für die in Frankreich
geleistete Arbeit ausgehändigt, den wir bei jeder Kasse in Deutschland einlösen könnten. Ich habe ihn bis zum heutigen
Tage nicht einlösen können, obwohl ich irgendwann in der Zeitung gelesen habe, das Verrechnungschecks die den aus
französischer Kriegsgefangenschaft Entlassenen, ausgehändigt wurden, einzulösen sind.
Wir kamen zuerst nach Saar Elbe, dann in die Nähe der Zonengrenze zu Thüringen. Hier mussten wir 2 Tage warten, weil
aus der sowjetischen Besatzungszone keine Eisenbahnwagen bereitgestellt wurden. Angesichts dessen, das der Russe beim
letzten Transport die aus Frankreich kommenden Wagen kassiert und nicht mehr herausgeben wollte, bestand der Franzose
jetzt darauf, seine Wagen sofort wieder mitzunehmen. Als der sehnsüchtig erwartete Zug endlich eintraf, durften wir
umsteigen und kamen, immer noch hinter Stacheldraht, nach Erfurt. Von dort weiter ins Quarantänelager nach Prätsch an
der Elbe.
Unter Androhung von Strafe war es verboten das Lager zu verlassen, doch der Hunger zwang uns dazu, in den umliegenden
Dörfern um Lebensmittel zu betteln. Man drohte uns damit, dass Zuwiderhandlungen, mit einer 14-tägigen Verlängerung der
Quarantäne geahndet werden. Der Roggen war schon reif und wir haben, auf den umliegenden Feldern, die Ähren abgerissen,
das Korn, zwischen 2 Steinen zu Mehl zerrieben, um daraus eine Suppe zu kochen, denn von dem was unsere Lagerküche uns
bieten konnte, war es nicht möglich zu überleben. Als der Eigentümer bemerkte wer seine Roggenähren entwendet hat, kam
er ins Lager, gerade zu dem Zeitpunkt als wir mit dem Mahlen beschäftigt waren. Der Lagerkommandant, bei dem er sich
beschwerte, drohte uns zu bestrafen, wenn wir unsere „Rauzüge” nicht unmittelbar einstellen würden. Wir sagten ihm er
solle uns heimfahren lassen, da wir doch lange genug hinter Stacheldraht gesessen hätten.
Endlich wieder in Freiheit
14 Tage nach unserer Ankunft wurden uns Entlassungspapiere ausgehändigt, sowie auch Fahrscheine
zum den, von uns angegeben Heimatorten. So kam ich nach Krottof, Kreis Oschersleben, zu meinem ehemaligen
Kriegskameraden, bei dem ich einen Tag geblieben bin. Er hatte mir schon eine Stelle bei einem Bauern besorgt, der 70
Jahre alt und kinderlos war. Zum Hof, den er mit seiner Ehefrau bewirtschaftet hat, gehörten 36 Morgen Land, 2 Ochsen
und 3 Kühe. Das Ackerland bestand aus 17 Parzellen und sicherte mir einen Arbeitsplatz.
Jetzt, da ich ein Dach überm Kopf und genug zu essen hatte, fing ich an nach dem Verbleib meiner Familie zu forschen.
Bei meinem letzten Heimaturlaub hatte ich mit meiner Frau verabredet; falls wir uns in den Kriegswirren verlieren
sollten, unsere Kontaktadresse, die meiner Quartiersleute in Burscheid, Kreis Opladen, sein sollte. Ich habe zuerst
nach Rohmanen geschrieben, aber leider keine Antwort erhalten. Dann habe ich nach Burscheid geschrieben, und siehe, -
bei denen lag schon eine Anfrage meiner Frau vor, die nach mir gefragt, und ihre jetzige Anschrift hinterlassen hatte.
Ich habe dem Bauern erzählt dass meine Frau sich zurzeit, auf einem Gut, in Alt Steinhorst, im Kreis Rostock, befindet.
Er war sofort bereit uns ein Zimmer zur Verfügung zu stellen, wenn ich meine Frau nach Krottorf rüberholen wollte. Das
habe ich Ihr mitgeteilt und sie war sofort bereit ihren Wohnsitz nach Krottorf zu verlegen, denn sie wohnte dort in
einem kleinen Stübchen unterm Dach.
Im Herbst, als die Feldarbeit so ziemlich erledigt war, bin ich nach Alt Steinhorst gefahren, um meine Frau und meinen
Sohn Kurt, sowie meinen Sohn Manfred, den ich noch nicht kannte, weil er erst nach der Flucht, am 31. Januar, in Groß
Lüssewitz, geboren wurde, nach Krottorf zu holen. Meine Frau hatte schon Holz für den Winter besorgt und vom Gut, auf
dem sie im Sommer gearbeitet hatte, Mehl und Kartoffeln bekommen. Wir haben das Mehl und andere Habseligkeiten in
Kisten verpackt. Das Holz haben wir einem Bauern gegeben, der uns und unser Gepäck, mit seinem Pferdewagen, zum 14
Kilometer entfernten Bahnhof, nach Ribnitz gebracht hat. Wir sind auch gut in Krottorf angekommen, aber als wir am
nächsten Tag, unsere Kisten vom Bahnhof abholen wollten, haben wir zwar die Kisten vorgefunden, doch der gesamte Inhalt
wurde während der Bahnfahrt entwendet. Die Bahnstation in Krottorf hat die Vorkommnisse zur Kenntnis genommen und
protokolliert, aber unsere Sachen haben wir nie wieder gesehen und mussten wieder bei Null anfangen.
Im Winter musste ich auf der Genossenschaft, unentgeltlich, für die Russen Weizen einsacken. Ich hatte versucht eine
Arbeit als Zimmermann zu bekommen, doch auf dem Arbeitsamt wurde mir gesagt, ich bin Ladwirt und muss auf der
Landwirtschaft arbeiten. Da in den ersten Nachkriegsjahren, auch in der sowjetisch besetzten Zone Arbeitsplätze knapp
waren, mussten auch solche, die einen anderen Beruf erlernt hatten, jede zumutbare Arbeit annehmen. Aus der Heimat
erhielt ich einen Brief, von meiner dort noch lebenden Mutter. Sie schrieb das sie mich noch einmal sehen wollte und
ich sollte doch wieder zurück kommen; Unser Hof wäre nicht von Polen besetzt und sie wäre ganz alleine, weil der Vater
nach dem Durchzug der Front von den Russen erschlagen wurde. Daraufhin habe ich dem polnischen Konsulat in Magdeburg
mitgeteilt, dass ich in Rohmanen eine Landwirtschaft besitze, und um eine Einreisegenehmigung gebeten.
Nach 2 Monaten erhielt ich eine Postkarte, mit der Mitteilung, ich sollte mich persönlich beim Konsulat vorstellen.
Nach Aufnahme meiner Personalien, wurde mir gesagt, das ich benachrichtigt werde wenn mein Antrag genehmigt wird. Ende
Juli 1947 erhielten wir die Einreisegenehmigung nach Ostpreußen, das jetzt unter polnischer Verwaltung stand. Wir
mussten zuerst zum polnischen Konsulat in Berlin-Lichterfelde, wo wir umgeben von einer Trümmerlandschaft, gewartet
haben, bis alle Untersuchungen und Formalitäten erledigt waren.
“ Wieder zurück in Ostpreußen.”
Der schwere Wiederaufbau nach dem Kriege
Dann fuhren wir über Frankfurt/Oder, Posen, Thorn, Allenstein, nach Ortelsburg, wo wir am 2. August 1947 ankamen. Mit
einem zweirädrigen Karren, den ich mir von einem noch in Ortelsburg lebenden Bekanten ausgeliehen hatte und meinem
Sohn Manfred im Kinderwagen fuhren wir nach Rohmanen. Meine Mutter war inzwischen verstorben und auf dem Hof war nur
meine, inzwischen aus Russischer Gefangenschaft wiedergekehrte Schwester, Frieda Pelkowski.

Es war alles ausgeplündert; kein Vieh, keine Maschinen und der ganze Hof mit kniehohem Graß überwachsen. Nur schmale
Trampelpfade, vom Haus zum Holzschuppen und zum Klo, durchkreuzten das satte Grün. Ich habe das Gras auf dem Hof mit
einer Sense, die ich noch gefunden habe, abgemäht, damit der Hof nicht so verwahrlost aussah. Am nächsten Tag habe ich
mich bei der Polizei in Ortelsburg angemeldet, wo ich auch ein Startgeld von 100 Zloty erhielt und Gepäckstücke, die
ich in Krottorf aufgegeben, am Bahnhof abgeholt. Es hat mich sehr gewundert das, das Gepäck überhaupt angekommen ist.
Da man von der Landwirtschaft nicht Leben konnte, habe ich mich in den nächsten Tagen, bei der jetzt polnischen Bahn,
um Arbeit beworben und wurde auch angenommen. Wenn wir unseren Monatslohn bekamen, saß immer einer am Tisch, der von
uns 100 Zloty für den Wiederaufbau von Warschau verlangte. Wenn ich dran war, riefen die Anderen, ich hätte Warschau
zerstört und müsste deshalb 200 Zloty abgeben. Nach 3 Jahren kam eine Verfügung, die besagte, dass wer länger als 1
Jahr bei der Bahn beschäftigt ist, angestellt werden muss. Um diese Bestimmung zu umgehen hat man mich entlassen und
eine Woche später wieder eingestellt.
Als ich vor Ablauf des nächsten Jahres, aus dem gleichen Grunde wieder entlassen wurde, habe ich mich bei der
Stadtverwaltung in Ortelsburg(jetzt Szczytno)beworben, wo ich zuerst im Gaswerk als Heizer und später auf Baustellen
als Zimmermann gearbeitet habe. Wir haben durch den Krieg beschädigte Häuser repariert, in den ehemals touristischen
Zentren einige Ausbesserungen an den Einrichtungen durchgeführt, eine Ziegelei wieder in Betrieb gesetzt und andere
anfallende Arbeiten verrichtet. Im Dach des Rathausturmes war während der Kämpfe eine Granate eingeschlagen, die, die
Dachlatten und die Verschalung zerstört hatte. Da wir, unter schwersten Bedingungen, den Schaden repariert haben,
wurde uns eine Höhenzulage versprochen, die wir aber nicht bekommen haben.
Aus Verärgerung darüber habe ich bei der Stadtverwaltung gekündigt und bei einer Wiederaufbaufirma unter der Leitung
von Bauingenieur Laskowski wieder angefangen, wo ich bis 1954, als Zimmermann beschäftigt war. Ab da habe ich mich
nur um meinen Hof gekümmert, der wegen meiner Arbeitsstellen, gezwungenermaßen, sehr vernachlässigt wurde. Als wir
1947 zurückkamen, brachten wir unseren Sohn Manfred noch im Kinderwagen. Den hat meine Frau zum Markt gebracht,
verkauft, und dafür eine Ziege erworben, die dank guter Pflege, uns täglich mit 4 Liter Milch versorgte. Das war der
erste Baustein zum Wiederaufbau, unserer durch den Krieg zerstörten, und danach ausgeplünderten Landwirtschaft.
Während meiner Arbeit bei der Bahn haben wir uns eine Kuh gekauft, die nach einem halben Jahr, wegen nicht bezahlter
Grundsteuer, vom Gerichtsvollzieher gepfändet wurde. Man hat uns die Kuh weggenommen und bei einem Arbeiter, der in
der Ernst-Mey-Straße in Ortelsburg wohnte und sie wegen nicht vorhandener Futtermittel, nur mit Kartoffelkraut
gefüttert hat, untergestellt. Als ich bei der Bahn meinen Monatslohn bekommen habe, bin ich zur Gmina gegangen, habe
eine Rate angezahlt und durfte dann die Kuh wieder mit nach Hause nehmen. Durch die schlechte Ernährung war die Kuh
stark abgemagert und lieferte nur die Hälfte der ursprünglichen Milchleistung.
Später habe ich ein Pferd auf Abzahlung bekommen, das 140.000 alte Zloty gekostet hat. Die Stute war schwach und unser
Feld sehr hügelig, so dass man nur bergab pflügen konnte, was sehr beschwerlich war, bergauf ging es immer im Leerlauf.
Später habe ich die schweren Böden mit dem Traktor umpflügen, und in den letzten Jahren auch mit dem Binder mähen
lassen. Von der Stute habe ich 2 schöne Fohlen gezogen; ein davon habe ich bei der Ausreise in die Bundesrepublik
mitgebracht und bei der Viehverwertungs-Genossenschaft in Göttingen verkauft. In den ersten Nachkriegsjahren als noch
wenig Land bestellt wurde, breiteten sich auf den nicht beackerten Flächen, Wildkräuter aus. Disteln und andere
Schnellwachsende, erreichten manchmal eine Höhe von 2 Meter, besonders auf den schweren Böden.
Es hat viel Schweiß gekostet ehe man den Acker soweit hatte, das er auch befriedigende Erträge abwarf. Die
Währungsreform von 1950, hat unser weiniges Geld das wir schon gespart hatten, wieder vernichtet. Ich hatte 2 Pferde,
1 Fohlen, 2 Kühe und Schweine, als ich wieder aufgefordert wurde nicht bezahlte Grundsteuern nachzuzahlen. Als ich
nicht bezahlen konnte, hat der Vollziehungsbeamte, ein Fohlen, eine Kuh und ein Schwein gepfändet. Es gelang mir jedoch
nach längeren Verhandlungen, ohne größere Verluste, alles zu regeln. Später kam eine Verfügung, die besagte; wenn
jemand auf seinem Hof nur eine Kuh und ein Pferd hatte, durften sie nicht gepfändet werden. Einige haben ihr Inventar
dieser Verfügung angepasst und dadurch die Zahlung von Grundsteuer umgangen.

Wer seine Steuern pünktlich bezahlt und sein Kontingent an landwirtschaftlichen Produkten fristgerecht abgeliefert hat,
der konnte seine, darüber hinaus erwirtschafteten Produkte zu marktgerechten Preisen verkaufen. Für eine hochtragende
Sterke, mindestens 400 kg schwer, die auf ein staatliches Gut verkauft wurde, konnte man bis zu 12000 Zloty bekommen.
Unsere Böden waren kalkarm, doch durch den Einsatz von Kalk und Kunstdünger konnte man den Ertrag erheblich steigern.
Kalk und Kunstdünger konnte man bei der Genossenschaft(GS) bestellen, der dann auch direkt auf den Hof geliefert wurde.
Kalk wurde geliefert und gleich auf dem Feld ausgestreut. In den 1960ger Jahren waren alle Ackerflächen der Rohmaner
Felder bestellt.
Die nach dem Krieg zurückgebliebenen deutschen Bauernfamilien, aber auch die Polen, die während des Krieges beim Bauern
in Deutschland gearbeitet haben, versuchten mit teils bescheidenen, oder auch zusammen gesuchten, landwirtschaftlichen
Geräten, die bäuerlichen Betriebe aufrecht zu erhalten. Nach den schweren Anfängen in den ersten Nachkriegsjahren
erzielten sie schließlich einen beachtlichen Erfolg, der sich in wogenden Kornfeldern, sowie in grünen Wiesen auf
denen gut genährtes Vieh weidete, widerspiegelte.
Ein schwerer Einschnitt in meinem Leben.
Am 11. Mai 1956 verstarb nach langer schwerer Krankheit, meine liebe Ehefrau Marta Rattay,
geborene Brosch. Ein Jahr zuvor war schon mein Schwiegervater Gottlib Brosch verstorben. Die schweren Bedingungen
unter denen wir nach Kriegende leben mussten, haben ihrer bereits angegriffenen Gesundheit sehr zugesetzt. Sie
verstarb mit 44 Jahren und hinterließ in unserer Familie eine große Lücke, die nicht mehr zu Überbrücken war. Wir
haben sie unter großer Anteilnahme der noch verbliebenen deutschen Bevölkerung zu Grabe getragen und auf dem Rohmaner
Friedhof beigesetzt. Die Arbeit die sie sonst verrichtet hatte fiel jetzt auf mich und meine Söhne zurück. Meine
Schwester Frieda Pelkowski half auch wo sie nur konnte. Wir waren auf die Unterstützung durch Nachbarn und Freunde
angewiesen, die uns immer wenn es nötig war, tatkräftig unterstützt haben. Im laufe der Zeit haben wir wieder zum
Alltag zurück gefunden, haben sie noch etliche Jahre auf dem Friedhof besuchen können, bis wir, bedingt durch unsere
Ausreise uns endgültig von ihr trennen mussten.
Der endgültige Abschied von Ostpreußen
Ab 1956 begannen, durch die Vermittlung des Deutschen Roten Kreuzes, die ersten Ausreisen in die
Bundesrepublik Deutschland. Zuerst waren es Kinder die zu ihren Eltern ausreisen durften, Familien deren Väter aus der
Kriegsgefangenschaft in den Westen Deutschlands entlassen wurden und andere durch den Krieg getrennte
Familienangehörige. Ab 1960 erhöhte sich die Zahl der Ausreisewilligen aus dem polnisch besetzten Ostpreußen. Es setzte
sich die Überzeugung durch, dass unsere Angestammte Heimat, uns für die Zukunft keine Perspektive mehr bieten konnte.
Meistens wurden die Anträge, die wir an die Passabteilung in Allenstein stellen mussten, um einen Ausreisepass zu
bekommen, negativ beschieden. Nach mehrmaligen Versuchen gelang es dann doch, diese begehrte Ausreiseberechtigung in
Empfang zu nehmen. Die Enttäuschung der Zurückgebliebenen war groß, wenn wieder mal Verwandte oder Nachbarn, den Weg
in Richtung Bahnhof einschlugen.
Um einen Reisepass zu beantragen, musste man zuerst eine Einladung von Verwandten aus der Bundesrepublik vorlegen, in
der, diese sich verpflichten mussten, für Unterkunft und Verpflegung der Eingeladenen zu sorgen. Diese Einladung
musste durch ein Amt in der Bundesrepublik beglaubigt werden. Außerdem mussten die Kosten für die Bahnfahrt, ab
polnischer Grenze, bis zum Zielort, beim polnischen Reisebüro ORBIS, in Warschau, in DM eingezahlt werden.
Unseren ersten Ausreiseantrag haben wir 1964, bei der Kommandantur der polnischen Miliz in Allenstein eingereicht, der
nach einer gewissen Zeitspanne, ohne eine uns verständliche Begründung zu nennen, abgelehnt wurde. Gegen diese
Ablehnung wurde ein Widerspruch zugelassen, den wir sofort einreichten. Nach einer weiteren Zeitspanne erhielten wir
wieder eine Ablehnung, gegen die kein Widerspruch mehr zulässig war. Wer seine Ausreiseabsicht nicht aufgeben wollte,
musste einen neuen Antrag stellen. Es gab Familien die schon 10 Mal einen Ausreiseantrag gestellt hatten und immer
wieder abgewiesen wurden. Da meine Söhne, nicht die Absicht hatten in Rohmanen zu bleiben und ich nach 2 Weltkriegen,
an denen ich teilgenommen, die schwere Arbeit auf der Landwirtschaft, nicht aus eigener Kraft schaffen würde, haben wir
1966 wieder einen Antrag gestellt, der prompt abgelehnt wurde. Der Widerspruch auf diese Ablehnung wurde auch negativ
beantwortet, so dass wir 1968 wieder einen Antrag eingereicht haben.
Weil das Passamt in Allenstein lange nichts von sich hören ließ, hegten wir schon die Hoffnung das es jetzt klappen
würde und waren sehr enttäuscht als wieder eine Absage kam. In der Zwischenzeit sind viele Nachbarn und Bekannte aus
Rohmanen, sowie aus der näheren Umgebung, ausgereist und das Häuflein der noch verbliebenen Deutschen, wurde immer
kleiner. Die Motivation, die uns in früheren Jahren, über so manche schwierige Lage hinweg geholfen hat, ist einer
hoffnungslosen Resignation gewichen. Man war davon überzeugt, dass unser Leben, in unser Angestammten Heimat, keine
Zukunftsperspektive mehr haben konnte und wenn wir keine Ausreisegenehmigung bekommen, wir eines Tages die letzten
Deutschen in der ganzen Umgebung sein werden.
Die Ausreise-Heimat ade
Wir hatten die Hoffnung schon aufgegeben, als am 30. April 1969, der Briefträger unseren Hof
betrat und mir einen Brief überreichte, in dem uns das Passamt in Allenstein mitteilte, dass unsere Ausreise in die
Bundesrepublik Deutschland, genehmigt worden ist. Wir müssten, nach Aushändigung der Reisepapiere, den Geltungsbereich
der Volksrepublik Polen, innerhalb von 3 Monaten verlassen. Wir waren zuerst geschockt, über den Hinweis, das wir
unsere Heimat in 3 Monaten verlassen müssen, aber dann stellte sich die Zukunftsperspektive wieder ein und wir gingen,
wie von einem schweren Ballast befreit und gut gelaunt unser weiteren Tätigkeit nach.
Als der Briefträger unseren Hof betrat, waren ich und mein Sohn Kurt gerade dabei eine Fuhre Mist zu laden. Wir hatten
den Wagen gerade halb geladen und haben nach der frohen Kunde nicht mehr weiter gemacht, sondern die Pferde vorgespannt
und den Mist aufs Feld gefahren, damit wir den Wagen für alle Fälle frei hatten. Das war die letzte Tätigkeit für
unsere Landwirtschaft in Ostpreußen.
Die Nachricht von unserer Ausreise verbreitete sich, ohne dass wir darüber gesprochen haben, wie ein Lauffeuer.
Alsbald kamen Leute aus dem Dorf, die sich für das Vieh und für diverse Landwirtschaftliche Geräte interessierten.
Etliche wollten bestimmte Sachen sofort kaufen, andere haben nur zurücklegen lassen und wollten später kommen und
bezahlen, haben es aber dann doch nicht genommen.

Wenn man eine Landwirtschaft hatte, konnte man 2 Pferde, 2 Rinder, 3 Schweine, 5 Schafe und 10 Hühner, in einem
geschlossenen Viehwaggon, in die Bundesrepublik mitnehmen. Jeden Tag war man unterwegs, von einer Behörde zur Andern.
Die Aushändigung der Reisepapiere erfolgte nur nach Vorlage bestimmter Bescheinigungen: Es mussten alle Steuern bezahlt
sein, das Kontingent landwirtschaftlicher Erzeugnisse musste abgeliefert sein, je eine Bescheinigung vom Katasteramt
und vom Notar musste vorgelegt werden, das man dem polnischen Staat das Grundstück abgetreten hat. Die Gebühren für
die notarielle Beglaubigung mussten wir selbst bezahlen. Wenn man alle Bescheinigungen beisammen hatte, bekam man bei
der Kreisverwaltung eine Gesamtbescheinigung. Mit dieser Bescheinigung konnte man nach Allenstein, zur
Polizeikommandantur fahren, wo man nach dem schriftlichen Verzicht auf die polnische Staatsangehörigkeit, einen
Reisepass ausgehändigt bekam, der den Inhaber zum Grenzübertritt berechtigte, aber nicht zur Wiedereinreise.
Wir haben 2 Pferde, eine Sterke, einen Ochsen, 5 Schafe, 2 Schweine und 10 Hühner mitgenommen. Über die Schutzimpfung
der Rinder musste man eine, vom Kreistierarzt beglaubigte Bescheinigung vorweisen. Ich habe 5 Schafsböcke gekauft, die
ich in der Zwischenzeit, hinter der Scheune, zum Weiden angekettet hatte. Einer von denen hat sich losgerissen und
seinen Nachbarn getötet. Das Fleisch konnten wir noch verkaufen, mussten aber dafür einen anderen Schafsbock kaufen.
Innerhalb von 3 Monaten mussten wir alles regeln und zwei Tage vor der Abfahrt einen Eisenbahnwagen, bei der
Eisenbahndirektion in Allenstein bestellen. Reservierungen bei den polnischen Behörden waren meist immer mit
Schmiergeld verbunden, weil man sonst nie sicher sein konnte dass diese Vereinbarungen auch eingehalten werden. Schon
2 Wochen vor unserer Abfahrt, gab es in Ortelsburg keine alkoholischen Getränke zu kaufen. Meine Söhne mussten mit dem
Motorrad die umliegenden Dörfer abfahren, damit wir für die Reise einen Vorrat anlegen konnten; denn Wodka war zu der
Zeit, in Polen, wie eine zweite Währung.
Am 25. Juli haben wir zusammen, mit meinem Neffen Siegfried Brosch, unseren sonstigen Hausrat, der in Kisten verpackt
war, in einen Eisenbahnwagen, auf dem Allensteiner Bahnhof verladen. Alles musste zuerst durch den Zoll, wo die
Federbetten gewogen wurden und über das erlaubte hinausgehende Kissen, verzollt werden mussten. Dasselbe galt auch für
Fleisch und Räucherwaren.
Am 26. Juli, unserem Verladetag, kam der Eisenbahnwagen aus Allenstein, erst um 11 Uhr auf dem Ortelsburger Bahnhof an.
Die Rinder hatten wir zu Fuß, zum Bahnhof gebracht; Schweine, Schafe und Hühner auf dem Pferdewagen. Im Eisenbahnwagen
mussten, mit Hilfe von Brettern und Bohlen, Boxen für die verschiedenen Tiere erstellt werden. Jedes Pferd und jedes
Rind in eine Bucht. Die Schafe zwischen die Pferde, die Schweine zwischen die Rinder und die Hühner in einem Käfig,
unter der Decke über den Rindern. Die Hühner hatten unterwegs Eier gelegt, somit hatten wir jeden Tag frische
Verpflegung. Bei der Fahrt im Viehwagen, begleitete mich mein Sohn Manfred. Als die Lokomotive nahte, um den Wagen
abzuholen, wurden noch schnell die restlichen Sachen hinein geworfen und so mache Abschiedsträne rollte dann die Wange
hinab.
Unsere Nachbarn, Deutsche und Polen, halfen uns beim Verladen des lebendigen Inventars. Jetzt erinnerte ich mich
plötzlich, an die oft auch schönen, Ereignisse der letzten 22 Jahre. Einer Zeit, in der das Zusammenleben von
Deutschen und Polen, von Jahr zu Jahr, besser wurde. Man half sich beim einbringen der Getreideernte, beim Dreschen
des Getreides, bei der Kartoffelernte und bei anderen Arbeiten, wo viele Menschen zupacken mussten. Es war eine
Dorfgemeinschaft, in schweren Zeiten geboren; jeder half jedem wenn Hilfe nötig war. Es wurde mir plötzlich bewusst,
das jetzt ein Lebensabschnitt zu Ende ging, zu dem ich nicht mehr zurückkehren konnte. Unsere Existenzgrundlage war
jetzt ein Eisenbahnwagen auf einem Schienenstrang, dessen Ende irgendwo in weiter Ferne lag. Obwohl, von langer Hand
vorbereitet, war dieser Moment voller Wehmut.
Doch als der Zug sich plötzlich, in Bewegung setzte, war ich sofort wieder in der Gegenwart. Menschen, mit denen man
Jahrzehnte lang, in gutem Einvernehmen zusammen gelebt hat, blieben plötzlich am Bahnsteig zurück und die Entfernung
zwischen ihnen und mir vergrößerte sich mit jeder Sekunde, bis sie letztendlich aus meinem Blickfeld verschwanden.
Es war ein heißer Julitag, als wir unsere Reise gen Westen antraten. Für die Schweine, die besonders unter der Hitze
zu leiden hatten, haben wir 10 Flaschen Essig mitgenommen und sie von Zeit zu Zeit besprenkelt, damit sie besser atmen
konnten. Für die anderen Tiere war reichlich Heu und Hafer vorhanden. Eine großes Fas und zwei Milchkannen waren mit
Wasser gefüllt, die wir auf den an der Strecke liegenden Bahnstationen, bei Bedarf wieder nachgefüllt haben.
Da der Kreistierarzt nicht in seinem Büro war, konnten wir die Impfbescheinigung für das Vieh, nicht rechtzeitig
herbeischaffen. Der Zug setzte sich in Bewegung und die Bescheinigung war immer noch nicht da. Als die Bescheinigung
dann eingetroffen, wir aber schon unterwegs waren, ist mein Sohn Kurt mit dem Motorrad hinterher gefahren und hat uns
in Passenheim, wo der Zug noch andere Wagen angehängt bekam, die Impfbescheinigung übergeben. Wir waren sehr froh das
er es noch geschafft hat, denn in solch einer Situation fühlt man sich sicherer wenn man alle Bescheinigungen bei sich
hat. Auf der Rückfahrt, mit dem Motorrad hatte er noch eine Panne, musste das Motorrad stehen lassen und per Anhalter
nach Hause fahren. Am nächsten Tag kam er mit Siegfried Deptolla, der das Motorrad wieder flott machte und brachte es
wieder nach Rohmanen zurück.
Die Fahrt mit dem Viehwagen, gen Westen
Von Ortelsburg bis Allenstein(45 km) hat unser Zug 4 Stunden gebraucht, weil auf jedem Bahnhof
gehalten wurde, um neue Wagen anzuhängen. Nachdem wir in Allenstein angekommen waren, kam ein Rangierer und fragte
nach unserem Ziel. Als wir ihm mitteilten, das wir in die Bundesrepublik Deutschland wollen, sagte er nur: „In 10
Minuten fährt ein Zug los. Wenn ich von euch 500 Zloty und einen Liter Wodka bekomme, werde euch sofort anhängen,
andernfalls kommt ihr auf ein Nebengleis und müsst dann auf den nächsten Zug warten. Es blieb uns nichts anderes übrig
als seiner Forderung nachzukommen, denn über derartige Erpressungen hat man bereits von Anderen, die vor uns ausgereist
sind, gehört. Wir wurden auch sofort angehängt und fuhren dann die ganze Nacht, an Osterode, und Thorn vorbei bis
Gnesen. Dort wurde wieder rangiert.
Von einer Anhöhe wurden die einzelnen Wagen auf verschiedene Gleise verteilt und zu neuen Zügen zusammengestellt. Der
Aufprall der ungebremsten Wagen erzeugte eine derartige Erschütterung, dass manche Bretter an den Boxen geborsten waren.
Von Gnesen ging es dann in einem Zuge durch bis zur Grenzstation Reppen(Rzepin). Dort mussten wir zum Zollamt, wo
unsere Ausfuhrpapiere durch die Zollbeamten, und durch einen Tierarzt geprüft wurden. Bis Reppen(Rzepin) haben wir für
den Eisenbahnwagen 900 Zloty bezahlt; hier mussten wir noch einmal 650 Zloty bezahlen. Bei der Wagenkontrolle erklärte
uns ein Bahnbeamter das unser Wagen, sich nicht für den internationalen Transport eignet und wir deshalb den Inhalt in
einen Anderen umladen müssen, der irgendwann, auf dem Nebengleis bereitgestellt wird. Nach langer Verhandlung, sowie
einer Zulage von 500 Zloty und einem Liter Wodka haben wir ihn davon überzeugt, das der Wagen sich doch für die
Weiterfahrt eignet.
In der Nacht war Schichtwechsel, der unseren Wagen wieder abgehängt hat, weil er angeblich von der Reichsbahn der DDR,
wegen technischer Mängel nicht weiterbefördert würde. Wir mussten unsere Verhandlung vom Vorabend wiederholen, die mit
der Zusage endete, dass wir am frühen Morgen, über die Grenze auf DDR Gebiet, gebracht werden. Um 5 Uhr morgens kam
eine Lokomotive, die uns den letzten Abschnitt bis über die Grenze bringen sollte. Als der Zug hat noch einmal anhielt,
kamen polnische Grenzbeamte und Soldaten in den Wagen. Sie durchsuchten ihn und fragten, ob wir noch polnisches Geld
oder einen Grundbuchauszug bei uns hätten. Wir zeigten ihnen 800 Zloty, die sie uns, nach Ausstellung einer Quittung
über 500 Zloty, abnahmen. Die Grundbuchauszüge habe ich, im Stroh versteckt, dem Ochsen vor die Füße gelegt. Falls
jemand da suchen sollte, hätte ich gesagt, das das Tier bösartig veranlagt ist, und ich für seine Sicherheit nicht
garantieren könnte, deshalb sollte er vorsichtig sein.
Als die Grenzkontrolle den Zug verlassen hatte, setzte sich die Lokomotive wieder in Bewegung und überquerte nach
kurzer Zeit die Oderbrücke. Auf einer eingezäunten Fläche, jenseits der Grenze, hat man uns abgestellt hat und die
Lokomotive fuhr zurück auf polnisches Gebiet. Vor und hinter uns waren die Tore verschlossen. Auf den Wachtürmen,
links und Rechts von uns, standen Posten mit einem Gewehr im Anschlag. Vier Grenzbeamte der DDR, jeder mit einer
Leiter in der Hand, sowie ein Schäferhund, kamen zu unserem Wagen. Sie öffneten die Schiebetüre, stellten die Leiter
davor und ließen den Hund in den Wagen springen, der nur etwas herum schnupperte und wieder heraussprang. 2 Beamte
haben dann anschließend, die Papiere kontrolliert und das Inventar gezählt.
Nach einiger Zeit wurden wir an einen Güterzug der Reichsbahn angehängt und fuhren von Frankfurt an der Oder, vorbei
an Berlin, Ellingen und Nordhausen, über die Grenze zur Bundesrepublik bis Herzberg. Hier hat ein Zollbeamter der
Bundesrepublik, die Formalitäten erledigt und ein Tierarzt die Pferde, Rinder und Schweine gründlich untersucht. Ich
musste ihnen die Mäuler aufhalten und die Füße hochheben. Danach hat uns die Lokomotive zu einer Wasserzapfstelle
gebracht, wo wir die Tiere tränken und unsere Behälter mit Wasser auffüllen konnten. Anschließen fuhren wir über
Northeim nach Göttingen, zur Viehverwertungsgenossenschaft, die zuvor von unserer Ankunft in Kenntnis gesetzt wurde.
Der Ochse, die Sterke und die Schweine wurden, in Göttingen zum Schlachthof gebracht; die Pferde kamen nach Hannover
und die Schafsböcke nach Kassel. Wir waren mit dem Viehtransport 5 Tage unterwegs; hatten so manche Klippe umschifft
und Schwierigkeiten gemeistert, die im normalen Leben nicht vorkommen.
Wir wurden mit einem PKW, ins Durchgangslager Friedland bei Göttingen gefahren, wo mein Sohn Kurt, meine Schwester
Frieda Pelkowski und Siegfried Brosch mit Familie, die am 30 Juli, um 14 Uhr, von Warschau mit dem Zug abgefahren, und
hier am 31. Juli in den Morgenstunden eingetroffen sind, schon auf uns gewartet haben. In Friedland hat man uns mit
Familie Siegfried Brosch in einem Raum untergebracht, wir wurden registriert und erhielten 20 DM Überbrückungsgeld,
pro Person. Da wir erst am Freitag in Friedland eingetroffen sind, mussten wir hier über das Wochenende bleiben,
obwohl die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der Regel nur 3 bis 4 Tage beträgt.
Um einen Antrag für die Ausreise stellen zu können, brauchten wir eine Einladung von in der Bundesrepublik lebenden
Verwandten. Diese Einladung hat uns mein Bruder, Ernst Rattay, aus Ingelheim am Rhein zugeschickt. Ingelheim liegt im
Bundesland Rheinland-Pfalz. Das Geld für die Bahnfahrt, hat uns, Frieda Schellin, geb. Nickel, aus Duisburg, die
Tochter unseres Nachbarn, überwiesen. In Friedland wurden wir registriert. Im Registrierschein, war als unser
nächster Aufenthaltsort in der Bundesrepublik, das Durchgangslager Osthofen bei Worms, das alle Aussiedler für
Rheinland-Pfalz aufnehmen musste, eingetragen. Die Eintragung erfolgte deshalb, weil der Ort aus dem uns unsere
Einladung zugeschickt wurde, sich auch in Rheinland-Pfalz befand.
Da ich nach dem Polenfeldzug, als Soldat, ein Jahr im Kreis Opladen, im Rheinland gewesen bin, wäre ich sehr gerne in
diese Gegend gezogen, denn die Erinnerung an die schönen Tage die ich dort verlebt habe war in mir immer noch wach.
Ich versuchte die Eintragung in unseren Regiestierscheinen ändern zu lassen, was nach einigen, vielleicht auch
berechtigten Einwänden, am 4. August, vom Beauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen, genehmigt wurde. Anstelle von
Rheinlad-Pfalz stand da jetzt Nordrhein-Westfalen und am 7. August, fuhren wir, noch mit anderen Aussiedlern, ins
Durchgangslager Unna-Massen, am östlichen Rande des Ruhrgebietes gelegen. Hier wurden wir in einem Zimmer untergebracht
und konnten unser Essen in einer Gemeinschaftsküche zubereiten.
Am 8. August wurden wir in Unna-Massen, als Bürger der Bundesrepublik Deutschland registriert, erhielten
Einhundert DM Begrüßungsgeld, den Vertriebenen Ausweis -A -und 4 Wochen später den Bundespersonalausweis. In
Unna-Massen haben wir mehr als 4 Monate verbracht, weil mein Sohn Kurt, wegen fehlender Berufsausbildung, in Unna, an
einem Grundlehrgang für Metallarbeiter teilgenommen hat, der vom Arbeitsamt finanziert wurde. Am 11 Dezember 1969 sind
wir endlich an unserem vorläufigen Wohnsitz, im Durchgangswohnheim, an der Elisabethstraße 13, in Velbert angekommen.
Ab dem 5. Januar 1970 konnten meine Söhne, in der Zahnradfabrik Reining, in Velbert ihrer geregelten Arbeit nachgehen.
Von Bau- und Sparverein in Velbert wurde uns am 20. Juni 1970, unsere erste Wohnung zugewiesen.
Velbert im Februar 1972
gezeichnet: Gustav Rattay
Italien hat Deutschland und Österreich den Krieg erklärt.
Zuerst sind drei Bataillone Österreicher ausgerückt, dann die Deutschen hinterher. Bis zum
Bahnhof Linowa wurden wir von einer Musikkapelle begleitet, dann ging es per Eisenbahn ab nach Baranowitsche. Dort
wurden wir der, an der Westfront aufgeriebenen, 15ten Reserve Division zugeteilt. Es wurde uns gesagt das Kameraden
aus der Heimat gleichen Gruppen zugeordnet werden können. Ich hatte einen Freund aus meinem Dorf, Gustav Spektor,
einen aus Groß Schöndamrau, Wilhelm Lukas und einen aus Ortelsburg, Karl Schlensack, wir kamen zu zusammen in eine
Kompanie. Zuerst waren wir in einem Kinosaal einquartiert, haben jeden Tag Schützengräben ausgehoben und Feldübungen
gemacht. Es war ein sumpfiges Gelände, so dass die Soldaten wegen den vielen Mücken, Netze auf den Köpfen tragen
mussten. Nach einem Gewitter wurde es plötzlich unerträglich. Die Mücken hatten meinen Freund so zerstochen dass sein
Gesicht dermaßen angeschwollen war und ich ihn gar nicht wieder erkannt habe.
Von Baranowitsche wurden wir wieder auf die Eisenbahn verladen, die uns mit unbekanntem Ziel Richtung Osten fuhr.
Nachdem wir unterwegs einmal zum Essenfassen gehalten haben, kamen wir in der Nacht in Krakau an. In der nächsten
Nacht befanden wir uns schon in den Karpaten, wo wir die Hügelketten zu Fuß überqueren mussten, die Fahrzeuge fuhren
um die Berge herum und wir mussten manchmal 2 Stunden warten bis sie uns wieder eingeholt hatten. So ging es immer
weiter bis wir auf einen Berg kamen wo wir Zelte aufgebaut und Biwak bezogen haben. Dort stießen wir auf türkische
Einheiten die auf Mauleseln Munition und Verpflegung über die Berge transportiert haben. Die Esel hatten ein Gestell
auf dem Rücken, auf jeder Seite eine Fass mit Wasser oder Kisten mit Proviant. Ihre Artillerie wurde von 6 Mauleseln
gezogen, während die Offiziere, ohne Sattel, ohne Zaumzeug, nur mit einem Hanfseil ausgerüstet, daher kamen.
Die Mannschaften marschierten wie es jeder für richtig hielt, mit aufgekrempelten Ärmeln, das Gewehr über den Tornister
gelegt, wie die Wilddiebe. Im Gegensatz dazu herrschte bei uns strenge Disziplin, wen jemand aus der Reihe ging kam
sofort der Kompanieführer angeritten, hat uns angeschrieen, uns klar gemacht dass wir keine Türken seien und nur auf
höheren Befehl etwas an der Marschordnung ändern dürften, wer dagegen verstoße, müsste mit einem 3tägigen Arrest
rechnen. Wir haben hinter der der Front Gewaltmärsche durchgeführt die dem Feind große Truppenaufmärsche vortäuschen
sollten.
Wir lagen in einem Buchenwald in Bereitschaft. Überläufer berichteten dass auf russischer Seite eine Großoffensive
vorbereitet wird. In einer Nacht wurde plötzlich Alarm geschlagen, der Russe war zu einem Angriff mit Gasgranaten
übergegangen. Wir lagen unter Zelten und hatten die Gasmasken gar nicht bei uns, sondern nur etwas abseits liegen. In
der Dunkelheit hat mach einer keine Gasmaske mehr gefunden. Es war ein fürchterliches Durcheinander. Dabei war es
unsere Pflicht die Maske immer an dem Tragriemen über dem Hals zu tragen, mit halb geöffnetem Deckel. Uns hat es zum
Glück nicht so stark betroffen weil wir auf einer Anhöhe lagen und die Gaswolken sich im Tal verteilten. Wir wurden in
höchste Alarmbereitschaft versetzt weil der Russe die österreichische Front durchbrochen hatte.
Eigentlich sollten wir noch an einer Gulaschkanone Essen fassen, aber es blieb uns dazu keine Zeit mehr. Der
Kompanieführer befahl uns die Zelte abzubrechen, auf den Tornister aufzurollen und in fünf Minuten marschbereit zu
sein. Die Kanoniere befanden sich schon in der Batteriestellung, luden die Granaten, die sofort abgefeuert wurden. Der
Battalions-Kommandeur versammelte die Kompanieführer und erteilte ihnen die Angriffsbefehle. Derweil sollten wir in
einem Eichenwal der schon mit Granattrichter übersät war, Deckung suchen. Bald hatten wir die Verbindung zu unserem
Batteriestab verloren. Wir warfen unsere Tornister auf einen Haufen, schwärmten unverzüglich, nur mit Sturmgepäck
ausgerüstet, 4 Handgranaten im Brotbeutel, zum Angriff aus. Wir robbten uns einzeln voran. Weil der Russe unsere
Stellungen schon überrannt hatte war jeder auf sich selbst angewiesen. Mann hörte kein Kommando mehr weil der Russe
inzwischen den Rückzug angetreten hatte, um sich auf einer Bergspitze zu verschanzen, von der er uns mit
Flachbahngeschützen beschoss. Irgendwann befanden wir uns in einem Schützengraben, wo ein Leutnant und 17 Mann aus
unserer Division die Stellung hielten. Unter Androhung von Gewalt befahl er uns den Graben sofort zu verlassen und am
Gegenangriff teilzunehmen. Wir sprangen über den Stacheldraht, duckten uns aber sofort im nächsten Graben damit das
mörderische Maschinengewehrfeuer uns nicht hinwegfegte.
Dort blieben wir bis zum Eintritt der Dunkelheit liegen. Wir konnten unsere Waffen nicht mehr einsetzen weil der Sand
die Gewehrschlösser blockiert hatte. Als es Nacht wurde herrschte ein gespenstische Stille. Wir krochen aus dem
Schützengraben und lauschten nach irgendeinem Lebenszeichen von anderen Kameraden. Dann hörten wir irgendwelche Laute
die wir nicht genau zuordnen konnten. Sie kamen aus einem Holzbunker ganz in der Nähe. Wir näherten uns ganz
vorsichtig, als plötzlich eine Schar österreichischer Soldaten herausstürmte. An unseren Stahlhelmen erkannten sie
dass wir Deutsche sind. Bald danach trafen wir auch auf 69 deutsche Soldaten die zu unserer Division gehörten. Dann
kam ein Hauptmann der uns mit Vorwürfen überschüttete, wir seien Feiglinge, wir hätten uns von unserer Einheit entfernt.
Wir haben ihm den Vorgang geschildert, aber ließ nicht mit sich reden und sagte nur dass wir bestraft werden und nichts
zu essen bekommen. Wir wurden einer Maschinengewehr Einheit zugeteilt welche die vorderste Stellung verteidigen
musste. Wir hatten einen Stollen mit 2 Ausgängen.
Die Russen haben bemerkt das sich etwas bewegte und haben uns unverzüglich mit Artilleriefeuer belegt. Schon die
dritte Granate war ein Volltreffer. Vier Kameraden waren sofort tot, ich bekam mit einem Stollenbrett in den Rücken
der sofort blau und grün angelaufen war. Ich schaute nach oben, alles war verschüttet. Ich wusste nicht das da noch
ein Ausgang war, doch die Kameraden die hier in Stellung waren haben mir geholfen das Freie zu erreichen. Ich habe
mich am nächsten Tag krank gemeldet, dachte 2 Tage Schonung zu bekommen, aber der Sanitäter hat mir nur den Rücken mit
Spiritus eingerieben und mich wieder, zurück zu unserer Kompanie geschickt. Sie bestand nur noch aus 3 Gruppen, die in
einem Stollen, der in einen Berg gehauen war, Stellung bezogen hatten. Wir konnten uns hier wenigstens waschen, an
einer Quelle die aus dem Felsen sprudelte. Wir waren nicht mehr einsatzfähig und mussten durch andere Truppenteile
verstärkt werden.
Beim Essen holen musste man auch das Gewehr bei sich haben, es wurde erzählt dass hier der braune Bär herumwandert.
Ich habe keinen gesehen, nur das die Toten ausgescharrt wurden und verstümmelt herumlagen. Nach einigen Wochen haben
die Deutschen eine Gegenoffensive gestartet, von den Bergen herunter, über den Fluss Zlota Lipa, bis zu einer Stadt
die Brzezany hieß. 2 Tage später wurden wir auch eingesetzt, bei großer Hitze ging es in Dauermärschen vorwärts, man
durfte aus den Flüssen kein Wasser trinken, weil es mit Petroleum verseucht war. Nur wenn es dunkel wurde machten wir
halt, dann mussten wir Gräben ausheben um vor Überraschungen sicher zu sein.
Links von uns war Tarnopol und rechts Rumänien. Wenn es nach einer Ruhepause wieder losging dann war es am schlimmsten,
man ging wie auf Nägel, weil die Füße die Strapazen nicht so ohne weiteres wegsteckten. Im Dorf wurde niemals Rast
gemacht, denn da waren immer Brunnen, zu denen alle hinstürmten. Später wurden Melder vorausgeschickt, die von den
Dorfbewohnern Wasser in Eimern am Weg raussetzen ließen, damit die Soldaten Ihren Durst löschen konnten. Ein Soldat hat
gleich den ganzen Eimer mitgenommen und ihn dann als er leer war, irgendwo am Wegrand stehen lassen. Der Kompanieführer
kam angeritten, hat ihn ausgeschimpft und gedroht, ihn mit 3 Tagen Arrest zu bestrafen. Wir gehörten zur Südarmee
welche von Graf Bothmer befehligt wurde.
Die Stellungen waren schlecht ausgebaut, abends mussten wir, von der 2 Kilometer hinter der Front liegenden Feldküche,
Essen und andren Proviant holen. Ich war der Jüngste der Gruppe, musste immer 9 Kochgeschirre tragen, Brot und Post
habe ich in 2 Sandsäcke, die ich über der Schulter hängen hatte, verstaut. Wenn wir unterwegs waren wurde der
Laufgraben immer beschossen. Einmal schlug eine Granate am Schützengrabenrand ein und hat mich halb verschütte, die
Kochgeschirre aus den Händen gerissen, so dass ich ohne Verpflegung im vorderen Graben ankam. Nach drei Wochen sollten
wir abgelöst werden Es hat jeden Tag geregnet, wir haben unsere Mäntel angezogen und uns mit Zelten bedeckt. Nach dem
wir abgelöst wurden kamen wir in ein Dorf dass von Juden bewohnt war. Die Bewohner waren froh dass wir keine Kosaken
waren, mit denen hatten sie vor ein par Tagen schon schlechte Erfahrung gemacht, die hatten ihnen beim Abzug Vieh und
Pferde weggenommen.
Der Boden war sehr fruchtbar, es wurden Hanf, Weizen, Hafer, Mais, Bohnen, Roggen und Kartoffeln angebaut. Die
Bewohner waren gerade mit der Ernte beschäftigt. Die Häuser waren nur aus Holz und Stroh erbaut. Die Leute lebten in
sehr ärmlichen Verhältnissen. Ich hatte mir in unserer Kantine für 20 Pfennig ein Taschenmesser gekauft, das hat mir
ein Bauer für 6 Eier und 2 Pfund Brot abgekauft, daraus hat er sich dann ein Rasiermesser geschliffen. Wenn unser
Versorgungstross auf denn holperigen Wegen nicht nachkam, haben im Dorf auch Verpflegung eingekauft. Die Leute hatten
Angst dass wir nicht bezahlen werden, doch wir bekamen meistens pünktlich unseren Wehrsold ausgezahlt und konnten uns
so manches genehmigen. Um unser Marschgepäck zu erleichtern haben wir so manches aus dem Tornister weg geworfen.
Unweit eines Dorfes wurde halt gemacht, wir sollten Zelte aufschlagen, doch niemand hatte mehr Zeltstöcke im Tornister,
alles war unterwegs liegen geblieben. Der Zugführer befahl uns ins Dorf zugehen und Stöcke zu besorgen. In einer
Scheune stießen wir auf eine Hühnerschar, mit den Stöcken haben wir einige Hühner erlegt, in einem Hanffeld gerupft
und dann im Eiltempo zurück zu unserer Truppe. Als wir ankamen war die Kompanie schon marschbereit, es gleich weiter,
mit dem Huhn im Tornister. Bei der nächsten Rast haben wir die Hühner ausgenommen und Holz besorgt um sie zu kochen,
doch wir mussten schnell wieder weiter marschieren und erst nach 2 Tagen konnten wir uns mit den Hühnern befassen,
leider waren die so alt das sie nicht gar wurden. Das Fleisch mussten wir wegwerfen, nur die Suppe konnten wir noch
gebrauchen.
Meine Verwundung am Pruth.
Wir befanden uns 8 km vor der russischen Grenze. Der Kompanieführer hatte uns informiert das
wir hier zum Einsatz kommen. Wir bekamen noch ein Mittagessen aus der Gulaschkanone, konnten unsere Feldflaschen mit
Tee, der mit Rum angereichert war, auffüllen, Munition und Handgranaten in Empfang nehmen und dann ging es zum Einsatz.
Um 3 Uhr begann das ganze Bataillon auszuschwärmen, sofort hat uns der Russen entdeckt und begann uns mit Artillerie
zu beschießen, je weiter wir vorrückten desto heftiger.
Bis zu einem Eisenbahndamm hatten wir gute Deckung, doch wir sollten den dahinter fließenden Fluss überqueren. Doch
plötzlich explodierte über meinem Kopf eine Schrapnellkugel, der Stahlhelm wurde mir vom Kopf gerissen, Tornister und
Koppel flogen auch weg, ich lag auf der Erde und wusste gar nicht was passiert war. Plötzlich fing Blut aus der
Kreuzbeingegend zu rieseln, aus dem rechten Oberschenkel auch. Gleich nebenan war ein Granattrichter, dort habe ich
Schutz gesucht. In der rechten Rockecke hatte man immer ein großes Verbandspäckchen, das habe ich herausgenommen und
auf die Wunde gedrückt, doch das Blut floss mir bis in den Stiefel. Links und rechts von mir schlugen Granaten ein,
dicke Erdbrocken und Schlamm fielen auf mich herab, doch in meinem Erdloch war ich vor Maschinengewehrsalven geschützt.
Der ganze Rücken war angeschwollen und ich konnte mich überhaupt nicht bewegen.
Die Deutschen mussten die Stellung den Russen überlassen, einer hatte mich entdeckt, da ich aber so blutverschmiert da
lag, hat er bestimmt gemeint ich wäre nicht mehr am leben und ist weitergegangen. Nach zwei Stunden habe ich gehört
das die Russen sich wieder zurückzogen, danach herrschte eine gespenstische Stille. Als es dunkel wurde kamen deutsche
Sanitäter mit Spürhunden und haben die Verwundeten aufgesammelt. Ich wurde auf eine Trage gelegt, lag gebeugt und
konnte mich nicht rühren weil der blutverschmierte Rücken völlig verkrustet war. Ein Pferdegespann konnte nur vier
Tragen befördern, die Fahrt über Ackerfurchen war eine Tortur, ich habe nicht geglaubt das ich es überleben werde. In
einer Dorfkirche wurden wir dann ausgeladen und zu den etwa 50 Verwundeten gelegt die da schon lagen.
Mich haben sie zu den Bauchschüssen gelegt, weil ich einen Nervenschock hatte und am ganzen Körper gezittert habe. Zu
trinken bekam ich nichts, nur einen feuchten Lappen in den Mund. Ich sollte gleich operiert werden, aber es kamen
immer mehr Verwundete, so bekam ich nur eine Tetanusspritze, wurde verbunden und für den Weitertransport ins Hinterland
vorbereitet. Im Morgengrauen wurden wir auf Lastautos verladen, die aus auf ein Landgut brachten, wo wir in einem
Pferdestall untergebracht wurden. Die Fahrer fuhren so schnell über die Granatlöcher, das wir vor Schmerzen geschrieen
haben. Wir baten sie langsamer zu fahren, aber die bekamen es in ihrem Führerhaus nicht mit, erst alt ein Verwundeter,
der einen Krückstock bei sich hatte von hinten die Scheibe einschlug wurde die Fahrt erträglich. Lastautos, die
Munition und Verpflegung an die Front transportiert hatten, brachten in den nächsten Tagen immer wieder Verwundete
ins Hinterland. Die Deutschen hatten an diesem Fronabschnitt hohe Verluste zu beklagen. Wir können von Glück reden
dass wir dem Höllenfeuer überhaupt entkommen sind.
Wir wurden mit Lastautos, die ein Feldlazarett uns geschickt hatte, bis nach Lemberg befördert. da wurden wir gewaschen,
rasiert und frisch verbunden. Auf einem Nebengleis stand ein Lazarettzug, in dem wurden wir anschließend in frisch
bezogenen Betten untergebracht. Der Zug brachte uns über Annaberg nach Freiburg in Sachsen, eine Stunde hinter Dresden.
Hier wurden wir auf Tragen gebettet und mit einem Möbelwagen in ein Reservelazarett transportiert.
Im Heimatlazarett.
Als ich am nächsten Tag aufwachte und das schöne Bett sah in dem ich lag, dachte ich dass ich
im Himmel bin. Ich dankte meinem Herrgott das er mich bis zu diesem Ort begleitet hat. Am Nachmittag kamen Schulkinder
mit Geschenken und haben uns schöne Lieder vorgesungen. Anhand von Röntgenaufnahmen wurde in den nächsten Tagen
festgestellt dass bei mir ein Schrapnellsplitter an der Wirbelsäule in die Kreuzbeingegend eingedrungen war. Ich wurde
jeden Tag in Salzwasser gebadet und bekam wieder volle Verpflegung, da mein Magen zum Glück nicht verletzt war. Auf
dem Transport bekam ich nur Suppe und bei Bedarf einen feuchten Lappen auf die Lippen. Ich bin von 62 auf 43 Kilogramm
abgemagert, gehen konnte ich wegen dem Nervenschock den ich bei der Verwundung erlitten hatte auch noch nicht. Die
Wunde am rechten Oberschenkel war nur ein Streifschuss und wurde mit einem Schutzverband versorgt.
In den nächsten Tagen habe ich einen Brief nach Hause geschrieben und mitgeteilt wo ich mich zurzeit befinde. Meine
Eltern schickten mir ein Paket mit Lebensmitteln, jetzt konnte ich essen was ich wollte. Das Essen im Lazarett war
nicht besonders, jeden Tag nur Kohlblätter. Der weg zu den Toiletten führte durch einen Gemüsegarten. Die gehfähigen
Kameraden haben den ganzen Kohlrabi aufgegessen, so dass schließlich Wachposten aufgestellt werden mussten. Sechs
Wochen lang konnte ich mich nur auf allen Vieren fortbewegen, denn sobald ich mich aufrichtete wurde es mir
schwindelig und ich musste zurück ins Bett.
Als ich wieder bei Kräften war habe ich meinen Eltern mitgeteilt das ich mich in ein Lazarett in ihrer Nähe verlegen
lassen will. Der Chefarzt hatte mir zugesichert, wenn die Möglichkeit besteht in Ortelsburg unterzukommen, wird er dem
zustimmen. Meine Mutter hat daraufhin, in Ortelsburg, beim Lazarettinspektor Zantopf nachgefragt und er hat angedeutet
das sie mich aufnehmen können. Daraufhin bekam ich die Krankenpapiere und einen Fahrschein nach Ortelsburg. Da ich als
Soldat nie Heimaturlaub hatte, beschloss ich zuerst meine Eltern zu besuchen. Ich fühlte mich noch sehr schwach, habe
nach jedem Kilometer Rast gemacht, aber letztendlich war ich wieder daheim bei meinen Eltern. Die Wiedersehensfreude
war sehr groß. Ich bin am 30 Juli verwundet worden und am gleichen Tag wurde mein ältester Bruder beerdigt. Er bekam
den Splitter einer Gasgranate ins rechte Bein und ist an einer Blutvergiftung verstorben.
Am nächsten Tag brachte mich mein Vater ins Garnisonslazarett nach Ortelsburg. Ich wurde jeden Tag gebadet und massiert,
weil die Rückenhaut am Knochen angewachsen war konnte ich mich nicht schmerzfrei bücken. In Ortelsburg verbrachte ich
noch sechs Wochen, bis Ende Oktober, da wurde es schon ziemlich kalt und in unserer Barackenunterkunft ziemlich
ungemütlich. Kohlen und anderes Brennmaterial lagen im Hof auf Halde, aber es war verboten zu heizen. Kameraden die in
der Nähe zu Hause waren konnten Sonntagsurlaub beantragen.
Einer von ihnen brachte von zuhause Brennholz mit und entzündete damit im Ofen ein wärmendes Feuer, andere holten vom
Hof Kohlen, so dass der Ofen in kurzer Zeit glühend heiß wurde und die Gefahr bestand das die Betten Feuer fangen
würden. Wir hatten die Betten schon weg gerückt, da kam der Feldwebel herein und fragte wer das Feuer im Ofen
angezündet hat, doch niemand fühlte sich angesprochen. Der Feldwebel hatte den Vorfall dem Stabsarzt gemeldet, als der
am nächsten Morgen zur Visite kam, war seine erste Frage: ”Wer hat gestern Abend das Feuer im Ofen angezündet”. Als
sich niemand meldete, schrie er uns an: ”Morgen wird alles entlassen, zum Ersatzbatallion, in Diez an der Lahn! Wer
gehen kann, sofort zur Schreibstube, Krankenpapiere und Fahrscheine abholen”. Er erinnerte uns noch daran am nächsten
Tag pünktlich am Bahnhof zu sein, weil eine Verspätung unangenehme Folgen für uns haben würde. Das war das Ende der
schönen Erholungsphase. Ich blieb noch eine Nacht zu Hause und bin dann am nächsten Tag von dort zum Bahnhof gegangen.
Wieder Kriegsverwendungsfähig.
Als wir am nächsten Tag in Diez angekommen waren, wurde ich gefragt ob ich aus dem Heimaturlaub
käme, als ich das verneinte wurden mir 2 Tage genehmigt und 14 Tage Genesungsurlaub dazu. Wieder zurück im
Ersatzbatallion bestand unsere Tätigkeit aus Wache schieben und Kartoffel schälen. Nach einem Monat wurden wir von
einem Generalarzt untersucht, er hat mich für nicht einsatzfähig befunden weil ich noch den Steckschuss im Rücken
hatte und das linke Bein 10 Zentimeter dünner war. Jetzt fing das Kasernenleben wieder von vorne an. Wachdienst,
Gewehr laden, sichern, Ehrenbezeugung, Einzelmarsch und Appell. Wer nicht weit nach Hause hatte bekam zu Weihnachten
Urlaub. Ich hatte zu Heiligabend und Silvester Torwache, denn nach Ostpreußen wurde niemand beurlaubt.
Nach Neujahr 1918 wurden wir neu eingekleidet und kamen nach Köln zur Baukompanie. Mit Musik wurden wir zum Bahnhof
gebracht. In Köln wurden wir noch mit Soldaten die von andern Truppenteilen dorthin verlegt wurden in einem großen
Kinosaal, im Stadtteil Edengarten untergebracht. Wir brauchten keinen Dienst zu machen und konnten zu Heilige Drei
Könige den Gottesdienst im Dom besuchen. Kameraden die aus irgendwelchen Gründen im Arrest saßen wurden gefragt ob sie
auch am Gottesdienst teilnehmen möchten, dann würde ihnen die Strafe erlassen. Fast alle haben dem zugestimmt. Einige
Tage später wurden wir wieder auf einen Transportzug verladen, der uns über Herbestal, Antwerpen nach Brügge in Belgien
brachte. Hier mussten wir den Zug kurzfristig verlassen und einen Luftschutzkeller aufsuchen, weil Fliegeralarm
gemeldet wurde. Danach ging es wieder weiter nach Turut, Kortemark, Hauseme, Kautremollen, Zaren, Zarenlinde. Dort
wurden wir in verschiedene Gruppen aufgeteilt und einer Pionierkompanie auf dem Pionierpark Struwendorf zugewiesen.
Wir haben hinter Klerken Bunker für schwere Maschinengewehre gebaut. Unsere Arbeit konnten wir nur bei Nebel verrichten,
denn bei Sonnenschein waren wir sofort dem Beschuss der feindlichen Artillerie ausgesetzt. eine Kleinbahn die Munition
und Stacheldraht an die Front brachte war dem Beschuss besonders ausgesetzt. Die Gleise, von schweren Geschossen
zerfetzt, mussten immer wieder hergerichtet werden, damit der Nachschub aufrechterhalten werden konnte. Später haben
wir am Kemelberg bei Armentier, eine Brücke über die Lys gebaut. Um in dem Sumpfgelände einen Untergrund dafür zu
schaffen, mussten wir 10 bis 12 Meter lange Pfähle in den Boden rammen. Ein Feldwebel gab immer den Befehl: „Hoch den
Bär, noch viel mehr, dass man sieht, wie er zieht, denn dieser Pfahl, glatt wie ein Aal, durch Fels und Stein, durch
Wasser und Sand, fürs Vaterland”. Jedes mal mussten wir den Bär an Schnüren hochziehen und dann wieder herunterlassen.
Wenn es manchmal, trotz vieler Mühe nicht mehr weiter ging wurde der Pfahl auf eine bestimmte Länge abgeschnitten.
Nach Fertigstellung der Brücke kamen wir in die Siegfriedstellung bei Kambrei, zum Bau eines Bataillons-Gefechtstandes.
Da der Boden kreidehaltig war, mussten wir die großen Stücke von Hand zu Hand reichen, den Schutt haben wir dann mit
Sandsäcken aus der Baugrube gehoben und mit Ästen getarnt, damit der Stand nicht von feindlichen Fliegern entdeckt
werden konnte. Alle acht Stunden wechselte die Arbeitsgruppe. Wir mussten von der Baustelle durch das Gelände robben,
denn aufrecht gehend war man dem Beschuss der feindlichen Scharfschützen ausgesetzt, die von einem Fesselballon aus
informiert wurden der über den feindlichen Linien stand.
Der Wechsel war mit einem großen Risiko verbunden, und wurde wenn Möglich bei Dunkelheit vollzogen. Um vor
Überraschungen sicher zu sein haben wir spanische Reiter (Stacheldrahtverhaue) gebaut und vor die ersten Gräben
gestellt, die dann oft in der Nacht von den Franzosen geklaut, und dann vor ihren eigenen Linien wieder aufbaut wurden.
Wir hatten aus Bohlen eine Brücke auf Rädern gebaut, die dann in den Graben geschoben wurde, damit die Artillerie und
andere Fahrzeuge über die Schützengräben kamen. Weil um vier Uhr morgens der Beschuss mit Gasgranaten begann, mussten
wir Gasmasken aufsetzen, danach haben feindliche Flieger unsere Munitionskolonne bombardiert und total aufgerieben.
Es wurde auch eine Marinedivision eingesetzt, die bis dahin dem Küstenschutz gedient hatte und jetzt ihren ersten
Einsatz hatte.
Wir sind zuerst ein ganzes Stück in Richtung Amiens vorangekommen, doch dann blieb unser Angriff in den zuvor von
Engländern besetzten Stellungen, stecken. Da die Engländer ihre Stellungen fluchtartig verlassen hatten, fiel ihr
ganzer Proviant in unsere Hände; Schokolade, Weißbrot, Flaschenwein. Die erste Nacht haben wir in einem runden Zelt
verbracht, weil ich mir durch den starken Wind, der da herrschte eine Angina zugezogen hatte, die mit hohem Fieber
verbunden war, konnte ich die vielen Köstlichkeiten überhaupt nicht genießen.
An eine ärztliche Versorgung war überhaupt nicht zu denken, denn es mussten zuerst die vielen Granatlöcher eingeebnet
werden damit die vielen Fahrzeuge und Geschütze wieder weiter fahren konnten. Auch eine Bahnlinie musste repariert
werden, damit die großen Geschütze in Stellung gebracht werden konnten, dabei wurden auch die vielen Kriegsgefangenen,
die bei dieser Offensive gemacht wurden, eingesetzt. Als die Offensive dann schließlich scheiterte, wurden wir an die
Somme verlegt. Da habe ich die Ortelsburger Jäger, die aus Italien an die Westfront verlegt wurden, zum ersten Mal im
Einsatz gesehen.
Unser nächster Einsatzort waren dann Stellungen hinter Laon. Hier wurden die Vorbereitungen zu einer neuen Offensive
getroffen. Feindliche Flieger versuchten uns Tag und Nacht daran zu hindern die Aufmarschwege instand zu halten. Als
die Offensive dann endlich losging, hatten wir die Order eine Brücke über die Oise mit Bohlen und Balken zu verstärken.
Gleich am Anfang der Offensive mussten wir Gasmasken anlegen, um für alle Fälle gewappnet zu sein. Nur die Artillerie
und Kraftfahrzeuge durften die Landstraße benutzen, die Infanterie ging immer im Straßengraben und wurde von einer
Seite von Kopf bis Fuß mit Dreck bespritzt. Die Franzosen und Engländer haben hier schon Panzer eingesetzt, die von
Truppen aus den Kolonien gefahren wurden. Die Australier gingen mit umgekrempelten Ärmeln hinter den Panzern her.
Die letzte Offensive des Ersten Weltkrieges.
Zum Jahresende 1917 hatten noch 153 deutsche 175 alliierten Divisionen gegenübergestanden.
Zur Vorbereitung der Offensive ließ Ludendorff 39 Divisionen aus dem Osten und aus Italien heranziehen. Er ließ
spezielle Angriffsdivisionen formieren, die durch intensive Ausbildung auf den beabsichtigten, schnellen Vormarsch
vorbereitet wurden. 6608 Geschütze, 3500 Minenwerfer und 1070 Flugzeuge wurden hinter dem vorgesehenen
Angriffsabschnitt konzentriert. Den Ausbildungsbefehlen Ludendorffs, die bis zu den Kompanieführern herab verteilt
wurden, konnte man entnehmen, dass der Versuch, den Krieg mit einem mächtigen Schlag zu entscheiden schon in der
nächsten Zeit gewagt werden sollte. Wir übten die fast vergessenen Formen des Schützengefechts und des
Bewegungskrieges, auch wurde eifrig mit Gewehr und Maschinengewehr geschossen. Wir hegten keinen Zweifel daran, dass
der große Plan gelingen würde.
Den ganzen Winter 1917/18 über plante der Generalquartiermeister Ludendorff die deutsche Offensive. Zwar hatten die
Vereinigten Staaten von Amerika dem Deutschen Reich am 6. April 1917 den Krieg erklärt, aber vor dem Sommer des
Jahres 1918 war mit dem Auftreten von US-Truppen in relevanter Größenordnung nicht zu rechnen. Der deutschen Führung
blieb nur ein schmales Zeitfenster, um die Niederlage und den zu erwartenden Diktatfrieden abzuwenden. Ypern,
Armentieres, Arras, Cambrai oder Verdun wurden ernsthaft als Schauplätze erwogen. Ludendorf entschied sich für einen
Angriff zwischen Cambrai und La Fere – genau an der Nahtstelle zwischen der Französischen Armee und dem britischen
Expeditionscorps.
Der Fluss Somme bildete die Grenze zwischen Franzosen und Briten. Die Briten – nicht die Franzosen – sollten das Ziel
des Vorstoßes werden. Ihre Stellungen waren nur 130 Kilometer von der Kanalküste entfernt. Beim erreichen der
Sommemündung wäre die gesamte britische Armee eingeschlossen gewesen, denn hinter ihnen lag die Straße von Dover.
Am 21. März 1918 begann die letzte entscheidende Offensive des deutschen Westheeres im Ersten Weltkrieg. Der
Angriffsstreifen war 75 Kilometer breit. Dort hatte Ludendorff 43 Angriffsdivisionen konzentriert, dahinter 30
weitere Reservedivisionen, ihnen standen lediglich 26 britische Divisionen gegenüber. „Michael“ – so der Deckname der
„Kaiserschlacht“ – lief dank Ludendorffs akribischer Vorbereitung gut an. Der britische Oberbefehlshaber General
Douglas Haig erkannte die Chance, welche die Deutschen in dieser Situation hatten. Wollten die Deutschen diese Chance
nutzen, mussten sie darauf verzichten die Somme zu überschreiten, wo sie auf die französischen Reserven treffen und
sich von der Küste entfernen würden. Genau diesen Fehler begingen jedoch die Deutschen.
Am dritten Tag überschritt der linke Flügel mit der 18. Armee die Somme. Ludendorf stellte die Taktik über die
Strategie, wie er das bei Tannenberg und der Schlacht an den Masurischen Seen auch schon getan hatte. Ludendorffs
Befehl an die 18. Armee vom Abend des 22. März 1918 lautete: „Jetzt gilt es den Sieg auszunutzen, den Feind nicht zum
Stehen kommen zu lassen, Somme und Crozat-Kanal zu überschreiten, bevor feindliche Verstärkungen wirksam werden“.
Was Haig befürchtet hatte, trat nicht ein. Die deutsche Offensive Lief weiter Richtung Süden und lief sich schließlich
tot. Am 31 März war Ludendorff zu der Erkenntnis gekommen, dass „Michael“ gescheitert war. Am 5. April wurde die
Einstellung der Offensive befohlen. Im Hochsommer waren die US-Truppen in Frankreich angekommen und gingen mit den
Franzosen zum Angriff vor. Nur mühsam konnten Hindenburg und Ludendorf den Zusammenhalt der Front waren. Am 24. Oktober
1918 forderte US-Präsident Woodrow Wilson die bedingungslose Kapitulation, am 11.Nuvember Wurde der Waffenstillstand
von Compiegne unterzeichnet.
Zusammenbruch der Westfront und Waffenstillstand .
Als die Offensive dann letztendlich gescheitert war, wurden wir auf Eisenbahnwaggon verladen, in
eine Stellung vor Verdun gebracht und der siebenten bayerischen Division zugeteilt. Als wir ausgeladen wurden nahm der
Franzose den Bahnhof unter Beschuss. Eine Granate traf einen Waggon der mit Seifenpulver beladen war, so dass der ganze
Bahnhof aussah als wäre gerade Neuschnee gefallen. Wir gingen auf die Suche nach Kartoffeln. Als ich mit einem Sack,
vollbeladen die Böschung runter ging um zur Feldküche zu gelangen, schlug unweit von mir eine Granate ein und riss mir
den Sack vom Rücken. Ich bin mit dem Schrecken davon gekommen, mir war nichts passiert.
Der Bahnhof war menschenleer, nur ein par Kaninchen liefen verschreckt durch die Gegend und einigen Kameraden gelang
es welche einzufangen. Am nächsten Tag gelang es uns endlich die Feldküche zu erreichen. Als wir gerade beim Essen
fassen waren, schlug unweit eine Granate ein so dass Pflastersteine das Dach durchschlugen und wir das Weite suchen
mussten. und wir wieder nichts zu Essen bekamen. Ein Friseur aus unserer Kompanie fuhr immer ins Hinterland um uns
mit Proviant zu versorgen. Als er 14 Tage vor dem Zusammenbruch wieder mal zurückkam erzählte er uns schon das der
Krieg nicht mehr lange dauern würde, weil Kaiser Wilhelm mit Frack und Zylinder bekleidet, Deutschland verlassen und
ins Ausland gehen würde. In unserer Einheit hatten wir auch einen Juden der glaubte dass er sich alles erlauben darf.
Eines Morgens ging er in die Küche, als er keinen Koch vorfand stieg er auf die Gulaschkanone und hob den Deckel vom
Kessel in dem der Kaffee kochte an. Der kochende Kaffee verbrühte seine Füße so sehr das er sofort ins Lazarett musste,
für ihn war der Krieg somit zuende. Es kam noch ein Erlass, das Kameraden die 2 Jahre aktiv gedient hatten und
Gefreiter waren sofort zum Sergeanten befördert wurden. Für den 11. November 1918 war ein Waffenstillstand vereinbart
und ab 11 Uhr sollte nicht mehr geschossen werden. Wir hatten unsere Kopfkissen aufgetrennt und eine Kissenschlacht
veranstaltet, um auf diese Art und Weise unserer Freude Ausdruck zu verleihen. Als die Federn durch die Luft flogen
brachen wir in Tränen aus.
In jeder Kompanie wurde ein Soldatenrat gewählt, der aus drei Mann bestand. Wenn der Kompanieführer jemanden bestrafen
wollte, musste er erst den Soldatenrat fragen, der die Strafe befürworten, aber auch ablehnen konnte. Die Offiziere
durften keine Achselstücke mehr tragen, was für sie einer Degradierung gleich kam. Wir waren in einem Dorf
einquartiert und morgens zum Appell angetreten, als einer vom Soldatenrat sich stockbesoffen vor den auf dem Pferd
sitzenden Kompanieführer stellte und schrie: „Alles hört auf mein Kommando”. Der Kompaniechef war wie vom Blitz
getroffen, ihm versagte die Stimme. Wir sahen ein das dies nicht so weiter gehen kann und wählten einen neuen
Soldatenrat. Unser Rückzug begann bei Konflanz, einer Vorfestung von Metz und führte uns zunächst über die
luxemburgische Grenze, wo wir in einem Ort einquartiert wurden. Als wir für die Küche Holz aus dem Wald holen gingen,
entschieden wir uns eine Eiche abzusägen, ohne uns dessen bewusst zu sein, in welchem Forst wir uns befanden. Als wir
beim fällen waren fielen plötzlich Schüsse, die wir auch sofort erwiderten, bis uns ein Elsässer der sich in unserer
Kompanie befand aufklärte: „Kameraden, wir befinden uns hier auf Luxemburgischem Hoheitsgebiet”.
Wir sind dann weiter durch das Fürstentum Birkenfeld marschiert, wo das Städtchen Merzig für uns geflaggt hatte. Das
Elsass haben wir auch noch kurz gestreift. Wo wir bei einem Bauern, der uns kein Stroh für das Nachtlager geben wollte,
einquartiert wurden. Daraufhin gingen wir in die Scheune und haben uns selbst was besorgt. Wir haben dann noch erfahren,
sie hätten ein Schwein geschlachtet und warteten auf den Einzug der Franzosen. Als wir uns 1917, an der Ostfront, in
den in Karpaten, im Einsatz befanden, waren unter uns auch viele Elsässer. Sie durften ihre Heimatpost nicht in
französischer Sprache schreiben, mussten ihre Briefe offen auf der Schreibstube abgeben, wo sie zuerst kontrolliert
und dann abgeschickt wurden. Als ich in einer Nacht, mit einem Elsässer auf einem Vorposten Wache schieben musste,
wollte er mich überreden zum Russen überzulaufen. Als ich darauf nicht eingehen wollte verschwand er plötzlich in der
Dunkelheit und ich habe ihn nie wieder gesehen.
Wir sind dann weiter Richtung Worms und Ludwighafen gezogen, dort wurden wir bei einem Mühlenbesitzer einquartiert,
ein Unteroffizier und vier Mann. Obwohl wir verlaust und verdreckt waren bestand die Müllerin darauf das wir in ihren
Betten übernachteten. „Wenn alles durch ist”, sagte sie, „werde ich alles gründlich reinigen”. Der Müller brachte uns
eine Gießkanne voll Wein und sagte wir sollen es uns Schmecken lassen. Wir haben reichlich davon Gebrauch gemacht, so
dass ich gar nicht weiß wie ich ins Bett kam. Das war meine Erinnerung an die Pfalz. Manchmal waren wir auch 2 Tage im
Quartier.
Vor dem Weitemarsch wurde uns immer gesagt welche Truppe die Vorhut und welche Truppe die Nachhut übernehmen sollte.
Die Nachhut hielt immer Verbindung zu den nachrückenden Franzosen und man muss staunen wie alles reibungslos, ohne
Zwischenfälle von statten ging, was wir in erster Linie dem General-Feldmarschall Paul von Hindenburg zu verdanken
haben, der den Rückzug an der Westfront koordiniert hat.
In Köln angekommen, erhielten wir im Volkshaus unsere Entlassungspapiere, Eisenbahnfahrscheine, Reisepässe,
unterschrieben von Oberstleutnant Mann. Wir mussten Köln umgehend verlassen, weil schon am nächsten Tag die
französischen Besatzungstruppen in einmarschieren sollten. Wir fuhren mit einem Zug der bis Allenstein fuhr, dort
wurden unsere Papiere vom Soldatenrat kontrolliert. Die jüngren Jahrgänge wurden festgehalten, zu neuen Einheiten
zusammengestellt und zur Sicherung der Ostgrenze gegen die Bolschewisten abkommandiert. Ich hatte gesagt das ich noch
einen Schrapnellsplitter in der Kreuzbeingegend habe und durfte daraufhin nach Hause fahren.
Kaum in Ortelsburg angekommen fiel ich wieder dem Soldatenrat in die Hände. Sie haben alles durchsucht, haben mir mein
Seitengewehr und eine Decke abgenommen, aber ich durfte weiter und bin dann kurz vor Weihnachten 1918 auf dem
elterlichen Hof angekommen. Schon auf dem Hof habe ich meine Kleider vom Leib gerissen, weil vor Läusen und anderem
Ungeziefer nicht mehr aushalten konnte und mich erst gründlich gewaschen bevor ich das elterliche Haus betreten habe.
Die Freude über das Wiedersehen war sehr groß.
“ Unser Leben zwischen den beiden Weltkriegen.”
Endlich wieder zurück in der Heimat
Rohmanen war durch die Kampfhandlungen 1914/15 zu einem drittel zerstört worden, aber schon
wieder im Aufbau. Die Firma Grzella aus Ortelsburg hatte die Bauarbeiten übernommen. Unter der Aufsicht von Polier
Karl Kontor wurden die Dachstühle errichtet. Ich habe mich, nach kurzer Erholungspause, auch als Zimmermanngehilfe am
Wiederaufbau beteiligt. Die Firma Grzella hat das Material geliefert und auch unsere Löhne gezahlt. Wegen meinem
Steckschuss bin ich dem VDK beigetreten und habe mit dessen Hilfe eine Rente beantragt die mir auch bewilligt wurde.
Nach vier Jahren wurde ich nach Allenstein zur Nachuntersuchung vorgeladen. Die ärztliche Untersuchung hatte ergeben,
das Geschoß sei verkapselt, und nur das linke Bein etwas in Mitleidenschaft gezogen. Daraufhin wurde die Rentenzahlung
eingestellt.
Der Stellmacher Adam Ornowski war im Krieg als Sanitäter eingesetzt und hatte auf Grund seiner Erfahrungen,
 Beziehungen zum medizinischen Dienst in Ortelsburg aufgebaut. Es wurden dort Lehrgänge in Erster Hilfe angeboten,
die von Prof. Dr. Kutz geleitet wurden. Adam Ornowski hat dafür gesorgt das einige junge Männer aus Rohmanen daran
teilnehmen konnten. Adam Ornowski, August Linka, Emil Rosowski, Johann Dembek, Emil Baschek und ich sind dann dem
Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes beigetreten und mussten jeden Sonntag am Lehrgang teilnehmen. Unser
Gruppenführer war Kreisobersekretär Albrecht, Landrat von Poser, als unser Ehrenvorsitzender, hat viel zu unserer
finanziellen Unterstützung beigetragen und hat dafür gesorgt dass die Bereitschaft eingekleidet wurde.
Beziehungen zum medizinischen Dienst in Ortelsburg aufgebaut. Es wurden dort Lehrgänge in Erster Hilfe angeboten,
die von Prof. Dr. Kutz geleitet wurden. Adam Ornowski hat dafür gesorgt das einige junge Männer aus Rohmanen daran
teilnehmen konnten. Adam Ornowski, August Linka, Emil Rosowski, Johann Dembek, Emil Baschek und ich sind dann dem
Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes beigetreten und mussten jeden Sonntag am Lehrgang teilnehmen. Unser
Gruppenführer war Kreisobersekretär Albrecht, Landrat von Poser, als unser Ehrenvorsitzender, hat viel zu unserer
finanziellen Unterstützung beigetragen und hat dafür gesorgt dass die Bereitschaft eingekleidet wurde.
In jedem Dorf wurde eine Unfallstelle eingerichtet, mit einem Verbandskasten und mit Verbandsmaterial für die erste
Hilfe ausgerüstet. Die Unfallstelle in Rohmanen, die am Haus von der Straßenseite, durch eine Tafel mit einem roten
Kreuz gekennzeichnet war, hatte ich zu verantworten. An Sonntagen wurden wir an Badestellen und bei Fußballspielen
eingesetzt, haben viele Übungen bei Waldbränden durchgeführt und auch Ausflüge nach Rudzany am Niedersee gemacht. Bei
der Einweihung des Tannenbergdenkmals in der Nähe von Hohenstein kamen wir an Straßenkreuzungen zum Einsatz.
Rohmanen hatte auch eine freiwillige Feuerwehr. Bis zum ersten Weltkrieg hat Friedrich Biella als Brandmeister das
Kommando gehabt. Er war aktiver Unteroffizier, hatte gute Führungsqualitäten und die Männer, die allesamt aus dem
aktiven Militärdienst stammten hatten zu ihm ein großes Vertrauen. Nach dem Krieg wollten diese Männer,
(Friedrich Nickel, Friedrich Willam, Julius Wittkowski, Jakob Janowski, Johann Gloddek, Gustav Bednarz), nicht mehr
weitermachen. Friedrich Biella, der inzwischen zum Gemeindevorsteher gewählt wurde, hat sich dann auf einer
Gemeinderatsitzung vorgeschlagen, für die Freiwillige Feuerwehr jüngere Kräfte anzuwerben.
Zum Brandmeister hat er Herrn Wilhelm Pilath vorgeschlagen. Der wurde dann nach Königsberg zur Fortbildung geschickt.
Der Feuerwehr gehörten nun folgende Personen an: Wilhelm Pilath(Brandmeister), August Linka(Stellvertreter), Gustav
Deptolla, Julius Matzey, Johann Dembek, Willy Willam, Gustav Rattay. Der Kreisbrandmeister war Heinrich Thalmann aus
Ortelsburg, sein Stellvertreter war Kreisobersekretär Salzmann. Der Bezirks-Kommissar bei der Ostpreußischen
Feuersozität War Herr Ernst Trzaska. Er hat dafür gesorgt das die Wehr uniformiert und mit Löschgeräten ausgerüstet
wurde. Da die alten Schläuche schon sehr marode waren, wurden sie durch moderne ersetzt, deren Kupplungen auch mit der
Motorspritze übereinstimmten.
Ernst Trzaska hat bei der Feuersozität und beim Landratsamt Finanzmittel beantragt und auch genehmigt bekommen. Der
Schneidermeister Wilhelm Baran wurde beauftragt Tuch und Drillichanzüge nach Maas zu schneidern. Er hat uns
Stoffmuster vorgelegt aus denen wir wählen sollten. Feuerwehrhelme haben wir auch bekommen. Die Gemeinde musste
Finanzmittel bereitstellen, einen Prozentsatz vom Gemeindebudget. Im Brandfall mussten für den Spritzenwagen Pferde
zur Verfügung stehen, von Willy Willam, Gustav Rattay, Julius Matzey und Gustav Dorka, weil sie in der Nähe des
Spritzenhauses wohnten. Am Spritzenhaus wurde ein großer Baum mit Querleisten aufgestellt, wo nach jedem Brand oder
einer größeren Übung die Schläuche zum trocknen aufgehängt wurden.
Der Kreisbrandmeister hat mindestens 2-3-mal im Jahr die Wehren besichtigt. Das ganze Dorf war dann auf den Beinen,
die Bauern mit Pferden, und andere Dorfbewohner mit Eimern und Spaten, wurden dann in verschiedene Gruppen eingeteilt.
Erst hat die Wehr sämtliche Aufstellungen am Gerät geübt; Grundstellung Fahrstellung und Marschstellung. Dann wurde
ein Brand angekündigt, die Feuerwehr mit der Spritze an den Brunnen, die Gruppen dort wohin sie beordert wurden, die
Bauern brachten mit den Wasserkiwen Wasser aus dem Brunnen zum Brandort. Wenn das Wasser im Brunnen alle wurde hat
man den Saugkorb in die Kiewen gelegt und dort Wasser entnommen. Die Wassergruppe ging mit Eimern zum Dorfteich, holte
Wasser und füllte damit die leeren Kiewen.
Der Löschtrupp ging mit Feuerhaken und Löschpatschen auf die umliegenden Gehöfte und versuchte das vermeintliche Feuer
von ihnen fernzuhalten. Nach dem Alarm wurde wieder am Spritzenhaus angetreten. Die Gruppenführer mussten angeben ob
ihre Gruppe auch vollständig erschienen war, denn Übungen wurden nur vor, oder nach der Feldarbeit durchgeführt, so
dass niemand eine Entschuldigung vorbringen konnte. Wer ohne begründete Entschuldigung nicht anwesend war erhielt eine
Verwarnung. Der Kreisbrandmeister erklärte dann welche Handgriffe den Vorschriften entsprachen und welche nicht. Die
Schläuche wurden noch schnell zum Trocknen aufgehängt. Anschließend gingen wir alle in den Gasthof Trzaska, haben über
vorhandene Mängel diskutiert, Verbesserungsvorschläge unterbreitet und zwischendurch den Durst gelöscht. Der
Kreisbrandmeister ist dann, nach einer kurzen Verabschiedung, ins nächste Dorf gefahren, weil er an einem Tag mehrere
Feuerwehren betreuen musste.
Der Rohmaner Dorffriedhof

Einen Kilometer vom Ende des Dorfes entfernt, auf der rechten Seite der Landstraße in Richtung
Ortelsburg, befand sich der Rohmaner Dorffriedhof. Wann dieser Friedhof angelegt wurde entzieht sich meiner Kenntnis.
Nach Aussagen älterer Dorfbewohner soll davor auch schon eine Ruhestätte vorhanden gewesen sein, und
zwar auf der linken Straßenseite gegenüber dem jetzigen Friedhof. An dieser Stelle befand sich bis in die
Nachkriegszeit ein kleiner Brunnen, aus dem die Dorfbewohner, das Wasser zum begießen der Grabbepflanzung auf den
Gräbern ihrer verstorbenen Angehörigen holten. Der Friedhof war in einer Hanglage angelegt, wahrscheinlich weil diese
Parzelle für eine landwirtschaftliche Nutzung nicht geeignet war. Um das Gräberfeld vor herumstreunenden Tieren oder
von der Weide entlaufenen Kühen zu schützen, hat man das ganze Gelände mit einem Holzzaun umgeben. Der Zugang befand
sich von der Straßenseite. Unter einem Torbogen hindurch wurden die Verstorbenen zu Grabe getragen. Die Gräber der
einzelnen Familien waren nebeneinander angelegt, mache, wie zum Beispiel die der Familie Trzaska, sogar mit einem
schmiedeeisernen Zaun eingefasst.
Nach dem 2. Weltkrieg verfiel der Friedhof immer mehr. Die nötigen Finanzmittel für die Pflege der Einfriedung konnten
von den restlichen noch verbliebenen Deutschen nicht mehr aufgebracht werden. An den gepflegten Gräbern konnte man noch
erkennen dass es Verwandte von noch in Rohmanen wohnenden Deutschen waren, oder von bereits im Westen Deutschlands
lebenden, die ihre noch in Rohmanen wohnenden Nachbarn damit beauftragt hatten. Die übrigen Gräber wurden von Jahr zu
Jahr immer mehr von Wildkräutern überwuchert und schließlich auch von Sträuchern und schnell wachsenden Bäumen.
In den späteren Jahren konnte man nicht mehr erkennen dass dort vor Jahren Tote zur letzten Ruhe gebettet wurden. Die
Natur holte sich das ganze Gelände zurück und nur unter großen Schwierigkeiten konnten Besucher aus dem Westen das
Friedhofsgelände noch betreten.
Das Gasthaus Trzaska

Nach dem ersten Weltkrieg hat der Gastwirt Friedrich Trzaska neben dem Gasthof einen großen Saal
für Festlichkeiten und Vereinsfeiern gebaut, in dem schon mal Feuerwehrfeste veranstaltet wurden. Ernst Trzaska war
Feuerkommissar bei der Ostpreußischen Feuersozität. Erich Trzaska war Vollziehungsbeamter beim Amtsgericht in
Ortelsburg. Unser Feuerkommissar war uns beim organisieren der Veranstaltungen sehr behilflich, hat uns den Saal, die
Musik und die Theaterstücke besorgt und die Feuerwehren aus den Nachbardörfern eingeladen.
Zu Manöverzeiten, vor dem 2. Weltkrieg und dann auch während des Krieges, waren im Gasthof Soldaten, meist im Range
eines Offiziers, einquartiert. Fräulein Mariechen Trzaska hat die Poststelle im Dorf betreut. Nachdem ich 1939 zum
Militär eingezogen wurde, hat sie, nach einer Schulung im Ortelsburger Krankenhaus, auch die Unfallmeldestelle
übernommen. Nach dem Krieg, pflegte sie mit vielen Bekannten, die bereits in der Bundesrepublik wohnten, einen regen
Briefwechsel. Auf dem Rohmaner Friedhof hat sie viele Gräber, im Auftrag von Angehörigen, die auf Grund ihrer
Abwesenheit, dazu nicht mehr in der Lage waren, gepflegt. Der Bauunternehmer Kurnitzki aus Ortelsburg, äußerte die
Bitte, sie möchte ihm doch ein Blatt vom Rosenstrauch, der auf dem Grab seiner Eltern steht, in den Brief legen. Als
sie uns den Brief vorgelesen hat, waren wir zu Tränen Gerührt. Sie hat als Letzte aus ihrer Familie, bis zu ihrem Tod
im Jahre 1960, in Rohmanen, im Gebäude der Gastwirtschaft gewohnt und ist auf dem Rohmaner Friedhof beerdigt worden.
Fleisch und Wurstwaren Karl Pelkowski
Im Jahr 1931 hat der Fleischermeister Karl Pelkowski, aus Grammen, direkt neben unserem Hof ein
Anwesen gekauft und dort eine Fleischerei eingerichtet. Er war mit meiner Schwester Frieda, verheiratet. Am Anfang hat
er die Schweine noch auf seinem Hof geschlachtet, später dann im Ortelsburger Schlachthof. Jede Woche fuhr er 2-mal,
mit dem Pferdewagen(Einspänner), nach Ortelsburg zum Wochenmarkt, wo er seine Fleisch und Wurstwaren zu Verkauf anbot.
Am Tag davor, wenn er die Wurst gekocht hat, kamen viele Rohmaner mit Kannen oder anderen Gefäßen, wegen der guten
Wurstsuppe, die er umsonst unter die Leute verteilte. Als Karl Pelkowski, Ende August 1939 zum Militär eingezogen
wurde, hat seine Frau das Pferd verkauft und den Beitrieb stillgelegt. Am Haus hing, immer noch die Tafel mit der
Aufschrift: Karl Pelkowski, Fleisch und Wurstwaren. Ein Witzbold hat irgendwann darunter geschrieben; „Fleisch und
Wurst waren einmal”, drauf hin hat Frau Pelkowski die Tafel entfernen lassen. Karl Pelkowski ist im Mai 1946 in
französischer Gefangenschaft verstorben. Seine Ehefrau Frieda, verstarb an ihrem 85. Geburtstag in Mettmann bei
Düsseldorf.
Die steinreichen Rohmaner Felder
Die letzte Eiszeit hat bei der Schmelze, auf der Rohmaner Feldgemarkung viele Steine und
Granitblöcke zurück gelassen. Überirdisch, aber besonders unter der Erde, gab es viele kleine, aber auch große Steine,
die, den Bauern, beim Pflügen und anderen Feldarbeiten sehr viel Schweiß, abverlangten. In einer Kiesgrube, auf dem
Feld des Bauern August Radek, lag ein Granitblock, von schätzungsweise 100 cbm. Vor etwa 80 Jahren, als man für diese
Steine noch keine Verwendung hatte, griffen die Bauern zu einer „List”. Weil er sonst nicht pflügen konnte, hat mancher
seinem Nachbarn, die Steine in der Nacht auf dessen Feld abgeladen. Als diese Tätigkeit unter Strafe gestellt wurde,
hat man die Steine in Schluchten gekippt und mit Mutterboden zugeschüttet. In späteren Jahren kam diese jedoch beim
pflügen wieder an die Oberfläche. Dann hat man aber schon Steine für den Straßenbau gebraucht und konnte sie so zu Geld
machen. Besonders im Raum südlich von Ortelsburg, bis zur polnischen Grenze, wo Steine eine Rarität waren, kamen sie
jetzt zum Einsatz. Auch beim Bau von Häusern, besonders für die Fundamente, wurden sie eingesetzt, weil auf diese
Weise viel Ziegeln eingespart wurden. Die Firma Gribienski aus Ortelsburg hat die großen Steine mit Dynamit gesprengt
und auf diese Weise die weitere Verarbeitung erleichtert.
Die Steine welche beim Pflügen aus dem Boden geholt wurden, hat man am Feldrand auf große Haufen zusammen getragen.
Wenn die Feldarbeit beendet war, sowie auch in den Wintermonaten, waren wir jeden Tag mit Steinen unterwegs. Wir sind
vorwiegend am Abend los gefahren, weil unter der schweren Last die Wagenachsen so heiß wurden und die Gefahr bestand,
das durch die Dehnung, die Räder blockiert würden. Bei einer Fahrt konnte man bis zu 24 Reichsmark verdienen, wogegen
1 Zentner Roggen für 8 bis 9 Reichsmark zu haben war. Ich bin selbst, mit dem Pferdewagen bis Fürstenwalde, Radostowen,
Luka, Altkirchen, Höhenwerder, ja sogar bis Friedrichshof gefahren.
In Rohmanen wurden auch rote Ziegeln gebrannt. Viele Häuser wurden, mit Ziegeln erbaut, die nur wenige 100 Meter von
der Baustelle entfernt hergestellt wurden. Der Lehn wurde auf den Feldern in der näheren Umgebung entnommen, dann von
Ochsen solange getreten, bis er so geschmeidig war, das er sich in Formen einstreichen ließ. Wenn die Ziegel in der
Form trocken war, wurde sie entnommen und in einem Brennofen gestapelt. Um einen Ofen richtig anzufeuern, brauchte man
12 Raummeter Holz, das im Zeitraum von ein par Tagen verheizt wurde. Der Fischer Karl Glitza hatte schon eine
Knetmaschine, die von einem Pferd angetrieben wurde, das mit verbundenen Augen, den ganzen Tag in die Runde ging.
Im Dorf waren auch vier Kalköfen, in denen so genannte Kalksteine, die sich an gewissen Stellen, im Erdboden befanden,
gebrannt wurden. Nach dem Brennen wurden die Steine mit Wasser abgelöscht und die daraus entstandne Masse diente, nach
dem Beimischen einer gewissen Menge Sand, dann als Bindemittel beim Häuserbau. Das Gerichtsgebäude und das
Lehrerseminar in Ortelsburg wurden mit Kalk, aus dem Rohmaner Brennöfen erbaut. Auch zum Bau einer Eisenbahnbrücke, auf
der, der Zug, den Sawitzfluß, von Ortelsburg nach Allenstein überquerte, hat mein Großvater, mit einem Ochsengespann,
Kalk gefahren.
Hinter der Scheune, beim Bauern Johann Dembek hat man Tonerde gefördert, aus der man mit Hilfe einer Formerscheibe,
die von einem Arbeiter mit Muskelkraft(Fußbetrieb) angetrieben wurde, schöne Krüge, Schalen und Vasen geformt hat.
Die Töpferware wurde, nachdem sie trocken genug war, auch in einem Ofen gebrannt, anschließend mit einer Lasur
überzogen und wieder gebrannt. Es wurden auch Kacheln zum Bau von Kachelöfen hergestellt, die mit verschiedenen
Ornamenten versehen, die Wohnstuben unserer Vorfahren schmückten. So haben unsere Großväter ihr Leben gemeistert und
nach und nach, unsere Dörfer aus der Rückständigkeit in die Neuzeit geführt.
Das gesellschaftliche Leben nach dem 1. Weltkrieg

Als der Lehrer Alfred Dorka, ein Frontkämpfer des Ersten Weltkrieges und ein Sportsmann, als
zweite Lehrkraft an der Rohmaner Schule angestellt wurde, hat er die Sitten und Gebräuche aus früherer Zeit wieder zum
Leben erweckt. Zuerst hat er die Jugend zusammen gerufen, einen Jugendverein und einen Fußballclub, gegründet. Zum
Vorsitzenden des Fußballclubs wurde Johann Gloddek berufen, der ihn auch geleitet hat. Bauer Wilhelm Spittka, der am
Rohmaner See wohnte, stellte Land für einen Sportplatz unentgeltlich zur Verfügung. Lehrer Alfred Dorka hat am
Rohmaner See eine Badestelle ausgesucht und ein Sprungbrett bauen lassen. An jedem Sonnabend im Sommer, bevor die
Sonne unterging, versammelte sich die gestammte Jugend des Dorfes an der Badestelle am See. Es wurde gebadet,
Heimatlieder gesungen, gespielt, im Fackelschein eines großen Biwakfeuers, bis in die späte Nacht hinein. Der Fischer
Karl Glitza hat uns Kähne zur Verfügung gestellt, mit denen wir auf den See hinausgepaddelt sind, dabei hatten wir viel
Spaß, was wiederum den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft gefördert hat. Ich habe mit meiner Mandoline den Gesang von
Volks- und Heimatliedern begleitet.
Der Rohmaner See liegt in einem Tal, dessen Hänge zu beiden Seiten mit Kiefern und Tannen bewaldet sind. Wenn man
gesungen oder Musiziert hat, hallte es von den Hängen zurück. Die Ufer waren mit Kalmus und Schilf bewachsen, was für
die Fischaufzucht von Vorteil war. Wenn man an einem sonnigen, windstillen Tag, am Seeufer spazieren ging, traf man
oft auf Flachstellen, an denen sich die Fischbrut im Sonnenlicht wärmte, wie ein Mückenschwarm. Im See befanden sich
folgende Fische: Karpfen, Hechte, Schleie, Barsche Plötze, Rotaugen, Aale und Krebse. Am Sonntagmorgen brachten viele
Rohmaner ihre Pferde zum See um sie zu baden.
Es wurden dort, unter der Aufsicht von Lehrer Dorka, auch viele Jugendfeste mit Theatervorführungen veranstaltet, zu
denen er selbst die Vorlagen organisiert hat. Der am See wohnende Bauer Johann Nadrowski, hat uns ein Scheunentor, als
Tanzboden zur Verfügung gestellt. Der Zimmermann Wilhelm Wittek hat uns eine Windmühle gebaut, die am auf dem Boden
liegenden Scheunentor aufgestellt wurde, dazu kamen Noch Tannen und Fichten, die das Ganze wie ein Bühnenbild
erscheinen ließen. Es wunden viele Bühnenstücke aufgeführt, unter anderen >Alte Weiber werden jung gemahlen<. Dazu bot
die Windmühle die entsprechende Kulisse.
Nach der Vorführung wurde der Boden aufgeräumt, um dann als Tanzdiele zur Verfügung zu stehen. Der Gastwirt Trzaska
hatte Tische und Bänke aufgestellt, Speisen und Getränke angeboten, so dass sich die die Veranstaltung bis in die
späte Nacht hinein zog. Es waren auch Leute aus Ortelsburg und anderen Nachbardörfern dabei. Im Winter hat Lehrer
Dorka eine Kreisrodelbahn eingerichtet, die von Zeit zu Zeit mit Wasser besprengt wurde, um die Gleitfähigkeit zu
verbessern. Von einer Anhöhe ging hinunter bis auf den halben See, was für alle ein großes Vergnügen war. Es kamen
Lehrer mit Schulklassen aus der näheren Umgebung um hier zu Rodeln.
Als Herr Lehrer Jobski als Hauptlehrer nach Rohmanen kam hat er mit dem Bürgermeister und der Gemeindeverwaltung
beschlossen, in der Nähe des Dorfes, auf einem zur Schule gehörenden Grundstück, einen Sportplatz anzulegen. Dafür
wurde gleich hinter den Gärten, 6 Morgen Ackerland abgetrennt, und nach Feierabend hat Lehrer Dorka mit den
Jugendlichen eingeebnet und gleich nebenan einen Graben für Schützenstand und Kugelfang ausgehoben. Am Sonntagvormittag
wurde Fußball gespielt und um 15:00 Uhr war Kleinkalieberschießen angesagt. Es musste auch ein kleiner Beitrag erhoben
werden, um Munition kaufen zu können. Eine Büchse konnten wir aus beim Kleinkalieberverein in Ortelsburg ausleihen.
Nach Hitlers Machtergreifung
Als Adolf Hitler an die Macht kam wurde die SA gegründet. Der Bürgermeister Michael Kownatzki
wurde zum Gruppenführer ernannt und folgende Männer haben sich freiwillig gemeldet: Wilhelm Matzey, Johann Gloddek,
Gustav Nadrowski, August Buttler, Karl Baran, Emil Nickel, Wilhelm Jaschinski, Emil Bork, Ernst Rattay und Gustav Bach.
Bei Versammlungen war die SA in Uniform angetreten um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Wer versucht hat Unruhe zu
stiften, egal aus welchem Grunde, wurde aufgefordert den Saal zu verlassen, andernfalls wurde er mit Gewalt entfernt.
Herr Lehrer Jobski wurde zum politischen Leiter ernannt, seine Frau hat die NS-Frauenschaft gegründet, Lehrer Dorka
die HJ, und so bekam die Dorfgemeinschaft, nach und nach ein anderes Gesicht. Der Sportplatz und der Schützenstand
wurden jetzt mehr als früher in den Mittelpunkt gestellt. Nach der Feldarbeit hat der Bürgermeister Fuhrwerke bestellt
und den Sportplatz noch besser herrichten lassen.
Der Bauer Wilhelm Both wurde zum Ortsbauernführer ernannt, mit der Aufgabe alles Land für den Anbau von Getreide und
Futtermittel bereitzustellen, oder wenn das nicht möglich war mit Wald aufzuforsten. Durch den Einsatz von Kunstdüngern
sollten größere Erträge aus dem Boden geholt werden, um den Viehbestand zu vergrößern und mehr Milch und Butter zu
produzieren. Deutschland sollte im Stande sein sich selbst zu selbst zu ernähren, ohne auf Importe angewiesen zu sein.
Frau Jobski hat, innerhalb der der NS-Frauenschaft, mit Hilfe von Fachkräften aus Ortelsburg, Lehrgänge veranstaltet,
auf denen man Backen und Nähen lernte. Auf den Bauernhöfen befand sich auch immer mehr Rassegeflügel, das eine erhöhte
Produktion von Eiern und Geflügelfleisch sicherstellen sollte.
Die Rohmaner Bauern hatten, außer in der Landwirtschaft, noch andere Verdienstmöglichkeiten in der Kreisstadt. In
Ortelsburg wurden vier Sägewerke betrieben, die mit Langholz aus dem Walde versorgt werden mussten. Wir haben eine
Kiefer von über 8 Festmeter angefahren, der wir zuerst 6 Meter Spitze abschneiden mussten, um diese Last überhaupt
auf den Wagen zu bekommen. Sechs Pferde musste angespannt werden um den Wagen zur befestigten Straße zu bringen.
Fichten und Tannen wuchsen bis zu einer Länge von 30 Metern. Auch beim Transport von Ziegel, von der Ziegelei zum
Bahnhof, konnte man gutes Geld verdienen.
Im Jahr 1934 wurde Rohmanen an das überregionale Stromnetz angeschlossen und schaffte auf diese Weise den Sprung von
der Petroleumlampe zur Glühbirne. Neben dem Grundstück von Karl Pietzonka wurde ein Transformatorhäuschen errichtet,
in dem der ankommende Strom von einer Hochspannung auf eine Verbrauchsspannung transformiert wurde. Es gab schon eine
Überlandleitung, die aus Richtung Ortelsburg kommend, quer über die Felder, in Richtung Neu Keykuth weiter ging.
Durch eine Zwischenspanne wurde der Transformator, mit der Hauptleitung auf Kownatzkis Feld verbunden.
Ein Stromanschluss konnte die Arbeit im Haus und Hof auf vielfältige Weise erleichtern, doch nur die besser gestellten
Bauern, sowie noch manche Pensionäre, die ein festes Einkommen hatten, konnten sich dass leisten. Weil nur wenige an
der Elektrifizierung teilnahmen, war ein Stromanschluss mit hohen Kosten verbunden. Nur Gustav Pietzonka, Gasthof
Trzaska, Friedrich Nickel, die Schule und Wilhelm Both, wurden in der ersten Phase erfasst.
Im Jahr 1952 wurde von den polnischen Behörden die zweite Stufe der Elektrifizierung eingeleitet, in der alle im Dorf
stehen Gebäude erfasst wurden. Am Anfang wurden nur Leitungen für Lichtstrom gelegt und auch nur 3 Lichtstellen pro
Haushalt bewilligt. Doch im nachfolgenden Zeitraum wurden dann, wenn Material vorhanden war, weitere Lichtpunkte
angelegt. 1952, am zweiten Wochenende im Advent, wurden dann die Leitungen geschaltet und alle waren von der
plötzlichen Helligkeit sehr begeistert. Wenn man Glühbirnen auswechseln wollte musste man am Anfang weite Wege
zurücklegen, um welche zu bekommen. In den 60ger Jahren wurden dann immer mehr Starkstromleitungen gelegt, weil die
Bauern elektrische Geräte kaufen konnten. Ende der 60ger wurden auch die Abbauten an das Stromnetz angeschlossen.
Das Urnengrab auf unserem Feld
Auf unserem Feld, in Richtung Seelonken, bin ich oft beim pflügen gegen Steine gestoßen, manchmal
rissen sogar die Stränge am Pferdegeschirr. Eines Tages nahm ich einen Spaten, Brechstange und einen langen Baum, um
der Sache auf den Grund zu gehen. Als ich eine Menge Sand ausgehoben hatte stieß ich auf eine steile, aus Steinen
errichtete Wand, die ich auch mit dem Baum nicht aus der Fassung bringen konnte. Ich habe den ganzen Vormittag gegraben,
konnte jedoch nicht unter die Steine kommen. Einige Tage später hatten wir in der Schule eine Bauernversammlung, da
habe ich Herrn Biella und Herrn Lehrer Dorka von meinem Fund berichtet. Am nächsten Morgen kam der Lehrer Dorka mit der
ganzen Schulklasse, mit Spaten und Sieben ausgerüstet auf unser Feld und fingen an die ausgehobene Erde zu sieben.
Lehrer Dorka benachrichtigte daraufhin den Leiter des Ortelsburger Heimatmuseums, der am nächsten Morgen vorbei kam um
sich die Fundstelle genau anzusehen. Er beauftragte ihn 4 Mann zu besorgen, um die Steine ringsum frei zu schaufeln.
Zwischen den Steinen durften wir die Erde nur mit Esslöffeln ausheben. Als es plötzlich zu regnen anfing hat Lehrer
Dorka die Brauerei Daum, in Ortelsburg angerufen, die uns über der Fundstelle ein Zelt errichtet haben, damit wir
ungestört weiterarbeiten konnten. Wir fanden 8 flache und 8 hohe Urnen zu beiden Seiten am Körper. Die Urnen wurden in
Gipsbinden eingewickelt und ins Heimatmuseum nach Ortelsburg gebracht, wo sie durch einen Fachmann, der extra aus einem
Königsberger Museum angereist war. Nach Reinigung der Urnen hat er festgestellt, das die Grabstätte etwa 2000 Jahre vor
Christi Geburt angelegt wurde und ein Doppelgrab war, in dem ein Toter liegend und einer in Hochstellung beigesetzt
wurde.
Die Nachricht von der Fundstelle verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Es erschienen viele Schaulustige, ganze
Schulklassen aus der Umgebung, mit Autos und zu Fuß. Durch die vielen Menschen wurden die bestellten Ackerflächen auf
unserem Feld sehr in Mitleidenschaft gezogen, eine Entschädigung haben wir nicht erhalten. Das Grab wurde vor dem
Heimatmuseum in Ortelsburg wieder so aufgebaut wie man es auf unserem Feld vorgefunden hat. Für den Transport der
Steine wurde ich entlohnt. Die Urnen hat das Königsberger Museum an sich genommen und wollte sie nicht wieder hergeben,
weil die solch einen Fund noch nicht in ihrer Sammlung hatten.
Sonnenwendfeuer
Am 24 Juni fand eine Sonnenwendfeier statt. Ein Brauch der an die alten Germanen erinnern sollte.
Der Lehrer Dorka hat den Bürgermeister beauftragt 2 Fuhrwerke in den Wald zu schicken, die Holz und alten Reisig holen
und auf dem großen Schulberg abladen sollten. Das Straßenbauamt hat uns Teertonnen zur Verfügung gestellt. Die ganze
Dorfgemeinschaft wurde eingeladen, am Abend, nach der Feldarbeit, an der Sonnenwendfeier teilzunehmen. Lehrer Dorka
hielt zuerst eine Ansprache, in der er anschaulich erklärte wie unsere Vorfahren in grauer Vorzeit gefeiert haben.
Nach dem offiziellen Teil wurden das Holz und die Teertonnen angezündet, es wurden Heimatlieder gesungen, wie: Wild
flutet der See, drauf schaukelt der Schiffer den schwankenden Kahn, Schaum wälzt er wie Schnee, von grausiger Mitte
zum Ufer heran, wild fluten die Wellen auf Vaterlands See, wie schön, oh trag mich auf Spiegel zu Hügel, Masovias See.
Masovia Land, mein Heimatland, Masovia es lebe mein Vaterland.
Lehrer Alfred Dorka und sein Wirken für Rohmanen.

Friedrich Biella hatte auf seinem Feld einen Granitstein mit einer geraden Seite, den haben wir
mit viel Schweiß an den Dorfteich transportiert und auf einer Erhöhung abgelegt. Der Stein sollte zum Denkmahl für die
Gefallenen des Ersten Weltkrieges umgestaltet werden. Da zu Wenige daran ein Interesse zeigten, wurde diese Idee fallen
gelassen und der Stein irgendwann ins Wasser gerollt. Der Lehrer Dorka war viele Jahre in Rohmanen tätig, dort hat er
später seine ehemalige Schülerin, Lotte Biella geheiratet. Er hat sich sehr für die Entwicklung des Dorfes interessiert,
war bei jeder Gemeindeversammlung anwesend und hat auf Schwachstellen hingewiesen die den Fortschritt behinderten.
Gemeinsam mit den Schülern hat er den Ehrenfriedhof für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges gepflegt, an der
Wegegablung nach Eichtal und zu Ehren des Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg eine Eiche gepflanzt.
Zum Advent hat Lehrer Dorka mit der Jugend einen Adventstern, in verschiedenen Farben gebastelt.
Der Stern wurde auf einer 2 Meter langen Stange befestigt, in der Mitte wurde ein Wachslicht angezündet, am Stern
wurde eine Schnur angebracht, wenn man daran zog rollte der Stern hin und her. Am ersten Wochenende im Advent
versammelten sich jung und alt, um den Stern durch das Dorf zu tragen. Alle schlossen sich dem vorausgehenden
Sternträger an, der den Stern durch die Hauptstraße und die angrenzenden Wege trug. Dieser Sternmarsch wurde an den
folgenden Adventwochenenden wiederholt.
Am ersten Weihnachtfeiertag wurde um 4:00 Uhr morgens ein Frühgottesdienst gehalten. Zuerst hat der Pfarrer eine
Andacht gehalten, dann haben die Kinder ein Krippenspiel aufgeführt und die Gemeinde hat schöne Weihnachtslieder
gesungen. Der Gastwirt Trzaska hat uns den Saal zur Verfügung gestellt. Wir hatten eine Posaunen- u. eine
Gitarrengruppe. Unter der Leitung von Herrn Willi Doormann spielten: Gottlieb Brosch, Fritz Ollech,
Gustav Rattay(Sopran), Wilhelm Pilath, Gustav Brosch(Alt), Fritz Both(Tenor) und Fritz Brosch(Bass).
In der Gitarrengruppe wirkten mit: Martha Ollech, Hedwig Ollech, Martha Lekzik, Martha Michalick und Auguste Lekzick.
Willy Doormann hat sie auf der Geige begleitet.
Kurz vor Ausbruch des 2. Weltkrieges
Bei der Aufstellung des Grenzschutzes(Regiment Buchholz), hat er als Hauptfeldwebel die
Gruppenführerkurse überwacht und selbst die fähigsten Männer dafür vorgeschlagen. Das Ausbildungspersonal hat das
Jäger-Battalion gestellt. Wir kamen zuerst ins Stadion(Waldheim), wurden da eingekleidet und dann ging es gleich
kasernenmäßig zu, theoretisch und praktisch. Jeder musste vor die Front treten und nachweisen ob er im Stande ist,
Befehle zu erteilen. Abends wurden Filme vorgeführt die uns zeigen sollten wie eine Gruppe sich im Gelände entfalten
muss. Die Exerziervorschriften hatten sich, im Verhältnis zu Kaiser Wilhelms Zeiten, etwas geändert. Damals bestand
eine Gruppe aus 8 Mann und einem Unteroffizier, jetzt aus 10 Schützen, 3 für das leichte Maschinengewehr und einem
Unteroffizier(13 Mann). Nach der Schulung folgte eine Abschlussprüfung, danach ein gemütliches Beisammensein. Aus
Rohmanen haben folgende Männer die Prüfung bestanden: Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy, Gustav Rattay und
Gustav Deptolla. Unsere Uniformen waren alle zu klein und es gab viel zu lachen bei der Anprobe.
Die erste Übung habe ich mit Emil Rosowski, in Lenzinen gemacht. Der Gutsbesitzer Marzinzick hat seine Scheune als
Unterkunft zur Verfügung gestellt. Er war im Range eines Hauptfeldwebels. In seinem haus war die Schreibstube
untergebracht, die er selbst verwaltete. Ein Lastauto hatte Uniformen aus der Kaserne in Ortelsburg geholt, jeder
musste eine Uniform anlegen und dann wurde solange getauscht bis alle eine passende gefunden hatten. An den Namen des
Kompanieführers kann ich mich nicht mehr erinnern. 1935 wurden wir zu einer Übung in die Dragonerkaserne nach Lyk
einberufen. Die Gruppenführer, Zugführer, und Kompanieführer die schon Frontberührung im dem Ersten Weltkrieg hatten,
mussten eine Woche früher anreisen. Die Übungen waren auf 6 Wochen angelegt. Die meisten der einberufenen waren noch
nie mit dem Wehrdienst in Berührung gekommen. Jeder Gruppenführer bekam 13 Mann zugeteilt.
Unser Zugführer war Leutnant Neumann, Kompanieführer Oberleutnant Rutschko, Battalions-Kommandeur Major Gröning
(Regiment Buchholz). Hier ging es wieder Kasernenmäßig voran. Das Bataillon wurde hier vereidigt. Jeden zweiten
Sonntag durften unsere Frauen uns besuchen. Ein Jahr später wurden wir wieder zu einer Übung einberufen, auf den
Truppenübungsplatz nach Arys. Jeder Gruppenführer hatte den Auftrag die Gruppe zu entfalten, und auf bewegliche
Figuren zu schießen. Diese Übung musste später mit scharfer Munition wiederholt werden. Jedes Maschinengewehr bekam
50 Schuss, jeder Schütze 20 Schuss zugeteilt. Nach dem Abschießen wurden die Treffer gezählt und dem Kommandierenden
Bericht erstattet. In einiger Entfernung spaziert ein Storch umher, der gar nicht bemerkt hatte dass geschossen wurde,
was bei den Kameraden ein großes Gelächter hervorrief.
Nach der Übung wurde uns gesagt das jeder Gruppenführer eine arische Abstammung nachweisen sollte. Ich konnte in den
Rheinsweiner Kirchenbüchern meine Vorfahren aus Gellen, bis zum Jahr 1732 zurück, nachweisen und wurde zum
Unteroffizier befördert. Aus unserem Dorf wurden auch, Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy und Gustav Deptolla
befördert. Zwischendurch mussten wir schon mal in die Radfahrer-Kaserne nach Ortelsburg, Gewehre empfangen und im
Gelände üben. Am 31 Juli 1939 wurde mir von einem Soldaten ein Schreiben übereicht, das mich aufforderte, am 1. August
um 6:00 Uhr, bei der 3. Kompanie, des 2. Infanterieregiments zu erscheinen.
Um 5:30 hat mich meine Schwester in die Kaserne gebracht. Auf der Schreibstube erklärte mir der Hauptfeldwebel,
dass mir ab sofort der Dienstgrad eines Sanitäters zugewiesen wird, ich mich in der Kammer einzukleiden hätte und mir
in der Handwerkerstube die entsprechenden Schulterklappen annähen lassen sollte. Die aktiven Sanitäter wurden den
Feldlazaretten zugewiesen und wir kamen an ihre Stelle. Unser Bataillon wurde nach Schodmak zum Bunker bauen und
Stacheldraht verlegen eingeteilt. Wir zogen in Begleitung einer Musikkapelle bis zur Kreuzung am Krankenhaus, dann
weiter zu unserem Bestimmungsort, gefolgt von einer Gulaschkanone die in den nächsten Tagen für unsere Verpflegung
sorgen sollte.
Am 14 August haben wir die Jägerkaserne, begleitet von einer Musikkapelle endgültig verlassen und zogen zuerst durch
Ortelsburg, dann über Lehmanen ins Feldmanöver, hinter Rohmanen. Dort entfaltete sich das Bataillon im Gelände, die
Verwundetensammelstelle wurde auf dem Hof des Bauern Friedrich Neumann eingerichtet. Gegen Abend wurde zu Sammeln
geblasen und Biwak bezogen, wobei unsere 3.Kompanie, in einem kleinen Wallt, in der Nähe von Otto Nickels Gehöft
Stellung bezogen hatte. Die 2. und 4. Kompanie hatte sich in der Nähe vom Abbau Pallasch niedergelassen. Die Frau
Nickel hat am Abend ein Mädel in Dorf geschickt um meiner Frau Bescheid zu sagen, wo wir uns zurzeit befinden. Meine
Frau ist dann noch gekommen um sich von mir zu verabschieden, weil wir am nächsten Morgen um 3:00 Uhr Zelte abbrechen
und um 4:00 Uhr in Richtung Kaspersguth marschieren sollten.
Wir sind dann über Achodden, Seelonken, Lehmanen, Ortelsburg, bis nach Grammen und Schützendorf marschiert, wo wir an
einem See Biwak bezogen haben. Es wurde immer gesagt, wir kommen zum Tannenberg-Denkmal bei Hohenstein, wo ein Reichs
Kriegervereinsfest stattfinden sollte. Es wurden auch schon Vorkommandos aufgestellt, doch dann kamen wir nach Orlau
und Lahna-Mühle, da wo die Alle entspringt haben wir 2 Tage biwakiert. Unser Kompanieführer hat uns nach Waplitz auf
den Soldatenfriedhof des Ersten Weltkrieges geführt und uns erklärt wie das Jägerbataillon sich 1914 hier entfaltet
hat und aufgerieben wurde. Dann mussten wir in der Nähe von Gut Koslau über einen Fluss und bezogen in einem Waldstück,
vorbereitete Stellungen in der Nähe der polnischen Grenze. Herr und Frau Thalmann haben uns jeden Tag, bis zur Grenze,
mit Brötchen und Getränken versorgt. Es wurde scharfe Munition ausgegeben, weil wir am nächsten Morgen um 4:00 Uhr die
polnische Grenze überschreiten sollten.
Am nächsten Morgen um 10 Minuten vor 4:00 Uhr kam der Befehl; scharfe Munition abgeben, alles zurück in ein 6 Kilometer
entferntes Dorf, wo wir auch einquartiert wurden. Das alles geschah’ eine Woche vor dem 1. September 1939. Es wurde
gesagt dass der Führer dem polnischen Präsidenten Rid-Szmigly, ein Ultimatum gestellt hat und es wahrscheinlich nicht
zum Krieg mit Polen kommt. Genau nach 5 Tagen kehrten wir wieder in die gleichen Stellungen zurück, es wurde wieder
scharfe Munition ausgegeben und am nächsten Morgen um 4:00 Uhr überschritten wir die polnische Grenze.
“Der 2. Weltkrieg.”
Der erste Einsatz in Polen
Wir kamen zuerst in ein Dorf in dem sich nur alte Menschen befanden. Auf unsere Frage wo denn die Bewohner wären sagte
man uns dass alle geflohen sind, weil erzählt wurde, die Deutschen würden alle Polen misshandeln und verstümmeln. Ich
habe ihnen daraufhin gesagt dass uns, unter Androhung von Strafe verboten wurde, einem Zivilisten etwas anzutun. Das
Vieh, die Schweine und Hunde des Dorfes liefen frei herum und die Soldaten fingen an auf die Hunde zu schießen, bis
gesagt wurde es seien Meldehunde im Dienste der Deutschen Wehrmacht und dieser Unfug der eigenen Truppe schaden würde,
weil etwaige Querschläger eigene Kameraden verletzen könnten. Wir gingen weiter auf polnischer Seite entlang der Grenze,
bis wir am Nachmittag die ersten Vorposten der Festung Mlawa erreichten, da befanden wir uns plötzlich im Feuerhagel
polnischer Festungsflack.
Am nächsten Morgen hatte ich schon 3 Verwundete und wusste nicht wo sich eine Verwundeten Sammelstelle befindet. Ich
suchte den Bataillonsgefechtstand auf der sich auf einer Anhöhe befand. Ich habe unseren Oberstabsarzt gefragt wo denn
die Verwundetensammelstelle wäre. Er rief beim Tross an, wo er die Auskunft erhielt, das sich vor dem Dorf ein Bunker
befindet in dem man die Verwundeten sammeln sollte, die dann von Sanitätsautos abgeholt würden, weil das Dorf unter
Artilleriebeschuss stand. Am Sonnabend haben unsere Flieger die Bunkerstellungen bombardiert, konnten aber, trotz guter
Treffer nicht viel ausrichten, die Bunker wurden nur etwas angekratzt.
Der Beschuss unserer vordersten Linien ging mit unverminderter Heftigkeit weiter. Am Sonntag verkündete eine große
Staubwolke die Ankunft unserer Panzer, doch sie kamen nur bis zur Panzersperre und mussten wieder abdrehen ohne den
Polen einen schaden zuzufügen. Ein Panzer bekam einen Volltreffer, der Fahrer konnte noch umkehren. Er blutete am Kopf
und der Schütze war so eingeklemmt, das wir ihn nur mit einem Seil unter den Armen, durch die Luke nach oben ziehen
konnten. Ob er seine Verwundung überlebt hat ist mir nicht bekannt, denn in der Nacht wurden Panzergeschütze nach
vorne in Stellung gebracht, die direkt in die Schießscharten der Bunker geschossen und so die Verteidiger vertrieben
haben. Daraufhin sind wir weiter vorgerückt. Auf einer Wiese war ein tiefer Graben ausgehoben und mit Ästen getarnt,
da war ein Panzer hinein gefahren, so dass nur das Hinterteil herausragte und er sich nicht aus eigner Kraft befreien
konnte. In der Luft waren Flieger die Brandbomben abwarfen, ich habe mich auf den Boden geworfen weil ich dachte die
würden explodieren, aber sie zischten nur, so das Stoppeln und Graß rings herum in Brand gerieten.
Bei den Kampfhandlungen gab es mehrere Verwundete, denen ich gerade Verbände anlegen wollte, als unser Hauptmann zur
Trillerpfeife griff um mir klar zu machen, dass ich ihm folgen sollte. Die Polen fingen an zu schreien, ich sollte
sie ins Lazarett bringen denn hier im Wald würde sie niemand finden. Ich setzte mich aufs Fahrrad und folgte unserem
Kompanieführer, der mir sagte ich soll immer bei der kämpfenden Truppe bleiben, denn hinter der Front sind die
Sanitätsabteilungen, die werden die Verwundeten schon versorgen. Der Vormarsch dauerte bis in die späte Nacht. Auf
einem Gehöft, das nach allen Seiten durch Feldwachen abgesichert wurde, machten wir endlich Rast. Wir haben
Getreidegarben auf dem Hof ausgebreitet und uns zur Ruhe gelegt, als plötzlich um Mitternacht Leuchtraketen den Himmel
erhellten und Maschinengewehrfeuer uns aus dem Schlaf schreckte. Ein par polnische Soldaten hatten das Feuer eröffnet,
aber sich kurz darauf ergeben.
Die Narew-Überquerung
Als es hell wurde ging der Vormarsch weiter. Es wurde uns untersagt Tagebuch zu führen, darum
weiß ich nicht wie die Orte hießen, durch die wir marschiert sind. Als wir durch ein sumpfiges Gelände vor drangen
stand auf einer Anhöhe am Horizont, die polnische Artillerie, die uns sofort unter Beschuss nahm. Unser Hauptmann war
der Meinung dass wir schon in der Nähe des Flusses Narew sein müssten, als aus den Sträuchern ein mit Schlauchboten
beladenes Lastauto auftauchte. Wir wurden aufgefordert mit je 6 Mann ein Schlauchboot zu nehmen, an einem Aggregat
der daneben stand mit Luft zu füllen und zu Wasser zu lassen. In einer Stunde war das ganze Bataillon über die Narew,
wo der Vormarsch fortgesetzt wurde. In einem Dorf überraschte uns die polnische Kavallerie und fing sofort mit
Maschinengewehren zu schießen an. Da kam der Befehl: Alles wieder zurück. Es ging noch schneller als auf der Hinfahrt.
Wir sind erst einige Kilometer am Fluss entlang gegangen und haben dann zum zweiten Mal rüber gesetzt.
Die Gehöfte im Dorf standen alle in Brand. Auf einem waren viele Bienestöcke. 2 Kameraden wollten den Stöcken Waben
entnehmen, doch die Bienen durch das Feuer aufgeschreckt, überfielen sie sofort und stachen derart zu das sie nicht
mehr wieder zu erkennen waren. Ich habe die Einstichstellen mit Salmiak betupft, mehr konnte ich nicht tun. Wir mussten
auf unserem Vormarsch durch einen Wald der in Flammen stand, so dass man kaum atmen konnte. Es ging weiter in Richtung
Minsk und Warschau, wo schon die Sowjetische Armee durchgegangen war, die Pferde und Vieh von einem Gut mitgenommen
hatten. In einem Wald stießen wir unverhofft auf ein Kloster, in dem wir einige Gefangene machten. Dann trafen wir auf
eine gute Straße die nach Grochow ging.
Als wir dort einmarschierten wurden wir aus den oberen Stockwerken beschossen, so dass wir, um uns zu schützen, nur an
den Hauswänden entlang gehen konnten. Wir haben jedes Haus nach Feinden durchsucht. Vor einem Haus stand ein Hund der
niemanden reinlassen wollte, solange bis ihn eine Kugel traf. Die polnische Artillerie feuerte von Warschau aus, um
unseren Vormarsch zu stoppen. Wir hatten uns gerade eingegraben als plötzlich deutsche Flieger am Himmel erschienen,
die unsere Stellungen mit Bomben bewarfen und dabei viel Unheil anrichteten. Wir haben sofort Fliegertücher
ausgebreitet und Leuchtraketen abgeschossen. Da ich in dem Graben, den ich kurz zuvor ausgehoben hatte, sofort in
Deckung gegangen bin ist mir zum Glück nichts passiert. Unter den anderen Kameraden gab es viele Verwundete, so dass
ich nicht wusste wem ich zuerst helfen sollte.
Der Oberstabsarzt hat mich sofort tatkräftig unterstützt, so das bald alle Verwundeten versorgt waren, außer einem,
dem ein Bombensplitter den Arm abgerissen hat. Ich habe im 3 große Verbandspäckchen auf die Wunde gelegt, doch die
Blutung ließ sich trotzdem nicht stoppen, so dass er eine Stunde später auf der Krankensammelstelle verstarb. Wir
haben danach in einem Tomatenfeld einen Graben ausgehoben und eine neue Abwehrstellung bezogen. Die Gruppe Schwarz
bekam den Auftrag nach etwaigen versprengten polnischen Verbänden Ausschau zu halten, als sie unerwartet aus einer
Häuserreihe mit Maschinengewehrsalven überschüttet wurden. Der Gruppenführer und noch ein Soldat wurden dabei tödlich
verwundet. Danach wurde noch ein weiter Stoßtrupp, unter der Führung von Leutnant Briskorn, der sich dazu freiwillig
gemeldet hatte, hinaus geschickt um den Gruppenführer und den anderen Toten zu bergen.
Bei diesem Unternehmen, das erfolglos ausging, weil die Toten schon verscharrt waren, durchschlug eine Kugel den
Stahlhelm von Leutnant Briskorn, der auch sofort tot war. Alle Toten wurden später, an der Kirchenmauer in Grochow, in
Särgen beigesetzt: Hauptmann Schönwald sagte, das sie nach dem Kriege auf den Heldenfriedhof nach Ortelsburg überführt
werden. Drei Tage lagen wir bei Grochow in Stellungen, waren dem polnischen Maschinengewehrfeuer sowie den Bomben
deutscher Flugzeuge ausgesetzt. In der Nacht musste ich zu einem Verwundeten in die vorderste Linie und habe den
Rückweg nicht mehr finden können, als plötzlich Gewehrfeuer aufflammte habe ich in den Ruinen Schutz gesucht. Erst im
Morgengrauen konnte ich mich wieder orientieren und zu meinem Unterstand zurückfinden.
Warschau wurde tagelang bombardiert und stand auch unter Artilleriebeschuss. Aus dunklen Rauchwolken kamen oft ganze
Bündel von Papier angeflogen. Die Verwundeten kamen oft auf Krücken zu unserem Unterstand, ich habe sie dann zur
Krankensammelstelle hingeführt. Wir haben auch polnische Zivilpersonen betreut, die während der Kampfhandlungen
verwundet wurden. Als einmal 2 Jungen vorbeiliefen hat einer ihnen nachgerufen sie sollten seiner Frau Bescheid sagen,
er wäre auf der Krankensammelstelle an der Kirche. Als wir dort ankamen war seine Frau, mit einem Kind auf dem Arm,
schon da.
Nach der Kapitulation von Warschau, gingen wir über Sokolow zum Bug und haben dort Quartier bezogen. Der Russe hatte
sich bereits hinter den Fluss zurückgezogen, hatte alles Vieh und Pferde mitgenommen. Dort erreichte mich ein Telegramm
von zu Hause, dass meine Tochter gestorben ist. Es sprach sich auch herum dass verschiedene Heimaturlaub bekommen haben,
ich durfte auch für 14 Tage heim. Wir fuhren mit Lastautos nach Allenstein in die neue Reiterkaserne, zum
Ersatzbatallion, da haben wir unsere Gewehre und Munition abgeben, dann durften wir, jeder in seinen Heimatort
weiterfahren.
Als wir unsere Quartiere am Bug verlassen haben war sehr viel Schnee gefallen. Hier in Ortelsburg fanden wir die
gleiche Wetterlage vor, aber nach 3 Tagen war alles wieder weggetaut und wir konnten die Kartoffelernte, die durch den
frühen Wintereinbruch gestoppt wurde, zu Ende bringen. Ein Tag bevor ich zu Hause angekommen bin wurde die Tochter
beerdigt. Nach 14 Tagen mussten wir uns in Allenstein melden, Gewehre empfangen und wieder zurück zur Division an den
Bug 150 Kilometer hinter Warschau. Die elfte Division, zu der wir auch gehörten sollte in den Westen Deutschlands
verlegt werden und war schon unterwegs zur Verladestation Skiernewice 50 Kilometer vor Warschau.
Mein Dienst als Sanitätsunteroffizier
Unser Bataillon kam in das Städtchen Burscheid, im Kreis Opladen, wo wir in Privatquartieren
untergebracht wurden. Nach 3 Monaten, im Januar 1940, wurden wir nach Solingen verlegt, wo wir bis zum
Frankreichfeldzug stationiert waren. Wir mussten an Feldübungen teilnehmen, wie andere die in Kasernen untergebracht
waren. Während dieser Zeit musste jeder seine Zähne in Ordnung bringen lassen. Jeden Tag fuhren 20 Mann in die
Cäzilienstraße nach Köln, zur Zahnklinik. Im Rheinland wurde unsere Division neu aufgestellt. Ausfälle durch den
Polenfeldzug wurden durch neue Soldaten ergänzt. Ich kam nun zum Ersatzbatallion, war der Älteste in der ganzen
Kompanie. Als der Frankreichfeldzug losging wurde unser Ersatzbatallion mit den noch vorhandenen Verwundeten, in die
neue Reiterkaserne, nach Allenstein verlegt.
Meine Frau hat, mit Unterstützung der Bauernschaft, einen Antrag gestellt, daraufhin wurde ich zur Frühjahrsbestellung,
beurlaubt und später bis auf weiteres vom Militärdienst freigestellt. Als der Russlandfeldzug losging wurde ich von der
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg, für 14 Tage einberufen. Ich war seit 1922, Mitglied der freiwilligen
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg und habe jedes Jahr an Übungen teilgenommen. Jede Bereitschaft musste etliche Leute
stellen. Von Rohmanen wurden Emil Rosowski, Johann Dembek, und ich, zur Krankensammelstelle Wirballen, in Litauen,
abkommandiert. Dorthin kamen Lazarettzüge aus Russland mit der Breitspurbahn. Die Verwundeten wurden frisch verbunden
und auf Waggon mit Normalspur verladen und nach Deutschland gebracht.
Als die 14 Tage vergangen waren wollten wir wieder nach Haus zurück, doch man wollte uns nicht entlassen. Stattdessen
wurden wir dem Wehrkreisamt Königsberg zugeteilt, neu eingekleidet und zur Aushilfe ins Lazarett nach Gumbinnen
abkommandiert. Mehr als ein Jahr war ich in den Urlauber-Baracken, habe dort Krankenstube betreut. Später, bis zum
Dezember 1944, war ich im Reserve-Lazarett 4, in Königsberg tätig. Dort habe ich auch die Luftangriffe der Engländer,
vom 25 bis 26. August 1944 miterlebt.
Wir sollten gerade einen Lazarettzug in Rotenstein entladen, als plötzlich die Sirenen ertönten - Fliegeralarm. Im
gleichen Moment waren die ersten Flugzeuge auch schon da, zuerst warfen sie „Tannenbäume” und danach Foßforkanister ab.
Die Omnibusse standen schon zur Abfahrt bereit als es losging. Wir haben die Verwundeten schnell in den
Luftschutzkeller getragen, haben die Betten von den Fenstern weggerückt damit die Verwundeten nicht von den
Glasssplittern verletzt wurden. Im Kasernenhof brannten die Fosforkanister lichterloh. Unsere Unterkunft, die sich in
einer Baracke befand ist völlig abgebrannt, mit dem Wenigen was wir unser Eigen nannten. Am nächsten Tag wurden wir neu
eingekleidet und am 29. bis 30. kamen die englischen Bomber wieder, sie setzten genau da ihr Zerstörungswerk fort wo
sie vor 3 Tagen aufgehört hatten.
Anfang Dezember 1944 musste ich mich nach Stablack melden und musste dann zur Sanitätsabteilung 1, nach Gernau, das
liegt zwischen Lodz und Warschau. Vormittags hatten wir Felddienstübungen und nachmittags theoretischen Unterricht.
Jeden Tag wurden Gruppen zusammengestellt und zu anderen Einheiten abkommandiert. Ich kam zu einer Panzerabteilung, wo
wir an einem Morgen plötzlich auf dem Kasernenhof antreten mussten und zu unserer Überraschung mit der Nachricht
konfrontiert wurden, dass der Russe an mehreren Frontabschnitten durchgebrochen war. Wir bekamen sofort einen
Marschbefehl in Richtung Lodz, wo das Stadtbild noch intakt war, selbst die Straßenbahnen fuhren noch. In der Nacht
haben russische Flugzeuge die Stadt bombardiert. Die Kaserne in der wir untergebracht waren hatte keine
Luftschutzkeller, aber zum Glück blieben wir von Bombentreffern verschont. Am nächsten morgen bot sich uns ein Bild der
Verwüstung. Die entgleisten Straßenbahnwagen, sowie andere Fahrzeuge blockierten die Straßen. Die Älteren unter uns
bekamen Fahrscheine für einen Transportzug, der bereit hinter Lodz abfahrbereit, unter Dampf stehen sollte. Als
russische Panzer in den Straßen auftauchten, verbrannte die Schreibstube unsere Wehrpässe und andere wichtige
Dokumente. Wir liefen zu der Station auf der unser Transportzug bereitstehen sollte, aber da war kein Zug mehr zu sehen
und wir setzten unseren Rückzug zu Fuß fort.
Der Rückzug und Zusammenbruch der Ostfront
In Dobroschin, einer Stadt in Polen, wurde gerade ein Lazarettzug verladen, doch wir kamen nicht
mehr zum Einsatz, weil die russische Infanterie uns schon auf den Fersen war. Es ging weiter über den Fluss Bober,
Sagan, bis nach Glogau an der Oder. Dort wurden wir der 29. motorisierten Sanitätskompanie zugeteilt. Im
Garnisonslazarett wurden noch Operationen durchgeführt. Unsere Division hatte ihr eigenes Feldlazarett, so dass wir den
Befehl zu Weiterfahrt erhielten und noch unbeschadet die Oderbrücke passieren konnten, denn Glogau wurde zur Festung
erklärt. Wir haben 2 Pferdewagen organisiert und mit Verbänden, sowie medizinischen Instrumenten beladen. So kamen wir
bis nach Lübbenau im Spreewald, wo wir in einem Schloss, in zuvor ein Museum war, unser Lazarett untergebracht haben.
Weil die Amerikaner Cottbus bombardiert hatten, wurden die Verwundeten zu uns nach Lübbenau gebracht. Hier haben wir
Tag und Nacht gearbeitet, um die vielen Verwundeten, aus den schweren Kämpfen bei Grünberg und Sagan zu versorgen. Die
Soldaten von der Abwehrfront kamen schon mit abgestorbenen Armen oder Beinen bei uns an, weil in vorderster Linie keine
Frontlazarette mehr vorhanden waren; es mussten viele Amputationen durchgeführt werden. Als für unsere Pferde kein Heu
mehr vorhanden war, schickte mich unser Hauptfeldwebel, zu einem Bauern in den Spreewald, mit dem Auftrag, Futter zu
besorgen. Mit noch zwei Mann fuhren mit zwei Kähnen, zuerst den Hauptstrom entlang und dann in einen Nebenarm; da haben
wir die Boote beladen und brachten das Heu nach Lübbenau.
Als wir uns bei unser Einheit zurück melden wollten, war alles schon marschbereit. Ich bin schnell in einen Bus
eingestiegen der sofort losfuhr, weil russische Verbände schon in sichtweite waren. Russische Flugzeuge kreisten über
den Dächern und nahmen, mit ihren Bordwaffen jeden unter Beschuss, der sich irgendwo blicken ließ. Wir konnten nur
durch den Wald, oder in der Nacht vorwärts kommen, denn wenn ein Auto auf der Landstraße fuhr, war alsbald ein Flugzeug
hinter ihm her und schoss es in Brand. Als wir nach Tagen am Ufer der Elbe ankamen, war bereits eine Ponton-Brücke
erstellt worden, welche die zerstörte Brücke ersetzen sollte.
Durch die vielen Fahrzeuge waren in den Sand tiefe Spuren gefahren, so dass andere Fahrzeuge unsere Busse ins
Schlepptau nehmen mussten, weil wir mit eigener Kraft nicht mehr weiterkamen. Beiderseits der Trasse standen
Flüchtlingswagen, in der der Hoffnung die Brücke passieren zu können, doch SS-Polizei verhinderte das die Gespanne den
militärischen Rückzug zum Stillstand brachten. Es gelang uns die Elbe zu überqueren, um in einem Waldstück Schutz vor
feindlichen Fliegern zu suchen.
Als wir unsere Busse und Autos gut getarnt hatten, hat unser Bataillonschef die anwesenden Parteigrößen zu sich
gerufen und ihnen erklärt das wir eine Einheit des Roten Kreuzes sind und nach internationalem Recht keine Waffen
besitzen dürfen. Nach langer, erregter Diskussion wurde beschlossen einen Graben auszuheben und alles im Sand zu
verscharren. Als wir dann weiter, durch die Dörfer fuhren, sahen wir schon viele weiße Bettlaken, als Zeichen der
Kapitulation, aus den Fenstern hängen. Es wurde uns erzählt dass der Bürgermeister von der SS erschossen wurde, weil
er die Bevölkerung zu diesem Schritt ermutigt hatte. Jetzt waren hinter uns die Russen und vor uns schon die Amerikaner.
Amerikanische Panzer fuhren umher und schossen wild durch die Gegend, ohne ein Ziel anzuvisieren. Niemand wollte sich
dem Russen ergeben, doch der Weg der zu den Amerikanern führte, war durch abgesägte Bäume blockiert. Wir sind schnell
in das nächste Dorf gegangen, haben uns Sägen und Äxte besorgt, die Bäume durchgesägt und in den Straßengraben
geworfen.
“ Nach dem Ende des 2. Weltkrieges.”
In amerikanische Kriegsgefangenschaft
Dann fuhren wir unter internationaler Flagge an eine Mulde Brücke, vor der zwei amerikanische Soldaten, mit Zigarren,
zur Hälfte im Mund, standen. Sie rauchten und kauten gleichzeitig. Wir mussten auf einen freien Platz fahren, alle
aussteigen und rechts wieder antreten. Wäschebeutel und Tornister mussten wir abstellen; danach wurden wir nach Waffen
durchsucht, Wertsachen, Uhren und Messer wurden uns gleich abgenommen. Als wir anschließend an unserem Gepäck
vorbeigingen durfte niemand was mitnehmen. Als ich gebückt, nach meinem Wäschebeutel greifen wollte, in dem sich noch
3 Konservendosen und ein Brot befanden, bekam ich einen Fußtritt ins Gesicht, so dass mir ein Zahn ausgeschlagen wurde.
Wir wurden dann in einem Garten zusammen getrieben und gefragt ob jemand bei der SS gedient hat. Nachdem wir in Reihe
und Glied angetreten waren, mussten wir den Oberkörper freimachen und die Arme anheben. Es wurde nach SS-Zeichen
gesucht, die gewöhnlich unter dem Oberarm eintätowiert waren. Nachdem wir Grimma bei Leipzig, wo wir in amerikanische
Gefangenschaft geraten waren, verlassen hatten, mussten wir durch ganz Thüringen bis Hersfeld, an der Grenze zu Hessen,
marschieren. In Hersfeld wurden wir auf große Lastautos verladen, die von farbigen Soldaten gefahren wurden. Man hat
uns mit Stöcken hinauf getrieben, solange bis das Auto so voll war das man kaum stehen konnte. Die Soldaten fuhren, für
diese Straßenverhältnisse, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Wenn die Straße eine scharfe Kurve hatte, flogen
wir alle übereinander und mussten erst mit viel Kraftanstrengung auf die Beine kommen um diese Fahrt zu überstehen.
Da die Straßenränder in dieser Gegend mit Obstbäumen bepflanzt sind und deren Äste sehr niedrig hängen, hätten die
uns die Köpfe abgerissen, wenn wir uns nicht ständig geduckt hätten. Unsere Fahrt endete in Bad Kreuznach, in der Pfalz,
wo wir in ein Lager, in dem sich später 130.000 Mann und 6 Generäle befanden, eingepfercht wurden. Die Unterkunft der
Generäle befand sich unter einem Zelt, alle anderen mussten die Zeit unter freiem Himmel zubringen. Die Offiziere, die
Unteroffiziere, die Mannschaften; wurden in getrennten Camps untergebracht. Die Mannschaften wurden auch zur Arbeit
abkommandiert und konnten bei dieser Gelegenheit, Brot, Brötchen oder Zigarettenstummel organisieren, wogegen die
Offiziere und Unteroffiziere ihr Camp überhaupt nicht verlassen durften.
Die ersten Tage gab es kein Wasser und kein Brot, so dass die Kameraden vor Erschöpfung umfielen. Später standen wir
manchmal den ganzen Tag nach Wasser an, das von den, uns bewachenden Negern mit großen Wassertanks angefahren wurde. Am
dritten Tag bekamen wir mittags und abends etwas zu Essen; Brot bekamen wir erst nach zwei Wochen, nach dem aus der
Umgebung herbeigeholte Handwerker, Backöfen gebaut hatten. In den verschiedenen Gemeinden, die in den uns umgebenden
Weinbergen lagen, mussten sich alle Männer beim Bürgermeister melden. Als sie dann erschienen waren, wurden sie auf
bereitstehende Lastautos getrieben und zu uns ins Lager gebracht. Sie waren ohne Kopfbedeckung und ohne wärmere
Bekleidung angekommen, weil ihnen gesagt wurde, dass ihr Aufenthalt im Lager nur von kurzer Dauer sein würde. Man hat
uns, falls noch vorhanden, Decken und Mäntel abgenommen, mit der Begründung, sie würden für Kranke und Verwundete
gebraucht. Jeden Tag starben mehr als 200 Mann, die wir sofort in ein Zelt tragen mussten. In der Nacht wurden die
Toten dann mit unbekanntem Ziel, weggefahren.
Viele haben ihren Verstand verloren uns irrten im ganzen Camp ziellos umher. Als Latrinen wurden Gräben ausgehoben, in
die verschiedene Kameraden, bei der Verrichtung ihrer Notdurft, vor Schwäche hineingefallen sind und nicht mehr wieder
heraus kamen. Aus den Pfählen die, die jungen Obstbäume stützten, haben wir Krankentragen gebaut um unsere Kameraden,
bei Bedarf, zur Krankensammelstelle zu tragen. Es war in diesem Frühjahr auch sehr kalt, doch unsere Erdlöcher, die wir
zum Schutz vor Kälte und Wind, nur mit leeren Konservendosen ausgehoben hatten, durften nicht tiefer als 20 Zentimeter
sein. Nach jedem Regenguss mussten wir das Wasser ausschöpfen. Nach einem Gewitter, standen wir wiedermal, total
durchnässt in unserem Camp, als unerwartet am Horizont die Sonne hervortrat. Einer unserer Kameraden hatte noch eine
Trompete gerettet und fing, von dem Anblick völlig überwältigt, zu spielen an: "Es geht alles vorüber, es geht alles
vorbei, nach jedem Dezember, folgt wieder ein Mai". Daraufhin hob sich die Stimmung der tiefbetrübten Kriegsgefangenen,
so das Heimatlieder durch das ganze Camp erklangen, obwohl wir in den nassen Kleider herumgehen mussten, bis sie am
Körper trocken wurden.
In französischer Kriegsgefangenschaft
Nach etwa einem Monat, haben uns die Amerikaner, den Franzosen, zum Arbeitseinsatz, ausgeliefert.
Etwa 4 Kilometer von Bad Kreuznach entfernt, stand auf freier Strecke, ein Zug mit offenen Kohlenloren, auf den wir
verladen wurden. In jeden Waggon, wurde pro Person eine Tafel Schokolade und ein Päcken Zwieback rein geworfen, doch
viele Kameraden fanden nur leere Päckchen vor, weil die schon zuvor von der französischen Wachmannschaft geplündert
wurden. Wir haben uns darüber beschwert, doch die haben uns nur ausgelacht. Nachdem wir zunächst bei Mainz über den
Rhein fuhren, endete unsere Fahrt bei Paris in einem großen Zeltlager. Dort wurden wir auf andere Züge verladen, die uns
nach Südfrankreich, in ein Barackenlager, bei Mazarei, brachten.
Auf einer Zwischenstation hat man uns unter einer Pumpe, die Lokomotiven mit Wasser versorgt, abgestellt, den Kran
aufgedreht und uns anschließend ausgelacht, die Kinder Haben uns mit Steinen beworfen. Ein Wachmann kam in unseren
Waggon gekommen, hat unser Gepäck durchsucht, wenn er Tabak oder Zigaretten gefunden hat, nahm er sie mit. Die Kameraden
waren darüber so empört, dass sie vorhatten, ihn nachts unter den Waggon zu werfen. Wir haben sie gebeten dass zu
unterlassen, weil man uns in diesem Falle, alle erschießen würde.
Als wir ins Lager kamen wurden wir zuerst gezählt, dann mussten wir unser Gepäck stehen lassen und beiseite treten.
Wenn man bei der Nachkontrolle noch was in den Taschen fand, wurde das auch entwendet, selbst Esslöffel. Wir wurden
dann in drei Baracken, ohne Toiletten, eingeschlossen. Die Kameraden haben ihre Bedürfnisse in Kochgeschirre erledigt
und durch ein kleines Fenster, das sich fast unter der Decke befand, hinausgeworfen. Andere Fenster ließen sich nicht
öffnen, weil sie mit Stacheldraht zu geflochten waren. Als die Kameraden die Kochgeschirre auskippten, haben die
Wachposten geschossen und die Fenster zertrümmert. Sie waren der Meinung dass wir ausbrechen wollten. Es herrschte eine
große Hitze, in den überfüllten Baracken sind wir fast erstickt. Am nächsten Tag haben wir uns über fehlende Toilettem
beschwert, da haben sie Heringsfässer durch die Hälfte geschnitten und an der Ausgangstür hingestellt. Um bei den
überfüllten Räumen dort hinzukommen, musste man über die Köpfe der Anderen steigen. Viele hatten Fieber und Durchfall
und mussten in die Krankenstube eingeliefert werden, wo sie kurz darauf verstarben.
Besonders Raucher litten sehr an der Unterernährung, bekamen Wasser in den Beinen und waren die Ersten die verstarben.
Nach der Registrierung wurden wir auf andere Baracken verteilt. Die Zivilbevölkerung kam in die Räume und begann uns
auszuplündern. Wer noch gute Schuhe besaß musste sie ausziehen und bekam dafür die kaputten des Plünderers. Eine Woche
lang mussten wir diesen Zustand ertragen, erst als die Kameraden sich beschwerten, wurde am Eingang eine Tafel am
Eingang angebracht, dass die Zivilbevölkerung das Lager nicht betreten darf. Bis auf einige, wenige Ausnahmen wurde
diese Anweisung befolgt.
Als wir im Lager ankamen, war der französische Lagerkommandant, ein ehemaliger Kriegsgefangener, der bei einem Bauern
in Deutschland gearbeitet hatte. Dieser Bauer war jetzt als Kriegsgefangener in seinem Lager. Als er ihn erkannte, hat
er ihn gleich zum Küchendienst eingeteilt und mit dem nächsten Krankentransport nach Hause fahren lassen. Zu Mittag
bekamen wir nur gekochte Haferkörner, da schwamm alles oben, später war man dann auf Gerste umgestiegen. Als viele
daran gestorben waren, weil sie diese „Rohkost”, die nur ein Kuhmagen verträgt, nicht gegessen haben, hat man die
Körner durch eine Schrotmühle laufen lassen. Dann hat man uns Steckrüben gekocht; wir bekamen 250 Gramm Weißbrot,
etwas Quark und ein viertel Liter Magermilch. Später, als wir schon arbeiten mussten, hat man in unserem Essen einen
Kuhkopf mitgekocht, das hat dann bedeutend besser geschmeckt.
Bevor wir morgens zur Arbeit gingen, mussten wir zu Flaggenparade und abends, nach der Rückkehr, haben wir die Flagge
wieder eingeholt. Wir haben einen Kanal gereinigt, dessen Sohle 2 Meter dick mit Schlamm bedeckt war. Zuerst wurde das
Wasser abgelassen, dann haben wir, einer dem andern, den Schlamm mit der Schippe hoch gereicht. Der Letzte hat den
Schlamm, der so zäh war, dass er nicht von der Schippe wollte, oben am Rande abgelegt. Manchmal waren 10 Mann nötig um
den Höhenunterschied zu überwinden. Das Wachpersonal schoss über unsere Köpfe hinweg und rief: „schnell arbeiten”. Bei
der großen Hitze war das ein Ding der Unmöglichkeit, zumal es nichts zu Trinken gab. Auf dem Heimweg haben wir im Walde
Heilkräuter gesammelt, die man in der Küche getrocknet und als Tee zubereitet hat, den wir am nächsten tag zur Arbeit
mitnahmen, um unseren Durst zu stillen.
Unser Aufseher hatte einen Stock, an dem sich noch kurz abgeschnittene Äste befanden. Wer seiner Meinung nach, nicht
ordentlich gearbeitet hat, bekam gleich Schläge auf den Rücken. Die weißen Aufseher wurden irgendwann durch Neger
ersetzt, die uns bedeutend besser behandelt haben. Wenn irgendetwas schief ging, haben sie nichts gesagt, nur gelacht.
In den übrig gebliebenen Wassertümpeln hatten sich noch einige Aale versteckt, die wir zu fangen versuchten, was uns
auch manchmal gelang. Wir mussten ihnen das Genick brechen, damit sie uns nicht entwischen konnten. Wenn die Franzosen
bemerkten das wir Aale hatten, wurden sie uns abgenommen. Gelang es uns aber, sie ins Lager zu bringen, dann haben wir
uns eine köstliche Malzeit zubereitet.
Um sicherzustellen dass niemand geflüchtet ist, wurden wir, wenn wir abends ins Lager zurückkamen, zuerst gezählt.
Diese Zählung wurde mehrmals wiederholt, weil die Wachmannschaften sich immer wieder verzählt haben. Als einer von uns
hin ging, ihnen sagte dass alle da sind, wollten sie es nicht glauben und haben uns vor dem stehen lassen, bis es ihnen
irgendwann einfiel. uns doch das Tor zuöffnen. Einmal, als wir von der Arbeit zurückgekehrt waren, standen wir bis 23
Uhr neben der Flagge, weil uns niemand das Tor geöffnet hat. Als wir dann doch irgendwie ins Lager kamen haben wir
festgestellt, dass das ganze Wachpersonal betrunken war und niemand im Stande uns das Tor zu öffnen.
Eines Tages waren wir wieder abends zur Parole angetreten, als ein älterer Herr mit seinem Hund, am Stacheldraht
entlang, spazieren ging. Weil der Hund, unterm Stacheldraht hindurch, zu uns kam, hat ihn einer geschnappt, ihm das
Genick gebrochen und unter seiner Jacke versteckt. Der Franzose hat nach seinem Hund gerufen und gepfiffen, aber alles
vergebens, der Hund war nicht aufzufinden. Die Kameraden haben ihm gleich das Fell über die Ohren gezogen, das Fleisch
gekocht und das Fell in die Latrine geworfen. Das Fleisch wurde umgehend verspeist.
Als wir am nächsten Tag von der Arbeit zurückkehrten, war im Lager der Teufel los. Wir mussten sofort antreten und
wurden gefragt, wo der Hund geblieben ist, der Gestern Abend, mit seinem Herrchen, am Zaun entlang spazieren ging. Als
sich niemand dazu bekannte, mussten wir weiterhin stehen bleiben, während die Wachmannschaften von Baracke zu Baracke
gingen und alles durchsuchten. In einer Latrine hat man dann das Fell gefunden, was uns ein furchtbares „Donnerwetter”
einbrachte und in den nächsten Tagen, nach der Arbeit, unter dem Kommando eines Oberfeldwebels, eine Stunde
nachexerzieren.
In Südfrankreich regnet es den ganzen Sommer nicht; die Bauern haben da keine Scheunen und das Getreide wir nur in
Schobern aufgestellt und dann umgehend gedroschen. Vom Oktober bis Dezember regnete es fasst jeden Tag in Strömen.
Gesät wird nur im Frühjahr und im Herbst, weil im Sommer alles vertrocknet. Es wird viel Wein angebaut und die
Steckrübe wächst den ganzen Winter. Neben den Weinreben wurde aus Schieferplatten ein Zaun aufgestellt, um dem Wein
einen optimalen Standort zu sichern. Die Bauernwagen hatten nur zwei Räder und waren nur mit einem Pferd bespannt, das
die ganze Balance des Wagens zu halten hatte. Trotzdem haben sie soviel aufgeladen wie wir auf einen Leiterwagen. Viele
Kameraden wurden den Bauern zur Arbeit ausgeliehen. Wenn ein Bauer einen Arbeiter gebraucht hat und es wurde gefragt,
wer sich in der Landwirtschaft auskennt, da haben sich alle gemeldet. Der Bauer konnte sich dann aussuchen, wen er
mitnehmen wollte.
Wenn wir durch die Stadt zur Arbeit gingen, haben verschiedene Leute Fallobst in die Abfalleimer gelegt. Wenn das von
den Kameraden bemerkt wurde, schwenkten viele aus der Reihe, um sich etwas mit zunehmen, was von den Wachmannschaften
nicht gern gesehen wurde. Viele Kriegsgefangene hatten keine Schuhe mehr, sie haben die Füße nur mit Lumpen bewickelt.
Eines Tages kamen Kameraden aus Norwegen, die nach Deutschland entlassen werden sollten. Mann hat sie jedoch ins Lager
gesteckt und zur Arbeit eingeteilt. In Norwegen hatten sie Kleider und Stoffe eingekauft, hatten volle Seesäcke und
sogar Karren auf 2 Rädern, weil sie ja in die Heimat entlassen werden sollten. Als wir morgens zur Arbeit rausgeführt
wurden standen sie schon vor dem Lager. Wir haben ihnen zugerufen, dass sie uns etwas abgeben sollen, weil ihnen ja
sowieso alles abgenommen wird, aber sie haben uns nur ausgelacht. Als sie ins Lager Kamen mussten sie ihr Gepäck
ablegen, wurden dann wo anders hingeführt und haben es danach nie wieder gesehen.
Durch die vielen Läuse, Flöhe und Wanzen die wie im Lager hatten, kam es bei verschieden Kameraden, an den
Einstichstellen, zu eiternden Entzündungen. Um dem vorzubeugen hat man uns mit einem Pulver, das in Frankreich
hergestellt wurde, aber bei den Parasiten keine Wirkung zeigte, eingesprüht. Erst bei der Anwendung eines Mittels
amerikanischer Herkunft, war alles über Nacht verschwunden.
Der Sonntag war arbeitsfrei. Dann kam ein katholischer, französischer Pfarrer, eskortiert von 3 Mann, mit
aufgepflanztem Seitengewehr ins Lager und hat Gottesdienst gehalten. Einen evangelischen Pfarrer gab es nicht, nur
einen Baptisten Prediger. Der wurde würdevoll eingekleidet, bekam ein großes Kreuz und hat jeden Sonntag in einer
extra dafür hergerichteten Baracke Gottesdienst gehalten. Wer Theologie studiert hatte und sich meldete, wurde zu
einem Seminar geschickt und konnte sein Studium fortsetzen. Glasbläser durften das Lager auch verlassen und ihrem
erlernten Beruf wieder arbeiten.
Wer sich freiwillig, für 5 Jahre, zum Dienst in der Fremdenlegion verpflichtet hat, das waren etliche unter uns, wurde
neu eingekleidet, bekam gutes Essen und Rauchwaren soviel er wollte. Nach einem Jahr wurden, nach und nach, die
Kranken und Körperbehinderten in die Sowjetische Besatzungszone entlassen. Eine Entlassung von Kriegsgefangenen, die
in den Westzonen oder jenseits von Oder und Neise zu Hause waren, war nicht vorgesehen. Die Österreicher wurden alle,
unabhängig von ihrem Gesundheitszustand entlassen.
Ich habe Briefe nach Hause geschrieben, aber die kamen nur bis Allenstein und wurden wieder zurück geschickt. Als eine
Kommission des Roten Kreuzes aus der Schweiz unser Lager besichtigt hat, haben wir uns beschwert, das wir als
Sanitätsdienstgrade, zur Arbeit gehen müssen. Daraufhin erging ein Befehl: Wer einen vom Roten Kreuz, ausgestellten
Ausweis besitzt, gehört einem internationalen Verband an und braucht nicht zu Arbeit gehen. Aus unserem Lager hatten
sich 20 Mann gemeldet, die daraufhin Freigang, in Begleitung von zwei französischen Wachsoldaten erhielten. Als wir
gefragt wurden wo wir hin wollen, entschlossen wir uns, einen Soldatenfriedhof, auf dem unsere verstorbenen Kameraden
beerdigt waren, zu besuchen.
Da der Untergrund in dieser Gegend aus Felsen bestand, wurden die Gräben, in denen die Toten in selbst gezimmerten
Kisten nebeneinander gestellt wurden, mit Hilfe von Dynamit ausgehoben. Ein Leichenwagen, mit einem Pferd bespannt,
das mit einer schwarzen Decke abgedeckt war, wurde von einem Kutscher in angemessener Kleidung, gefahren. Der Wagen
konnte gleichzeitig 4 Kisten transportieren. Wenn wir von der Arbeit kommend, dem Leichenwagen begegneten, wurde
gehalten und mit einer Schweigeminute der Toten gedacht, bis der Wagen vorbei war. Die Zivilbevölkerung verharrte auch
im Schweigen, mit abgenommener Kopfbedeckung.
Ein Kamerad, der in Krottorf, Kreis Oschersleben, bei Magdeburg, zuhause war, sagte bei seiner Entlassung zu mir:
Sollte ich das Glück haben, meine Entlassungspapiere zu erhalten ohne eine Bleibe vorzuweisen, dann soll ich Krottorf
als Heimatadresse angeben. Auf der Krankenstube habe ich angegeben, dass sich noch ein Schrapnellsplitter, aus dem
Ersten Weltkrieg, in meiner Kreuzbeingegend befindet, er zwar verkapselt ist, aber immer noch Beschwerden verursacht.
Daraufhin wurde ich zur Entlassung vornotiert. Als bekannt wurde das ein Rückkehrertransport in die sowjetische
Besatzungszone zusammengestellt wird, habe ich mich sofort gemeldet und wurde für ein Entlassungslager in Angoleme
vorgesehen. War das eine Freude, als uns mitgeteilt wurde, wann der Rücktransport stattfindet.
In unserem Lager waren noch 2 Kameraden aus dem Kreis Ortelsburg: Ein Gustav Lumma aus Leynau und ein Alfred Moritz
aus Groß Schöndamerau. Sie mussten noch zurückbleiben und haben mir den Auftrag erteil, die Angehörigen in der Heimat
zu grüßen und ihnen die Anschrift mitzuteilen. Als wir im Entlassungslager ankamen, fragte man uns nach unserer
Heimatanschrift. Dann wurden die Entlassungspapiere angefertigt. Es wurde uns auch ein Barscheck, für die in Frankreich
geleistete Arbeit ausgehändigt, den wir bei jeder Kasse in Deutschland einlösen könnten. Ich habe ihn bis zum heutigen
Tage nicht einlösen können, obwohl ich irgendwann in der Zeitung gelesen habe, das Verrechnungschecks die den aus
französischer Kriegsgefangenschaft Entlassenen, ausgehändigt wurden, einzulösen sind.
Wir kamen zuerst nach Saar Elbe, dann in die Nähe der Zonengrenze zu Thüringen. Hier mussten wir 2 Tage warten, weil
aus der sowjetischen Besatzungszone keine Eisenbahnwagen bereitgestellt wurden. Angesichts dessen, das der Russe beim
letzten Transport die aus Frankreich kommenden Wagen kassiert und nicht mehr herausgeben wollte, bestand der Franzose
jetzt darauf, seine Wagen sofort wieder mitzunehmen. Als der sehnsüchtig erwartete Zug endlich eintraf, durften wir
umsteigen und kamen, immer noch hinter Stacheldraht, nach Erfurt. Von dort weiter ins Quarantänelager nach Prätsch an
der Elbe.
Unter Androhung von Strafe war es verboten das Lager zu verlassen, doch der Hunger zwang uns dazu, in den umliegenden
Dörfern um Lebensmittel zu betteln. Man drohte uns damit, dass Zuwiderhandlungen, mit einer 14-tägigen Verlängerung der
Quarantäne geahndet werden. Der Roggen war schon reif und wir haben, auf den umliegenden Feldern, die Ähren abgerissen,
das Korn, zwischen 2 Steinen zu Mehl zerrieben, um daraus eine Suppe zu kochen, denn von dem was unsere Lagerküche uns
bieten konnte, war es nicht möglich zu überleben. Als der Eigentümer bemerkte wer seine Roggenähren entwendet hat, kam
er ins Lager, gerade zu dem Zeitpunkt als wir mit dem Mahlen beschäftigt waren. Der Lagerkommandant, bei dem er sich
beschwerte, drohte uns zu bestrafen, wenn wir unsere „Rauzüge” nicht unmittelbar einstellen würden. Wir sagten ihm er
solle uns heimfahren lassen, da wir doch lange genug hinter Stacheldraht gesessen hätten.
Endlich wieder in Freiheit
14 Tage nach unserer Ankunft wurden uns Entlassungspapiere ausgehändigt, sowie auch Fahrscheine
zum den, von uns angegeben Heimatorten. So kam ich nach Krottof, Kreis Oschersleben, zu meinem ehemaligen
Kriegskameraden, bei dem ich einen Tag geblieben bin. Er hatte mir schon eine Stelle bei einem Bauern besorgt, der 70
Jahre alt und kinderlos war. Zum Hof, den er mit seiner Ehefrau bewirtschaftet hat, gehörten 36 Morgen Land, 2 Ochsen
und 3 Kühe. Das Ackerland bestand aus 17 Parzellen und sicherte mir einen Arbeitsplatz.
Jetzt, da ich ein Dach überm Kopf und genug zu essen hatte, fing ich an nach dem Verbleib meiner Familie zu forschen.
Bei meinem letzten Heimaturlaub hatte ich mit meiner Frau verabredet; falls wir uns in den Kriegswirren verlieren
sollten, unsere Kontaktadresse, die meiner Quartiersleute in Burscheid, Kreis Opladen, sein sollte. Ich habe zuerst
nach Rohmanen geschrieben, aber leider keine Antwort erhalten. Dann habe ich nach Burscheid geschrieben, und siehe, -
bei denen lag schon eine Anfrage meiner Frau vor, die nach mir gefragt, und ihre jetzige Anschrift hinterlassen hatte.
Ich habe dem Bauern erzählt dass meine Frau sich zurzeit, auf einem Gut, in Alt Steinhorst, im Kreis Rostock, befindet.
Er war sofort bereit uns ein Zimmer zur Verfügung zu stellen, wenn ich meine Frau nach Krottorf rüberholen wollte. Das
habe ich Ihr mitgeteilt und sie war sofort bereit ihren Wohnsitz nach Krottorf zu verlegen, denn sie wohnte dort in
einem kleinen Stübchen unterm Dach.
Im Herbst, als die Feldarbeit so ziemlich erledigt war, bin ich nach Alt Steinhorst gefahren, um meine Frau und meinen
Sohn Kurt, sowie meinen Sohn Manfred, den ich noch nicht kannte, weil er erst nach der Flucht, am 31. Januar, in Groß
Lüssewitz, geboren wurde, nach Krottorf zu holen. Meine Frau hatte schon Holz für den Winter besorgt und vom Gut, auf
dem sie im Sommer gearbeitet hatte, Mehl und Kartoffeln bekommen. Wir haben das Mehl und andere Habseligkeiten in
Kisten verpackt. Das Holz haben wir einem Bauern gegeben, der uns und unser Gepäck, mit seinem Pferdewagen, zum 14
Kilometer entfernten Bahnhof, nach Ribnitz gebracht hat. Wir sind auch gut in Krottorf angekommen, aber als wir am
nächsten Tag, unsere Kisten vom Bahnhof abholen wollten, haben wir zwar die Kisten vorgefunden, doch der gesamte Inhalt
wurde während der Bahnfahrt entwendet. Die Bahnstation in Krottorf hat die Vorkommnisse zur Kenntnis genommen und
protokolliert, aber unsere Sachen haben wir nie wieder gesehen und mussten wieder bei Null anfangen.
Im Winter musste ich auf der Genossenschaft, unentgeltlich, für die Russen Weizen einsacken. Ich hatte versucht eine
Arbeit als Zimmermann zu bekommen, doch auf dem Arbeitsamt wurde mir gesagt, ich bin Ladwirt und muss auf der
Landwirtschaft arbeiten. Da in den ersten Nachkriegsjahren, auch in der sowjetisch besetzten Zone Arbeitsplätze knapp
waren, mussten auch solche, die einen anderen Beruf erlernt hatten, jede zumutbare Arbeit annehmen. Aus der Heimat
erhielt ich einen Brief, von meiner dort noch lebenden Mutter. Sie schrieb das sie mich noch einmal sehen wollte und
ich sollte doch wieder zurück kommen; Unser Hof wäre nicht von Polen besetzt und sie wäre ganz alleine, weil der Vater
nach dem Durchzug der Front von den Russen erschlagen wurde. Daraufhin habe ich dem polnischen Konsulat in Magdeburg
mitgeteilt, dass ich in Rohmanen eine Landwirtschaft besitze, und um eine Einreisegenehmigung gebeten.
Nach 2 Monaten erhielt ich eine Postkarte, mit der Mitteilung, ich sollte mich persönlich beim Konsulat vorstellen.
Nach Aufnahme meiner Personalien, wurde mir gesagt, das ich benachrichtigt werde wenn mein Antrag genehmigt wird. Ende
Juli 1947 erhielten wir die Einreisegenehmigung nach Ostpreußen, das jetzt unter polnischer Verwaltung stand. Wir
mussten zuerst zum polnischen Konsulat in Berlin-Lichterfelde, wo wir umgeben von einer Trümmerlandschaft, gewartet
haben, bis alle Untersuchungen und Formalitäten erledigt waren.
“ Wieder zurück in Ostpreußen.”
Der schwere Wiederaufbau nach dem Kriege
Dann fuhren wir über Frankfurt/Oder, Posen, Thorn, Allenstein, nach Ortelsburg, wo wir am 2. August 1947 ankamen. Mit
einem zweirädrigen Karren, den ich mir von einem noch in Ortelsburg lebenden Bekanten ausgeliehen hatte und meinem
Sohn Manfred im Kinderwagen fuhren wir nach Rohmanen. Meine Mutter war inzwischen verstorben und auf dem Hof war nur
meine, inzwischen aus Russischer Gefangenschaft wiedergekehrte Schwester, Frieda Pelkowski.

Es war alles ausgeplündert; kein Vieh, keine Maschinen und der ganze Hof mit kniehohem Graß überwachsen. Nur schmale
Trampelpfade, vom Haus zum Holzschuppen und zum Klo, durchkreuzten das satte Grün. Ich habe das Gras auf dem Hof mit
einer Sense, die ich noch gefunden habe, abgemäht, damit der Hof nicht so verwahrlost aussah. Am nächsten Tag habe ich
mich bei der Polizei in Ortelsburg angemeldet, wo ich auch ein Startgeld von 100 Zloty erhielt und Gepäckstücke, die
ich in Krottorf aufgegeben, am Bahnhof abgeholt. Es hat mich sehr gewundert das, das Gepäck überhaupt angekommen ist.
Da man von der Landwirtschaft nicht Leben konnte, habe ich mich in den nächsten Tagen, bei der jetzt polnischen Bahn,
um Arbeit beworben und wurde auch angenommen. Wenn wir unseren Monatslohn bekamen, saß immer einer am Tisch, der von
uns 100 Zloty für den Wiederaufbau von Warschau verlangte. Wenn ich dran war, riefen die Anderen, ich hätte Warschau
zerstört und müsste deshalb 200 Zloty abgeben. Nach 3 Jahren kam eine Verfügung, die besagte, dass wer länger als 1
Jahr bei der Bahn beschäftigt ist, angestellt werden muss. Um diese Bestimmung zu umgehen hat man mich entlassen und
eine Woche später wieder eingestellt.
Als ich vor Ablauf des nächsten Jahres, aus dem gleichen Grunde wieder entlassen wurde, habe ich mich bei der
Stadtverwaltung in Ortelsburg(jetzt Szczytno)beworben, wo ich zuerst im Gaswerk als Heizer und später auf Baustellen
als Zimmermann gearbeitet habe. Wir haben durch den Krieg beschädigte Häuser repariert, in den ehemals touristischen
Zentren einige Ausbesserungen an den Einrichtungen durchgeführt, eine Ziegelei wieder in Betrieb gesetzt und andere
anfallende Arbeiten verrichtet. Im Dach des Rathausturmes war während der Kämpfe eine Granate eingeschlagen, die, die
Dachlatten und die Verschalung zerstört hatte. Da wir, unter schwersten Bedingungen, den Schaden repariert haben,
wurde uns eine Höhenzulage versprochen, die wir aber nicht bekommen haben.
Aus Verärgerung darüber habe ich bei der Stadtverwaltung gekündigt und bei einer Wiederaufbaufirma unter der Leitung
von Bauingenieur Laskowski wieder angefangen, wo ich bis 1954, als Zimmermann beschäftigt war. Ab da habe ich mich
nur um meinen Hof gekümmert, der wegen meiner Arbeitsstellen, gezwungenermaßen, sehr vernachlässigt wurde. Als wir
1947 zurückkamen, brachten wir unseren Sohn Manfred noch im Kinderwagen. Den hat meine Frau zum Markt gebracht,
verkauft, und dafür eine Ziege erworben, die dank guter Pflege, uns täglich mit 4 Liter Milch versorgte. Das war der
erste Baustein zum Wiederaufbau, unserer durch den Krieg zerstörten, und danach ausgeplünderten Landwirtschaft.
Während meiner Arbeit bei der Bahn haben wir uns eine Kuh gekauft, die nach einem halben Jahr, wegen nicht bezahlter
Grundsteuer, vom Gerichtsvollzieher gepfändet wurde. Man hat uns die Kuh weggenommen und bei einem Arbeiter, der in
der Ernst-Mey-Straße in Ortelsburg wohnte und sie wegen nicht vorhandener Futtermittel, nur mit Kartoffelkraut
gefüttert hat, untergestellt. Als ich bei der Bahn meinen Monatslohn bekommen habe, bin ich zur Gmina gegangen, habe
eine Rate angezahlt und durfte dann die Kuh wieder mit nach Hause nehmen. Durch die schlechte Ernährung war die Kuh
stark abgemagert und lieferte nur die Hälfte der ursprünglichen Milchleistung.
Später habe ich ein Pferd auf Abzahlung bekommen, das 140.000 alte Zloty gekostet hat. Die Stute war schwach und unser
Feld sehr hügelig, so dass man nur bergab pflügen konnte, was sehr beschwerlich war, bergauf ging es immer im Leerlauf.
Später habe ich die schweren Böden mit dem Traktor umpflügen, und in den letzten Jahren auch mit dem Binder mähen
lassen. Von der Stute habe ich 2 schöne Fohlen gezogen; ein davon habe ich bei der Ausreise in die Bundesrepublik
mitgebracht und bei der Viehverwertungs-Genossenschaft in Göttingen verkauft. In den ersten Nachkriegsjahren als noch
wenig Land bestellt wurde, breiteten sich auf den nicht beackerten Flächen, Wildkräuter aus. Disteln und andere
Schnellwachsende, erreichten manchmal eine Höhe von 2 Meter, besonders auf den schweren Böden.
Es hat viel Schweiß gekostet ehe man den Acker soweit hatte, das er auch befriedigende Erträge abwarf. Die
Währungsreform von 1950, hat unser weiniges Geld das wir schon gespart hatten, wieder vernichtet. Ich hatte 2 Pferde,
1 Fohlen, 2 Kühe und Schweine, als ich wieder aufgefordert wurde nicht bezahlte Grundsteuern nachzuzahlen. Als ich
nicht bezahlen konnte, hat der Vollziehungsbeamte, ein Fohlen, eine Kuh und ein Schwein gepfändet. Es gelang mir jedoch
nach längeren Verhandlungen, ohne größere Verluste, alles zu regeln. Später kam eine Verfügung, die besagte; wenn
jemand auf seinem Hof nur eine Kuh und ein Pferd hatte, durften sie nicht gepfändet werden. Einige haben ihr Inventar
dieser Verfügung angepasst und dadurch die Zahlung von Grundsteuer umgangen.

Wer seine Steuern pünktlich bezahlt und sein Kontingent an landwirtschaftlichen Produkten fristgerecht abgeliefert hat,
der konnte seine, darüber hinaus erwirtschafteten Produkte zu marktgerechten Preisen verkaufen. Für eine hochtragende
Sterke, mindestens 400 kg schwer, die auf ein staatliches Gut verkauft wurde, konnte man bis zu 12000 Zloty bekommen.
Unsere Böden waren kalkarm, doch durch den Einsatz von Kalk und Kunstdünger konnte man den Ertrag erheblich steigern.
Kalk und Kunstdünger konnte man bei der Genossenschaft(GS) bestellen, der dann auch direkt auf den Hof geliefert wurde.
Kalk wurde geliefert und gleich auf dem Feld ausgestreut. In den 1960ger Jahren waren alle Ackerflächen der Rohmaner
Felder bestellt.
Die nach dem Krieg zurückgebliebenen deutschen Bauernfamilien, aber auch die Polen, die während des Krieges beim Bauern
in Deutschland gearbeitet haben, versuchten mit teils bescheidenen, oder auch zusammen gesuchten, landwirtschaftlichen
Geräten, die bäuerlichen Betriebe aufrecht zu erhalten. Nach den schweren Anfängen in den ersten Nachkriegsjahren
erzielten sie schließlich einen beachtlichen Erfolg, der sich in wogenden Kornfeldern, sowie in grünen Wiesen auf
denen gut genährtes Vieh weidete, widerspiegelte.
Ein schwerer Einschnitt in meinem Leben.
Am 11. Mai 1956 verstarb nach langer schwerer Krankheit, meine liebe Ehefrau Marta Rattay,
geborene Brosch. Ein Jahr zuvor war schon mein Schwiegervater Gottlib Brosch verstorben. Die schweren Bedingungen
unter denen wir nach Kriegende leben mussten, haben ihrer bereits angegriffenen Gesundheit sehr zugesetzt. Sie
verstarb mit 44 Jahren und hinterließ in unserer Familie eine große Lücke, die nicht mehr zu Überbrücken war. Wir
haben sie unter großer Anteilnahme der noch verbliebenen deutschen Bevölkerung zu Grabe getragen und auf dem Rohmaner
Friedhof beigesetzt. Die Arbeit die sie sonst verrichtet hatte fiel jetzt auf mich und meine Söhne zurück. Meine
Schwester Frieda Pelkowski half auch wo sie nur konnte. Wir waren auf die Unterstützung durch Nachbarn und Freunde
angewiesen, die uns immer wenn es nötig war, tatkräftig unterstützt haben. Im laufe der Zeit haben wir wieder zum
Alltag zurück gefunden, haben sie noch etliche Jahre auf dem Friedhof besuchen können, bis wir, bedingt durch unsere
Ausreise uns endgültig von ihr trennen mussten.
Der endgültige Abschied von Ostpreußen
Ab 1956 begannen, durch die Vermittlung des Deutschen Roten Kreuzes, die ersten Ausreisen in die
Bundesrepublik Deutschland. Zuerst waren es Kinder die zu ihren Eltern ausreisen durften, Familien deren Väter aus der
Kriegsgefangenschaft in den Westen Deutschlands entlassen wurden und andere durch den Krieg getrennte
Familienangehörige. Ab 1960 erhöhte sich die Zahl der Ausreisewilligen aus dem polnisch besetzten Ostpreußen. Es setzte
sich die Überzeugung durch, dass unsere Angestammte Heimat, uns für die Zukunft keine Perspektive mehr bieten konnte.
Meistens wurden die Anträge, die wir an die Passabteilung in Allenstein stellen mussten, um einen Ausreisepass zu
bekommen, negativ beschieden. Nach mehrmaligen Versuchen gelang es dann doch, diese begehrte Ausreiseberechtigung in
Empfang zu nehmen. Die Enttäuschung der Zurückgebliebenen war groß, wenn wieder mal Verwandte oder Nachbarn, den Weg
in Richtung Bahnhof einschlugen.
Um einen Reisepass zu beantragen, musste man zuerst eine Einladung von Verwandten aus der Bundesrepublik vorlegen, in
der, diese sich verpflichten mussten, für Unterkunft und Verpflegung der Eingeladenen zu sorgen. Diese Einladung
musste durch ein Amt in der Bundesrepublik beglaubigt werden. Außerdem mussten die Kosten für die Bahnfahrt, ab
polnischer Grenze, bis zum Zielort, beim polnischen Reisebüro ORBIS, in Warschau, in DM eingezahlt werden.
Unseren ersten Ausreiseantrag haben wir 1964, bei der Kommandantur der polnischen Miliz in Allenstein eingereicht, der
nach einer gewissen Zeitspanne, ohne eine uns verständliche Begründung zu nennen, abgelehnt wurde. Gegen diese
Ablehnung wurde ein Widerspruch zugelassen, den wir sofort einreichten. Nach einer weiteren Zeitspanne erhielten wir
wieder eine Ablehnung, gegen die kein Widerspruch mehr zulässig war. Wer seine Ausreiseabsicht nicht aufgeben wollte,
musste einen neuen Antrag stellen. Es gab Familien die schon 10 Mal einen Ausreiseantrag gestellt hatten und immer
wieder abgewiesen wurden. Da meine Söhne, nicht die Absicht hatten in Rohmanen zu bleiben und ich nach 2 Weltkriegen,
an denen ich teilgenommen, die schwere Arbeit auf der Landwirtschaft, nicht aus eigener Kraft schaffen würde, haben wir
1966 wieder einen Antrag gestellt, der prompt abgelehnt wurde. Der Widerspruch auf diese Ablehnung wurde auch negativ
beantwortet, so dass wir 1968 wieder einen Antrag eingereicht haben.
Weil das Passamt in Allenstein lange nichts von sich hören ließ, hegten wir schon die Hoffnung das es jetzt klappen
würde und waren sehr enttäuscht als wieder eine Absage kam. In der Zwischenzeit sind viele Nachbarn und Bekannte aus
Rohmanen, sowie aus der näheren Umgebung, ausgereist und das Häuflein der noch verbliebenen Deutschen, wurde immer
kleiner. Die Motivation, die uns in früheren Jahren, über so manche schwierige Lage hinweg geholfen hat, ist einer
hoffnungslosen Resignation gewichen. Man war davon überzeugt, dass unser Leben, in unser Angestammten Heimat, keine
Zukunftsperspektive mehr haben konnte und wenn wir keine Ausreisegenehmigung bekommen, wir eines Tages die letzten
Deutschen in der ganzen Umgebung sein werden.
Die Ausreise-Heimat ade
Wir hatten die Hoffnung schon aufgegeben, als am 30. April 1969, der Briefträger unseren Hof
betrat und mir einen Brief überreichte, in dem uns das Passamt in Allenstein mitteilte, dass unsere Ausreise in die
Bundesrepublik Deutschland, genehmigt worden ist. Wir müssten, nach Aushändigung der Reisepapiere, den Geltungsbereich
der Volksrepublik Polen, innerhalb von 3 Monaten verlassen. Wir waren zuerst geschockt, über den Hinweis, das wir
unsere Heimat in 3 Monaten verlassen müssen, aber dann stellte sich die Zukunftsperspektive wieder ein und wir gingen,
wie von einem schweren Ballast befreit und gut gelaunt unser weiteren Tätigkeit nach.
Als der Briefträger unseren Hof betrat, waren ich und mein Sohn Kurt gerade dabei eine Fuhre Mist zu laden. Wir hatten
den Wagen gerade halb geladen und haben nach der frohen Kunde nicht mehr weiter gemacht, sondern die Pferde vorgespannt
und den Mist aufs Feld gefahren, damit wir den Wagen für alle Fälle frei hatten. Das war die letzte Tätigkeit für
unsere Landwirtschaft in Ostpreußen.
Die Nachricht von unserer Ausreise verbreitete sich, ohne dass wir darüber gesprochen haben, wie ein Lauffeuer.
Alsbald kamen Leute aus dem Dorf, die sich für das Vieh und für diverse Landwirtschaftliche Geräte interessierten.
Etliche wollten bestimmte Sachen sofort kaufen, andere haben nur zurücklegen lassen und wollten später kommen und
bezahlen, haben es aber dann doch nicht genommen.

Wenn man eine Landwirtschaft hatte, konnte man 2 Pferde, 2 Rinder, 3 Schweine, 5 Schafe und 10 Hühner, in einem
geschlossenen Viehwaggon, in die Bundesrepublik mitnehmen. Jeden Tag war man unterwegs, von einer Behörde zur Andern.
Die Aushändigung der Reisepapiere erfolgte nur nach Vorlage bestimmter Bescheinigungen: Es mussten alle Steuern bezahlt
sein, das Kontingent landwirtschaftlicher Erzeugnisse musste abgeliefert sein, je eine Bescheinigung vom Katasteramt
und vom Notar musste vorgelegt werden, das man dem polnischen Staat das Grundstück abgetreten hat. Die Gebühren für
die notarielle Beglaubigung mussten wir selbst bezahlen. Wenn man alle Bescheinigungen beisammen hatte, bekam man bei
der Kreisverwaltung eine Gesamtbescheinigung. Mit dieser Bescheinigung konnte man nach Allenstein, zur
Polizeikommandantur fahren, wo man nach dem schriftlichen Verzicht auf die polnische Staatsangehörigkeit, einen
Reisepass ausgehändigt bekam, der den Inhaber zum Grenzübertritt berechtigte, aber nicht zur Wiedereinreise.
Wir haben 2 Pferde, eine Sterke, einen Ochsen, 5 Schafe, 2 Schweine und 10 Hühner mitgenommen. Über die Schutzimpfung
der Rinder musste man eine, vom Kreistierarzt beglaubigte Bescheinigung vorweisen. Ich habe 5 Schafsböcke gekauft, die
ich in der Zwischenzeit, hinter der Scheune, zum Weiden angekettet hatte. Einer von denen hat sich losgerissen und
seinen Nachbarn getötet. Das Fleisch konnten wir noch verkaufen, mussten aber dafür einen anderen Schafsbock kaufen.
Innerhalb von 3 Monaten mussten wir alles regeln und zwei Tage vor der Abfahrt einen Eisenbahnwagen, bei der
Eisenbahndirektion in Allenstein bestellen. Reservierungen bei den polnischen Behörden waren meist immer mit
Schmiergeld verbunden, weil man sonst nie sicher sein konnte dass diese Vereinbarungen auch eingehalten werden. Schon
2 Wochen vor unserer Abfahrt, gab es in Ortelsburg keine alkoholischen Getränke zu kaufen. Meine Söhne mussten mit dem
Motorrad die umliegenden Dörfer abfahren, damit wir für die Reise einen Vorrat anlegen konnten; denn Wodka war zu der
Zeit, in Polen, wie eine zweite Währung.
Am 25. Juli haben wir zusammen, mit meinem Neffen Siegfried Brosch, unseren sonstigen Hausrat, der in Kisten verpackt
war, in einen Eisenbahnwagen, auf dem Allensteiner Bahnhof verladen. Alles musste zuerst durch den Zoll, wo die
Federbetten gewogen wurden und über das erlaubte hinausgehende Kissen, verzollt werden mussten. Dasselbe galt auch für
Fleisch und Räucherwaren.
Am 26. Juli, unserem Verladetag, kam der Eisenbahnwagen aus Allenstein, erst um 11 Uhr auf dem Ortelsburger Bahnhof an.
Die Rinder hatten wir zu Fuß, zum Bahnhof gebracht; Schweine, Schafe und Hühner auf dem Pferdewagen. Im Eisenbahnwagen
mussten, mit Hilfe von Brettern und Bohlen, Boxen für die verschiedenen Tiere erstellt werden. Jedes Pferd und jedes
Rind in eine Bucht. Die Schafe zwischen die Pferde, die Schweine zwischen die Rinder und die Hühner in einem Käfig,
unter der Decke über den Rindern. Die Hühner hatten unterwegs Eier gelegt, somit hatten wir jeden Tag frische
Verpflegung. Bei der Fahrt im Viehwagen, begleitete mich mein Sohn Manfred. Als die Lokomotive nahte, um den Wagen
abzuholen, wurden noch schnell die restlichen Sachen hinein geworfen und so mache Abschiedsträne rollte dann die Wange
hinab.
Unsere Nachbarn, Deutsche und Polen, halfen uns beim Verladen des lebendigen Inventars. Jetzt erinnerte ich mich
plötzlich, an die oft auch schönen, Ereignisse der letzten 22 Jahre. Einer Zeit, in der das Zusammenleben von
Deutschen und Polen, von Jahr zu Jahr, besser wurde. Man half sich beim einbringen der Getreideernte, beim Dreschen
des Getreides, bei der Kartoffelernte und bei anderen Arbeiten, wo viele Menschen zupacken mussten. Es war eine
Dorfgemeinschaft, in schweren Zeiten geboren; jeder half jedem wenn Hilfe nötig war. Es wurde mir plötzlich bewusst,
das jetzt ein Lebensabschnitt zu Ende ging, zu dem ich nicht mehr zurückkehren konnte. Unsere Existenzgrundlage war
jetzt ein Eisenbahnwagen auf einem Schienenstrang, dessen Ende irgendwo in weiter Ferne lag. Obwohl, von langer Hand
vorbereitet, war dieser Moment voller Wehmut.
Doch als der Zug sich plötzlich, in Bewegung setzte, war ich sofort wieder in der Gegenwart. Menschen, mit denen man
Jahrzehnte lang, in gutem Einvernehmen zusammen gelebt hat, blieben plötzlich am Bahnsteig zurück und die Entfernung
zwischen ihnen und mir vergrößerte sich mit jeder Sekunde, bis sie letztendlich aus meinem Blickfeld verschwanden.
Es war ein heißer Julitag, als wir unsere Reise gen Westen antraten. Für die Schweine, die besonders unter der Hitze
zu leiden hatten, haben wir 10 Flaschen Essig mitgenommen und sie von Zeit zu Zeit besprenkelt, damit sie besser atmen
konnten. Für die anderen Tiere war reichlich Heu und Hafer vorhanden. Eine großes Fas und zwei Milchkannen waren mit
Wasser gefüllt, die wir auf den an der Strecke liegenden Bahnstationen, bei Bedarf wieder nachgefüllt haben.
Da der Kreistierarzt nicht in seinem Büro war, konnten wir die Impfbescheinigung für das Vieh, nicht rechtzeitig
herbeischaffen. Der Zug setzte sich in Bewegung und die Bescheinigung war immer noch nicht da. Als die Bescheinigung
dann eingetroffen, wir aber schon unterwegs waren, ist mein Sohn Kurt mit dem Motorrad hinterher gefahren und hat uns
in Passenheim, wo der Zug noch andere Wagen angehängt bekam, die Impfbescheinigung übergeben. Wir waren sehr froh das
er es noch geschafft hat, denn in solch einer Situation fühlt man sich sicherer wenn man alle Bescheinigungen bei sich
hat. Auf der Rückfahrt, mit dem Motorrad hatte er noch eine Panne, musste das Motorrad stehen lassen und per Anhalter
nach Hause fahren. Am nächsten Tag kam er mit Siegfried Deptolla, der das Motorrad wieder flott machte und brachte es
wieder nach Rohmanen zurück.
Die Fahrt mit dem Viehwagen, gen Westen
Von Ortelsburg bis Allenstein(45 km) hat unser Zug 4 Stunden gebraucht, weil auf jedem Bahnhof
gehalten wurde, um neue Wagen anzuhängen. Nachdem wir in Allenstein angekommen waren, kam ein Rangierer und fragte
nach unserem Ziel. Als wir ihm mitteilten, das wir in die Bundesrepublik Deutschland wollen, sagte er nur: „In 10
Minuten fährt ein Zug los. Wenn ich von euch 500 Zloty und einen Liter Wodka bekomme, werde euch sofort anhängen,
andernfalls kommt ihr auf ein Nebengleis und müsst dann auf den nächsten Zug warten. Es blieb uns nichts anderes übrig
als seiner Forderung nachzukommen, denn über derartige Erpressungen hat man bereits von Anderen, die vor uns ausgereist
sind, gehört. Wir wurden auch sofort angehängt und fuhren dann die ganze Nacht, an Osterode, und Thorn vorbei bis
Gnesen. Dort wurde wieder rangiert.
Von einer Anhöhe wurden die einzelnen Wagen auf verschiedene Gleise verteilt und zu neuen Zügen zusammengestellt. Der
Aufprall der ungebremsten Wagen erzeugte eine derartige Erschütterung, dass manche Bretter an den Boxen geborsten waren.
Von Gnesen ging es dann in einem Zuge durch bis zur Grenzstation Reppen(Rzepin). Dort mussten wir zum Zollamt, wo
unsere Ausfuhrpapiere durch die Zollbeamten, und durch einen Tierarzt geprüft wurden. Bis Reppen(Rzepin) haben wir für
den Eisenbahnwagen 900 Zloty bezahlt; hier mussten wir noch einmal 650 Zloty bezahlen. Bei der Wagenkontrolle erklärte
uns ein Bahnbeamter das unser Wagen, sich nicht für den internationalen Transport eignet und wir deshalb den Inhalt in
einen Anderen umladen müssen, der irgendwann, auf dem Nebengleis bereitgestellt wird. Nach langer Verhandlung, sowie
einer Zulage von 500 Zloty und einem Liter Wodka haben wir ihn davon überzeugt, das der Wagen sich doch für die
Weiterfahrt eignet.
In der Nacht war Schichtwechsel, der unseren Wagen wieder abgehängt hat, weil er angeblich von der Reichsbahn der DDR,
wegen technischer Mängel nicht weiterbefördert würde. Wir mussten unsere Verhandlung vom Vorabend wiederholen, die mit
der Zusage endete, dass wir am frühen Morgen, über die Grenze auf DDR Gebiet, gebracht werden. Um 5 Uhr morgens kam
eine Lokomotive, die uns den letzten Abschnitt bis über die Grenze bringen sollte. Als der Zug hat noch einmal anhielt,
kamen polnische Grenzbeamte und Soldaten in den Wagen. Sie durchsuchten ihn und fragten, ob wir noch polnisches Geld
oder einen Grundbuchauszug bei uns hätten. Wir zeigten ihnen 800 Zloty, die sie uns, nach Ausstellung einer Quittung
über 500 Zloty, abnahmen. Die Grundbuchauszüge habe ich, im Stroh versteckt, dem Ochsen vor die Füße gelegt. Falls
jemand da suchen sollte, hätte ich gesagt, das das Tier bösartig veranlagt ist, und ich für seine Sicherheit nicht
garantieren könnte, deshalb sollte er vorsichtig sein.
Als die Grenzkontrolle den Zug verlassen hatte, setzte sich die Lokomotive wieder in Bewegung und überquerte nach
kurzer Zeit die Oderbrücke. Auf einer eingezäunten Fläche, jenseits der Grenze, hat man uns abgestellt hat und die
Lokomotive fuhr zurück auf polnisches Gebiet. Vor und hinter uns waren die Tore verschlossen. Auf den Wachtürmen,
links und Rechts von uns, standen Posten mit einem Gewehr im Anschlag. Vier Grenzbeamte der DDR, jeder mit einer
Leiter in der Hand, sowie ein Schäferhund, kamen zu unserem Wagen. Sie öffneten die Schiebetüre, stellten die Leiter
davor und ließen den Hund in den Wagen springen, der nur etwas herum schnupperte und wieder heraussprang. 2 Beamte
haben dann anschließend, die Papiere kontrolliert und das Inventar gezählt.
Nach einiger Zeit wurden wir an einen Güterzug der Reichsbahn angehängt und fuhren von Frankfurt an der Oder, vorbei
an Berlin, Ellingen und Nordhausen, über die Grenze zur Bundesrepublik bis Herzberg. Hier hat ein Zollbeamter der
Bundesrepublik, die Formalitäten erledigt und ein Tierarzt die Pferde, Rinder und Schweine gründlich untersucht. Ich
musste ihnen die Mäuler aufhalten und die Füße hochheben. Danach hat uns die Lokomotive zu einer Wasserzapfstelle
gebracht, wo wir die Tiere tränken und unsere Behälter mit Wasser auffüllen konnten. Anschließen fuhren wir über
Northeim nach Göttingen, zur Viehverwertungsgenossenschaft, die zuvor von unserer Ankunft in Kenntnis gesetzt wurde.
Der Ochse, die Sterke und die Schweine wurden, in Göttingen zum Schlachthof gebracht; die Pferde kamen nach Hannover
und die Schafsböcke nach Kassel. Wir waren mit dem Viehtransport 5 Tage unterwegs; hatten so manche Klippe umschifft
und Schwierigkeiten gemeistert, die im normalen Leben nicht vorkommen.
Wir wurden mit einem PKW, ins Durchgangslager Friedland bei Göttingen gefahren, wo mein Sohn Kurt, meine Schwester
Frieda Pelkowski und Siegfried Brosch mit Familie, die am 30 Juli, um 14 Uhr, von Warschau mit dem Zug abgefahren, und
hier am 31. Juli in den Morgenstunden eingetroffen sind, schon auf uns gewartet haben. In Friedland hat man uns mit
Familie Siegfried Brosch in einem Raum untergebracht, wir wurden registriert und erhielten 20 DM Überbrückungsgeld,
pro Person. Da wir erst am Freitag in Friedland eingetroffen sind, mussten wir hier über das Wochenende bleiben,
obwohl die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der Regel nur 3 bis 4 Tage beträgt.
Um einen Antrag für die Ausreise stellen zu können, brauchten wir eine Einladung von in der Bundesrepublik lebenden
Verwandten. Diese Einladung hat uns mein Bruder, Ernst Rattay, aus Ingelheim am Rhein zugeschickt. Ingelheim liegt im
Bundesland Rheinland-Pfalz. Das Geld für die Bahnfahrt, hat uns, Frieda Schellin, geb. Nickel, aus Duisburg, die
Tochter unseres Nachbarn, überwiesen. In Friedland wurden wir registriert. Im Registrierschein, war als unser
nächster Aufenthaltsort in der Bundesrepublik, das Durchgangslager Osthofen bei Worms, das alle Aussiedler für
Rheinland-Pfalz aufnehmen musste, eingetragen. Die Eintragung erfolgte deshalb, weil der Ort aus dem uns unsere
Einladung zugeschickt wurde, sich auch in Rheinland-Pfalz befand.
Da ich nach dem Polenfeldzug, als Soldat, ein Jahr im Kreis Opladen, im Rheinland gewesen bin, wäre ich sehr gerne in
diese Gegend gezogen, denn die Erinnerung an die schönen Tage die ich dort verlebt habe war in mir immer noch wach.
Ich versuchte die Eintragung in unseren Regiestierscheinen ändern zu lassen, was nach einigen, vielleicht auch
berechtigten Einwänden, am 4. August, vom Beauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen, genehmigt wurde. Anstelle von
Rheinlad-Pfalz stand da jetzt Nordrhein-Westfalen und am 7. August, fuhren wir, noch mit anderen Aussiedlern, ins
Durchgangslager Unna-Massen, am östlichen Rande des Ruhrgebietes gelegen. Hier wurden wir in einem Zimmer untergebracht
und konnten unser Essen in einer Gemeinschaftsküche zubereiten.
Am 8. August wurden wir in Unna-Massen, als Bürger der Bundesrepublik Deutschland registriert, erhielten
Einhundert DM Begrüßungsgeld, den Vertriebenen Ausweis -A -und 4 Wochen später den Bundespersonalausweis. In
Unna-Massen haben wir mehr als 4 Monate verbracht, weil mein Sohn Kurt, wegen fehlender Berufsausbildung, in Unna, an
einem Grundlehrgang für Metallarbeiter teilgenommen hat, der vom Arbeitsamt finanziert wurde. Am 11 Dezember 1969 sind
wir endlich an unserem vorläufigen Wohnsitz, im Durchgangswohnheim, an der Elisabethstraße 13, in Velbert angekommen.
Ab dem 5. Januar 1970 konnten meine Söhne, in der Zahnradfabrik Reining, in Velbert ihrer geregelten Arbeit nachgehen.
Von Bau- und Sparverein in Velbert wurde uns am 20. Juni 1970, unsere erste Wohnung zugewiesen.
Velbert im Februar 1972
gezeichnet: Gustav Rattay
Von Baranowitsche wurden wir wieder auf die Eisenbahn verladen, die uns mit unbekanntem Ziel Richtung Osten fuhr.
Nachdem wir unterwegs einmal zum Essenfassen gehalten haben, kamen wir in der Nacht in Krakau an. In der nächsten
Nacht befanden wir uns schon in den Karpaten, wo wir die Hügelketten zu Fuß überqueren mussten, die Fahrzeuge fuhren
um die Berge herum und wir mussten manchmal 2 Stunden warten bis sie uns wieder eingeholt hatten. So ging es immer
weiter bis wir auf einen Berg kamen wo wir Zelte aufgebaut und Biwak bezogen haben. Dort stießen wir auf türkische
Einheiten die auf Mauleseln Munition und Verpflegung über die Berge transportiert haben. Die Esel hatten ein Gestell
auf dem Rücken, auf jeder Seite eine Fass mit Wasser oder Kisten mit Proviant. Ihre Artillerie wurde von 6 Mauleseln
gezogen, während die Offiziere, ohne Sattel, ohne Zaumzeug, nur mit einem Hanfseil ausgerüstet, daher kamen.
Die Mannschaften marschierten wie es jeder für richtig hielt, mit aufgekrempelten Ärmeln, das Gewehr über den Tornister
gelegt, wie die Wilddiebe. Im Gegensatz dazu herrschte bei uns strenge Disziplin, wen jemand aus der Reihe ging kam
sofort der Kompanieführer angeritten, hat uns angeschrieen, uns klar gemacht dass wir keine Türken seien und nur auf
höheren Befehl etwas an der Marschordnung ändern dürften, wer dagegen verstoße, müsste mit einem 3tägigen Arrest
rechnen. Wir haben hinter der der Front Gewaltmärsche durchgeführt die dem Feind große Truppenaufmärsche vortäuschen
sollten.
Wir lagen in einem Buchenwald in Bereitschaft. Überläufer berichteten dass auf russischer Seite eine Großoffensive
vorbereitet wird. In einer Nacht wurde plötzlich Alarm geschlagen, der Russe war zu einem Angriff mit Gasgranaten
übergegangen. Wir lagen unter Zelten und hatten die Gasmasken gar nicht bei uns, sondern nur etwas abseits liegen. In
der Dunkelheit hat mach einer keine Gasmaske mehr gefunden. Es war ein fürchterliches Durcheinander. Dabei war es
unsere Pflicht die Maske immer an dem Tragriemen über dem Hals zu tragen, mit halb geöffnetem Deckel. Uns hat es zum
Glück nicht so stark betroffen weil wir auf einer Anhöhe lagen und die Gaswolken sich im Tal verteilten. Wir wurden in
höchste Alarmbereitschaft versetzt weil der Russe die österreichische Front durchbrochen hatte.
Eigentlich sollten wir noch an einer Gulaschkanone Essen fassen, aber es blieb uns dazu keine Zeit mehr. Der
Kompanieführer befahl uns die Zelte abzubrechen, auf den Tornister aufzurollen und in fünf Minuten marschbereit zu
sein. Die Kanoniere befanden sich schon in der Batteriestellung, luden die Granaten, die sofort abgefeuert wurden. Der
Battalions-Kommandeur versammelte die Kompanieführer und erteilte ihnen die Angriffsbefehle. Derweil sollten wir in
einem Eichenwal der schon mit Granattrichter übersät war, Deckung suchen. Bald hatten wir die Verbindung zu unserem
Batteriestab verloren. Wir warfen unsere Tornister auf einen Haufen, schwärmten unverzüglich, nur mit Sturmgepäck
ausgerüstet, 4 Handgranaten im Brotbeutel, zum Angriff aus. Wir robbten uns einzeln voran. Weil der Russe unsere
Stellungen schon überrannt hatte war jeder auf sich selbst angewiesen. Mann hörte kein Kommando mehr weil der Russe
inzwischen den Rückzug angetreten hatte, um sich auf einer Bergspitze zu verschanzen, von der er uns mit
Flachbahngeschützen beschoss. Irgendwann befanden wir uns in einem Schützengraben, wo ein Leutnant und 17 Mann aus
unserer Division die Stellung hielten. Unter Androhung von Gewalt befahl er uns den Graben sofort zu verlassen und am
Gegenangriff teilzunehmen. Wir sprangen über den Stacheldraht, duckten uns aber sofort im nächsten Graben damit das
mörderische Maschinengewehrfeuer uns nicht hinwegfegte.
Dort blieben wir bis zum Eintritt der Dunkelheit liegen. Wir konnten unsere Waffen nicht mehr einsetzen weil der Sand
die Gewehrschlösser blockiert hatte. Als es Nacht wurde herrschte ein gespenstische Stille. Wir krochen aus dem
Schützengraben und lauschten nach irgendeinem Lebenszeichen von anderen Kameraden. Dann hörten wir irgendwelche Laute
die wir nicht genau zuordnen konnten. Sie kamen aus einem Holzbunker ganz in der Nähe. Wir näherten uns ganz
vorsichtig, als plötzlich eine Schar österreichischer Soldaten herausstürmte. An unseren Stahlhelmen erkannten sie
dass wir Deutsche sind. Bald danach trafen wir auch auf 69 deutsche Soldaten die zu unserer Division gehörten. Dann
kam ein Hauptmann der uns mit Vorwürfen überschüttete, wir seien Feiglinge, wir hätten uns von unserer Einheit entfernt.
Wir haben ihm den Vorgang geschildert, aber ließ nicht mit sich reden und sagte nur dass wir bestraft werden und nichts
zu essen bekommen. Wir wurden einer Maschinengewehr Einheit zugeteilt welche die vorderste Stellung verteidigen
musste. Wir hatten einen Stollen mit 2 Ausgängen.
Die Russen haben bemerkt das sich etwas bewegte und haben uns unverzüglich mit Artilleriefeuer belegt. Schon die
dritte Granate war ein Volltreffer. Vier Kameraden waren sofort tot, ich bekam mit einem Stollenbrett in den Rücken
der sofort blau und grün angelaufen war. Ich schaute nach oben, alles war verschüttet. Ich wusste nicht das da noch
ein Ausgang war, doch die Kameraden die hier in Stellung waren haben mir geholfen das Freie zu erreichen. Ich habe
mich am nächsten Tag krank gemeldet, dachte 2 Tage Schonung zu bekommen, aber der Sanitäter hat mir nur den Rücken mit
Spiritus eingerieben und mich wieder, zurück zu unserer Kompanie geschickt. Sie bestand nur noch aus 3 Gruppen, die in
einem Stollen, der in einen Berg gehauen war, Stellung bezogen hatten. Wir konnten uns hier wenigstens waschen, an
einer Quelle die aus dem Felsen sprudelte. Wir waren nicht mehr einsatzfähig und mussten durch andere Truppenteile
verstärkt werden.
Beim Essen holen musste man auch das Gewehr bei sich haben, es wurde erzählt dass hier der braune Bär herumwandert.
Ich habe keinen gesehen, nur das die Toten ausgescharrt wurden und verstümmelt herumlagen. Nach einigen Wochen haben
die Deutschen eine Gegenoffensive gestartet, von den Bergen herunter, über den Fluss Zlota Lipa, bis zu einer Stadt
die Brzezany hieß. 2 Tage später wurden wir auch eingesetzt, bei großer Hitze ging es in Dauermärschen vorwärts, man
durfte aus den Flüssen kein Wasser trinken, weil es mit Petroleum verseucht war. Nur wenn es dunkel wurde machten wir
halt, dann mussten wir Gräben ausheben um vor Überraschungen sicher zu sein.
Links von uns war Tarnopol und rechts Rumänien. Wenn es nach einer Ruhepause wieder losging dann war es am schlimmsten,
man ging wie auf Nägel, weil die Füße die Strapazen nicht so ohne weiteres wegsteckten. Im Dorf wurde niemals Rast
gemacht, denn da waren immer Brunnen, zu denen alle hinstürmten. Später wurden Melder vorausgeschickt, die von den
Dorfbewohnern Wasser in Eimern am Weg raussetzen ließen, damit die Soldaten Ihren Durst löschen konnten. Ein Soldat hat
gleich den ganzen Eimer mitgenommen und ihn dann als er leer war, irgendwo am Wegrand stehen lassen. Der Kompanieführer
kam angeritten, hat ihn ausgeschimpft und gedroht, ihn mit 3 Tagen Arrest zu bestrafen. Wir gehörten zur Südarmee
welche von Graf Bothmer befehligt wurde.
Die Stellungen waren schlecht ausgebaut, abends mussten wir, von der 2 Kilometer hinter der Front liegenden Feldküche,
Essen und andren Proviant holen. Ich war der Jüngste der Gruppe, musste immer 9 Kochgeschirre tragen, Brot und Post
habe ich in 2 Sandsäcke, die ich über der Schulter hängen hatte, verstaut. Wenn wir unterwegs waren wurde der
Laufgraben immer beschossen. Einmal schlug eine Granate am Schützengrabenrand ein und hat mich halb verschütte, die
Kochgeschirre aus den Händen gerissen, so dass ich ohne Verpflegung im vorderen Graben ankam. Nach drei Wochen sollten
wir abgelöst werden Es hat jeden Tag geregnet, wir haben unsere Mäntel angezogen und uns mit Zelten bedeckt. Nach dem
wir abgelöst wurden kamen wir in ein Dorf dass von Juden bewohnt war. Die Bewohner waren froh dass wir keine Kosaken
waren, mit denen hatten sie vor ein par Tagen schon schlechte Erfahrung gemacht, die hatten ihnen beim Abzug Vieh und
Pferde weggenommen.
Der Boden war sehr fruchtbar, es wurden Hanf, Weizen, Hafer, Mais, Bohnen, Roggen und Kartoffeln angebaut. Die
Bewohner waren gerade mit der Ernte beschäftigt. Die Häuser waren nur aus Holz und Stroh erbaut. Die Leute lebten in
sehr ärmlichen Verhältnissen. Ich hatte mir in unserer Kantine für 20 Pfennig ein Taschenmesser gekauft, das hat mir
ein Bauer für 6 Eier und 2 Pfund Brot abgekauft, daraus hat er sich dann ein Rasiermesser geschliffen. Wenn unser
Versorgungstross auf denn holperigen Wegen nicht nachkam, haben im Dorf auch Verpflegung eingekauft. Die Leute hatten
Angst dass wir nicht bezahlen werden, doch wir bekamen meistens pünktlich unseren Wehrsold ausgezahlt und konnten uns
so manches genehmigen. Um unser Marschgepäck zu erleichtern haben wir so manches aus dem Tornister weg geworfen.
Unweit eines Dorfes wurde halt gemacht, wir sollten Zelte aufschlagen, doch niemand hatte mehr Zeltstöcke im Tornister,
alles war unterwegs liegen geblieben. Der Zugführer befahl uns ins Dorf zugehen und Stöcke zu besorgen. In einer
Scheune stießen wir auf eine Hühnerschar, mit den Stöcken haben wir einige Hühner erlegt, in einem Hanffeld gerupft
und dann im Eiltempo zurück zu unserer Truppe. Als wir ankamen war die Kompanie schon marschbereit, es gleich weiter,
mit dem Huhn im Tornister. Bei der nächsten Rast haben wir die Hühner ausgenommen und Holz besorgt um sie zu kochen,
doch wir mussten schnell wieder weiter marschieren und erst nach 2 Tagen konnten wir uns mit den Hühnern befassen,
leider waren die so alt das sie nicht gar wurden. Das Fleisch mussten wir wegwerfen, nur die Suppe konnten wir noch
gebrauchen.
Wir lagen in einem Buchenwald in Bereitschaft. Überläufer berichteten dass auf russischer Seite eine Großoffensive
vorbereitet wird. In einer Nacht wurde plötzlich Alarm geschlagen, der Russe war zu einem Angriff mit Gasgranaten
übergegangen. Wir lagen unter Zelten und hatten die Gasmasken gar nicht bei uns, sondern nur etwas abseits liegen. In
der Dunkelheit hat mach einer keine Gasmaske mehr gefunden. Es war ein fürchterliches Durcheinander. Dabei war es
unsere Pflicht die Maske immer an dem Tragriemen über dem Hals zu tragen, mit halb geöffnetem Deckel. Uns hat es zum
Glück nicht so stark betroffen weil wir auf einer Anhöhe lagen und die Gaswolken sich im Tal verteilten. Wir wurden in
höchste Alarmbereitschaft versetzt weil der Russe die österreichische Front durchbrochen hatte.
Eigentlich sollten wir noch an einer Gulaschkanone Essen fassen, aber es blieb uns dazu keine Zeit mehr. Der
Kompanieführer befahl uns die Zelte abzubrechen, auf den Tornister aufzurollen und in fünf Minuten marschbereit zu
sein. Die Kanoniere befanden sich schon in der Batteriestellung, luden die Granaten, die sofort abgefeuert wurden. Der
Battalions-Kommandeur versammelte die Kompanieführer und erteilte ihnen die Angriffsbefehle. Derweil sollten wir in
einem Eichenwal der schon mit Granattrichter übersät war, Deckung suchen. Bald hatten wir die Verbindung zu unserem
Batteriestab verloren. Wir warfen unsere Tornister auf einen Haufen, schwärmten unverzüglich, nur mit Sturmgepäck
ausgerüstet, 4 Handgranaten im Brotbeutel, zum Angriff aus. Wir robbten uns einzeln voran. Weil der Russe unsere
Stellungen schon überrannt hatte war jeder auf sich selbst angewiesen. Mann hörte kein Kommando mehr weil der Russe
inzwischen den Rückzug angetreten hatte, um sich auf einer Bergspitze zu verschanzen, von der er uns mit
Flachbahngeschützen beschoss. Irgendwann befanden wir uns in einem Schützengraben, wo ein Leutnant und 17 Mann aus
unserer Division die Stellung hielten. Unter Androhung von Gewalt befahl er uns den Graben sofort zu verlassen und am
Gegenangriff teilzunehmen. Wir sprangen über den Stacheldraht, duckten uns aber sofort im nächsten Graben damit das
mörderische Maschinengewehrfeuer uns nicht hinwegfegte.
Dort blieben wir bis zum Eintritt der Dunkelheit liegen. Wir konnten unsere Waffen nicht mehr einsetzen weil der Sand
die Gewehrschlösser blockiert hatte. Als es Nacht wurde herrschte ein gespenstische Stille. Wir krochen aus dem
Schützengraben und lauschten nach irgendeinem Lebenszeichen von anderen Kameraden. Dann hörten wir irgendwelche Laute
die wir nicht genau zuordnen konnten. Sie kamen aus einem Holzbunker ganz in der Nähe. Wir näherten uns ganz
vorsichtig, als plötzlich eine Schar österreichischer Soldaten herausstürmte. An unseren Stahlhelmen erkannten sie
dass wir Deutsche sind. Bald danach trafen wir auch auf 69 deutsche Soldaten die zu unserer Division gehörten. Dann
kam ein Hauptmann der uns mit Vorwürfen überschüttete, wir seien Feiglinge, wir hätten uns von unserer Einheit entfernt.
Wir haben ihm den Vorgang geschildert, aber ließ nicht mit sich reden und sagte nur dass wir bestraft werden und nichts
zu essen bekommen. Wir wurden einer Maschinengewehr Einheit zugeteilt welche die vorderste Stellung verteidigen
musste. Wir hatten einen Stollen mit 2 Ausgängen.
Die Russen haben bemerkt das sich etwas bewegte und haben uns unverzüglich mit Artilleriefeuer belegt. Schon die
dritte Granate war ein Volltreffer. Vier Kameraden waren sofort tot, ich bekam mit einem Stollenbrett in den Rücken
der sofort blau und grün angelaufen war. Ich schaute nach oben, alles war verschüttet. Ich wusste nicht das da noch
ein Ausgang war, doch die Kameraden die hier in Stellung waren haben mir geholfen das Freie zu erreichen. Ich habe
mich am nächsten Tag krank gemeldet, dachte 2 Tage Schonung zu bekommen, aber der Sanitäter hat mir nur den Rücken mit
Spiritus eingerieben und mich wieder, zurück zu unserer Kompanie geschickt. Sie bestand nur noch aus 3 Gruppen, die in
einem Stollen, der in einen Berg gehauen war, Stellung bezogen hatten. Wir konnten uns hier wenigstens waschen, an
einer Quelle die aus dem Felsen sprudelte. Wir waren nicht mehr einsatzfähig und mussten durch andere Truppenteile
verstärkt werden.
Beim Essen holen musste man auch das Gewehr bei sich haben, es wurde erzählt dass hier der braune Bär herumwandert.
Ich habe keinen gesehen, nur das die Toten ausgescharrt wurden und verstümmelt herumlagen. Nach einigen Wochen haben
die Deutschen eine Gegenoffensive gestartet, von den Bergen herunter, über den Fluss Zlota Lipa, bis zu einer Stadt
die Brzezany hieß. 2 Tage später wurden wir auch eingesetzt, bei großer Hitze ging es in Dauermärschen vorwärts, man
durfte aus den Flüssen kein Wasser trinken, weil es mit Petroleum verseucht war. Nur wenn es dunkel wurde machten wir
halt, dann mussten wir Gräben ausheben um vor Überraschungen sicher zu sein.
Links von uns war Tarnopol und rechts Rumänien. Wenn es nach einer Ruhepause wieder losging dann war es am schlimmsten,
man ging wie auf Nägel, weil die Füße die Strapazen nicht so ohne weiteres wegsteckten. Im Dorf wurde niemals Rast
gemacht, denn da waren immer Brunnen, zu denen alle hinstürmten. Später wurden Melder vorausgeschickt, die von den
Dorfbewohnern Wasser in Eimern am Weg raussetzen ließen, damit die Soldaten Ihren Durst löschen konnten. Ein Soldat hat
gleich den ganzen Eimer mitgenommen und ihn dann als er leer war, irgendwo am Wegrand stehen lassen. Der Kompanieführer
kam angeritten, hat ihn ausgeschimpft und gedroht, ihn mit 3 Tagen Arrest zu bestrafen. Wir gehörten zur Südarmee
welche von Graf Bothmer befehligt wurde.
Die Stellungen waren schlecht ausgebaut, abends mussten wir, von der 2 Kilometer hinter der Front liegenden Feldküche,
Essen und andren Proviant holen. Ich war der Jüngste der Gruppe, musste immer 9 Kochgeschirre tragen, Brot und Post
habe ich in 2 Sandsäcke, die ich über der Schulter hängen hatte, verstaut. Wenn wir unterwegs waren wurde der
Laufgraben immer beschossen. Einmal schlug eine Granate am Schützengrabenrand ein und hat mich halb verschütte, die
Kochgeschirre aus den Händen gerissen, so dass ich ohne Verpflegung im vorderen Graben ankam. Nach drei Wochen sollten
wir abgelöst werden Es hat jeden Tag geregnet, wir haben unsere Mäntel angezogen und uns mit Zelten bedeckt. Nach dem
wir abgelöst wurden kamen wir in ein Dorf dass von Juden bewohnt war. Die Bewohner waren froh dass wir keine Kosaken
waren, mit denen hatten sie vor ein par Tagen schon schlechte Erfahrung gemacht, die hatten ihnen beim Abzug Vieh und
Pferde weggenommen.
Der Boden war sehr fruchtbar, es wurden Hanf, Weizen, Hafer, Mais, Bohnen, Roggen und Kartoffeln angebaut. Die
Bewohner waren gerade mit der Ernte beschäftigt. Die Häuser waren nur aus Holz und Stroh erbaut. Die Leute lebten in
sehr ärmlichen Verhältnissen. Ich hatte mir in unserer Kantine für 20 Pfennig ein Taschenmesser gekauft, das hat mir
ein Bauer für 6 Eier und 2 Pfund Brot abgekauft, daraus hat er sich dann ein Rasiermesser geschliffen. Wenn unser
Versorgungstross auf denn holperigen Wegen nicht nachkam, haben im Dorf auch Verpflegung eingekauft. Die Leute hatten
Angst dass wir nicht bezahlen werden, doch wir bekamen meistens pünktlich unseren Wehrsold ausgezahlt und konnten uns
so manches genehmigen. Um unser Marschgepäck zu erleichtern haben wir so manches aus dem Tornister weg geworfen.
Unweit eines Dorfes wurde halt gemacht, wir sollten Zelte aufschlagen, doch niemand hatte mehr Zeltstöcke im Tornister,
alles war unterwegs liegen geblieben. Der Zugführer befahl uns ins Dorf zugehen und Stöcke zu besorgen. In einer
Scheune stießen wir auf eine Hühnerschar, mit den Stöcken haben wir einige Hühner erlegt, in einem Hanffeld gerupft
und dann im Eiltempo zurück zu unserer Truppe. Als wir ankamen war die Kompanie schon marschbereit, es gleich weiter,
mit dem Huhn im Tornister. Bei der nächsten Rast haben wir die Hühner ausgenommen und Holz besorgt um sie zu kochen,
doch wir mussten schnell wieder weiter marschieren und erst nach 2 Tagen konnten wir uns mit den Hühnern befassen,
leider waren die so alt das sie nicht gar wurden. Das Fleisch mussten wir wegwerfen, nur die Suppe konnten wir noch
gebrauchen.
Dort blieben wir bis zum Eintritt der Dunkelheit liegen. Wir konnten unsere Waffen nicht mehr einsetzen weil der Sand
die Gewehrschlösser blockiert hatte. Als es Nacht wurde herrschte ein gespenstische Stille. Wir krochen aus dem
Schützengraben und lauschten nach irgendeinem Lebenszeichen von anderen Kameraden. Dann hörten wir irgendwelche Laute
die wir nicht genau zuordnen konnten. Sie kamen aus einem Holzbunker ganz in der Nähe. Wir näherten uns ganz
vorsichtig, als plötzlich eine Schar österreichischer Soldaten herausstürmte. An unseren Stahlhelmen erkannten sie
dass wir Deutsche sind. Bald danach trafen wir auch auf 69 deutsche Soldaten die zu unserer Division gehörten. Dann
kam ein Hauptmann der uns mit Vorwürfen überschüttete, wir seien Feiglinge, wir hätten uns von unserer Einheit entfernt.
Wir haben ihm den Vorgang geschildert, aber ließ nicht mit sich reden und sagte nur dass wir bestraft werden und nichts
zu essen bekommen. Wir wurden einer Maschinengewehr Einheit zugeteilt welche die vorderste Stellung verteidigen
musste. Wir hatten einen Stollen mit 2 Ausgängen.
Die Russen haben bemerkt das sich etwas bewegte und haben uns unverzüglich mit Artilleriefeuer belegt. Schon die
dritte Granate war ein Volltreffer. Vier Kameraden waren sofort tot, ich bekam mit einem Stollenbrett in den Rücken
der sofort blau und grün angelaufen war. Ich schaute nach oben, alles war verschüttet. Ich wusste nicht das da noch
ein Ausgang war, doch die Kameraden die hier in Stellung waren haben mir geholfen das Freie zu erreichen. Ich habe
mich am nächsten Tag krank gemeldet, dachte 2 Tage Schonung zu bekommen, aber der Sanitäter hat mir nur den Rücken mit
Spiritus eingerieben und mich wieder, zurück zu unserer Kompanie geschickt. Sie bestand nur noch aus 3 Gruppen, die in
einem Stollen, der in einen Berg gehauen war, Stellung bezogen hatten. Wir konnten uns hier wenigstens waschen, an
einer Quelle die aus dem Felsen sprudelte. Wir waren nicht mehr einsatzfähig und mussten durch andere Truppenteile
verstärkt werden.
Beim Essen holen musste man auch das Gewehr bei sich haben, es wurde erzählt dass hier der braune Bär herumwandert.
Ich habe keinen gesehen, nur das die Toten ausgescharrt wurden und verstümmelt herumlagen. Nach einigen Wochen haben
die Deutschen eine Gegenoffensive gestartet, von den Bergen herunter, über den Fluss Zlota Lipa, bis zu einer Stadt
die Brzezany hieß. 2 Tage später wurden wir auch eingesetzt, bei großer Hitze ging es in Dauermärschen vorwärts, man
durfte aus den Flüssen kein Wasser trinken, weil es mit Petroleum verseucht war. Nur wenn es dunkel wurde machten wir
halt, dann mussten wir Gräben ausheben um vor Überraschungen sicher zu sein.
Links von uns war Tarnopol und rechts Rumänien. Wenn es nach einer Ruhepause wieder losging dann war es am schlimmsten,
man ging wie auf Nägel, weil die Füße die Strapazen nicht so ohne weiteres wegsteckten. Im Dorf wurde niemals Rast
gemacht, denn da waren immer Brunnen, zu denen alle hinstürmten. Später wurden Melder vorausgeschickt, die von den
Dorfbewohnern Wasser in Eimern am Weg raussetzen ließen, damit die Soldaten Ihren Durst löschen konnten. Ein Soldat hat
gleich den ganzen Eimer mitgenommen und ihn dann als er leer war, irgendwo am Wegrand stehen lassen. Der Kompanieführer
kam angeritten, hat ihn ausgeschimpft und gedroht, ihn mit 3 Tagen Arrest zu bestrafen. Wir gehörten zur Südarmee
welche von Graf Bothmer befehligt wurde.
Die Stellungen waren schlecht ausgebaut, abends mussten wir, von der 2 Kilometer hinter der Front liegenden Feldküche,
Essen und andren Proviant holen. Ich war der Jüngste der Gruppe, musste immer 9 Kochgeschirre tragen, Brot und Post
habe ich in 2 Sandsäcke, die ich über der Schulter hängen hatte, verstaut. Wenn wir unterwegs waren wurde der
Laufgraben immer beschossen. Einmal schlug eine Granate am Schützengrabenrand ein und hat mich halb verschütte, die
Kochgeschirre aus den Händen gerissen, so dass ich ohne Verpflegung im vorderen Graben ankam. Nach drei Wochen sollten
wir abgelöst werden Es hat jeden Tag geregnet, wir haben unsere Mäntel angezogen und uns mit Zelten bedeckt. Nach dem
wir abgelöst wurden kamen wir in ein Dorf dass von Juden bewohnt war. Die Bewohner waren froh dass wir keine Kosaken
waren, mit denen hatten sie vor ein par Tagen schon schlechte Erfahrung gemacht, die hatten ihnen beim Abzug Vieh und
Pferde weggenommen.
Der Boden war sehr fruchtbar, es wurden Hanf, Weizen, Hafer, Mais, Bohnen, Roggen und Kartoffeln angebaut. Die
Bewohner waren gerade mit der Ernte beschäftigt. Die Häuser waren nur aus Holz und Stroh erbaut. Die Leute lebten in
sehr ärmlichen Verhältnissen. Ich hatte mir in unserer Kantine für 20 Pfennig ein Taschenmesser gekauft, das hat mir
ein Bauer für 6 Eier und 2 Pfund Brot abgekauft, daraus hat er sich dann ein Rasiermesser geschliffen. Wenn unser
Versorgungstross auf denn holperigen Wegen nicht nachkam, haben im Dorf auch Verpflegung eingekauft. Die Leute hatten
Angst dass wir nicht bezahlen werden, doch wir bekamen meistens pünktlich unseren Wehrsold ausgezahlt und konnten uns
so manches genehmigen. Um unser Marschgepäck zu erleichtern haben wir so manches aus dem Tornister weg geworfen.
Unweit eines Dorfes wurde halt gemacht, wir sollten Zelte aufschlagen, doch niemand hatte mehr Zeltstöcke im Tornister,
alles war unterwegs liegen geblieben. Der Zugführer befahl uns ins Dorf zugehen und Stöcke zu besorgen. In einer
Scheune stießen wir auf eine Hühnerschar, mit den Stöcken haben wir einige Hühner erlegt, in einem Hanffeld gerupft
und dann im Eiltempo zurück zu unserer Truppe. Als wir ankamen war die Kompanie schon marschbereit, es gleich weiter,
mit dem Huhn im Tornister. Bei der nächsten Rast haben wir die Hühner ausgenommen und Holz besorgt um sie zu kochen,
doch wir mussten schnell wieder weiter marschieren und erst nach 2 Tagen konnten wir uns mit den Hühnern befassen,
leider waren die so alt das sie nicht gar wurden. Das Fleisch mussten wir wegwerfen, nur die Suppe konnten wir noch
gebrauchen.
Beim Essen holen musste man auch das Gewehr bei sich haben, es wurde erzählt dass hier der braune Bär herumwandert.
Ich habe keinen gesehen, nur das die Toten ausgescharrt wurden und verstümmelt herumlagen. Nach einigen Wochen haben
die Deutschen eine Gegenoffensive gestartet, von den Bergen herunter, über den Fluss Zlota Lipa, bis zu einer Stadt
die Brzezany hieß. 2 Tage später wurden wir auch eingesetzt, bei großer Hitze ging es in Dauermärschen vorwärts, man
durfte aus den Flüssen kein Wasser trinken, weil es mit Petroleum verseucht war. Nur wenn es dunkel wurde machten wir
halt, dann mussten wir Gräben ausheben um vor Überraschungen sicher zu sein.
Links von uns war Tarnopol und rechts Rumänien. Wenn es nach einer Ruhepause wieder losging dann war es am schlimmsten,
man ging wie auf Nägel, weil die Füße die Strapazen nicht so ohne weiteres wegsteckten. Im Dorf wurde niemals Rast
gemacht, denn da waren immer Brunnen, zu denen alle hinstürmten. Später wurden Melder vorausgeschickt, die von den
Dorfbewohnern Wasser in Eimern am Weg raussetzen ließen, damit die Soldaten Ihren Durst löschen konnten. Ein Soldat hat
gleich den ganzen Eimer mitgenommen und ihn dann als er leer war, irgendwo am Wegrand stehen lassen. Der Kompanieführer
kam angeritten, hat ihn ausgeschimpft und gedroht, ihn mit 3 Tagen Arrest zu bestrafen. Wir gehörten zur Südarmee
welche von Graf Bothmer befehligt wurde.
Die Stellungen waren schlecht ausgebaut, abends mussten wir, von der 2 Kilometer hinter der Front liegenden Feldküche,
Essen und andren Proviant holen. Ich war der Jüngste der Gruppe, musste immer 9 Kochgeschirre tragen, Brot und Post
habe ich in 2 Sandsäcke, die ich über der Schulter hängen hatte, verstaut. Wenn wir unterwegs waren wurde der
Laufgraben immer beschossen. Einmal schlug eine Granate am Schützengrabenrand ein und hat mich halb verschütte, die
Kochgeschirre aus den Händen gerissen, so dass ich ohne Verpflegung im vorderen Graben ankam. Nach drei Wochen sollten
wir abgelöst werden Es hat jeden Tag geregnet, wir haben unsere Mäntel angezogen und uns mit Zelten bedeckt. Nach dem
wir abgelöst wurden kamen wir in ein Dorf dass von Juden bewohnt war. Die Bewohner waren froh dass wir keine Kosaken
waren, mit denen hatten sie vor ein par Tagen schon schlechte Erfahrung gemacht, die hatten ihnen beim Abzug Vieh und
Pferde weggenommen.
Der Boden war sehr fruchtbar, es wurden Hanf, Weizen, Hafer, Mais, Bohnen, Roggen und Kartoffeln angebaut. Die
Bewohner waren gerade mit der Ernte beschäftigt. Die Häuser waren nur aus Holz und Stroh erbaut. Die Leute lebten in
sehr ärmlichen Verhältnissen. Ich hatte mir in unserer Kantine für 20 Pfennig ein Taschenmesser gekauft, das hat mir
ein Bauer für 6 Eier und 2 Pfund Brot abgekauft, daraus hat er sich dann ein Rasiermesser geschliffen. Wenn unser
Versorgungstross auf denn holperigen Wegen nicht nachkam, haben im Dorf auch Verpflegung eingekauft. Die Leute hatten
Angst dass wir nicht bezahlen werden, doch wir bekamen meistens pünktlich unseren Wehrsold ausgezahlt und konnten uns
so manches genehmigen. Um unser Marschgepäck zu erleichtern haben wir so manches aus dem Tornister weg geworfen.
Unweit eines Dorfes wurde halt gemacht, wir sollten Zelte aufschlagen, doch niemand hatte mehr Zeltstöcke im Tornister,
alles war unterwegs liegen geblieben. Der Zugführer befahl uns ins Dorf zugehen und Stöcke zu besorgen. In einer
Scheune stießen wir auf eine Hühnerschar, mit den Stöcken haben wir einige Hühner erlegt, in einem Hanffeld gerupft
und dann im Eiltempo zurück zu unserer Truppe. Als wir ankamen war die Kompanie schon marschbereit, es gleich weiter,
mit dem Huhn im Tornister. Bei der nächsten Rast haben wir die Hühner ausgenommen und Holz besorgt um sie zu kochen,
doch wir mussten schnell wieder weiter marschieren und erst nach 2 Tagen konnten wir uns mit den Hühnern befassen,
leider waren die so alt das sie nicht gar wurden. Das Fleisch mussten wir wegwerfen, nur die Suppe konnten wir noch
gebrauchen.
Die Stellungen waren schlecht ausgebaut, abends mussten wir, von der 2 Kilometer hinter der Front liegenden Feldküche,
Essen und andren Proviant holen. Ich war der Jüngste der Gruppe, musste immer 9 Kochgeschirre tragen, Brot und Post
habe ich in 2 Sandsäcke, die ich über der Schulter hängen hatte, verstaut. Wenn wir unterwegs waren wurde der
Laufgraben immer beschossen. Einmal schlug eine Granate am Schützengrabenrand ein und hat mich halb verschütte, die
Kochgeschirre aus den Händen gerissen, so dass ich ohne Verpflegung im vorderen Graben ankam. Nach drei Wochen sollten
wir abgelöst werden Es hat jeden Tag geregnet, wir haben unsere Mäntel angezogen und uns mit Zelten bedeckt. Nach dem
wir abgelöst wurden kamen wir in ein Dorf dass von Juden bewohnt war. Die Bewohner waren froh dass wir keine Kosaken
waren, mit denen hatten sie vor ein par Tagen schon schlechte Erfahrung gemacht, die hatten ihnen beim Abzug Vieh und
Pferde weggenommen.
Der Boden war sehr fruchtbar, es wurden Hanf, Weizen, Hafer, Mais, Bohnen, Roggen und Kartoffeln angebaut. Die
Bewohner waren gerade mit der Ernte beschäftigt. Die Häuser waren nur aus Holz und Stroh erbaut. Die Leute lebten in
sehr ärmlichen Verhältnissen. Ich hatte mir in unserer Kantine für 20 Pfennig ein Taschenmesser gekauft, das hat mir
ein Bauer für 6 Eier und 2 Pfund Brot abgekauft, daraus hat er sich dann ein Rasiermesser geschliffen. Wenn unser
Versorgungstross auf denn holperigen Wegen nicht nachkam, haben im Dorf auch Verpflegung eingekauft. Die Leute hatten
Angst dass wir nicht bezahlen werden, doch wir bekamen meistens pünktlich unseren Wehrsold ausgezahlt und konnten uns
so manches genehmigen. Um unser Marschgepäck zu erleichtern haben wir so manches aus dem Tornister weg geworfen.
Unweit eines Dorfes wurde halt gemacht, wir sollten Zelte aufschlagen, doch niemand hatte mehr Zeltstöcke im Tornister,
alles war unterwegs liegen geblieben. Der Zugführer befahl uns ins Dorf zugehen und Stöcke zu besorgen. In einer
Scheune stießen wir auf eine Hühnerschar, mit den Stöcken haben wir einige Hühner erlegt, in einem Hanffeld gerupft
und dann im Eiltempo zurück zu unserer Truppe. Als wir ankamen war die Kompanie schon marschbereit, es gleich weiter,
mit dem Huhn im Tornister. Bei der nächsten Rast haben wir die Hühner ausgenommen und Holz besorgt um sie zu kochen,
doch wir mussten schnell wieder weiter marschieren und erst nach 2 Tagen konnten wir uns mit den Hühnern befassen,
leider waren die so alt das sie nicht gar wurden. Das Fleisch mussten wir wegwerfen, nur die Suppe konnten wir noch
gebrauchen.
Unweit eines Dorfes wurde halt gemacht, wir sollten Zelte aufschlagen, doch niemand hatte mehr Zeltstöcke im Tornister, alles war unterwegs liegen geblieben. Der Zugführer befahl uns ins Dorf zugehen und Stöcke zu besorgen. In einer Scheune stießen wir auf eine Hühnerschar, mit den Stöcken haben wir einige Hühner erlegt, in einem Hanffeld gerupft und dann im Eiltempo zurück zu unserer Truppe. Als wir ankamen war die Kompanie schon marschbereit, es gleich weiter, mit dem Huhn im Tornister. Bei der nächsten Rast haben wir die Hühner ausgenommen und Holz besorgt um sie zu kochen, doch wir mussten schnell wieder weiter marschieren und erst nach 2 Tagen konnten wir uns mit den Hühnern befassen, leider waren die so alt das sie nicht gar wurden. Das Fleisch mussten wir wegwerfen, nur die Suppe konnten wir noch gebrauchen.
Meine Verwundung am Pruth.
Wir befanden uns 8 km vor der russischen Grenze. Der Kompanieführer hatte uns informiert das
wir hier zum Einsatz kommen. Wir bekamen noch ein Mittagessen aus der Gulaschkanone, konnten unsere Feldflaschen mit
Tee, der mit Rum angereichert war, auffüllen, Munition und Handgranaten in Empfang nehmen und dann ging es zum Einsatz.
Um 3 Uhr begann das ganze Bataillon auszuschwärmen, sofort hat uns der Russen entdeckt und begann uns mit Artillerie
zu beschießen, je weiter wir vorrückten desto heftiger.
Bis zu einem Eisenbahndamm hatten wir gute Deckung, doch wir sollten den dahinter fließenden Fluss überqueren. Doch
plötzlich explodierte über meinem Kopf eine Schrapnellkugel, der Stahlhelm wurde mir vom Kopf gerissen, Tornister und
Koppel flogen auch weg, ich lag auf der Erde und wusste gar nicht was passiert war. Plötzlich fing Blut aus der
Kreuzbeingegend zu rieseln, aus dem rechten Oberschenkel auch. Gleich nebenan war ein Granattrichter, dort habe ich
Schutz gesucht. In der rechten Rockecke hatte man immer ein großes Verbandspäckchen, das habe ich herausgenommen und
auf die Wunde gedrückt, doch das Blut floss mir bis in den Stiefel. Links und rechts von mir schlugen Granaten ein,
dicke Erdbrocken und Schlamm fielen auf mich herab, doch in meinem Erdloch war ich vor Maschinengewehrsalven geschützt.
Der ganze Rücken war angeschwollen und ich konnte mich überhaupt nicht bewegen.
Die Deutschen mussten die Stellung den Russen überlassen, einer hatte mich entdeckt, da ich aber so blutverschmiert da
lag, hat er bestimmt gemeint ich wäre nicht mehr am leben und ist weitergegangen. Nach zwei Stunden habe ich gehört
das die Russen sich wieder zurückzogen, danach herrschte eine gespenstische Stille. Als es dunkel wurde kamen deutsche
Sanitäter mit Spürhunden und haben die Verwundeten aufgesammelt. Ich wurde auf eine Trage gelegt, lag gebeugt und
konnte mich nicht rühren weil der blutverschmierte Rücken völlig verkrustet war. Ein Pferdegespann konnte nur vier
Tragen befördern, die Fahrt über Ackerfurchen war eine Tortur, ich habe nicht geglaubt das ich es überleben werde. In
einer Dorfkirche wurden wir dann ausgeladen und zu den etwa 50 Verwundeten gelegt die da schon lagen.
Mich haben sie zu den Bauchschüssen gelegt, weil ich einen Nervenschock hatte und am ganzen Körper gezittert habe. Zu
trinken bekam ich nichts, nur einen feuchten Lappen in den Mund. Ich sollte gleich operiert werden, aber es kamen
immer mehr Verwundete, so bekam ich nur eine Tetanusspritze, wurde verbunden und für den Weitertransport ins Hinterland
vorbereitet. Im Morgengrauen wurden wir auf Lastautos verladen, die aus auf ein Landgut brachten, wo wir in einem
Pferdestall untergebracht wurden. Die Fahrer fuhren so schnell über die Granatlöcher, das wir vor Schmerzen geschrieen
haben. Wir baten sie langsamer zu fahren, aber die bekamen es in ihrem Führerhaus nicht mit, erst alt ein Verwundeter,
der einen Krückstock bei sich hatte von hinten die Scheibe einschlug wurde die Fahrt erträglich. Lastautos, die
Munition und Verpflegung an die Front transportiert hatten, brachten in den nächsten Tagen immer wieder Verwundete
ins Hinterland. Die Deutschen hatten an diesem Fronabschnitt hohe Verluste zu beklagen. Wir können von Glück reden
dass wir dem Höllenfeuer überhaupt entkommen sind.
Wir wurden mit Lastautos, die ein Feldlazarett uns geschickt hatte, bis nach Lemberg befördert. da wurden wir gewaschen,
rasiert und frisch verbunden. Auf einem Nebengleis stand ein Lazarettzug, in dem wurden wir anschließend in frisch
bezogenen Betten untergebracht. Der Zug brachte uns über Annaberg nach Freiburg in Sachsen, eine Stunde hinter Dresden.
Hier wurden wir auf Tragen gebettet und mit einem Möbelwagen in ein Reservelazarett transportiert.
Im Heimatlazarett.
Als ich am nächsten Tag aufwachte und das schöne Bett sah in dem ich lag, dachte ich dass ich
im Himmel bin. Ich dankte meinem Herrgott das er mich bis zu diesem Ort begleitet hat. Am Nachmittag kamen Schulkinder
mit Geschenken und haben uns schöne Lieder vorgesungen. Anhand von Röntgenaufnahmen wurde in den nächsten Tagen
festgestellt dass bei mir ein Schrapnellsplitter an der Wirbelsäule in die Kreuzbeingegend eingedrungen war. Ich wurde
jeden Tag in Salzwasser gebadet und bekam wieder volle Verpflegung, da mein Magen zum Glück nicht verletzt war. Auf
dem Transport bekam ich nur Suppe und bei Bedarf einen feuchten Lappen auf die Lippen. Ich bin von 62 auf 43 Kilogramm
abgemagert, gehen konnte ich wegen dem Nervenschock den ich bei der Verwundung erlitten hatte auch noch nicht. Die
Wunde am rechten Oberschenkel war nur ein Streifschuss und wurde mit einem Schutzverband versorgt.
In den nächsten Tagen habe ich einen Brief nach Hause geschrieben und mitgeteilt wo ich mich zurzeit befinde. Meine
Eltern schickten mir ein Paket mit Lebensmitteln, jetzt konnte ich essen was ich wollte. Das Essen im Lazarett war
nicht besonders, jeden Tag nur Kohlblätter. Der weg zu den Toiletten führte durch einen Gemüsegarten. Die gehfähigen
Kameraden haben den ganzen Kohlrabi aufgegessen, so dass schließlich Wachposten aufgestellt werden mussten. Sechs
Wochen lang konnte ich mich nur auf allen Vieren fortbewegen, denn sobald ich mich aufrichtete wurde es mir
schwindelig und ich musste zurück ins Bett.
Als ich wieder bei Kräften war habe ich meinen Eltern mitgeteilt das ich mich in ein Lazarett in ihrer Nähe verlegen
lassen will. Der Chefarzt hatte mir zugesichert, wenn die Möglichkeit besteht in Ortelsburg unterzukommen, wird er dem
zustimmen. Meine Mutter hat daraufhin, in Ortelsburg, beim Lazarettinspektor Zantopf nachgefragt und er hat angedeutet
das sie mich aufnehmen können. Daraufhin bekam ich die Krankenpapiere und einen Fahrschein nach Ortelsburg. Da ich als
Soldat nie Heimaturlaub hatte, beschloss ich zuerst meine Eltern zu besuchen. Ich fühlte mich noch sehr schwach, habe
nach jedem Kilometer Rast gemacht, aber letztendlich war ich wieder daheim bei meinen Eltern. Die Wiedersehensfreude
war sehr groß. Ich bin am 30 Juli verwundet worden und am gleichen Tag wurde mein ältester Bruder beerdigt. Er bekam
den Splitter einer Gasgranate ins rechte Bein und ist an einer Blutvergiftung verstorben.
Am nächsten Tag brachte mich mein Vater ins Garnisonslazarett nach Ortelsburg. Ich wurde jeden Tag gebadet und massiert,
weil die Rückenhaut am Knochen angewachsen war konnte ich mich nicht schmerzfrei bücken. In Ortelsburg verbrachte ich
noch sechs Wochen, bis Ende Oktober, da wurde es schon ziemlich kalt und in unserer Barackenunterkunft ziemlich
ungemütlich. Kohlen und anderes Brennmaterial lagen im Hof auf Halde, aber es war verboten zu heizen. Kameraden die in
der Nähe zu Hause waren konnten Sonntagsurlaub beantragen.
Einer von ihnen brachte von zuhause Brennholz mit und entzündete damit im Ofen ein wärmendes Feuer, andere holten vom
Hof Kohlen, so dass der Ofen in kurzer Zeit glühend heiß wurde und die Gefahr bestand das die Betten Feuer fangen
würden. Wir hatten die Betten schon weg gerückt, da kam der Feldwebel herein und fragte wer das Feuer im Ofen
angezündet hat, doch niemand fühlte sich angesprochen. Der Feldwebel hatte den Vorfall dem Stabsarzt gemeldet, als der
am nächsten Morgen zur Visite kam, war seine erste Frage: ”Wer hat gestern Abend das Feuer im Ofen angezündet”. Als
sich niemand meldete, schrie er uns an: ”Morgen wird alles entlassen, zum Ersatzbatallion, in Diez an der Lahn! Wer
gehen kann, sofort zur Schreibstube, Krankenpapiere und Fahrscheine abholen”. Er erinnerte uns noch daran am nächsten
Tag pünktlich am Bahnhof zu sein, weil eine Verspätung unangenehme Folgen für uns haben würde. Das war das Ende der
schönen Erholungsphase. Ich blieb noch eine Nacht zu Hause und bin dann am nächsten Tag von dort zum Bahnhof gegangen.
Wieder Kriegsverwendungsfähig.
Als wir am nächsten Tag in Diez angekommen waren, wurde ich gefragt ob ich aus dem Heimaturlaub
käme, als ich das verneinte wurden mir 2 Tage genehmigt und 14 Tage Genesungsurlaub dazu. Wieder zurück im
Ersatzbatallion bestand unsere Tätigkeit aus Wache schieben und Kartoffel schälen. Nach einem Monat wurden wir von
einem Generalarzt untersucht, er hat mich für nicht einsatzfähig befunden weil ich noch den Steckschuss im Rücken
hatte und das linke Bein 10 Zentimeter dünner war. Jetzt fing das Kasernenleben wieder von vorne an. Wachdienst,
Gewehr laden, sichern, Ehrenbezeugung, Einzelmarsch und Appell. Wer nicht weit nach Hause hatte bekam zu Weihnachten
Urlaub. Ich hatte zu Heiligabend und Silvester Torwache, denn nach Ostpreußen wurde niemand beurlaubt.
Nach Neujahr 1918 wurden wir neu eingekleidet und kamen nach Köln zur Baukompanie. Mit Musik wurden wir zum Bahnhof
gebracht. In Köln wurden wir noch mit Soldaten die von andern Truppenteilen dorthin verlegt wurden in einem großen
Kinosaal, im Stadtteil Edengarten untergebracht. Wir brauchten keinen Dienst zu machen und konnten zu Heilige Drei
Könige den Gottesdienst im Dom besuchen. Kameraden die aus irgendwelchen Gründen im Arrest saßen wurden gefragt ob sie
auch am Gottesdienst teilnehmen möchten, dann würde ihnen die Strafe erlassen. Fast alle haben dem zugestimmt. Einige
Tage später wurden wir wieder auf einen Transportzug verladen, der uns über Herbestal, Antwerpen nach Brügge in Belgien
brachte. Hier mussten wir den Zug kurzfristig verlassen und einen Luftschutzkeller aufsuchen, weil Fliegeralarm
gemeldet wurde. Danach ging es wieder weiter nach Turut, Kortemark, Hauseme, Kautremollen, Zaren, Zarenlinde. Dort
wurden wir in verschiedene Gruppen aufgeteilt und einer Pionierkompanie auf dem Pionierpark Struwendorf zugewiesen.
Wir haben hinter Klerken Bunker für schwere Maschinengewehre gebaut. Unsere Arbeit konnten wir nur bei Nebel verrichten,
denn bei Sonnenschein waren wir sofort dem Beschuss der feindlichen Artillerie ausgesetzt. eine Kleinbahn die Munition
und Stacheldraht an die Front brachte war dem Beschuss besonders ausgesetzt. Die Gleise, von schweren Geschossen
zerfetzt, mussten immer wieder hergerichtet werden, damit der Nachschub aufrechterhalten werden konnte. Später haben
wir am Kemelberg bei Armentier, eine Brücke über die Lys gebaut. Um in dem Sumpfgelände einen Untergrund dafür zu
schaffen, mussten wir 10 bis 12 Meter lange Pfähle in den Boden rammen. Ein Feldwebel gab immer den Befehl: „Hoch den
Bär, noch viel mehr, dass man sieht, wie er zieht, denn dieser Pfahl, glatt wie ein Aal, durch Fels und Stein, durch
Wasser und Sand, fürs Vaterland”. Jedes mal mussten wir den Bär an Schnüren hochziehen und dann wieder herunterlassen.
Wenn es manchmal, trotz vieler Mühe nicht mehr weiter ging wurde der Pfahl auf eine bestimmte Länge abgeschnitten.
Nach Fertigstellung der Brücke kamen wir in die Siegfriedstellung bei Kambrei, zum Bau eines Bataillons-Gefechtstandes.
Da der Boden kreidehaltig war, mussten wir die großen Stücke von Hand zu Hand reichen, den Schutt haben wir dann mit
Sandsäcken aus der Baugrube gehoben und mit Ästen getarnt, damit der Stand nicht von feindlichen Fliegern entdeckt
werden konnte. Alle acht Stunden wechselte die Arbeitsgruppe. Wir mussten von der Baustelle durch das Gelände robben,
denn aufrecht gehend war man dem Beschuss der feindlichen Scharfschützen ausgesetzt, die von einem Fesselballon aus
informiert wurden der über den feindlichen Linien stand.
Der Wechsel war mit einem großen Risiko verbunden, und wurde wenn Möglich bei Dunkelheit vollzogen. Um vor
Überraschungen sicher zu sein haben wir spanische Reiter (Stacheldrahtverhaue) gebaut und vor die ersten Gräben
gestellt, die dann oft in der Nacht von den Franzosen geklaut, und dann vor ihren eigenen Linien wieder aufbaut wurden.
Wir hatten aus Bohlen eine Brücke auf Rädern gebaut, die dann in den Graben geschoben wurde, damit die Artillerie und
andere Fahrzeuge über die Schützengräben kamen. Weil um vier Uhr morgens der Beschuss mit Gasgranaten begann, mussten
wir Gasmasken aufsetzen, danach haben feindliche Flieger unsere Munitionskolonne bombardiert und total aufgerieben.
Es wurde auch eine Marinedivision eingesetzt, die bis dahin dem Küstenschutz gedient hatte und jetzt ihren ersten
Einsatz hatte.
Wir sind zuerst ein ganzes Stück in Richtung Amiens vorangekommen, doch dann blieb unser Angriff in den zuvor von
Engländern besetzten Stellungen, stecken. Da die Engländer ihre Stellungen fluchtartig verlassen hatten, fiel ihr
ganzer Proviant in unsere Hände; Schokolade, Weißbrot, Flaschenwein. Die erste Nacht haben wir in einem runden Zelt
verbracht, weil ich mir durch den starken Wind, der da herrschte eine Angina zugezogen hatte, die mit hohem Fieber
verbunden war, konnte ich die vielen Köstlichkeiten überhaupt nicht genießen.
An eine ärztliche Versorgung war überhaupt nicht zu denken, denn es mussten zuerst die vielen Granatlöcher eingeebnet
werden damit die vielen Fahrzeuge und Geschütze wieder weiter fahren konnten. Auch eine Bahnlinie musste repariert
werden, damit die großen Geschütze in Stellung gebracht werden konnten, dabei wurden auch die vielen Kriegsgefangenen,
die bei dieser Offensive gemacht wurden, eingesetzt. Als die Offensive dann schließlich scheiterte, wurden wir an die
Somme verlegt. Da habe ich die Ortelsburger Jäger, die aus Italien an die Westfront verlegt wurden, zum ersten Mal im
Einsatz gesehen.
Unser nächster Einsatzort waren dann Stellungen hinter Laon. Hier wurden die Vorbereitungen zu einer neuen Offensive
getroffen. Feindliche Flieger versuchten uns Tag und Nacht daran zu hindern die Aufmarschwege instand zu halten. Als
die Offensive dann endlich losging, hatten wir die Order eine Brücke über die Oise mit Bohlen und Balken zu verstärken.
Gleich am Anfang der Offensive mussten wir Gasmasken anlegen, um für alle Fälle gewappnet zu sein. Nur die Artillerie
und Kraftfahrzeuge durften die Landstraße benutzen, die Infanterie ging immer im Straßengraben und wurde von einer
Seite von Kopf bis Fuß mit Dreck bespritzt. Die Franzosen und Engländer haben hier schon Panzer eingesetzt, die von
Truppen aus den Kolonien gefahren wurden. Die Australier gingen mit umgekrempelten Ärmeln hinter den Panzern her.
Die letzte Offensive des Ersten Weltkrieges.
Zum Jahresende 1917 hatten noch 153 deutsche 175 alliierten Divisionen gegenübergestanden.
Zur Vorbereitung der Offensive ließ Ludendorff 39 Divisionen aus dem Osten und aus Italien heranziehen. Er ließ
spezielle Angriffsdivisionen formieren, die durch intensive Ausbildung auf den beabsichtigten, schnellen Vormarsch
vorbereitet wurden. 6608 Geschütze, 3500 Minenwerfer und 1070 Flugzeuge wurden hinter dem vorgesehenen
Angriffsabschnitt konzentriert. Den Ausbildungsbefehlen Ludendorffs, die bis zu den Kompanieführern herab verteilt
wurden, konnte man entnehmen, dass der Versuch, den Krieg mit einem mächtigen Schlag zu entscheiden schon in der
nächsten Zeit gewagt werden sollte. Wir übten die fast vergessenen Formen des Schützengefechts und des
Bewegungskrieges, auch wurde eifrig mit Gewehr und Maschinengewehr geschossen. Wir hegten keinen Zweifel daran, dass
der große Plan gelingen würde.
Den ganzen Winter 1917/18 über plante der Generalquartiermeister Ludendorff die deutsche Offensive. Zwar hatten die
Vereinigten Staaten von Amerika dem Deutschen Reich am 6. April 1917 den Krieg erklärt, aber vor dem Sommer des
Jahres 1918 war mit dem Auftreten von US-Truppen in relevanter Größenordnung nicht zu rechnen. Der deutschen Führung
blieb nur ein schmales Zeitfenster, um die Niederlage und den zu erwartenden Diktatfrieden abzuwenden. Ypern,
Armentieres, Arras, Cambrai oder Verdun wurden ernsthaft als Schauplätze erwogen. Ludendorf entschied sich für einen
Angriff zwischen Cambrai und La Fere – genau an der Nahtstelle zwischen der Französischen Armee und dem britischen
Expeditionscorps.
Der Fluss Somme bildete die Grenze zwischen Franzosen und Briten. Die Briten – nicht die Franzosen – sollten das Ziel
des Vorstoßes werden. Ihre Stellungen waren nur 130 Kilometer von der Kanalküste entfernt. Beim erreichen der
Sommemündung wäre die gesamte britische Armee eingeschlossen gewesen, denn hinter ihnen lag die Straße von Dover.
Am 21. März 1918 begann die letzte entscheidende Offensive des deutschen Westheeres im Ersten Weltkrieg. Der
Angriffsstreifen war 75 Kilometer breit. Dort hatte Ludendorff 43 Angriffsdivisionen konzentriert, dahinter 30
weitere Reservedivisionen, ihnen standen lediglich 26 britische Divisionen gegenüber. „Michael“ – so der Deckname der
„Kaiserschlacht“ – lief dank Ludendorffs akribischer Vorbereitung gut an. Der britische Oberbefehlshaber General
Douglas Haig erkannte die Chance, welche die Deutschen in dieser Situation hatten. Wollten die Deutschen diese Chance
nutzen, mussten sie darauf verzichten die Somme zu überschreiten, wo sie auf die französischen Reserven treffen und
sich von der Küste entfernen würden. Genau diesen Fehler begingen jedoch die Deutschen.
Am dritten Tag überschritt der linke Flügel mit der 18. Armee die Somme. Ludendorf stellte die Taktik über die
Strategie, wie er das bei Tannenberg und der Schlacht an den Masurischen Seen auch schon getan hatte. Ludendorffs
Befehl an die 18. Armee vom Abend des 22. März 1918 lautete: „Jetzt gilt es den Sieg auszunutzen, den Feind nicht zum
Stehen kommen zu lassen, Somme und Crozat-Kanal zu überschreiten, bevor feindliche Verstärkungen wirksam werden“.
Was Haig befürchtet hatte, trat nicht ein. Die deutsche Offensive Lief weiter Richtung Süden und lief sich schließlich
tot. Am 31 März war Ludendorff zu der Erkenntnis gekommen, dass „Michael“ gescheitert war. Am 5. April wurde die
Einstellung der Offensive befohlen. Im Hochsommer waren die US-Truppen in Frankreich angekommen und gingen mit den
Franzosen zum Angriff vor. Nur mühsam konnten Hindenburg und Ludendorf den Zusammenhalt der Front waren. Am 24. Oktober
1918 forderte US-Präsident Woodrow Wilson die bedingungslose Kapitulation, am 11.Nuvember Wurde der Waffenstillstand
von Compiegne unterzeichnet.
Zusammenbruch der Westfront und Waffenstillstand .
Als die Offensive dann letztendlich gescheitert war, wurden wir auf Eisenbahnwaggon verladen, in
eine Stellung vor Verdun gebracht und der siebenten bayerischen Division zugeteilt. Als wir ausgeladen wurden nahm der
Franzose den Bahnhof unter Beschuss. Eine Granate traf einen Waggon der mit Seifenpulver beladen war, so dass der ganze
Bahnhof aussah als wäre gerade Neuschnee gefallen. Wir gingen auf die Suche nach Kartoffeln. Als ich mit einem Sack,
vollbeladen die Böschung runter ging um zur Feldküche zu gelangen, schlug unweit von mir eine Granate ein und riss mir
den Sack vom Rücken. Ich bin mit dem Schrecken davon gekommen, mir war nichts passiert.
Der Bahnhof war menschenleer, nur ein par Kaninchen liefen verschreckt durch die Gegend und einigen Kameraden gelang
es welche einzufangen. Am nächsten Tag gelang es uns endlich die Feldküche zu erreichen. Als wir gerade beim Essen
fassen waren, schlug unweit eine Granate ein so dass Pflastersteine das Dach durchschlugen und wir das Weite suchen
mussten. und wir wieder nichts zu Essen bekamen. Ein Friseur aus unserer Kompanie fuhr immer ins Hinterland um uns
mit Proviant zu versorgen. Als er 14 Tage vor dem Zusammenbruch wieder mal zurückkam erzählte er uns schon das der
Krieg nicht mehr lange dauern würde, weil Kaiser Wilhelm mit Frack und Zylinder bekleidet, Deutschland verlassen und
ins Ausland gehen würde. In unserer Einheit hatten wir auch einen Juden der glaubte dass er sich alles erlauben darf.
Eines Morgens ging er in die Küche, als er keinen Koch vorfand stieg er auf die Gulaschkanone und hob den Deckel vom
Kessel in dem der Kaffee kochte an. Der kochende Kaffee verbrühte seine Füße so sehr das er sofort ins Lazarett musste,
für ihn war der Krieg somit zuende. Es kam noch ein Erlass, das Kameraden die 2 Jahre aktiv gedient hatten und
Gefreiter waren sofort zum Sergeanten befördert wurden. Für den 11. November 1918 war ein Waffenstillstand vereinbart
und ab 11 Uhr sollte nicht mehr geschossen werden. Wir hatten unsere Kopfkissen aufgetrennt und eine Kissenschlacht
veranstaltet, um auf diese Art und Weise unserer Freude Ausdruck zu verleihen. Als die Federn durch die Luft flogen
brachen wir in Tränen aus.
In jeder Kompanie wurde ein Soldatenrat gewählt, der aus drei Mann bestand. Wenn der Kompanieführer jemanden bestrafen
wollte, musste er erst den Soldatenrat fragen, der die Strafe befürworten, aber auch ablehnen konnte. Die Offiziere
durften keine Achselstücke mehr tragen, was für sie einer Degradierung gleich kam. Wir waren in einem Dorf
einquartiert und morgens zum Appell angetreten, als einer vom Soldatenrat sich stockbesoffen vor den auf dem Pferd
sitzenden Kompanieführer stellte und schrie: „Alles hört auf mein Kommando”. Der Kompaniechef war wie vom Blitz
getroffen, ihm versagte die Stimme. Wir sahen ein das dies nicht so weiter gehen kann und wählten einen neuen
Soldatenrat. Unser Rückzug begann bei Konflanz, einer Vorfestung von Metz und führte uns zunächst über die
luxemburgische Grenze, wo wir in einem Ort einquartiert wurden. Als wir für die Küche Holz aus dem Wald holen gingen,
entschieden wir uns eine Eiche abzusägen, ohne uns dessen bewusst zu sein, in welchem Forst wir uns befanden. Als wir
beim fällen waren fielen plötzlich Schüsse, die wir auch sofort erwiderten, bis uns ein Elsässer der sich in unserer
Kompanie befand aufklärte: „Kameraden, wir befinden uns hier auf Luxemburgischem Hoheitsgebiet”.
Wir sind dann weiter durch das Fürstentum Birkenfeld marschiert, wo das Städtchen Merzig für uns geflaggt hatte. Das
Elsass haben wir auch noch kurz gestreift. Wo wir bei einem Bauern, der uns kein Stroh für das Nachtlager geben wollte,
einquartiert wurden. Daraufhin gingen wir in die Scheune und haben uns selbst was besorgt. Wir haben dann noch erfahren,
sie hätten ein Schwein geschlachtet und warteten auf den Einzug der Franzosen. Als wir uns 1917, an der Ostfront, in
den in Karpaten, im Einsatz befanden, waren unter uns auch viele Elsässer. Sie durften ihre Heimatpost nicht in
französischer Sprache schreiben, mussten ihre Briefe offen auf der Schreibstube abgeben, wo sie zuerst kontrolliert
und dann abgeschickt wurden. Als ich in einer Nacht, mit einem Elsässer auf einem Vorposten Wache schieben musste,
wollte er mich überreden zum Russen überzulaufen. Als ich darauf nicht eingehen wollte verschwand er plötzlich in der
Dunkelheit und ich habe ihn nie wieder gesehen.
Wir sind dann weiter Richtung Worms und Ludwighafen gezogen, dort wurden wir bei einem Mühlenbesitzer einquartiert,
ein Unteroffizier und vier Mann. Obwohl wir verlaust und verdreckt waren bestand die Müllerin darauf das wir in ihren
Betten übernachteten. „Wenn alles durch ist”, sagte sie, „werde ich alles gründlich reinigen”. Der Müller brachte uns
eine Gießkanne voll Wein und sagte wir sollen es uns Schmecken lassen. Wir haben reichlich davon Gebrauch gemacht, so
dass ich gar nicht weiß wie ich ins Bett kam. Das war meine Erinnerung an die Pfalz. Manchmal waren wir auch 2 Tage im
Quartier.
Vor dem Weitemarsch wurde uns immer gesagt welche Truppe die Vorhut und welche Truppe die Nachhut übernehmen sollte.
Die Nachhut hielt immer Verbindung zu den nachrückenden Franzosen und man muss staunen wie alles reibungslos, ohne
Zwischenfälle von statten ging, was wir in erster Linie dem General-Feldmarschall Paul von Hindenburg zu verdanken
haben, der den Rückzug an der Westfront koordiniert hat.
In Köln angekommen, erhielten wir im Volkshaus unsere Entlassungspapiere, Eisenbahnfahrscheine, Reisepässe,
unterschrieben von Oberstleutnant Mann. Wir mussten Köln umgehend verlassen, weil schon am nächsten Tag die
französischen Besatzungstruppen in einmarschieren sollten. Wir fuhren mit einem Zug der bis Allenstein fuhr, dort
wurden unsere Papiere vom Soldatenrat kontrolliert. Die jüngren Jahrgänge wurden festgehalten, zu neuen Einheiten
zusammengestellt und zur Sicherung der Ostgrenze gegen die Bolschewisten abkommandiert. Ich hatte gesagt das ich noch
einen Schrapnellsplitter in der Kreuzbeingegend habe und durfte daraufhin nach Hause fahren.
Kaum in Ortelsburg angekommen fiel ich wieder dem Soldatenrat in die Hände. Sie haben alles durchsucht, haben mir mein
Seitengewehr und eine Decke abgenommen, aber ich durfte weiter und bin dann kurz vor Weihnachten 1918 auf dem
elterlichen Hof angekommen. Schon auf dem Hof habe ich meine Kleider vom Leib gerissen, weil vor Läusen und anderem
Ungeziefer nicht mehr aushalten konnte und mich erst gründlich gewaschen bevor ich das elterliche Haus betreten habe.
Die Freude über das Wiedersehen war sehr groß.
“ Unser Leben zwischen den beiden Weltkriegen.”
Endlich wieder zurück in der Heimat
Rohmanen war durch die Kampfhandlungen 1914/15 zu einem drittel zerstört worden, aber schon
wieder im Aufbau. Die Firma Grzella aus Ortelsburg hatte die Bauarbeiten übernommen. Unter der Aufsicht von Polier
Karl Kontor wurden die Dachstühle errichtet. Ich habe mich, nach kurzer Erholungspause, auch als Zimmermanngehilfe am
Wiederaufbau beteiligt. Die Firma Grzella hat das Material geliefert und auch unsere Löhne gezahlt. Wegen meinem
Steckschuss bin ich dem VDK beigetreten und habe mit dessen Hilfe eine Rente beantragt die mir auch bewilligt wurde.
Nach vier Jahren wurde ich nach Allenstein zur Nachuntersuchung vorgeladen. Die ärztliche Untersuchung hatte ergeben,
das Geschoß sei verkapselt, und nur das linke Bein etwas in Mitleidenschaft gezogen. Daraufhin wurde die Rentenzahlung
eingestellt.
Der Stellmacher Adam Ornowski war im Krieg als Sanitäter eingesetzt und hatte auf Grund seiner Erfahrungen,
 Beziehungen zum medizinischen Dienst in Ortelsburg aufgebaut. Es wurden dort Lehrgänge in Erster Hilfe angeboten,
die von Prof. Dr. Kutz geleitet wurden. Adam Ornowski hat dafür gesorgt das einige junge Männer aus Rohmanen daran
teilnehmen konnten. Adam Ornowski, August Linka, Emil Rosowski, Johann Dembek, Emil Baschek und ich sind dann dem
Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes beigetreten und mussten jeden Sonntag am Lehrgang teilnehmen. Unser
Gruppenführer war Kreisobersekretär Albrecht, Landrat von Poser, als unser Ehrenvorsitzender, hat viel zu unserer
finanziellen Unterstützung beigetragen und hat dafür gesorgt dass die Bereitschaft eingekleidet wurde.
Beziehungen zum medizinischen Dienst in Ortelsburg aufgebaut. Es wurden dort Lehrgänge in Erster Hilfe angeboten,
die von Prof. Dr. Kutz geleitet wurden. Adam Ornowski hat dafür gesorgt das einige junge Männer aus Rohmanen daran
teilnehmen konnten. Adam Ornowski, August Linka, Emil Rosowski, Johann Dembek, Emil Baschek und ich sind dann dem
Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes beigetreten und mussten jeden Sonntag am Lehrgang teilnehmen. Unser
Gruppenführer war Kreisobersekretär Albrecht, Landrat von Poser, als unser Ehrenvorsitzender, hat viel zu unserer
finanziellen Unterstützung beigetragen und hat dafür gesorgt dass die Bereitschaft eingekleidet wurde.
In jedem Dorf wurde eine Unfallstelle eingerichtet, mit einem Verbandskasten und mit Verbandsmaterial für die erste
Hilfe ausgerüstet. Die Unfallstelle in Rohmanen, die am Haus von der Straßenseite, durch eine Tafel mit einem roten
Kreuz gekennzeichnet war, hatte ich zu verantworten. An Sonntagen wurden wir an Badestellen und bei Fußballspielen
eingesetzt, haben viele Übungen bei Waldbränden durchgeführt und auch Ausflüge nach Rudzany am Niedersee gemacht. Bei
der Einweihung des Tannenbergdenkmals in der Nähe von Hohenstein kamen wir an Straßenkreuzungen zum Einsatz.
Rohmanen hatte auch eine freiwillige Feuerwehr. Bis zum ersten Weltkrieg hat Friedrich Biella als Brandmeister das
Kommando gehabt. Er war aktiver Unteroffizier, hatte gute Führungsqualitäten und die Männer, die allesamt aus dem
aktiven Militärdienst stammten hatten zu ihm ein großes Vertrauen. Nach dem Krieg wollten diese Männer,
(Friedrich Nickel, Friedrich Willam, Julius Wittkowski, Jakob Janowski, Johann Gloddek, Gustav Bednarz), nicht mehr
weitermachen. Friedrich Biella, der inzwischen zum Gemeindevorsteher gewählt wurde, hat sich dann auf einer
Gemeinderatsitzung vorgeschlagen, für die Freiwillige Feuerwehr jüngere Kräfte anzuwerben.
Zum Brandmeister hat er Herrn Wilhelm Pilath vorgeschlagen. Der wurde dann nach Königsberg zur Fortbildung geschickt.
Der Feuerwehr gehörten nun folgende Personen an: Wilhelm Pilath(Brandmeister), August Linka(Stellvertreter), Gustav
Deptolla, Julius Matzey, Johann Dembek, Willy Willam, Gustav Rattay. Der Kreisbrandmeister war Heinrich Thalmann aus
Ortelsburg, sein Stellvertreter war Kreisobersekretär Salzmann. Der Bezirks-Kommissar bei der Ostpreußischen
Feuersozität War Herr Ernst Trzaska. Er hat dafür gesorgt das die Wehr uniformiert und mit Löschgeräten ausgerüstet
wurde. Da die alten Schläuche schon sehr marode waren, wurden sie durch moderne ersetzt, deren Kupplungen auch mit der
Motorspritze übereinstimmten.
Ernst Trzaska hat bei der Feuersozität und beim Landratsamt Finanzmittel beantragt und auch genehmigt bekommen. Der
Schneidermeister Wilhelm Baran wurde beauftragt Tuch und Drillichanzüge nach Maas zu schneidern. Er hat uns
Stoffmuster vorgelegt aus denen wir wählen sollten. Feuerwehrhelme haben wir auch bekommen. Die Gemeinde musste
Finanzmittel bereitstellen, einen Prozentsatz vom Gemeindebudget. Im Brandfall mussten für den Spritzenwagen Pferde
zur Verfügung stehen, von Willy Willam, Gustav Rattay, Julius Matzey und Gustav Dorka, weil sie in der Nähe des
Spritzenhauses wohnten. Am Spritzenhaus wurde ein großer Baum mit Querleisten aufgestellt, wo nach jedem Brand oder
einer größeren Übung die Schläuche zum trocknen aufgehängt wurden.
Der Kreisbrandmeister hat mindestens 2-3-mal im Jahr die Wehren besichtigt. Das ganze Dorf war dann auf den Beinen,
die Bauern mit Pferden, und andere Dorfbewohner mit Eimern und Spaten, wurden dann in verschiedene Gruppen eingeteilt.
Erst hat die Wehr sämtliche Aufstellungen am Gerät geübt; Grundstellung Fahrstellung und Marschstellung. Dann wurde
ein Brand angekündigt, die Feuerwehr mit der Spritze an den Brunnen, die Gruppen dort wohin sie beordert wurden, die
Bauern brachten mit den Wasserkiwen Wasser aus dem Brunnen zum Brandort. Wenn das Wasser im Brunnen alle wurde hat
man den Saugkorb in die Kiewen gelegt und dort Wasser entnommen. Die Wassergruppe ging mit Eimern zum Dorfteich, holte
Wasser und füllte damit die leeren Kiewen.
Der Löschtrupp ging mit Feuerhaken und Löschpatschen auf die umliegenden Gehöfte und versuchte das vermeintliche Feuer
von ihnen fernzuhalten. Nach dem Alarm wurde wieder am Spritzenhaus angetreten. Die Gruppenführer mussten angeben ob
ihre Gruppe auch vollständig erschienen war, denn Übungen wurden nur vor, oder nach der Feldarbeit durchgeführt, so
dass niemand eine Entschuldigung vorbringen konnte. Wer ohne begründete Entschuldigung nicht anwesend war erhielt eine
Verwarnung. Der Kreisbrandmeister erklärte dann welche Handgriffe den Vorschriften entsprachen und welche nicht. Die
Schläuche wurden noch schnell zum Trocknen aufgehängt. Anschließend gingen wir alle in den Gasthof Trzaska, haben über
vorhandene Mängel diskutiert, Verbesserungsvorschläge unterbreitet und zwischendurch den Durst gelöscht. Der
Kreisbrandmeister ist dann, nach einer kurzen Verabschiedung, ins nächste Dorf gefahren, weil er an einem Tag mehrere
Feuerwehren betreuen musste.
Der Rohmaner Dorffriedhof

Einen Kilometer vom Ende des Dorfes entfernt, auf der rechten Seite der Landstraße in Richtung
Ortelsburg, befand sich der Rohmaner Dorffriedhof. Wann dieser Friedhof angelegt wurde entzieht sich meiner Kenntnis.
Nach Aussagen älterer Dorfbewohner soll davor auch schon eine Ruhestätte vorhanden gewesen sein, und
zwar auf der linken Straßenseite gegenüber dem jetzigen Friedhof. An dieser Stelle befand sich bis in die
Nachkriegszeit ein kleiner Brunnen, aus dem die Dorfbewohner, das Wasser zum begießen der Grabbepflanzung auf den
Gräbern ihrer verstorbenen Angehörigen holten. Der Friedhof war in einer Hanglage angelegt, wahrscheinlich weil diese
Parzelle für eine landwirtschaftliche Nutzung nicht geeignet war. Um das Gräberfeld vor herumstreunenden Tieren oder
von der Weide entlaufenen Kühen zu schützen, hat man das ganze Gelände mit einem Holzzaun umgeben. Der Zugang befand
sich von der Straßenseite. Unter einem Torbogen hindurch wurden die Verstorbenen zu Grabe getragen. Die Gräber der
einzelnen Familien waren nebeneinander angelegt, mache, wie zum Beispiel die der Familie Trzaska, sogar mit einem
schmiedeeisernen Zaun eingefasst.
Nach dem 2. Weltkrieg verfiel der Friedhof immer mehr. Die nötigen Finanzmittel für die Pflege der Einfriedung konnten
von den restlichen noch verbliebenen Deutschen nicht mehr aufgebracht werden. An den gepflegten Gräbern konnte man noch
erkennen dass es Verwandte von noch in Rohmanen wohnenden Deutschen waren, oder von bereits im Westen Deutschlands
lebenden, die ihre noch in Rohmanen wohnenden Nachbarn damit beauftragt hatten. Die übrigen Gräber wurden von Jahr zu
Jahr immer mehr von Wildkräutern überwuchert und schließlich auch von Sträuchern und schnell wachsenden Bäumen.
In den späteren Jahren konnte man nicht mehr erkennen dass dort vor Jahren Tote zur letzten Ruhe gebettet wurden. Die
Natur holte sich das ganze Gelände zurück und nur unter großen Schwierigkeiten konnten Besucher aus dem Westen das
Friedhofsgelände noch betreten.
Das Gasthaus Trzaska

Nach dem ersten Weltkrieg hat der Gastwirt Friedrich Trzaska neben dem Gasthof einen großen Saal
für Festlichkeiten und Vereinsfeiern gebaut, in dem schon mal Feuerwehrfeste veranstaltet wurden. Ernst Trzaska war
Feuerkommissar bei der Ostpreußischen Feuersozität. Erich Trzaska war Vollziehungsbeamter beim Amtsgericht in
Ortelsburg. Unser Feuerkommissar war uns beim organisieren der Veranstaltungen sehr behilflich, hat uns den Saal, die
Musik und die Theaterstücke besorgt und die Feuerwehren aus den Nachbardörfern eingeladen.
Zu Manöverzeiten, vor dem 2. Weltkrieg und dann auch während des Krieges, waren im Gasthof Soldaten, meist im Range
eines Offiziers, einquartiert. Fräulein Mariechen Trzaska hat die Poststelle im Dorf betreut. Nachdem ich 1939 zum
Militär eingezogen wurde, hat sie, nach einer Schulung im Ortelsburger Krankenhaus, auch die Unfallmeldestelle
übernommen. Nach dem Krieg, pflegte sie mit vielen Bekannten, die bereits in der Bundesrepublik wohnten, einen regen
Briefwechsel. Auf dem Rohmaner Friedhof hat sie viele Gräber, im Auftrag von Angehörigen, die auf Grund ihrer
Abwesenheit, dazu nicht mehr in der Lage waren, gepflegt. Der Bauunternehmer Kurnitzki aus Ortelsburg, äußerte die
Bitte, sie möchte ihm doch ein Blatt vom Rosenstrauch, der auf dem Grab seiner Eltern steht, in den Brief legen. Als
sie uns den Brief vorgelesen hat, waren wir zu Tränen Gerührt. Sie hat als Letzte aus ihrer Familie, bis zu ihrem Tod
im Jahre 1960, in Rohmanen, im Gebäude der Gastwirtschaft gewohnt und ist auf dem Rohmaner Friedhof beerdigt worden.
Fleisch und Wurstwaren Karl Pelkowski
Im Jahr 1931 hat der Fleischermeister Karl Pelkowski, aus Grammen, direkt neben unserem Hof ein
Anwesen gekauft und dort eine Fleischerei eingerichtet. Er war mit meiner Schwester Frieda, verheiratet. Am Anfang hat
er die Schweine noch auf seinem Hof geschlachtet, später dann im Ortelsburger Schlachthof. Jede Woche fuhr er 2-mal,
mit dem Pferdewagen(Einspänner), nach Ortelsburg zum Wochenmarkt, wo er seine Fleisch und Wurstwaren zu Verkauf anbot.
Am Tag davor, wenn er die Wurst gekocht hat, kamen viele Rohmaner mit Kannen oder anderen Gefäßen, wegen der guten
Wurstsuppe, die er umsonst unter die Leute verteilte. Als Karl Pelkowski, Ende August 1939 zum Militär eingezogen
wurde, hat seine Frau das Pferd verkauft und den Beitrieb stillgelegt. Am Haus hing, immer noch die Tafel mit der
Aufschrift: Karl Pelkowski, Fleisch und Wurstwaren. Ein Witzbold hat irgendwann darunter geschrieben; „Fleisch und
Wurst waren einmal”, drauf hin hat Frau Pelkowski die Tafel entfernen lassen. Karl Pelkowski ist im Mai 1946 in
französischer Gefangenschaft verstorben. Seine Ehefrau Frieda, verstarb an ihrem 85. Geburtstag in Mettmann bei
Düsseldorf.
Die steinreichen Rohmaner Felder
Die letzte Eiszeit hat bei der Schmelze, auf der Rohmaner Feldgemarkung viele Steine und
Granitblöcke zurück gelassen. Überirdisch, aber besonders unter der Erde, gab es viele kleine, aber auch große Steine,
die, den Bauern, beim Pflügen und anderen Feldarbeiten sehr viel Schweiß, abverlangten. In einer Kiesgrube, auf dem
Feld des Bauern August Radek, lag ein Granitblock, von schätzungsweise 100 cbm. Vor etwa 80 Jahren, als man für diese
Steine noch keine Verwendung hatte, griffen die Bauern zu einer „List”. Weil er sonst nicht pflügen konnte, hat mancher
seinem Nachbarn, die Steine in der Nacht auf dessen Feld abgeladen. Als diese Tätigkeit unter Strafe gestellt wurde,
hat man die Steine in Schluchten gekippt und mit Mutterboden zugeschüttet. In späteren Jahren kam diese jedoch beim
pflügen wieder an die Oberfläche. Dann hat man aber schon Steine für den Straßenbau gebraucht und konnte sie so zu Geld
machen. Besonders im Raum südlich von Ortelsburg, bis zur polnischen Grenze, wo Steine eine Rarität waren, kamen sie
jetzt zum Einsatz. Auch beim Bau von Häusern, besonders für die Fundamente, wurden sie eingesetzt, weil auf diese
Weise viel Ziegeln eingespart wurden. Die Firma Gribienski aus Ortelsburg hat die großen Steine mit Dynamit gesprengt
und auf diese Weise die weitere Verarbeitung erleichtert.
Die Steine welche beim Pflügen aus dem Boden geholt wurden, hat man am Feldrand auf große Haufen zusammen getragen.
Wenn die Feldarbeit beendet war, sowie auch in den Wintermonaten, waren wir jeden Tag mit Steinen unterwegs. Wir sind
vorwiegend am Abend los gefahren, weil unter der schweren Last die Wagenachsen so heiß wurden und die Gefahr bestand,
das durch die Dehnung, die Räder blockiert würden. Bei einer Fahrt konnte man bis zu 24 Reichsmark verdienen, wogegen
1 Zentner Roggen für 8 bis 9 Reichsmark zu haben war. Ich bin selbst, mit dem Pferdewagen bis Fürstenwalde, Radostowen,
Luka, Altkirchen, Höhenwerder, ja sogar bis Friedrichshof gefahren.
In Rohmanen wurden auch rote Ziegeln gebrannt. Viele Häuser wurden, mit Ziegeln erbaut, die nur wenige 100 Meter von
der Baustelle entfernt hergestellt wurden. Der Lehn wurde auf den Feldern in der näheren Umgebung entnommen, dann von
Ochsen solange getreten, bis er so geschmeidig war, das er sich in Formen einstreichen ließ. Wenn die Ziegel in der
Form trocken war, wurde sie entnommen und in einem Brennofen gestapelt. Um einen Ofen richtig anzufeuern, brauchte man
12 Raummeter Holz, das im Zeitraum von ein par Tagen verheizt wurde. Der Fischer Karl Glitza hatte schon eine
Knetmaschine, die von einem Pferd angetrieben wurde, das mit verbundenen Augen, den ganzen Tag in die Runde ging.
Im Dorf waren auch vier Kalköfen, in denen so genannte Kalksteine, die sich an gewissen Stellen, im Erdboden befanden,
gebrannt wurden. Nach dem Brennen wurden die Steine mit Wasser abgelöscht und die daraus entstandne Masse diente, nach
dem Beimischen einer gewissen Menge Sand, dann als Bindemittel beim Häuserbau. Das Gerichtsgebäude und das
Lehrerseminar in Ortelsburg wurden mit Kalk, aus dem Rohmaner Brennöfen erbaut. Auch zum Bau einer Eisenbahnbrücke, auf
der, der Zug, den Sawitzfluß, von Ortelsburg nach Allenstein überquerte, hat mein Großvater, mit einem Ochsengespann,
Kalk gefahren.
Hinter der Scheune, beim Bauern Johann Dembek hat man Tonerde gefördert, aus der man mit Hilfe einer Formerscheibe,
die von einem Arbeiter mit Muskelkraft(Fußbetrieb) angetrieben wurde, schöne Krüge, Schalen und Vasen geformt hat.
Die Töpferware wurde, nachdem sie trocken genug war, auch in einem Ofen gebrannt, anschließend mit einer Lasur
überzogen und wieder gebrannt. Es wurden auch Kacheln zum Bau von Kachelöfen hergestellt, die mit verschiedenen
Ornamenten versehen, die Wohnstuben unserer Vorfahren schmückten. So haben unsere Großväter ihr Leben gemeistert und
nach und nach, unsere Dörfer aus der Rückständigkeit in die Neuzeit geführt.
Das gesellschaftliche Leben nach dem 1. Weltkrieg

Als der Lehrer Alfred Dorka, ein Frontkämpfer des Ersten Weltkrieges und ein Sportsmann, als
zweite Lehrkraft an der Rohmaner Schule angestellt wurde, hat er die Sitten und Gebräuche aus früherer Zeit wieder zum
Leben erweckt. Zuerst hat er die Jugend zusammen gerufen, einen Jugendverein und einen Fußballclub, gegründet. Zum
Vorsitzenden des Fußballclubs wurde Johann Gloddek berufen, der ihn auch geleitet hat. Bauer Wilhelm Spittka, der am
Rohmaner See wohnte, stellte Land für einen Sportplatz unentgeltlich zur Verfügung. Lehrer Alfred Dorka hat am
Rohmaner See eine Badestelle ausgesucht und ein Sprungbrett bauen lassen. An jedem Sonnabend im Sommer, bevor die
Sonne unterging, versammelte sich die gestammte Jugend des Dorfes an der Badestelle am See. Es wurde gebadet,
Heimatlieder gesungen, gespielt, im Fackelschein eines großen Biwakfeuers, bis in die späte Nacht hinein. Der Fischer
Karl Glitza hat uns Kähne zur Verfügung gestellt, mit denen wir auf den See hinausgepaddelt sind, dabei hatten wir viel
Spaß, was wiederum den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft gefördert hat. Ich habe mit meiner Mandoline den Gesang von
Volks- und Heimatliedern begleitet.
Der Rohmaner See liegt in einem Tal, dessen Hänge zu beiden Seiten mit Kiefern und Tannen bewaldet sind. Wenn man
gesungen oder Musiziert hat, hallte es von den Hängen zurück. Die Ufer waren mit Kalmus und Schilf bewachsen, was für
die Fischaufzucht von Vorteil war. Wenn man an einem sonnigen, windstillen Tag, am Seeufer spazieren ging, traf man
oft auf Flachstellen, an denen sich die Fischbrut im Sonnenlicht wärmte, wie ein Mückenschwarm. Im See befanden sich
folgende Fische: Karpfen, Hechte, Schleie, Barsche Plötze, Rotaugen, Aale und Krebse. Am Sonntagmorgen brachten viele
Rohmaner ihre Pferde zum See um sie zu baden.
Es wurden dort, unter der Aufsicht von Lehrer Dorka, auch viele Jugendfeste mit Theatervorführungen veranstaltet, zu
denen er selbst die Vorlagen organisiert hat. Der am See wohnende Bauer Johann Nadrowski, hat uns ein Scheunentor, als
Tanzboden zur Verfügung gestellt. Der Zimmermann Wilhelm Wittek hat uns eine Windmühle gebaut, die am auf dem Boden
liegenden Scheunentor aufgestellt wurde, dazu kamen Noch Tannen und Fichten, die das Ganze wie ein Bühnenbild
erscheinen ließen. Es wunden viele Bühnenstücke aufgeführt, unter anderen >Alte Weiber werden jung gemahlen<. Dazu bot
die Windmühle die entsprechende Kulisse.
Nach der Vorführung wurde der Boden aufgeräumt, um dann als Tanzdiele zur Verfügung zu stehen. Der Gastwirt Trzaska
hatte Tische und Bänke aufgestellt, Speisen und Getränke angeboten, so dass sich die die Veranstaltung bis in die
späte Nacht hinein zog. Es waren auch Leute aus Ortelsburg und anderen Nachbardörfern dabei. Im Winter hat Lehrer
Dorka eine Kreisrodelbahn eingerichtet, die von Zeit zu Zeit mit Wasser besprengt wurde, um die Gleitfähigkeit zu
verbessern. Von einer Anhöhe ging hinunter bis auf den halben See, was für alle ein großes Vergnügen war. Es kamen
Lehrer mit Schulklassen aus der näheren Umgebung um hier zu Rodeln.
Als Herr Lehrer Jobski als Hauptlehrer nach Rohmanen kam hat er mit dem Bürgermeister und der Gemeindeverwaltung
beschlossen, in der Nähe des Dorfes, auf einem zur Schule gehörenden Grundstück, einen Sportplatz anzulegen. Dafür
wurde gleich hinter den Gärten, 6 Morgen Ackerland abgetrennt, und nach Feierabend hat Lehrer Dorka mit den
Jugendlichen eingeebnet und gleich nebenan einen Graben für Schützenstand und Kugelfang ausgehoben. Am Sonntagvormittag
wurde Fußball gespielt und um 15:00 Uhr war Kleinkalieberschießen angesagt. Es musste auch ein kleiner Beitrag erhoben
werden, um Munition kaufen zu können. Eine Büchse konnten wir aus beim Kleinkalieberverein in Ortelsburg ausleihen.
Nach Hitlers Machtergreifung
Als Adolf Hitler an die Macht kam wurde die SA gegründet. Der Bürgermeister Michael Kownatzki
wurde zum Gruppenführer ernannt und folgende Männer haben sich freiwillig gemeldet: Wilhelm Matzey, Johann Gloddek,
Gustav Nadrowski, August Buttler, Karl Baran, Emil Nickel, Wilhelm Jaschinski, Emil Bork, Ernst Rattay und Gustav Bach.
Bei Versammlungen war die SA in Uniform angetreten um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Wer versucht hat Unruhe zu
stiften, egal aus welchem Grunde, wurde aufgefordert den Saal zu verlassen, andernfalls wurde er mit Gewalt entfernt.
Herr Lehrer Jobski wurde zum politischen Leiter ernannt, seine Frau hat die NS-Frauenschaft gegründet, Lehrer Dorka
die HJ, und so bekam die Dorfgemeinschaft, nach und nach ein anderes Gesicht. Der Sportplatz und der Schützenstand
wurden jetzt mehr als früher in den Mittelpunkt gestellt. Nach der Feldarbeit hat der Bürgermeister Fuhrwerke bestellt
und den Sportplatz noch besser herrichten lassen.
Der Bauer Wilhelm Both wurde zum Ortsbauernführer ernannt, mit der Aufgabe alles Land für den Anbau von Getreide und
Futtermittel bereitzustellen, oder wenn das nicht möglich war mit Wald aufzuforsten. Durch den Einsatz von Kunstdüngern
sollten größere Erträge aus dem Boden geholt werden, um den Viehbestand zu vergrößern und mehr Milch und Butter zu
produzieren. Deutschland sollte im Stande sein sich selbst zu selbst zu ernähren, ohne auf Importe angewiesen zu sein.
Frau Jobski hat, innerhalb der der NS-Frauenschaft, mit Hilfe von Fachkräften aus Ortelsburg, Lehrgänge veranstaltet,
auf denen man Backen und Nähen lernte. Auf den Bauernhöfen befand sich auch immer mehr Rassegeflügel, das eine erhöhte
Produktion von Eiern und Geflügelfleisch sicherstellen sollte.
Die Rohmaner Bauern hatten, außer in der Landwirtschaft, noch andere Verdienstmöglichkeiten in der Kreisstadt. In
Ortelsburg wurden vier Sägewerke betrieben, die mit Langholz aus dem Walde versorgt werden mussten. Wir haben eine
Kiefer von über 8 Festmeter angefahren, der wir zuerst 6 Meter Spitze abschneiden mussten, um diese Last überhaupt
auf den Wagen zu bekommen. Sechs Pferde musste angespannt werden um den Wagen zur befestigten Straße zu bringen.
Fichten und Tannen wuchsen bis zu einer Länge von 30 Metern. Auch beim Transport von Ziegel, von der Ziegelei zum
Bahnhof, konnte man gutes Geld verdienen.
Im Jahr 1934 wurde Rohmanen an das überregionale Stromnetz angeschlossen und schaffte auf diese Weise den Sprung von
der Petroleumlampe zur Glühbirne. Neben dem Grundstück von Karl Pietzonka wurde ein Transformatorhäuschen errichtet,
in dem der ankommende Strom von einer Hochspannung auf eine Verbrauchsspannung transformiert wurde. Es gab schon eine
Überlandleitung, die aus Richtung Ortelsburg kommend, quer über die Felder, in Richtung Neu Keykuth weiter ging.
Durch eine Zwischenspanne wurde der Transformator, mit der Hauptleitung auf Kownatzkis Feld verbunden.
Ein Stromanschluss konnte die Arbeit im Haus und Hof auf vielfältige Weise erleichtern, doch nur die besser gestellten
Bauern, sowie noch manche Pensionäre, die ein festes Einkommen hatten, konnten sich dass leisten. Weil nur wenige an
der Elektrifizierung teilnahmen, war ein Stromanschluss mit hohen Kosten verbunden. Nur Gustav Pietzonka, Gasthof
Trzaska, Friedrich Nickel, die Schule und Wilhelm Both, wurden in der ersten Phase erfasst.
Im Jahr 1952 wurde von den polnischen Behörden die zweite Stufe der Elektrifizierung eingeleitet, in der alle im Dorf
stehen Gebäude erfasst wurden. Am Anfang wurden nur Leitungen für Lichtstrom gelegt und auch nur 3 Lichtstellen pro
Haushalt bewilligt. Doch im nachfolgenden Zeitraum wurden dann, wenn Material vorhanden war, weitere Lichtpunkte
angelegt. 1952, am zweiten Wochenende im Advent, wurden dann die Leitungen geschaltet und alle waren von der
plötzlichen Helligkeit sehr begeistert. Wenn man Glühbirnen auswechseln wollte musste man am Anfang weite Wege
zurücklegen, um welche zu bekommen. In den 60ger Jahren wurden dann immer mehr Starkstromleitungen gelegt, weil die
Bauern elektrische Geräte kaufen konnten. Ende der 60ger wurden auch die Abbauten an das Stromnetz angeschlossen.
Das Urnengrab auf unserem Feld
Auf unserem Feld, in Richtung Seelonken, bin ich oft beim pflügen gegen Steine gestoßen, manchmal
rissen sogar die Stränge am Pferdegeschirr. Eines Tages nahm ich einen Spaten, Brechstange und einen langen Baum, um
der Sache auf den Grund zu gehen. Als ich eine Menge Sand ausgehoben hatte stieß ich auf eine steile, aus Steinen
errichtete Wand, die ich auch mit dem Baum nicht aus der Fassung bringen konnte. Ich habe den ganzen Vormittag gegraben,
konnte jedoch nicht unter die Steine kommen. Einige Tage später hatten wir in der Schule eine Bauernversammlung, da
habe ich Herrn Biella und Herrn Lehrer Dorka von meinem Fund berichtet. Am nächsten Morgen kam der Lehrer Dorka mit der
ganzen Schulklasse, mit Spaten und Sieben ausgerüstet auf unser Feld und fingen an die ausgehobene Erde zu sieben.
Lehrer Dorka benachrichtigte daraufhin den Leiter des Ortelsburger Heimatmuseums, der am nächsten Morgen vorbei kam um
sich die Fundstelle genau anzusehen. Er beauftragte ihn 4 Mann zu besorgen, um die Steine ringsum frei zu schaufeln.
Zwischen den Steinen durften wir die Erde nur mit Esslöffeln ausheben. Als es plötzlich zu regnen anfing hat Lehrer
Dorka die Brauerei Daum, in Ortelsburg angerufen, die uns über der Fundstelle ein Zelt errichtet haben, damit wir
ungestört weiterarbeiten konnten. Wir fanden 8 flache und 8 hohe Urnen zu beiden Seiten am Körper. Die Urnen wurden in
Gipsbinden eingewickelt und ins Heimatmuseum nach Ortelsburg gebracht, wo sie durch einen Fachmann, der extra aus einem
Königsberger Museum angereist war. Nach Reinigung der Urnen hat er festgestellt, das die Grabstätte etwa 2000 Jahre vor
Christi Geburt angelegt wurde und ein Doppelgrab war, in dem ein Toter liegend und einer in Hochstellung beigesetzt
wurde.
Die Nachricht von der Fundstelle verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Es erschienen viele Schaulustige, ganze
Schulklassen aus der Umgebung, mit Autos und zu Fuß. Durch die vielen Menschen wurden die bestellten Ackerflächen auf
unserem Feld sehr in Mitleidenschaft gezogen, eine Entschädigung haben wir nicht erhalten. Das Grab wurde vor dem
Heimatmuseum in Ortelsburg wieder so aufgebaut wie man es auf unserem Feld vorgefunden hat. Für den Transport der
Steine wurde ich entlohnt. Die Urnen hat das Königsberger Museum an sich genommen und wollte sie nicht wieder hergeben,
weil die solch einen Fund noch nicht in ihrer Sammlung hatten.
Sonnenwendfeuer
Am 24 Juni fand eine Sonnenwendfeier statt. Ein Brauch der an die alten Germanen erinnern sollte.
Der Lehrer Dorka hat den Bürgermeister beauftragt 2 Fuhrwerke in den Wald zu schicken, die Holz und alten Reisig holen
und auf dem großen Schulberg abladen sollten. Das Straßenbauamt hat uns Teertonnen zur Verfügung gestellt. Die ganze
Dorfgemeinschaft wurde eingeladen, am Abend, nach der Feldarbeit, an der Sonnenwendfeier teilzunehmen. Lehrer Dorka
hielt zuerst eine Ansprache, in der er anschaulich erklärte wie unsere Vorfahren in grauer Vorzeit gefeiert haben.
Nach dem offiziellen Teil wurden das Holz und die Teertonnen angezündet, es wurden Heimatlieder gesungen, wie: Wild
flutet der See, drauf schaukelt der Schiffer den schwankenden Kahn, Schaum wälzt er wie Schnee, von grausiger Mitte
zum Ufer heran, wild fluten die Wellen auf Vaterlands See, wie schön, oh trag mich auf Spiegel zu Hügel, Masovias See.
Masovia Land, mein Heimatland, Masovia es lebe mein Vaterland.
Lehrer Alfred Dorka und sein Wirken für Rohmanen.

Friedrich Biella hatte auf seinem Feld einen Granitstein mit einer geraden Seite, den haben wir
mit viel Schweiß an den Dorfteich transportiert und auf einer Erhöhung abgelegt. Der Stein sollte zum Denkmahl für die
Gefallenen des Ersten Weltkrieges umgestaltet werden. Da zu Wenige daran ein Interesse zeigten, wurde diese Idee fallen
gelassen und der Stein irgendwann ins Wasser gerollt. Der Lehrer Dorka war viele Jahre in Rohmanen tätig, dort hat er
später seine ehemalige Schülerin, Lotte Biella geheiratet. Er hat sich sehr für die Entwicklung des Dorfes interessiert,
war bei jeder Gemeindeversammlung anwesend und hat auf Schwachstellen hingewiesen die den Fortschritt behinderten.
Gemeinsam mit den Schülern hat er den Ehrenfriedhof für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges gepflegt, an der
Wegegablung nach Eichtal und zu Ehren des Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg eine Eiche gepflanzt.
Zum Advent hat Lehrer Dorka mit der Jugend einen Adventstern, in verschiedenen Farben gebastelt.
Der Stern wurde auf einer 2 Meter langen Stange befestigt, in der Mitte wurde ein Wachslicht angezündet, am Stern
wurde eine Schnur angebracht, wenn man daran zog rollte der Stern hin und her. Am ersten Wochenende im Advent
versammelten sich jung und alt, um den Stern durch das Dorf zu tragen. Alle schlossen sich dem vorausgehenden
Sternträger an, der den Stern durch die Hauptstraße und die angrenzenden Wege trug. Dieser Sternmarsch wurde an den
folgenden Adventwochenenden wiederholt.
Am ersten Weihnachtfeiertag wurde um 4:00 Uhr morgens ein Frühgottesdienst gehalten. Zuerst hat der Pfarrer eine
Andacht gehalten, dann haben die Kinder ein Krippenspiel aufgeführt und die Gemeinde hat schöne Weihnachtslieder
gesungen. Der Gastwirt Trzaska hat uns den Saal zur Verfügung gestellt. Wir hatten eine Posaunen- u. eine
Gitarrengruppe. Unter der Leitung von Herrn Willi Doormann spielten: Gottlieb Brosch, Fritz Ollech,
Gustav Rattay(Sopran), Wilhelm Pilath, Gustav Brosch(Alt), Fritz Both(Tenor) und Fritz Brosch(Bass).
In der Gitarrengruppe wirkten mit: Martha Ollech, Hedwig Ollech, Martha Lekzik, Martha Michalick und Auguste Lekzick.
Willy Doormann hat sie auf der Geige begleitet.
Kurz vor Ausbruch des 2. Weltkrieges
Bei der Aufstellung des Grenzschutzes(Regiment Buchholz), hat er als Hauptfeldwebel die
Gruppenführerkurse überwacht und selbst die fähigsten Männer dafür vorgeschlagen. Das Ausbildungspersonal hat das
Jäger-Battalion gestellt. Wir kamen zuerst ins Stadion(Waldheim), wurden da eingekleidet und dann ging es gleich
kasernenmäßig zu, theoretisch und praktisch. Jeder musste vor die Front treten und nachweisen ob er im Stande ist,
Befehle zu erteilen. Abends wurden Filme vorgeführt die uns zeigen sollten wie eine Gruppe sich im Gelände entfalten
muss. Die Exerziervorschriften hatten sich, im Verhältnis zu Kaiser Wilhelms Zeiten, etwas geändert. Damals bestand
eine Gruppe aus 8 Mann und einem Unteroffizier, jetzt aus 10 Schützen, 3 für das leichte Maschinengewehr und einem
Unteroffizier(13 Mann). Nach der Schulung folgte eine Abschlussprüfung, danach ein gemütliches Beisammensein. Aus
Rohmanen haben folgende Männer die Prüfung bestanden: Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy, Gustav Rattay und
Gustav Deptolla. Unsere Uniformen waren alle zu klein und es gab viel zu lachen bei der Anprobe.
Die erste Übung habe ich mit Emil Rosowski, in Lenzinen gemacht. Der Gutsbesitzer Marzinzick hat seine Scheune als
Unterkunft zur Verfügung gestellt. Er war im Range eines Hauptfeldwebels. In seinem haus war die Schreibstube
untergebracht, die er selbst verwaltete. Ein Lastauto hatte Uniformen aus der Kaserne in Ortelsburg geholt, jeder
musste eine Uniform anlegen und dann wurde solange getauscht bis alle eine passende gefunden hatten. An den Namen des
Kompanieführers kann ich mich nicht mehr erinnern. 1935 wurden wir zu einer Übung in die Dragonerkaserne nach Lyk
einberufen. Die Gruppenführer, Zugführer, und Kompanieführer die schon Frontberührung im dem Ersten Weltkrieg hatten,
mussten eine Woche früher anreisen. Die Übungen waren auf 6 Wochen angelegt. Die meisten der einberufenen waren noch
nie mit dem Wehrdienst in Berührung gekommen. Jeder Gruppenführer bekam 13 Mann zugeteilt.
Unser Zugführer war Leutnant Neumann, Kompanieführer Oberleutnant Rutschko, Battalions-Kommandeur Major Gröning
(Regiment Buchholz). Hier ging es wieder Kasernenmäßig voran. Das Bataillon wurde hier vereidigt. Jeden zweiten
Sonntag durften unsere Frauen uns besuchen. Ein Jahr später wurden wir wieder zu einer Übung einberufen, auf den
Truppenübungsplatz nach Arys. Jeder Gruppenführer hatte den Auftrag die Gruppe zu entfalten, und auf bewegliche
Figuren zu schießen. Diese Übung musste später mit scharfer Munition wiederholt werden. Jedes Maschinengewehr bekam
50 Schuss, jeder Schütze 20 Schuss zugeteilt. Nach dem Abschießen wurden die Treffer gezählt und dem Kommandierenden
Bericht erstattet. In einiger Entfernung spaziert ein Storch umher, der gar nicht bemerkt hatte dass geschossen wurde,
was bei den Kameraden ein großes Gelächter hervorrief.
Nach der Übung wurde uns gesagt das jeder Gruppenführer eine arische Abstammung nachweisen sollte. Ich konnte in den
Rheinsweiner Kirchenbüchern meine Vorfahren aus Gellen, bis zum Jahr 1732 zurück, nachweisen und wurde zum
Unteroffizier befördert. Aus unserem Dorf wurden auch, Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy und Gustav Deptolla
befördert. Zwischendurch mussten wir schon mal in die Radfahrer-Kaserne nach Ortelsburg, Gewehre empfangen und im
Gelände üben. Am 31 Juli 1939 wurde mir von einem Soldaten ein Schreiben übereicht, das mich aufforderte, am 1. August
um 6:00 Uhr, bei der 3. Kompanie, des 2. Infanterieregiments zu erscheinen.
Um 5:30 hat mich meine Schwester in die Kaserne gebracht. Auf der Schreibstube erklärte mir der Hauptfeldwebel,
dass mir ab sofort der Dienstgrad eines Sanitäters zugewiesen wird, ich mich in der Kammer einzukleiden hätte und mir
in der Handwerkerstube die entsprechenden Schulterklappen annähen lassen sollte. Die aktiven Sanitäter wurden den
Feldlazaretten zugewiesen und wir kamen an ihre Stelle. Unser Bataillon wurde nach Schodmak zum Bunker bauen und
Stacheldraht verlegen eingeteilt. Wir zogen in Begleitung einer Musikkapelle bis zur Kreuzung am Krankenhaus, dann
weiter zu unserem Bestimmungsort, gefolgt von einer Gulaschkanone die in den nächsten Tagen für unsere Verpflegung
sorgen sollte.
Am 14 August haben wir die Jägerkaserne, begleitet von einer Musikkapelle endgültig verlassen und zogen zuerst durch
Ortelsburg, dann über Lehmanen ins Feldmanöver, hinter Rohmanen. Dort entfaltete sich das Bataillon im Gelände, die
Verwundetensammelstelle wurde auf dem Hof des Bauern Friedrich Neumann eingerichtet. Gegen Abend wurde zu Sammeln
geblasen und Biwak bezogen, wobei unsere 3.Kompanie, in einem kleinen Wallt, in der Nähe von Otto Nickels Gehöft
Stellung bezogen hatte. Die 2. und 4. Kompanie hatte sich in der Nähe vom Abbau Pallasch niedergelassen. Die Frau
Nickel hat am Abend ein Mädel in Dorf geschickt um meiner Frau Bescheid zu sagen, wo wir uns zurzeit befinden. Meine
Frau ist dann noch gekommen um sich von mir zu verabschieden, weil wir am nächsten Morgen um 3:00 Uhr Zelte abbrechen
und um 4:00 Uhr in Richtung Kaspersguth marschieren sollten.
Wir sind dann über Achodden, Seelonken, Lehmanen, Ortelsburg, bis nach Grammen und Schützendorf marschiert, wo wir an
einem See Biwak bezogen haben. Es wurde immer gesagt, wir kommen zum Tannenberg-Denkmal bei Hohenstein, wo ein Reichs
Kriegervereinsfest stattfinden sollte. Es wurden auch schon Vorkommandos aufgestellt, doch dann kamen wir nach Orlau
und Lahna-Mühle, da wo die Alle entspringt haben wir 2 Tage biwakiert. Unser Kompanieführer hat uns nach Waplitz auf
den Soldatenfriedhof des Ersten Weltkrieges geführt und uns erklärt wie das Jägerbataillon sich 1914 hier entfaltet
hat und aufgerieben wurde. Dann mussten wir in der Nähe von Gut Koslau über einen Fluss und bezogen in einem Waldstück,
vorbereitete Stellungen in der Nähe der polnischen Grenze. Herr und Frau Thalmann haben uns jeden Tag, bis zur Grenze,
mit Brötchen und Getränken versorgt. Es wurde scharfe Munition ausgegeben, weil wir am nächsten Morgen um 4:00 Uhr die
polnische Grenze überschreiten sollten.
Am nächsten Morgen um 10 Minuten vor 4:00 Uhr kam der Befehl; scharfe Munition abgeben, alles zurück in ein 6 Kilometer
entferntes Dorf, wo wir auch einquartiert wurden. Das alles geschah’ eine Woche vor dem 1. September 1939. Es wurde
gesagt dass der Führer dem polnischen Präsidenten Rid-Szmigly, ein Ultimatum gestellt hat und es wahrscheinlich nicht
zum Krieg mit Polen kommt. Genau nach 5 Tagen kehrten wir wieder in die gleichen Stellungen zurück, es wurde wieder
scharfe Munition ausgegeben und am nächsten Morgen um 4:00 Uhr überschritten wir die polnische Grenze.
“Der 2. Weltkrieg.”
Der erste Einsatz in Polen
Wir kamen zuerst in ein Dorf in dem sich nur alte Menschen befanden. Auf unsere Frage wo denn die Bewohner wären sagte
man uns dass alle geflohen sind, weil erzählt wurde, die Deutschen würden alle Polen misshandeln und verstümmeln. Ich
habe ihnen daraufhin gesagt dass uns, unter Androhung von Strafe verboten wurde, einem Zivilisten etwas anzutun. Das
Vieh, die Schweine und Hunde des Dorfes liefen frei herum und die Soldaten fingen an auf die Hunde zu schießen, bis
gesagt wurde es seien Meldehunde im Dienste der Deutschen Wehrmacht und dieser Unfug der eigenen Truppe schaden würde,
weil etwaige Querschläger eigene Kameraden verletzen könnten. Wir gingen weiter auf polnischer Seite entlang der Grenze,
bis wir am Nachmittag die ersten Vorposten der Festung Mlawa erreichten, da befanden wir uns plötzlich im Feuerhagel
polnischer Festungsflack.
Am nächsten Morgen hatte ich schon 3 Verwundete und wusste nicht wo sich eine Verwundeten Sammelstelle befindet. Ich
suchte den Bataillonsgefechtstand auf der sich auf einer Anhöhe befand. Ich habe unseren Oberstabsarzt gefragt wo denn
die Verwundetensammelstelle wäre. Er rief beim Tross an, wo er die Auskunft erhielt, das sich vor dem Dorf ein Bunker
befindet in dem man die Verwundeten sammeln sollte, die dann von Sanitätsautos abgeholt würden, weil das Dorf unter
Artilleriebeschuss stand. Am Sonnabend haben unsere Flieger die Bunkerstellungen bombardiert, konnten aber, trotz guter
Treffer nicht viel ausrichten, die Bunker wurden nur etwas angekratzt.
Der Beschuss unserer vordersten Linien ging mit unverminderter Heftigkeit weiter. Am Sonntag verkündete eine große
Staubwolke die Ankunft unserer Panzer, doch sie kamen nur bis zur Panzersperre und mussten wieder abdrehen ohne den
Polen einen schaden zuzufügen. Ein Panzer bekam einen Volltreffer, der Fahrer konnte noch umkehren. Er blutete am Kopf
und der Schütze war so eingeklemmt, das wir ihn nur mit einem Seil unter den Armen, durch die Luke nach oben ziehen
konnten. Ob er seine Verwundung überlebt hat ist mir nicht bekannt, denn in der Nacht wurden Panzergeschütze nach
vorne in Stellung gebracht, die direkt in die Schießscharten der Bunker geschossen und so die Verteidiger vertrieben
haben. Daraufhin sind wir weiter vorgerückt. Auf einer Wiese war ein tiefer Graben ausgehoben und mit Ästen getarnt,
da war ein Panzer hinein gefahren, so dass nur das Hinterteil herausragte und er sich nicht aus eigner Kraft befreien
konnte. In der Luft waren Flieger die Brandbomben abwarfen, ich habe mich auf den Boden geworfen weil ich dachte die
würden explodieren, aber sie zischten nur, so das Stoppeln und Graß rings herum in Brand gerieten.
Bei den Kampfhandlungen gab es mehrere Verwundete, denen ich gerade Verbände anlegen wollte, als unser Hauptmann zur
Trillerpfeife griff um mir klar zu machen, dass ich ihm folgen sollte. Die Polen fingen an zu schreien, ich sollte
sie ins Lazarett bringen denn hier im Wald würde sie niemand finden. Ich setzte mich aufs Fahrrad und folgte unserem
Kompanieführer, der mir sagte ich soll immer bei der kämpfenden Truppe bleiben, denn hinter der Front sind die
Sanitätsabteilungen, die werden die Verwundeten schon versorgen. Der Vormarsch dauerte bis in die späte Nacht. Auf
einem Gehöft, das nach allen Seiten durch Feldwachen abgesichert wurde, machten wir endlich Rast. Wir haben
Getreidegarben auf dem Hof ausgebreitet und uns zur Ruhe gelegt, als plötzlich um Mitternacht Leuchtraketen den Himmel
erhellten und Maschinengewehrfeuer uns aus dem Schlaf schreckte. Ein par polnische Soldaten hatten das Feuer eröffnet,
aber sich kurz darauf ergeben.
Die Narew-Überquerung
Als es hell wurde ging der Vormarsch weiter. Es wurde uns untersagt Tagebuch zu führen, darum
weiß ich nicht wie die Orte hießen, durch die wir marschiert sind. Als wir durch ein sumpfiges Gelände vor drangen
stand auf einer Anhöhe am Horizont, die polnische Artillerie, die uns sofort unter Beschuss nahm. Unser Hauptmann war
der Meinung dass wir schon in der Nähe des Flusses Narew sein müssten, als aus den Sträuchern ein mit Schlauchboten
beladenes Lastauto auftauchte. Wir wurden aufgefordert mit je 6 Mann ein Schlauchboot zu nehmen, an einem Aggregat
der daneben stand mit Luft zu füllen und zu Wasser zu lassen. In einer Stunde war das ganze Bataillon über die Narew,
wo der Vormarsch fortgesetzt wurde. In einem Dorf überraschte uns die polnische Kavallerie und fing sofort mit
Maschinengewehren zu schießen an. Da kam der Befehl: Alles wieder zurück. Es ging noch schneller als auf der Hinfahrt.
Wir sind erst einige Kilometer am Fluss entlang gegangen und haben dann zum zweiten Mal rüber gesetzt.
Die Gehöfte im Dorf standen alle in Brand. Auf einem waren viele Bienestöcke. 2 Kameraden wollten den Stöcken Waben
entnehmen, doch die Bienen durch das Feuer aufgeschreckt, überfielen sie sofort und stachen derart zu das sie nicht
mehr wieder zu erkennen waren. Ich habe die Einstichstellen mit Salmiak betupft, mehr konnte ich nicht tun. Wir mussten
auf unserem Vormarsch durch einen Wald der in Flammen stand, so dass man kaum atmen konnte. Es ging weiter in Richtung
Minsk und Warschau, wo schon die Sowjetische Armee durchgegangen war, die Pferde und Vieh von einem Gut mitgenommen
hatten. In einem Wald stießen wir unverhofft auf ein Kloster, in dem wir einige Gefangene machten. Dann trafen wir auf
eine gute Straße die nach Grochow ging.
Als wir dort einmarschierten wurden wir aus den oberen Stockwerken beschossen, so dass wir, um uns zu schützen, nur an
den Hauswänden entlang gehen konnten. Wir haben jedes Haus nach Feinden durchsucht. Vor einem Haus stand ein Hund der
niemanden reinlassen wollte, solange bis ihn eine Kugel traf. Die polnische Artillerie feuerte von Warschau aus, um
unseren Vormarsch zu stoppen. Wir hatten uns gerade eingegraben als plötzlich deutsche Flieger am Himmel erschienen,
die unsere Stellungen mit Bomben bewarfen und dabei viel Unheil anrichteten. Wir haben sofort Fliegertücher
ausgebreitet und Leuchtraketen abgeschossen. Da ich in dem Graben, den ich kurz zuvor ausgehoben hatte, sofort in
Deckung gegangen bin ist mir zum Glück nichts passiert. Unter den anderen Kameraden gab es viele Verwundete, so dass
ich nicht wusste wem ich zuerst helfen sollte.
Der Oberstabsarzt hat mich sofort tatkräftig unterstützt, so das bald alle Verwundeten versorgt waren, außer einem,
dem ein Bombensplitter den Arm abgerissen hat. Ich habe im 3 große Verbandspäckchen auf die Wunde gelegt, doch die
Blutung ließ sich trotzdem nicht stoppen, so dass er eine Stunde später auf der Krankensammelstelle verstarb. Wir
haben danach in einem Tomatenfeld einen Graben ausgehoben und eine neue Abwehrstellung bezogen. Die Gruppe Schwarz
bekam den Auftrag nach etwaigen versprengten polnischen Verbänden Ausschau zu halten, als sie unerwartet aus einer
Häuserreihe mit Maschinengewehrsalven überschüttet wurden. Der Gruppenführer und noch ein Soldat wurden dabei tödlich
verwundet. Danach wurde noch ein weiter Stoßtrupp, unter der Führung von Leutnant Briskorn, der sich dazu freiwillig
gemeldet hatte, hinaus geschickt um den Gruppenführer und den anderen Toten zu bergen.
Bei diesem Unternehmen, das erfolglos ausging, weil die Toten schon verscharrt waren, durchschlug eine Kugel den
Stahlhelm von Leutnant Briskorn, der auch sofort tot war. Alle Toten wurden später, an der Kirchenmauer in Grochow, in
Särgen beigesetzt: Hauptmann Schönwald sagte, das sie nach dem Kriege auf den Heldenfriedhof nach Ortelsburg überführt
werden. Drei Tage lagen wir bei Grochow in Stellungen, waren dem polnischen Maschinengewehrfeuer sowie den Bomben
deutscher Flugzeuge ausgesetzt. In der Nacht musste ich zu einem Verwundeten in die vorderste Linie und habe den
Rückweg nicht mehr finden können, als plötzlich Gewehrfeuer aufflammte habe ich in den Ruinen Schutz gesucht. Erst im
Morgengrauen konnte ich mich wieder orientieren und zu meinem Unterstand zurückfinden.
Warschau wurde tagelang bombardiert und stand auch unter Artilleriebeschuss. Aus dunklen Rauchwolken kamen oft ganze
Bündel von Papier angeflogen. Die Verwundeten kamen oft auf Krücken zu unserem Unterstand, ich habe sie dann zur
Krankensammelstelle hingeführt. Wir haben auch polnische Zivilpersonen betreut, die während der Kampfhandlungen
verwundet wurden. Als einmal 2 Jungen vorbeiliefen hat einer ihnen nachgerufen sie sollten seiner Frau Bescheid sagen,
er wäre auf der Krankensammelstelle an der Kirche. Als wir dort ankamen war seine Frau, mit einem Kind auf dem Arm,
schon da.
Nach der Kapitulation von Warschau, gingen wir über Sokolow zum Bug und haben dort Quartier bezogen. Der Russe hatte
sich bereits hinter den Fluss zurückgezogen, hatte alles Vieh und Pferde mitgenommen. Dort erreichte mich ein Telegramm
von zu Hause, dass meine Tochter gestorben ist. Es sprach sich auch herum dass verschiedene Heimaturlaub bekommen haben,
ich durfte auch für 14 Tage heim. Wir fuhren mit Lastautos nach Allenstein in die neue Reiterkaserne, zum
Ersatzbatallion, da haben wir unsere Gewehre und Munition abgeben, dann durften wir, jeder in seinen Heimatort
weiterfahren.
Als wir unsere Quartiere am Bug verlassen haben war sehr viel Schnee gefallen. Hier in Ortelsburg fanden wir die
gleiche Wetterlage vor, aber nach 3 Tagen war alles wieder weggetaut und wir konnten die Kartoffelernte, die durch den
frühen Wintereinbruch gestoppt wurde, zu Ende bringen. Ein Tag bevor ich zu Hause angekommen bin wurde die Tochter
beerdigt. Nach 14 Tagen mussten wir uns in Allenstein melden, Gewehre empfangen und wieder zurück zur Division an den
Bug 150 Kilometer hinter Warschau. Die elfte Division, zu der wir auch gehörten sollte in den Westen Deutschlands
verlegt werden und war schon unterwegs zur Verladestation Skiernewice 50 Kilometer vor Warschau.
Mein Dienst als Sanitätsunteroffizier
Unser Bataillon kam in das Städtchen Burscheid, im Kreis Opladen, wo wir in Privatquartieren
untergebracht wurden. Nach 3 Monaten, im Januar 1940, wurden wir nach Solingen verlegt, wo wir bis zum
Frankreichfeldzug stationiert waren. Wir mussten an Feldübungen teilnehmen, wie andere die in Kasernen untergebracht
waren. Während dieser Zeit musste jeder seine Zähne in Ordnung bringen lassen. Jeden Tag fuhren 20 Mann in die
Cäzilienstraße nach Köln, zur Zahnklinik. Im Rheinland wurde unsere Division neu aufgestellt. Ausfälle durch den
Polenfeldzug wurden durch neue Soldaten ergänzt. Ich kam nun zum Ersatzbatallion, war der Älteste in der ganzen
Kompanie. Als der Frankreichfeldzug losging wurde unser Ersatzbatallion mit den noch vorhandenen Verwundeten, in die
neue Reiterkaserne, nach Allenstein verlegt.
Meine Frau hat, mit Unterstützung der Bauernschaft, einen Antrag gestellt, daraufhin wurde ich zur Frühjahrsbestellung,
beurlaubt und später bis auf weiteres vom Militärdienst freigestellt. Als der Russlandfeldzug losging wurde ich von der
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg, für 14 Tage einberufen. Ich war seit 1922, Mitglied der freiwilligen
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg und habe jedes Jahr an Übungen teilgenommen. Jede Bereitschaft musste etliche Leute
stellen. Von Rohmanen wurden Emil Rosowski, Johann Dembek, und ich, zur Krankensammelstelle Wirballen, in Litauen,
abkommandiert. Dorthin kamen Lazarettzüge aus Russland mit der Breitspurbahn. Die Verwundeten wurden frisch verbunden
und auf Waggon mit Normalspur verladen und nach Deutschland gebracht.
Als die 14 Tage vergangen waren wollten wir wieder nach Haus zurück, doch man wollte uns nicht entlassen. Stattdessen
wurden wir dem Wehrkreisamt Königsberg zugeteilt, neu eingekleidet und zur Aushilfe ins Lazarett nach Gumbinnen
abkommandiert. Mehr als ein Jahr war ich in den Urlauber-Baracken, habe dort Krankenstube betreut. Später, bis zum
Dezember 1944, war ich im Reserve-Lazarett 4, in Königsberg tätig. Dort habe ich auch die Luftangriffe der Engländer,
vom 25 bis 26. August 1944 miterlebt.
Wir sollten gerade einen Lazarettzug in Rotenstein entladen, als plötzlich die Sirenen ertönten - Fliegeralarm. Im
gleichen Moment waren die ersten Flugzeuge auch schon da, zuerst warfen sie „Tannenbäume” und danach Foßforkanister ab.
Die Omnibusse standen schon zur Abfahrt bereit als es losging. Wir haben die Verwundeten schnell in den
Luftschutzkeller getragen, haben die Betten von den Fenstern weggerückt damit die Verwundeten nicht von den
Glasssplittern verletzt wurden. Im Kasernenhof brannten die Fosforkanister lichterloh. Unsere Unterkunft, die sich in
einer Baracke befand ist völlig abgebrannt, mit dem Wenigen was wir unser Eigen nannten. Am nächsten Tag wurden wir neu
eingekleidet und am 29. bis 30. kamen die englischen Bomber wieder, sie setzten genau da ihr Zerstörungswerk fort wo
sie vor 3 Tagen aufgehört hatten.
Anfang Dezember 1944 musste ich mich nach Stablack melden und musste dann zur Sanitätsabteilung 1, nach Gernau, das
liegt zwischen Lodz und Warschau. Vormittags hatten wir Felddienstübungen und nachmittags theoretischen Unterricht.
Jeden Tag wurden Gruppen zusammengestellt und zu anderen Einheiten abkommandiert. Ich kam zu einer Panzerabteilung, wo
wir an einem Morgen plötzlich auf dem Kasernenhof antreten mussten und zu unserer Überraschung mit der Nachricht
konfrontiert wurden, dass der Russe an mehreren Frontabschnitten durchgebrochen war. Wir bekamen sofort einen
Marschbefehl in Richtung Lodz, wo das Stadtbild noch intakt war, selbst die Straßenbahnen fuhren noch. In der Nacht
haben russische Flugzeuge die Stadt bombardiert. Die Kaserne in der wir untergebracht waren hatte keine
Luftschutzkeller, aber zum Glück blieben wir von Bombentreffern verschont. Am nächsten morgen bot sich uns ein Bild der
Verwüstung. Die entgleisten Straßenbahnwagen, sowie andere Fahrzeuge blockierten die Straßen. Die Älteren unter uns
bekamen Fahrscheine für einen Transportzug, der bereit hinter Lodz abfahrbereit, unter Dampf stehen sollte. Als
russische Panzer in den Straßen auftauchten, verbrannte die Schreibstube unsere Wehrpässe und andere wichtige
Dokumente. Wir liefen zu der Station auf der unser Transportzug bereitstehen sollte, aber da war kein Zug mehr zu sehen
und wir setzten unseren Rückzug zu Fuß fort.
Der Rückzug und Zusammenbruch der Ostfront
In Dobroschin, einer Stadt in Polen, wurde gerade ein Lazarettzug verladen, doch wir kamen nicht
mehr zum Einsatz, weil die russische Infanterie uns schon auf den Fersen war. Es ging weiter über den Fluss Bober,
Sagan, bis nach Glogau an der Oder. Dort wurden wir der 29. motorisierten Sanitätskompanie zugeteilt. Im
Garnisonslazarett wurden noch Operationen durchgeführt. Unsere Division hatte ihr eigenes Feldlazarett, so dass wir den
Befehl zu Weiterfahrt erhielten und noch unbeschadet die Oderbrücke passieren konnten, denn Glogau wurde zur Festung
erklärt. Wir haben 2 Pferdewagen organisiert und mit Verbänden, sowie medizinischen Instrumenten beladen. So kamen wir
bis nach Lübbenau im Spreewald, wo wir in einem Schloss, in zuvor ein Museum war, unser Lazarett untergebracht haben.
Weil die Amerikaner Cottbus bombardiert hatten, wurden die Verwundeten zu uns nach Lübbenau gebracht. Hier haben wir
Tag und Nacht gearbeitet, um die vielen Verwundeten, aus den schweren Kämpfen bei Grünberg und Sagan zu versorgen. Die
Soldaten von der Abwehrfront kamen schon mit abgestorbenen Armen oder Beinen bei uns an, weil in vorderster Linie keine
Frontlazarette mehr vorhanden waren; es mussten viele Amputationen durchgeführt werden. Als für unsere Pferde kein Heu
mehr vorhanden war, schickte mich unser Hauptfeldwebel, zu einem Bauern in den Spreewald, mit dem Auftrag, Futter zu
besorgen. Mit noch zwei Mann fuhren mit zwei Kähnen, zuerst den Hauptstrom entlang und dann in einen Nebenarm; da haben
wir die Boote beladen und brachten das Heu nach Lübbenau.
Als wir uns bei unser Einheit zurück melden wollten, war alles schon marschbereit. Ich bin schnell in einen Bus
eingestiegen der sofort losfuhr, weil russische Verbände schon in sichtweite waren. Russische Flugzeuge kreisten über
den Dächern und nahmen, mit ihren Bordwaffen jeden unter Beschuss, der sich irgendwo blicken ließ. Wir konnten nur
durch den Wald, oder in der Nacht vorwärts kommen, denn wenn ein Auto auf der Landstraße fuhr, war alsbald ein Flugzeug
hinter ihm her und schoss es in Brand. Als wir nach Tagen am Ufer der Elbe ankamen, war bereits eine Ponton-Brücke
erstellt worden, welche die zerstörte Brücke ersetzen sollte.
Durch die vielen Fahrzeuge waren in den Sand tiefe Spuren gefahren, so dass andere Fahrzeuge unsere Busse ins
Schlepptau nehmen mussten, weil wir mit eigener Kraft nicht mehr weiterkamen. Beiderseits der Trasse standen
Flüchtlingswagen, in der der Hoffnung die Brücke passieren zu können, doch SS-Polizei verhinderte das die Gespanne den
militärischen Rückzug zum Stillstand brachten. Es gelang uns die Elbe zu überqueren, um in einem Waldstück Schutz vor
feindlichen Fliegern zu suchen.
Als wir unsere Busse und Autos gut getarnt hatten, hat unser Bataillonschef die anwesenden Parteigrößen zu sich
gerufen und ihnen erklärt das wir eine Einheit des Roten Kreuzes sind und nach internationalem Recht keine Waffen
besitzen dürfen. Nach langer, erregter Diskussion wurde beschlossen einen Graben auszuheben und alles im Sand zu
verscharren. Als wir dann weiter, durch die Dörfer fuhren, sahen wir schon viele weiße Bettlaken, als Zeichen der
Kapitulation, aus den Fenstern hängen. Es wurde uns erzählt dass der Bürgermeister von der SS erschossen wurde, weil
er die Bevölkerung zu diesem Schritt ermutigt hatte. Jetzt waren hinter uns die Russen und vor uns schon die Amerikaner.
Amerikanische Panzer fuhren umher und schossen wild durch die Gegend, ohne ein Ziel anzuvisieren. Niemand wollte sich
dem Russen ergeben, doch der Weg der zu den Amerikanern führte, war durch abgesägte Bäume blockiert. Wir sind schnell
in das nächste Dorf gegangen, haben uns Sägen und Äxte besorgt, die Bäume durchgesägt und in den Straßengraben
geworfen.
“ Nach dem Ende des 2. Weltkrieges.”
In amerikanische Kriegsgefangenschaft
Dann fuhren wir unter internationaler Flagge an eine Mulde Brücke, vor der zwei amerikanische Soldaten, mit Zigarren,
zur Hälfte im Mund, standen. Sie rauchten und kauten gleichzeitig. Wir mussten auf einen freien Platz fahren, alle
aussteigen und rechts wieder antreten. Wäschebeutel und Tornister mussten wir abstellen; danach wurden wir nach Waffen
durchsucht, Wertsachen, Uhren und Messer wurden uns gleich abgenommen. Als wir anschließend an unserem Gepäck
vorbeigingen durfte niemand was mitnehmen. Als ich gebückt, nach meinem Wäschebeutel greifen wollte, in dem sich noch
3 Konservendosen und ein Brot befanden, bekam ich einen Fußtritt ins Gesicht, so dass mir ein Zahn ausgeschlagen wurde.
Wir wurden dann in einem Garten zusammen getrieben und gefragt ob jemand bei der SS gedient hat. Nachdem wir in Reihe
und Glied angetreten waren, mussten wir den Oberkörper freimachen und die Arme anheben. Es wurde nach SS-Zeichen
gesucht, die gewöhnlich unter dem Oberarm eintätowiert waren. Nachdem wir Grimma bei Leipzig, wo wir in amerikanische
Gefangenschaft geraten waren, verlassen hatten, mussten wir durch ganz Thüringen bis Hersfeld, an der Grenze zu Hessen,
marschieren. In Hersfeld wurden wir auf große Lastautos verladen, die von farbigen Soldaten gefahren wurden. Man hat
uns mit Stöcken hinauf getrieben, solange bis das Auto so voll war das man kaum stehen konnte. Die Soldaten fuhren, für
diese Straßenverhältnisse, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Wenn die Straße eine scharfe Kurve hatte, flogen
wir alle übereinander und mussten erst mit viel Kraftanstrengung auf die Beine kommen um diese Fahrt zu überstehen.
Da die Straßenränder in dieser Gegend mit Obstbäumen bepflanzt sind und deren Äste sehr niedrig hängen, hätten die
uns die Köpfe abgerissen, wenn wir uns nicht ständig geduckt hätten. Unsere Fahrt endete in Bad Kreuznach, in der Pfalz,
wo wir in ein Lager, in dem sich später 130.000 Mann und 6 Generäle befanden, eingepfercht wurden. Die Unterkunft der
Generäle befand sich unter einem Zelt, alle anderen mussten die Zeit unter freiem Himmel zubringen. Die Offiziere, die
Unteroffiziere, die Mannschaften; wurden in getrennten Camps untergebracht. Die Mannschaften wurden auch zur Arbeit
abkommandiert und konnten bei dieser Gelegenheit, Brot, Brötchen oder Zigarettenstummel organisieren, wogegen die
Offiziere und Unteroffiziere ihr Camp überhaupt nicht verlassen durften.
Die ersten Tage gab es kein Wasser und kein Brot, so dass die Kameraden vor Erschöpfung umfielen. Später standen wir
manchmal den ganzen Tag nach Wasser an, das von den, uns bewachenden Negern mit großen Wassertanks angefahren wurde. Am
dritten Tag bekamen wir mittags und abends etwas zu Essen; Brot bekamen wir erst nach zwei Wochen, nach dem aus der
Umgebung herbeigeholte Handwerker, Backöfen gebaut hatten. In den verschiedenen Gemeinden, die in den uns umgebenden
Weinbergen lagen, mussten sich alle Männer beim Bürgermeister melden. Als sie dann erschienen waren, wurden sie auf
bereitstehende Lastautos getrieben und zu uns ins Lager gebracht. Sie waren ohne Kopfbedeckung und ohne wärmere
Bekleidung angekommen, weil ihnen gesagt wurde, dass ihr Aufenthalt im Lager nur von kurzer Dauer sein würde. Man hat
uns, falls noch vorhanden, Decken und Mäntel abgenommen, mit der Begründung, sie würden für Kranke und Verwundete
gebraucht. Jeden Tag starben mehr als 200 Mann, die wir sofort in ein Zelt tragen mussten. In der Nacht wurden die
Toten dann mit unbekanntem Ziel, weggefahren.
Viele haben ihren Verstand verloren uns irrten im ganzen Camp ziellos umher. Als Latrinen wurden Gräben ausgehoben, in
die verschiedene Kameraden, bei der Verrichtung ihrer Notdurft, vor Schwäche hineingefallen sind und nicht mehr wieder
heraus kamen. Aus den Pfählen die, die jungen Obstbäume stützten, haben wir Krankentragen gebaut um unsere Kameraden,
bei Bedarf, zur Krankensammelstelle zu tragen. Es war in diesem Frühjahr auch sehr kalt, doch unsere Erdlöcher, die wir
zum Schutz vor Kälte und Wind, nur mit leeren Konservendosen ausgehoben hatten, durften nicht tiefer als 20 Zentimeter
sein. Nach jedem Regenguss mussten wir das Wasser ausschöpfen. Nach einem Gewitter, standen wir wiedermal, total
durchnässt in unserem Camp, als unerwartet am Horizont die Sonne hervortrat. Einer unserer Kameraden hatte noch eine
Trompete gerettet und fing, von dem Anblick völlig überwältigt, zu spielen an: "Es geht alles vorüber, es geht alles
vorbei, nach jedem Dezember, folgt wieder ein Mai". Daraufhin hob sich die Stimmung der tiefbetrübten Kriegsgefangenen,
so das Heimatlieder durch das ganze Camp erklangen, obwohl wir in den nassen Kleider herumgehen mussten, bis sie am
Körper trocken wurden.
In französischer Kriegsgefangenschaft
Nach etwa einem Monat, haben uns die Amerikaner, den Franzosen, zum Arbeitseinsatz, ausgeliefert.
Etwa 4 Kilometer von Bad Kreuznach entfernt, stand auf freier Strecke, ein Zug mit offenen Kohlenloren, auf den wir
verladen wurden. In jeden Waggon, wurde pro Person eine Tafel Schokolade und ein Päcken Zwieback rein geworfen, doch
viele Kameraden fanden nur leere Päckchen vor, weil die schon zuvor von der französischen Wachmannschaft geplündert
wurden. Wir haben uns darüber beschwert, doch die haben uns nur ausgelacht. Nachdem wir zunächst bei Mainz über den
Rhein fuhren, endete unsere Fahrt bei Paris in einem großen Zeltlager. Dort wurden wir auf andere Züge verladen, die uns
nach Südfrankreich, in ein Barackenlager, bei Mazarei, brachten.
Auf einer Zwischenstation hat man uns unter einer Pumpe, die Lokomotiven mit Wasser versorgt, abgestellt, den Kran
aufgedreht und uns anschließend ausgelacht, die Kinder Haben uns mit Steinen beworfen. Ein Wachmann kam in unseren
Waggon gekommen, hat unser Gepäck durchsucht, wenn er Tabak oder Zigaretten gefunden hat, nahm er sie mit. Die Kameraden
waren darüber so empört, dass sie vorhatten, ihn nachts unter den Waggon zu werfen. Wir haben sie gebeten dass zu
unterlassen, weil man uns in diesem Falle, alle erschießen würde.
Als wir ins Lager kamen wurden wir zuerst gezählt, dann mussten wir unser Gepäck stehen lassen und beiseite treten.
Wenn man bei der Nachkontrolle noch was in den Taschen fand, wurde das auch entwendet, selbst Esslöffel. Wir wurden
dann in drei Baracken, ohne Toiletten, eingeschlossen. Die Kameraden haben ihre Bedürfnisse in Kochgeschirre erledigt
und durch ein kleines Fenster, das sich fast unter der Decke befand, hinausgeworfen. Andere Fenster ließen sich nicht
öffnen, weil sie mit Stacheldraht zu geflochten waren. Als die Kameraden die Kochgeschirre auskippten, haben die
Wachposten geschossen und die Fenster zertrümmert. Sie waren der Meinung dass wir ausbrechen wollten. Es herrschte eine
große Hitze, in den überfüllten Baracken sind wir fast erstickt. Am nächsten Tag haben wir uns über fehlende Toilettem
beschwert, da haben sie Heringsfässer durch die Hälfte geschnitten und an der Ausgangstür hingestellt. Um bei den
überfüllten Räumen dort hinzukommen, musste man über die Köpfe der Anderen steigen. Viele hatten Fieber und Durchfall
und mussten in die Krankenstube eingeliefert werden, wo sie kurz darauf verstarben.
Besonders Raucher litten sehr an der Unterernährung, bekamen Wasser in den Beinen und waren die Ersten die verstarben.
Nach der Registrierung wurden wir auf andere Baracken verteilt. Die Zivilbevölkerung kam in die Räume und begann uns
auszuplündern. Wer noch gute Schuhe besaß musste sie ausziehen und bekam dafür die kaputten des Plünderers. Eine Woche
lang mussten wir diesen Zustand ertragen, erst als die Kameraden sich beschwerten, wurde am Eingang eine Tafel am
Eingang angebracht, dass die Zivilbevölkerung das Lager nicht betreten darf. Bis auf einige, wenige Ausnahmen wurde
diese Anweisung befolgt.
Als wir im Lager ankamen, war der französische Lagerkommandant, ein ehemaliger Kriegsgefangener, der bei einem Bauern
in Deutschland gearbeitet hatte. Dieser Bauer war jetzt als Kriegsgefangener in seinem Lager. Als er ihn erkannte, hat
er ihn gleich zum Küchendienst eingeteilt und mit dem nächsten Krankentransport nach Hause fahren lassen. Zu Mittag
bekamen wir nur gekochte Haferkörner, da schwamm alles oben, später war man dann auf Gerste umgestiegen. Als viele
daran gestorben waren, weil sie diese „Rohkost”, die nur ein Kuhmagen verträgt, nicht gegessen haben, hat man die
Körner durch eine Schrotmühle laufen lassen. Dann hat man uns Steckrüben gekocht; wir bekamen 250 Gramm Weißbrot,
etwas Quark und ein viertel Liter Magermilch. Später, als wir schon arbeiten mussten, hat man in unserem Essen einen
Kuhkopf mitgekocht, das hat dann bedeutend besser geschmeckt.
Bevor wir morgens zur Arbeit gingen, mussten wir zu Flaggenparade und abends, nach der Rückkehr, haben wir die Flagge
wieder eingeholt. Wir haben einen Kanal gereinigt, dessen Sohle 2 Meter dick mit Schlamm bedeckt war. Zuerst wurde das
Wasser abgelassen, dann haben wir, einer dem andern, den Schlamm mit der Schippe hoch gereicht. Der Letzte hat den
Schlamm, der so zäh war, dass er nicht von der Schippe wollte, oben am Rande abgelegt. Manchmal waren 10 Mann nötig um
den Höhenunterschied zu überwinden. Das Wachpersonal schoss über unsere Köpfe hinweg und rief: „schnell arbeiten”. Bei
der großen Hitze war das ein Ding der Unmöglichkeit, zumal es nichts zu Trinken gab. Auf dem Heimweg haben wir im Walde
Heilkräuter gesammelt, die man in der Küche getrocknet und als Tee zubereitet hat, den wir am nächsten tag zur Arbeit
mitnahmen, um unseren Durst zu stillen.
Unser Aufseher hatte einen Stock, an dem sich noch kurz abgeschnittene Äste befanden. Wer seiner Meinung nach, nicht
ordentlich gearbeitet hat, bekam gleich Schläge auf den Rücken. Die weißen Aufseher wurden irgendwann durch Neger
ersetzt, die uns bedeutend besser behandelt haben. Wenn irgendetwas schief ging, haben sie nichts gesagt, nur gelacht.
In den übrig gebliebenen Wassertümpeln hatten sich noch einige Aale versteckt, die wir zu fangen versuchten, was uns
auch manchmal gelang. Wir mussten ihnen das Genick brechen, damit sie uns nicht entwischen konnten. Wenn die Franzosen
bemerkten das wir Aale hatten, wurden sie uns abgenommen. Gelang es uns aber, sie ins Lager zu bringen, dann haben wir
uns eine köstliche Malzeit zubereitet.
Um sicherzustellen dass niemand geflüchtet ist, wurden wir, wenn wir abends ins Lager zurückkamen, zuerst gezählt.
Diese Zählung wurde mehrmals wiederholt, weil die Wachmannschaften sich immer wieder verzählt haben. Als einer von uns
hin ging, ihnen sagte dass alle da sind, wollten sie es nicht glauben und haben uns vor dem stehen lassen, bis es ihnen
irgendwann einfiel. uns doch das Tor zuöffnen. Einmal, als wir von der Arbeit zurückgekehrt waren, standen wir bis 23
Uhr neben der Flagge, weil uns niemand das Tor geöffnet hat. Als wir dann doch irgendwie ins Lager kamen haben wir
festgestellt, dass das ganze Wachpersonal betrunken war und niemand im Stande uns das Tor zu öffnen.
Eines Tages waren wir wieder abends zur Parole angetreten, als ein älterer Herr mit seinem Hund, am Stacheldraht
entlang, spazieren ging. Weil der Hund, unterm Stacheldraht hindurch, zu uns kam, hat ihn einer geschnappt, ihm das
Genick gebrochen und unter seiner Jacke versteckt. Der Franzose hat nach seinem Hund gerufen und gepfiffen, aber alles
vergebens, der Hund war nicht aufzufinden. Die Kameraden haben ihm gleich das Fell über die Ohren gezogen, das Fleisch
gekocht und das Fell in die Latrine geworfen. Das Fleisch wurde umgehend verspeist.
Als wir am nächsten Tag von der Arbeit zurückkehrten, war im Lager der Teufel los. Wir mussten sofort antreten und
wurden gefragt, wo der Hund geblieben ist, der Gestern Abend, mit seinem Herrchen, am Zaun entlang spazieren ging. Als
sich niemand dazu bekannte, mussten wir weiterhin stehen bleiben, während die Wachmannschaften von Baracke zu Baracke
gingen und alles durchsuchten. In einer Latrine hat man dann das Fell gefunden, was uns ein furchtbares „Donnerwetter”
einbrachte und in den nächsten Tagen, nach der Arbeit, unter dem Kommando eines Oberfeldwebels, eine Stunde
nachexerzieren.
In Südfrankreich regnet es den ganzen Sommer nicht; die Bauern haben da keine Scheunen und das Getreide wir nur in
Schobern aufgestellt und dann umgehend gedroschen. Vom Oktober bis Dezember regnete es fasst jeden Tag in Strömen.
Gesät wird nur im Frühjahr und im Herbst, weil im Sommer alles vertrocknet. Es wird viel Wein angebaut und die
Steckrübe wächst den ganzen Winter. Neben den Weinreben wurde aus Schieferplatten ein Zaun aufgestellt, um dem Wein
einen optimalen Standort zu sichern. Die Bauernwagen hatten nur zwei Räder und waren nur mit einem Pferd bespannt, das
die ganze Balance des Wagens zu halten hatte. Trotzdem haben sie soviel aufgeladen wie wir auf einen Leiterwagen. Viele
Kameraden wurden den Bauern zur Arbeit ausgeliehen. Wenn ein Bauer einen Arbeiter gebraucht hat und es wurde gefragt,
wer sich in der Landwirtschaft auskennt, da haben sich alle gemeldet. Der Bauer konnte sich dann aussuchen, wen er
mitnehmen wollte.
Wenn wir durch die Stadt zur Arbeit gingen, haben verschiedene Leute Fallobst in die Abfalleimer gelegt. Wenn das von
den Kameraden bemerkt wurde, schwenkten viele aus der Reihe, um sich etwas mit zunehmen, was von den Wachmannschaften
nicht gern gesehen wurde. Viele Kriegsgefangene hatten keine Schuhe mehr, sie haben die Füße nur mit Lumpen bewickelt.
Eines Tages kamen Kameraden aus Norwegen, die nach Deutschland entlassen werden sollten. Mann hat sie jedoch ins Lager
gesteckt und zur Arbeit eingeteilt. In Norwegen hatten sie Kleider und Stoffe eingekauft, hatten volle Seesäcke und
sogar Karren auf 2 Rädern, weil sie ja in die Heimat entlassen werden sollten. Als wir morgens zur Arbeit rausgeführt
wurden standen sie schon vor dem Lager. Wir haben ihnen zugerufen, dass sie uns etwas abgeben sollen, weil ihnen ja
sowieso alles abgenommen wird, aber sie haben uns nur ausgelacht. Als sie ins Lager Kamen mussten sie ihr Gepäck
ablegen, wurden dann wo anders hingeführt und haben es danach nie wieder gesehen.
Durch die vielen Läuse, Flöhe und Wanzen die wie im Lager hatten, kam es bei verschieden Kameraden, an den
Einstichstellen, zu eiternden Entzündungen. Um dem vorzubeugen hat man uns mit einem Pulver, das in Frankreich
hergestellt wurde, aber bei den Parasiten keine Wirkung zeigte, eingesprüht. Erst bei der Anwendung eines Mittels
amerikanischer Herkunft, war alles über Nacht verschwunden.
Der Sonntag war arbeitsfrei. Dann kam ein katholischer, französischer Pfarrer, eskortiert von 3 Mann, mit
aufgepflanztem Seitengewehr ins Lager und hat Gottesdienst gehalten. Einen evangelischen Pfarrer gab es nicht, nur
einen Baptisten Prediger. Der wurde würdevoll eingekleidet, bekam ein großes Kreuz und hat jeden Sonntag in einer
extra dafür hergerichteten Baracke Gottesdienst gehalten. Wer Theologie studiert hatte und sich meldete, wurde zu
einem Seminar geschickt und konnte sein Studium fortsetzen. Glasbläser durften das Lager auch verlassen und ihrem
erlernten Beruf wieder arbeiten.
Wer sich freiwillig, für 5 Jahre, zum Dienst in der Fremdenlegion verpflichtet hat, das waren etliche unter uns, wurde
neu eingekleidet, bekam gutes Essen und Rauchwaren soviel er wollte. Nach einem Jahr wurden, nach und nach, die
Kranken und Körperbehinderten in die Sowjetische Besatzungszone entlassen. Eine Entlassung von Kriegsgefangenen, die
in den Westzonen oder jenseits von Oder und Neise zu Hause waren, war nicht vorgesehen. Die Österreicher wurden alle,
unabhängig von ihrem Gesundheitszustand entlassen.
Ich habe Briefe nach Hause geschrieben, aber die kamen nur bis Allenstein und wurden wieder zurück geschickt. Als eine
Kommission des Roten Kreuzes aus der Schweiz unser Lager besichtigt hat, haben wir uns beschwert, das wir als
Sanitätsdienstgrade, zur Arbeit gehen müssen. Daraufhin erging ein Befehl: Wer einen vom Roten Kreuz, ausgestellten
Ausweis besitzt, gehört einem internationalen Verband an und braucht nicht zu Arbeit gehen. Aus unserem Lager hatten
sich 20 Mann gemeldet, die daraufhin Freigang, in Begleitung von zwei französischen Wachsoldaten erhielten. Als wir
gefragt wurden wo wir hin wollen, entschlossen wir uns, einen Soldatenfriedhof, auf dem unsere verstorbenen Kameraden
beerdigt waren, zu besuchen.
Da der Untergrund in dieser Gegend aus Felsen bestand, wurden die Gräben, in denen die Toten in selbst gezimmerten
Kisten nebeneinander gestellt wurden, mit Hilfe von Dynamit ausgehoben. Ein Leichenwagen, mit einem Pferd bespannt,
das mit einer schwarzen Decke abgedeckt war, wurde von einem Kutscher in angemessener Kleidung, gefahren. Der Wagen
konnte gleichzeitig 4 Kisten transportieren. Wenn wir von der Arbeit kommend, dem Leichenwagen begegneten, wurde
gehalten und mit einer Schweigeminute der Toten gedacht, bis der Wagen vorbei war. Die Zivilbevölkerung verharrte auch
im Schweigen, mit abgenommener Kopfbedeckung.
Ein Kamerad, der in Krottorf, Kreis Oschersleben, bei Magdeburg, zuhause war, sagte bei seiner Entlassung zu mir:
Sollte ich das Glück haben, meine Entlassungspapiere zu erhalten ohne eine Bleibe vorzuweisen, dann soll ich Krottorf
als Heimatadresse angeben. Auf der Krankenstube habe ich angegeben, dass sich noch ein Schrapnellsplitter, aus dem
Ersten Weltkrieg, in meiner Kreuzbeingegend befindet, er zwar verkapselt ist, aber immer noch Beschwerden verursacht.
Daraufhin wurde ich zur Entlassung vornotiert. Als bekannt wurde das ein Rückkehrertransport in die sowjetische
Besatzungszone zusammengestellt wird, habe ich mich sofort gemeldet und wurde für ein Entlassungslager in Angoleme
vorgesehen. War das eine Freude, als uns mitgeteilt wurde, wann der Rücktransport stattfindet.
In unserem Lager waren noch 2 Kameraden aus dem Kreis Ortelsburg: Ein Gustav Lumma aus Leynau und ein Alfred Moritz
aus Groß Schöndamerau. Sie mussten noch zurückbleiben und haben mir den Auftrag erteil, die Angehörigen in der Heimat
zu grüßen und ihnen die Anschrift mitzuteilen. Als wir im Entlassungslager ankamen, fragte man uns nach unserer
Heimatanschrift. Dann wurden die Entlassungspapiere angefertigt. Es wurde uns auch ein Barscheck, für die in Frankreich
geleistete Arbeit ausgehändigt, den wir bei jeder Kasse in Deutschland einlösen könnten. Ich habe ihn bis zum heutigen
Tage nicht einlösen können, obwohl ich irgendwann in der Zeitung gelesen habe, das Verrechnungschecks die den aus
französischer Kriegsgefangenschaft Entlassenen, ausgehändigt wurden, einzulösen sind.
Wir kamen zuerst nach Saar Elbe, dann in die Nähe der Zonengrenze zu Thüringen. Hier mussten wir 2 Tage warten, weil
aus der sowjetischen Besatzungszone keine Eisenbahnwagen bereitgestellt wurden. Angesichts dessen, das der Russe beim
letzten Transport die aus Frankreich kommenden Wagen kassiert und nicht mehr herausgeben wollte, bestand der Franzose
jetzt darauf, seine Wagen sofort wieder mitzunehmen. Als der sehnsüchtig erwartete Zug endlich eintraf, durften wir
umsteigen und kamen, immer noch hinter Stacheldraht, nach Erfurt. Von dort weiter ins Quarantänelager nach Prätsch an
der Elbe.
Unter Androhung von Strafe war es verboten das Lager zu verlassen, doch der Hunger zwang uns dazu, in den umliegenden
Dörfern um Lebensmittel zu betteln. Man drohte uns damit, dass Zuwiderhandlungen, mit einer 14-tägigen Verlängerung der
Quarantäne geahndet werden. Der Roggen war schon reif und wir haben, auf den umliegenden Feldern, die Ähren abgerissen,
das Korn, zwischen 2 Steinen zu Mehl zerrieben, um daraus eine Suppe zu kochen, denn von dem was unsere Lagerküche uns
bieten konnte, war es nicht möglich zu überleben. Als der Eigentümer bemerkte wer seine Roggenähren entwendet hat, kam
er ins Lager, gerade zu dem Zeitpunkt als wir mit dem Mahlen beschäftigt waren. Der Lagerkommandant, bei dem er sich
beschwerte, drohte uns zu bestrafen, wenn wir unsere „Rauzüge” nicht unmittelbar einstellen würden. Wir sagten ihm er
solle uns heimfahren lassen, da wir doch lange genug hinter Stacheldraht gesessen hätten.
Endlich wieder in Freiheit
14 Tage nach unserer Ankunft wurden uns Entlassungspapiere ausgehändigt, sowie auch Fahrscheine
zum den, von uns angegeben Heimatorten. So kam ich nach Krottof, Kreis Oschersleben, zu meinem ehemaligen
Kriegskameraden, bei dem ich einen Tag geblieben bin. Er hatte mir schon eine Stelle bei einem Bauern besorgt, der 70
Jahre alt und kinderlos war. Zum Hof, den er mit seiner Ehefrau bewirtschaftet hat, gehörten 36 Morgen Land, 2 Ochsen
und 3 Kühe. Das Ackerland bestand aus 17 Parzellen und sicherte mir einen Arbeitsplatz.
Jetzt, da ich ein Dach überm Kopf und genug zu essen hatte, fing ich an nach dem Verbleib meiner Familie zu forschen.
Bei meinem letzten Heimaturlaub hatte ich mit meiner Frau verabredet; falls wir uns in den Kriegswirren verlieren
sollten, unsere Kontaktadresse, die meiner Quartiersleute in Burscheid, Kreis Opladen, sein sollte. Ich habe zuerst
nach Rohmanen geschrieben, aber leider keine Antwort erhalten. Dann habe ich nach Burscheid geschrieben, und siehe, -
bei denen lag schon eine Anfrage meiner Frau vor, die nach mir gefragt, und ihre jetzige Anschrift hinterlassen hatte.
Ich habe dem Bauern erzählt dass meine Frau sich zurzeit, auf einem Gut, in Alt Steinhorst, im Kreis Rostock, befindet.
Er war sofort bereit uns ein Zimmer zur Verfügung zu stellen, wenn ich meine Frau nach Krottorf rüberholen wollte. Das
habe ich Ihr mitgeteilt und sie war sofort bereit ihren Wohnsitz nach Krottorf zu verlegen, denn sie wohnte dort in
einem kleinen Stübchen unterm Dach.
Im Herbst, als die Feldarbeit so ziemlich erledigt war, bin ich nach Alt Steinhorst gefahren, um meine Frau und meinen
Sohn Kurt, sowie meinen Sohn Manfred, den ich noch nicht kannte, weil er erst nach der Flucht, am 31. Januar, in Groß
Lüssewitz, geboren wurde, nach Krottorf zu holen. Meine Frau hatte schon Holz für den Winter besorgt und vom Gut, auf
dem sie im Sommer gearbeitet hatte, Mehl und Kartoffeln bekommen. Wir haben das Mehl und andere Habseligkeiten in
Kisten verpackt. Das Holz haben wir einem Bauern gegeben, der uns und unser Gepäck, mit seinem Pferdewagen, zum 14
Kilometer entfernten Bahnhof, nach Ribnitz gebracht hat. Wir sind auch gut in Krottorf angekommen, aber als wir am
nächsten Tag, unsere Kisten vom Bahnhof abholen wollten, haben wir zwar die Kisten vorgefunden, doch der gesamte Inhalt
wurde während der Bahnfahrt entwendet. Die Bahnstation in Krottorf hat die Vorkommnisse zur Kenntnis genommen und
protokolliert, aber unsere Sachen haben wir nie wieder gesehen und mussten wieder bei Null anfangen.
Im Winter musste ich auf der Genossenschaft, unentgeltlich, für die Russen Weizen einsacken. Ich hatte versucht eine
Arbeit als Zimmermann zu bekommen, doch auf dem Arbeitsamt wurde mir gesagt, ich bin Ladwirt und muss auf der
Landwirtschaft arbeiten. Da in den ersten Nachkriegsjahren, auch in der sowjetisch besetzten Zone Arbeitsplätze knapp
waren, mussten auch solche, die einen anderen Beruf erlernt hatten, jede zumutbare Arbeit annehmen. Aus der Heimat
erhielt ich einen Brief, von meiner dort noch lebenden Mutter. Sie schrieb das sie mich noch einmal sehen wollte und
ich sollte doch wieder zurück kommen; Unser Hof wäre nicht von Polen besetzt und sie wäre ganz alleine, weil der Vater
nach dem Durchzug der Front von den Russen erschlagen wurde. Daraufhin habe ich dem polnischen Konsulat in Magdeburg
mitgeteilt, dass ich in Rohmanen eine Landwirtschaft besitze, und um eine Einreisegenehmigung gebeten.
Nach 2 Monaten erhielt ich eine Postkarte, mit der Mitteilung, ich sollte mich persönlich beim Konsulat vorstellen.
Nach Aufnahme meiner Personalien, wurde mir gesagt, das ich benachrichtigt werde wenn mein Antrag genehmigt wird. Ende
Juli 1947 erhielten wir die Einreisegenehmigung nach Ostpreußen, das jetzt unter polnischer Verwaltung stand. Wir
mussten zuerst zum polnischen Konsulat in Berlin-Lichterfelde, wo wir umgeben von einer Trümmerlandschaft, gewartet
haben, bis alle Untersuchungen und Formalitäten erledigt waren.
“ Wieder zurück in Ostpreußen.”
Der schwere Wiederaufbau nach dem Kriege
Dann fuhren wir über Frankfurt/Oder, Posen, Thorn, Allenstein, nach Ortelsburg, wo wir am 2. August 1947 ankamen. Mit
einem zweirädrigen Karren, den ich mir von einem noch in Ortelsburg lebenden Bekanten ausgeliehen hatte und meinem
Sohn Manfred im Kinderwagen fuhren wir nach Rohmanen. Meine Mutter war inzwischen verstorben und auf dem Hof war nur
meine, inzwischen aus Russischer Gefangenschaft wiedergekehrte Schwester, Frieda Pelkowski.

Es war alles ausgeplündert; kein Vieh, keine Maschinen und der ganze Hof mit kniehohem Graß überwachsen. Nur schmale
Trampelpfade, vom Haus zum Holzschuppen und zum Klo, durchkreuzten das satte Grün. Ich habe das Gras auf dem Hof mit
einer Sense, die ich noch gefunden habe, abgemäht, damit der Hof nicht so verwahrlost aussah. Am nächsten Tag habe ich
mich bei der Polizei in Ortelsburg angemeldet, wo ich auch ein Startgeld von 100 Zloty erhielt und Gepäckstücke, die
ich in Krottorf aufgegeben, am Bahnhof abgeholt. Es hat mich sehr gewundert das, das Gepäck überhaupt angekommen ist.
Da man von der Landwirtschaft nicht Leben konnte, habe ich mich in den nächsten Tagen, bei der jetzt polnischen Bahn,
um Arbeit beworben und wurde auch angenommen. Wenn wir unseren Monatslohn bekamen, saß immer einer am Tisch, der von
uns 100 Zloty für den Wiederaufbau von Warschau verlangte. Wenn ich dran war, riefen die Anderen, ich hätte Warschau
zerstört und müsste deshalb 200 Zloty abgeben. Nach 3 Jahren kam eine Verfügung, die besagte, dass wer länger als 1
Jahr bei der Bahn beschäftigt ist, angestellt werden muss. Um diese Bestimmung zu umgehen hat man mich entlassen und
eine Woche später wieder eingestellt.
Als ich vor Ablauf des nächsten Jahres, aus dem gleichen Grunde wieder entlassen wurde, habe ich mich bei der
Stadtverwaltung in Ortelsburg(jetzt Szczytno)beworben, wo ich zuerst im Gaswerk als Heizer und später auf Baustellen
als Zimmermann gearbeitet habe. Wir haben durch den Krieg beschädigte Häuser repariert, in den ehemals touristischen
Zentren einige Ausbesserungen an den Einrichtungen durchgeführt, eine Ziegelei wieder in Betrieb gesetzt und andere
anfallende Arbeiten verrichtet. Im Dach des Rathausturmes war während der Kämpfe eine Granate eingeschlagen, die, die
Dachlatten und die Verschalung zerstört hatte. Da wir, unter schwersten Bedingungen, den Schaden repariert haben,
wurde uns eine Höhenzulage versprochen, die wir aber nicht bekommen haben.
Aus Verärgerung darüber habe ich bei der Stadtverwaltung gekündigt und bei einer Wiederaufbaufirma unter der Leitung
von Bauingenieur Laskowski wieder angefangen, wo ich bis 1954, als Zimmermann beschäftigt war. Ab da habe ich mich
nur um meinen Hof gekümmert, der wegen meiner Arbeitsstellen, gezwungenermaßen, sehr vernachlässigt wurde. Als wir
1947 zurückkamen, brachten wir unseren Sohn Manfred noch im Kinderwagen. Den hat meine Frau zum Markt gebracht,
verkauft, und dafür eine Ziege erworben, die dank guter Pflege, uns täglich mit 4 Liter Milch versorgte. Das war der
erste Baustein zum Wiederaufbau, unserer durch den Krieg zerstörten, und danach ausgeplünderten Landwirtschaft.
Während meiner Arbeit bei der Bahn haben wir uns eine Kuh gekauft, die nach einem halben Jahr, wegen nicht bezahlter
Grundsteuer, vom Gerichtsvollzieher gepfändet wurde. Man hat uns die Kuh weggenommen und bei einem Arbeiter, der in
der Ernst-Mey-Straße in Ortelsburg wohnte und sie wegen nicht vorhandener Futtermittel, nur mit Kartoffelkraut
gefüttert hat, untergestellt. Als ich bei der Bahn meinen Monatslohn bekommen habe, bin ich zur Gmina gegangen, habe
eine Rate angezahlt und durfte dann die Kuh wieder mit nach Hause nehmen. Durch die schlechte Ernährung war die Kuh
stark abgemagert und lieferte nur die Hälfte der ursprünglichen Milchleistung.
Später habe ich ein Pferd auf Abzahlung bekommen, das 140.000 alte Zloty gekostet hat. Die Stute war schwach und unser
Feld sehr hügelig, so dass man nur bergab pflügen konnte, was sehr beschwerlich war, bergauf ging es immer im Leerlauf.
Später habe ich die schweren Böden mit dem Traktor umpflügen, und in den letzten Jahren auch mit dem Binder mähen
lassen. Von der Stute habe ich 2 schöne Fohlen gezogen; ein davon habe ich bei der Ausreise in die Bundesrepublik
mitgebracht und bei der Viehverwertungs-Genossenschaft in Göttingen verkauft. In den ersten Nachkriegsjahren als noch
wenig Land bestellt wurde, breiteten sich auf den nicht beackerten Flächen, Wildkräuter aus. Disteln und andere
Schnellwachsende, erreichten manchmal eine Höhe von 2 Meter, besonders auf den schweren Böden.
Es hat viel Schweiß gekostet ehe man den Acker soweit hatte, das er auch befriedigende Erträge abwarf. Die
Währungsreform von 1950, hat unser weiniges Geld das wir schon gespart hatten, wieder vernichtet. Ich hatte 2 Pferde,
1 Fohlen, 2 Kühe und Schweine, als ich wieder aufgefordert wurde nicht bezahlte Grundsteuern nachzuzahlen. Als ich
nicht bezahlen konnte, hat der Vollziehungsbeamte, ein Fohlen, eine Kuh und ein Schwein gepfändet. Es gelang mir jedoch
nach längeren Verhandlungen, ohne größere Verluste, alles zu regeln. Später kam eine Verfügung, die besagte; wenn
jemand auf seinem Hof nur eine Kuh und ein Pferd hatte, durften sie nicht gepfändet werden. Einige haben ihr Inventar
dieser Verfügung angepasst und dadurch die Zahlung von Grundsteuer umgangen.

Wer seine Steuern pünktlich bezahlt und sein Kontingent an landwirtschaftlichen Produkten fristgerecht abgeliefert hat,
der konnte seine, darüber hinaus erwirtschafteten Produkte zu marktgerechten Preisen verkaufen. Für eine hochtragende
Sterke, mindestens 400 kg schwer, die auf ein staatliches Gut verkauft wurde, konnte man bis zu 12000 Zloty bekommen.
Unsere Böden waren kalkarm, doch durch den Einsatz von Kalk und Kunstdünger konnte man den Ertrag erheblich steigern.
Kalk und Kunstdünger konnte man bei der Genossenschaft(GS) bestellen, der dann auch direkt auf den Hof geliefert wurde.
Kalk wurde geliefert und gleich auf dem Feld ausgestreut. In den 1960ger Jahren waren alle Ackerflächen der Rohmaner
Felder bestellt.
Die nach dem Krieg zurückgebliebenen deutschen Bauernfamilien, aber auch die Polen, die während des Krieges beim Bauern
in Deutschland gearbeitet haben, versuchten mit teils bescheidenen, oder auch zusammen gesuchten, landwirtschaftlichen
Geräten, die bäuerlichen Betriebe aufrecht zu erhalten. Nach den schweren Anfängen in den ersten Nachkriegsjahren
erzielten sie schließlich einen beachtlichen Erfolg, der sich in wogenden Kornfeldern, sowie in grünen Wiesen auf
denen gut genährtes Vieh weidete, widerspiegelte.
Ein schwerer Einschnitt in meinem Leben.
Am 11. Mai 1956 verstarb nach langer schwerer Krankheit, meine liebe Ehefrau Marta Rattay,
geborene Brosch. Ein Jahr zuvor war schon mein Schwiegervater Gottlib Brosch verstorben. Die schweren Bedingungen
unter denen wir nach Kriegende leben mussten, haben ihrer bereits angegriffenen Gesundheit sehr zugesetzt. Sie
verstarb mit 44 Jahren und hinterließ in unserer Familie eine große Lücke, die nicht mehr zu Überbrücken war. Wir
haben sie unter großer Anteilnahme der noch verbliebenen deutschen Bevölkerung zu Grabe getragen und auf dem Rohmaner
Friedhof beigesetzt. Die Arbeit die sie sonst verrichtet hatte fiel jetzt auf mich und meine Söhne zurück. Meine
Schwester Frieda Pelkowski half auch wo sie nur konnte. Wir waren auf die Unterstützung durch Nachbarn und Freunde
angewiesen, die uns immer wenn es nötig war, tatkräftig unterstützt haben. Im laufe der Zeit haben wir wieder zum
Alltag zurück gefunden, haben sie noch etliche Jahre auf dem Friedhof besuchen können, bis wir, bedingt durch unsere
Ausreise uns endgültig von ihr trennen mussten.
Der endgültige Abschied von Ostpreußen
Ab 1956 begannen, durch die Vermittlung des Deutschen Roten Kreuzes, die ersten Ausreisen in die
Bundesrepublik Deutschland. Zuerst waren es Kinder die zu ihren Eltern ausreisen durften, Familien deren Väter aus der
Kriegsgefangenschaft in den Westen Deutschlands entlassen wurden und andere durch den Krieg getrennte
Familienangehörige. Ab 1960 erhöhte sich die Zahl der Ausreisewilligen aus dem polnisch besetzten Ostpreußen. Es setzte
sich die Überzeugung durch, dass unsere Angestammte Heimat, uns für die Zukunft keine Perspektive mehr bieten konnte.
Meistens wurden die Anträge, die wir an die Passabteilung in Allenstein stellen mussten, um einen Ausreisepass zu
bekommen, negativ beschieden. Nach mehrmaligen Versuchen gelang es dann doch, diese begehrte Ausreiseberechtigung in
Empfang zu nehmen. Die Enttäuschung der Zurückgebliebenen war groß, wenn wieder mal Verwandte oder Nachbarn, den Weg
in Richtung Bahnhof einschlugen.
Um einen Reisepass zu beantragen, musste man zuerst eine Einladung von Verwandten aus der Bundesrepublik vorlegen, in
der, diese sich verpflichten mussten, für Unterkunft und Verpflegung der Eingeladenen zu sorgen. Diese Einladung
musste durch ein Amt in der Bundesrepublik beglaubigt werden. Außerdem mussten die Kosten für die Bahnfahrt, ab
polnischer Grenze, bis zum Zielort, beim polnischen Reisebüro ORBIS, in Warschau, in DM eingezahlt werden.
Unseren ersten Ausreiseantrag haben wir 1964, bei der Kommandantur der polnischen Miliz in Allenstein eingereicht, der
nach einer gewissen Zeitspanne, ohne eine uns verständliche Begründung zu nennen, abgelehnt wurde. Gegen diese
Ablehnung wurde ein Widerspruch zugelassen, den wir sofort einreichten. Nach einer weiteren Zeitspanne erhielten wir
wieder eine Ablehnung, gegen die kein Widerspruch mehr zulässig war. Wer seine Ausreiseabsicht nicht aufgeben wollte,
musste einen neuen Antrag stellen. Es gab Familien die schon 10 Mal einen Ausreiseantrag gestellt hatten und immer
wieder abgewiesen wurden. Da meine Söhne, nicht die Absicht hatten in Rohmanen zu bleiben und ich nach 2 Weltkriegen,
an denen ich teilgenommen, die schwere Arbeit auf der Landwirtschaft, nicht aus eigener Kraft schaffen würde, haben wir
1966 wieder einen Antrag gestellt, der prompt abgelehnt wurde. Der Widerspruch auf diese Ablehnung wurde auch negativ
beantwortet, so dass wir 1968 wieder einen Antrag eingereicht haben.
Weil das Passamt in Allenstein lange nichts von sich hören ließ, hegten wir schon die Hoffnung das es jetzt klappen
würde und waren sehr enttäuscht als wieder eine Absage kam. In der Zwischenzeit sind viele Nachbarn und Bekannte aus
Rohmanen, sowie aus der näheren Umgebung, ausgereist und das Häuflein der noch verbliebenen Deutschen, wurde immer
kleiner. Die Motivation, die uns in früheren Jahren, über so manche schwierige Lage hinweg geholfen hat, ist einer
hoffnungslosen Resignation gewichen. Man war davon überzeugt, dass unser Leben, in unser Angestammten Heimat, keine
Zukunftsperspektive mehr haben konnte und wenn wir keine Ausreisegenehmigung bekommen, wir eines Tages die letzten
Deutschen in der ganzen Umgebung sein werden.
Die Ausreise-Heimat ade
Wir hatten die Hoffnung schon aufgegeben, als am 30. April 1969, der Briefträger unseren Hof
betrat und mir einen Brief überreichte, in dem uns das Passamt in Allenstein mitteilte, dass unsere Ausreise in die
Bundesrepublik Deutschland, genehmigt worden ist. Wir müssten, nach Aushändigung der Reisepapiere, den Geltungsbereich
der Volksrepublik Polen, innerhalb von 3 Monaten verlassen. Wir waren zuerst geschockt, über den Hinweis, das wir
unsere Heimat in 3 Monaten verlassen müssen, aber dann stellte sich die Zukunftsperspektive wieder ein und wir gingen,
wie von einem schweren Ballast befreit und gut gelaunt unser weiteren Tätigkeit nach.
Als der Briefträger unseren Hof betrat, waren ich und mein Sohn Kurt gerade dabei eine Fuhre Mist zu laden. Wir hatten
den Wagen gerade halb geladen und haben nach der frohen Kunde nicht mehr weiter gemacht, sondern die Pferde vorgespannt
und den Mist aufs Feld gefahren, damit wir den Wagen für alle Fälle frei hatten. Das war die letzte Tätigkeit für
unsere Landwirtschaft in Ostpreußen.
Die Nachricht von unserer Ausreise verbreitete sich, ohne dass wir darüber gesprochen haben, wie ein Lauffeuer.
Alsbald kamen Leute aus dem Dorf, die sich für das Vieh und für diverse Landwirtschaftliche Geräte interessierten.
Etliche wollten bestimmte Sachen sofort kaufen, andere haben nur zurücklegen lassen und wollten später kommen und
bezahlen, haben es aber dann doch nicht genommen.

Wenn man eine Landwirtschaft hatte, konnte man 2 Pferde, 2 Rinder, 3 Schweine, 5 Schafe und 10 Hühner, in einem
geschlossenen Viehwaggon, in die Bundesrepublik mitnehmen. Jeden Tag war man unterwegs, von einer Behörde zur Andern.
Die Aushändigung der Reisepapiere erfolgte nur nach Vorlage bestimmter Bescheinigungen: Es mussten alle Steuern bezahlt
sein, das Kontingent landwirtschaftlicher Erzeugnisse musste abgeliefert sein, je eine Bescheinigung vom Katasteramt
und vom Notar musste vorgelegt werden, das man dem polnischen Staat das Grundstück abgetreten hat. Die Gebühren für
die notarielle Beglaubigung mussten wir selbst bezahlen. Wenn man alle Bescheinigungen beisammen hatte, bekam man bei
der Kreisverwaltung eine Gesamtbescheinigung. Mit dieser Bescheinigung konnte man nach Allenstein, zur
Polizeikommandantur fahren, wo man nach dem schriftlichen Verzicht auf die polnische Staatsangehörigkeit, einen
Reisepass ausgehändigt bekam, der den Inhaber zum Grenzübertritt berechtigte, aber nicht zur Wiedereinreise.
Wir haben 2 Pferde, eine Sterke, einen Ochsen, 5 Schafe, 2 Schweine und 10 Hühner mitgenommen. Über die Schutzimpfung
der Rinder musste man eine, vom Kreistierarzt beglaubigte Bescheinigung vorweisen. Ich habe 5 Schafsböcke gekauft, die
ich in der Zwischenzeit, hinter der Scheune, zum Weiden angekettet hatte. Einer von denen hat sich losgerissen und
seinen Nachbarn getötet. Das Fleisch konnten wir noch verkaufen, mussten aber dafür einen anderen Schafsbock kaufen.
Innerhalb von 3 Monaten mussten wir alles regeln und zwei Tage vor der Abfahrt einen Eisenbahnwagen, bei der
Eisenbahndirektion in Allenstein bestellen. Reservierungen bei den polnischen Behörden waren meist immer mit
Schmiergeld verbunden, weil man sonst nie sicher sein konnte dass diese Vereinbarungen auch eingehalten werden. Schon
2 Wochen vor unserer Abfahrt, gab es in Ortelsburg keine alkoholischen Getränke zu kaufen. Meine Söhne mussten mit dem
Motorrad die umliegenden Dörfer abfahren, damit wir für die Reise einen Vorrat anlegen konnten; denn Wodka war zu der
Zeit, in Polen, wie eine zweite Währung.
Am 25. Juli haben wir zusammen, mit meinem Neffen Siegfried Brosch, unseren sonstigen Hausrat, der in Kisten verpackt
war, in einen Eisenbahnwagen, auf dem Allensteiner Bahnhof verladen. Alles musste zuerst durch den Zoll, wo die
Federbetten gewogen wurden und über das erlaubte hinausgehende Kissen, verzollt werden mussten. Dasselbe galt auch für
Fleisch und Räucherwaren.
Am 26. Juli, unserem Verladetag, kam der Eisenbahnwagen aus Allenstein, erst um 11 Uhr auf dem Ortelsburger Bahnhof an.
Die Rinder hatten wir zu Fuß, zum Bahnhof gebracht; Schweine, Schafe und Hühner auf dem Pferdewagen. Im Eisenbahnwagen
mussten, mit Hilfe von Brettern und Bohlen, Boxen für die verschiedenen Tiere erstellt werden. Jedes Pferd und jedes
Rind in eine Bucht. Die Schafe zwischen die Pferde, die Schweine zwischen die Rinder und die Hühner in einem Käfig,
unter der Decke über den Rindern. Die Hühner hatten unterwegs Eier gelegt, somit hatten wir jeden Tag frische
Verpflegung. Bei der Fahrt im Viehwagen, begleitete mich mein Sohn Manfred. Als die Lokomotive nahte, um den Wagen
abzuholen, wurden noch schnell die restlichen Sachen hinein geworfen und so mache Abschiedsträne rollte dann die Wange
hinab.
Unsere Nachbarn, Deutsche und Polen, halfen uns beim Verladen des lebendigen Inventars. Jetzt erinnerte ich mich
plötzlich, an die oft auch schönen, Ereignisse der letzten 22 Jahre. Einer Zeit, in der das Zusammenleben von
Deutschen und Polen, von Jahr zu Jahr, besser wurde. Man half sich beim einbringen der Getreideernte, beim Dreschen
des Getreides, bei der Kartoffelernte und bei anderen Arbeiten, wo viele Menschen zupacken mussten. Es war eine
Dorfgemeinschaft, in schweren Zeiten geboren; jeder half jedem wenn Hilfe nötig war. Es wurde mir plötzlich bewusst,
das jetzt ein Lebensabschnitt zu Ende ging, zu dem ich nicht mehr zurückkehren konnte. Unsere Existenzgrundlage war
jetzt ein Eisenbahnwagen auf einem Schienenstrang, dessen Ende irgendwo in weiter Ferne lag. Obwohl, von langer Hand
vorbereitet, war dieser Moment voller Wehmut.
Doch als der Zug sich plötzlich, in Bewegung setzte, war ich sofort wieder in der Gegenwart. Menschen, mit denen man
Jahrzehnte lang, in gutem Einvernehmen zusammen gelebt hat, blieben plötzlich am Bahnsteig zurück und die Entfernung
zwischen ihnen und mir vergrößerte sich mit jeder Sekunde, bis sie letztendlich aus meinem Blickfeld verschwanden.
Es war ein heißer Julitag, als wir unsere Reise gen Westen antraten. Für die Schweine, die besonders unter der Hitze
zu leiden hatten, haben wir 10 Flaschen Essig mitgenommen und sie von Zeit zu Zeit besprenkelt, damit sie besser atmen
konnten. Für die anderen Tiere war reichlich Heu und Hafer vorhanden. Eine großes Fas und zwei Milchkannen waren mit
Wasser gefüllt, die wir auf den an der Strecke liegenden Bahnstationen, bei Bedarf wieder nachgefüllt haben.
Da der Kreistierarzt nicht in seinem Büro war, konnten wir die Impfbescheinigung für das Vieh, nicht rechtzeitig
herbeischaffen. Der Zug setzte sich in Bewegung und die Bescheinigung war immer noch nicht da. Als die Bescheinigung
dann eingetroffen, wir aber schon unterwegs waren, ist mein Sohn Kurt mit dem Motorrad hinterher gefahren und hat uns
in Passenheim, wo der Zug noch andere Wagen angehängt bekam, die Impfbescheinigung übergeben. Wir waren sehr froh das
er es noch geschafft hat, denn in solch einer Situation fühlt man sich sicherer wenn man alle Bescheinigungen bei sich
hat. Auf der Rückfahrt, mit dem Motorrad hatte er noch eine Panne, musste das Motorrad stehen lassen und per Anhalter
nach Hause fahren. Am nächsten Tag kam er mit Siegfried Deptolla, der das Motorrad wieder flott machte und brachte es
wieder nach Rohmanen zurück.
Die Fahrt mit dem Viehwagen, gen Westen
Von Ortelsburg bis Allenstein(45 km) hat unser Zug 4 Stunden gebraucht, weil auf jedem Bahnhof
gehalten wurde, um neue Wagen anzuhängen. Nachdem wir in Allenstein angekommen waren, kam ein Rangierer und fragte
nach unserem Ziel. Als wir ihm mitteilten, das wir in die Bundesrepublik Deutschland wollen, sagte er nur: „In 10
Minuten fährt ein Zug los. Wenn ich von euch 500 Zloty und einen Liter Wodka bekomme, werde euch sofort anhängen,
andernfalls kommt ihr auf ein Nebengleis und müsst dann auf den nächsten Zug warten. Es blieb uns nichts anderes übrig
als seiner Forderung nachzukommen, denn über derartige Erpressungen hat man bereits von Anderen, die vor uns ausgereist
sind, gehört. Wir wurden auch sofort angehängt und fuhren dann die ganze Nacht, an Osterode, und Thorn vorbei bis
Gnesen. Dort wurde wieder rangiert.
Von einer Anhöhe wurden die einzelnen Wagen auf verschiedene Gleise verteilt und zu neuen Zügen zusammengestellt. Der
Aufprall der ungebremsten Wagen erzeugte eine derartige Erschütterung, dass manche Bretter an den Boxen geborsten waren.
Von Gnesen ging es dann in einem Zuge durch bis zur Grenzstation Reppen(Rzepin). Dort mussten wir zum Zollamt, wo
unsere Ausfuhrpapiere durch die Zollbeamten, und durch einen Tierarzt geprüft wurden. Bis Reppen(Rzepin) haben wir für
den Eisenbahnwagen 900 Zloty bezahlt; hier mussten wir noch einmal 650 Zloty bezahlen. Bei der Wagenkontrolle erklärte
uns ein Bahnbeamter das unser Wagen, sich nicht für den internationalen Transport eignet und wir deshalb den Inhalt in
einen Anderen umladen müssen, der irgendwann, auf dem Nebengleis bereitgestellt wird. Nach langer Verhandlung, sowie
einer Zulage von 500 Zloty und einem Liter Wodka haben wir ihn davon überzeugt, das der Wagen sich doch für die
Weiterfahrt eignet.
In der Nacht war Schichtwechsel, der unseren Wagen wieder abgehängt hat, weil er angeblich von der Reichsbahn der DDR,
wegen technischer Mängel nicht weiterbefördert würde. Wir mussten unsere Verhandlung vom Vorabend wiederholen, die mit
der Zusage endete, dass wir am frühen Morgen, über die Grenze auf DDR Gebiet, gebracht werden. Um 5 Uhr morgens kam
eine Lokomotive, die uns den letzten Abschnitt bis über die Grenze bringen sollte. Als der Zug hat noch einmal anhielt,
kamen polnische Grenzbeamte und Soldaten in den Wagen. Sie durchsuchten ihn und fragten, ob wir noch polnisches Geld
oder einen Grundbuchauszug bei uns hätten. Wir zeigten ihnen 800 Zloty, die sie uns, nach Ausstellung einer Quittung
über 500 Zloty, abnahmen. Die Grundbuchauszüge habe ich, im Stroh versteckt, dem Ochsen vor die Füße gelegt. Falls
jemand da suchen sollte, hätte ich gesagt, das das Tier bösartig veranlagt ist, und ich für seine Sicherheit nicht
garantieren könnte, deshalb sollte er vorsichtig sein.
Als die Grenzkontrolle den Zug verlassen hatte, setzte sich die Lokomotive wieder in Bewegung und überquerte nach
kurzer Zeit die Oderbrücke. Auf einer eingezäunten Fläche, jenseits der Grenze, hat man uns abgestellt hat und die
Lokomotive fuhr zurück auf polnisches Gebiet. Vor und hinter uns waren die Tore verschlossen. Auf den Wachtürmen,
links und Rechts von uns, standen Posten mit einem Gewehr im Anschlag. Vier Grenzbeamte der DDR, jeder mit einer
Leiter in der Hand, sowie ein Schäferhund, kamen zu unserem Wagen. Sie öffneten die Schiebetüre, stellten die Leiter
davor und ließen den Hund in den Wagen springen, der nur etwas herum schnupperte und wieder heraussprang. 2 Beamte
haben dann anschließend, die Papiere kontrolliert und das Inventar gezählt.
Nach einiger Zeit wurden wir an einen Güterzug der Reichsbahn angehängt und fuhren von Frankfurt an der Oder, vorbei
an Berlin, Ellingen und Nordhausen, über die Grenze zur Bundesrepublik bis Herzberg. Hier hat ein Zollbeamter der
Bundesrepublik, die Formalitäten erledigt und ein Tierarzt die Pferde, Rinder und Schweine gründlich untersucht. Ich
musste ihnen die Mäuler aufhalten und die Füße hochheben. Danach hat uns die Lokomotive zu einer Wasserzapfstelle
gebracht, wo wir die Tiere tränken und unsere Behälter mit Wasser auffüllen konnten. Anschließen fuhren wir über
Northeim nach Göttingen, zur Viehverwertungsgenossenschaft, die zuvor von unserer Ankunft in Kenntnis gesetzt wurde.
Der Ochse, die Sterke und die Schweine wurden, in Göttingen zum Schlachthof gebracht; die Pferde kamen nach Hannover
und die Schafsböcke nach Kassel. Wir waren mit dem Viehtransport 5 Tage unterwegs; hatten so manche Klippe umschifft
und Schwierigkeiten gemeistert, die im normalen Leben nicht vorkommen.
Wir wurden mit einem PKW, ins Durchgangslager Friedland bei Göttingen gefahren, wo mein Sohn Kurt, meine Schwester
Frieda Pelkowski und Siegfried Brosch mit Familie, die am 30 Juli, um 14 Uhr, von Warschau mit dem Zug abgefahren, und
hier am 31. Juli in den Morgenstunden eingetroffen sind, schon auf uns gewartet haben. In Friedland hat man uns mit
Familie Siegfried Brosch in einem Raum untergebracht, wir wurden registriert und erhielten 20 DM Überbrückungsgeld,
pro Person. Da wir erst am Freitag in Friedland eingetroffen sind, mussten wir hier über das Wochenende bleiben,
obwohl die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der Regel nur 3 bis 4 Tage beträgt.
Um einen Antrag für die Ausreise stellen zu können, brauchten wir eine Einladung von in der Bundesrepublik lebenden
Verwandten. Diese Einladung hat uns mein Bruder, Ernst Rattay, aus Ingelheim am Rhein zugeschickt. Ingelheim liegt im
Bundesland Rheinland-Pfalz. Das Geld für die Bahnfahrt, hat uns, Frieda Schellin, geb. Nickel, aus Duisburg, die
Tochter unseres Nachbarn, überwiesen. In Friedland wurden wir registriert. Im Registrierschein, war als unser
nächster Aufenthaltsort in der Bundesrepublik, das Durchgangslager Osthofen bei Worms, das alle Aussiedler für
Rheinland-Pfalz aufnehmen musste, eingetragen. Die Eintragung erfolgte deshalb, weil der Ort aus dem uns unsere
Einladung zugeschickt wurde, sich auch in Rheinland-Pfalz befand.
Da ich nach dem Polenfeldzug, als Soldat, ein Jahr im Kreis Opladen, im Rheinland gewesen bin, wäre ich sehr gerne in
diese Gegend gezogen, denn die Erinnerung an die schönen Tage die ich dort verlebt habe war in mir immer noch wach.
Ich versuchte die Eintragung in unseren Regiestierscheinen ändern zu lassen, was nach einigen, vielleicht auch
berechtigten Einwänden, am 4. August, vom Beauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen, genehmigt wurde. Anstelle von
Rheinlad-Pfalz stand da jetzt Nordrhein-Westfalen und am 7. August, fuhren wir, noch mit anderen Aussiedlern, ins
Durchgangslager Unna-Massen, am östlichen Rande des Ruhrgebietes gelegen. Hier wurden wir in einem Zimmer untergebracht
und konnten unser Essen in einer Gemeinschaftsküche zubereiten.
Am 8. August wurden wir in Unna-Massen, als Bürger der Bundesrepublik Deutschland registriert, erhielten
Einhundert DM Begrüßungsgeld, den Vertriebenen Ausweis -A -und 4 Wochen später den Bundespersonalausweis. In
Unna-Massen haben wir mehr als 4 Monate verbracht, weil mein Sohn Kurt, wegen fehlender Berufsausbildung, in Unna, an
einem Grundlehrgang für Metallarbeiter teilgenommen hat, der vom Arbeitsamt finanziert wurde. Am 11 Dezember 1969 sind
wir endlich an unserem vorläufigen Wohnsitz, im Durchgangswohnheim, an der Elisabethstraße 13, in Velbert angekommen.
Ab dem 5. Januar 1970 konnten meine Söhne, in der Zahnradfabrik Reining, in Velbert ihrer geregelten Arbeit nachgehen.
Von Bau- und Sparverein in Velbert wurde uns am 20. Juni 1970, unsere erste Wohnung zugewiesen.
Velbert im Februar 1972
gezeichnet: Gustav Rattay
Bis zu einem Eisenbahndamm hatten wir gute Deckung, doch wir sollten den dahinter fließenden Fluss überqueren. Doch
plötzlich explodierte über meinem Kopf eine Schrapnellkugel, der Stahlhelm wurde mir vom Kopf gerissen, Tornister und
Koppel flogen auch weg, ich lag auf der Erde und wusste gar nicht was passiert war. Plötzlich fing Blut aus der
Kreuzbeingegend zu rieseln, aus dem rechten Oberschenkel auch. Gleich nebenan war ein Granattrichter, dort habe ich
Schutz gesucht. In der rechten Rockecke hatte man immer ein großes Verbandspäckchen, das habe ich herausgenommen und
auf die Wunde gedrückt, doch das Blut floss mir bis in den Stiefel. Links und rechts von mir schlugen Granaten ein,
dicke Erdbrocken und Schlamm fielen auf mich herab, doch in meinem Erdloch war ich vor Maschinengewehrsalven geschützt.
Der ganze Rücken war angeschwollen und ich konnte mich überhaupt nicht bewegen.
Die Deutschen mussten die Stellung den Russen überlassen, einer hatte mich entdeckt, da ich aber so blutverschmiert da
lag, hat er bestimmt gemeint ich wäre nicht mehr am leben und ist weitergegangen. Nach zwei Stunden habe ich gehört
das die Russen sich wieder zurückzogen, danach herrschte eine gespenstische Stille. Als es dunkel wurde kamen deutsche
Sanitäter mit Spürhunden und haben die Verwundeten aufgesammelt. Ich wurde auf eine Trage gelegt, lag gebeugt und
konnte mich nicht rühren weil der blutverschmierte Rücken völlig verkrustet war. Ein Pferdegespann konnte nur vier
Tragen befördern, die Fahrt über Ackerfurchen war eine Tortur, ich habe nicht geglaubt das ich es überleben werde. In
einer Dorfkirche wurden wir dann ausgeladen und zu den etwa 50 Verwundeten gelegt die da schon lagen.
Mich haben sie zu den Bauchschüssen gelegt, weil ich einen Nervenschock hatte und am ganzen Körper gezittert habe. Zu
trinken bekam ich nichts, nur einen feuchten Lappen in den Mund. Ich sollte gleich operiert werden, aber es kamen
immer mehr Verwundete, so bekam ich nur eine Tetanusspritze, wurde verbunden und für den Weitertransport ins Hinterland
vorbereitet. Im Morgengrauen wurden wir auf Lastautos verladen, die aus auf ein Landgut brachten, wo wir in einem
Pferdestall untergebracht wurden. Die Fahrer fuhren so schnell über die Granatlöcher, das wir vor Schmerzen geschrieen
haben. Wir baten sie langsamer zu fahren, aber die bekamen es in ihrem Führerhaus nicht mit, erst alt ein Verwundeter,
der einen Krückstock bei sich hatte von hinten die Scheibe einschlug wurde die Fahrt erträglich. Lastautos, die
Munition und Verpflegung an die Front transportiert hatten, brachten in den nächsten Tagen immer wieder Verwundete
ins Hinterland. Die Deutschen hatten an diesem Fronabschnitt hohe Verluste zu beklagen. Wir können von Glück reden
dass wir dem Höllenfeuer überhaupt entkommen sind.
Wir wurden mit Lastautos, die ein Feldlazarett uns geschickt hatte, bis nach Lemberg befördert. da wurden wir gewaschen,
rasiert und frisch verbunden. Auf einem Nebengleis stand ein Lazarettzug, in dem wurden wir anschließend in frisch
bezogenen Betten untergebracht. Der Zug brachte uns über Annaberg nach Freiburg in Sachsen, eine Stunde hinter Dresden.
Hier wurden wir auf Tragen gebettet und mit einem Möbelwagen in ein Reservelazarett transportiert.
Mich haben sie zu den Bauchschüssen gelegt, weil ich einen Nervenschock hatte und am ganzen Körper gezittert habe. Zu
trinken bekam ich nichts, nur einen feuchten Lappen in den Mund. Ich sollte gleich operiert werden, aber es kamen
immer mehr Verwundete, so bekam ich nur eine Tetanusspritze, wurde verbunden und für den Weitertransport ins Hinterland
vorbereitet. Im Morgengrauen wurden wir auf Lastautos verladen, die aus auf ein Landgut brachten, wo wir in einem
Pferdestall untergebracht wurden. Die Fahrer fuhren so schnell über die Granatlöcher, das wir vor Schmerzen geschrieen
haben. Wir baten sie langsamer zu fahren, aber die bekamen es in ihrem Führerhaus nicht mit, erst alt ein Verwundeter,
der einen Krückstock bei sich hatte von hinten die Scheibe einschlug wurde die Fahrt erträglich. Lastautos, die
Munition und Verpflegung an die Front transportiert hatten, brachten in den nächsten Tagen immer wieder Verwundete
ins Hinterland. Die Deutschen hatten an diesem Fronabschnitt hohe Verluste zu beklagen. Wir können von Glück reden
dass wir dem Höllenfeuer überhaupt entkommen sind.
Wir wurden mit Lastautos, die ein Feldlazarett uns geschickt hatte, bis nach Lemberg befördert. da wurden wir gewaschen,
rasiert und frisch verbunden. Auf einem Nebengleis stand ein Lazarettzug, in dem wurden wir anschließend in frisch
bezogenen Betten untergebracht. Der Zug brachte uns über Annaberg nach Freiburg in Sachsen, eine Stunde hinter Dresden.
Hier wurden wir auf Tragen gebettet und mit einem Möbelwagen in ein Reservelazarett transportiert.
Im Heimatlazarett.
Als ich am nächsten Tag aufwachte und das schöne Bett sah in dem ich lag, dachte ich dass ich
im Himmel bin. Ich dankte meinem Herrgott das er mich bis zu diesem Ort begleitet hat. Am Nachmittag kamen Schulkinder
mit Geschenken und haben uns schöne Lieder vorgesungen. Anhand von Röntgenaufnahmen wurde in den nächsten Tagen
festgestellt dass bei mir ein Schrapnellsplitter an der Wirbelsäule in die Kreuzbeingegend eingedrungen war. Ich wurde
jeden Tag in Salzwasser gebadet und bekam wieder volle Verpflegung, da mein Magen zum Glück nicht verletzt war. Auf
dem Transport bekam ich nur Suppe und bei Bedarf einen feuchten Lappen auf die Lippen. Ich bin von 62 auf 43 Kilogramm
abgemagert, gehen konnte ich wegen dem Nervenschock den ich bei der Verwundung erlitten hatte auch noch nicht. Die
Wunde am rechten Oberschenkel war nur ein Streifschuss und wurde mit einem Schutzverband versorgt.
In den nächsten Tagen habe ich einen Brief nach Hause geschrieben und mitgeteilt wo ich mich zurzeit befinde. Meine
Eltern schickten mir ein Paket mit Lebensmitteln, jetzt konnte ich essen was ich wollte. Das Essen im Lazarett war
nicht besonders, jeden Tag nur Kohlblätter. Der weg zu den Toiletten führte durch einen Gemüsegarten. Die gehfähigen
Kameraden haben den ganzen Kohlrabi aufgegessen, so dass schließlich Wachposten aufgestellt werden mussten. Sechs
Wochen lang konnte ich mich nur auf allen Vieren fortbewegen, denn sobald ich mich aufrichtete wurde es mir
schwindelig und ich musste zurück ins Bett.
Als ich wieder bei Kräften war habe ich meinen Eltern mitgeteilt das ich mich in ein Lazarett in ihrer Nähe verlegen
lassen will. Der Chefarzt hatte mir zugesichert, wenn die Möglichkeit besteht in Ortelsburg unterzukommen, wird er dem
zustimmen. Meine Mutter hat daraufhin, in Ortelsburg, beim Lazarettinspektor Zantopf nachgefragt und er hat angedeutet
das sie mich aufnehmen können. Daraufhin bekam ich die Krankenpapiere und einen Fahrschein nach Ortelsburg. Da ich als
Soldat nie Heimaturlaub hatte, beschloss ich zuerst meine Eltern zu besuchen. Ich fühlte mich noch sehr schwach, habe
nach jedem Kilometer Rast gemacht, aber letztendlich war ich wieder daheim bei meinen Eltern. Die Wiedersehensfreude
war sehr groß. Ich bin am 30 Juli verwundet worden und am gleichen Tag wurde mein ältester Bruder beerdigt. Er bekam
den Splitter einer Gasgranate ins rechte Bein und ist an einer Blutvergiftung verstorben.
Am nächsten Tag brachte mich mein Vater ins Garnisonslazarett nach Ortelsburg. Ich wurde jeden Tag gebadet und massiert,
weil die Rückenhaut am Knochen angewachsen war konnte ich mich nicht schmerzfrei bücken. In Ortelsburg verbrachte ich
noch sechs Wochen, bis Ende Oktober, da wurde es schon ziemlich kalt und in unserer Barackenunterkunft ziemlich
ungemütlich. Kohlen und anderes Brennmaterial lagen im Hof auf Halde, aber es war verboten zu heizen. Kameraden die in
der Nähe zu Hause waren konnten Sonntagsurlaub beantragen.
Einer von ihnen brachte von zuhause Brennholz mit und entzündete damit im Ofen ein wärmendes Feuer, andere holten vom
Hof Kohlen, so dass der Ofen in kurzer Zeit glühend heiß wurde und die Gefahr bestand das die Betten Feuer fangen
würden. Wir hatten die Betten schon weg gerückt, da kam der Feldwebel herein und fragte wer das Feuer im Ofen
angezündet hat, doch niemand fühlte sich angesprochen. Der Feldwebel hatte den Vorfall dem Stabsarzt gemeldet, als der
am nächsten Morgen zur Visite kam, war seine erste Frage: ”Wer hat gestern Abend das Feuer im Ofen angezündet”. Als
sich niemand meldete, schrie er uns an: ”Morgen wird alles entlassen, zum Ersatzbatallion, in Diez an der Lahn! Wer
gehen kann, sofort zur Schreibstube, Krankenpapiere und Fahrscheine abholen”. Er erinnerte uns noch daran am nächsten
Tag pünktlich am Bahnhof zu sein, weil eine Verspätung unangenehme Folgen für uns haben würde. Das war das Ende der
schönen Erholungsphase. Ich blieb noch eine Nacht zu Hause und bin dann am nächsten Tag von dort zum Bahnhof gegangen.
Wieder Kriegsverwendungsfähig.
Als wir am nächsten Tag in Diez angekommen waren, wurde ich gefragt ob ich aus dem Heimaturlaub
käme, als ich das verneinte wurden mir 2 Tage genehmigt und 14 Tage Genesungsurlaub dazu. Wieder zurück im
Ersatzbatallion bestand unsere Tätigkeit aus Wache schieben und Kartoffel schälen. Nach einem Monat wurden wir von
einem Generalarzt untersucht, er hat mich für nicht einsatzfähig befunden weil ich noch den Steckschuss im Rücken
hatte und das linke Bein 10 Zentimeter dünner war. Jetzt fing das Kasernenleben wieder von vorne an. Wachdienst,
Gewehr laden, sichern, Ehrenbezeugung, Einzelmarsch und Appell. Wer nicht weit nach Hause hatte bekam zu Weihnachten
Urlaub. Ich hatte zu Heiligabend und Silvester Torwache, denn nach Ostpreußen wurde niemand beurlaubt.
Nach Neujahr 1918 wurden wir neu eingekleidet und kamen nach Köln zur Baukompanie. Mit Musik wurden wir zum Bahnhof
gebracht. In Köln wurden wir noch mit Soldaten die von andern Truppenteilen dorthin verlegt wurden in einem großen
Kinosaal, im Stadtteil Edengarten untergebracht. Wir brauchten keinen Dienst zu machen und konnten zu Heilige Drei
Könige den Gottesdienst im Dom besuchen. Kameraden die aus irgendwelchen Gründen im Arrest saßen wurden gefragt ob sie
auch am Gottesdienst teilnehmen möchten, dann würde ihnen die Strafe erlassen. Fast alle haben dem zugestimmt. Einige
Tage später wurden wir wieder auf einen Transportzug verladen, der uns über Herbestal, Antwerpen nach Brügge in Belgien
brachte. Hier mussten wir den Zug kurzfristig verlassen und einen Luftschutzkeller aufsuchen, weil Fliegeralarm
gemeldet wurde. Danach ging es wieder weiter nach Turut, Kortemark, Hauseme, Kautremollen, Zaren, Zarenlinde. Dort
wurden wir in verschiedene Gruppen aufgeteilt und einer Pionierkompanie auf dem Pionierpark Struwendorf zugewiesen.
Wir haben hinter Klerken Bunker für schwere Maschinengewehre gebaut. Unsere Arbeit konnten wir nur bei Nebel verrichten,
denn bei Sonnenschein waren wir sofort dem Beschuss der feindlichen Artillerie ausgesetzt. eine Kleinbahn die Munition
und Stacheldraht an die Front brachte war dem Beschuss besonders ausgesetzt. Die Gleise, von schweren Geschossen
zerfetzt, mussten immer wieder hergerichtet werden, damit der Nachschub aufrechterhalten werden konnte. Später haben
wir am Kemelberg bei Armentier, eine Brücke über die Lys gebaut. Um in dem Sumpfgelände einen Untergrund dafür zu
schaffen, mussten wir 10 bis 12 Meter lange Pfähle in den Boden rammen. Ein Feldwebel gab immer den Befehl: „Hoch den
Bär, noch viel mehr, dass man sieht, wie er zieht, denn dieser Pfahl, glatt wie ein Aal, durch Fels und Stein, durch
Wasser und Sand, fürs Vaterland”. Jedes mal mussten wir den Bär an Schnüren hochziehen und dann wieder herunterlassen.
Wenn es manchmal, trotz vieler Mühe nicht mehr weiter ging wurde der Pfahl auf eine bestimmte Länge abgeschnitten.
Nach Fertigstellung der Brücke kamen wir in die Siegfriedstellung bei Kambrei, zum Bau eines Bataillons-Gefechtstandes.
Da der Boden kreidehaltig war, mussten wir die großen Stücke von Hand zu Hand reichen, den Schutt haben wir dann mit
Sandsäcken aus der Baugrube gehoben und mit Ästen getarnt, damit der Stand nicht von feindlichen Fliegern entdeckt
werden konnte. Alle acht Stunden wechselte die Arbeitsgruppe. Wir mussten von der Baustelle durch das Gelände robben,
denn aufrecht gehend war man dem Beschuss der feindlichen Scharfschützen ausgesetzt, die von einem Fesselballon aus
informiert wurden der über den feindlichen Linien stand.
Der Wechsel war mit einem großen Risiko verbunden, und wurde wenn Möglich bei Dunkelheit vollzogen. Um vor
Überraschungen sicher zu sein haben wir spanische Reiter (Stacheldrahtverhaue) gebaut und vor die ersten Gräben
gestellt, die dann oft in der Nacht von den Franzosen geklaut, und dann vor ihren eigenen Linien wieder aufbaut wurden.
Wir hatten aus Bohlen eine Brücke auf Rädern gebaut, die dann in den Graben geschoben wurde, damit die Artillerie und
andere Fahrzeuge über die Schützengräben kamen. Weil um vier Uhr morgens der Beschuss mit Gasgranaten begann, mussten
wir Gasmasken aufsetzen, danach haben feindliche Flieger unsere Munitionskolonne bombardiert und total aufgerieben.
Es wurde auch eine Marinedivision eingesetzt, die bis dahin dem Küstenschutz gedient hatte und jetzt ihren ersten
Einsatz hatte.
Wir sind zuerst ein ganzes Stück in Richtung Amiens vorangekommen, doch dann blieb unser Angriff in den zuvor von
Engländern besetzten Stellungen, stecken. Da die Engländer ihre Stellungen fluchtartig verlassen hatten, fiel ihr
ganzer Proviant in unsere Hände; Schokolade, Weißbrot, Flaschenwein. Die erste Nacht haben wir in einem runden Zelt
verbracht, weil ich mir durch den starken Wind, der da herrschte eine Angina zugezogen hatte, die mit hohem Fieber
verbunden war, konnte ich die vielen Köstlichkeiten überhaupt nicht genießen.
An eine ärztliche Versorgung war überhaupt nicht zu denken, denn es mussten zuerst die vielen Granatlöcher eingeebnet
werden damit die vielen Fahrzeuge und Geschütze wieder weiter fahren konnten. Auch eine Bahnlinie musste repariert
werden, damit die großen Geschütze in Stellung gebracht werden konnten, dabei wurden auch die vielen Kriegsgefangenen,
die bei dieser Offensive gemacht wurden, eingesetzt. Als die Offensive dann schließlich scheiterte, wurden wir an die
Somme verlegt. Da habe ich die Ortelsburger Jäger, die aus Italien an die Westfront verlegt wurden, zum ersten Mal im
Einsatz gesehen.
Unser nächster Einsatzort waren dann Stellungen hinter Laon. Hier wurden die Vorbereitungen zu einer neuen Offensive
getroffen. Feindliche Flieger versuchten uns Tag und Nacht daran zu hindern die Aufmarschwege instand zu halten. Als
die Offensive dann endlich losging, hatten wir die Order eine Brücke über die Oise mit Bohlen und Balken zu verstärken.
Gleich am Anfang der Offensive mussten wir Gasmasken anlegen, um für alle Fälle gewappnet zu sein. Nur die Artillerie
und Kraftfahrzeuge durften die Landstraße benutzen, die Infanterie ging immer im Straßengraben und wurde von einer
Seite von Kopf bis Fuß mit Dreck bespritzt. Die Franzosen und Engländer haben hier schon Panzer eingesetzt, die von
Truppen aus den Kolonien gefahren wurden. Die Australier gingen mit umgekrempelten Ärmeln hinter den Panzern her.
Die letzte Offensive des Ersten Weltkrieges.
Zum Jahresende 1917 hatten noch 153 deutsche 175 alliierten Divisionen gegenübergestanden.
Zur Vorbereitung der Offensive ließ Ludendorff 39 Divisionen aus dem Osten und aus Italien heranziehen. Er ließ
spezielle Angriffsdivisionen formieren, die durch intensive Ausbildung auf den beabsichtigten, schnellen Vormarsch
vorbereitet wurden. 6608 Geschütze, 3500 Minenwerfer und 1070 Flugzeuge wurden hinter dem vorgesehenen
Angriffsabschnitt konzentriert. Den Ausbildungsbefehlen Ludendorffs, die bis zu den Kompanieführern herab verteilt
wurden, konnte man entnehmen, dass der Versuch, den Krieg mit einem mächtigen Schlag zu entscheiden schon in der
nächsten Zeit gewagt werden sollte. Wir übten die fast vergessenen Formen des Schützengefechts und des
Bewegungskrieges, auch wurde eifrig mit Gewehr und Maschinengewehr geschossen. Wir hegten keinen Zweifel daran, dass
der große Plan gelingen würde.
Den ganzen Winter 1917/18 über plante der Generalquartiermeister Ludendorff die deutsche Offensive. Zwar hatten die
Vereinigten Staaten von Amerika dem Deutschen Reich am 6. April 1917 den Krieg erklärt, aber vor dem Sommer des
Jahres 1918 war mit dem Auftreten von US-Truppen in relevanter Größenordnung nicht zu rechnen. Der deutschen Führung
blieb nur ein schmales Zeitfenster, um die Niederlage und den zu erwartenden Diktatfrieden abzuwenden. Ypern,
Armentieres, Arras, Cambrai oder Verdun wurden ernsthaft als Schauplätze erwogen. Ludendorf entschied sich für einen
Angriff zwischen Cambrai und La Fere – genau an der Nahtstelle zwischen der Französischen Armee und dem britischen
Expeditionscorps.
Der Fluss Somme bildete die Grenze zwischen Franzosen und Briten. Die Briten – nicht die Franzosen – sollten das Ziel
des Vorstoßes werden. Ihre Stellungen waren nur 130 Kilometer von der Kanalküste entfernt. Beim erreichen der
Sommemündung wäre die gesamte britische Armee eingeschlossen gewesen, denn hinter ihnen lag die Straße von Dover.
Am 21. März 1918 begann die letzte entscheidende Offensive des deutschen Westheeres im Ersten Weltkrieg. Der
Angriffsstreifen war 75 Kilometer breit. Dort hatte Ludendorff 43 Angriffsdivisionen konzentriert, dahinter 30
weitere Reservedivisionen, ihnen standen lediglich 26 britische Divisionen gegenüber. „Michael“ – so der Deckname der
„Kaiserschlacht“ – lief dank Ludendorffs akribischer Vorbereitung gut an. Der britische Oberbefehlshaber General
Douglas Haig erkannte die Chance, welche die Deutschen in dieser Situation hatten. Wollten die Deutschen diese Chance
nutzen, mussten sie darauf verzichten die Somme zu überschreiten, wo sie auf die französischen Reserven treffen und
sich von der Küste entfernen würden. Genau diesen Fehler begingen jedoch die Deutschen.
Am dritten Tag überschritt der linke Flügel mit der 18. Armee die Somme. Ludendorf stellte die Taktik über die
Strategie, wie er das bei Tannenberg und der Schlacht an den Masurischen Seen auch schon getan hatte. Ludendorffs
Befehl an die 18. Armee vom Abend des 22. März 1918 lautete: „Jetzt gilt es den Sieg auszunutzen, den Feind nicht zum
Stehen kommen zu lassen, Somme und Crozat-Kanal zu überschreiten, bevor feindliche Verstärkungen wirksam werden“.
Was Haig befürchtet hatte, trat nicht ein. Die deutsche Offensive Lief weiter Richtung Süden und lief sich schließlich
tot. Am 31 März war Ludendorff zu der Erkenntnis gekommen, dass „Michael“ gescheitert war. Am 5. April wurde die
Einstellung der Offensive befohlen. Im Hochsommer waren die US-Truppen in Frankreich angekommen und gingen mit den
Franzosen zum Angriff vor. Nur mühsam konnten Hindenburg und Ludendorf den Zusammenhalt der Front waren. Am 24. Oktober
1918 forderte US-Präsident Woodrow Wilson die bedingungslose Kapitulation, am 11.Nuvember Wurde der Waffenstillstand
von Compiegne unterzeichnet.
Zusammenbruch der Westfront und Waffenstillstand .
Als die Offensive dann letztendlich gescheitert war, wurden wir auf Eisenbahnwaggon verladen, in
eine Stellung vor Verdun gebracht und der siebenten bayerischen Division zugeteilt. Als wir ausgeladen wurden nahm der
Franzose den Bahnhof unter Beschuss. Eine Granate traf einen Waggon der mit Seifenpulver beladen war, so dass der ganze
Bahnhof aussah als wäre gerade Neuschnee gefallen. Wir gingen auf die Suche nach Kartoffeln. Als ich mit einem Sack,
vollbeladen die Böschung runter ging um zur Feldküche zu gelangen, schlug unweit von mir eine Granate ein und riss mir
den Sack vom Rücken. Ich bin mit dem Schrecken davon gekommen, mir war nichts passiert.
Der Bahnhof war menschenleer, nur ein par Kaninchen liefen verschreckt durch die Gegend und einigen Kameraden gelang
es welche einzufangen. Am nächsten Tag gelang es uns endlich die Feldküche zu erreichen. Als wir gerade beim Essen
fassen waren, schlug unweit eine Granate ein so dass Pflastersteine das Dach durchschlugen und wir das Weite suchen
mussten. und wir wieder nichts zu Essen bekamen. Ein Friseur aus unserer Kompanie fuhr immer ins Hinterland um uns
mit Proviant zu versorgen. Als er 14 Tage vor dem Zusammenbruch wieder mal zurückkam erzählte er uns schon das der
Krieg nicht mehr lange dauern würde, weil Kaiser Wilhelm mit Frack und Zylinder bekleidet, Deutschland verlassen und
ins Ausland gehen würde. In unserer Einheit hatten wir auch einen Juden der glaubte dass er sich alles erlauben darf.
Eines Morgens ging er in die Küche, als er keinen Koch vorfand stieg er auf die Gulaschkanone und hob den Deckel vom
Kessel in dem der Kaffee kochte an. Der kochende Kaffee verbrühte seine Füße so sehr das er sofort ins Lazarett musste,
für ihn war der Krieg somit zuende. Es kam noch ein Erlass, das Kameraden die 2 Jahre aktiv gedient hatten und
Gefreiter waren sofort zum Sergeanten befördert wurden. Für den 11. November 1918 war ein Waffenstillstand vereinbart
und ab 11 Uhr sollte nicht mehr geschossen werden. Wir hatten unsere Kopfkissen aufgetrennt und eine Kissenschlacht
veranstaltet, um auf diese Art und Weise unserer Freude Ausdruck zu verleihen. Als die Federn durch die Luft flogen
brachen wir in Tränen aus.
In jeder Kompanie wurde ein Soldatenrat gewählt, der aus drei Mann bestand. Wenn der Kompanieführer jemanden bestrafen
wollte, musste er erst den Soldatenrat fragen, der die Strafe befürworten, aber auch ablehnen konnte. Die Offiziere
durften keine Achselstücke mehr tragen, was für sie einer Degradierung gleich kam. Wir waren in einem Dorf
einquartiert und morgens zum Appell angetreten, als einer vom Soldatenrat sich stockbesoffen vor den auf dem Pferd
sitzenden Kompanieführer stellte und schrie: „Alles hört auf mein Kommando”. Der Kompaniechef war wie vom Blitz
getroffen, ihm versagte die Stimme. Wir sahen ein das dies nicht so weiter gehen kann und wählten einen neuen
Soldatenrat. Unser Rückzug begann bei Konflanz, einer Vorfestung von Metz und führte uns zunächst über die
luxemburgische Grenze, wo wir in einem Ort einquartiert wurden. Als wir für die Küche Holz aus dem Wald holen gingen,
entschieden wir uns eine Eiche abzusägen, ohne uns dessen bewusst zu sein, in welchem Forst wir uns befanden. Als wir
beim fällen waren fielen plötzlich Schüsse, die wir auch sofort erwiderten, bis uns ein Elsässer der sich in unserer
Kompanie befand aufklärte: „Kameraden, wir befinden uns hier auf Luxemburgischem Hoheitsgebiet”.
Wir sind dann weiter durch das Fürstentum Birkenfeld marschiert, wo das Städtchen Merzig für uns geflaggt hatte. Das
Elsass haben wir auch noch kurz gestreift. Wo wir bei einem Bauern, der uns kein Stroh für das Nachtlager geben wollte,
einquartiert wurden. Daraufhin gingen wir in die Scheune und haben uns selbst was besorgt. Wir haben dann noch erfahren,
sie hätten ein Schwein geschlachtet und warteten auf den Einzug der Franzosen. Als wir uns 1917, an der Ostfront, in
den in Karpaten, im Einsatz befanden, waren unter uns auch viele Elsässer. Sie durften ihre Heimatpost nicht in
französischer Sprache schreiben, mussten ihre Briefe offen auf der Schreibstube abgeben, wo sie zuerst kontrolliert
und dann abgeschickt wurden. Als ich in einer Nacht, mit einem Elsässer auf einem Vorposten Wache schieben musste,
wollte er mich überreden zum Russen überzulaufen. Als ich darauf nicht eingehen wollte verschwand er plötzlich in der
Dunkelheit und ich habe ihn nie wieder gesehen.
Wir sind dann weiter Richtung Worms und Ludwighafen gezogen, dort wurden wir bei einem Mühlenbesitzer einquartiert,
ein Unteroffizier und vier Mann. Obwohl wir verlaust und verdreckt waren bestand die Müllerin darauf das wir in ihren
Betten übernachteten. „Wenn alles durch ist”, sagte sie, „werde ich alles gründlich reinigen”. Der Müller brachte uns
eine Gießkanne voll Wein und sagte wir sollen es uns Schmecken lassen. Wir haben reichlich davon Gebrauch gemacht, so
dass ich gar nicht weiß wie ich ins Bett kam. Das war meine Erinnerung an die Pfalz. Manchmal waren wir auch 2 Tage im
Quartier.
Vor dem Weitemarsch wurde uns immer gesagt welche Truppe die Vorhut und welche Truppe die Nachhut übernehmen sollte.
Die Nachhut hielt immer Verbindung zu den nachrückenden Franzosen und man muss staunen wie alles reibungslos, ohne
Zwischenfälle von statten ging, was wir in erster Linie dem General-Feldmarschall Paul von Hindenburg zu verdanken
haben, der den Rückzug an der Westfront koordiniert hat.
In Köln angekommen, erhielten wir im Volkshaus unsere Entlassungspapiere, Eisenbahnfahrscheine, Reisepässe,
unterschrieben von Oberstleutnant Mann. Wir mussten Köln umgehend verlassen, weil schon am nächsten Tag die
französischen Besatzungstruppen in einmarschieren sollten. Wir fuhren mit einem Zug der bis Allenstein fuhr, dort
wurden unsere Papiere vom Soldatenrat kontrolliert. Die jüngren Jahrgänge wurden festgehalten, zu neuen Einheiten
zusammengestellt und zur Sicherung der Ostgrenze gegen die Bolschewisten abkommandiert. Ich hatte gesagt das ich noch
einen Schrapnellsplitter in der Kreuzbeingegend habe und durfte daraufhin nach Hause fahren.
Kaum in Ortelsburg angekommen fiel ich wieder dem Soldatenrat in die Hände. Sie haben alles durchsucht, haben mir mein
Seitengewehr und eine Decke abgenommen, aber ich durfte weiter und bin dann kurz vor Weihnachten 1918 auf dem
elterlichen Hof angekommen. Schon auf dem Hof habe ich meine Kleider vom Leib gerissen, weil vor Läusen und anderem
Ungeziefer nicht mehr aushalten konnte und mich erst gründlich gewaschen bevor ich das elterliche Haus betreten habe.
Die Freude über das Wiedersehen war sehr groß.
“ Unser Leben zwischen den beiden Weltkriegen.”
Endlich wieder zurück in der Heimat
Rohmanen war durch die Kampfhandlungen 1914/15 zu einem drittel zerstört worden, aber schon
wieder im Aufbau. Die Firma Grzella aus Ortelsburg hatte die Bauarbeiten übernommen. Unter der Aufsicht von Polier
Karl Kontor wurden die Dachstühle errichtet. Ich habe mich, nach kurzer Erholungspause, auch als Zimmermanngehilfe am
Wiederaufbau beteiligt. Die Firma Grzella hat das Material geliefert und auch unsere Löhne gezahlt. Wegen meinem
Steckschuss bin ich dem VDK beigetreten und habe mit dessen Hilfe eine Rente beantragt die mir auch bewilligt wurde.
Nach vier Jahren wurde ich nach Allenstein zur Nachuntersuchung vorgeladen. Die ärztliche Untersuchung hatte ergeben,
das Geschoß sei verkapselt, und nur das linke Bein etwas in Mitleidenschaft gezogen. Daraufhin wurde die Rentenzahlung
eingestellt.
Der Stellmacher Adam Ornowski war im Krieg als Sanitäter eingesetzt und hatte auf Grund seiner Erfahrungen,
 Beziehungen zum medizinischen Dienst in Ortelsburg aufgebaut. Es wurden dort Lehrgänge in Erster Hilfe angeboten,
die von Prof. Dr. Kutz geleitet wurden. Adam Ornowski hat dafür gesorgt das einige junge Männer aus Rohmanen daran
teilnehmen konnten. Adam Ornowski, August Linka, Emil Rosowski, Johann Dembek, Emil Baschek und ich sind dann dem
Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes beigetreten und mussten jeden Sonntag am Lehrgang teilnehmen. Unser
Gruppenführer war Kreisobersekretär Albrecht, Landrat von Poser, als unser Ehrenvorsitzender, hat viel zu unserer
finanziellen Unterstützung beigetragen und hat dafür gesorgt dass die Bereitschaft eingekleidet wurde.
Beziehungen zum medizinischen Dienst in Ortelsburg aufgebaut. Es wurden dort Lehrgänge in Erster Hilfe angeboten,
die von Prof. Dr. Kutz geleitet wurden. Adam Ornowski hat dafür gesorgt das einige junge Männer aus Rohmanen daran
teilnehmen konnten. Adam Ornowski, August Linka, Emil Rosowski, Johann Dembek, Emil Baschek und ich sind dann dem
Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes beigetreten und mussten jeden Sonntag am Lehrgang teilnehmen. Unser
Gruppenführer war Kreisobersekretär Albrecht, Landrat von Poser, als unser Ehrenvorsitzender, hat viel zu unserer
finanziellen Unterstützung beigetragen und hat dafür gesorgt dass die Bereitschaft eingekleidet wurde.
In jedem Dorf wurde eine Unfallstelle eingerichtet, mit einem Verbandskasten und mit Verbandsmaterial für die erste
Hilfe ausgerüstet. Die Unfallstelle in Rohmanen, die am Haus von der Straßenseite, durch eine Tafel mit einem roten
Kreuz gekennzeichnet war, hatte ich zu verantworten. An Sonntagen wurden wir an Badestellen und bei Fußballspielen
eingesetzt, haben viele Übungen bei Waldbränden durchgeführt und auch Ausflüge nach Rudzany am Niedersee gemacht. Bei
der Einweihung des Tannenbergdenkmals in der Nähe von Hohenstein kamen wir an Straßenkreuzungen zum Einsatz.
Rohmanen hatte auch eine freiwillige Feuerwehr. Bis zum ersten Weltkrieg hat Friedrich Biella als Brandmeister das
Kommando gehabt. Er war aktiver Unteroffizier, hatte gute Führungsqualitäten und die Männer, die allesamt aus dem
aktiven Militärdienst stammten hatten zu ihm ein großes Vertrauen. Nach dem Krieg wollten diese Männer,
(Friedrich Nickel, Friedrich Willam, Julius Wittkowski, Jakob Janowski, Johann Gloddek, Gustav Bednarz), nicht mehr
weitermachen. Friedrich Biella, der inzwischen zum Gemeindevorsteher gewählt wurde, hat sich dann auf einer
Gemeinderatsitzung vorgeschlagen, für die Freiwillige Feuerwehr jüngere Kräfte anzuwerben.
Zum Brandmeister hat er Herrn Wilhelm Pilath vorgeschlagen. Der wurde dann nach Königsberg zur Fortbildung geschickt.
Der Feuerwehr gehörten nun folgende Personen an: Wilhelm Pilath(Brandmeister), August Linka(Stellvertreter), Gustav
Deptolla, Julius Matzey, Johann Dembek, Willy Willam, Gustav Rattay. Der Kreisbrandmeister war Heinrich Thalmann aus
Ortelsburg, sein Stellvertreter war Kreisobersekretär Salzmann. Der Bezirks-Kommissar bei der Ostpreußischen
Feuersozität War Herr Ernst Trzaska. Er hat dafür gesorgt das die Wehr uniformiert und mit Löschgeräten ausgerüstet
wurde. Da die alten Schläuche schon sehr marode waren, wurden sie durch moderne ersetzt, deren Kupplungen auch mit der
Motorspritze übereinstimmten.
Ernst Trzaska hat bei der Feuersozität und beim Landratsamt Finanzmittel beantragt und auch genehmigt bekommen. Der
Schneidermeister Wilhelm Baran wurde beauftragt Tuch und Drillichanzüge nach Maas zu schneidern. Er hat uns
Stoffmuster vorgelegt aus denen wir wählen sollten. Feuerwehrhelme haben wir auch bekommen. Die Gemeinde musste
Finanzmittel bereitstellen, einen Prozentsatz vom Gemeindebudget. Im Brandfall mussten für den Spritzenwagen Pferde
zur Verfügung stehen, von Willy Willam, Gustav Rattay, Julius Matzey und Gustav Dorka, weil sie in der Nähe des
Spritzenhauses wohnten. Am Spritzenhaus wurde ein großer Baum mit Querleisten aufgestellt, wo nach jedem Brand oder
einer größeren Übung die Schläuche zum trocknen aufgehängt wurden.
Der Kreisbrandmeister hat mindestens 2-3-mal im Jahr die Wehren besichtigt. Das ganze Dorf war dann auf den Beinen,
die Bauern mit Pferden, und andere Dorfbewohner mit Eimern und Spaten, wurden dann in verschiedene Gruppen eingeteilt.
Erst hat die Wehr sämtliche Aufstellungen am Gerät geübt; Grundstellung Fahrstellung und Marschstellung. Dann wurde
ein Brand angekündigt, die Feuerwehr mit der Spritze an den Brunnen, die Gruppen dort wohin sie beordert wurden, die
Bauern brachten mit den Wasserkiwen Wasser aus dem Brunnen zum Brandort. Wenn das Wasser im Brunnen alle wurde hat
man den Saugkorb in die Kiewen gelegt und dort Wasser entnommen. Die Wassergruppe ging mit Eimern zum Dorfteich, holte
Wasser und füllte damit die leeren Kiewen.
Der Löschtrupp ging mit Feuerhaken und Löschpatschen auf die umliegenden Gehöfte und versuchte das vermeintliche Feuer
von ihnen fernzuhalten. Nach dem Alarm wurde wieder am Spritzenhaus angetreten. Die Gruppenführer mussten angeben ob
ihre Gruppe auch vollständig erschienen war, denn Übungen wurden nur vor, oder nach der Feldarbeit durchgeführt, so
dass niemand eine Entschuldigung vorbringen konnte. Wer ohne begründete Entschuldigung nicht anwesend war erhielt eine
Verwarnung. Der Kreisbrandmeister erklärte dann welche Handgriffe den Vorschriften entsprachen und welche nicht. Die
Schläuche wurden noch schnell zum Trocknen aufgehängt. Anschließend gingen wir alle in den Gasthof Trzaska, haben über
vorhandene Mängel diskutiert, Verbesserungsvorschläge unterbreitet und zwischendurch den Durst gelöscht. Der
Kreisbrandmeister ist dann, nach einer kurzen Verabschiedung, ins nächste Dorf gefahren, weil er an einem Tag mehrere
Feuerwehren betreuen musste.
Der Rohmaner Dorffriedhof

Einen Kilometer vom Ende des Dorfes entfernt, auf der rechten Seite der Landstraße in Richtung
Ortelsburg, befand sich der Rohmaner Dorffriedhof. Wann dieser Friedhof angelegt wurde entzieht sich meiner Kenntnis.
Nach Aussagen älterer Dorfbewohner soll davor auch schon eine Ruhestätte vorhanden gewesen sein, und
zwar auf der linken Straßenseite gegenüber dem jetzigen Friedhof. An dieser Stelle befand sich bis in die
Nachkriegszeit ein kleiner Brunnen, aus dem die Dorfbewohner, das Wasser zum begießen der Grabbepflanzung auf den
Gräbern ihrer verstorbenen Angehörigen holten. Der Friedhof war in einer Hanglage angelegt, wahrscheinlich weil diese
Parzelle für eine landwirtschaftliche Nutzung nicht geeignet war. Um das Gräberfeld vor herumstreunenden Tieren oder
von der Weide entlaufenen Kühen zu schützen, hat man das ganze Gelände mit einem Holzzaun umgeben. Der Zugang befand
sich von der Straßenseite. Unter einem Torbogen hindurch wurden die Verstorbenen zu Grabe getragen. Die Gräber der
einzelnen Familien waren nebeneinander angelegt, mache, wie zum Beispiel die der Familie Trzaska, sogar mit einem
schmiedeeisernen Zaun eingefasst.
Nach dem 2. Weltkrieg verfiel der Friedhof immer mehr. Die nötigen Finanzmittel für die Pflege der Einfriedung konnten
von den restlichen noch verbliebenen Deutschen nicht mehr aufgebracht werden. An den gepflegten Gräbern konnte man noch
erkennen dass es Verwandte von noch in Rohmanen wohnenden Deutschen waren, oder von bereits im Westen Deutschlands
lebenden, die ihre noch in Rohmanen wohnenden Nachbarn damit beauftragt hatten. Die übrigen Gräber wurden von Jahr zu
Jahr immer mehr von Wildkräutern überwuchert und schließlich auch von Sträuchern und schnell wachsenden Bäumen.
In den späteren Jahren konnte man nicht mehr erkennen dass dort vor Jahren Tote zur letzten Ruhe gebettet wurden. Die
Natur holte sich das ganze Gelände zurück und nur unter großen Schwierigkeiten konnten Besucher aus dem Westen das
Friedhofsgelände noch betreten.
Das Gasthaus Trzaska

Nach dem ersten Weltkrieg hat der Gastwirt Friedrich Trzaska neben dem Gasthof einen großen Saal
für Festlichkeiten und Vereinsfeiern gebaut, in dem schon mal Feuerwehrfeste veranstaltet wurden. Ernst Trzaska war
Feuerkommissar bei der Ostpreußischen Feuersozität. Erich Trzaska war Vollziehungsbeamter beim Amtsgericht in
Ortelsburg. Unser Feuerkommissar war uns beim organisieren der Veranstaltungen sehr behilflich, hat uns den Saal, die
Musik und die Theaterstücke besorgt und die Feuerwehren aus den Nachbardörfern eingeladen.
Zu Manöverzeiten, vor dem 2. Weltkrieg und dann auch während des Krieges, waren im Gasthof Soldaten, meist im Range
eines Offiziers, einquartiert. Fräulein Mariechen Trzaska hat die Poststelle im Dorf betreut. Nachdem ich 1939 zum
Militär eingezogen wurde, hat sie, nach einer Schulung im Ortelsburger Krankenhaus, auch die Unfallmeldestelle
übernommen. Nach dem Krieg, pflegte sie mit vielen Bekannten, die bereits in der Bundesrepublik wohnten, einen regen
Briefwechsel. Auf dem Rohmaner Friedhof hat sie viele Gräber, im Auftrag von Angehörigen, die auf Grund ihrer
Abwesenheit, dazu nicht mehr in der Lage waren, gepflegt. Der Bauunternehmer Kurnitzki aus Ortelsburg, äußerte die
Bitte, sie möchte ihm doch ein Blatt vom Rosenstrauch, der auf dem Grab seiner Eltern steht, in den Brief legen. Als
sie uns den Brief vorgelesen hat, waren wir zu Tränen Gerührt. Sie hat als Letzte aus ihrer Familie, bis zu ihrem Tod
im Jahre 1960, in Rohmanen, im Gebäude der Gastwirtschaft gewohnt und ist auf dem Rohmaner Friedhof beerdigt worden.
Fleisch und Wurstwaren Karl Pelkowski
Im Jahr 1931 hat der Fleischermeister Karl Pelkowski, aus Grammen, direkt neben unserem Hof ein
Anwesen gekauft und dort eine Fleischerei eingerichtet. Er war mit meiner Schwester Frieda, verheiratet. Am Anfang hat
er die Schweine noch auf seinem Hof geschlachtet, später dann im Ortelsburger Schlachthof. Jede Woche fuhr er 2-mal,
mit dem Pferdewagen(Einspänner), nach Ortelsburg zum Wochenmarkt, wo er seine Fleisch und Wurstwaren zu Verkauf anbot.
Am Tag davor, wenn er die Wurst gekocht hat, kamen viele Rohmaner mit Kannen oder anderen Gefäßen, wegen der guten
Wurstsuppe, die er umsonst unter die Leute verteilte. Als Karl Pelkowski, Ende August 1939 zum Militär eingezogen
wurde, hat seine Frau das Pferd verkauft und den Beitrieb stillgelegt. Am Haus hing, immer noch die Tafel mit der
Aufschrift: Karl Pelkowski, Fleisch und Wurstwaren. Ein Witzbold hat irgendwann darunter geschrieben; „Fleisch und
Wurst waren einmal”, drauf hin hat Frau Pelkowski die Tafel entfernen lassen. Karl Pelkowski ist im Mai 1946 in
französischer Gefangenschaft verstorben. Seine Ehefrau Frieda, verstarb an ihrem 85. Geburtstag in Mettmann bei
Düsseldorf.
Die steinreichen Rohmaner Felder
Die letzte Eiszeit hat bei der Schmelze, auf der Rohmaner Feldgemarkung viele Steine und
Granitblöcke zurück gelassen. Überirdisch, aber besonders unter der Erde, gab es viele kleine, aber auch große Steine,
die, den Bauern, beim Pflügen und anderen Feldarbeiten sehr viel Schweiß, abverlangten. In einer Kiesgrube, auf dem
Feld des Bauern August Radek, lag ein Granitblock, von schätzungsweise 100 cbm. Vor etwa 80 Jahren, als man für diese
Steine noch keine Verwendung hatte, griffen die Bauern zu einer „List”. Weil er sonst nicht pflügen konnte, hat mancher
seinem Nachbarn, die Steine in der Nacht auf dessen Feld abgeladen. Als diese Tätigkeit unter Strafe gestellt wurde,
hat man die Steine in Schluchten gekippt und mit Mutterboden zugeschüttet. In späteren Jahren kam diese jedoch beim
pflügen wieder an die Oberfläche. Dann hat man aber schon Steine für den Straßenbau gebraucht und konnte sie so zu Geld
machen. Besonders im Raum südlich von Ortelsburg, bis zur polnischen Grenze, wo Steine eine Rarität waren, kamen sie
jetzt zum Einsatz. Auch beim Bau von Häusern, besonders für die Fundamente, wurden sie eingesetzt, weil auf diese
Weise viel Ziegeln eingespart wurden. Die Firma Gribienski aus Ortelsburg hat die großen Steine mit Dynamit gesprengt
und auf diese Weise die weitere Verarbeitung erleichtert.
Die Steine welche beim Pflügen aus dem Boden geholt wurden, hat man am Feldrand auf große Haufen zusammen getragen.
Wenn die Feldarbeit beendet war, sowie auch in den Wintermonaten, waren wir jeden Tag mit Steinen unterwegs. Wir sind
vorwiegend am Abend los gefahren, weil unter der schweren Last die Wagenachsen so heiß wurden und die Gefahr bestand,
das durch die Dehnung, die Räder blockiert würden. Bei einer Fahrt konnte man bis zu 24 Reichsmark verdienen, wogegen
1 Zentner Roggen für 8 bis 9 Reichsmark zu haben war. Ich bin selbst, mit dem Pferdewagen bis Fürstenwalde, Radostowen,
Luka, Altkirchen, Höhenwerder, ja sogar bis Friedrichshof gefahren.
In Rohmanen wurden auch rote Ziegeln gebrannt. Viele Häuser wurden, mit Ziegeln erbaut, die nur wenige 100 Meter von
der Baustelle entfernt hergestellt wurden. Der Lehn wurde auf den Feldern in der näheren Umgebung entnommen, dann von
Ochsen solange getreten, bis er so geschmeidig war, das er sich in Formen einstreichen ließ. Wenn die Ziegel in der
Form trocken war, wurde sie entnommen und in einem Brennofen gestapelt. Um einen Ofen richtig anzufeuern, brauchte man
12 Raummeter Holz, das im Zeitraum von ein par Tagen verheizt wurde. Der Fischer Karl Glitza hatte schon eine
Knetmaschine, die von einem Pferd angetrieben wurde, das mit verbundenen Augen, den ganzen Tag in die Runde ging.
Im Dorf waren auch vier Kalköfen, in denen so genannte Kalksteine, die sich an gewissen Stellen, im Erdboden befanden,
gebrannt wurden. Nach dem Brennen wurden die Steine mit Wasser abgelöscht und die daraus entstandne Masse diente, nach
dem Beimischen einer gewissen Menge Sand, dann als Bindemittel beim Häuserbau. Das Gerichtsgebäude und das
Lehrerseminar in Ortelsburg wurden mit Kalk, aus dem Rohmaner Brennöfen erbaut. Auch zum Bau einer Eisenbahnbrücke, auf
der, der Zug, den Sawitzfluß, von Ortelsburg nach Allenstein überquerte, hat mein Großvater, mit einem Ochsengespann,
Kalk gefahren.
Hinter der Scheune, beim Bauern Johann Dembek hat man Tonerde gefördert, aus der man mit Hilfe einer Formerscheibe,
die von einem Arbeiter mit Muskelkraft(Fußbetrieb) angetrieben wurde, schöne Krüge, Schalen und Vasen geformt hat.
Die Töpferware wurde, nachdem sie trocken genug war, auch in einem Ofen gebrannt, anschließend mit einer Lasur
überzogen und wieder gebrannt. Es wurden auch Kacheln zum Bau von Kachelöfen hergestellt, die mit verschiedenen
Ornamenten versehen, die Wohnstuben unserer Vorfahren schmückten. So haben unsere Großväter ihr Leben gemeistert und
nach und nach, unsere Dörfer aus der Rückständigkeit in die Neuzeit geführt.
Das gesellschaftliche Leben nach dem 1. Weltkrieg

Als der Lehrer Alfred Dorka, ein Frontkämpfer des Ersten Weltkrieges und ein Sportsmann, als
zweite Lehrkraft an der Rohmaner Schule angestellt wurde, hat er die Sitten und Gebräuche aus früherer Zeit wieder zum
Leben erweckt. Zuerst hat er die Jugend zusammen gerufen, einen Jugendverein und einen Fußballclub, gegründet. Zum
Vorsitzenden des Fußballclubs wurde Johann Gloddek berufen, der ihn auch geleitet hat. Bauer Wilhelm Spittka, der am
Rohmaner See wohnte, stellte Land für einen Sportplatz unentgeltlich zur Verfügung. Lehrer Alfred Dorka hat am
Rohmaner See eine Badestelle ausgesucht und ein Sprungbrett bauen lassen. An jedem Sonnabend im Sommer, bevor die
Sonne unterging, versammelte sich die gestammte Jugend des Dorfes an der Badestelle am See. Es wurde gebadet,
Heimatlieder gesungen, gespielt, im Fackelschein eines großen Biwakfeuers, bis in die späte Nacht hinein. Der Fischer
Karl Glitza hat uns Kähne zur Verfügung gestellt, mit denen wir auf den See hinausgepaddelt sind, dabei hatten wir viel
Spaß, was wiederum den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft gefördert hat. Ich habe mit meiner Mandoline den Gesang von
Volks- und Heimatliedern begleitet.
Der Rohmaner See liegt in einem Tal, dessen Hänge zu beiden Seiten mit Kiefern und Tannen bewaldet sind. Wenn man
gesungen oder Musiziert hat, hallte es von den Hängen zurück. Die Ufer waren mit Kalmus und Schilf bewachsen, was für
die Fischaufzucht von Vorteil war. Wenn man an einem sonnigen, windstillen Tag, am Seeufer spazieren ging, traf man
oft auf Flachstellen, an denen sich die Fischbrut im Sonnenlicht wärmte, wie ein Mückenschwarm. Im See befanden sich
folgende Fische: Karpfen, Hechte, Schleie, Barsche Plötze, Rotaugen, Aale und Krebse. Am Sonntagmorgen brachten viele
Rohmaner ihre Pferde zum See um sie zu baden.
Es wurden dort, unter der Aufsicht von Lehrer Dorka, auch viele Jugendfeste mit Theatervorführungen veranstaltet, zu
denen er selbst die Vorlagen organisiert hat. Der am See wohnende Bauer Johann Nadrowski, hat uns ein Scheunentor, als
Tanzboden zur Verfügung gestellt. Der Zimmermann Wilhelm Wittek hat uns eine Windmühle gebaut, die am auf dem Boden
liegenden Scheunentor aufgestellt wurde, dazu kamen Noch Tannen und Fichten, die das Ganze wie ein Bühnenbild
erscheinen ließen. Es wunden viele Bühnenstücke aufgeführt, unter anderen >Alte Weiber werden jung gemahlen<. Dazu bot
die Windmühle die entsprechende Kulisse.
Nach der Vorführung wurde der Boden aufgeräumt, um dann als Tanzdiele zur Verfügung zu stehen. Der Gastwirt Trzaska
hatte Tische und Bänke aufgestellt, Speisen und Getränke angeboten, so dass sich die die Veranstaltung bis in die
späte Nacht hinein zog. Es waren auch Leute aus Ortelsburg und anderen Nachbardörfern dabei. Im Winter hat Lehrer
Dorka eine Kreisrodelbahn eingerichtet, die von Zeit zu Zeit mit Wasser besprengt wurde, um die Gleitfähigkeit zu
verbessern. Von einer Anhöhe ging hinunter bis auf den halben See, was für alle ein großes Vergnügen war. Es kamen
Lehrer mit Schulklassen aus der näheren Umgebung um hier zu Rodeln.
Als Herr Lehrer Jobski als Hauptlehrer nach Rohmanen kam hat er mit dem Bürgermeister und der Gemeindeverwaltung
beschlossen, in der Nähe des Dorfes, auf einem zur Schule gehörenden Grundstück, einen Sportplatz anzulegen. Dafür
wurde gleich hinter den Gärten, 6 Morgen Ackerland abgetrennt, und nach Feierabend hat Lehrer Dorka mit den
Jugendlichen eingeebnet und gleich nebenan einen Graben für Schützenstand und Kugelfang ausgehoben. Am Sonntagvormittag
wurde Fußball gespielt und um 15:00 Uhr war Kleinkalieberschießen angesagt. Es musste auch ein kleiner Beitrag erhoben
werden, um Munition kaufen zu können. Eine Büchse konnten wir aus beim Kleinkalieberverein in Ortelsburg ausleihen.
Nach Hitlers Machtergreifung
Als Adolf Hitler an die Macht kam wurde die SA gegründet. Der Bürgermeister Michael Kownatzki
wurde zum Gruppenführer ernannt und folgende Männer haben sich freiwillig gemeldet: Wilhelm Matzey, Johann Gloddek,
Gustav Nadrowski, August Buttler, Karl Baran, Emil Nickel, Wilhelm Jaschinski, Emil Bork, Ernst Rattay und Gustav Bach.
Bei Versammlungen war die SA in Uniform angetreten um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Wer versucht hat Unruhe zu
stiften, egal aus welchem Grunde, wurde aufgefordert den Saal zu verlassen, andernfalls wurde er mit Gewalt entfernt.
Herr Lehrer Jobski wurde zum politischen Leiter ernannt, seine Frau hat die NS-Frauenschaft gegründet, Lehrer Dorka
die HJ, und so bekam die Dorfgemeinschaft, nach und nach ein anderes Gesicht. Der Sportplatz und der Schützenstand
wurden jetzt mehr als früher in den Mittelpunkt gestellt. Nach der Feldarbeit hat der Bürgermeister Fuhrwerke bestellt
und den Sportplatz noch besser herrichten lassen.
Der Bauer Wilhelm Both wurde zum Ortsbauernführer ernannt, mit der Aufgabe alles Land für den Anbau von Getreide und
Futtermittel bereitzustellen, oder wenn das nicht möglich war mit Wald aufzuforsten. Durch den Einsatz von Kunstdüngern
sollten größere Erträge aus dem Boden geholt werden, um den Viehbestand zu vergrößern und mehr Milch und Butter zu
produzieren. Deutschland sollte im Stande sein sich selbst zu selbst zu ernähren, ohne auf Importe angewiesen zu sein.
Frau Jobski hat, innerhalb der der NS-Frauenschaft, mit Hilfe von Fachkräften aus Ortelsburg, Lehrgänge veranstaltet,
auf denen man Backen und Nähen lernte. Auf den Bauernhöfen befand sich auch immer mehr Rassegeflügel, das eine erhöhte
Produktion von Eiern und Geflügelfleisch sicherstellen sollte.
Die Rohmaner Bauern hatten, außer in der Landwirtschaft, noch andere Verdienstmöglichkeiten in der Kreisstadt. In
Ortelsburg wurden vier Sägewerke betrieben, die mit Langholz aus dem Walde versorgt werden mussten. Wir haben eine
Kiefer von über 8 Festmeter angefahren, der wir zuerst 6 Meter Spitze abschneiden mussten, um diese Last überhaupt
auf den Wagen zu bekommen. Sechs Pferde musste angespannt werden um den Wagen zur befestigten Straße zu bringen.
Fichten und Tannen wuchsen bis zu einer Länge von 30 Metern. Auch beim Transport von Ziegel, von der Ziegelei zum
Bahnhof, konnte man gutes Geld verdienen.
Im Jahr 1934 wurde Rohmanen an das überregionale Stromnetz angeschlossen und schaffte auf diese Weise den Sprung von
der Petroleumlampe zur Glühbirne. Neben dem Grundstück von Karl Pietzonka wurde ein Transformatorhäuschen errichtet,
in dem der ankommende Strom von einer Hochspannung auf eine Verbrauchsspannung transformiert wurde. Es gab schon eine
Überlandleitung, die aus Richtung Ortelsburg kommend, quer über die Felder, in Richtung Neu Keykuth weiter ging.
Durch eine Zwischenspanne wurde der Transformator, mit der Hauptleitung auf Kownatzkis Feld verbunden.
Ein Stromanschluss konnte die Arbeit im Haus und Hof auf vielfältige Weise erleichtern, doch nur die besser gestellten
Bauern, sowie noch manche Pensionäre, die ein festes Einkommen hatten, konnten sich dass leisten. Weil nur wenige an
der Elektrifizierung teilnahmen, war ein Stromanschluss mit hohen Kosten verbunden. Nur Gustav Pietzonka, Gasthof
Trzaska, Friedrich Nickel, die Schule und Wilhelm Both, wurden in der ersten Phase erfasst.
Im Jahr 1952 wurde von den polnischen Behörden die zweite Stufe der Elektrifizierung eingeleitet, in der alle im Dorf
stehen Gebäude erfasst wurden. Am Anfang wurden nur Leitungen für Lichtstrom gelegt und auch nur 3 Lichtstellen pro
Haushalt bewilligt. Doch im nachfolgenden Zeitraum wurden dann, wenn Material vorhanden war, weitere Lichtpunkte
angelegt. 1952, am zweiten Wochenende im Advent, wurden dann die Leitungen geschaltet und alle waren von der
plötzlichen Helligkeit sehr begeistert. Wenn man Glühbirnen auswechseln wollte musste man am Anfang weite Wege
zurücklegen, um welche zu bekommen. In den 60ger Jahren wurden dann immer mehr Starkstromleitungen gelegt, weil die
Bauern elektrische Geräte kaufen konnten. Ende der 60ger wurden auch die Abbauten an das Stromnetz angeschlossen.
Das Urnengrab auf unserem Feld
Auf unserem Feld, in Richtung Seelonken, bin ich oft beim pflügen gegen Steine gestoßen, manchmal
rissen sogar die Stränge am Pferdegeschirr. Eines Tages nahm ich einen Spaten, Brechstange und einen langen Baum, um
der Sache auf den Grund zu gehen. Als ich eine Menge Sand ausgehoben hatte stieß ich auf eine steile, aus Steinen
errichtete Wand, die ich auch mit dem Baum nicht aus der Fassung bringen konnte. Ich habe den ganzen Vormittag gegraben,
konnte jedoch nicht unter die Steine kommen. Einige Tage später hatten wir in der Schule eine Bauernversammlung, da
habe ich Herrn Biella und Herrn Lehrer Dorka von meinem Fund berichtet. Am nächsten Morgen kam der Lehrer Dorka mit der
ganzen Schulklasse, mit Spaten und Sieben ausgerüstet auf unser Feld und fingen an die ausgehobene Erde zu sieben.
Lehrer Dorka benachrichtigte daraufhin den Leiter des Ortelsburger Heimatmuseums, der am nächsten Morgen vorbei kam um
sich die Fundstelle genau anzusehen. Er beauftragte ihn 4 Mann zu besorgen, um die Steine ringsum frei zu schaufeln.
Zwischen den Steinen durften wir die Erde nur mit Esslöffeln ausheben. Als es plötzlich zu regnen anfing hat Lehrer
Dorka die Brauerei Daum, in Ortelsburg angerufen, die uns über der Fundstelle ein Zelt errichtet haben, damit wir
ungestört weiterarbeiten konnten. Wir fanden 8 flache und 8 hohe Urnen zu beiden Seiten am Körper. Die Urnen wurden in
Gipsbinden eingewickelt und ins Heimatmuseum nach Ortelsburg gebracht, wo sie durch einen Fachmann, der extra aus einem
Königsberger Museum angereist war. Nach Reinigung der Urnen hat er festgestellt, das die Grabstätte etwa 2000 Jahre vor
Christi Geburt angelegt wurde und ein Doppelgrab war, in dem ein Toter liegend und einer in Hochstellung beigesetzt
wurde.
Die Nachricht von der Fundstelle verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Es erschienen viele Schaulustige, ganze
Schulklassen aus der Umgebung, mit Autos und zu Fuß. Durch die vielen Menschen wurden die bestellten Ackerflächen auf
unserem Feld sehr in Mitleidenschaft gezogen, eine Entschädigung haben wir nicht erhalten. Das Grab wurde vor dem
Heimatmuseum in Ortelsburg wieder so aufgebaut wie man es auf unserem Feld vorgefunden hat. Für den Transport der
Steine wurde ich entlohnt. Die Urnen hat das Königsberger Museum an sich genommen und wollte sie nicht wieder hergeben,
weil die solch einen Fund noch nicht in ihrer Sammlung hatten.
Sonnenwendfeuer
Am 24 Juni fand eine Sonnenwendfeier statt. Ein Brauch der an die alten Germanen erinnern sollte.
Der Lehrer Dorka hat den Bürgermeister beauftragt 2 Fuhrwerke in den Wald zu schicken, die Holz und alten Reisig holen
und auf dem großen Schulberg abladen sollten. Das Straßenbauamt hat uns Teertonnen zur Verfügung gestellt. Die ganze
Dorfgemeinschaft wurde eingeladen, am Abend, nach der Feldarbeit, an der Sonnenwendfeier teilzunehmen. Lehrer Dorka
hielt zuerst eine Ansprache, in der er anschaulich erklärte wie unsere Vorfahren in grauer Vorzeit gefeiert haben.
Nach dem offiziellen Teil wurden das Holz und die Teertonnen angezündet, es wurden Heimatlieder gesungen, wie: Wild
flutet der See, drauf schaukelt der Schiffer den schwankenden Kahn, Schaum wälzt er wie Schnee, von grausiger Mitte
zum Ufer heran, wild fluten die Wellen auf Vaterlands See, wie schön, oh trag mich auf Spiegel zu Hügel, Masovias See.
Masovia Land, mein Heimatland, Masovia es lebe mein Vaterland.
Lehrer Alfred Dorka und sein Wirken für Rohmanen.

Friedrich Biella hatte auf seinem Feld einen Granitstein mit einer geraden Seite, den haben wir
mit viel Schweiß an den Dorfteich transportiert und auf einer Erhöhung abgelegt. Der Stein sollte zum Denkmahl für die
Gefallenen des Ersten Weltkrieges umgestaltet werden. Da zu Wenige daran ein Interesse zeigten, wurde diese Idee fallen
gelassen und der Stein irgendwann ins Wasser gerollt. Der Lehrer Dorka war viele Jahre in Rohmanen tätig, dort hat er
später seine ehemalige Schülerin, Lotte Biella geheiratet. Er hat sich sehr für die Entwicklung des Dorfes interessiert,
war bei jeder Gemeindeversammlung anwesend und hat auf Schwachstellen hingewiesen die den Fortschritt behinderten.
Gemeinsam mit den Schülern hat er den Ehrenfriedhof für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges gepflegt, an der
Wegegablung nach Eichtal und zu Ehren des Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg eine Eiche gepflanzt.
Zum Advent hat Lehrer Dorka mit der Jugend einen Adventstern, in verschiedenen Farben gebastelt.
Der Stern wurde auf einer 2 Meter langen Stange befestigt, in der Mitte wurde ein Wachslicht angezündet, am Stern
wurde eine Schnur angebracht, wenn man daran zog rollte der Stern hin und her. Am ersten Wochenende im Advent
versammelten sich jung und alt, um den Stern durch das Dorf zu tragen. Alle schlossen sich dem vorausgehenden
Sternträger an, der den Stern durch die Hauptstraße und die angrenzenden Wege trug. Dieser Sternmarsch wurde an den
folgenden Adventwochenenden wiederholt.
Am ersten Weihnachtfeiertag wurde um 4:00 Uhr morgens ein Frühgottesdienst gehalten. Zuerst hat der Pfarrer eine
Andacht gehalten, dann haben die Kinder ein Krippenspiel aufgeführt und die Gemeinde hat schöne Weihnachtslieder
gesungen. Der Gastwirt Trzaska hat uns den Saal zur Verfügung gestellt. Wir hatten eine Posaunen- u. eine
Gitarrengruppe. Unter der Leitung von Herrn Willi Doormann spielten: Gottlieb Brosch, Fritz Ollech,
Gustav Rattay(Sopran), Wilhelm Pilath, Gustav Brosch(Alt), Fritz Both(Tenor) und Fritz Brosch(Bass).
In der Gitarrengruppe wirkten mit: Martha Ollech, Hedwig Ollech, Martha Lekzik, Martha Michalick und Auguste Lekzick.
Willy Doormann hat sie auf der Geige begleitet.
Kurz vor Ausbruch des 2. Weltkrieges
Bei der Aufstellung des Grenzschutzes(Regiment Buchholz), hat er als Hauptfeldwebel die
Gruppenführerkurse überwacht und selbst die fähigsten Männer dafür vorgeschlagen. Das Ausbildungspersonal hat das
Jäger-Battalion gestellt. Wir kamen zuerst ins Stadion(Waldheim), wurden da eingekleidet und dann ging es gleich
kasernenmäßig zu, theoretisch und praktisch. Jeder musste vor die Front treten und nachweisen ob er im Stande ist,
Befehle zu erteilen. Abends wurden Filme vorgeführt die uns zeigen sollten wie eine Gruppe sich im Gelände entfalten
muss. Die Exerziervorschriften hatten sich, im Verhältnis zu Kaiser Wilhelms Zeiten, etwas geändert. Damals bestand
eine Gruppe aus 8 Mann und einem Unteroffizier, jetzt aus 10 Schützen, 3 für das leichte Maschinengewehr und einem
Unteroffizier(13 Mann). Nach der Schulung folgte eine Abschlussprüfung, danach ein gemütliches Beisammensein. Aus
Rohmanen haben folgende Männer die Prüfung bestanden: Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy, Gustav Rattay und
Gustav Deptolla. Unsere Uniformen waren alle zu klein und es gab viel zu lachen bei der Anprobe.
Die erste Übung habe ich mit Emil Rosowski, in Lenzinen gemacht. Der Gutsbesitzer Marzinzick hat seine Scheune als
Unterkunft zur Verfügung gestellt. Er war im Range eines Hauptfeldwebels. In seinem haus war die Schreibstube
untergebracht, die er selbst verwaltete. Ein Lastauto hatte Uniformen aus der Kaserne in Ortelsburg geholt, jeder
musste eine Uniform anlegen und dann wurde solange getauscht bis alle eine passende gefunden hatten. An den Namen des
Kompanieführers kann ich mich nicht mehr erinnern. 1935 wurden wir zu einer Übung in die Dragonerkaserne nach Lyk
einberufen. Die Gruppenführer, Zugführer, und Kompanieführer die schon Frontberührung im dem Ersten Weltkrieg hatten,
mussten eine Woche früher anreisen. Die Übungen waren auf 6 Wochen angelegt. Die meisten der einberufenen waren noch
nie mit dem Wehrdienst in Berührung gekommen. Jeder Gruppenführer bekam 13 Mann zugeteilt.
Unser Zugführer war Leutnant Neumann, Kompanieführer Oberleutnant Rutschko, Battalions-Kommandeur Major Gröning
(Regiment Buchholz). Hier ging es wieder Kasernenmäßig voran. Das Bataillon wurde hier vereidigt. Jeden zweiten
Sonntag durften unsere Frauen uns besuchen. Ein Jahr später wurden wir wieder zu einer Übung einberufen, auf den
Truppenübungsplatz nach Arys. Jeder Gruppenführer hatte den Auftrag die Gruppe zu entfalten, und auf bewegliche
Figuren zu schießen. Diese Übung musste später mit scharfer Munition wiederholt werden. Jedes Maschinengewehr bekam
50 Schuss, jeder Schütze 20 Schuss zugeteilt. Nach dem Abschießen wurden die Treffer gezählt und dem Kommandierenden
Bericht erstattet. In einiger Entfernung spaziert ein Storch umher, der gar nicht bemerkt hatte dass geschossen wurde,
was bei den Kameraden ein großes Gelächter hervorrief.
Nach der Übung wurde uns gesagt das jeder Gruppenführer eine arische Abstammung nachweisen sollte. Ich konnte in den
Rheinsweiner Kirchenbüchern meine Vorfahren aus Gellen, bis zum Jahr 1732 zurück, nachweisen und wurde zum
Unteroffizier befördert. Aus unserem Dorf wurden auch, Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy und Gustav Deptolla
befördert. Zwischendurch mussten wir schon mal in die Radfahrer-Kaserne nach Ortelsburg, Gewehre empfangen und im
Gelände üben. Am 31 Juli 1939 wurde mir von einem Soldaten ein Schreiben übereicht, das mich aufforderte, am 1. August
um 6:00 Uhr, bei der 3. Kompanie, des 2. Infanterieregiments zu erscheinen.
Um 5:30 hat mich meine Schwester in die Kaserne gebracht. Auf der Schreibstube erklärte mir der Hauptfeldwebel,
dass mir ab sofort der Dienstgrad eines Sanitäters zugewiesen wird, ich mich in der Kammer einzukleiden hätte und mir
in der Handwerkerstube die entsprechenden Schulterklappen annähen lassen sollte. Die aktiven Sanitäter wurden den
Feldlazaretten zugewiesen und wir kamen an ihre Stelle. Unser Bataillon wurde nach Schodmak zum Bunker bauen und
Stacheldraht verlegen eingeteilt. Wir zogen in Begleitung einer Musikkapelle bis zur Kreuzung am Krankenhaus, dann
weiter zu unserem Bestimmungsort, gefolgt von einer Gulaschkanone die in den nächsten Tagen für unsere Verpflegung
sorgen sollte.
Am 14 August haben wir die Jägerkaserne, begleitet von einer Musikkapelle endgültig verlassen und zogen zuerst durch
Ortelsburg, dann über Lehmanen ins Feldmanöver, hinter Rohmanen. Dort entfaltete sich das Bataillon im Gelände, die
Verwundetensammelstelle wurde auf dem Hof des Bauern Friedrich Neumann eingerichtet. Gegen Abend wurde zu Sammeln
geblasen und Biwak bezogen, wobei unsere 3.Kompanie, in einem kleinen Wallt, in der Nähe von Otto Nickels Gehöft
Stellung bezogen hatte. Die 2. und 4. Kompanie hatte sich in der Nähe vom Abbau Pallasch niedergelassen. Die Frau
Nickel hat am Abend ein Mädel in Dorf geschickt um meiner Frau Bescheid zu sagen, wo wir uns zurzeit befinden. Meine
Frau ist dann noch gekommen um sich von mir zu verabschieden, weil wir am nächsten Morgen um 3:00 Uhr Zelte abbrechen
und um 4:00 Uhr in Richtung Kaspersguth marschieren sollten.
Wir sind dann über Achodden, Seelonken, Lehmanen, Ortelsburg, bis nach Grammen und Schützendorf marschiert, wo wir an
einem See Biwak bezogen haben. Es wurde immer gesagt, wir kommen zum Tannenberg-Denkmal bei Hohenstein, wo ein Reichs
Kriegervereinsfest stattfinden sollte. Es wurden auch schon Vorkommandos aufgestellt, doch dann kamen wir nach Orlau
und Lahna-Mühle, da wo die Alle entspringt haben wir 2 Tage biwakiert. Unser Kompanieführer hat uns nach Waplitz auf
den Soldatenfriedhof des Ersten Weltkrieges geführt und uns erklärt wie das Jägerbataillon sich 1914 hier entfaltet
hat und aufgerieben wurde. Dann mussten wir in der Nähe von Gut Koslau über einen Fluss und bezogen in einem Waldstück,
vorbereitete Stellungen in der Nähe der polnischen Grenze. Herr und Frau Thalmann haben uns jeden Tag, bis zur Grenze,
mit Brötchen und Getränken versorgt. Es wurde scharfe Munition ausgegeben, weil wir am nächsten Morgen um 4:00 Uhr die
polnische Grenze überschreiten sollten.
Am nächsten Morgen um 10 Minuten vor 4:00 Uhr kam der Befehl; scharfe Munition abgeben, alles zurück in ein 6 Kilometer
entferntes Dorf, wo wir auch einquartiert wurden. Das alles geschah’ eine Woche vor dem 1. September 1939. Es wurde
gesagt dass der Führer dem polnischen Präsidenten Rid-Szmigly, ein Ultimatum gestellt hat und es wahrscheinlich nicht
zum Krieg mit Polen kommt. Genau nach 5 Tagen kehrten wir wieder in die gleichen Stellungen zurück, es wurde wieder
scharfe Munition ausgegeben und am nächsten Morgen um 4:00 Uhr überschritten wir die polnische Grenze.
“Der 2. Weltkrieg.”
Der erste Einsatz in Polen
Wir kamen zuerst in ein Dorf in dem sich nur alte Menschen befanden. Auf unsere Frage wo denn die Bewohner wären sagte
man uns dass alle geflohen sind, weil erzählt wurde, die Deutschen würden alle Polen misshandeln und verstümmeln. Ich
habe ihnen daraufhin gesagt dass uns, unter Androhung von Strafe verboten wurde, einem Zivilisten etwas anzutun. Das
Vieh, die Schweine und Hunde des Dorfes liefen frei herum und die Soldaten fingen an auf die Hunde zu schießen, bis
gesagt wurde es seien Meldehunde im Dienste der Deutschen Wehrmacht und dieser Unfug der eigenen Truppe schaden würde,
weil etwaige Querschläger eigene Kameraden verletzen könnten. Wir gingen weiter auf polnischer Seite entlang der Grenze,
bis wir am Nachmittag die ersten Vorposten der Festung Mlawa erreichten, da befanden wir uns plötzlich im Feuerhagel
polnischer Festungsflack.
Am nächsten Morgen hatte ich schon 3 Verwundete und wusste nicht wo sich eine Verwundeten Sammelstelle befindet. Ich
suchte den Bataillonsgefechtstand auf der sich auf einer Anhöhe befand. Ich habe unseren Oberstabsarzt gefragt wo denn
die Verwundetensammelstelle wäre. Er rief beim Tross an, wo er die Auskunft erhielt, das sich vor dem Dorf ein Bunker
befindet in dem man die Verwundeten sammeln sollte, die dann von Sanitätsautos abgeholt würden, weil das Dorf unter
Artilleriebeschuss stand. Am Sonnabend haben unsere Flieger die Bunkerstellungen bombardiert, konnten aber, trotz guter
Treffer nicht viel ausrichten, die Bunker wurden nur etwas angekratzt.
Der Beschuss unserer vordersten Linien ging mit unverminderter Heftigkeit weiter. Am Sonntag verkündete eine große
Staubwolke die Ankunft unserer Panzer, doch sie kamen nur bis zur Panzersperre und mussten wieder abdrehen ohne den
Polen einen schaden zuzufügen. Ein Panzer bekam einen Volltreffer, der Fahrer konnte noch umkehren. Er blutete am Kopf
und der Schütze war so eingeklemmt, das wir ihn nur mit einem Seil unter den Armen, durch die Luke nach oben ziehen
konnten. Ob er seine Verwundung überlebt hat ist mir nicht bekannt, denn in der Nacht wurden Panzergeschütze nach
vorne in Stellung gebracht, die direkt in die Schießscharten der Bunker geschossen und so die Verteidiger vertrieben
haben. Daraufhin sind wir weiter vorgerückt. Auf einer Wiese war ein tiefer Graben ausgehoben und mit Ästen getarnt,
da war ein Panzer hinein gefahren, so dass nur das Hinterteil herausragte und er sich nicht aus eigner Kraft befreien
konnte. In der Luft waren Flieger die Brandbomben abwarfen, ich habe mich auf den Boden geworfen weil ich dachte die
würden explodieren, aber sie zischten nur, so das Stoppeln und Graß rings herum in Brand gerieten.
Bei den Kampfhandlungen gab es mehrere Verwundete, denen ich gerade Verbände anlegen wollte, als unser Hauptmann zur
Trillerpfeife griff um mir klar zu machen, dass ich ihm folgen sollte. Die Polen fingen an zu schreien, ich sollte
sie ins Lazarett bringen denn hier im Wald würde sie niemand finden. Ich setzte mich aufs Fahrrad und folgte unserem
Kompanieführer, der mir sagte ich soll immer bei der kämpfenden Truppe bleiben, denn hinter der Front sind die
Sanitätsabteilungen, die werden die Verwundeten schon versorgen. Der Vormarsch dauerte bis in die späte Nacht. Auf
einem Gehöft, das nach allen Seiten durch Feldwachen abgesichert wurde, machten wir endlich Rast. Wir haben
Getreidegarben auf dem Hof ausgebreitet und uns zur Ruhe gelegt, als plötzlich um Mitternacht Leuchtraketen den Himmel
erhellten und Maschinengewehrfeuer uns aus dem Schlaf schreckte. Ein par polnische Soldaten hatten das Feuer eröffnet,
aber sich kurz darauf ergeben.
Die Narew-Überquerung
Als es hell wurde ging der Vormarsch weiter. Es wurde uns untersagt Tagebuch zu führen, darum
weiß ich nicht wie die Orte hießen, durch die wir marschiert sind. Als wir durch ein sumpfiges Gelände vor drangen
stand auf einer Anhöhe am Horizont, die polnische Artillerie, die uns sofort unter Beschuss nahm. Unser Hauptmann war
der Meinung dass wir schon in der Nähe des Flusses Narew sein müssten, als aus den Sträuchern ein mit Schlauchboten
beladenes Lastauto auftauchte. Wir wurden aufgefordert mit je 6 Mann ein Schlauchboot zu nehmen, an einem Aggregat
der daneben stand mit Luft zu füllen und zu Wasser zu lassen. In einer Stunde war das ganze Bataillon über die Narew,
wo der Vormarsch fortgesetzt wurde. In einem Dorf überraschte uns die polnische Kavallerie und fing sofort mit
Maschinengewehren zu schießen an. Da kam der Befehl: Alles wieder zurück. Es ging noch schneller als auf der Hinfahrt.
Wir sind erst einige Kilometer am Fluss entlang gegangen und haben dann zum zweiten Mal rüber gesetzt.
Die Gehöfte im Dorf standen alle in Brand. Auf einem waren viele Bienestöcke. 2 Kameraden wollten den Stöcken Waben
entnehmen, doch die Bienen durch das Feuer aufgeschreckt, überfielen sie sofort und stachen derart zu das sie nicht
mehr wieder zu erkennen waren. Ich habe die Einstichstellen mit Salmiak betupft, mehr konnte ich nicht tun. Wir mussten
auf unserem Vormarsch durch einen Wald der in Flammen stand, so dass man kaum atmen konnte. Es ging weiter in Richtung
Minsk und Warschau, wo schon die Sowjetische Armee durchgegangen war, die Pferde und Vieh von einem Gut mitgenommen
hatten. In einem Wald stießen wir unverhofft auf ein Kloster, in dem wir einige Gefangene machten. Dann trafen wir auf
eine gute Straße die nach Grochow ging.
Als wir dort einmarschierten wurden wir aus den oberen Stockwerken beschossen, so dass wir, um uns zu schützen, nur an
den Hauswänden entlang gehen konnten. Wir haben jedes Haus nach Feinden durchsucht. Vor einem Haus stand ein Hund der
niemanden reinlassen wollte, solange bis ihn eine Kugel traf. Die polnische Artillerie feuerte von Warschau aus, um
unseren Vormarsch zu stoppen. Wir hatten uns gerade eingegraben als plötzlich deutsche Flieger am Himmel erschienen,
die unsere Stellungen mit Bomben bewarfen und dabei viel Unheil anrichteten. Wir haben sofort Fliegertücher
ausgebreitet und Leuchtraketen abgeschossen. Da ich in dem Graben, den ich kurz zuvor ausgehoben hatte, sofort in
Deckung gegangen bin ist mir zum Glück nichts passiert. Unter den anderen Kameraden gab es viele Verwundete, so dass
ich nicht wusste wem ich zuerst helfen sollte.
Der Oberstabsarzt hat mich sofort tatkräftig unterstützt, so das bald alle Verwundeten versorgt waren, außer einem,
dem ein Bombensplitter den Arm abgerissen hat. Ich habe im 3 große Verbandspäckchen auf die Wunde gelegt, doch die
Blutung ließ sich trotzdem nicht stoppen, so dass er eine Stunde später auf der Krankensammelstelle verstarb. Wir
haben danach in einem Tomatenfeld einen Graben ausgehoben und eine neue Abwehrstellung bezogen. Die Gruppe Schwarz
bekam den Auftrag nach etwaigen versprengten polnischen Verbänden Ausschau zu halten, als sie unerwartet aus einer
Häuserreihe mit Maschinengewehrsalven überschüttet wurden. Der Gruppenführer und noch ein Soldat wurden dabei tödlich
verwundet. Danach wurde noch ein weiter Stoßtrupp, unter der Führung von Leutnant Briskorn, der sich dazu freiwillig
gemeldet hatte, hinaus geschickt um den Gruppenführer und den anderen Toten zu bergen.
Bei diesem Unternehmen, das erfolglos ausging, weil die Toten schon verscharrt waren, durchschlug eine Kugel den
Stahlhelm von Leutnant Briskorn, der auch sofort tot war. Alle Toten wurden später, an der Kirchenmauer in Grochow, in
Särgen beigesetzt: Hauptmann Schönwald sagte, das sie nach dem Kriege auf den Heldenfriedhof nach Ortelsburg überführt
werden. Drei Tage lagen wir bei Grochow in Stellungen, waren dem polnischen Maschinengewehrfeuer sowie den Bomben
deutscher Flugzeuge ausgesetzt. In der Nacht musste ich zu einem Verwundeten in die vorderste Linie und habe den
Rückweg nicht mehr finden können, als plötzlich Gewehrfeuer aufflammte habe ich in den Ruinen Schutz gesucht. Erst im
Morgengrauen konnte ich mich wieder orientieren und zu meinem Unterstand zurückfinden.
Warschau wurde tagelang bombardiert und stand auch unter Artilleriebeschuss. Aus dunklen Rauchwolken kamen oft ganze
Bündel von Papier angeflogen. Die Verwundeten kamen oft auf Krücken zu unserem Unterstand, ich habe sie dann zur
Krankensammelstelle hingeführt. Wir haben auch polnische Zivilpersonen betreut, die während der Kampfhandlungen
verwundet wurden. Als einmal 2 Jungen vorbeiliefen hat einer ihnen nachgerufen sie sollten seiner Frau Bescheid sagen,
er wäre auf der Krankensammelstelle an der Kirche. Als wir dort ankamen war seine Frau, mit einem Kind auf dem Arm,
schon da.
Nach der Kapitulation von Warschau, gingen wir über Sokolow zum Bug und haben dort Quartier bezogen. Der Russe hatte
sich bereits hinter den Fluss zurückgezogen, hatte alles Vieh und Pferde mitgenommen. Dort erreichte mich ein Telegramm
von zu Hause, dass meine Tochter gestorben ist. Es sprach sich auch herum dass verschiedene Heimaturlaub bekommen haben,
ich durfte auch für 14 Tage heim. Wir fuhren mit Lastautos nach Allenstein in die neue Reiterkaserne, zum
Ersatzbatallion, da haben wir unsere Gewehre und Munition abgeben, dann durften wir, jeder in seinen Heimatort
weiterfahren.
Als wir unsere Quartiere am Bug verlassen haben war sehr viel Schnee gefallen. Hier in Ortelsburg fanden wir die
gleiche Wetterlage vor, aber nach 3 Tagen war alles wieder weggetaut und wir konnten die Kartoffelernte, die durch den
frühen Wintereinbruch gestoppt wurde, zu Ende bringen. Ein Tag bevor ich zu Hause angekommen bin wurde die Tochter
beerdigt. Nach 14 Tagen mussten wir uns in Allenstein melden, Gewehre empfangen und wieder zurück zur Division an den
Bug 150 Kilometer hinter Warschau. Die elfte Division, zu der wir auch gehörten sollte in den Westen Deutschlands
verlegt werden und war schon unterwegs zur Verladestation Skiernewice 50 Kilometer vor Warschau.
Mein Dienst als Sanitätsunteroffizier
Unser Bataillon kam in das Städtchen Burscheid, im Kreis Opladen, wo wir in Privatquartieren
untergebracht wurden. Nach 3 Monaten, im Januar 1940, wurden wir nach Solingen verlegt, wo wir bis zum
Frankreichfeldzug stationiert waren. Wir mussten an Feldübungen teilnehmen, wie andere die in Kasernen untergebracht
waren. Während dieser Zeit musste jeder seine Zähne in Ordnung bringen lassen. Jeden Tag fuhren 20 Mann in die
Cäzilienstraße nach Köln, zur Zahnklinik. Im Rheinland wurde unsere Division neu aufgestellt. Ausfälle durch den
Polenfeldzug wurden durch neue Soldaten ergänzt. Ich kam nun zum Ersatzbatallion, war der Älteste in der ganzen
Kompanie. Als der Frankreichfeldzug losging wurde unser Ersatzbatallion mit den noch vorhandenen Verwundeten, in die
neue Reiterkaserne, nach Allenstein verlegt.
Meine Frau hat, mit Unterstützung der Bauernschaft, einen Antrag gestellt, daraufhin wurde ich zur Frühjahrsbestellung,
beurlaubt und später bis auf weiteres vom Militärdienst freigestellt. Als der Russlandfeldzug losging wurde ich von der
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg, für 14 Tage einberufen. Ich war seit 1922, Mitglied der freiwilligen
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg und habe jedes Jahr an Übungen teilgenommen. Jede Bereitschaft musste etliche Leute
stellen. Von Rohmanen wurden Emil Rosowski, Johann Dembek, und ich, zur Krankensammelstelle Wirballen, in Litauen,
abkommandiert. Dorthin kamen Lazarettzüge aus Russland mit der Breitspurbahn. Die Verwundeten wurden frisch verbunden
und auf Waggon mit Normalspur verladen und nach Deutschland gebracht.
Als die 14 Tage vergangen waren wollten wir wieder nach Haus zurück, doch man wollte uns nicht entlassen. Stattdessen
wurden wir dem Wehrkreisamt Königsberg zugeteilt, neu eingekleidet und zur Aushilfe ins Lazarett nach Gumbinnen
abkommandiert. Mehr als ein Jahr war ich in den Urlauber-Baracken, habe dort Krankenstube betreut. Später, bis zum
Dezember 1944, war ich im Reserve-Lazarett 4, in Königsberg tätig. Dort habe ich auch die Luftangriffe der Engländer,
vom 25 bis 26. August 1944 miterlebt.
Wir sollten gerade einen Lazarettzug in Rotenstein entladen, als plötzlich die Sirenen ertönten - Fliegeralarm. Im
gleichen Moment waren die ersten Flugzeuge auch schon da, zuerst warfen sie „Tannenbäume” und danach Foßforkanister ab.
Die Omnibusse standen schon zur Abfahrt bereit als es losging. Wir haben die Verwundeten schnell in den
Luftschutzkeller getragen, haben die Betten von den Fenstern weggerückt damit die Verwundeten nicht von den
Glasssplittern verletzt wurden. Im Kasernenhof brannten die Fosforkanister lichterloh. Unsere Unterkunft, die sich in
einer Baracke befand ist völlig abgebrannt, mit dem Wenigen was wir unser Eigen nannten. Am nächsten Tag wurden wir neu
eingekleidet und am 29. bis 30. kamen die englischen Bomber wieder, sie setzten genau da ihr Zerstörungswerk fort wo
sie vor 3 Tagen aufgehört hatten.
Anfang Dezember 1944 musste ich mich nach Stablack melden und musste dann zur Sanitätsabteilung 1, nach Gernau, das
liegt zwischen Lodz und Warschau. Vormittags hatten wir Felddienstübungen und nachmittags theoretischen Unterricht.
Jeden Tag wurden Gruppen zusammengestellt und zu anderen Einheiten abkommandiert. Ich kam zu einer Panzerabteilung, wo
wir an einem Morgen plötzlich auf dem Kasernenhof antreten mussten und zu unserer Überraschung mit der Nachricht
konfrontiert wurden, dass der Russe an mehreren Frontabschnitten durchgebrochen war. Wir bekamen sofort einen
Marschbefehl in Richtung Lodz, wo das Stadtbild noch intakt war, selbst die Straßenbahnen fuhren noch. In der Nacht
haben russische Flugzeuge die Stadt bombardiert. Die Kaserne in der wir untergebracht waren hatte keine
Luftschutzkeller, aber zum Glück blieben wir von Bombentreffern verschont. Am nächsten morgen bot sich uns ein Bild der
Verwüstung. Die entgleisten Straßenbahnwagen, sowie andere Fahrzeuge blockierten die Straßen. Die Älteren unter uns
bekamen Fahrscheine für einen Transportzug, der bereit hinter Lodz abfahrbereit, unter Dampf stehen sollte. Als
russische Panzer in den Straßen auftauchten, verbrannte die Schreibstube unsere Wehrpässe und andere wichtige
Dokumente. Wir liefen zu der Station auf der unser Transportzug bereitstehen sollte, aber da war kein Zug mehr zu sehen
und wir setzten unseren Rückzug zu Fuß fort.
Der Rückzug und Zusammenbruch der Ostfront
In Dobroschin, einer Stadt in Polen, wurde gerade ein Lazarettzug verladen, doch wir kamen nicht
mehr zum Einsatz, weil die russische Infanterie uns schon auf den Fersen war. Es ging weiter über den Fluss Bober,
Sagan, bis nach Glogau an der Oder. Dort wurden wir der 29. motorisierten Sanitätskompanie zugeteilt. Im
Garnisonslazarett wurden noch Operationen durchgeführt. Unsere Division hatte ihr eigenes Feldlazarett, so dass wir den
Befehl zu Weiterfahrt erhielten und noch unbeschadet die Oderbrücke passieren konnten, denn Glogau wurde zur Festung
erklärt. Wir haben 2 Pferdewagen organisiert und mit Verbänden, sowie medizinischen Instrumenten beladen. So kamen wir
bis nach Lübbenau im Spreewald, wo wir in einem Schloss, in zuvor ein Museum war, unser Lazarett untergebracht haben.
Weil die Amerikaner Cottbus bombardiert hatten, wurden die Verwundeten zu uns nach Lübbenau gebracht. Hier haben wir
Tag und Nacht gearbeitet, um die vielen Verwundeten, aus den schweren Kämpfen bei Grünberg und Sagan zu versorgen. Die
Soldaten von der Abwehrfront kamen schon mit abgestorbenen Armen oder Beinen bei uns an, weil in vorderster Linie keine
Frontlazarette mehr vorhanden waren; es mussten viele Amputationen durchgeführt werden. Als für unsere Pferde kein Heu
mehr vorhanden war, schickte mich unser Hauptfeldwebel, zu einem Bauern in den Spreewald, mit dem Auftrag, Futter zu
besorgen. Mit noch zwei Mann fuhren mit zwei Kähnen, zuerst den Hauptstrom entlang und dann in einen Nebenarm; da haben
wir die Boote beladen und brachten das Heu nach Lübbenau.
Als wir uns bei unser Einheit zurück melden wollten, war alles schon marschbereit. Ich bin schnell in einen Bus
eingestiegen der sofort losfuhr, weil russische Verbände schon in sichtweite waren. Russische Flugzeuge kreisten über
den Dächern und nahmen, mit ihren Bordwaffen jeden unter Beschuss, der sich irgendwo blicken ließ. Wir konnten nur
durch den Wald, oder in der Nacht vorwärts kommen, denn wenn ein Auto auf der Landstraße fuhr, war alsbald ein Flugzeug
hinter ihm her und schoss es in Brand. Als wir nach Tagen am Ufer der Elbe ankamen, war bereits eine Ponton-Brücke
erstellt worden, welche die zerstörte Brücke ersetzen sollte.
Durch die vielen Fahrzeuge waren in den Sand tiefe Spuren gefahren, so dass andere Fahrzeuge unsere Busse ins
Schlepptau nehmen mussten, weil wir mit eigener Kraft nicht mehr weiterkamen. Beiderseits der Trasse standen
Flüchtlingswagen, in der der Hoffnung die Brücke passieren zu können, doch SS-Polizei verhinderte das die Gespanne den
militärischen Rückzug zum Stillstand brachten. Es gelang uns die Elbe zu überqueren, um in einem Waldstück Schutz vor
feindlichen Fliegern zu suchen.
Als wir unsere Busse und Autos gut getarnt hatten, hat unser Bataillonschef die anwesenden Parteigrößen zu sich
gerufen und ihnen erklärt das wir eine Einheit des Roten Kreuzes sind und nach internationalem Recht keine Waffen
besitzen dürfen. Nach langer, erregter Diskussion wurde beschlossen einen Graben auszuheben und alles im Sand zu
verscharren. Als wir dann weiter, durch die Dörfer fuhren, sahen wir schon viele weiße Bettlaken, als Zeichen der
Kapitulation, aus den Fenstern hängen. Es wurde uns erzählt dass der Bürgermeister von der SS erschossen wurde, weil
er die Bevölkerung zu diesem Schritt ermutigt hatte. Jetzt waren hinter uns die Russen und vor uns schon die Amerikaner.
Amerikanische Panzer fuhren umher und schossen wild durch die Gegend, ohne ein Ziel anzuvisieren. Niemand wollte sich
dem Russen ergeben, doch der Weg der zu den Amerikanern führte, war durch abgesägte Bäume blockiert. Wir sind schnell
in das nächste Dorf gegangen, haben uns Sägen und Äxte besorgt, die Bäume durchgesägt und in den Straßengraben
geworfen.
“ Nach dem Ende des 2. Weltkrieges.”
In amerikanische Kriegsgefangenschaft
Dann fuhren wir unter internationaler Flagge an eine Mulde Brücke, vor der zwei amerikanische Soldaten, mit Zigarren,
zur Hälfte im Mund, standen. Sie rauchten und kauten gleichzeitig. Wir mussten auf einen freien Platz fahren, alle
aussteigen und rechts wieder antreten. Wäschebeutel und Tornister mussten wir abstellen; danach wurden wir nach Waffen
durchsucht, Wertsachen, Uhren und Messer wurden uns gleich abgenommen. Als wir anschließend an unserem Gepäck
vorbeigingen durfte niemand was mitnehmen. Als ich gebückt, nach meinem Wäschebeutel greifen wollte, in dem sich noch
3 Konservendosen und ein Brot befanden, bekam ich einen Fußtritt ins Gesicht, so dass mir ein Zahn ausgeschlagen wurde.
Wir wurden dann in einem Garten zusammen getrieben und gefragt ob jemand bei der SS gedient hat. Nachdem wir in Reihe
und Glied angetreten waren, mussten wir den Oberkörper freimachen und die Arme anheben. Es wurde nach SS-Zeichen
gesucht, die gewöhnlich unter dem Oberarm eintätowiert waren. Nachdem wir Grimma bei Leipzig, wo wir in amerikanische
Gefangenschaft geraten waren, verlassen hatten, mussten wir durch ganz Thüringen bis Hersfeld, an der Grenze zu Hessen,
marschieren. In Hersfeld wurden wir auf große Lastautos verladen, die von farbigen Soldaten gefahren wurden. Man hat
uns mit Stöcken hinauf getrieben, solange bis das Auto so voll war das man kaum stehen konnte. Die Soldaten fuhren, für
diese Straßenverhältnisse, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Wenn die Straße eine scharfe Kurve hatte, flogen
wir alle übereinander und mussten erst mit viel Kraftanstrengung auf die Beine kommen um diese Fahrt zu überstehen.
Da die Straßenränder in dieser Gegend mit Obstbäumen bepflanzt sind und deren Äste sehr niedrig hängen, hätten die
uns die Köpfe abgerissen, wenn wir uns nicht ständig geduckt hätten. Unsere Fahrt endete in Bad Kreuznach, in der Pfalz,
wo wir in ein Lager, in dem sich später 130.000 Mann und 6 Generäle befanden, eingepfercht wurden. Die Unterkunft der
Generäle befand sich unter einem Zelt, alle anderen mussten die Zeit unter freiem Himmel zubringen. Die Offiziere, die
Unteroffiziere, die Mannschaften; wurden in getrennten Camps untergebracht. Die Mannschaften wurden auch zur Arbeit
abkommandiert und konnten bei dieser Gelegenheit, Brot, Brötchen oder Zigarettenstummel organisieren, wogegen die
Offiziere und Unteroffiziere ihr Camp überhaupt nicht verlassen durften.
Die ersten Tage gab es kein Wasser und kein Brot, so dass die Kameraden vor Erschöpfung umfielen. Später standen wir
manchmal den ganzen Tag nach Wasser an, das von den, uns bewachenden Negern mit großen Wassertanks angefahren wurde. Am
dritten Tag bekamen wir mittags und abends etwas zu Essen; Brot bekamen wir erst nach zwei Wochen, nach dem aus der
Umgebung herbeigeholte Handwerker, Backöfen gebaut hatten. In den verschiedenen Gemeinden, die in den uns umgebenden
Weinbergen lagen, mussten sich alle Männer beim Bürgermeister melden. Als sie dann erschienen waren, wurden sie auf
bereitstehende Lastautos getrieben und zu uns ins Lager gebracht. Sie waren ohne Kopfbedeckung und ohne wärmere
Bekleidung angekommen, weil ihnen gesagt wurde, dass ihr Aufenthalt im Lager nur von kurzer Dauer sein würde. Man hat
uns, falls noch vorhanden, Decken und Mäntel abgenommen, mit der Begründung, sie würden für Kranke und Verwundete
gebraucht. Jeden Tag starben mehr als 200 Mann, die wir sofort in ein Zelt tragen mussten. In der Nacht wurden die
Toten dann mit unbekanntem Ziel, weggefahren.
Viele haben ihren Verstand verloren uns irrten im ganzen Camp ziellos umher. Als Latrinen wurden Gräben ausgehoben, in
die verschiedene Kameraden, bei der Verrichtung ihrer Notdurft, vor Schwäche hineingefallen sind und nicht mehr wieder
heraus kamen. Aus den Pfählen die, die jungen Obstbäume stützten, haben wir Krankentragen gebaut um unsere Kameraden,
bei Bedarf, zur Krankensammelstelle zu tragen. Es war in diesem Frühjahr auch sehr kalt, doch unsere Erdlöcher, die wir
zum Schutz vor Kälte und Wind, nur mit leeren Konservendosen ausgehoben hatten, durften nicht tiefer als 20 Zentimeter
sein. Nach jedem Regenguss mussten wir das Wasser ausschöpfen. Nach einem Gewitter, standen wir wiedermal, total
durchnässt in unserem Camp, als unerwartet am Horizont die Sonne hervortrat. Einer unserer Kameraden hatte noch eine
Trompete gerettet und fing, von dem Anblick völlig überwältigt, zu spielen an: "Es geht alles vorüber, es geht alles
vorbei, nach jedem Dezember, folgt wieder ein Mai". Daraufhin hob sich die Stimmung der tiefbetrübten Kriegsgefangenen,
so das Heimatlieder durch das ganze Camp erklangen, obwohl wir in den nassen Kleider herumgehen mussten, bis sie am
Körper trocken wurden.
In französischer Kriegsgefangenschaft
Nach etwa einem Monat, haben uns die Amerikaner, den Franzosen, zum Arbeitseinsatz, ausgeliefert.
Etwa 4 Kilometer von Bad Kreuznach entfernt, stand auf freier Strecke, ein Zug mit offenen Kohlenloren, auf den wir
verladen wurden. In jeden Waggon, wurde pro Person eine Tafel Schokolade und ein Päcken Zwieback rein geworfen, doch
viele Kameraden fanden nur leere Päckchen vor, weil die schon zuvor von der französischen Wachmannschaft geplündert
wurden. Wir haben uns darüber beschwert, doch die haben uns nur ausgelacht. Nachdem wir zunächst bei Mainz über den
Rhein fuhren, endete unsere Fahrt bei Paris in einem großen Zeltlager. Dort wurden wir auf andere Züge verladen, die uns
nach Südfrankreich, in ein Barackenlager, bei Mazarei, brachten.
Auf einer Zwischenstation hat man uns unter einer Pumpe, die Lokomotiven mit Wasser versorgt, abgestellt, den Kran
aufgedreht und uns anschließend ausgelacht, die Kinder Haben uns mit Steinen beworfen. Ein Wachmann kam in unseren
Waggon gekommen, hat unser Gepäck durchsucht, wenn er Tabak oder Zigaretten gefunden hat, nahm er sie mit. Die Kameraden
waren darüber so empört, dass sie vorhatten, ihn nachts unter den Waggon zu werfen. Wir haben sie gebeten dass zu
unterlassen, weil man uns in diesem Falle, alle erschießen würde.
Als wir ins Lager kamen wurden wir zuerst gezählt, dann mussten wir unser Gepäck stehen lassen und beiseite treten.
Wenn man bei der Nachkontrolle noch was in den Taschen fand, wurde das auch entwendet, selbst Esslöffel. Wir wurden
dann in drei Baracken, ohne Toiletten, eingeschlossen. Die Kameraden haben ihre Bedürfnisse in Kochgeschirre erledigt
und durch ein kleines Fenster, das sich fast unter der Decke befand, hinausgeworfen. Andere Fenster ließen sich nicht
öffnen, weil sie mit Stacheldraht zu geflochten waren. Als die Kameraden die Kochgeschirre auskippten, haben die
Wachposten geschossen und die Fenster zertrümmert. Sie waren der Meinung dass wir ausbrechen wollten. Es herrschte eine
große Hitze, in den überfüllten Baracken sind wir fast erstickt. Am nächsten Tag haben wir uns über fehlende Toilettem
beschwert, da haben sie Heringsfässer durch die Hälfte geschnitten und an der Ausgangstür hingestellt. Um bei den
überfüllten Räumen dort hinzukommen, musste man über die Köpfe der Anderen steigen. Viele hatten Fieber und Durchfall
und mussten in die Krankenstube eingeliefert werden, wo sie kurz darauf verstarben.
Besonders Raucher litten sehr an der Unterernährung, bekamen Wasser in den Beinen und waren die Ersten die verstarben.
Nach der Registrierung wurden wir auf andere Baracken verteilt. Die Zivilbevölkerung kam in die Räume und begann uns
auszuplündern. Wer noch gute Schuhe besaß musste sie ausziehen und bekam dafür die kaputten des Plünderers. Eine Woche
lang mussten wir diesen Zustand ertragen, erst als die Kameraden sich beschwerten, wurde am Eingang eine Tafel am
Eingang angebracht, dass die Zivilbevölkerung das Lager nicht betreten darf. Bis auf einige, wenige Ausnahmen wurde
diese Anweisung befolgt.
Als wir im Lager ankamen, war der französische Lagerkommandant, ein ehemaliger Kriegsgefangener, der bei einem Bauern
in Deutschland gearbeitet hatte. Dieser Bauer war jetzt als Kriegsgefangener in seinem Lager. Als er ihn erkannte, hat
er ihn gleich zum Küchendienst eingeteilt und mit dem nächsten Krankentransport nach Hause fahren lassen. Zu Mittag
bekamen wir nur gekochte Haferkörner, da schwamm alles oben, später war man dann auf Gerste umgestiegen. Als viele
daran gestorben waren, weil sie diese „Rohkost”, die nur ein Kuhmagen verträgt, nicht gegessen haben, hat man die
Körner durch eine Schrotmühle laufen lassen. Dann hat man uns Steckrüben gekocht; wir bekamen 250 Gramm Weißbrot,
etwas Quark und ein viertel Liter Magermilch. Später, als wir schon arbeiten mussten, hat man in unserem Essen einen
Kuhkopf mitgekocht, das hat dann bedeutend besser geschmeckt.
Bevor wir morgens zur Arbeit gingen, mussten wir zu Flaggenparade und abends, nach der Rückkehr, haben wir die Flagge
wieder eingeholt. Wir haben einen Kanal gereinigt, dessen Sohle 2 Meter dick mit Schlamm bedeckt war. Zuerst wurde das
Wasser abgelassen, dann haben wir, einer dem andern, den Schlamm mit der Schippe hoch gereicht. Der Letzte hat den
Schlamm, der so zäh war, dass er nicht von der Schippe wollte, oben am Rande abgelegt. Manchmal waren 10 Mann nötig um
den Höhenunterschied zu überwinden. Das Wachpersonal schoss über unsere Köpfe hinweg und rief: „schnell arbeiten”. Bei
der großen Hitze war das ein Ding der Unmöglichkeit, zumal es nichts zu Trinken gab. Auf dem Heimweg haben wir im Walde
Heilkräuter gesammelt, die man in der Küche getrocknet und als Tee zubereitet hat, den wir am nächsten tag zur Arbeit
mitnahmen, um unseren Durst zu stillen.
Unser Aufseher hatte einen Stock, an dem sich noch kurz abgeschnittene Äste befanden. Wer seiner Meinung nach, nicht
ordentlich gearbeitet hat, bekam gleich Schläge auf den Rücken. Die weißen Aufseher wurden irgendwann durch Neger
ersetzt, die uns bedeutend besser behandelt haben. Wenn irgendetwas schief ging, haben sie nichts gesagt, nur gelacht.
In den übrig gebliebenen Wassertümpeln hatten sich noch einige Aale versteckt, die wir zu fangen versuchten, was uns
auch manchmal gelang. Wir mussten ihnen das Genick brechen, damit sie uns nicht entwischen konnten. Wenn die Franzosen
bemerkten das wir Aale hatten, wurden sie uns abgenommen. Gelang es uns aber, sie ins Lager zu bringen, dann haben wir
uns eine köstliche Malzeit zubereitet.
Um sicherzustellen dass niemand geflüchtet ist, wurden wir, wenn wir abends ins Lager zurückkamen, zuerst gezählt.
Diese Zählung wurde mehrmals wiederholt, weil die Wachmannschaften sich immer wieder verzählt haben. Als einer von uns
hin ging, ihnen sagte dass alle da sind, wollten sie es nicht glauben und haben uns vor dem stehen lassen, bis es ihnen
irgendwann einfiel. uns doch das Tor zuöffnen. Einmal, als wir von der Arbeit zurückgekehrt waren, standen wir bis 23
Uhr neben der Flagge, weil uns niemand das Tor geöffnet hat. Als wir dann doch irgendwie ins Lager kamen haben wir
festgestellt, dass das ganze Wachpersonal betrunken war und niemand im Stande uns das Tor zu öffnen.
Eines Tages waren wir wieder abends zur Parole angetreten, als ein älterer Herr mit seinem Hund, am Stacheldraht
entlang, spazieren ging. Weil der Hund, unterm Stacheldraht hindurch, zu uns kam, hat ihn einer geschnappt, ihm das
Genick gebrochen und unter seiner Jacke versteckt. Der Franzose hat nach seinem Hund gerufen und gepfiffen, aber alles
vergebens, der Hund war nicht aufzufinden. Die Kameraden haben ihm gleich das Fell über die Ohren gezogen, das Fleisch
gekocht und das Fell in die Latrine geworfen. Das Fleisch wurde umgehend verspeist.
Als wir am nächsten Tag von der Arbeit zurückkehrten, war im Lager der Teufel los. Wir mussten sofort antreten und
wurden gefragt, wo der Hund geblieben ist, der Gestern Abend, mit seinem Herrchen, am Zaun entlang spazieren ging. Als
sich niemand dazu bekannte, mussten wir weiterhin stehen bleiben, während die Wachmannschaften von Baracke zu Baracke
gingen und alles durchsuchten. In einer Latrine hat man dann das Fell gefunden, was uns ein furchtbares „Donnerwetter”
einbrachte und in den nächsten Tagen, nach der Arbeit, unter dem Kommando eines Oberfeldwebels, eine Stunde
nachexerzieren.
In Südfrankreich regnet es den ganzen Sommer nicht; die Bauern haben da keine Scheunen und das Getreide wir nur in
Schobern aufgestellt und dann umgehend gedroschen. Vom Oktober bis Dezember regnete es fasst jeden Tag in Strömen.
Gesät wird nur im Frühjahr und im Herbst, weil im Sommer alles vertrocknet. Es wird viel Wein angebaut und die
Steckrübe wächst den ganzen Winter. Neben den Weinreben wurde aus Schieferplatten ein Zaun aufgestellt, um dem Wein
einen optimalen Standort zu sichern. Die Bauernwagen hatten nur zwei Räder und waren nur mit einem Pferd bespannt, das
die ganze Balance des Wagens zu halten hatte. Trotzdem haben sie soviel aufgeladen wie wir auf einen Leiterwagen. Viele
Kameraden wurden den Bauern zur Arbeit ausgeliehen. Wenn ein Bauer einen Arbeiter gebraucht hat und es wurde gefragt,
wer sich in der Landwirtschaft auskennt, da haben sich alle gemeldet. Der Bauer konnte sich dann aussuchen, wen er
mitnehmen wollte.
Wenn wir durch die Stadt zur Arbeit gingen, haben verschiedene Leute Fallobst in die Abfalleimer gelegt. Wenn das von
den Kameraden bemerkt wurde, schwenkten viele aus der Reihe, um sich etwas mit zunehmen, was von den Wachmannschaften
nicht gern gesehen wurde. Viele Kriegsgefangene hatten keine Schuhe mehr, sie haben die Füße nur mit Lumpen bewickelt.
Eines Tages kamen Kameraden aus Norwegen, die nach Deutschland entlassen werden sollten. Mann hat sie jedoch ins Lager
gesteckt und zur Arbeit eingeteilt. In Norwegen hatten sie Kleider und Stoffe eingekauft, hatten volle Seesäcke und
sogar Karren auf 2 Rädern, weil sie ja in die Heimat entlassen werden sollten. Als wir morgens zur Arbeit rausgeführt
wurden standen sie schon vor dem Lager. Wir haben ihnen zugerufen, dass sie uns etwas abgeben sollen, weil ihnen ja
sowieso alles abgenommen wird, aber sie haben uns nur ausgelacht. Als sie ins Lager Kamen mussten sie ihr Gepäck
ablegen, wurden dann wo anders hingeführt und haben es danach nie wieder gesehen.
Durch die vielen Läuse, Flöhe und Wanzen die wie im Lager hatten, kam es bei verschieden Kameraden, an den
Einstichstellen, zu eiternden Entzündungen. Um dem vorzubeugen hat man uns mit einem Pulver, das in Frankreich
hergestellt wurde, aber bei den Parasiten keine Wirkung zeigte, eingesprüht. Erst bei der Anwendung eines Mittels
amerikanischer Herkunft, war alles über Nacht verschwunden.
Der Sonntag war arbeitsfrei. Dann kam ein katholischer, französischer Pfarrer, eskortiert von 3 Mann, mit
aufgepflanztem Seitengewehr ins Lager und hat Gottesdienst gehalten. Einen evangelischen Pfarrer gab es nicht, nur
einen Baptisten Prediger. Der wurde würdevoll eingekleidet, bekam ein großes Kreuz und hat jeden Sonntag in einer
extra dafür hergerichteten Baracke Gottesdienst gehalten. Wer Theologie studiert hatte und sich meldete, wurde zu
einem Seminar geschickt und konnte sein Studium fortsetzen. Glasbläser durften das Lager auch verlassen und ihrem
erlernten Beruf wieder arbeiten.
Wer sich freiwillig, für 5 Jahre, zum Dienst in der Fremdenlegion verpflichtet hat, das waren etliche unter uns, wurde
neu eingekleidet, bekam gutes Essen und Rauchwaren soviel er wollte. Nach einem Jahr wurden, nach und nach, die
Kranken und Körperbehinderten in die Sowjetische Besatzungszone entlassen. Eine Entlassung von Kriegsgefangenen, die
in den Westzonen oder jenseits von Oder und Neise zu Hause waren, war nicht vorgesehen. Die Österreicher wurden alle,
unabhängig von ihrem Gesundheitszustand entlassen.
Ich habe Briefe nach Hause geschrieben, aber die kamen nur bis Allenstein und wurden wieder zurück geschickt. Als eine
Kommission des Roten Kreuzes aus der Schweiz unser Lager besichtigt hat, haben wir uns beschwert, das wir als
Sanitätsdienstgrade, zur Arbeit gehen müssen. Daraufhin erging ein Befehl: Wer einen vom Roten Kreuz, ausgestellten
Ausweis besitzt, gehört einem internationalen Verband an und braucht nicht zu Arbeit gehen. Aus unserem Lager hatten
sich 20 Mann gemeldet, die daraufhin Freigang, in Begleitung von zwei französischen Wachsoldaten erhielten. Als wir
gefragt wurden wo wir hin wollen, entschlossen wir uns, einen Soldatenfriedhof, auf dem unsere verstorbenen Kameraden
beerdigt waren, zu besuchen.
Da der Untergrund in dieser Gegend aus Felsen bestand, wurden die Gräben, in denen die Toten in selbst gezimmerten
Kisten nebeneinander gestellt wurden, mit Hilfe von Dynamit ausgehoben. Ein Leichenwagen, mit einem Pferd bespannt,
das mit einer schwarzen Decke abgedeckt war, wurde von einem Kutscher in angemessener Kleidung, gefahren. Der Wagen
konnte gleichzeitig 4 Kisten transportieren. Wenn wir von der Arbeit kommend, dem Leichenwagen begegneten, wurde
gehalten und mit einer Schweigeminute der Toten gedacht, bis der Wagen vorbei war. Die Zivilbevölkerung verharrte auch
im Schweigen, mit abgenommener Kopfbedeckung.
Ein Kamerad, der in Krottorf, Kreis Oschersleben, bei Magdeburg, zuhause war, sagte bei seiner Entlassung zu mir:
Sollte ich das Glück haben, meine Entlassungspapiere zu erhalten ohne eine Bleibe vorzuweisen, dann soll ich Krottorf
als Heimatadresse angeben. Auf der Krankenstube habe ich angegeben, dass sich noch ein Schrapnellsplitter, aus dem
Ersten Weltkrieg, in meiner Kreuzbeingegend befindet, er zwar verkapselt ist, aber immer noch Beschwerden verursacht.
Daraufhin wurde ich zur Entlassung vornotiert. Als bekannt wurde das ein Rückkehrertransport in die sowjetische
Besatzungszone zusammengestellt wird, habe ich mich sofort gemeldet und wurde für ein Entlassungslager in Angoleme
vorgesehen. War das eine Freude, als uns mitgeteilt wurde, wann der Rücktransport stattfindet.
In unserem Lager waren noch 2 Kameraden aus dem Kreis Ortelsburg: Ein Gustav Lumma aus Leynau und ein Alfred Moritz
aus Groß Schöndamerau. Sie mussten noch zurückbleiben und haben mir den Auftrag erteil, die Angehörigen in der Heimat
zu grüßen und ihnen die Anschrift mitzuteilen. Als wir im Entlassungslager ankamen, fragte man uns nach unserer
Heimatanschrift. Dann wurden die Entlassungspapiere angefertigt. Es wurde uns auch ein Barscheck, für die in Frankreich
geleistete Arbeit ausgehändigt, den wir bei jeder Kasse in Deutschland einlösen könnten. Ich habe ihn bis zum heutigen
Tage nicht einlösen können, obwohl ich irgendwann in der Zeitung gelesen habe, das Verrechnungschecks die den aus
französischer Kriegsgefangenschaft Entlassenen, ausgehändigt wurden, einzulösen sind.
Wir kamen zuerst nach Saar Elbe, dann in die Nähe der Zonengrenze zu Thüringen. Hier mussten wir 2 Tage warten, weil
aus der sowjetischen Besatzungszone keine Eisenbahnwagen bereitgestellt wurden. Angesichts dessen, das der Russe beim
letzten Transport die aus Frankreich kommenden Wagen kassiert und nicht mehr herausgeben wollte, bestand der Franzose
jetzt darauf, seine Wagen sofort wieder mitzunehmen. Als der sehnsüchtig erwartete Zug endlich eintraf, durften wir
umsteigen und kamen, immer noch hinter Stacheldraht, nach Erfurt. Von dort weiter ins Quarantänelager nach Prätsch an
der Elbe.
Unter Androhung von Strafe war es verboten das Lager zu verlassen, doch der Hunger zwang uns dazu, in den umliegenden
Dörfern um Lebensmittel zu betteln. Man drohte uns damit, dass Zuwiderhandlungen, mit einer 14-tägigen Verlängerung der
Quarantäne geahndet werden. Der Roggen war schon reif und wir haben, auf den umliegenden Feldern, die Ähren abgerissen,
das Korn, zwischen 2 Steinen zu Mehl zerrieben, um daraus eine Suppe zu kochen, denn von dem was unsere Lagerküche uns
bieten konnte, war es nicht möglich zu überleben. Als der Eigentümer bemerkte wer seine Roggenähren entwendet hat, kam
er ins Lager, gerade zu dem Zeitpunkt als wir mit dem Mahlen beschäftigt waren. Der Lagerkommandant, bei dem er sich
beschwerte, drohte uns zu bestrafen, wenn wir unsere „Rauzüge” nicht unmittelbar einstellen würden. Wir sagten ihm er
solle uns heimfahren lassen, da wir doch lange genug hinter Stacheldraht gesessen hätten.
Endlich wieder in Freiheit
14 Tage nach unserer Ankunft wurden uns Entlassungspapiere ausgehändigt, sowie auch Fahrscheine
zum den, von uns angegeben Heimatorten. So kam ich nach Krottof, Kreis Oschersleben, zu meinem ehemaligen
Kriegskameraden, bei dem ich einen Tag geblieben bin. Er hatte mir schon eine Stelle bei einem Bauern besorgt, der 70
Jahre alt und kinderlos war. Zum Hof, den er mit seiner Ehefrau bewirtschaftet hat, gehörten 36 Morgen Land, 2 Ochsen
und 3 Kühe. Das Ackerland bestand aus 17 Parzellen und sicherte mir einen Arbeitsplatz.
Jetzt, da ich ein Dach überm Kopf und genug zu essen hatte, fing ich an nach dem Verbleib meiner Familie zu forschen.
Bei meinem letzten Heimaturlaub hatte ich mit meiner Frau verabredet; falls wir uns in den Kriegswirren verlieren
sollten, unsere Kontaktadresse, die meiner Quartiersleute in Burscheid, Kreis Opladen, sein sollte. Ich habe zuerst
nach Rohmanen geschrieben, aber leider keine Antwort erhalten. Dann habe ich nach Burscheid geschrieben, und siehe, -
bei denen lag schon eine Anfrage meiner Frau vor, die nach mir gefragt, und ihre jetzige Anschrift hinterlassen hatte.
Ich habe dem Bauern erzählt dass meine Frau sich zurzeit, auf einem Gut, in Alt Steinhorst, im Kreis Rostock, befindet.
Er war sofort bereit uns ein Zimmer zur Verfügung zu stellen, wenn ich meine Frau nach Krottorf rüberholen wollte. Das
habe ich Ihr mitgeteilt und sie war sofort bereit ihren Wohnsitz nach Krottorf zu verlegen, denn sie wohnte dort in
einem kleinen Stübchen unterm Dach.
Im Herbst, als die Feldarbeit so ziemlich erledigt war, bin ich nach Alt Steinhorst gefahren, um meine Frau und meinen
Sohn Kurt, sowie meinen Sohn Manfred, den ich noch nicht kannte, weil er erst nach der Flucht, am 31. Januar, in Groß
Lüssewitz, geboren wurde, nach Krottorf zu holen. Meine Frau hatte schon Holz für den Winter besorgt und vom Gut, auf
dem sie im Sommer gearbeitet hatte, Mehl und Kartoffeln bekommen. Wir haben das Mehl und andere Habseligkeiten in
Kisten verpackt. Das Holz haben wir einem Bauern gegeben, der uns und unser Gepäck, mit seinem Pferdewagen, zum 14
Kilometer entfernten Bahnhof, nach Ribnitz gebracht hat. Wir sind auch gut in Krottorf angekommen, aber als wir am
nächsten Tag, unsere Kisten vom Bahnhof abholen wollten, haben wir zwar die Kisten vorgefunden, doch der gesamte Inhalt
wurde während der Bahnfahrt entwendet. Die Bahnstation in Krottorf hat die Vorkommnisse zur Kenntnis genommen und
protokolliert, aber unsere Sachen haben wir nie wieder gesehen und mussten wieder bei Null anfangen.
Im Winter musste ich auf der Genossenschaft, unentgeltlich, für die Russen Weizen einsacken. Ich hatte versucht eine
Arbeit als Zimmermann zu bekommen, doch auf dem Arbeitsamt wurde mir gesagt, ich bin Ladwirt und muss auf der
Landwirtschaft arbeiten. Da in den ersten Nachkriegsjahren, auch in der sowjetisch besetzten Zone Arbeitsplätze knapp
waren, mussten auch solche, die einen anderen Beruf erlernt hatten, jede zumutbare Arbeit annehmen. Aus der Heimat
erhielt ich einen Brief, von meiner dort noch lebenden Mutter. Sie schrieb das sie mich noch einmal sehen wollte und
ich sollte doch wieder zurück kommen; Unser Hof wäre nicht von Polen besetzt und sie wäre ganz alleine, weil der Vater
nach dem Durchzug der Front von den Russen erschlagen wurde. Daraufhin habe ich dem polnischen Konsulat in Magdeburg
mitgeteilt, dass ich in Rohmanen eine Landwirtschaft besitze, und um eine Einreisegenehmigung gebeten.
Nach 2 Monaten erhielt ich eine Postkarte, mit der Mitteilung, ich sollte mich persönlich beim Konsulat vorstellen.
Nach Aufnahme meiner Personalien, wurde mir gesagt, das ich benachrichtigt werde wenn mein Antrag genehmigt wird. Ende
Juli 1947 erhielten wir die Einreisegenehmigung nach Ostpreußen, das jetzt unter polnischer Verwaltung stand. Wir
mussten zuerst zum polnischen Konsulat in Berlin-Lichterfelde, wo wir umgeben von einer Trümmerlandschaft, gewartet
haben, bis alle Untersuchungen und Formalitäten erledigt waren.
“ Wieder zurück in Ostpreußen.”
Der schwere Wiederaufbau nach dem Kriege
Dann fuhren wir über Frankfurt/Oder, Posen, Thorn, Allenstein, nach Ortelsburg, wo wir am 2. August 1947 ankamen. Mit
einem zweirädrigen Karren, den ich mir von einem noch in Ortelsburg lebenden Bekanten ausgeliehen hatte und meinem
Sohn Manfred im Kinderwagen fuhren wir nach Rohmanen. Meine Mutter war inzwischen verstorben und auf dem Hof war nur
meine, inzwischen aus Russischer Gefangenschaft wiedergekehrte Schwester, Frieda Pelkowski.

Es war alles ausgeplündert; kein Vieh, keine Maschinen und der ganze Hof mit kniehohem Graß überwachsen. Nur schmale
Trampelpfade, vom Haus zum Holzschuppen und zum Klo, durchkreuzten das satte Grün. Ich habe das Gras auf dem Hof mit
einer Sense, die ich noch gefunden habe, abgemäht, damit der Hof nicht so verwahrlost aussah. Am nächsten Tag habe ich
mich bei der Polizei in Ortelsburg angemeldet, wo ich auch ein Startgeld von 100 Zloty erhielt und Gepäckstücke, die
ich in Krottorf aufgegeben, am Bahnhof abgeholt. Es hat mich sehr gewundert das, das Gepäck überhaupt angekommen ist.
Da man von der Landwirtschaft nicht Leben konnte, habe ich mich in den nächsten Tagen, bei der jetzt polnischen Bahn,
um Arbeit beworben und wurde auch angenommen. Wenn wir unseren Monatslohn bekamen, saß immer einer am Tisch, der von
uns 100 Zloty für den Wiederaufbau von Warschau verlangte. Wenn ich dran war, riefen die Anderen, ich hätte Warschau
zerstört und müsste deshalb 200 Zloty abgeben. Nach 3 Jahren kam eine Verfügung, die besagte, dass wer länger als 1
Jahr bei der Bahn beschäftigt ist, angestellt werden muss. Um diese Bestimmung zu umgehen hat man mich entlassen und
eine Woche später wieder eingestellt.
Als ich vor Ablauf des nächsten Jahres, aus dem gleichen Grunde wieder entlassen wurde, habe ich mich bei der
Stadtverwaltung in Ortelsburg(jetzt Szczytno)beworben, wo ich zuerst im Gaswerk als Heizer und später auf Baustellen
als Zimmermann gearbeitet habe. Wir haben durch den Krieg beschädigte Häuser repariert, in den ehemals touristischen
Zentren einige Ausbesserungen an den Einrichtungen durchgeführt, eine Ziegelei wieder in Betrieb gesetzt und andere
anfallende Arbeiten verrichtet. Im Dach des Rathausturmes war während der Kämpfe eine Granate eingeschlagen, die, die
Dachlatten und die Verschalung zerstört hatte. Da wir, unter schwersten Bedingungen, den Schaden repariert haben,
wurde uns eine Höhenzulage versprochen, die wir aber nicht bekommen haben.
Aus Verärgerung darüber habe ich bei der Stadtverwaltung gekündigt und bei einer Wiederaufbaufirma unter der Leitung
von Bauingenieur Laskowski wieder angefangen, wo ich bis 1954, als Zimmermann beschäftigt war. Ab da habe ich mich
nur um meinen Hof gekümmert, der wegen meiner Arbeitsstellen, gezwungenermaßen, sehr vernachlässigt wurde. Als wir
1947 zurückkamen, brachten wir unseren Sohn Manfred noch im Kinderwagen. Den hat meine Frau zum Markt gebracht,
verkauft, und dafür eine Ziege erworben, die dank guter Pflege, uns täglich mit 4 Liter Milch versorgte. Das war der
erste Baustein zum Wiederaufbau, unserer durch den Krieg zerstörten, und danach ausgeplünderten Landwirtschaft.
Während meiner Arbeit bei der Bahn haben wir uns eine Kuh gekauft, die nach einem halben Jahr, wegen nicht bezahlter
Grundsteuer, vom Gerichtsvollzieher gepfändet wurde. Man hat uns die Kuh weggenommen und bei einem Arbeiter, der in
der Ernst-Mey-Straße in Ortelsburg wohnte und sie wegen nicht vorhandener Futtermittel, nur mit Kartoffelkraut
gefüttert hat, untergestellt. Als ich bei der Bahn meinen Monatslohn bekommen habe, bin ich zur Gmina gegangen, habe
eine Rate angezahlt und durfte dann die Kuh wieder mit nach Hause nehmen. Durch die schlechte Ernährung war die Kuh
stark abgemagert und lieferte nur die Hälfte der ursprünglichen Milchleistung.
Später habe ich ein Pferd auf Abzahlung bekommen, das 140.000 alte Zloty gekostet hat. Die Stute war schwach und unser
Feld sehr hügelig, so dass man nur bergab pflügen konnte, was sehr beschwerlich war, bergauf ging es immer im Leerlauf.
Später habe ich die schweren Böden mit dem Traktor umpflügen, und in den letzten Jahren auch mit dem Binder mähen
lassen. Von der Stute habe ich 2 schöne Fohlen gezogen; ein davon habe ich bei der Ausreise in die Bundesrepublik
mitgebracht und bei der Viehverwertungs-Genossenschaft in Göttingen verkauft. In den ersten Nachkriegsjahren als noch
wenig Land bestellt wurde, breiteten sich auf den nicht beackerten Flächen, Wildkräuter aus. Disteln und andere
Schnellwachsende, erreichten manchmal eine Höhe von 2 Meter, besonders auf den schweren Böden.
Es hat viel Schweiß gekostet ehe man den Acker soweit hatte, das er auch befriedigende Erträge abwarf. Die
Währungsreform von 1950, hat unser weiniges Geld das wir schon gespart hatten, wieder vernichtet. Ich hatte 2 Pferde,
1 Fohlen, 2 Kühe und Schweine, als ich wieder aufgefordert wurde nicht bezahlte Grundsteuern nachzuzahlen. Als ich
nicht bezahlen konnte, hat der Vollziehungsbeamte, ein Fohlen, eine Kuh und ein Schwein gepfändet. Es gelang mir jedoch
nach längeren Verhandlungen, ohne größere Verluste, alles zu regeln. Später kam eine Verfügung, die besagte; wenn
jemand auf seinem Hof nur eine Kuh und ein Pferd hatte, durften sie nicht gepfändet werden. Einige haben ihr Inventar
dieser Verfügung angepasst und dadurch die Zahlung von Grundsteuer umgangen.

Wer seine Steuern pünktlich bezahlt und sein Kontingent an landwirtschaftlichen Produkten fristgerecht abgeliefert hat,
der konnte seine, darüber hinaus erwirtschafteten Produkte zu marktgerechten Preisen verkaufen. Für eine hochtragende
Sterke, mindestens 400 kg schwer, die auf ein staatliches Gut verkauft wurde, konnte man bis zu 12000 Zloty bekommen.
Unsere Böden waren kalkarm, doch durch den Einsatz von Kalk und Kunstdünger konnte man den Ertrag erheblich steigern.
Kalk und Kunstdünger konnte man bei der Genossenschaft(GS) bestellen, der dann auch direkt auf den Hof geliefert wurde.
Kalk wurde geliefert und gleich auf dem Feld ausgestreut. In den 1960ger Jahren waren alle Ackerflächen der Rohmaner
Felder bestellt.
Die nach dem Krieg zurückgebliebenen deutschen Bauernfamilien, aber auch die Polen, die während des Krieges beim Bauern
in Deutschland gearbeitet haben, versuchten mit teils bescheidenen, oder auch zusammen gesuchten, landwirtschaftlichen
Geräten, die bäuerlichen Betriebe aufrecht zu erhalten. Nach den schweren Anfängen in den ersten Nachkriegsjahren
erzielten sie schließlich einen beachtlichen Erfolg, der sich in wogenden Kornfeldern, sowie in grünen Wiesen auf
denen gut genährtes Vieh weidete, widerspiegelte.
Ein schwerer Einschnitt in meinem Leben.
Am 11. Mai 1956 verstarb nach langer schwerer Krankheit, meine liebe Ehefrau Marta Rattay,
geborene Brosch. Ein Jahr zuvor war schon mein Schwiegervater Gottlib Brosch verstorben. Die schweren Bedingungen
unter denen wir nach Kriegende leben mussten, haben ihrer bereits angegriffenen Gesundheit sehr zugesetzt. Sie
verstarb mit 44 Jahren und hinterließ in unserer Familie eine große Lücke, die nicht mehr zu Überbrücken war. Wir
haben sie unter großer Anteilnahme der noch verbliebenen deutschen Bevölkerung zu Grabe getragen und auf dem Rohmaner
Friedhof beigesetzt. Die Arbeit die sie sonst verrichtet hatte fiel jetzt auf mich und meine Söhne zurück. Meine
Schwester Frieda Pelkowski half auch wo sie nur konnte. Wir waren auf die Unterstützung durch Nachbarn und Freunde
angewiesen, die uns immer wenn es nötig war, tatkräftig unterstützt haben. Im laufe der Zeit haben wir wieder zum
Alltag zurück gefunden, haben sie noch etliche Jahre auf dem Friedhof besuchen können, bis wir, bedingt durch unsere
Ausreise uns endgültig von ihr trennen mussten.
Der endgültige Abschied von Ostpreußen
Ab 1956 begannen, durch die Vermittlung des Deutschen Roten Kreuzes, die ersten Ausreisen in die
Bundesrepublik Deutschland. Zuerst waren es Kinder die zu ihren Eltern ausreisen durften, Familien deren Väter aus der
Kriegsgefangenschaft in den Westen Deutschlands entlassen wurden und andere durch den Krieg getrennte
Familienangehörige. Ab 1960 erhöhte sich die Zahl der Ausreisewilligen aus dem polnisch besetzten Ostpreußen. Es setzte
sich die Überzeugung durch, dass unsere Angestammte Heimat, uns für die Zukunft keine Perspektive mehr bieten konnte.
Meistens wurden die Anträge, die wir an die Passabteilung in Allenstein stellen mussten, um einen Ausreisepass zu
bekommen, negativ beschieden. Nach mehrmaligen Versuchen gelang es dann doch, diese begehrte Ausreiseberechtigung in
Empfang zu nehmen. Die Enttäuschung der Zurückgebliebenen war groß, wenn wieder mal Verwandte oder Nachbarn, den Weg
in Richtung Bahnhof einschlugen.
Um einen Reisepass zu beantragen, musste man zuerst eine Einladung von Verwandten aus der Bundesrepublik vorlegen, in
der, diese sich verpflichten mussten, für Unterkunft und Verpflegung der Eingeladenen zu sorgen. Diese Einladung
musste durch ein Amt in der Bundesrepublik beglaubigt werden. Außerdem mussten die Kosten für die Bahnfahrt, ab
polnischer Grenze, bis zum Zielort, beim polnischen Reisebüro ORBIS, in Warschau, in DM eingezahlt werden.
Unseren ersten Ausreiseantrag haben wir 1964, bei der Kommandantur der polnischen Miliz in Allenstein eingereicht, der
nach einer gewissen Zeitspanne, ohne eine uns verständliche Begründung zu nennen, abgelehnt wurde. Gegen diese
Ablehnung wurde ein Widerspruch zugelassen, den wir sofort einreichten. Nach einer weiteren Zeitspanne erhielten wir
wieder eine Ablehnung, gegen die kein Widerspruch mehr zulässig war. Wer seine Ausreiseabsicht nicht aufgeben wollte,
musste einen neuen Antrag stellen. Es gab Familien die schon 10 Mal einen Ausreiseantrag gestellt hatten und immer
wieder abgewiesen wurden. Da meine Söhne, nicht die Absicht hatten in Rohmanen zu bleiben und ich nach 2 Weltkriegen,
an denen ich teilgenommen, die schwere Arbeit auf der Landwirtschaft, nicht aus eigener Kraft schaffen würde, haben wir
1966 wieder einen Antrag gestellt, der prompt abgelehnt wurde. Der Widerspruch auf diese Ablehnung wurde auch negativ
beantwortet, so dass wir 1968 wieder einen Antrag eingereicht haben.
Weil das Passamt in Allenstein lange nichts von sich hören ließ, hegten wir schon die Hoffnung das es jetzt klappen
würde und waren sehr enttäuscht als wieder eine Absage kam. In der Zwischenzeit sind viele Nachbarn und Bekannte aus
Rohmanen, sowie aus der näheren Umgebung, ausgereist und das Häuflein der noch verbliebenen Deutschen, wurde immer
kleiner. Die Motivation, die uns in früheren Jahren, über so manche schwierige Lage hinweg geholfen hat, ist einer
hoffnungslosen Resignation gewichen. Man war davon überzeugt, dass unser Leben, in unser Angestammten Heimat, keine
Zukunftsperspektive mehr haben konnte und wenn wir keine Ausreisegenehmigung bekommen, wir eines Tages die letzten
Deutschen in der ganzen Umgebung sein werden.
Die Ausreise-Heimat ade
Wir hatten die Hoffnung schon aufgegeben, als am 30. April 1969, der Briefträger unseren Hof
betrat und mir einen Brief überreichte, in dem uns das Passamt in Allenstein mitteilte, dass unsere Ausreise in die
Bundesrepublik Deutschland, genehmigt worden ist. Wir müssten, nach Aushändigung der Reisepapiere, den Geltungsbereich
der Volksrepublik Polen, innerhalb von 3 Monaten verlassen. Wir waren zuerst geschockt, über den Hinweis, das wir
unsere Heimat in 3 Monaten verlassen müssen, aber dann stellte sich die Zukunftsperspektive wieder ein und wir gingen,
wie von einem schweren Ballast befreit und gut gelaunt unser weiteren Tätigkeit nach.
Als der Briefträger unseren Hof betrat, waren ich und mein Sohn Kurt gerade dabei eine Fuhre Mist zu laden. Wir hatten
den Wagen gerade halb geladen und haben nach der frohen Kunde nicht mehr weiter gemacht, sondern die Pferde vorgespannt
und den Mist aufs Feld gefahren, damit wir den Wagen für alle Fälle frei hatten. Das war die letzte Tätigkeit für
unsere Landwirtschaft in Ostpreußen.
Die Nachricht von unserer Ausreise verbreitete sich, ohne dass wir darüber gesprochen haben, wie ein Lauffeuer.
Alsbald kamen Leute aus dem Dorf, die sich für das Vieh und für diverse Landwirtschaftliche Geräte interessierten.
Etliche wollten bestimmte Sachen sofort kaufen, andere haben nur zurücklegen lassen und wollten später kommen und
bezahlen, haben es aber dann doch nicht genommen.

Wenn man eine Landwirtschaft hatte, konnte man 2 Pferde, 2 Rinder, 3 Schweine, 5 Schafe und 10 Hühner, in einem
geschlossenen Viehwaggon, in die Bundesrepublik mitnehmen. Jeden Tag war man unterwegs, von einer Behörde zur Andern.
Die Aushändigung der Reisepapiere erfolgte nur nach Vorlage bestimmter Bescheinigungen: Es mussten alle Steuern bezahlt
sein, das Kontingent landwirtschaftlicher Erzeugnisse musste abgeliefert sein, je eine Bescheinigung vom Katasteramt
und vom Notar musste vorgelegt werden, das man dem polnischen Staat das Grundstück abgetreten hat. Die Gebühren für
die notarielle Beglaubigung mussten wir selbst bezahlen. Wenn man alle Bescheinigungen beisammen hatte, bekam man bei
der Kreisverwaltung eine Gesamtbescheinigung. Mit dieser Bescheinigung konnte man nach Allenstein, zur
Polizeikommandantur fahren, wo man nach dem schriftlichen Verzicht auf die polnische Staatsangehörigkeit, einen
Reisepass ausgehändigt bekam, der den Inhaber zum Grenzübertritt berechtigte, aber nicht zur Wiedereinreise.
Wir haben 2 Pferde, eine Sterke, einen Ochsen, 5 Schafe, 2 Schweine und 10 Hühner mitgenommen. Über die Schutzimpfung
der Rinder musste man eine, vom Kreistierarzt beglaubigte Bescheinigung vorweisen. Ich habe 5 Schafsböcke gekauft, die
ich in der Zwischenzeit, hinter der Scheune, zum Weiden angekettet hatte. Einer von denen hat sich losgerissen und
seinen Nachbarn getötet. Das Fleisch konnten wir noch verkaufen, mussten aber dafür einen anderen Schafsbock kaufen.
Innerhalb von 3 Monaten mussten wir alles regeln und zwei Tage vor der Abfahrt einen Eisenbahnwagen, bei der
Eisenbahndirektion in Allenstein bestellen. Reservierungen bei den polnischen Behörden waren meist immer mit
Schmiergeld verbunden, weil man sonst nie sicher sein konnte dass diese Vereinbarungen auch eingehalten werden. Schon
2 Wochen vor unserer Abfahrt, gab es in Ortelsburg keine alkoholischen Getränke zu kaufen. Meine Söhne mussten mit dem
Motorrad die umliegenden Dörfer abfahren, damit wir für die Reise einen Vorrat anlegen konnten; denn Wodka war zu der
Zeit, in Polen, wie eine zweite Währung.
Am 25. Juli haben wir zusammen, mit meinem Neffen Siegfried Brosch, unseren sonstigen Hausrat, der in Kisten verpackt
war, in einen Eisenbahnwagen, auf dem Allensteiner Bahnhof verladen. Alles musste zuerst durch den Zoll, wo die
Federbetten gewogen wurden und über das erlaubte hinausgehende Kissen, verzollt werden mussten. Dasselbe galt auch für
Fleisch und Räucherwaren.
Am 26. Juli, unserem Verladetag, kam der Eisenbahnwagen aus Allenstein, erst um 11 Uhr auf dem Ortelsburger Bahnhof an.
Die Rinder hatten wir zu Fuß, zum Bahnhof gebracht; Schweine, Schafe und Hühner auf dem Pferdewagen. Im Eisenbahnwagen
mussten, mit Hilfe von Brettern und Bohlen, Boxen für die verschiedenen Tiere erstellt werden. Jedes Pferd und jedes
Rind in eine Bucht. Die Schafe zwischen die Pferde, die Schweine zwischen die Rinder und die Hühner in einem Käfig,
unter der Decke über den Rindern. Die Hühner hatten unterwegs Eier gelegt, somit hatten wir jeden Tag frische
Verpflegung. Bei der Fahrt im Viehwagen, begleitete mich mein Sohn Manfred. Als die Lokomotive nahte, um den Wagen
abzuholen, wurden noch schnell die restlichen Sachen hinein geworfen und so mache Abschiedsträne rollte dann die Wange
hinab.
Unsere Nachbarn, Deutsche und Polen, halfen uns beim Verladen des lebendigen Inventars. Jetzt erinnerte ich mich
plötzlich, an die oft auch schönen, Ereignisse der letzten 22 Jahre. Einer Zeit, in der das Zusammenleben von
Deutschen und Polen, von Jahr zu Jahr, besser wurde. Man half sich beim einbringen der Getreideernte, beim Dreschen
des Getreides, bei der Kartoffelernte und bei anderen Arbeiten, wo viele Menschen zupacken mussten. Es war eine
Dorfgemeinschaft, in schweren Zeiten geboren; jeder half jedem wenn Hilfe nötig war. Es wurde mir plötzlich bewusst,
das jetzt ein Lebensabschnitt zu Ende ging, zu dem ich nicht mehr zurückkehren konnte. Unsere Existenzgrundlage war
jetzt ein Eisenbahnwagen auf einem Schienenstrang, dessen Ende irgendwo in weiter Ferne lag. Obwohl, von langer Hand
vorbereitet, war dieser Moment voller Wehmut.
Doch als der Zug sich plötzlich, in Bewegung setzte, war ich sofort wieder in der Gegenwart. Menschen, mit denen man
Jahrzehnte lang, in gutem Einvernehmen zusammen gelebt hat, blieben plötzlich am Bahnsteig zurück und die Entfernung
zwischen ihnen und mir vergrößerte sich mit jeder Sekunde, bis sie letztendlich aus meinem Blickfeld verschwanden.
Es war ein heißer Julitag, als wir unsere Reise gen Westen antraten. Für die Schweine, die besonders unter der Hitze
zu leiden hatten, haben wir 10 Flaschen Essig mitgenommen und sie von Zeit zu Zeit besprenkelt, damit sie besser atmen
konnten. Für die anderen Tiere war reichlich Heu und Hafer vorhanden. Eine großes Fas und zwei Milchkannen waren mit
Wasser gefüllt, die wir auf den an der Strecke liegenden Bahnstationen, bei Bedarf wieder nachgefüllt haben.
Da der Kreistierarzt nicht in seinem Büro war, konnten wir die Impfbescheinigung für das Vieh, nicht rechtzeitig
herbeischaffen. Der Zug setzte sich in Bewegung und die Bescheinigung war immer noch nicht da. Als die Bescheinigung
dann eingetroffen, wir aber schon unterwegs waren, ist mein Sohn Kurt mit dem Motorrad hinterher gefahren und hat uns
in Passenheim, wo der Zug noch andere Wagen angehängt bekam, die Impfbescheinigung übergeben. Wir waren sehr froh das
er es noch geschafft hat, denn in solch einer Situation fühlt man sich sicherer wenn man alle Bescheinigungen bei sich
hat. Auf der Rückfahrt, mit dem Motorrad hatte er noch eine Panne, musste das Motorrad stehen lassen und per Anhalter
nach Hause fahren. Am nächsten Tag kam er mit Siegfried Deptolla, der das Motorrad wieder flott machte und brachte es
wieder nach Rohmanen zurück.
Die Fahrt mit dem Viehwagen, gen Westen
Von Ortelsburg bis Allenstein(45 km) hat unser Zug 4 Stunden gebraucht, weil auf jedem Bahnhof
gehalten wurde, um neue Wagen anzuhängen. Nachdem wir in Allenstein angekommen waren, kam ein Rangierer und fragte
nach unserem Ziel. Als wir ihm mitteilten, das wir in die Bundesrepublik Deutschland wollen, sagte er nur: „In 10
Minuten fährt ein Zug los. Wenn ich von euch 500 Zloty und einen Liter Wodka bekomme, werde euch sofort anhängen,
andernfalls kommt ihr auf ein Nebengleis und müsst dann auf den nächsten Zug warten. Es blieb uns nichts anderes übrig
als seiner Forderung nachzukommen, denn über derartige Erpressungen hat man bereits von Anderen, die vor uns ausgereist
sind, gehört. Wir wurden auch sofort angehängt und fuhren dann die ganze Nacht, an Osterode, und Thorn vorbei bis
Gnesen. Dort wurde wieder rangiert.
Von einer Anhöhe wurden die einzelnen Wagen auf verschiedene Gleise verteilt und zu neuen Zügen zusammengestellt. Der
Aufprall der ungebremsten Wagen erzeugte eine derartige Erschütterung, dass manche Bretter an den Boxen geborsten waren.
Von Gnesen ging es dann in einem Zuge durch bis zur Grenzstation Reppen(Rzepin). Dort mussten wir zum Zollamt, wo
unsere Ausfuhrpapiere durch die Zollbeamten, und durch einen Tierarzt geprüft wurden. Bis Reppen(Rzepin) haben wir für
den Eisenbahnwagen 900 Zloty bezahlt; hier mussten wir noch einmal 650 Zloty bezahlen. Bei der Wagenkontrolle erklärte
uns ein Bahnbeamter das unser Wagen, sich nicht für den internationalen Transport eignet und wir deshalb den Inhalt in
einen Anderen umladen müssen, der irgendwann, auf dem Nebengleis bereitgestellt wird. Nach langer Verhandlung, sowie
einer Zulage von 500 Zloty und einem Liter Wodka haben wir ihn davon überzeugt, das der Wagen sich doch für die
Weiterfahrt eignet.
In der Nacht war Schichtwechsel, der unseren Wagen wieder abgehängt hat, weil er angeblich von der Reichsbahn der DDR,
wegen technischer Mängel nicht weiterbefördert würde. Wir mussten unsere Verhandlung vom Vorabend wiederholen, die mit
der Zusage endete, dass wir am frühen Morgen, über die Grenze auf DDR Gebiet, gebracht werden. Um 5 Uhr morgens kam
eine Lokomotive, die uns den letzten Abschnitt bis über die Grenze bringen sollte. Als der Zug hat noch einmal anhielt,
kamen polnische Grenzbeamte und Soldaten in den Wagen. Sie durchsuchten ihn und fragten, ob wir noch polnisches Geld
oder einen Grundbuchauszug bei uns hätten. Wir zeigten ihnen 800 Zloty, die sie uns, nach Ausstellung einer Quittung
über 500 Zloty, abnahmen. Die Grundbuchauszüge habe ich, im Stroh versteckt, dem Ochsen vor die Füße gelegt. Falls
jemand da suchen sollte, hätte ich gesagt, das das Tier bösartig veranlagt ist, und ich für seine Sicherheit nicht
garantieren könnte, deshalb sollte er vorsichtig sein.
Als die Grenzkontrolle den Zug verlassen hatte, setzte sich die Lokomotive wieder in Bewegung und überquerte nach
kurzer Zeit die Oderbrücke. Auf einer eingezäunten Fläche, jenseits der Grenze, hat man uns abgestellt hat und die
Lokomotive fuhr zurück auf polnisches Gebiet. Vor und hinter uns waren die Tore verschlossen. Auf den Wachtürmen,
links und Rechts von uns, standen Posten mit einem Gewehr im Anschlag. Vier Grenzbeamte der DDR, jeder mit einer
Leiter in der Hand, sowie ein Schäferhund, kamen zu unserem Wagen. Sie öffneten die Schiebetüre, stellten die Leiter
davor und ließen den Hund in den Wagen springen, der nur etwas herum schnupperte und wieder heraussprang. 2 Beamte
haben dann anschließend, die Papiere kontrolliert und das Inventar gezählt.
Nach einiger Zeit wurden wir an einen Güterzug der Reichsbahn angehängt und fuhren von Frankfurt an der Oder, vorbei
an Berlin, Ellingen und Nordhausen, über die Grenze zur Bundesrepublik bis Herzberg. Hier hat ein Zollbeamter der
Bundesrepublik, die Formalitäten erledigt und ein Tierarzt die Pferde, Rinder und Schweine gründlich untersucht. Ich
musste ihnen die Mäuler aufhalten und die Füße hochheben. Danach hat uns die Lokomotive zu einer Wasserzapfstelle
gebracht, wo wir die Tiere tränken und unsere Behälter mit Wasser auffüllen konnten. Anschließen fuhren wir über
Northeim nach Göttingen, zur Viehverwertungsgenossenschaft, die zuvor von unserer Ankunft in Kenntnis gesetzt wurde.
Der Ochse, die Sterke und die Schweine wurden, in Göttingen zum Schlachthof gebracht; die Pferde kamen nach Hannover
und die Schafsböcke nach Kassel. Wir waren mit dem Viehtransport 5 Tage unterwegs; hatten so manche Klippe umschifft
und Schwierigkeiten gemeistert, die im normalen Leben nicht vorkommen.
Wir wurden mit einem PKW, ins Durchgangslager Friedland bei Göttingen gefahren, wo mein Sohn Kurt, meine Schwester
Frieda Pelkowski und Siegfried Brosch mit Familie, die am 30 Juli, um 14 Uhr, von Warschau mit dem Zug abgefahren, und
hier am 31. Juli in den Morgenstunden eingetroffen sind, schon auf uns gewartet haben. In Friedland hat man uns mit
Familie Siegfried Brosch in einem Raum untergebracht, wir wurden registriert und erhielten 20 DM Überbrückungsgeld,
pro Person. Da wir erst am Freitag in Friedland eingetroffen sind, mussten wir hier über das Wochenende bleiben,
obwohl die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der Regel nur 3 bis 4 Tage beträgt.
Um einen Antrag für die Ausreise stellen zu können, brauchten wir eine Einladung von in der Bundesrepublik lebenden
Verwandten. Diese Einladung hat uns mein Bruder, Ernst Rattay, aus Ingelheim am Rhein zugeschickt. Ingelheim liegt im
Bundesland Rheinland-Pfalz. Das Geld für die Bahnfahrt, hat uns, Frieda Schellin, geb. Nickel, aus Duisburg, die
Tochter unseres Nachbarn, überwiesen. In Friedland wurden wir registriert. Im Registrierschein, war als unser
nächster Aufenthaltsort in der Bundesrepublik, das Durchgangslager Osthofen bei Worms, das alle Aussiedler für
Rheinland-Pfalz aufnehmen musste, eingetragen. Die Eintragung erfolgte deshalb, weil der Ort aus dem uns unsere
Einladung zugeschickt wurde, sich auch in Rheinland-Pfalz befand.
Da ich nach dem Polenfeldzug, als Soldat, ein Jahr im Kreis Opladen, im Rheinland gewesen bin, wäre ich sehr gerne in
diese Gegend gezogen, denn die Erinnerung an die schönen Tage die ich dort verlebt habe war in mir immer noch wach.
Ich versuchte die Eintragung in unseren Regiestierscheinen ändern zu lassen, was nach einigen, vielleicht auch
berechtigten Einwänden, am 4. August, vom Beauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen, genehmigt wurde. Anstelle von
Rheinlad-Pfalz stand da jetzt Nordrhein-Westfalen und am 7. August, fuhren wir, noch mit anderen Aussiedlern, ins
Durchgangslager Unna-Massen, am östlichen Rande des Ruhrgebietes gelegen. Hier wurden wir in einem Zimmer untergebracht
und konnten unser Essen in einer Gemeinschaftsküche zubereiten.
Am 8. August wurden wir in Unna-Massen, als Bürger der Bundesrepublik Deutschland registriert, erhielten
Einhundert DM Begrüßungsgeld, den Vertriebenen Ausweis -A -und 4 Wochen später den Bundespersonalausweis. In
Unna-Massen haben wir mehr als 4 Monate verbracht, weil mein Sohn Kurt, wegen fehlender Berufsausbildung, in Unna, an
einem Grundlehrgang für Metallarbeiter teilgenommen hat, der vom Arbeitsamt finanziert wurde. Am 11 Dezember 1969 sind
wir endlich an unserem vorläufigen Wohnsitz, im Durchgangswohnheim, an der Elisabethstraße 13, in Velbert angekommen.
Ab dem 5. Januar 1970 konnten meine Söhne, in der Zahnradfabrik Reining, in Velbert ihrer geregelten Arbeit nachgehen.
Von Bau- und Sparverein in Velbert wurde uns am 20. Juni 1970, unsere erste Wohnung zugewiesen.
Velbert im Februar 1972
gezeichnet: Gustav Rattay
In den nächsten Tagen habe ich einen Brief nach Hause geschrieben und mitgeteilt wo ich mich zurzeit befinde. Meine
Eltern schickten mir ein Paket mit Lebensmitteln, jetzt konnte ich essen was ich wollte. Das Essen im Lazarett war
nicht besonders, jeden Tag nur Kohlblätter. Der weg zu den Toiletten führte durch einen Gemüsegarten. Die gehfähigen
Kameraden haben den ganzen Kohlrabi aufgegessen, so dass schließlich Wachposten aufgestellt werden mussten. Sechs
Wochen lang konnte ich mich nur auf allen Vieren fortbewegen, denn sobald ich mich aufrichtete wurde es mir
schwindelig und ich musste zurück ins Bett.
Als ich wieder bei Kräften war habe ich meinen Eltern mitgeteilt das ich mich in ein Lazarett in ihrer Nähe verlegen
lassen will. Der Chefarzt hatte mir zugesichert, wenn die Möglichkeit besteht in Ortelsburg unterzukommen, wird er dem
zustimmen. Meine Mutter hat daraufhin, in Ortelsburg, beim Lazarettinspektor Zantopf nachgefragt und er hat angedeutet
das sie mich aufnehmen können. Daraufhin bekam ich die Krankenpapiere und einen Fahrschein nach Ortelsburg. Da ich als
Soldat nie Heimaturlaub hatte, beschloss ich zuerst meine Eltern zu besuchen. Ich fühlte mich noch sehr schwach, habe
nach jedem Kilometer Rast gemacht, aber letztendlich war ich wieder daheim bei meinen Eltern. Die Wiedersehensfreude
war sehr groß. Ich bin am 30 Juli verwundet worden und am gleichen Tag wurde mein ältester Bruder beerdigt. Er bekam
den Splitter einer Gasgranate ins rechte Bein und ist an einer Blutvergiftung verstorben.
Am nächsten Tag brachte mich mein Vater ins Garnisonslazarett nach Ortelsburg. Ich wurde jeden Tag gebadet und massiert,
weil die Rückenhaut am Knochen angewachsen war konnte ich mich nicht schmerzfrei bücken. In Ortelsburg verbrachte ich
noch sechs Wochen, bis Ende Oktober, da wurde es schon ziemlich kalt und in unserer Barackenunterkunft ziemlich
ungemütlich. Kohlen und anderes Brennmaterial lagen im Hof auf Halde, aber es war verboten zu heizen. Kameraden die in
der Nähe zu Hause waren konnten Sonntagsurlaub beantragen.
Einer von ihnen brachte von zuhause Brennholz mit und entzündete damit im Ofen ein wärmendes Feuer, andere holten vom
Hof Kohlen, so dass der Ofen in kurzer Zeit glühend heiß wurde und die Gefahr bestand das die Betten Feuer fangen
würden. Wir hatten die Betten schon weg gerückt, da kam der Feldwebel herein und fragte wer das Feuer im Ofen
angezündet hat, doch niemand fühlte sich angesprochen. Der Feldwebel hatte den Vorfall dem Stabsarzt gemeldet, als der
am nächsten Morgen zur Visite kam, war seine erste Frage: ”Wer hat gestern Abend das Feuer im Ofen angezündet”. Als
sich niemand meldete, schrie er uns an: ”Morgen wird alles entlassen, zum Ersatzbatallion, in Diez an der Lahn! Wer
gehen kann, sofort zur Schreibstube, Krankenpapiere und Fahrscheine abholen”. Er erinnerte uns noch daran am nächsten
Tag pünktlich am Bahnhof zu sein, weil eine Verspätung unangenehme Folgen für uns haben würde. Das war das Ende der
schönen Erholungsphase. Ich blieb noch eine Nacht zu Hause und bin dann am nächsten Tag von dort zum Bahnhof gegangen.
Am nächsten Tag brachte mich mein Vater ins Garnisonslazarett nach Ortelsburg. Ich wurde jeden Tag gebadet und massiert,
weil die Rückenhaut am Knochen angewachsen war konnte ich mich nicht schmerzfrei bücken. In Ortelsburg verbrachte ich
noch sechs Wochen, bis Ende Oktober, da wurde es schon ziemlich kalt und in unserer Barackenunterkunft ziemlich
ungemütlich. Kohlen und anderes Brennmaterial lagen im Hof auf Halde, aber es war verboten zu heizen. Kameraden die in
der Nähe zu Hause waren konnten Sonntagsurlaub beantragen.
Einer von ihnen brachte von zuhause Brennholz mit und entzündete damit im Ofen ein wärmendes Feuer, andere holten vom
Hof Kohlen, so dass der Ofen in kurzer Zeit glühend heiß wurde und die Gefahr bestand das die Betten Feuer fangen
würden. Wir hatten die Betten schon weg gerückt, da kam der Feldwebel herein und fragte wer das Feuer im Ofen
angezündet hat, doch niemand fühlte sich angesprochen. Der Feldwebel hatte den Vorfall dem Stabsarzt gemeldet, als der
am nächsten Morgen zur Visite kam, war seine erste Frage: ”Wer hat gestern Abend das Feuer im Ofen angezündet”. Als
sich niemand meldete, schrie er uns an: ”Morgen wird alles entlassen, zum Ersatzbatallion, in Diez an der Lahn! Wer
gehen kann, sofort zur Schreibstube, Krankenpapiere und Fahrscheine abholen”. Er erinnerte uns noch daran am nächsten
Tag pünktlich am Bahnhof zu sein, weil eine Verspätung unangenehme Folgen für uns haben würde. Das war das Ende der
schönen Erholungsphase. Ich blieb noch eine Nacht zu Hause und bin dann am nächsten Tag von dort zum Bahnhof gegangen.
Wieder Kriegsverwendungsfähig.
Als wir am nächsten Tag in Diez angekommen waren, wurde ich gefragt ob ich aus dem Heimaturlaub
käme, als ich das verneinte wurden mir 2 Tage genehmigt und 14 Tage Genesungsurlaub dazu. Wieder zurück im
Ersatzbatallion bestand unsere Tätigkeit aus Wache schieben und Kartoffel schälen. Nach einem Monat wurden wir von
einem Generalarzt untersucht, er hat mich für nicht einsatzfähig befunden weil ich noch den Steckschuss im Rücken
hatte und das linke Bein 10 Zentimeter dünner war. Jetzt fing das Kasernenleben wieder von vorne an. Wachdienst,
Gewehr laden, sichern, Ehrenbezeugung, Einzelmarsch und Appell. Wer nicht weit nach Hause hatte bekam zu Weihnachten
Urlaub. Ich hatte zu Heiligabend und Silvester Torwache, denn nach Ostpreußen wurde niemand beurlaubt.
Nach Neujahr 1918 wurden wir neu eingekleidet und kamen nach Köln zur Baukompanie. Mit Musik wurden wir zum Bahnhof
gebracht. In Köln wurden wir noch mit Soldaten die von andern Truppenteilen dorthin verlegt wurden in einem großen
Kinosaal, im Stadtteil Edengarten untergebracht. Wir brauchten keinen Dienst zu machen und konnten zu Heilige Drei
Könige den Gottesdienst im Dom besuchen. Kameraden die aus irgendwelchen Gründen im Arrest saßen wurden gefragt ob sie
auch am Gottesdienst teilnehmen möchten, dann würde ihnen die Strafe erlassen. Fast alle haben dem zugestimmt. Einige
Tage später wurden wir wieder auf einen Transportzug verladen, der uns über Herbestal, Antwerpen nach Brügge in Belgien
brachte. Hier mussten wir den Zug kurzfristig verlassen und einen Luftschutzkeller aufsuchen, weil Fliegeralarm
gemeldet wurde. Danach ging es wieder weiter nach Turut, Kortemark, Hauseme, Kautremollen, Zaren, Zarenlinde. Dort
wurden wir in verschiedene Gruppen aufgeteilt und einer Pionierkompanie auf dem Pionierpark Struwendorf zugewiesen.
Wir haben hinter Klerken Bunker für schwere Maschinengewehre gebaut. Unsere Arbeit konnten wir nur bei Nebel verrichten,
denn bei Sonnenschein waren wir sofort dem Beschuss der feindlichen Artillerie ausgesetzt. eine Kleinbahn die Munition
und Stacheldraht an die Front brachte war dem Beschuss besonders ausgesetzt. Die Gleise, von schweren Geschossen
zerfetzt, mussten immer wieder hergerichtet werden, damit der Nachschub aufrechterhalten werden konnte. Später haben
wir am Kemelberg bei Armentier, eine Brücke über die Lys gebaut. Um in dem Sumpfgelände einen Untergrund dafür zu
schaffen, mussten wir 10 bis 12 Meter lange Pfähle in den Boden rammen. Ein Feldwebel gab immer den Befehl: „Hoch den
Bär, noch viel mehr, dass man sieht, wie er zieht, denn dieser Pfahl, glatt wie ein Aal, durch Fels und Stein, durch
Wasser und Sand, fürs Vaterland”. Jedes mal mussten wir den Bär an Schnüren hochziehen und dann wieder herunterlassen.
Wenn es manchmal, trotz vieler Mühe nicht mehr weiter ging wurde der Pfahl auf eine bestimmte Länge abgeschnitten.
Nach Fertigstellung der Brücke kamen wir in die Siegfriedstellung bei Kambrei, zum Bau eines Bataillons-Gefechtstandes.
Da der Boden kreidehaltig war, mussten wir die großen Stücke von Hand zu Hand reichen, den Schutt haben wir dann mit
Sandsäcken aus der Baugrube gehoben und mit Ästen getarnt, damit der Stand nicht von feindlichen Fliegern entdeckt
werden konnte. Alle acht Stunden wechselte die Arbeitsgruppe. Wir mussten von der Baustelle durch das Gelände robben,
denn aufrecht gehend war man dem Beschuss der feindlichen Scharfschützen ausgesetzt, die von einem Fesselballon aus
informiert wurden der über den feindlichen Linien stand.
Der Wechsel war mit einem großen Risiko verbunden, und wurde wenn Möglich bei Dunkelheit vollzogen. Um vor
Überraschungen sicher zu sein haben wir spanische Reiter (Stacheldrahtverhaue) gebaut und vor die ersten Gräben
gestellt, die dann oft in der Nacht von den Franzosen geklaut, und dann vor ihren eigenen Linien wieder aufbaut wurden.
Wir hatten aus Bohlen eine Brücke auf Rädern gebaut, die dann in den Graben geschoben wurde, damit die Artillerie und
andere Fahrzeuge über die Schützengräben kamen. Weil um vier Uhr morgens der Beschuss mit Gasgranaten begann, mussten
wir Gasmasken aufsetzen, danach haben feindliche Flieger unsere Munitionskolonne bombardiert und total aufgerieben.
Es wurde auch eine Marinedivision eingesetzt, die bis dahin dem Küstenschutz gedient hatte und jetzt ihren ersten
Einsatz hatte.
Wir sind zuerst ein ganzes Stück in Richtung Amiens vorangekommen, doch dann blieb unser Angriff in den zuvor von
Engländern besetzten Stellungen, stecken. Da die Engländer ihre Stellungen fluchtartig verlassen hatten, fiel ihr
ganzer Proviant in unsere Hände; Schokolade, Weißbrot, Flaschenwein. Die erste Nacht haben wir in einem runden Zelt
verbracht, weil ich mir durch den starken Wind, der da herrschte eine Angina zugezogen hatte, die mit hohem Fieber
verbunden war, konnte ich die vielen Köstlichkeiten überhaupt nicht genießen.
An eine ärztliche Versorgung war überhaupt nicht zu denken, denn es mussten zuerst die vielen Granatlöcher eingeebnet
werden damit die vielen Fahrzeuge und Geschütze wieder weiter fahren konnten. Auch eine Bahnlinie musste repariert
werden, damit die großen Geschütze in Stellung gebracht werden konnten, dabei wurden auch die vielen Kriegsgefangenen,
die bei dieser Offensive gemacht wurden, eingesetzt. Als die Offensive dann schließlich scheiterte, wurden wir an die
Somme verlegt. Da habe ich die Ortelsburger Jäger, die aus Italien an die Westfront verlegt wurden, zum ersten Mal im
Einsatz gesehen.
Unser nächster Einsatzort waren dann Stellungen hinter Laon. Hier wurden die Vorbereitungen zu einer neuen Offensive
getroffen. Feindliche Flieger versuchten uns Tag und Nacht daran zu hindern die Aufmarschwege instand zu halten. Als
die Offensive dann endlich losging, hatten wir die Order eine Brücke über die Oise mit Bohlen und Balken zu verstärken.
Gleich am Anfang der Offensive mussten wir Gasmasken anlegen, um für alle Fälle gewappnet zu sein. Nur die Artillerie
und Kraftfahrzeuge durften die Landstraße benutzen, die Infanterie ging immer im Straßengraben und wurde von einer
Seite von Kopf bis Fuß mit Dreck bespritzt. Die Franzosen und Engländer haben hier schon Panzer eingesetzt, die von
Truppen aus den Kolonien gefahren wurden. Die Australier gingen mit umgekrempelten Ärmeln hinter den Panzern her.
Die letzte Offensive des Ersten Weltkrieges.
Zum Jahresende 1917 hatten noch 153 deutsche 175 alliierten Divisionen gegenübergestanden.
Zur Vorbereitung der Offensive ließ Ludendorff 39 Divisionen aus dem Osten und aus Italien heranziehen. Er ließ
spezielle Angriffsdivisionen formieren, die durch intensive Ausbildung auf den beabsichtigten, schnellen Vormarsch
vorbereitet wurden. 6608 Geschütze, 3500 Minenwerfer und 1070 Flugzeuge wurden hinter dem vorgesehenen
Angriffsabschnitt konzentriert. Den Ausbildungsbefehlen Ludendorffs, die bis zu den Kompanieführern herab verteilt
wurden, konnte man entnehmen, dass der Versuch, den Krieg mit einem mächtigen Schlag zu entscheiden schon in der
nächsten Zeit gewagt werden sollte. Wir übten die fast vergessenen Formen des Schützengefechts und des
Bewegungskrieges, auch wurde eifrig mit Gewehr und Maschinengewehr geschossen. Wir hegten keinen Zweifel daran, dass
der große Plan gelingen würde.
Den ganzen Winter 1917/18 über plante der Generalquartiermeister Ludendorff die deutsche Offensive. Zwar hatten die
Vereinigten Staaten von Amerika dem Deutschen Reich am 6. April 1917 den Krieg erklärt, aber vor dem Sommer des
Jahres 1918 war mit dem Auftreten von US-Truppen in relevanter Größenordnung nicht zu rechnen. Der deutschen Führung
blieb nur ein schmales Zeitfenster, um die Niederlage und den zu erwartenden Diktatfrieden abzuwenden. Ypern,
Armentieres, Arras, Cambrai oder Verdun wurden ernsthaft als Schauplätze erwogen. Ludendorf entschied sich für einen
Angriff zwischen Cambrai und La Fere – genau an der Nahtstelle zwischen der Französischen Armee und dem britischen
Expeditionscorps.
Der Fluss Somme bildete die Grenze zwischen Franzosen und Briten. Die Briten – nicht die Franzosen – sollten das Ziel
des Vorstoßes werden. Ihre Stellungen waren nur 130 Kilometer von der Kanalküste entfernt. Beim erreichen der
Sommemündung wäre die gesamte britische Armee eingeschlossen gewesen, denn hinter ihnen lag die Straße von Dover.
Am 21. März 1918 begann die letzte entscheidende Offensive des deutschen Westheeres im Ersten Weltkrieg. Der
Angriffsstreifen war 75 Kilometer breit. Dort hatte Ludendorff 43 Angriffsdivisionen konzentriert, dahinter 30
weitere Reservedivisionen, ihnen standen lediglich 26 britische Divisionen gegenüber. „Michael“ – so der Deckname der
„Kaiserschlacht“ – lief dank Ludendorffs akribischer Vorbereitung gut an. Der britische Oberbefehlshaber General
Douglas Haig erkannte die Chance, welche die Deutschen in dieser Situation hatten. Wollten die Deutschen diese Chance
nutzen, mussten sie darauf verzichten die Somme zu überschreiten, wo sie auf die französischen Reserven treffen und
sich von der Küste entfernen würden. Genau diesen Fehler begingen jedoch die Deutschen.
Am dritten Tag überschritt der linke Flügel mit der 18. Armee die Somme. Ludendorf stellte die Taktik über die
Strategie, wie er das bei Tannenberg und der Schlacht an den Masurischen Seen auch schon getan hatte. Ludendorffs
Befehl an die 18. Armee vom Abend des 22. März 1918 lautete: „Jetzt gilt es den Sieg auszunutzen, den Feind nicht zum
Stehen kommen zu lassen, Somme und Crozat-Kanal zu überschreiten, bevor feindliche Verstärkungen wirksam werden“.
Was Haig befürchtet hatte, trat nicht ein. Die deutsche Offensive Lief weiter Richtung Süden und lief sich schließlich
tot. Am 31 März war Ludendorff zu der Erkenntnis gekommen, dass „Michael“ gescheitert war. Am 5. April wurde die
Einstellung der Offensive befohlen. Im Hochsommer waren die US-Truppen in Frankreich angekommen und gingen mit den
Franzosen zum Angriff vor. Nur mühsam konnten Hindenburg und Ludendorf den Zusammenhalt der Front waren. Am 24. Oktober
1918 forderte US-Präsident Woodrow Wilson die bedingungslose Kapitulation, am 11.Nuvember Wurde der Waffenstillstand
von Compiegne unterzeichnet.
Zusammenbruch der Westfront und Waffenstillstand .
Als die Offensive dann letztendlich gescheitert war, wurden wir auf Eisenbahnwaggon verladen, in
eine Stellung vor Verdun gebracht und der siebenten bayerischen Division zugeteilt. Als wir ausgeladen wurden nahm der
Franzose den Bahnhof unter Beschuss. Eine Granate traf einen Waggon der mit Seifenpulver beladen war, so dass der ganze
Bahnhof aussah als wäre gerade Neuschnee gefallen. Wir gingen auf die Suche nach Kartoffeln. Als ich mit einem Sack,
vollbeladen die Böschung runter ging um zur Feldküche zu gelangen, schlug unweit von mir eine Granate ein und riss mir
den Sack vom Rücken. Ich bin mit dem Schrecken davon gekommen, mir war nichts passiert.
Der Bahnhof war menschenleer, nur ein par Kaninchen liefen verschreckt durch die Gegend und einigen Kameraden gelang
es welche einzufangen. Am nächsten Tag gelang es uns endlich die Feldküche zu erreichen. Als wir gerade beim Essen
fassen waren, schlug unweit eine Granate ein so dass Pflastersteine das Dach durchschlugen und wir das Weite suchen
mussten. und wir wieder nichts zu Essen bekamen. Ein Friseur aus unserer Kompanie fuhr immer ins Hinterland um uns
mit Proviant zu versorgen. Als er 14 Tage vor dem Zusammenbruch wieder mal zurückkam erzählte er uns schon das der
Krieg nicht mehr lange dauern würde, weil Kaiser Wilhelm mit Frack und Zylinder bekleidet, Deutschland verlassen und
ins Ausland gehen würde. In unserer Einheit hatten wir auch einen Juden der glaubte dass er sich alles erlauben darf.
Eines Morgens ging er in die Küche, als er keinen Koch vorfand stieg er auf die Gulaschkanone und hob den Deckel vom
Kessel in dem der Kaffee kochte an. Der kochende Kaffee verbrühte seine Füße so sehr das er sofort ins Lazarett musste,
für ihn war der Krieg somit zuende. Es kam noch ein Erlass, das Kameraden die 2 Jahre aktiv gedient hatten und
Gefreiter waren sofort zum Sergeanten befördert wurden. Für den 11. November 1918 war ein Waffenstillstand vereinbart
und ab 11 Uhr sollte nicht mehr geschossen werden. Wir hatten unsere Kopfkissen aufgetrennt und eine Kissenschlacht
veranstaltet, um auf diese Art und Weise unserer Freude Ausdruck zu verleihen. Als die Federn durch die Luft flogen
brachen wir in Tränen aus.
In jeder Kompanie wurde ein Soldatenrat gewählt, der aus drei Mann bestand. Wenn der Kompanieführer jemanden bestrafen
wollte, musste er erst den Soldatenrat fragen, der die Strafe befürworten, aber auch ablehnen konnte. Die Offiziere
durften keine Achselstücke mehr tragen, was für sie einer Degradierung gleich kam. Wir waren in einem Dorf
einquartiert und morgens zum Appell angetreten, als einer vom Soldatenrat sich stockbesoffen vor den auf dem Pferd
sitzenden Kompanieführer stellte und schrie: „Alles hört auf mein Kommando”. Der Kompaniechef war wie vom Blitz
getroffen, ihm versagte die Stimme. Wir sahen ein das dies nicht so weiter gehen kann und wählten einen neuen
Soldatenrat. Unser Rückzug begann bei Konflanz, einer Vorfestung von Metz und führte uns zunächst über die
luxemburgische Grenze, wo wir in einem Ort einquartiert wurden. Als wir für die Küche Holz aus dem Wald holen gingen,
entschieden wir uns eine Eiche abzusägen, ohne uns dessen bewusst zu sein, in welchem Forst wir uns befanden. Als wir
beim fällen waren fielen plötzlich Schüsse, die wir auch sofort erwiderten, bis uns ein Elsässer der sich in unserer
Kompanie befand aufklärte: „Kameraden, wir befinden uns hier auf Luxemburgischem Hoheitsgebiet”.
Wir sind dann weiter durch das Fürstentum Birkenfeld marschiert, wo das Städtchen Merzig für uns geflaggt hatte. Das
Elsass haben wir auch noch kurz gestreift. Wo wir bei einem Bauern, der uns kein Stroh für das Nachtlager geben wollte,
einquartiert wurden. Daraufhin gingen wir in die Scheune und haben uns selbst was besorgt. Wir haben dann noch erfahren,
sie hätten ein Schwein geschlachtet und warteten auf den Einzug der Franzosen. Als wir uns 1917, an der Ostfront, in
den in Karpaten, im Einsatz befanden, waren unter uns auch viele Elsässer. Sie durften ihre Heimatpost nicht in
französischer Sprache schreiben, mussten ihre Briefe offen auf der Schreibstube abgeben, wo sie zuerst kontrolliert
und dann abgeschickt wurden. Als ich in einer Nacht, mit einem Elsässer auf einem Vorposten Wache schieben musste,
wollte er mich überreden zum Russen überzulaufen. Als ich darauf nicht eingehen wollte verschwand er plötzlich in der
Dunkelheit und ich habe ihn nie wieder gesehen.
Wir sind dann weiter Richtung Worms und Ludwighafen gezogen, dort wurden wir bei einem Mühlenbesitzer einquartiert,
ein Unteroffizier und vier Mann. Obwohl wir verlaust und verdreckt waren bestand die Müllerin darauf das wir in ihren
Betten übernachteten. „Wenn alles durch ist”, sagte sie, „werde ich alles gründlich reinigen”. Der Müller brachte uns
eine Gießkanne voll Wein und sagte wir sollen es uns Schmecken lassen. Wir haben reichlich davon Gebrauch gemacht, so
dass ich gar nicht weiß wie ich ins Bett kam. Das war meine Erinnerung an die Pfalz. Manchmal waren wir auch 2 Tage im
Quartier.
Vor dem Weitemarsch wurde uns immer gesagt welche Truppe die Vorhut und welche Truppe die Nachhut übernehmen sollte.
Die Nachhut hielt immer Verbindung zu den nachrückenden Franzosen und man muss staunen wie alles reibungslos, ohne
Zwischenfälle von statten ging, was wir in erster Linie dem General-Feldmarschall Paul von Hindenburg zu verdanken
haben, der den Rückzug an der Westfront koordiniert hat.
In Köln angekommen, erhielten wir im Volkshaus unsere Entlassungspapiere, Eisenbahnfahrscheine, Reisepässe,
unterschrieben von Oberstleutnant Mann. Wir mussten Köln umgehend verlassen, weil schon am nächsten Tag die
französischen Besatzungstruppen in einmarschieren sollten. Wir fuhren mit einem Zug der bis Allenstein fuhr, dort
wurden unsere Papiere vom Soldatenrat kontrolliert. Die jüngren Jahrgänge wurden festgehalten, zu neuen Einheiten
zusammengestellt und zur Sicherung der Ostgrenze gegen die Bolschewisten abkommandiert. Ich hatte gesagt das ich noch
einen Schrapnellsplitter in der Kreuzbeingegend habe und durfte daraufhin nach Hause fahren.
Kaum in Ortelsburg angekommen fiel ich wieder dem Soldatenrat in die Hände. Sie haben alles durchsucht, haben mir mein
Seitengewehr und eine Decke abgenommen, aber ich durfte weiter und bin dann kurz vor Weihnachten 1918 auf dem
elterlichen Hof angekommen. Schon auf dem Hof habe ich meine Kleider vom Leib gerissen, weil vor Läusen und anderem
Ungeziefer nicht mehr aushalten konnte und mich erst gründlich gewaschen bevor ich das elterliche Haus betreten habe.
Die Freude über das Wiedersehen war sehr groß.
“ Unser Leben zwischen den beiden Weltkriegen.”
Endlich wieder zurück in der Heimat
Rohmanen war durch die Kampfhandlungen 1914/15 zu einem drittel zerstört worden, aber schon
wieder im Aufbau. Die Firma Grzella aus Ortelsburg hatte die Bauarbeiten übernommen. Unter der Aufsicht von Polier
Karl Kontor wurden die Dachstühle errichtet. Ich habe mich, nach kurzer Erholungspause, auch als Zimmermanngehilfe am
Wiederaufbau beteiligt. Die Firma Grzella hat das Material geliefert und auch unsere Löhne gezahlt. Wegen meinem
Steckschuss bin ich dem VDK beigetreten und habe mit dessen Hilfe eine Rente beantragt die mir auch bewilligt wurde.
Nach vier Jahren wurde ich nach Allenstein zur Nachuntersuchung vorgeladen. Die ärztliche Untersuchung hatte ergeben,
das Geschoß sei verkapselt, und nur das linke Bein etwas in Mitleidenschaft gezogen. Daraufhin wurde die Rentenzahlung
eingestellt.
Der Stellmacher Adam Ornowski war im Krieg als Sanitäter eingesetzt und hatte auf Grund seiner Erfahrungen,
 Beziehungen zum medizinischen Dienst in Ortelsburg aufgebaut. Es wurden dort Lehrgänge in Erster Hilfe angeboten,
die von Prof. Dr. Kutz geleitet wurden. Adam Ornowski hat dafür gesorgt das einige junge Männer aus Rohmanen daran
teilnehmen konnten. Adam Ornowski, August Linka, Emil Rosowski, Johann Dembek, Emil Baschek und ich sind dann dem
Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes beigetreten und mussten jeden Sonntag am Lehrgang teilnehmen. Unser
Gruppenführer war Kreisobersekretär Albrecht, Landrat von Poser, als unser Ehrenvorsitzender, hat viel zu unserer
finanziellen Unterstützung beigetragen und hat dafür gesorgt dass die Bereitschaft eingekleidet wurde.
Beziehungen zum medizinischen Dienst in Ortelsburg aufgebaut. Es wurden dort Lehrgänge in Erster Hilfe angeboten,
die von Prof. Dr. Kutz geleitet wurden. Adam Ornowski hat dafür gesorgt das einige junge Männer aus Rohmanen daran
teilnehmen konnten. Adam Ornowski, August Linka, Emil Rosowski, Johann Dembek, Emil Baschek und ich sind dann dem
Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes beigetreten und mussten jeden Sonntag am Lehrgang teilnehmen. Unser
Gruppenführer war Kreisobersekretär Albrecht, Landrat von Poser, als unser Ehrenvorsitzender, hat viel zu unserer
finanziellen Unterstützung beigetragen und hat dafür gesorgt dass die Bereitschaft eingekleidet wurde.
In jedem Dorf wurde eine Unfallstelle eingerichtet, mit einem Verbandskasten und mit Verbandsmaterial für die erste
Hilfe ausgerüstet. Die Unfallstelle in Rohmanen, die am Haus von der Straßenseite, durch eine Tafel mit einem roten
Kreuz gekennzeichnet war, hatte ich zu verantworten. An Sonntagen wurden wir an Badestellen und bei Fußballspielen
eingesetzt, haben viele Übungen bei Waldbränden durchgeführt und auch Ausflüge nach Rudzany am Niedersee gemacht. Bei
der Einweihung des Tannenbergdenkmals in der Nähe von Hohenstein kamen wir an Straßenkreuzungen zum Einsatz.
Rohmanen hatte auch eine freiwillige Feuerwehr. Bis zum ersten Weltkrieg hat Friedrich Biella als Brandmeister das
Kommando gehabt. Er war aktiver Unteroffizier, hatte gute Führungsqualitäten und die Männer, die allesamt aus dem
aktiven Militärdienst stammten hatten zu ihm ein großes Vertrauen. Nach dem Krieg wollten diese Männer,
(Friedrich Nickel, Friedrich Willam, Julius Wittkowski, Jakob Janowski, Johann Gloddek, Gustav Bednarz), nicht mehr
weitermachen. Friedrich Biella, der inzwischen zum Gemeindevorsteher gewählt wurde, hat sich dann auf einer
Gemeinderatsitzung vorgeschlagen, für die Freiwillige Feuerwehr jüngere Kräfte anzuwerben.
Zum Brandmeister hat er Herrn Wilhelm Pilath vorgeschlagen. Der wurde dann nach Königsberg zur Fortbildung geschickt.
Der Feuerwehr gehörten nun folgende Personen an: Wilhelm Pilath(Brandmeister), August Linka(Stellvertreter), Gustav
Deptolla, Julius Matzey, Johann Dembek, Willy Willam, Gustav Rattay. Der Kreisbrandmeister war Heinrich Thalmann aus
Ortelsburg, sein Stellvertreter war Kreisobersekretär Salzmann. Der Bezirks-Kommissar bei der Ostpreußischen
Feuersozität War Herr Ernst Trzaska. Er hat dafür gesorgt das die Wehr uniformiert und mit Löschgeräten ausgerüstet
wurde. Da die alten Schläuche schon sehr marode waren, wurden sie durch moderne ersetzt, deren Kupplungen auch mit der
Motorspritze übereinstimmten.
Ernst Trzaska hat bei der Feuersozität und beim Landratsamt Finanzmittel beantragt und auch genehmigt bekommen. Der
Schneidermeister Wilhelm Baran wurde beauftragt Tuch und Drillichanzüge nach Maas zu schneidern. Er hat uns
Stoffmuster vorgelegt aus denen wir wählen sollten. Feuerwehrhelme haben wir auch bekommen. Die Gemeinde musste
Finanzmittel bereitstellen, einen Prozentsatz vom Gemeindebudget. Im Brandfall mussten für den Spritzenwagen Pferde
zur Verfügung stehen, von Willy Willam, Gustav Rattay, Julius Matzey und Gustav Dorka, weil sie in der Nähe des
Spritzenhauses wohnten. Am Spritzenhaus wurde ein großer Baum mit Querleisten aufgestellt, wo nach jedem Brand oder
einer größeren Übung die Schläuche zum trocknen aufgehängt wurden.
Der Kreisbrandmeister hat mindestens 2-3-mal im Jahr die Wehren besichtigt. Das ganze Dorf war dann auf den Beinen,
die Bauern mit Pferden, und andere Dorfbewohner mit Eimern und Spaten, wurden dann in verschiedene Gruppen eingeteilt.
Erst hat die Wehr sämtliche Aufstellungen am Gerät geübt; Grundstellung Fahrstellung und Marschstellung. Dann wurde
ein Brand angekündigt, die Feuerwehr mit der Spritze an den Brunnen, die Gruppen dort wohin sie beordert wurden, die
Bauern brachten mit den Wasserkiwen Wasser aus dem Brunnen zum Brandort. Wenn das Wasser im Brunnen alle wurde hat
man den Saugkorb in die Kiewen gelegt und dort Wasser entnommen. Die Wassergruppe ging mit Eimern zum Dorfteich, holte
Wasser und füllte damit die leeren Kiewen.
Der Löschtrupp ging mit Feuerhaken und Löschpatschen auf die umliegenden Gehöfte und versuchte das vermeintliche Feuer
von ihnen fernzuhalten. Nach dem Alarm wurde wieder am Spritzenhaus angetreten. Die Gruppenführer mussten angeben ob
ihre Gruppe auch vollständig erschienen war, denn Übungen wurden nur vor, oder nach der Feldarbeit durchgeführt, so
dass niemand eine Entschuldigung vorbringen konnte. Wer ohne begründete Entschuldigung nicht anwesend war erhielt eine
Verwarnung. Der Kreisbrandmeister erklärte dann welche Handgriffe den Vorschriften entsprachen und welche nicht. Die
Schläuche wurden noch schnell zum Trocknen aufgehängt. Anschließend gingen wir alle in den Gasthof Trzaska, haben über
vorhandene Mängel diskutiert, Verbesserungsvorschläge unterbreitet und zwischendurch den Durst gelöscht. Der
Kreisbrandmeister ist dann, nach einer kurzen Verabschiedung, ins nächste Dorf gefahren, weil er an einem Tag mehrere
Feuerwehren betreuen musste.
Der Rohmaner Dorffriedhof

Einen Kilometer vom Ende des Dorfes entfernt, auf der rechten Seite der Landstraße in Richtung
Ortelsburg, befand sich der Rohmaner Dorffriedhof. Wann dieser Friedhof angelegt wurde entzieht sich meiner Kenntnis.
Nach Aussagen älterer Dorfbewohner soll davor auch schon eine Ruhestätte vorhanden gewesen sein, und
zwar auf der linken Straßenseite gegenüber dem jetzigen Friedhof. An dieser Stelle befand sich bis in die
Nachkriegszeit ein kleiner Brunnen, aus dem die Dorfbewohner, das Wasser zum begießen der Grabbepflanzung auf den
Gräbern ihrer verstorbenen Angehörigen holten. Der Friedhof war in einer Hanglage angelegt, wahrscheinlich weil diese
Parzelle für eine landwirtschaftliche Nutzung nicht geeignet war. Um das Gräberfeld vor herumstreunenden Tieren oder
von der Weide entlaufenen Kühen zu schützen, hat man das ganze Gelände mit einem Holzzaun umgeben. Der Zugang befand
sich von der Straßenseite. Unter einem Torbogen hindurch wurden die Verstorbenen zu Grabe getragen. Die Gräber der
einzelnen Familien waren nebeneinander angelegt, mache, wie zum Beispiel die der Familie Trzaska, sogar mit einem
schmiedeeisernen Zaun eingefasst.
Nach dem 2. Weltkrieg verfiel der Friedhof immer mehr. Die nötigen Finanzmittel für die Pflege der Einfriedung konnten
von den restlichen noch verbliebenen Deutschen nicht mehr aufgebracht werden. An den gepflegten Gräbern konnte man noch
erkennen dass es Verwandte von noch in Rohmanen wohnenden Deutschen waren, oder von bereits im Westen Deutschlands
lebenden, die ihre noch in Rohmanen wohnenden Nachbarn damit beauftragt hatten. Die übrigen Gräber wurden von Jahr zu
Jahr immer mehr von Wildkräutern überwuchert und schließlich auch von Sträuchern und schnell wachsenden Bäumen.
In den späteren Jahren konnte man nicht mehr erkennen dass dort vor Jahren Tote zur letzten Ruhe gebettet wurden. Die
Natur holte sich das ganze Gelände zurück und nur unter großen Schwierigkeiten konnten Besucher aus dem Westen das
Friedhofsgelände noch betreten.
Das Gasthaus Trzaska

Nach dem ersten Weltkrieg hat der Gastwirt Friedrich Trzaska neben dem Gasthof einen großen Saal
für Festlichkeiten und Vereinsfeiern gebaut, in dem schon mal Feuerwehrfeste veranstaltet wurden. Ernst Trzaska war
Feuerkommissar bei der Ostpreußischen Feuersozität. Erich Trzaska war Vollziehungsbeamter beim Amtsgericht in
Ortelsburg. Unser Feuerkommissar war uns beim organisieren der Veranstaltungen sehr behilflich, hat uns den Saal, die
Musik und die Theaterstücke besorgt und die Feuerwehren aus den Nachbardörfern eingeladen.
Zu Manöverzeiten, vor dem 2. Weltkrieg und dann auch während des Krieges, waren im Gasthof Soldaten, meist im Range
eines Offiziers, einquartiert. Fräulein Mariechen Trzaska hat die Poststelle im Dorf betreut. Nachdem ich 1939 zum
Militär eingezogen wurde, hat sie, nach einer Schulung im Ortelsburger Krankenhaus, auch die Unfallmeldestelle
übernommen. Nach dem Krieg, pflegte sie mit vielen Bekannten, die bereits in der Bundesrepublik wohnten, einen regen
Briefwechsel. Auf dem Rohmaner Friedhof hat sie viele Gräber, im Auftrag von Angehörigen, die auf Grund ihrer
Abwesenheit, dazu nicht mehr in der Lage waren, gepflegt. Der Bauunternehmer Kurnitzki aus Ortelsburg, äußerte die
Bitte, sie möchte ihm doch ein Blatt vom Rosenstrauch, der auf dem Grab seiner Eltern steht, in den Brief legen. Als
sie uns den Brief vorgelesen hat, waren wir zu Tränen Gerührt. Sie hat als Letzte aus ihrer Familie, bis zu ihrem Tod
im Jahre 1960, in Rohmanen, im Gebäude der Gastwirtschaft gewohnt und ist auf dem Rohmaner Friedhof beerdigt worden.
Fleisch und Wurstwaren Karl Pelkowski
Im Jahr 1931 hat der Fleischermeister Karl Pelkowski, aus Grammen, direkt neben unserem Hof ein
Anwesen gekauft und dort eine Fleischerei eingerichtet. Er war mit meiner Schwester Frieda, verheiratet. Am Anfang hat
er die Schweine noch auf seinem Hof geschlachtet, später dann im Ortelsburger Schlachthof. Jede Woche fuhr er 2-mal,
mit dem Pferdewagen(Einspänner), nach Ortelsburg zum Wochenmarkt, wo er seine Fleisch und Wurstwaren zu Verkauf anbot.
Am Tag davor, wenn er die Wurst gekocht hat, kamen viele Rohmaner mit Kannen oder anderen Gefäßen, wegen der guten
Wurstsuppe, die er umsonst unter die Leute verteilte. Als Karl Pelkowski, Ende August 1939 zum Militär eingezogen
wurde, hat seine Frau das Pferd verkauft und den Beitrieb stillgelegt. Am Haus hing, immer noch die Tafel mit der
Aufschrift: Karl Pelkowski, Fleisch und Wurstwaren. Ein Witzbold hat irgendwann darunter geschrieben; „Fleisch und
Wurst waren einmal”, drauf hin hat Frau Pelkowski die Tafel entfernen lassen. Karl Pelkowski ist im Mai 1946 in
französischer Gefangenschaft verstorben. Seine Ehefrau Frieda, verstarb an ihrem 85. Geburtstag in Mettmann bei
Düsseldorf.
Die steinreichen Rohmaner Felder
Die letzte Eiszeit hat bei der Schmelze, auf der Rohmaner Feldgemarkung viele Steine und
Granitblöcke zurück gelassen. Überirdisch, aber besonders unter der Erde, gab es viele kleine, aber auch große Steine,
die, den Bauern, beim Pflügen und anderen Feldarbeiten sehr viel Schweiß, abverlangten. In einer Kiesgrube, auf dem
Feld des Bauern August Radek, lag ein Granitblock, von schätzungsweise 100 cbm. Vor etwa 80 Jahren, als man für diese
Steine noch keine Verwendung hatte, griffen die Bauern zu einer „List”. Weil er sonst nicht pflügen konnte, hat mancher
seinem Nachbarn, die Steine in der Nacht auf dessen Feld abgeladen. Als diese Tätigkeit unter Strafe gestellt wurde,
hat man die Steine in Schluchten gekippt und mit Mutterboden zugeschüttet. In späteren Jahren kam diese jedoch beim
pflügen wieder an die Oberfläche. Dann hat man aber schon Steine für den Straßenbau gebraucht und konnte sie so zu Geld
machen. Besonders im Raum südlich von Ortelsburg, bis zur polnischen Grenze, wo Steine eine Rarität waren, kamen sie
jetzt zum Einsatz. Auch beim Bau von Häusern, besonders für die Fundamente, wurden sie eingesetzt, weil auf diese
Weise viel Ziegeln eingespart wurden. Die Firma Gribienski aus Ortelsburg hat die großen Steine mit Dynamit gesprengt
und auf diese Weise die weitere Verarbeitung erleichtert.
Die Steine welche beim Pflügen aus dem Boden geholt wurden, hat man am Feldrand auf große Haufen zusammen getragen.
Wenn die Feldarbeit beendet war, sowie auch in den Wintermonaten, waren wir jeden Tag mit Steinen unterwegs. Wir sind
vorwiegend am Abend los gefahren, weil unter der schweren Last die Wagenachsen so heiß wurden und die Gefahr bestand,
das durch die Dehnung, die Räder blockiert würden. Bei einer Fahrt konnte man bis zu 24 Reichsmark verdienen, wogegen
1 Zentner Roggen für 8 bis 9 Reichsmark zu haben war. Ich bin selbst, mit dem Pferdewagen bis Fürstenwalde, Radostowen,
Luka, Altkirchen, Höhenwerder, ja sogar bis Friedrichshof gefahren.
In Rohmanen wurden auch rote Ziegeln gebrannt. Viele Häuser wurden, mit Ziegeln erbaut, die nur wenige 100 Meter von
der Baustelle entfernt hergestellt wurden. Der Lehn wurde auf den Feldern in der näheren Umgebung entnommen, dann von
Ochsen solange getreten, bis er so geschmeidig war, das er sich in Formen einstreichen ließ. Wenn die Ziegel in der
Form trocken war, wurde sie entnommen und in einem Brennofen gestapelt. Um einen Ofen richtig anzufeuern, brauchte man
12 Raummeter Holz, das im Zeitraum von ein par Tagen verheizt wurde. Der Fischer Karl Glitza hatte schon eine
Knetmaschine, die von einem Pferd angetrieben wurde, das mit verbundenen Augen, den ganzen Tag in die Runde ging.
Im Dorf waren auch vier Kalköfen, in denen so genannte Kalksteine, die sich an gewissen Stellen, im Erdboden befanden,
gebrannt wurden. Nach dem Brennen wurden die Steine mit Wasser abgelöscht und die daraus entstandne Masse diente, nach
dem Beimischen einer gewissen Menge Sand, dann als Bindemittel beim Häuserbau. Das Gerichtsgebäude und das
Lehrerseminar in Ortelsburg wurden mit Kalk, aus dem Rohmaner Brennöfen erbaut. Auch zum Bau einer Eisenbahnbrücke, auf
der, der Zug, den Sawitzfluß, von Ortelsburg nach Allenstein überquerte, hat mein Großvater, mit einem Ochsengespann,
Kalk gefahren.
Hinter der Scheune, beim Bauern Johann Dembek hat man Tonerde gefördert, aus der man mit Hilfe einer Formerscheibe,
die von einem Arbeiter mit Muskelkraft(Fußbetrieb) angetrieben wurde, schöne Krüge, Schalen und Vasen geformt hat.
Die Töpferware wurde, nachdem sie trocken genug war, auch in einem Ofen gebrannt, anschließend mit einer Lasur
überzogen und wieder gebrannt. Es wurden auch Kacheln zum Bau von Kachelöfen hergestellt, die mit verschiedenen
Ornamenten versehen, die Wohnstuben unserer Vorfahren schmückten. So haben unsere Großväter ihr Leben gemeistert und
nach und nach, unsere Dörfer aus der Rückständigkeit in die Neuzeit geführt.
Das gesellschaftliche Leben nach dem 1. Weltkrieg

Als der Lehrer Alfred Dorka, ein Frontkämpfer des Ersten Weltkrieges und ein Sportsmann, als
zweite Lehrkraft an der Rohmaner Schule angestellt wurde, hat er die Sitten und Gebräuche aus früherer Zeit wieder zum
Leben erweckt. Zuerst hat er die Jugend zusammen gerufen, einen Jugendverein und einen Fußballclub, gegründet. Zum
Vorsitzenden des Fußballclubs wurde Johann Gloddek berufen, der ihn auch geleitet hat. Bauer Wilhelm Spittka, der am
Rohmaner See wohnte, stellte Land für einen Sportplatz unentgeltlich zur Verfügung. Lehrer Alfred Dorka hat am
Rohmaner See eine Badestelle ausgesucht und ein Sprungbrett bauen lassen. An jedem Sonnabend im Sommer, bevor die
Sonne unterging, versammelte sich die gestammte Jugend des Dorfes an der Badestelle am See. Es wurde gebadet,
Heimatlieder gesungen, gespielt, im Fackelschein eines großen Biwakfeuers, bis in die späte Nacht hinein. Der Fischer
Karl Glitza hat uns Kähne zur Verfügung gestellt, mit denen wir auf den See hinausgepaddelt sind, dabei hatten wir viel
Spaß, was wiederum den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft gefördert hat. Ich habe mit meiner Mandoline den Gesang von
Volks- und Heimatliedern begleitet.
Der Rohmaner See liegt in einem Tal, dessen Hänge zu beiden Seiten mit Kiefern und Tannen bewaldet sind. Wenn man
gesungen oder Musiziert hat, hallte es von den Hängen zurück. Die Ufer waren mit Kalmus und Schilf bewachsen, was für
die Fischaufzucht von Vorteil war. Wenn man an einem sonnigen, windstillen Tag, am Seeufer spazieren ging, traf man
oft auf Flachstellen, an denen sich die Fischbrut im Sonnenlicht wärmte, wie ein Mückenschwarm. Im See befanden sich
folgende Fische: Karpfen, Hechte, Schleie, Barsche Plötze, Rotaugen, Aale und Krebse. Am Sonntagmorgen brachten viele
Rohmaner ihre Pferde zum See um sie zu baden.
Es wurden dort, unter der Aufsicht von Lehrer Dorka, auch viele Jugendfeste mit Theatervorführungen veranstaltet, zu
denen er selbst die Vorlagen organisiert hat. Der am See wohnende Bauer Johann Nadrowski, hat uns ein Scheunentor, als
Tanzboden zur Verfügung gestellt. Der Zimmermann Wilhelm Wittek hat uns eine Windmühle gebaut, die am auf dem Boden
liegenden Scheunentor aufgestellt wurde, dazu kamen Noch Tannen und Fichten, die das Ganze wie ein Bühnenbild
erscheinen ließen. Es wunden viele Bühnenstücke aufgeführt, unter anderen >Alte Weiber werden jung gemahlen<. Dazu bot
die Windmühle die entsprechende Kulisse.
Nach der Vorführung wurde der Boden aufgeräumt, um dann als Tanzdiele zur Verfügung zu stehen. Der Gastwirt Trzaska
hatte Tische und Bänke aufgestellt, Speisen und Getränke angeboten, so dass sich die die Veranstaltung bis in die
späte Nacht hinein zog. Es waren auch Leute aus Ortelsburg und anderen Nachbardörfern dabei. Im Winter hat Lehrer
Dorka eine Kreisrodelbahn eingerichtet, die von Zeit zu Zeit mit Wasser besprengt wurde, um die Gleitfähigkeit zu
verbessern. Von einer Anhöhe ging hinunter bis auf den halben See, was für alle ein großes Vergnügen war. Es kamen
Lehrer mit Schulklassen aus der näheren Umgebung um hier zu Rodeln.
Als Herr Lehrer Jobski als Hauptlehrer nach Rohmanen kam hat er mit dem Bürgermeister und der Gemeindeverwaltung
beschlossen, in der Nähe des Dorfes, auf einem zur Schule gehörenden Grundstück, einen Sportplatz anzulegen. Dafür
wurde gleich hinter den Gärten, 6 Morgen Ackerland abgetrennt, und nach Feierabend hat Lehrer Dorka mit den
Jugendlichen eingeebnet und gleich nebenan einen Graben für Schützenstand und Kugelfang ausgehoben. Am Sonntagvormittag
wurde Fußball gespielt und um 15:00 Uhr war Kleinkalieberschießen angesagt. Es musste auch ein kleiner Beitrag erhoben
werden, um Munition kaufen zu können. Eine Büchse konnten wir aus beim Kleinkalieberverein in Ortelsburg ausleihen.
Nach Hitlers Machtergreifung
Als Adolf Hitler an die Macht kam wurde die SA gegründet. Der Bürgermeister Michael Kownatzki
wurde zum Gruppenführer ernannt und folgende Männer haben sich freiwillig gemeldet: Wilhelm Matzey, Johann Gloddek,
Gustav Nadrowski, August Buttler, Karl Baran, Emil Nickel, Wilhelm Jaschinski, Emil Bork, Ernst Rattay und Gustav Bach.
Bei Versammlungen war die SA in Uniform angetreten um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Wer versucht hat Unruhe zu
stiften, egal aus welchem Grunde, wurde aufgefordert den Saal zu verlassen, andernfalls wurde er mit Gewalt entfernt.
Herr Lehrer Jobski wurde zum politischen Leiter ernannt, seine Frau hat die NS-Frauenschaft gegründet, Lehrer Dorka
die HJ, und so bekam die Dorfgemeinschaft, nach und nach ein anderes Gesicht. Der Sportplatz und der Schützenstand
wurden jetzt mehr als früher in den Mittelpunkt gestellt. Nach der Feldarbeit hat der Bürgermeister Fuhrwerke bestellt
und den Sportplatz noch besser herrichten lassen.
Der Bauer Wilhelm Both wurde zum Ortsbauernführer ernannt, mit der Aufgabe alles Land für den Anbau von Getreide und
Futtermittel bereitzustellen, oder wenn das nicht möglich war mit Wald aufzuforsten. Durch den Einsatz von Kunstdüngern
sollten größere Erträge aus dem Boden geholt werden, um den Viehbestand zu vergrößern und mehr Milch und Butter zu
produzieren. Deutschland sollte im Stande sein sich selbst zu selbst zu ernähren, ohne auf Importe angewiesen zu sein.
Frau Jobski hat, innerhalb der der NS-Frauenschaft, mit Hilfe von Fachkräften aus Ortelsburg, Lehrgänge veranstaltet,
auf denen man Backen und Nähen lernte. Auf den Bauernhöfen befand sich auch immer mehr Rassegeflügel, das eine erhöhte
Produktion von Eiern und Geflügelfleisch sicherstellen sollte.
Die Rohmaner Bauern hatten, außer in der Landwirtschaft, noch andere Verdienstmöglichkeiten in der Kreisstadt. In
Ortelsburg wurden vier Sägewerke betrieben, die mit Langholz aus dem Walde versorgt werden mussten. Wir haben eine
Kiefer von über 8 Festmeter angefahren, der wir zuerst 6 Meter Spitze abschneiden mussten, um diese Last überhaupt
auf den Wagen zu bekommen. Sechs Pferde musste angespannt werden um den Wagen zur befestigten Straße zu bringen.
Fichten und Tannen wuchsen bis zu einer Länge von 30 Metern. Auch beim Transport von Ziegel, von der Ziegelei zum
Bahnhof, konnte man gutes Geld verdienen.
Im Jahr 1934 wurde Rohmanen an das überregionale Stromnetz angeschlossen und schaffte auf diese Weise den Sprung von
der Petroleumlampe zur Glühbirne. Neben dem Grundstück von Karl Pietzonka wurde ein Transformatorhäuschen errichtet,
in dem der ankommende Strom von einer Hochspannung auf eine Verbrauchsspannung transformiert wurde. Es gab schon eine
Überlandleitung, die aus Richtung Ortelsburg kommend, quer über die Felder, in Richtung Neu Keykuth weiter ging.
Durch eine Zwischenspanne wurde der Transformator, mit der Hauptleitung auf Kownatzkis Feld verbunden.
Ein Stromanschluss konnte die Arbeit im Haus und Hof auf vielfältige Weise erleichtern, doch nur die besser gestellten
Bauern, sowie noch manche Pensionäre, die ein festes Einkommen hatten, konnten sich dass leisten. Weil nur wenige an
der Elektrifizierung teilnahmen, war ein Stromanschluss mit hohen Kosten verbunden. Nur Gustav Pietzonka, Gasthof
Trzaska, Friedrich Nickel, die Schule und Wilhelm Both, wurden in der ersten Phase erfasst.
Im Jahr 1952 wurde von den polnischen Behörden die zweite Stufe der Elektrifizierung eingeleitet, in der alle im Dorf
stehen Gebäude erfasst wurden. Am Anfang wurden nur Leitungen für Lichtstrom gelegt und auch nur 3 Lichtstellen pro
Haushalt bewilligt. Doch im nachfolgenden Zeitraum wurden dann, wenn Material vorhanden war, weitere Lichtpunkte
angelegt. 1952, am zweiten Wochenende im Advent, wurden dann die Leitungen geschaltet und alle waren von der
plötzlichen Helligkeit sehr begeistert. Wenn man Glühbirnen auswechseln wollte musste man am Anfang weite Wege
zurücklegen, um welche zu bekommen. In den 60ger Jahren wurden dann immer mehr Starkstromleitungen gelegt, weil die
Bauern elektrische Geräte kaufen konnten. Ende der 60ger wurden auch die Abbauten an das Stromnetz angeschlossen.
Das Urnengrab auf unserem Feld
Auf unserem Feld, in Richtung Seelonken, bin ich oft beim pflügen gegen Steine gestoßen, manchmal
rissen sogar die Stränge am Pferdegeschirr. Eines Tages nahm ich einen Spaten, Brechstange und einen langen Baum, um
der Sache auf den Grund zu gehen. Als ich eine Menge Sand ausgehoben hatte stieß ich auf eine steile, aus Steinen
errichtete Wand, die ich auch mit dem Baum nicht aus der Fassung bringen konnte. Ich habe den ganzen Vormittag gegraben,
konnte jedoch nicht unter die Steine kommen. Einige Tage später hatten wir in der Schule eine Bauernversammlung, da
habe ich Herrn Biella und Herrn Lehrer Dorka von meinem Fund berichtet. Am nächsten Morgen kam der Lehrer Dorka mit der
ganzen Schulklasse, mit Spaten und Sieben ausgerüstet auf unser Feld und fingen an die ausgehobene Erde zu sieben.
Lehrer Dorka benachrichtigte daraufhin den Leiter des Ortelsburger Heimatmuseums, der am nächsten Morgen vorbei kam um
sich die Fundstelle genau anzusehen. Er beauftragte ihn 4 Mann zu besorgen, um die Steine ringsum frei zu schaufeln.
Zwischen den Steinen durften wir die Erde nur mit Esslöffeln ausheben. Als es plötzlich zu regnen anfing hat Lehrer
Dorka die Brauerei Daum, in Ortelsburg angerufen, die uns über der Fundstelle ein Zelt errichtet haben, damit wir
ungestört weiterarbeiten konnten. Wir fanden 8 flache und 8 hohe Urnen zu beiden Seiten am Körper. Die Urnen wurden in
Gipsbinden eingewickelt und ins Heimatmuseum nach Ortelsburg gebracht, wo sie durch einen Fachmann, der extra aus einem
Königsberger Museum angereist war. Nach Reinigung der Urnen hat er festgestellt, das die Grabstätte etwa 2000 Jahre vor
Christi Geburt angelegt wurde und ein Doppelgrab war, in dem ein Toter liegend und einer in Hochstellung beigesetzt
wurde.
Die Nachricht von der Fundstelle verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Es erschienen viele Schaulustige, ganze
Schulklassen aus der Umgebung, mit Autos und zu Fuß. Durch die vielen Menschen wurden die bestellten Ackerflächen auf
unserem Feld sehr in Mitleidenschaft gezogen, eine Entschädigung haben wir nicht erhalten. Das Grab wurde vor dem
Heimatmuseum in Ortelsburg wieder so aufgebaut wie man es auf unserem Feld vorgefunden hat. Für den Transport der
Steine wurde ich entlohnt. Die Urnen hat das Königsberger Museum an sich genommen und wollte sie nicht wieder hergeben,
weil die solch einen Fund noch nicht in ihrer Sammlung hatten.
Sonnenwendfeuer
Am 24 Juni fand eine Sonnenwendfeier statt. Ein Brauch der an die alten Germanen erinnern sollte.
Der Lehrer Dorka hat den Bürgermeister beauftragt 2 Fuhrwerke in den Wald zu schicken, die Holz und alten Reisig holen
und auf dem großen Schulberg abladen sollten. Das Straßenbauamt hat uns Teertonnen zur Verfügung gestellt. Die ganze
Dorfgemeinschaft wurde eingeladen, am Abend, nach der Feldarbeit, an der Sonnenwendfeier teilzunehmen. Lehrer Dorka
hielt zuerst eine Ansprache, in der er anschaulich erklärte wie unsere Vorfahren in grauer Vorzeit gefeiert haben.
Nach dem offiziellen Teil wurden das Holz und die Teertonnen angezündet, es wurden Heimatlieder gesungen, wie: Wild
flutet der See, drauf schaukelt der Schiffer den schwankenden Kahn, Schaum wälzt er wie Schnee, von grausiger Mitte
zum Ufer heran, wild fluten die Wellen auf Vaterlands See, wie schön, oh trag mich auf Spiegel zu Hügel, Masovias See.
Masovia Land, mein Heimatland, Masovia es lebe mein Vaterland.
Lehrer Alfred Dorka und sein Wirken für Rohmanen.

Friedrich Biella hatte auf seinem Feld einen Granitstein mit einer geraden Seite, den haben wir
mit viel Schweiß an den Dorfteich transportiert und auf einer Erhöhung abgelegt. Der Stein sollte zum Denkmahl für die
Gefallenen des Ersten Weltkrieges umgestaltet werden. Da zu Wenige daran ein Interesse zeigten, wurde diese Idee fallen
gelassen und der Stein irgendwann ins Wasser gerollt. Der Lehrer Dorka war viele Jahre in Rohmanen tätig, dort hat er
später seine ehemalige Schülerin, Lotte Biella geheiratet. Er hat sich sehr für die Entwicklung des Dorfes interessiert,
war bei jeder Gemeindeversammlung anwesend und hat auf Schwachstellen hingewiesen die den Fortschritt behinderten.
Gemeinsam mit den Schülern hat er den Ehrenfriedhof für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges gepflegt, an der
Wegegablung nach Eichtal und zu Ehren des Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg eine Eiche gepflanzt.
Zum Advent hat Lehrer Dorka mit der Jugend einen Adventstern, in verschiedenen Farben gebastelt.
Der Stern wurde auf einer 2 Meter langen Stange befestigt, in der Mitte wurde ein Wachslicht angezündet, am Stern
wurde eine Schnur angebracht, wenn man daran zog rollte der Stern hin und her. Am ersten Wochenende im Advent
versammelten sich jung und alt, um den Stern durch das Dorf zu tragen. Alle schlossen sich dem vorausgehenden
Sternträger an, der den Stern durch die Hauptstraße und die angrenzenden Wege trug. Dieser Sternmarsch wurde an den
folgenden Adventwochenenden wiederholt.
Am ersten Weihnachtfeiertag wurde um 4:00 Uhr morgens ein Frühgottesdienst gehalten. Zuerst hat der Pfarrer eine
Andacht gehalten, dann haben die Kinder ein Krippenspiel aufgeführt und die Gemeinde hat schöne Weihnachtslieder
gesungen. Der Gastwirt Trzaska hat uns den Saal zur Verfügung gestellt. Wir hatten eine Posaunen- u. eine
Gitarrengruppe. Unter der Leitung von Herrn Willi Doormann spielten: Gottlieb Brosch, Fritz Ollech,
Gustav Rattay(Sopran), Wilhelm Pilath, Gustav Brosch(Alt), Fritz Both(Tenor) und Fritz Brosch(Bass).
In der Gitarrengruppe wirkten mit: Martha Ollech, Hedwig Ollech, Martha Lekzik, Martha Michalick und Auguste Lekzick.
Willy Doormann hat sie auf der Geige begleitet.
Kurz vor Ausbruch des 2. Weltkrieges
Bei der Aufstellung des Grenzschutzes(Regiment Buchholz), hat er als Hauptfeldwebel die
Gruppenführerkurse überwacht und selbst die fähigsten Männer dafür vorgeschlagen. Das Ausbildungspersonal hat das
Jäger-Battalion gestellt. Wir kamen zuerst ins Stadion(Waldheim), wurden da eingekleidet und dann ging es gleich
kasernenmäßig zu, theoretisch und praktisch. Jeder musste vor die Front treten und nachweisen ob er im Stande ist,
Befehle zu erteilen. Abends wurden Filme vorgeführt die uns zeigen sollten wie eine Gruppe sich im Gelände entfalten
muss. Die Exerziervorschriften hatten sich, im Verhältnis zu Kaiser Wilhelms Zeiten, etwas geändert. Damals bestand
eine Gruppe aus 8 Mann und einem Unteroffizier, jetzt aus 10 Schützen, 3 für das leichte Maschinengewehr und einem
Unteroffizier(13 Mann). Nach der Schulung folgte eine Abschlussprüfung, danach ein gemütliches Beisammensein. Aus
Rohmanen haben folgende Männer die Prüfung bestanden: Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy, Gustav Rattay und
Gustav Deptolla. Unsere Uniformen waren alle zu klein und es gab viel zu lachen bei der Anprobe.
Die erste Übung habe ich mit Emil Rosowski, in Lenzinen gemacht. Der Gutsbesitzer Marzinzick hat seine Scheune als
Unterkunft zur Verfügung gestellt. Er war im Range eines Hauptfeldwebels. In seinem haus war die Schreibstube
untergebracht, die er selbst verwaltete. Ein Lastauto hatte Uniformen aus der Kaserne in Ortelsburg geholt, jeder
musste eine Uniform anlegen und dann wurde solange getauscht bis alle eine passende gefunden hatten. An den Namen des
Kompanieführers kann ich mich nicht mehr erinnern. 1935 wurden wir zu einer Übung in die Dragonerkaserne nach Lyk
einberufen. Die Gruppenführer, Zugführer, und Kompanieführer die schon Frontberührung im dem Ersten Weltkrieg hatten,
mussten eine Woche früher anreisen. Die Übungen waren auf 6 Wochen angelegt. Die meisten der einberufenen waren noch
nie mit dem Wehrdienst in Berührung gekommen. Jeder Gruppenführer bekam 13 Mann zugeteilt.
Unser Zugführer war Leutnant Neumann, Kompanieführer Oberleutnant Rutschko, Battalions-Kommandeur Major Gröning
(Regiment Buchholz). Hier ging es wieder Kasernenmäßig voran. Das Bataillon wurde hier vereidigt. Jeden zweiten
Sonntag durften unsere Frauen uns besuchen. Ein Jahr später wurden wir wieder zu einer Übung einberufen, auf den
Truppenübungsplatz nach Arys. Jeder Gruppenführer hatte den Auftrag die Gruppe zu entfalten, und auf bewegliche
Figuren zu schießen. Diese Übung musste später mit scharfer Munition wiederholt werden. Jedes Maschinengewehr bekam
50 Schuss, jeder Schütze 20 Schuss zugeteilt. Nach dem Abschießen wurden die Treffer gezählt und dem Kommandierenden
Bericht erstattet. In einiger Entfernung spaziert ein Storch umher, der gar nicht bemerkt hatte dass geschossen wurde,
was bei den Kameraden ein großes Gelächter hervorrief.
Nach der Übung wurde uns gesagt das jeder Gruppenführer eine arische Abstammung nachweisen sollte. Ich konnte in den
Rheinsweiner Kirchenbüchern meine Vorfahren aus Gellen, bis zum Jahr 1732 zurück, nachweisen und wurde zum
Unteroffizier befördert. Aus unserem Dorf wurden auch, Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy und Gustav Deptolla
befördert. Zwischendurch mussten wir schon mal in die Radfahrer-Kaserne nach Ortelsburg, Gewehre empfangen und im
Gelände üben. Am 31 Juli 1939 wurde mir von einem Soldaten ein Schreiben übereicht, das mich aufforderte, am 1. August
um 6:00 Uhr, bei der 3. Kompanie, des 2. Infanterieregiments zu erscheinen.
Um 5:30 hat mich meine Schwester in die Kaserne gebracht. Auf der Schreibstube erklärte mir der Hauptfeldwebel,
dass mir ab sofort der Dienstgrad eines Sanitäters zugewiesen wird, ich mich in der Kammer einzukleiden hätte und mir
in der Handwerkerstube die entsprechenden Schulterklappen annähen lassen sollte. Die aktiven Sanitäter wurden den
Feldlazaretten zugewiesen und wir kamen an ihre Stelle. Unser Bataillon wurde nach Schodmak zum Bunker bauen und
Stacheldraht verlegen eingeteilt. Wir zogen in Begleitung einer Musikkapelle bis zur Kreuzung am Krankenhaus, dann
weiter zu unserem Bestimmungsort, gefolgt von einer Gulaschkanone die in den nächsten Tagen für unsere Verpflegung
sorgen sollte.
Am 14 August haben wir die Jägerkaserne, begleitet von einer Musikkapelle endgültig verlassen und zogen zuerst durch
Ortelsburg, dann über Lehmanen ins Feldmanöver, hinter Rohmanen. Dort entfaltete sich das Bataillon im Gelände, die
Verwundetensammelstelle wurde auf dem Hof des Bauern Friedrich Neumann eingerichtet. Gegen Abend wurde zu Sammeln
geblasen und Biwak bezogen, wobei unsere 3.Kompanie, in einem kleinen Wallt, in der Nähe von Otto Nickels Gehöft
Stellung bezogen hatte. Die 2. und 4. Kompanie hatte sich in der Nähe vom Abbau Pallasch niedergelassen. Die Frau
Nickel hat am Abend ein Mädel in Dorf geschickt um meiner Frau Bescheid zu sagen, wo wir uns zurzeit befinden. Meine
Frau ist dann noch gekommen um sich von mir zu verabschieden, weil wir am nächsten Morgen um 3:00 Uhr Zelte abbrechen
und um 4:00 Uhr in Richtung Kaspersguth marschieren sollten.
Wir sind dann über Achodden, Seelonken, Lehmanen, Ortelsburg, bis nach Grammen und Schützendorf marschiert, wo wir an
einem See Biwak bezogen haben. Es wurde immer gesagt, wir kommen zum Tannenberg-Denkmal bei Hohenstein, wo ein Reichs
Kriegervereinsfest stattfinden sollte. Es wurden auch schon Vorkommandos aufgestellt, doch dann kamen wir nach Orlau
und Lahna-Mühle, da wo die Alle entspringt haben wir 2 Tage biwakiert. Unser Kompanieführer hat uns nach Waplitz auf
den Soldatenfriedhof des Ersten Weltkrieges geführt und uns erklärt wie das Jägerbataillon sich 1914 hier entfaltet
hat und aufgerieben wurde. Dann mussten wir in der Nähe von Gut Koslau über einen Fluss und bezogen in einem Waldstück,
vorbereitete Stellungen in der Nähe der polnischen Grenze. Herr und Frau Thalmann haben uns jeden Tag, bis zur Grenze,
mit Brötchen und Getränken versorgt. Es wurde scharfe Munition ausgegeben, weil wir am nächsten Morgen um 4:00 Uhr die
polnische Grenze überschreiten sollten.
Am nächsten Morgen um 10 Minuten vor 4:00 Uhr kam der Befehl; scharfe Munition abgeben, alles zurück in ein 6 Kilometer
entferntes Dorf, wo wir auch einquartiert wurden. Das alles geschah’ eine Woche vor dem 1. September 1939. Es wurde
gesagt dass der Führer dem polnischen Präsidenten Rid-Szmigly, ein Ultimatum gestellt hat und es wahrscheinlich nicht
zum Krieg mit Polen kommt. Genau nach 5 Tagen kehrten wir wieder in die gleichen Stellungen zurück, es wurde wieder
scharfe Munition ausgegeben und am nächsten Morgen um 4:00 Uhr überschritten wir die polnische Grenze.
“Der 2. Weltkrieg.”
Der erste Einsatz in Polen
Wir kamen zuerst in ein Dorf in dem sich nur alte Menschen befanden. Auf unsere Frage wo denn die Bewohner wären sagte
man uns dass alle geflohen sind, weil erzählt wurde, die Deutschen würden alle Polen misshandeln und verstümmeln. Ich
habe ihnen daraufhin gesagt dass uns, unter Androhung von Strafe verboten wurde, einem Zivilisten etwas anzutun. Das
Vieh, die Schweine und Hunde des Dorfes liefen frei herum und die Soldaten fingen an auf die Hunde zu schießen, bis
gesagt wurde es seien Meldehunde im Dienste der Deutschen Wehrmacht und dieser Unfug der eigenen Truppe schaden würde,
weil etwaige Querschläger eigene Kameraden verletzen könnten. Wir gingen weiter auf polnischer Seite entlang der Grenze,
bis wir am Nachmittag die ersten Vorposten der Festung Mlawa erreichten, da befanden wir uns plötzlich im Feuerhagel
polnischer Festungsflack.
Am nächsten Morgen hatte ich schon 3 Verwundete und wusste nicht wo sich eine Verwundeten Sammelstelle befindet. Ich
suchte den Bataillonsgefechtstand auf der sich auf einer Anhöhe befand. Ich habe unseren Oberstabsarzt gefragt wo denn
die Verwundetensammelstelle wäre. Er rief beim Tross an, wo er die Auskunft erhielt, das sich vor dem Dorf ein Bunker
befindet in dem man die Verwundeten sammeln sollte, die dann von Sanitätsautos abgeholt würden, weil das Dorf unter
Artilleriebeschuss stand. Am Sonnabend haben unsere Flieger die Bunkerstellungen bombardiert, konnten aber, trotz guter
Treffer nicht viel ausrichten, die Bunker wurden nur etwas angekratzt.
Der Beschuss unserer vordersten Linien ging mit unverminderter Heftigkeit weiter. Am Sonntag verkündete eine große
Staubwolke die Ankunft unserer Panzer, doch sie kamen nur bis zur Panzersperre und mussten wieder abdrehen ohne den
Polen einen schaden zuzufügen. Ein Panzer bekam einen Volltreffer, der Fahrer konnte noch umkehren. Er blutete am Kopf
und der Schütze war so eingeklemmt, das wir ihn nur mit einem Seil unter den Armen, durch die Luke nach oben ziehen
konnten. Ob er seine Verwundung überlebt hat ist mir nicht bekannt, denn in der Nacht wurden Panzergeschütze nach
vorne in Stellung gebracht, die direkt in die Schießscharten der Bunker geschossen und so die Verteidiger vertrieben
haben. Daraufhin sind wir weiter vorgerückt. Auf einer Wiese war ein tiefer Graben ausgehoben und mit Ästen getarnt,
da war ein Panzer hinein gefahren, so dass nur das Hinterteil herausragte und er sich nicht aus eigner Kraft befreien
konnte. In der Luft waren Flieger die Brandbomben abwarfen, ich habe mich auf den Boden geworfen weil ich dachte die
würden explodieren, aber sie zischten nur, so das Stoppeln und Graß rings herum in Brand gerieten.
Bei den Kampfhandlungen gab es mehrere Verwundete, denen ich gerade Verbände anlegen wollte, als unser Hauptmann zur
Trillerpfeife griff um mir klar zu machen, dass ich ihm folgen sollte. Die Polen fingen an zu schreien, ich sollte
sie ins Lazarett bringen denn hier im Wald würde sie niemand finden. Ich setzte mich aufs Fahrrad und folgte unserem
Kompanieführer, der mir sagte ich soll immer bei der kämpfenden Truppe bleiben, denn hinter der Front sind die
Sanitätsabteilungen, die werden die Verwundeten schon versorgen. Der Vormarsch dauerte bis in die späte Nacht. Auf
einem Gehöft, das nach allen Seiten durch Feldwachen abgesichert wurde, machten wir endlich Rast. Wir haben
Getreidegarben auf dem Hof ausgebreitet und uns zur Ruhe gelegt, als plötzlich um Mitternacht Leuchtraketen den Himmel
erhellten und Maschinengewehrfeuer uns aus dem Schlaf schreckte. Ein par polnische Soldaten hatten das Feuer eröffnet,
aber sich kurz darauf ergeben.
Die Narew-Überquerung
Als es hell wurde ging der Vormarsch weiter. Es wurde uns untersagt Tagebuch zu führen, darum
weiß ich nicht wie die Orte hießen, durch die wir marschiert sind. Als wir durch ein sumpfiges Gelände vor drangen
stand auf einer Anhöhe am Horizont, die polnische Artillerie, die uns sofort unter Beschuss nahm. Unser Hauptmann war
der Meinung dass wir schon in der Nähe des Flusses Narew sein müssten, als aus den Sträuchern ein mit Schlauchboten
beladenes Lastauto auftauchte. Wir wurden aufgefordert mit je 6 Mann ein Schlauchboot zu nehmen, an einem Aggregat
der daneben stand mit Luft zu füllen und zu Wasser zu lassen. In einer Stunde war das ganze Bataillon über die Narew,
wo der Vormarsch fortgesetzt wurde. In einem Dorf überraschte uns die polnische Kavallerie und fing sofort mit
Maschinengewehren zu schießen an. Da kam der Befehl: Alles wieder zurück. Es ging noch schneller als auf der Hinfahrt.
Wir sind erst einige Kilometer am Fluss entlang gegangen und haben dann zum zweiten Mal rüber gesetzt.
Die Gehöfte im Dorf standen alle in Brand. Auf einem waren viele Bienestöcke. 2 Kameraden wollten den Stöcken Waben
entnehmen, doch die Bienen durch das Feuer aufgeschreckt, überfielen sie sofort und stachen derart zu das sie nicht
mehr wieder zu erkennen waren. Ich habe die Einstichstellen mit Salmiak betupft, mehr konnte ich nicht tun. Wir mussten
auf unserem Vormarsch durch einen Wald der in Flammen stand, so dass man kaum atmen konnte. Es ging weiter in Richtung
Minsk und Warschau, wo schon die Sowjetische Armee durchgegangen war, die Pferde und Vieh von einem Gut mitgenommen
hatten. In einem Wald stießen wir unverhofft auf ein Kloster, in dem wir einige Gefangene machten. Dann trafen wir auf
eine gute Straße die nach Grochow ging.
Als wir dort einmarschierten wurden wir aus den oberen Stockwerken beschossen, so dass wir, um uns zu schützen, nur an
den Hauswänden entlang gehen konnten. Wir haben jedes Haus nach Feinden durchsucht. Vor einem Haus stand ein Hund der
niemanden reinlassen wollte, solange bis ihn eine Kugel traf. Die polnische Artillerie feuerte von Warschau aus, um
unseren Vormarsch zu stoppen. Wir hatten uns gerade eingegraben als plötzlich deutsche Flieger am Himmel erschienen,
die unsere Stellungen mit Bomben bewarfen und dabei viel Unheil anrichteten. Wir haben sofort Fliegertücher
ausgebreitet und Leuchtraketen abgeschossen. Da ich in dem Graben, den ich kurz zuvor ausgehoben hatte, sofort in
Deckung gegangen bin ist mir zum Glück nichts passiert. Unter den anderen Kameraden gab es viele Verwundete, so dass
ich nicht wusste wem ich zuerst helfen sollte.
Der Oberstabsarzt hat mich sofort tatkräftig unterstützt, so das bald alle Verwundeten versorgt waren, außer einem,
dem ein Bombensplitter den Arm abgerissen hat. Ich habe im 3 große Verbandspäckchen auf die Wunde gelegt, doch die
Blutung ließ sich trotzdem nicht stoppen, so dass er eine Stunde später auf der Krankensammelstelle verstarb. Wir
haben danach in einem Tomatenfeld einen Graben ausgehoben und eine neue Abwehrstellung bezogen. Die Gruppe Schwarz
bekam den Auftrag nach etwaigen versprengten polnischen Verbänden Ausschau zu halten, als sie unerwartet aus einer
Häuserreihe mit Maschinengewehrsalven überschüttet wurden. Der Gruppenführer und noch ein Soldat wurden dabei tödlich
verwundet. Danach wurde noch ein weiter Stoßtrupp, unter der Führung von Leutnant Briskorn, der sich dazu freiwillig
gemeldet hatte, hinaus geschickt um den Gruppenführer und den anderen Toten zu bergen.
Bei diesem Unternehmen, das erfolglos ausging, weil die Toten schon verscharrt waren, durchschlug eine Kugel den
Stahlhelm von Leutnant Briskorn, der auch sofort tot war. Alle Toten wurden später, an der Kirchenmauer in Grochow, in
Särgen beigesetzt: Hauptmann Schönwald sagte, das sie nach dem Kriege auf den Heldenfriedhof nach Ortelsburg überführt
werden. Drei Tage lagen wir bei Grochow in Stellungen, waren dem polnischen Maschinengewehrfeuer sowie den Bomben
deutscher Flugzeuge ausgesetzt. In der Nacht musste ich zu einem Verwundeten in die vorderste Linie und habe den
Rückweg nicht mehr finden können, als plötzlich Gewehrfeuer aufflammte habe ich in den Ruinen Schutz gesucht. Erst im
Morgengrauen konnte ich mich wieder orientieren und zu meinem Unterstand zurückfinden.
Warschau wurde tagelang bombardiert und stand auch unter Artilleriebeschuss. Aus dunklen Rauchwolken kamen oft ganze
Bündel von Papier angeflogen. Die Verwundeten kamen oft auf Krücken zu unserem Unterstand, ich habe sie dann zur
Krankensammelstelle hingeführt. Wir haben auch polnische Zivilpersonen betreut, die während der Kampfhandlungen
verwundet wurden. Als einmal 2 Jungen vorbeiliefen hat einer ihnen nachgerufen sie sollten seiner Frau Bescheid sagen,
er wäre auf der Krankensammelstelle an der Kirche. Als wir dort ankamen war seine Frau, mit einem Kind auf dem Arm,
schon da.
Nach der Kapitulation von Warschau, gingen wir über Sokolow zum Bug und haben dort Quartier bezogen. Der Russe hatte
sich bereits hinter den Fluss zurückgezogen, hatte alles Vieh und Pferde mitgenommen. Dort erreichte mich ein Telegramm
von zu Hause, dass meine Tochter gestorben ist. Es sprach sich auch herum dass verschiedene Heimaturlaub bekommen haben,
ich durfte auch für 14 Tage heim. Wir fuhren mit Lastautos nach Allenstein in die neue Reiterkaserne, zum
Ersatzbatallion, da haben wir unsere Gewehre und Munition abgeben, dann durften wir, jeder in seinen Heimatort
weiterfahren.
Als wir unsere Quartiere am Bug verlassen haben war sehr viel Schnee gefallen. Hier in Ortelsburg fanden wir die
gleiche Wetterlage vor, aber nach 3 Tagen war alles wieder weggetaut und wir konnten die Kartoffelernte, die durch den
frühen Wintereinbruch gestoppt wurde, zu Ende bringen. Ein Tag bevor ich zu Hause angekommen bin wurde die Tochter
beerdigt. Nach 14 Tagen mussten wir uns in Allenstein melden, Gewehre empfangen und wieder zurück zur Division an den
Bug 150 Kilometer hinter Warschau. Die elfte Division, zu der wir auch gehörten sollte in den Westen Deutschlands
verlegt werden und war schon unterwegs zur Verladestation Skiernewice 50 Kilometer vor Warschau.
Mein Dienst als Sanitätsunteroffizier
Unser Bataillon kam in das Städtchen Burscheid, im Kreis Opladen, wo wir in Privatquartieren
untergebracht wurden. Nach 3 Monaten, im Januar 1940, wurden wir nach Solingen verlegt, wo wir bis zum
Frankreichfeldzug stationiert waren. Wir mussten an Feldübungen teilnehmen, wie andere die in Kasernen untergebracht
waren. Während dieser Zeit musste jeder seine Zähne in Ordnung bringen lassen. Jeden Tag fuhren 20 Mann in die
Cäzilienstraße nach Köln, zur Zahnklinik. Im Rheinland wurde unsere Division neu aufgestellt. Ausfälle durch den
Polenfeldzug wurden durch neue Soldaten ergänzt. Ich kam nun zum Ersatzbatallion, war der Älteste in der ganzen
Kompanie. Als der Frankreichfeldzug losging wurde unser Ersatzbatallion mit den noch vorhandenen Verwundeten, in die
neue Reiterkaserne, nach Allenstein verlegt.
Meine Frau hat, mit Unterstützung der Bauernschaft, einen Antrag gestellt, daraufhin wurde ich zur Frühjahrsbestellung,
beurlaubt und später bis auf weiteres vom Militärdienst freigestellt. Als der Russlandfeldzug losging wurde ich von der
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg, für 14 Tage einberufen. Ich war seit 1922, Mitglied der freiwilligen
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg und habe jedes Jahr an Übungen teilgenommen. Jede Bereitschaft musste etliche Leute
stellen. Von Rohmanen wurden Emil Rosowski, Johann Dembek, und ich, zur Krankensammelstelle Wirballen, in Litauen,
abkommandiert. Dorthin kamen Lazarettzüge aus Russland mit der Breitspurbahn. Die Verwundeten wurden frisch verbunden
und auf Waggon mit Normalspur verladen und nach Deutschland gebracht.
Als die 14 Tage vergangen waren wollten wir wieder nach Haus zurück, doch man wollte uns nicht entlassen. Stattdessen
wurden wir dem Wehrkreisamt Königsberg zugeteilt, neu eingekleidet und zur Aushilfe ins Lazarett nach Gumbinnen
abkommandiert. Mehr als ein Jahr war ich in den Urlauber-Baracken, habe dort Krankenstube betreut. Später, bis zum
Dezember 1944, war ich im Reserve-Lazarett 4, in Königsberg tätig. Dort habe ich auch die Luftangriffe der Engländer,
vom 25 bis 26. August 1944 miterlebt.
Wir sollten gerade einen Lazarettzug in Rotenstein entladen, als plötzlich die Sirenen ertönten - Fliegeralarm. Im
gleichen Moment waren die ersten Flugzeuge auch schon da, zuerst warfen sie „Tannenbäume” und danach Foßforkanister ab.
Die Omnibusse standen schon zur Abfahrt bereit als es losging. Wir haben die Verwundeten schnell in den
Luftschutzkeller getragen, haben die Betten von den Fenstern weggerückt damit die Verwundeten nicht von den
Glasssplittern verletzt wurden. Im Kasernenhof brannten die Fosforkanister lichterloh. Unsere Unterkunft, die sich in
einer Baracke befand ist völlig abgebrannt, mit dem Wenigen was wir unser Eigen nannten. Am nächsten Tag wurden wir neu
eingekleidet und am 29. bis 30. kamen die englischen Bomber wieder, sie setzten genau da ihr Zerstörungswerk fort wo
sie vor 3 Tagen aufgehört hatten.
Anfang Dezember 1944 musste ich mich nach Stablack melden und musste dann zur Sanitätsabteilung 1, nach Gernau, das
liegt zwischen Lodz und Warschau. Vormittags hatten wir Felddienstübungen und nachmittags theoretischen Unterricht.
Jeden Tag wurden Gruppen zusammengestellt und zu anderen Einheiten abkommandiert. Ich kam zu einer Panzerabteilung, wo
wir an einem Morgen plötzlich auf dem Kasernenhof antreten mussten und zu unserer Überraschung mit der Nachricht
konfrontiert wurden, dass der Russe an mehreren Frontabschnitten durchgebrochen war. Wir bekamen sofort einen
Marschbefehl in Richtung Lodz, wo das Stadtbild noch intakt war, selbst die Straßenbahnen fuhren noch. In der Nacht
haben russische Flugzeuge die Stadt bombardiert. Die Kaserne in der wir untergebracht waren hatte keine
Luftschutzkeller, aber zum Glück blieben wir von Bombentreffern verschont. Am nächsten morgen bot sich uns ein Bild der
Verwüstung. Die entgleisten Straßenbahnwagen, sowie andere Fahrzeuge blockierten die Straßen. Die Älteren unter uns
bekamen Fahrscheine für einen Transportzug, der bereit hinter Lodz abfahrbereit, unter Dampf stehen sollte. Als
russische Panzer in den Straßen auftauchten, verbrannte die Schreibstube unsere Wehrpässe und andere wichtige
Dokumente. Wir liefen zu der Station auf der unser Transportzug bereitstehen sollte, aber da war kein Zug mehr zu sehen
und wir setzten unseren Rückzug zu Fuß fort.
Der Rückzug und Zusammenbruch der Ostfront
In Dobroschin, einer Stadt in Polen, wurde gerade ein Lazarettzug verladen, doch wir kamen nicht
mehr zum Einsatz, weil die russische Infanterie uns schon auf den Fersen war. Es ging weiter über den Fluss Bober,
Sagan, bis nach Glogau an der Oder. Dort wurden wir der 29. motorisierten Sanitätskompanie zugeteilt. Im
Garnisonslazarett wurden noch Operationen durchgeführt. Unsere Division hatte ihr eigenes Feldlazarett, so dass wir den
Befehl zu Weiterfahrt erhielten und noch unbeschadet die Oderbrücke passieren konnten, denn Glogau wurde zur Festung
erklärt. Wir haben 2 Pferdewagen organisiert und mit Verbänden, sowie medizinischen Instrumenten beladen. So kamen wir
bis nach Lübbenau im Spreewald, wo wir in einem Schloss, in zuvor ein Museum war, unser Lazarett untergebracht haben.
Weil die Amerikaner Cottbus bombardiert hatten, wurden die Verwundeten zu uns nach Lübbenau gebracht. Hier haben wir
Tag und Nacht gearbeitet, um die vielen Verwundeten, aus den schweren Kämpfen bei Grünberg und Sagan zu versorgen. Die
Soldaten von der Abwehrfront kamen schon mit abgestorbenen Armen oder Beinen bei uns an, weil in vorderster Linie keine
Frontlazarette mehr vorhanden waren; es mussten viele Amputationen durchgeführt werden. Als für unsere Pferde kein Heu
mehr vorhanden war, schickte mich unser Hauptfeldwebel, zu einem Bauern in den Spreewald, mit dem Auftrag, Futter zu
besorgen. Mit noch zwei Mann fuhren mit zwei Kähnen, zuerst den Hauptstrom entlang und dann in einen Nebenarm; da haben
wir die Boote beladen und brachten das Heu nach Lübbenau.
Als wir uns bei unser Einheit zurück melden wollten, war alles schon marschbereit. Ich bin schnell in einen Bus
eingestiegen der sofort losfuhr, weil russische Verbände schon in sichtweite waren. Russische Flugzeuge kreisten über
den Dächern und nahmen, mit ihren Bordwaffen jeden unter Beschuss, der sich irgendwo blicken ließ. Wir konnten nur
durch den Wald, oder in der Nacht vorwärts kommen, denn wenn ein Auto auf der Landstraße fuhr, war alsbald ein Flugzeug
hinter ihm her und schoss es in Brand. Als wir nach Tagen am Ufer der Elbe ankamen, war bereits eine Ponton-Brücke
erstellt worden, welche die zerstörte Brücke ersetzen sollte.
Durch die vielen Fahrzeuge waren in den Sand tiefe Spuren gefahren, so dass andere Fahrzeuge unsere Busse ins
Schlepptau nehmen mussten, weil wir mit eigener Kraft nicht mehr weiterkamen. Beiderseits der Trasse standen
Flüchtlingswagen, in der der Hoffnung die Brücke passieren zu können, doch SS-Polizei verhinderte das die Gespanne den
militärischen Rückzug zum Stillstand brachten. Es gelang uns die Elbe zu überqueren, um in einem Waldstück Schutz vor
feindlichen Fliegern zu suchen.
Als wir unsere Busse und Autos gut getarnt hatten, hat unser Bataillonschef die anwesenden Parteigrößen zu sich
gerufen und ihnen erklärt das wir eine Einheit des Roten Kreuzes sind und nach internationalem Recht keine Waffen
besitzen dürfen. Nach langer, erregter Diskussion wurde beschlossen einen Graben auszuheben und alles im Sand zu
verscharren. Als wir dann weiter, durch die Dörfer fuhren, sahen wir schon viele weiße Bettlaken, als Zeichen der
Kapitulation, aus den Fenstern hängen. Es wurde uns erzählt dass der Bürgermeister von der SS erschossen wurde, weil
er die Bevölkerung zu diesem Schritt ermutigt hatte. Jetzt waren hinter uns die Russen und vor uns schon die Amerikaner.
Amerikanische Panzer fuhren umher und schossen wild durch die Gegend, ohne ein Ziel anzuvisieren. Niemand wollte sich
dem Russen ergeben, doch der Weg der zu den Amerikanern führte, war durch abgesägte Bäume blockiert. Wir sind schnell
in das nächste Dorf gegangen, haben uns Sägen und Äxte besorgt, die Bäume durchgesägt und in den Straßengraben
geworfen.
“ Nach dem Ende des 2. Weltkrieges.”
In amerikanische Kriegsgefangenschaft
Dann fuhren wir unter internationaler Flagge an eine Mulde Brücke, vor der zwei amerikanische Soldaten, mit Zigarren,
zur Hälfte im Mund, standen. Sie rauchten und kauten gleichzeitig. Wir mussten auf einen freien Platz fahren, alle
aussteigen und rechts wieder antreten. Wäschebeutel und Tornister mussten wir abstellen; danach wurden wir nach Waffen
durchsucht, Wertsachen, Uhren und Messer wurden uns gleich abgenommen. Als wir anschließend an unserem Gepäck
vorbeigingen durfte niemand was mitnehmen. Als ich gebückt, nach meinem Wäschebeutel greifen wollte, in dem sich noch
3 Konservendosen und ein Brot befanden, bekam ich einen Fußtritt ins Gesicht, so dass mir ein Zahn ausgeschlagen wurde.
Wir wurden dann in einem Garten zusammen getrieben und gefragt ob jemand bei der SS gedient hat. Nachdem wir in Reihe
und Glied angetreten waren, mussten wir den Oberkörper freimachen und die Arme anheben. Es wurde nach SS-Zeichen
gesucht, die gewöhnlich unter dem Oberarm eintätowiert waren. Nachdem wir Grimma bei Leipzig, wo wir in amerikanische
Gefangenschaft geraten waren, verlassen hatten, mussten wir durch ganz Thüringen bis Hersfeld, an der Grenze zu Hessen,
marschieren. In Hersfeld wurden wir auf große Lastautos verladen, die von farbigen Soldaten gefahren wurden. Man hat
uns mit Stöcken hinauf getrieben, solange bis das Auto so voll war das man kaum stehen konnte. Die Soldaten fuhren, für
diese Straßenverhältnisse, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Wenn die Straße eine scharfe Kurve hatte, flogen
wir alle übereinander und mussten erst mit viel Kraftanstrengung auf die Beine kommen um diese Fahrt zu überstehen.
Da die Straßenränder in dieser Gegend mit Obstbäumen bepflanzt sind und deren Äste sehr niedrig hängen, hätten die
uns die Köpfe abgerissen, wenn wir uns nicht ständig geduckt hätten. Unsere Fahrt endete in Bad Kreuznach, in der Pfalz,
wo wir in ein Lager, in dem sich später 130.000 Mann und 6 Generäle befanden, eingepfercht wurden. Die Unterkunft der
Generäle befand sich unter einem Zelt, alle anderen mussten die Zeit unter freiem Himmel zubringen. Die Offiziere, die
Unteroffiziere, die Mannschaften; wurden in getrennten Camps untergebracht. Die Mannschaften wurden auch zur Arbeit
abkommandiert und konnten bei dieser Gelegenheit, Brot, Brötchen oder Zigarettenstummel organisieren, wogegen die
Offiziere und Unteroffiziere ihr Camp überhaupt nicht verlassen durften.
Die ersten Tage gab es kein Wasser und kein Brot, so dass die Kameraden vor Erschöpfung umfielen. Später standen wir
manchmal den ganzen Tag nach Wasser an, das von den, uns bewachenden Negern mit großen Wassertanks angefahren wurde. Am
dritten Tag bekamen wir mittags und abends etwas zu Essen; Brot bekamen wir erst nach zwei Wochen, nach dem aus der
Umgebung herbeigeholte Handwerker, Backöfen gebaut hatten. In den verschiedenen Gemeinden, die in den uns umgebenden
Weinbergen lagen, mussten sich alle Männer beim Bürgermeister melden. Als sie dann erschienen waren, wurden sie auf
bereitstehende Lastautos getrieben und zu uns ins Lager gebracht. Sie waren ohne Kopfbedeckung und ohne wärmere
Bekleidung angekommen, weil ihnen gesagt wurde, dass ihr Aufenthalt im Lager nur von kurzer Dauer sein würde. Man hat
uns, falls noch vorhanden, Decken und Mäntel abgenommen, mit der Begründung, sie würden für Kranke und Verwundete
gebraucht. Jeden Tag starben mehr als 200 Mann, die wir sofort in ein Zelt tragen mussten. In der Nacht wurden die
Toten dann mit unbekanntem Ziel, weggefahren.
Viele haben ihren Verstand verloren uns irrten im ganzen Camp ziellos umher. Als Latrinen wurden Gräben ausgehoben, in
die verschiedene Kameraden, bei der Verrichtung ihrer Notdurft, vor Schwäche hineingefallen sind und nicht mehr wieder
heraus kamen. Aus den Pfählen die, die jungen Obstbäume stützten, haben wir Krankentragen gebaut um unsere Kameraden,
bei Bedarf, zur Krankensammelstelle zu tragen. Es war in diesem Frühjahr auch sehr kalt, doch unsere Erdlöcher, die wir
zum Schutz vor Kälte und Wind, nur mit leeren Konservendosen ausgehoben hatten, durften nicht tiefer als 20 Zentimeter
sein. Nach jedem Regenguss mussten wir das Wasser ausschöpfen. Nach einem Gewitter, standen wir wiedermal, total
durchnässt in unserem Camp, als unerwartet am Horizont die Sonne hervortrat. Einer unserer Kameraden hatte noch eine
Trompete gerettet und fing, von dem Anblick völlig überwältigt, zu spielen an: "Es geht alles vorüber, es geht alles
vorbei, nach jedem Dezember, folgt wieder ein Mai". Daraufhin hob sich die Stimmung der tiefbetrübten Kriegsgefangenen,
so das Heimatlieder durch das ganze Camp erklangen, obwohl wir in den nassen Kleider herumgehen mussten, bis sie am
Körper trocken wurden.
In französischer Kriegsgefangenschaft
Nach etwa einem Monat, haben uns die Amerikaner, den Franzosen, zum Arbeitseinsatz, ausgeliefert.
Etwa 4 Kilometer von Bad Kreuznach entfernt, stand auf freier Strecke, ein Zug mit offenen Kohlenloren, auf den wir
verladen wurden. In jeden Waggon, wurde pro Person eine Tafel Schokolade und ein Päcken Zwieback rein geworfen, doch
viele Kameraden fanden nur leere Päckchen vor, weil die schon zuvor von der französischen Wachmannschaft geplündert
wurden. Wir haben uns darüber beschwert, doch die haben uns nur ausgelacht. Nachdem wir zunächst bei Mainz über den
Rhein fuhren, endete unsere Fahrt bei Paris in einem großen Zeltlager. Dort wurden wir auf andere Züge verladen, die uns
nach Südfrankreich, in ein Barackenlager, bei Mazarei, brachten.
Auf einer Zwischenstation hat man uns unter einer Pumpe, die Lokomotiven mit Wasser versorgt, abgestellt, den Kran
aufgedreht und uns anschließend ausgelacht, die Kinder Haben uns mit Steinen beworfen. Ein Wachmann kam in unseren
Waggon gekommen, hat unser Gepäck durchsucht, wenn er Tabak oder Zigaretten gefunden hat, nahm er sie mit. Die Kameraden
waren darüber so empört, dass sie vorhatten, ihn nachts unter den Waggon zu werfen. Wir haben sie gebeten dass zu
unterlassen, weil man uns in diesem Falle, alle erschießen würde.
Als wir ins Lager kamen wurden wir zuerst gezählt, dann mussten wir unser Gepäck stehen lassen und beiseite treten.
Wenn man bei der Nachkontrolle noch was in den Taschen fand, wurde das auch entwendet, selbst Esslöffel. Wir wurden
dann in drei Baracken, ohne Toiletten, eingeschlossen. Die Kameraden haben ihre Bedürfnisse in Kochgeschirre erledigt
und durch ein kleines Fenster, das sich fast unter der Decke befand, hinausgeworfen. Andere Fenster ließen sich nicht
öffnen, weil sie mit Stacheldraht zu geflochten waren. Als die Kameraden die Kochgeschirre auskippten, haben die
Wachposten geschossen und die Fenster zertrümmert. Sie waren der Meinung dass wir ausbrechen wollten. Es herrschte eine
große Hitze, in den überfüllten Baracken sind wir fast erstickt. Am nächsten Tag haben wir uns über fehlende Toilettem
beschwert, da haben sie Heringsfässer durch die Hälfte geschnitten und an der Ausgangstür hingestellt. Um bei den
überfüllten Räumen dort hinzukommen, musste man über die Köpfe der Anderen steigen. Viele hatten Fieber und Durchfall
und mussten in die Krankenstube eingeliefert werden, wo sie kurz darauf verstarben.
Besonders Raucher litten sehr an der Unterernährung, bekamen Wasser in den Beinen und waren die Ersten die verstarben.
Nach der Registrierung wurden wir auf andere Baracken verteilt. Die Zivilbevölkerung kam in die Räume und begann uns
auszuplündern. Wer noch gute Schuhe besaß musste sie ausziehen und bekam dafür die kaputten des Plünderers. Eine Woche
lang mussten wir diesen Zustand ertragen, erst als die Kameraden sich beschwerten, wurde am Eingang eine Tafel am
Eingang angebracht, dass die Zivilbevölkerung das Lager nicht betreten darf. Bis auf einige, wenige Ausnahmen wurde
diese Anweisung befolgt.
Als wir im Lager ankamen, war der französische Lagerkommandant, ein ehemaliger Kriegsgefangener, der bei einem Bauern
in Deutschland gearbeitet hatte. Dieser Bauer war jetzt als Kriegsgefangener in seinem Lager. Als er ihn erkannte, hat
er ihn gleich zum Küchendienst eingeteilt und mit dem nächsten Krankentransport nach Hause fahren lassen. Zu Mittag
bekamen wir nur gekochte Haferkörner, da schwamm alles oben, später war man dann auf Gerste umgestiegen. Als viele
daran gestorben waren, weil sie diese „Rohkost”, die nur ein Kuhmagen verträgt, nicht gegessen haben, hat man die
Körner durch eine Schrotmühle laufen lassen. Dann hat man uns Steckrüben gekocht; wir bekamen 250 Gramm Weißbrot,
etwas Quark und ein viertel Liter Magermilch. Später, als wir schon arbeiten mussten, hat man in unserem Essen einen
Kuhkopf mitgekocht, das hat dann bedeutend besser geschmeckt.
Bevor wir morgens zur Arbeit gingen, mussten wir zu Flaggenparade und abends, nach der Rückkehr, haben wir die Flagge
wieder eingeholt. Wir haben einen Kanal gereinigt, dessen Sohle 2 Meter dick mit Schlamm bedeckt war. Zuerst wurde das
Wasser abgelassen, dann haben wir, einer dem andern, den Schlamm mit der Schippe hoch gereicht. Der Letzte hat den
Schlamm, der so zäh war, dass er nicht von der Schippe wollte, oben am Rande abgelegt. Manchmal waren 10 Mann nötig um
den Höhenunterschied zu überwinden. Das Wachpersonal schoss über unsere Köpfe hinweg und rief: „schnell arbeiten”. Bei
der großen Hitze war das ein Ding der Unmöglichkeit, zumal es nichts zu Trinken gab. Auf dem Heimweg haben wir im Walde
Heilkräuter gesammelt, die man in der Küche getrocknet und als Tee zubereitet hat, den wir am nächsten tag zur Arbeit
mitnahmen, um unseren Durst zu stillen.
Unser Aufseher hatte einen Stock, an dem sich noch kurz abgeschnittene Äste befanden. Wer seiner Meinung nach, nicht
ordentlich gearbeitet hat, bekam gleich Schläge auf den Rücken. Die weißen Aufseher wurden irgendwann durch Neger
ersetzt, die uns bedeutend besser behandelt haben. Wenn irgendetwas schief ging, haben sie nichts gesagt, nur gelacht.
In den übrig gebliebenen Wassertümpeln hatten sich noch einige Aale versteckt, die wir zu fangen versuchten, was uns
auch manchmal gelang. Wir mussten ihnen das Genick brechen, damit sie uns nicht entwischen konnten. Wenn die Franzosen
bemerkten das wir Aale hatten, wurden sie uns abgenommen. Gelang es uns aber, sie ins Lager zu bringen, dann haben wir
uns eine köstliche Malzeit zubereitet.
Um sicherzustellen dass niemand geflüchtet ist, wurden wir, wenn wir abends ins Lager zurückkamen, zuerst gezählt.
Diese Zählung wurde mehrmals wiederholt, weil die Wachmannschaften sich immer wieder verzählt haben. Als einer von uns
hin ging, ihnen sagte dass alle da sind, wollten sie es nicht glauben und haben uns vor dem stehen lassen, bis es ihnen
irgendwann einfiel. uns doch das Tor zuöffnen. Einmal, als wir von der Arbeit zurückgekehrt waren, standen wir bis 23
Uhr neben der Flagge, weil uns niemand das Tor geöffnet hat. Als wir dann doch irgendwie ins Lager kamen haben wir
festgestellt, dass das ganze Wachpersonal betrunken war und niemand im Stande uns das Tor zu öffnen.
Eines Tages waren wir wieder abends zur Parole angetreten, als ein älterer Herr mit seinem Hund, am Stacheldraht
entlang, spazieren ging. Weil der Hund, unterm Stacheldraht hindurch, zu uns kam, hat ihn einer geschnappt, ihm das
Genick gebrochen und unter seiner Jacke versteckt. Der Franzose hat nach seinem Hund gerufen und gepfiffen, aber alles
vergebens, der Hund war nicht aufzufinden. Die Kameraden haben ihm gleich das Fell über die Ohren gezogen, das Fleisch
gekocht und das Fell in die Latrine geworfen. Das Fleisch wurde umgehend verspeist.
Als wir am nächsten Tag von der Arbeit zurückkehrten, war im Lager der Teufel los. Wir mussten sofort antreten und
wurden gefragt, wo der Hund geblieben ist, der Gestern Abend, mit seinem Herrchen, am Zaun entlang spazieren ging. Als
sich niemand dazu bekannte, mussten wir weiterhin stehen bleiben, während die Wachmannschaften von Baracke zu Baracke
gingen und alles durchsuchten. In einer Latrine hat man dann das Fell gefunden, was uns ein furchtbares „Donnerwetter”
einbrachte und in den nächsten Tagen, nach der Arbeit, unter dem Kommando eines Oberfeldwebels, eine Stunde
nachexerzieren.
In Südfrankreich regnet es den ganzen Sommer nicht; die Bauern haben da keine Scheunen und das Getreide wir nur in
Schobern aufgestellt und dann umgehend gedroschen. Vom Oktober bis Dezember regnete es fasst jeden Tag in Strömen.
Gesät wird nur im Frühjahr und im Herbst, weil im Sommer alles vertrocknet. Es wird viel Wein angebaut und die
Steckrübe wächst den ganzen Winter. Neben den Weinreben wurde aus Schieferplatten ein Zaun aufgestellt, um dem Wein
einen optimalen Standort zu sichern. Die Bauernwagen hatten nur zwei Räder und waren nur mit einem Pferd bespannt, das
die ganze Balance des Wagens zu halten hatte. Trotzdem haben sie soviel aufgeladen wie wir auf einen Leiterwagen. Viele
Kameraden wurden den Bauern zur Arbeit ausgeliehen. Wenn ein Bauer einen Arbeiter gebraucht hat und es wurde gefragt,
wer sich in der Landwirtschaft auskennt, da haben sich alle gemeldet. Der Bauer konnte sich dann aussuchen, wen er
mitnehmen wollte.
Wenn wir durch die Stadt zur Arbeit gingen, haben verschiedene Leute Fallobst in die Abfalleimer gelegt. Wenn das von
den Kameraden bemerkt wurde, schwenkten viele aus der Reihe, um sich etwas mit zunehmen, was von den Wachmannschaften
nicht gern gesehen wurde. Viele Kriegsgefangene hatten keine Schuhe mehr, sie haben die Füße nur mit Lumpen bewickelt.
Eines Tages kamen Kameraden aus Norwegen, die nach Deutschland entlassen werden sollten. Mann hat sie jedoch ins Lager
gesteckt und zur Arbeit eingeteilt. In Norwegen hatten sie Kleider und Stoffe eingekauft, hatten volle Seesäcke und
sogar Karren auf 2 Rädern, weil sie ja in die Heimat entlassen werden sollten. Als wir morgens zur Arbeit rausgeführt
wurden standen sie schon vor dem Lager. Wir haben ihnen zugerufen, dass sie uns etwas abgeben sollen, weil ihnen ja
sowieso alles abgenommen wird, aber sie haben uns nur ausgelacht. Als sie ins Lager Kamen mussten sie ihr Gepäck
ablegen, wurden dann wo anders hingeführt und haben es danach nie wieder gesehen.
Durch die vielen Läuse, Flöhe und Wanzen die wie im Lager hatten, kam es bei verschieden Kameraden, an den
Einstichstellen, zu eiternden Entzündungen. Um dem vorzubeugen hat man uns mit einem Pulver, das in Frankreich
hergestellt wurde, aber bei den Parasiten keine Wirkung zeigte, eingesprüht. Erst bei der Anwendung eines Mittels
amerikanischer Herkunft, war alles über Nacht verschwunden.
Der Sonntag war arbeitsfrei. Dann kam ein katholischer, französischer Pfarrer, eskortiert von 3 Mann, mit
aufgepflanztem Seitengewehr ins Lager und hat Gottesdienst gehalten. Einen evangelischen Pfarrer gab es nicht, nur
einen Baptisten Prediger. Der wurde würdevoll eingekleidet, bekam ein großes Kreuz und hat jeden Sonntag in einer
extra dafür hergerichteten Baracke Gottesdienst gehalten. Wer Theologie studiert hatte und sich meldete, wurde zu
einem Seminar geschickt und konnte sein Studium fortsetzen. Glasbläser durften das Lager auch verlassen und ihrem
erlernten Beruf wieder arbeiten.
Wer sich freiwillig, für 5 Jahre, zum Dienst in der Fremdenlegion verpflichtet hat, das waren etliche unter uns, wurde
neu eingekleidet, bekam gutes Essen und Rauchwaren soviel er wollte. Nach einem Jahr wurden, nach und nach, die
Kranken und Körperbehinderten in die Sowjetische Besatzungszone entlassen. Eine Entlassung von Kriegsgefangenen, die
in den Westzonen oder jenseits von Oder und Neise zu Hause waren, war nicht vorgesehen. Die Österreicher wurden alle,
unabhängig von ihrem Gesundheitszustand entlassen.
Ich habe Briefe nach Hause geschrieben, aber die kamen nur bis Allenstein und wurden wieder zurück geschickt. Als eine
Kommission des Roten Kreuzes aus der Schweiz unser Lager besichtigt hat, haben wir uns beschwert, das wir als
Sanitätsdienstgrade, zur Arbeit gehen müssen. Daraufhin erging ein Befehl: Wer einen vom Roten Kreuz, ausgestellten
Ausweis besitzt, gehört einem internationalen Verband an und braucht nicht zu Arbeit gehen. Aus unserem Lager hatten
sich 20 Mann gemeldet, die daraufhin Freigang, in Begleitung von zwei französischen Wachsoldaten erhielten. Als wir
gefragt wurden wo wir hin wollen, entschlossen wir uns, einen Soldatenfriedhof, auf dem unsere verstorbenen Kameraden
beerdigt waren, zu besuchen.
Da der Untergrund in dieser Gegend aus Felsen bestand, wurden die Gräben, in denen die Toten in selbst gezimmerten
Kisten nebeneinander gestellt wurden, mit Hilfe von Dynamit ausgehoben. Ein Leichenwagen, mit einem Pferd bespannt,
das mit einer schwarzen Decke abgedeckt war, wurde von einem Kutscher in angemessener Kleidung, gefahren. Der Wagen
konnte gleichzeitig 4 Kisten transportieren. Wenn wir von der Arbeit kommend, dem Leichenwagen begegneten, wurde
gehalten und mit einer Schweigeminute der Toten gedacht, bis der Wagen vorbei war. Die Zivilbevölkerung verharrte auch
im Schweigen, mit abgenommener Kopfbedeckung.
Ein Kamerad, der in Krottorf, Kreis Oschersleben, bei Magdeburg, zuhause war, sagte bei seiner Entlassung zu mir:
Sollte ich das Glück haben, meine Entlassungspapiere zu erhalten ohne eine Bleibe vorzuweisen, dann soll ich Krottorf
als Heimatadresse angeben. Auf der Krankenstube habe ich angegeben, dass sich noch ein Schrapnellsplitter, aus dem
Ersten Weltkrieg, in meiner Kreuzbeingegend befindet, er zwar verkapselt ist, aber immer noch Beschwerden verursacht.
Daraufhin wurde ich zur Entlassung vornotiert. Als bekannt wurde das ein Rückkehrertransport in die sowjetische
Besatzungszone zusammengestellt wird, habe ich mich sofort gemeldet und wurde für ein Entlassungslager in Angoleme
vorgesehen. War das eine Freude, als uns mitgeteilt wurde, wann der Rücktransport stattfindet.
In unserem Lager waren noch 2 Kameraden aus dem Kreis Ortelsburg: Ein Gustav Lumma aus Leynau und ein Alfred Moritz
aus Groß Schöndamerau. Sie mussten noch zurückbleiben und haben mir den Auftrag erteil, die Angehörigen in der Heimat
zu grüßen und ihnen die Anschrift mitzuteilen. Als wir im Entlassungslager ankamen, fragte man uns nach unserer
Heimatanschrift. Dann wurden die Entlassungspapiere angefertigt. Es wurde uns auch ein Barscheck, für die in Frankreich
geleistete Arbeit ausgehändigt, den wir bei jeder Kasse in Deutschland einlösen könnten. Ich habe ihn bis zum heutigen
Tage nicht einlösen können, obwohl ich irgendwann in der Zeitung gelesen habe, das Verrechnungschecks die den aus
französischer Kriegsgefangenschaft Entlassenen, ausgehändigt wurden, einzulösen sind.
Wir kamen zuerst nach Saar Elbe, dann in die Nähe der Zonengrenze zu Thüringen. Hier mussten wir 2 Tage warten, weil
aus der sowjetischen Besatzungszone keine Eisenbahnwagen bereitgestellt wurden. Angesichts dessen, das der Russe beim
letzten Transport die aus Frankreich kommenden Wagen kassiert und nicht mehr herausgeben wollte, bestand der Franzose
jetzt darauf, seine Wagen sofort wieder mitzunehmen. Als der sehnsüchtig erwartete Zug endlich eintraf, durften wir
umsteigen und kamen, immer noch hinter Stacheldraht, nach Erfurt. Von dort weiter ins Quarantänelager nach Prätsch an
der Elbe.
Unter Androhung von Strafe war es verboten das Lager zu verlassen, doch der Hunger zwang uns dazu, in den umliegenden
Dörfern um Lebensmittel zu betteln. Man drohte uns damit, dass Zuwiderhandlungen, mit einer 14-tägigen Verlängerung der
Quarantäne geahndet werden. Der Roggen war schon reif und wir haben, auf den umliegenden Feldern, die Ähren abgerissen,
das Korn, zwischen 2 Steinen zu Mehl zerrieben, um daraus eine Suppe zu kochen, denn von dem was unsere Lagerküche uns
bieten konnte, war es nicht möglich zu überleben. Als der Eigentümer bemerkte wer seine Roggenähren entwendet hat, kam
er ins Lager, gerade zu dem Zeitpunkt als wir mit dem Mahlen beschäftigt waren. Der Lagerkommandant, bei dem er sich
beschwerte, drohte uns zu bestrafen, wenn wir unsere „Rauzüge” nicht unmittelbar einstellen würden. Wir sagten ihm er
solle uns heimfahren lassen, da wir doch lange genug hinter Stacheldraht gesessen hätten.
Endlich wieder in Freiheit
14 Tage nach unserer Ankunft wurden uns Entlassungspapiere ausgehändigt, sowie auch Fahrscheine
zum den, von uns angegeben Heimatorten. So kam ich nach Krottof, Kreis Oschersleben, zu meinem ehemaligen
Kriegskameraden, bei dem ich einen Tag geblieben bin. Er hatte mir schon eine Stelle bei einem Bauern besorgt, der 70
Jahre alt und kinderlos war. Zum Hof, den er mit seiner Ehefrau bewirtschaftet hat, gehörten 36 Morgen Land, 2 Ochsen
und 3 Kühe. Das Ackerland bestand aus 17 Parzellen und sicherte mir einen Arbeitsplatz.
Jetzt, da ich ein Dach überm Kopf und genug zu essen hatte, fing ich an nach dem Verbleib meiner Familie zu forschen.
Bei meinem letzten Heimaturlaub hatte ich mit meiner Frau verabredet; falls wir uns in den Kriegswirren verlieren
sollten, unsere Kontaktadresse, die meiner Quartiersleute in Burscheid, Kreis Opladen, sein sollte. Ich habe zuerst
nach Rohmanen geschrieben, aber leider keine Antwort erhalten. Dann habe ich nach Burscheid geschrieben, und siehe, -
bei denen lag schon eine Anfrage meiner Frau vor, die nach mir gefragt, und ihre jetzige Anschrift hinterlassen hatte.
Ich habe dem Bauern erzählt dass meine Frau sich zurzeit, auf einem Gut, in Alt Steinhorst, im Kreis Rostock, befindet.
Er war sofort bereit uns ein Zimmer zur Verfügung zu stellen, wenn ich meine Frau nach Krottorf rüberholen wollte. Das
habe ich Ihr mitgeteilt und sie war sofort bereit ihren Wohnsitz nach Krottorf zu verlegen, denn sie wohnte dort in
einem kleinen Stübchen unterm Dach.
Im Herbst, als die Feldarbeit so ziemlich erledigt war, bin ich nach Alt Steinhorst gefahren, um meine Frau und meinen
Sohn Kurt, sowie meinen Sohn Manfred, den ich noch nicht kannte, weil er erst nach der Flucht, am 31. Januar, in Groß
Lüssewitz, geboren wurde, nach Krottorf zu holen. Meine Frau hatte schon Holz für den Winter besorgt und vom Gut, auf
dem sie im Sommer gearbeitet hatte, Mehl und Kartoffeln bekommen. Wir haben das Mehl und andere Habseligkeiten in
Kisten verpackt. Das Holz haben wir einem Bauern gegeben, der uns und unser Gepäck, mit seinem Pferdewagen, zum 14
Kilometer entfernten Bahnhof, nach Ribnitz gebracht hat. Wir sind auch gut in Krottorf angekommen, aber als wir am
nächsten Tag, unsere Kisten vom Bahnhof abholen wollten, haben wir zwar die Kisten vorgefunden, doch der gesamte Inhalt
wurde während der Bahnfahrt entwendet. Die Bahnstation in Krottorf hat die Vorkommnisse zur Kenntnis genommen und
protokolliert, aber unsere Sachen haben wir nie wieder gesehen und mussten wieder bei Null anfangen.
Im Winter musste ich auf der Genossenschaft, unentgeltlich, für die Russen Weizen einsacken. Ich hatte versucht eine
Arbeit als Zimmermann zu bekommen, doch auf dem Arbeitsamt wurde mir gesagt, ich bin Ladwirt und muss auf der
Landwirtschaft arbeiten. Da in den ersten Nachkriegsjahren, auch in der sowjetisch besetzten Zone Arbeitsplätze knapp
waren, mussten auch solche, die einen anderen Beruf erlernt hatten, jede zumutbare Arbeit annehmen. Aus der Heimat
erhielt ich einen Brief, von meiner dort noch lebenden Mutter. Sie schrieb das sie mich noch einmal sehen wollte und
ich sollte doch wieder zurück kommen; Unser Hof wäre nicht von Polen besetzt und sie wäre ganz alleine, weil der Vater
nach dem Durchzug der Front von den Russen erschlagen wurde. Daraufhin habe ich dem polnischen Konsulat in Magdeburg
mitgeteilt, dass ich in Rohmanen eine Landwirtschaft besitze, und um eine Einreisegenehmigung gebeten.
Nach 2 Monaten erhielt ich eine Postkarte, mit der Mitteilung, ich sollte mich persönlich beim Konsulat vorstellen.
Nach Aufnahme meiner Personalien, wurde mir gesagt, das ich benachrichtigt werde wenn mein Antrag genehmigt wird. Ende
Juli 1947 erhielten wir die Einreisegenehmigung nach Ostpreußen, das jetzt unter polnischer Verwaltung stand. Wir
mussten zuerst zum polnischen Konsulat in Berlin-Lichterfelde, wo wir umgeben von einer Trümmerlandschaft, gewartet
haben, bis alle Untersuchungen und Formalitäten erledigt waren.
“ Wieder zurück in Ostpreußen.”
Der schwere Wiederaufbau nach dem Kriege
Dann fuhren wir über Frankfurt/Oder, Posen, Thorn, Allenstein, nach Ortelsburg, wo wir am 2. August 1947 ankamen. Mit
einem zweirädrigen Karren, den ich mir von einem noch in Ortelsburg lebenden Bekanten ausgeliehen hatte und meinem
Sohn Manfred im Kinderwagen fuhren wir nach Rohmanen. Meine Mutter war inzwischen verstorben und auf dem Hof war nur
meine, inzwischen aus Russischer Gefangenschaft wiedergekehrte Schwester, Frieda Pelkowski.

Es war alles ausgeplündert; kein Vieh, keine Maschinen und der ganze Hof mit kniehohem Graß überwachsen. Nur schmale
Trampelpfade, vom Haus zum Holzschuppen und zum Klo, durchkreuzten das satte Grün. Ich habe das Gras auf dem Hof mit
einer Sense, die ich noch gefunden habe, abgemäht, damit der Hof nicht so verwahrlost aussah. Am nächsten Tag habe ich
mich bei der Polizei in Ortelsburg angemeldet, wo ich auch ein Startgeld von 100 Zloty erhielt und Gepäckstücke, die
ich in Krottorf aufgegeben, am Bahnhof abgeholt. Es hat mich sehr gewundert das, das Gepäck überhaupt angekommen ist.
Da man von der Landwirtschaft nicht Leben konnte, habe ich mich in den nächsten Tagen, bei der jetzt polnischen Bahn,
um Arbeit beworben und wurde auch angenommen. Wenn wir unseren Monatslohn bekamen, saß immer einer am Tisch, der von
uns 100 Zloty für den Wiederaufbau von Warschau verlangte. Wenn ich dran war, riefen die Anderen, ich hätte Warschau
zerstört und müsste deshalb 200 Zloty abgeben. Nach 3 Jahren kam eine Verfügung, die besagte, dass wer länger als 1
Jahr bei der Bahn beschäftigt ist, angestellt werden muss. Um diese Bestimmung zu umgehen hat man mich entlassen und
eine Woche später wieder eingestellt.
Als ich vor Ablauf des nächsten Jahres, aus dem gleichen Grunde wieder entlassen wurde, habe ich mich bei der
Stadtverwaltung in Ortelsburg(jetzt Szczytno)beworben, wo ich zuerst im Gaswerk als Heizer und später auf Baustellen
als Zimmermann gearbeitet habe. Wir haben durch den Krieg beschädigte Häuser repariert, in den ehemals touristischen
Zentren einige Ausbesserungen an den Einrichtungen durchgeführt, eine Ziegelei wieder in Betrieb gesetzt und andere
anfallende Arbeiten verrichtet. Im Dach des Rathausturmes war während der Kämpfe eine Granate eingeschlagen, die, die
Dachlatten und die Verschalung zerstört hatte. Da wir, unter schwersten Bedingungen, den Schaden repariert haben,
wurde uns eine Höhenzulage versprochen, die wir aber nicht bekommen haben.
Aus Verärgerung darüber habe ich bei der Stadtverwaltung gekündigt und bei einer Wiederaufbaufirma unter der Leitung
von Bauingenieur Laskowski wieder angefangen, wo ich bis 1954, als Zimmermann beschäftigt war. Ab da habe ich mich
nur um meinen Hof gekümmert, der wegen meiner Arbeitsstellen, gezwungenermaßen, sehr vernachlässigt wurde. Als wir
1947 zurückkamen, brachten wir unseren Sohn Manfred noch im Kinderwagen. Den hat meine Frau zum Markt gebracht,
verkauft, und dafür eine Ziege erworben, die dank guter Pflege, uns täglich mit 4 Liter Milch versorgte. Das war der
erste Baustein zum Wiederaufbau, unserer durch den Krieg zerstörten, und danach ausgeplünderten Landwirtschaft.
Während meiner Arbeit bei der Bahn haben wir uns eine Kuh gekauft, die nach einem halben Jahr, wegen nicht bezahlter
Grundsteuer, vom Gerichtsvollzieher gepfändet wurde. Man hat uns die Kuh weggenommen und bei einem Arbeiter, der in
der Ernst-Mey-Straße in Ortelsburg wohnte und sie wegen nicht vorhandener Futtermittel, nur mit Kartoffelkraut
gefüttert hat, untergestellt. Als ich bei der Bahn meinen Monatslohn bekommen habe, bin ich zur Gmina gegangen, habe
eine Rate angezahlt und durfte dann die Kuh wieder mit nach Hause nehmen. Durch die schlechte Ernährung war die Kuh
stark abgemagert und lieferte nur die Hälfte der ursprünglichen Milchleistung.
Später habe ich ein Pferd auf Abzahlung bekommen, das 140.000 alte Zloty gekostet hat. Die Stute war schwach und unser
Feld sehr hügelig, so dass man nur bergab pflügen konnte, was sehr beschwerlich war, bergauf ging es immer im Leerlauf.
Später habe ich die schweren Böden mit dem Traktor umpflügen, und in den letzten Jahren auch mit dem Binder mähen
lassen. Von der Stute habe ich 2 schöne Fohlen gezogen; ein davon habe ich bei der Ausreise in die Bundesrepublik
mitgebracht und bei der Viehverwertungs-Genossenschaft in Göttingen verkauft. In den ersten Nachkriegsjahren als noch
wenig Land bestellt wurde, breiteten sich auf den nicht beackerten Flächen, Wildkräuter aus. Disteln und andere
Schnellwachsende, erreichten manchmal eine Höhe von 2 Meter, besonders auf den schweren Böden.
Es hat viel Schweiß gekostet ehe man den Acker soweit hatte, das er auch befriedigende Erträge abwarf. Die
Währungsreform von 1950, hat unser weiniges Geld das wir schon gespart hatten, wieder vernichtet. Ich hatte 2 Pferde,
1 Fohlen, 2 Kühe und Schweine, als ich wieder aufgefordert wurde nicht bezahlte Grundsteuern nachzuzahlen. Als ich
nicht bezahlen konnte, hat der Vollziehungsbeamte, ein Fohlen, eine Kuh und ein Schwein gepfändet. Es gelang mir jedoch
nach längeren Verhandlungen, ohne größere Verluste, alles zu regeln. Später kam eine Verfügung, die besagte; wenn
jemand auf seinem Hof nur eine Kuh und ein Pferd hatte, durften sie nicht gepfändet werden. Einige haben ihr Inventar
dieser Verfügung angepasst und dadurch die Zahlung von Grundsteuer umgangen.

Wer seine Steuern pünktlich bezahlt und sein Kontingent an landwirtschaftlichen Produkten fristgerecht abgeliefert hat,
der konnte seine, darüber hinaus erwirtschafteten Produkte zu marktgerechten Preisen verkaufen. Für eine hochtragende
Sterke, mindestens 400 kg schwer, die auf ein staatliches Gut verkauft wurde, konnte man bis zu 12000 Zloty bekommen.
Unsere Böden waren kalkarm, doch durch den Einsatz von Kalk und Kunstdünger konnte man den Ertrag erheblich steigern.
Kalk und Kunstdünger konnte man bei der Genossenschaft(GS) bestellen, der dann auch direkt auf den Hof geliefert wurde.
Kalk wurde geliefert und gleich auf dem Feld ausgestreut. In den 1960ger Jahren waren alle Ackerflächen der Rohmaner
Felder bestellt.
Die nach dem Krieg zurückgebliebenen deutschen Bauernfamilien, aber auch die Polen, die während des Krieges beim Bauern
in Deutschland gearbeitet haben, versuchten mit teils bescheidenen, oder auch zusammen gesuchten, landwirtschaftlichen
Geräten, die bäuerlichen Betriebe aufrecht zu erhalten. Nach den schweren Anfängen in den ersten Nachkriegsjahren
erzielten sie schließlich einen beachtlichen Erfolg, der sich in wogenden Kornfeldern, sowie in grünen Wiesen auf
denen gut genährtes Vieh weidete, widerspiegelte.
Ein schwerer Einschnitt in meinem Leben.
Am 11. Mai 1956 verstarb nach langer schwerer Krankheit, meine liebe Ehefrau Marta Rattay,
geborene Brosch. Ein Jahr zuvor war schon mein Schwiegervater Gottlib Brosch verstorben. Die schweren Bedingungen
unter denen wir nach Kriegende leben mussten, haben ihrer bereits angegriffenen Gesundheit sehr zugesetzt. Sie
verstarb mit 44 Jahren und hinterließ in unserer Familie eine große Lücke, die nicht mehr zu Überbrücken war. Wir
haben sie unter großer Anteilnahme der noch verbliebenen deutschen Bevölkerung zu Grabe getragen und auf dem Rohmaner
Friedhof beigesetzt. Die Arbeit die sie sonst verrichtet hatte fiel jetzt auf mich und meine Söhne zurück. Meine
Schwester Frieda Pelkowski half auch wo sie nur konnte. Wir waren auf die Unterstützung durch Nachbarn und Freunde
angewiesen, die uns immer wenn es nötig war, tatkräftig unterstützt haben. Im laufe der Zeit haben wir wieder zum
Alltag zurück gefunden, haben sie noch etliche Jahre auf dem Friedhof besuchen können, bis wir, bedingt durch unsere
Ausreise uns endgültig von ihr trennen mussten.
Der endgültige Abschied von Ostpreußen
Ab 1956 begannen, durch die Vermittlung des Deutschen Roten Kreuzes, die ersten Ausreisen in die
Bundesrepublik Deutschland. Zuerst waren es Kinder die zu ihren Eltern ausreisen durften, Familien deren Väter aus der
Kriegsgefangenschaft in den Westen Deutschlands entlassen wurden und andere durch den Krieg getrennte
Familienangehörige. Ab 1960 erhöhte sich die Zahl der Ausreisewilligen aus dem polnisch besetzten Ostpreußen. Es setzte
sich die Überzeugung durch, dass unsere Angestammte Heimat, uns für die Zukunft keine Perspektive mehr bieten konnte.
Meistens wurden die Anträge, die wir an die Passabteilung in Allenstein stellen mussten, um einen Ausreisepass zu
bekommen, negativ beschieden. Nach mehrmaligen Versuchen gelang es dann doch, diese begehrte Ausreiseberechtigung in
Empfang zu nehmen. Die Enttäuschung der Zurückgebliebenen war groß, wenn wieder mal Verwandte oder Nachbarn, den Weg
in Richtung Bahnhof einschlugen.
Um einen Reisepass zu beantragen, musste man zuerst eine Einladung von Verwandten aus der Bundesrepublik vorlegen, in
der, diese sich verpflichten mussten, für Unterkunft und Verpflegung der Eingeladenen zu sorgen. Diese Einladung
musste durch ein Amt in der Bundesrepublik beglaubigt werden. Außerdem mussten die Kosten für die Bahnfahrt, ab
polnischer Grenze, bis zum Zielort, beim polnischen Reisebüro ORBIS, in Warschau, in DM eingezahlt werden.
Unseren ersten Ausreiseantrag haben wir 1964, bei der Kommandantur der polnischen Miliz in Allenstein eingereicht, der
nach einer gewissen Zeitspanne, ohne eine uns verständliche Begründung zu nennen, abgelehnt wurde. Gegen diese
Ablehnung wurde ein Widerspruch zugelassen, den wir sofort einreichten. Nach einer weiteren Zeitspanne erhielten wir
wieder eine Ablehnung, gegen die kein Widerspruch mehr zulässig war. Wer seine Ausreiseabsicht nicht aufgeben wollte,
musste einen neuen Antrag stellen. Es gab Familien die schon 10 Mal einen Ausreiseantrag gestellt hatten und immer
wieder abgewiesen wurden. Da meine Söhne, nicht die Absicht hatten in Rohmanen zu bleiben und ich nach 2 Weltkriegen,
an denen ich teilgenommen, die schwere Arbeit auf der Landwirtschaft, nicht aus eigener Kraft schaffen würde, haben wir
1966 wieder einen Antrag gestellt, der prompt abgelehnt wurde. Der Widerspruch auf diese Ablehnung wurde auch negativ
beantwortet, so dass wir 1968 wieder einen Antrag eingereicht haben.
Weil das Passamt in Allenstein lange nichts von sich hören ließ, hegten wir schon die Hoffnung das es jetzt klappen
würde und waren sehr enttäuscht als wieder eine Absage kam. In der Zwischenzeit sind viele Nachbarn und Bekannte aus
Rohmanen, sowie aus der näheren Umgebung, ausgereist und das Häuflein der noch verbliebenen Deutschen, wurde immer
kleiner. Die Motivation, die uns in früheren Jahren, über so manche schwierige Lage hinweg geholfen hat, ist einer
hoffnungslosen Resignation gewichen. Man war davon überzeugt, dass unser Leben, in unser Angestammten Heimat, keine
Zukunftsperspektive mehr haben konnte und wenn wir keine Ausreisegenehmigung bekommen, wir eines Tages die letzten
Deutschen in der ganzen Umgebung sein werden.
Die Ausreise-Heimat ade
Wir hatten die Hoffnung schon aufgegeben, als am 30. April 1969, der Briefträger unseren Hof
betrat und mir einen Brief überreichte, in dem uns das Passamt in Allenstein mitteilte, dass unsere Ausreise in die
Bundesrepublik Deutschland, genehmigt worden ist. Wir müssten, nach Aushändigung der Reisepapiere, den Geltungsbereich
der Volksrepublik Polen, innerhalb von 3 Monaten verlassen. Wir waren zuerst geschockt, über den Hinweis, das wir
unsere Heimat in 3 Monaten verlassen müssen, aber dann stellte sich die Zukunftsperspektive wieder ein und wir gingen,
wie von einem schweren Ballast befreit und gut gelaunt unser weiteren Tätigkeit nach.
Als der Briefträger unseren Hof betrat, waren ich und mein Sohn Kurt gerade dabei eine Fuhre Mist zu laden. Wir hatten
den Wagen gerade halb geladen und haben nach der frohen Kunde nicht mehr weiter gemacht, sondern die Pferde vorgespannt
und den Mist aufs Feld gefahren, damit wir den Wagen für alle Fälle frei hatten. Das war die letzte Tätigkeit für
unsere Landwirtschaft in Ostpreußen.
Die Nachricht von unserer Ausreise verbreitete sich, ohne dass wir darüber gesprochen haben, wie ein Lauffeuer.
Alsbald kamen Leute aus dem Dorf, die sich für das Vieh und für diverse Landwirtschaftliche Geräte interessierten.
Etliche wollten bestimmte Sachen sofort kaufen, andere haben nur zurücklegen lassen und wollten später kommen und
bezahlen, haben es aber dann doch nicht genommen.

Wenn man eine Landwirtschaft hatte, konnte man 2 Pferde, 2 Rinder, 3 Schweine, 5 Schafe und 10 Hühner, in einem
geschlossenen Viehwaggon, in die Bundesrepublik mitnehmen. Jeden Tag war man unterwegs, von einer Behörde zur Andern.
Die Aushändigung der Reisepapiere erfolgte nur nach Vorlage bestimmter Bescheinigungen: Es mussten alle Steuern bezahlt
sein, das Kontingent landwirtschaftlicher Erzeugnisse musste abgeliefert sein, je eine Bescheinigung vom Katasteramt
und vom Notar musste vorgelegt werden, das man dem polnischen Staat das Grundstück abgetreten hat. Die Gebühren für
die notarielle Beglaubigung mussten wir selbst bezahlen. Wenn man alle Bescheinigungen beisammen hatte, bekam man bei
der Kreisverwaltung eine Gesamtbescheinigung. Mit dieser Bescheinigung konnte man nach Allenstein, zur
Polizeikommandantur fahren, wo man nach dem schriftlichen Verzicht auf die polnische Staatsangehörigkeit, einen
Reisepass ausgehändigt bekam, der den Inhaber zum Grenzübertritt berechtigte, aber nicht zur Wiedereinreise.
Wir haben 2 Pferde, eine Sterke, einen Ochsen, 5 Schafe, 2 Schweine und 10 Hühner mitgenommen. Über die Schutzimpfung
der Rinder musste man eine, vom Kreistierarzt beglaubigte Bescheinigung vorweisen. Ich habe 5 Schafsböcke gekauft, die
ich in der Zwischenzeit, hinter der Scheune, zum Weiden angekettet hatte. Einer von denen hat sich losgerissen und
seinen Nachbarn getötet. Das Fleisch konnten wir noch verkaufen, mussten aber dafür einen anderen Schafsbock kaufen.
Innerhalb von 3 Monaten mussten wir alles regeln und zwei Tage vor der Abfahrt einen Eisenbahnwagen, bei der
Eisenbahndirektion in Allenstein bestellen. Reservierungen bei den polnischen Behörden waren meist immer mit
Schmiergeld verbunden, weil man sonst nie sicher sein konnte dass diese Vereinbarungen auch eingehalten werden. Schon
2 Wochen vor unserer Abfahrt, gab es in Ortelsburg keine alkoholischen Getränke zu kaufen. Meine Söhne mussten mit dem
Motorrad die umliegenden Dörfer abfahren, damit wir für die Reise einen Vorrat anlegen konnten; denn Wodka war zu der
Zeit, in Polen, wie eine zweite Währung.
Am 25. Juli haben wir zusammen, mit meinem Neffen Siegfried Brosch, unseren sonstigen Hausrat, der in Kisten verpackt
war, in einen Eisenbahnwagen, auf dem Allensteiner Bahnhof verladen. Alles musste zuerst durch den Zoll, wo die
Federbetten gewogen wurden und über das erlaubte hinausgehende Kissen, verzollt werden mussten. Dasselbe galt auch für
Fleisch und Räucherwaren.
Am 26. Juli, unserem Verladetag, kam der Eisenbahnwagen aus Allenstein, erst um 11 Uhr auf dem Ortelsburger Bahnhof an.
Die Rinder hatten wir zu Fuß, zum Bahnhof gebracht; Schweine, Schafe und Hühner auf dem Pferdewagen. Im Eisenbahnwagen
mussten, mit Hilfe von Brettern und Bohlen, Boxen für die verschiedenen Tiere erstellt werden. Jedes Pferd und jedes
Rind in eine Bucht. Die Schafe zwischen die Pferde, die Schweine zwischen die Rinder und die Hühner in einem Käfig,
unter der Decke über den Rindern. Die Hühner hatten unterwegs Eier gelegt, somit hatten wir jeden Tag frische
Verpflegung. Bei der Fahrt im Viehwagen, begleitete mich mein Sohn Manfred. Als die Lokomotive nahte, um den Wagen
abzuholen, wurden noch schnell die restlichen Sachen hinein geworfen und so mache Abschiedsträne rollte dann die Wange
hinab.
Unsere Nachbarn, Deutsche und Polen, halfen uns beim Verladen des lebendigen Inventars. Jetzt erinnerte ich mich
plötzlich, an die oft auch schönen, Ereignisse der letzten 22 Jahre. Einer Zeit, in der das Zusammenleben von
Deutschen und Polen, von Jahr zu Jahr, besser wurde. Man half sich beim einbringen der Getreideernte, beim Dreschen
des Getreides, bei der Kartoffelernte und bei anderen Arbeiten, wo viele Menschen zupacken mussten. Es war eine
Dorfgemeinschaft, in schweren Zeiten geboren; jeder half jedem wenn Hilfe nötig war. Es wurde mir plötzlich bewusst,
das jetzt ein Lebensabschnitt zu Ende ging, zu dem ich nicht mehr zurückkehren konnte. Unsere Existenzgrundlage war
jetzt ein Eisenbahnwagen auf einem Schienenstrang, dessen Ende irgendwo in weiter Ferne lag. Obwohl, von langer Hand
vorbereitet, war dieser Moment voller Wehmut.
Doch als der Zug sich plötzlich, in Bewegung setzte, war ich sofort wieder in der Gegenwart. Menschen, mit denen man
Jahrzehnte lang, in gutem Einvernehmen zusammen gelebt hat, blieben plötzlich am Bahnsteig zurück und die Entfernung
zwischen ihnen und mir vergrößerte sich mit jeder Sekunde, bis sie letztendlich aus meinem Blickfeld verschwanden.
Es war ein heißer Julitag, als wir unsere Reise gen Westen antraten. Für die Schweine, die besonders unter der Hitze
zu leiden hatten, haben wir 10 Flaschen Essig mitgenommen und sie von Zeit zu Zeit besprenkelt, damit sie besser atmen
konnten. Für die anderen Tiere war reichlich Heu und Hafer vorhanden. Eine großes Fas und zwei Milchkannen waren mit
Wasser gefüllt, die wir auf den an der Strecke liegenden Bahnstationen, bei Bedarf wieder nachgefüllt haben.
Da der Kreistierarzt nicht in seinem Büro war, konnten wir die Impfbescheinigung für das Vieh, nicht rechtzeitig
herbeischaffen. Der Zug setzte sich in Bewegung und die Bescheinigung war immer noch nicht da. Als die Bescheinigung
dann eingetroffen, wir aber schon unterwegs waren, ist mein Sohn Kurt mit dem Motorrad hinterher gefahren und hat uns
in Passenheim, wo der Zug noch andere Wagen angehängt bekam, die Impfbescheinigung übergeben. Wir waren sehr froh das
er es noch geschafft hat, denn in solch einer Situation fühlt man sich sicherer wenn man alle Bescheinigungen bei sich
hat. Auf der Rückfahrt, mit dem Motorrad hatte er noch eine Panne, musste das Motorrad stehen lassen und per Anhalter
nach Hause fahren. Am nächsten Tag kam er mit Siegfried Deptolla, der das Motorrad wieder flott machte und brachte es
wieder nach Rohmanen zurück.
Die Fahrt mit dem Viehwagen, gen Westen
Von Ortelsburg bis Allenstein(45 km) hat unser Zug 4 Stunden gebraucht, weil auf jedem Bahnhof
gehalten wurde, um neue Wagen anzuhängen. Nachdem wir in Allenstein angekommen waren, kam ein Rangierer und fragte
nach unserem Ziel. Als wir ihm mitteilten, das wir in die Bundesrepublik Deutschland wollen, sagte er nur: „In 10
Minuten fährt ein Zug los. Wenn ich von euch 500 Zloty und einen Liter Wodka bekomme, werde euch sofort anhängen,
andernfalls kommt ihr auf ein Nebengleis und müsst dann auf den nächsten Zug warten. Es blieb uns nichts anderes übrig
als seiner Forderung nachzukommen, denn über derartige Erpressungen hat man bereits von Anderen, die vor uns ausgereist
sind, gehört. Wir wurden auch sofort angehängt und fuhren dann die ganze Nacht, an Osterode, und Thorn vorbei bis
Gnesen. Dort wurde wieder rangiert.
Von einer Anhöhe wurden die einzelnen Wagen auf verschiedene Gleise verteilt und zu neuen Zügen zusammengestellt. Der
Aufprall der ungebremsten Wagen erzeugte eine derartige Erschütterung, dass manche Bretter an den Boxen geborsten waren.
Von Gnesen ging es dann in einem Zuge durch bis zur Grenzstation Reppen(Rzepin). Dort mussten wir zum Zollamt, wo
unsere Ausfuhrpapiere durch die Zollbeamten, und durch einen Tierarzt geprüft wurden. Bis Reppen(Rzepin) haben wir für
den Eisenbahnwagen 900 Zloty bezahlt; hier mussten wir noch einmal 650 Zloty bezahlen. Bei der Wagenkontrolle erklärte
uns ein Bahnbeamter das unser Wagen, sich nicht für den internationalen Transport eignet und wir deshalb den Inhalt in
einen Anderen umladen müssen, der irgendwann, auf dem Nebengleis bereitgestellt wird. Nach langer Verhandlung, sowie
einer Zulage von 500 Zloty und einem Liter Wodka haben wir ihn davon überzeugt, das der Wagen sich doch für die
Weiterfahrt eignet.
In der Nacht war Schichtwechsel, der unseren Wagen wieder abgehängt hat, weil er angeblich von der Reichsbahn der DDR,
wegen technischer Mängel nicht weiterbefördert würde. Wir mussten unsere Verhandlung vom Vorabend wiederholen, die mit
der Zusage endete, dass wir am frühen Morgen, über die Grenze auf DDR Gebiet, gebracht werden. Um 5 Uhr morgens kam
eine Lokomotive, die uns den letzten Abschnitt bis über die Grenze bringen sollte. Als der Zug hat noch einmal anhielt,
kamen polnische Grenzbeamte und Soldaten in den Wagen. Sie durchsuchten ihn und fragten, ob wir noch polnisches Geld
oder einen Grundbuchauszug bei uns hätten. Wir zeigten ihnen 800 Zloty, die sie uns, nach Ausstellung einer Quittung
über 500 Zloty, abnahmen. Die Grundbuchauszüge habe ich, im Stroh versteckt, dem Ochsen vor die Füße gelegt. Falls
jemand da suchen sollte, hätte ich gesagt, das das Tier bösartig veranlagt ist, und ich für seine Sicherheit nicht
garantieren könnte, deshalb sollte er vorsichtig sein.
Als die Grenzkontrolle den Zug verlassen hatte, setzte sich die Lokomotive wieder in Bewegung und überquerte nach
kurzer Zeit die Oderbrücke. Auf einer eingezäunten Fläche, jenseits der Grenze, hat man uns abgestellt hat und die
Lokomotive fuhr zurück auf polnisches Gebiet. Vor und hinter uns waren die Tore verschlossen. Auf den Wachtürmen,
links und Rechts von uns, standen Posten mit einem Gewehr im Anschlag. Vier Grenzbeamte der DDR, jeder mit einer
Leiter in der Hand, sowie ein Schäferhund, kamen zu unserem Wagen. Sie öffneten die Schiebetüre, stellten die Leiter
davor und ließen den Hund in den Wagen springen, der nur etwas herum schnupperte und wieder heraussprang. 2 Beamte
haben dann anschließend, die Papiere kontrolliert und das Inventar gezählt.
Nach einiger Zeit wurden wir an einen Güterzug der Reichsbahn angehängt und fuhren von Frankfurt an der Oder, vorbei
an Berlin, Ellingen und Nordhausen, über die Grenze zur Bundesrepublik bis Herzberg. Hier hat ein Zollbeamter der
Bundesrepublik, die Formalitäten erledigt und ein Tierarzt die Pferde, Rinder und Schweine gründlich untersucht. Ich
musste ihnen die Mäuler aufhalten und die Füße hochheben. Danach hat uns die Lokomotive zu einer Wasserzapfstelle
gebracht, wo wir die Tiere tränken und unsere Behälter mit Wasser auffüllen konnten. Anschließen fuhren wir über
Northeim nach Göttingen, zur Viehverwertungsgenossenschaft, die zuvor von unserer Ankunft in Kenntnis gesetzt wurde.
Der Ochse, die Sterke und die Schweine wurden, in Göttingen zum Schlachthof gebracht; die Pferde kamen nach Hannover
und die Schafsböcke nach Kassel. Wir waren mit dem Viehtransport 5 Tage unterwegs; hatten so manche Klippe umschifft
und Schwierigkeiten gemeistert, die im normalen Leben nicht vorkommen.
Wir wurden mit einem PKW, ins Durchgangslager Friedland bei Göttingen gefahren, wo mein Sohn Kurt, meine Schwester
Frieda Pelkowski und Siegfried Brosch mit Familie, die am 30 Juli, um 14 Uhr, von Warschau mit dem Zug abgefahren, und
hier am 31. Juli in den Morgenstunden eingetroffen sind, schon auf uns gewartet haben. In Friedland hat man uns mit
Familie Siegfried Brosch in einem Raum untergebracht, wir wurden registriert und erhielten 20 DM Überbrückungsgeld,
pro Person. Da wir erst am Freitag in Friedland eingetroffen sind, mussten wir hier über das Wochenende bleiben,
obwohl die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der Regel nur 3 bis 4 Tage beträgt.
Um einen Antrag für die Ausreise stellen zu können, brauchten wir eine Einladung von in der Bundesrepublik lebenden
Verwandten. Diese Einladung hat uns mein Bruder, Ernst Rattay, aus Ingelheim am Rhein zugeschickt. Ingelheim liegt im
Bundesland Rheinland-Pfalz. Das Geld für die Bahnfahrt, hat uns, Frieda Schellin, geb. Nickel, aus Duisburg, die
Tochter unseres Nachbarn, überwiesen. In Friedland wurden wir registriert. Im Registrierschein, war als unser
nächster Aufenthaltsort in der Bundesrepublik, das Durchgangslager Osthofen bei Worms, das alle Aussiedler für
Rheinland-Pfalz aufnehmen musste, eingetragen. Die Eintragung erfolgte deshalb, weil der Ort aus dem uns unsere
Einladung zugeschickt wurde, sich auch in Rheinland-Pfalz befand.
Da ich nach dem Polenfeldzug, als Soldat, ein Jahr im Kreis Opladen, im Rheinland gewesen bin, wäre ich sehr gerne in
diese Gegend gezogen, denn die Erinnerung an die schönen Tage die ich dort verlebt habe war in mir immer noch wach.
Ich versuchte die Eintragung in unseren Regiestierscheinen ändern zu lassen, was nach einigen, vielleicht auch
berechtigten Einwänden, am 4. August, vom Beauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen, genehmigt wurde. Anstelle von
Rheinlad-Pfalz stand da jetzt Nordrhein-Westfalen und am 7. August, fuhren wir, noch mit anderen Aussiedlern, ins
Durchgangslager Unna-Massen, am östlichen Rande des Ruhrgebietes gelegen. Hier wurden wir in einem Zimmer untergebracht
und konnten unser Essen in einer Gemeinschaftsküche zubereiten.
Am 8. August wurden wir in Unna-Massen, als Bürger der Bundesrepublik Deutschland registriert, erhielten
Einhundert DM Begrüßungsgeld, den Vertriebenen Ausweis -A -und 4 Wochen später den Bundespersonalausweis. In
Unna-Massen haben wir mehr als 4 Monate verbracht, weil mein Sohn Kurt, wegen fehlender Berufsausbildung, in Unna, an
einem Grundlehrgang für Metallarbeiter teilgenommen hat, der vom Arbeitsamt finanziert wurde. Am 11 Dezember 1969 sind
wir endlich an unserem vorläufigen Wohnsitz, im Durchgangswohnheim, an der Elisabethstraße 13, in Velbert angekommen.
Ab dem 5. Januar 1970 konnten meine Söhne, in der Zahnradfabrik Reining, in Velbert ihrer geregelten Arbeit nachgehen.
Von Bau- und Sparverein in Velbert wurde uns am 20. Juni 1970, unsere erste Wohnung zugewiesen.
Velbert im Februar 1972
gezeichnet: Gustav Rattay
Nach Neujahr 1918 wurden wir neu eingekleidet und kamen nach Köln zur Baukompanie. Mit Musik wurden wir zum Bahnhof
gebracht. In Köln wurden wir noch mit Soldaten die von andern Truppenteilen dorthin verlegt wurden in einem großen
Kinosaal, im Stadtteil Edengarten untergebracht. Wir brauchten keinen Dienst zu machen und konnten zu Heilige Drei
Könige den Gottesdienst im Dom besuchen. Kameraden die aus irgendwelchen Gründen im Arrest saßen wurden gefragt ob sie
auch am Gottesdienst teilnehmen möchten, dann würde ihnen die Strafe erlassen. Fast alle haben dem zugestimmt. Einige
Tage später wurden wir wieder auf einen Transportzug verladen, der uns über Herbestal, Antwerpen nach Brügge in Belgien
brachte. Hier mussten wir den Zug kurzfristig verlassen und einen Luftschutzkeller aufsuchen, weil Fliegeralarm
gemeldet wurde. Danach ging es wieder weiter nach Turut, Kortemark, Hauseme, Kautremollen, Zaren, Zarenlinde. Dort
wurden wir in verschiedene Gruppen aufgeteilt und einer Pionierkompanie auf dem Pionierpark Struwendorf zugewiesen.
Wir haben hinter Klerken Bunker für schwere Maschinengewehre gebaut. Unsere Arbeit konnten wir nur bei Nebel verrichten,
denn bei Sonnenschein waren wir sofort dem Beschuss der feindlichen Artillerie ausgesetzt. eine Kleinbahn die Munition
und Stacheldraht an die Front brachte war dem Beschuss besonders ausgesetzt. Die Gleise, von schweren Geschossen
zerfetzt, mussten immer wieder hergerichtet werden, damit der Nachschub aufrechterhalten werden konnte. Später haben
wir am Kemelberg bei Armentier, eine Brücke über die Lys gebaut. Um in dem Sumpfgelände einen Untergrund dafür zu
schaffen, mussten wir 10 bis 12 Meter lange Pfähle in den Boden rammen. Ein Feldwebel gab immer den Befehl: „Hoch den
Bär, noch viel mehr, dass man sieht, wie er zieht, denn dieser Pfahl, glatt wie ein Aal, durch Fels und Stein, durch
Wasser und Sand, fürs Vaterland”. Jedes mal mussten wir den Bär an Schnüren hochziehen und dann wieder herunterlassen.
Wenn es manchmal, trotz vieler Mühe nicht mehr weiter ging wurde der Pfahl auf eine bestimmte Länge abgeschnitten.
Nach Fertigstellung der Brücke kamen wir in die Siegfriedstellung bei Kambrei, zum Bau eines Bataillons-Gefechtstandes.
Da der Boden kreidehaltig war, mussten wir die großen Stücke von Hand zu Hand reichen, den Schutt haben wir dann mit
Sandsäcken aus der Baugrube gehoben und mit Ästen getarnt, damit der Stand nicht von feindlichen Fliegern entdeckt
werden konnte. Alle acht Stunden wechselte die Arbeitsgruppe. Wir mussten von der Baustelle durch das Gelände robben,
denn aufrecht gehend war man dem Beschuss der feindlichen Scharfschützen ausgesetzt, die von einem Fesselballon aus
informiert wurden der über den feindlichen Linien stand.
Der Wechsel war mit einem großen Risiko verbunden, und wurde wenn Möglich bei Dunkelheit vollzogen. Um vor
Überraschungen sicher zu sein haben wir spanische Reiter (Stacheldrahtverhaue) gebaut und vor die ersten Gräben
gestellt, die dann oft in der Nacht von den Franzosen geklaut, und dann vor ihren eigenen Linien wieder aufbaut wurden.
Wir hatten aus Bohlen eine Brücke auf Rädern gebaut, die dann in den Graben geschoben wurde, damit die Artillerie und
andere Fahrzeuge über die Schützengräben kamen. Weil um vier Uhr morgens der Beschuss mit Gasgranaten begann, mussten
wir Gasmasken aufsetzen, danach haben feindliche Flieger unsere Munitionskolonne bombardiert und total aufgerieben.
Es wurde auch eine Marinedivision eingesetzt, die bis dahin dem Küstenschutz gedient hatte und jetzt ihren ersten
Einsatz hatte.
Wir sind zuerst ein ganzes Stück in Richtung Amiens vorangekommen, doch dann blieb unser Angriff in den zuvor von
Engländern besetzten Stellungen, stecken. Da die Engländer ihre Stellungen fluchtartig verlassen hatten, fiel ihr
ganzer Proviant in unsere Hände; Schokolade, Weißbrot, Flaschenwein. Die erste Nacht haben wir in einem runden Zelt
verbracht, weil ich mir durch den starken Wind, der da herrschte eine Angina zugezogen hatte, die mit hohem Fieber
verbunden war, konnte ich die vielen Köstlichkeiten überhaupt nicht genießen.
An eine ärztliche Versorgung war überhaupt nicht zu denken, denn es mussten zuerst die vielen Granatlöcher eingeebnet
werden damit die vielen Fahrzeuge und Geschütze wieder weiter fahren konnten. Auch eine Bahnlinie musste repariert
werden, damit die großen Geschütze in Stellung gebracht werden konnten, dabei wurden auch die vielen Kriegsgefangenen,
die bei dieser Offensive gemacht wurden, eingesetzt. Als die Offensive dann schließlich scheiterte, wurden wir an die
Somme verlegt. Da habe ich die Ortelsburger Jäger, die aus Italien an die Westfront verlegt wurden, zum ersten Mal im
Einsatz gesehen.
Unser nächster Einsatzort waren dann Stellungen hinter Laon. Hier wurden die Vorbereitungen zu einer neuen Offensive
getroffen. Feindliche Flieger versuchten uns Tag und Nacht daran zu hindern die Aufmarschwege instand zu halten. Als
die Offensive dann endlich losging, hatten wir die Order eine Brücke über die Oise mit Bohlen und Balken zu verstärken.
Gleich am Anfang der Offensive mussten wir Gasmasken anlegen, um für alle Fälle gewappnet zu sein. Nur die Artillerie
und Kraftfahrzeuge durften die Landstraße benutzen, die Infanterie ging immer im Straßengraben und wurde von einer
Seite von Kopf bis Fuß mit Dreck bespritzt. Die Franzosen und Engländer haben hier schon Panzer eingesetzt, die von
Truppen aus den Kolonien gefahren wurden. Die Australier gingen mit umgekrempelten Ärmeln hinter den Panzern her.
Wenn es manchmal, trotz vieler Mühe nicht mehr weiter ging wurde der Pfahl auf eine bestimmte Länge abgeschnitten.
Nach Fertigstellung der Brücke kamen wir in die Siegfriedstellung bei Kambrei, zum Bau eines Bataillons-Gefechtstandes.
Da der Boden kreidehaltig war, mussten wir die großen Stücke von Hand zu Hand reichen, den Schutt haben wir dann mit
Sandsäcken aus der Baugrube gehoben und mit Ästen getarnt, damit der Stand nicht von feindlichen Fliegern entdeckt
werden konnte. Alle acht Stunden wechselte die Arbeitsgruppe. Wir mussten von der Baustelle durch das Gelände robben,
denn aufrecht gehend war man dem Beschuss der feindlichen Scharfschützen ausgesetzt, die von einem Fesselballon aus
informiert wurden der über den feindlichen Linien stand.
Der Wechsel war mit einem großen Risiko verbunden, und wurde wenn Möglich bei Dunkelheit vollzogen. Um vor
Überraschungen sicher zu sein haben wir spanische Reiter (Stacheldrahtverhaue) gebaut und vor die ersten Gräben
gestellt, die dann oft in der Nacht von den Franzosen geklaut, und dann vor ihren eigenen Linien wieder aufbaut wurden.
Wir hatten aus Bohlen eine Brücke auf Rädern gebaut, die dann in den Graben geschoben wurde, damit die Artillerie und
andere Fahrzeuge über die Schützengräben kamen. Weil um vier Uhr morgens der Beschuss mit Gasgranaten begann, mussten
wir Gasmasken aufsetzen, danach haben feindliche Flieger unsere Munitionskolonne bombardiert und total aufgerieben.
Es wurde auch eine Marinedivision eingesetzt, die bis dahin dem Küstenschutz gedient hatte und jetzt ihren ersten
Einsatz hatte.
Wir sind zuerst ein ganzes Stück in Richtung Amiens vorangekommen, doch dann blieb unser Angriff in den zuvor von
Engländern besetzten Stellungen, stecken. Da die Engländer ihre Stellungen fluchtartig verlassen hatten, fiel ihr
ganzer Proviant in unsere Hände; Schokolade, Weißbrot, Flaschenwein. Die erste Nacht haben wir in einem runden Zelt
verbracht, weil ich mir durch den starken Wind, der da herrschte eine Angina zugezogen hatte, die mit hohem Fieber
verbunden war, konnte ich die vielen Köstlichkeiten überhaupt nicht genießen.
An eine ärztliche Versorgung war überhaupt nicht zu denken, denn es mussten zuerst die vielen Granatlöcher eingeebnet
werden damit die vielen Fahrzeuge und Geschütze wieder weiter fahren konnten. Auch eine Bahnlinie musste repariert
werden, damit die großen Geschütze in Stellung gebracht werden konnten, dabei wurden auch die vielen Kriegsgefangenen,
die bei dieser Offensive gemacht wurden, eingesetzt. Als die Offensive dann schließlich scheiterte, wurden wir an die
Somme verlegt. Da habe ich die Ortelsburger Jäger, die aus Italien an die Westfront verlegt wurden, zum ersten Mal im
Einsatz gesehen.
Unser nächster Einsatzort waren dann Stellungen hinter Laon. Hier wurden die Vorbereitungen zu einer neuen Offensive
getroffen. Feindliche Flieger versuchten uns Tag und Nacht daran zu hindern die Aufmarschwege instand zu halten. Als
die Offensive dann endlich losging, hatten wir die Order eine Brücke über die Oise mit Bohlen und Balken zu verstärken.
Gleich am Anfang der Offensive mussten wir Gasmasken anlegen, um für alle Fälle gewappnet zu sein. Nur die Artillerie
und Kraftfahrzeuge durften die Landstraße benutzen, die Infanterie ging immer im Straßengraben und wurde von einer
Seite von Kopf bis Fuß mit Dreck bespritzt. Die Franzosen und Engländer haben hier schon Panzer eingesetzt, die von
Truppen aus den Kolonien gefahren wurden. Die Australier gingen mit umgekrempelten Ärmeln hinter den Panzern her.
Wir sind zuerst ein ganzes Stück in Richtung Amiens vorangekommen, doch dann blieb unser Angriff in den zuvor von
Engländern besetzten Stellungen, stecken. Da die Engländer ihre Stellungen fluchtartig verlassen hatten, fiel ihr
ganzer Proviant in unsere Hände; Schokolade, Weißbrot, Flaschenwein. Die erste Nacht haben wir in einem runden Zelt
verbracht, weil ich mir durch den starken Wind, der da herrschte eine Angina zugezogen hatte, die mit hohem Fieber
verbunden war, konnte ich die vielen Köstlichkeiten überhaupt nicht genießen.
An eine ärztliche Versorgung war überhaupt nicht zu denken, denn es mussten zuerst die vielen Granatlöcher eingeebnet
werden damit die vielen Fahrzeuge und Geschütze wieder weiter fahren konnten. Auch eine Bahnlinie musste repariert
werden, damit die großen Geschütze in Stellung gebracht werden konnten, dabei wurden auch die vielen Kriegsgefangenen,
die bei dieser Offensive gemacht wurden, eingesetzt. Als die Offensive dann schließlich scheiterte, wurden wir an die
Somme verlegt. Da habe ich die Ortelsburger Jäger, die aus Italien an die Westfront verlegt wurden, zum ersten Mal im
Einsatz gesehen.
Unser nächster Einsatzort waren dann Stellungen hinter Laon. Hier wurden die Vorbereitungen zu einer neuen Offensive
getroffen. Feindliche Flieger versuchten uns Tag und Nacht daran zu hindern die Aufmarschwege instand zu halten. Als
die Offensive dann endlich losging, hatten wir die Order eine Brücke über die Oise mit Bohlen und Balken zu verstärken.
Gleich am Anfang der Offensive mussten wir Gasmasken anlegen, um für alle Fälle gewappnet zu sein. Nur die Artillerie
und Kraftfahrzeuge durften die Landstraße benutzen, die Infanterie ging immer im Straßengraben und wurde von einer
Seite von Kopf bis Fuß mit Dreck bespritzt. Die Franzosen und Engländer haben hier schon Panzer eingesetzt, die von
Truppen aus den Kolonien gefahren wurden. Die Australier gingen mit umgekrempelten Ärmeln hinter den Panzern her.
Unser nächster Einsatzort waren dann Stellungen hinter Laon. Hier wurden die Vorbereitungen zu einer neuen Offensive getroffen. Feindliche Flieger versuchten uns Tag und Nacht daran zu hindern die Aufmarschwege instand zu halten. Als die Offensive dann endlich losging, hatten wir die Order eine Brücke über die Oise mit Bohlen und Balken zu verstärken. Gleich am Anfang der Offensive mussten wir Gasmasken anlegen, um für alle Fälle gewappnet zu sein. Nur die Artillerie und Kraftfahrzeuge durften die Landstraße benutzen, die Infanterie ging immer im Straßengraben und wurde von einer Seite von Kopf bis Fuß mit Dreck bespritzt. Die Franzosen und Engländer haben hier schon Panzer eingesetzt, die von Truppen aus den Kolonien gefahren wurden. Die Australier gingen mit umgekrempelten Ärmeln hinter den Panzern her.
Die letzte Offensive des Ersten Weltkrieges.
Zum Jahresende 1917 hatten noch 153 deutsche 175 alliierten Divisionen gegenübergestanden.
Zur Vorbereitung der Offensive ließ Ludendorff 39 Divisionen aus dem Osten und aus Italien heranziehen. Er ließ
spezielle Angriffsdivisionen formieren, die durch intensive Ausbildung auf den beabsichtigten, schnellen Vormarsch
vorbereitet wurden. 6608 Geschütze, 3500 Minenwerfer und 1070 Flugzeuge wurden hinter dem vorgesehenen
Angriffsabschnitt konzentriert. Den Ausbildungsbefehlen Ludendorffs, die bis zu den Kompanieführern herab verteilt
wurden, konnte man entnehmen, dass der Versuch, den Krieg mit einem mächtigen Schlag zu entscheiden schon in der
nächsten Zeit gewagt werden sollte. Wir übten die fast vergessenen Formen des Schützengefechts und des
Bewegungskrieges, auch wurde eifrig mit Gewehr und Maschinengewehr geschossen. Wir hegten keinen Zweifel daran, dass
der große Plan gelingen würde.
Den ganzen Winter 1917/18 über plante der Generalquartiermeister Ludendorff die deutsche Offensive. Zwar hatten die
Vereinigten Staaten von Amerika dem Deutschen Reich am 6. April 1917 den Krieg erklärt, aber vor dem Sommer des
Jahres 1918 war mit dem Auftreten von US-Truppen in relevanter Größenordnung nicht zu rechnen. Der deutschen Führung
blieb nur ein schmales Zeitfenster, um die Niederlage und den zu erwartenden Diktatfrieden abzuwenden. Ypern,
Armentieres, Arras, Cambrai oder Verdun wurden ernsthaft als Schauplätze erwogen. Ludendorf entschied sich für einen
Angriff zwischen Cambrai und La Fere – genau an der Nahtstelle zwischen der Französischen Armee und dem britischen
Expeditionscorps.
Der Fluss Somme bildete die Grenze zwischen Franzosen und Briten. Die Briten – nicht die Franzosen – sollten das Ziel
des Vorstoßes werden. Ihre Stellungen waren nur 130 Kilometer von der Kanalküste entfernt. Beim erreichen der
Sommemündung wäre die gesamte britische Armee eingeschlossen gewesen, denn hinter ihnen lag die Straße von Dover.
Am 21. März 1918 begann die letzte entscheidende Offensive des deutschen Westheeres im Ersten Weltkrieg. Der
Angriffsstreifen war 75 Kilometer breit. Dort hatte Ludendorff 43 Angriffsdivisionen konzentriert, dahinter 30
weitere Reservedivisionen, ihnen standen lediglich 26 britische Divisionen gegenüber. „Michael“ – so der Deckname der
„Kaiserschlacht“ – lief dank Ludendorffs akribischer Vorbereitung gut an. Der britische Oberbefehlshaber General
Douglas Haig erkannte die Chance, welche die Deutschen in dieser Situation hatten. Wollten die Deutschen diese Chance
nutzen, mussten sie darauf verzichten die Somme zu überschreiten, wo sie auf die französischen Reserven treffen und
sich von der Küste entfernen würden. Genau diesen Fehler begingen jedoch die Deutschen.
Am dritten Tag überschritt der linke Flügel mit der 18. Armee die Somme. Ludendorf stellte die Taktik über die
Strategie, wie er das bei Tannenberg und der Schlacht an den Masurischen Seen auch schon getan hatte. Ludendorffs
Befehl an die 18. Armee vom Abend des 22. März 1918 lautete: „Jetzt gilt es den Sieg auszunutzen, den Feind nicht zum
Stehen kommen zu lassen, Somme und Crozat-Kanal zu überschreiten, bevor feindliche Verstärkungen wirksam werden“.
Was Haig befürchtet hatte, trat nicht ein. Die deutsche Offensive Lief weiter Richtung Süden und lief sich schließlich
tot. Am 31 März war Ludendorff zu der Erkenntnis gekommen, dass „Michael“ gescheitert war. Am 5. April wurde die
Einstellung der Offensive befohlen. Im Hochsommer waren die US-Truppen in Frankreich angekommen und gingen mit den
Franzosen zum Angriff vor. Nur mühsam konnten Hindenburg und Ludendorf den Zusammenhalt der Front waren. Am 24. Oktober
1918 forderte US-Präsident Woodrow Wilson die bedingungslose Kapitulation, am 11.Nuvember Wurde der Waffenstillstand
von Compiegne unterzeichnet.
Zusammenbruch der Westfront und Waffenstillstand .
Als die Offensive dann letztendlich gescheitert war, wurden wir auf Eisenbahnwaggon verladen, in
eine Stellung vor Verdun gebracht und der siebenten bayerischen Division zugeteilt. Als wir ausgeladen wurden nahm der
Franzose den Bahnhof unter Beschuss. Eine Granate traf einen Waggon der mit Seifenpulver beladen war, so dass der ganze
Bahnhof aussah als wäre gerade Neuschnee gefallen. Wir gingen auf die Suche nach Kartoffeln. Als ich mit einem Sack,
vollbeladen die Böschung runter ging um zur Feldküche zu gelangen, schlug unweit von mir eine Granate ein und riss mir
den Sack vom Rücken. Ich bin mit dem Schrecken davon gekommen, mir war nichts passiert.
Der Bahnhof war menschenleer, nur ein par Kaninchen liefen verschreckt durch die Gegend und einigen Kameraden gelang
es welche einzufangen. Am nächsten Tag gelang es uns endlich die Feldküche zu erreichen. Als wir gerade beim Essen
fassen waren, schlug unweit eine Granate ein so dass Pflastersteine das Dach durchschlugen und wir das Weite suchen
mussten. und wir wieder nichts zu Essen bekamen. Ein Friseur aus unserer Kompanie fuhr immer ins Hinterland um uns
mit Proviant zu versorgen. Als er 14 Tage vor dem Zusammenbruch wieder mal zurückkam erzählte er uns schon das der
Krieg nicht mehr lange dauern würde, weil Kaiser Wilhelm mit Frack und Zylinder bekleidet, Deutschland verlassen und
ins Ausland gehen würde. In unserer Einheit hatten wir auch einen Juden der glaubte dass er sich alles erlauben darf.
Eines Morgens ging er in die Küche, als er keinen Koch vorfand stieg er auf die Gulaschkanone und hob den Deckel vom
Kessel in dem der Kaffee kochte an. Der kochende Kaffee verbrühte seine Füße so sehr das er sofort ins Lazarett musste,
für ihn war der Krieg somit zuende. Es kam noch ein Erlass, das Kameraden die 2 Jahre aktiv gedient hatten und
Gefreiter waren sofort zum Sergeanten befördert wurden. Für den 11. November 1918 war ein Waffenstillstand vereinbart
und ab 11 Uhr sollte nicht mehr geschossen werden. Wir hatten unsere Kopfkissen aufgetrennt und eine Kissenschlacht
veranstaltet, um auf diese Art und Weise unserer Freude Ausdruck zu verleihen. Als die Federn durch die Luft flogen
brachen wir in Tränen aus.
In jeder Kompanie wurde ein Soldatenrat gewählt, der aus drei Mann bestand. Wenn der Kompanieführer jemanden bestrafen
wollte, musste er erst den Soldatenrat fragen, der die Strafe befürworten, aber auch ablehnen konnte. Die Offiziere
durften keine Achselstücke mehr tragen, was für sie einer Degradierung gleich kam. Wir waren in einem Dorf
einquartiert und morgens zum Appell angetreten, als einer vom Soldatenrat sich stockbesoffen vor den auf dem Pferd
sitzenden Kompanieführer stellte und schrie: „Alles hört auf mein Kommando”. Der Kompaniechef war wie vom Blitz
getroffen, ihm versagte die Stimme. Wir sahen ein das dies nicht so weiter gehen kann und wählten einen neuen
Soldatenrat. Unser Rückzug begann bei Konflanz, einer Vorfestung von Metz und führte uns zunächst über die
luxemburgische Grenze, wo wir in einem Ort einquartiert wurden. Als wir für die Küche Holz aus dem Wald holen gingen,
entschieden wir uns eine Eiche abzusägen, ohne uns dessen bewusst zu sein, in welchem Forst wir uns befanden. Als wir
beim fällen waren fielen plötzlich Schüsse, die wir auch sofort erwiderten, bis uns ein Elsässer der sich in unserer
Kompanie befand aufklärte: „Kameraden, wir befinden uns hier auf Luxemburgischem Hoheitsgebiet”.
Wir sind dann weiter durch das Fürstentum Birkenfeld marschiert, wo das Städtchen Merzig für uns geflaggt hatte. Das
Elsass haben wir auch noch kurz gestreift. Wo wir bei einem Bauern, der uns kein Stroh für das Nachtlager geben wollte,
einquartiert wurden. Daraufhin gingen wir in die Scheune und haben uns selbst was besorgt. Wir haben dann noch erfahren,
sie hätten ein Schwein geschlachtet und warteten auf den Einzug der Franzosen. Als wir uns 1917, an der Ostfront, in
den in Karpaten, im Einsatz befanden, waren unter uns auch viele Elsässer. Sie durften ihre Heimatpost nicht in
französischer Sprache schreiben, mussten ihre Briefe offen auf der Schreibstube abgeben, wo sie zuerst kontrolliert
und dann abgeschickt wurden. Als ich in einer Nacht, mit einem Elsässer auf einem Vorposten Wache schieben musste,
wollte er mich überreden zum Russen überzulaufen. Als ich darauf nicht eingehen wollte verschwand er plötzlich in der
Dunkelheit und ich habe ihn nie wieder gesehen.
Wir sind dann weiter Richtung Worms und Ludwighafen gezogen, dort wurden wir bei einem Mühlenbesitzer einquartiert,
ein Unteroffizier und vier Mann. Obwohl wir verlaust und verdreckt waren bestand die Müllerin darauf das wir in ihren
Betten übernachteten. „Wenn alles durch ist”, sagte sie, „werde ich alles gründlich reinigen”. Der Müller brachte uns
eine Gießkanne voll Wein und sagte wir sollen es uns Schmecken lassen. Wir haben reichlich davon Gebrauch gemacht, so
dass ich gar nicht weiß wie ich ins Bett kam. Das war meine Erinnerung an die Pfalz. Manchmal waren wir auch 2 Tage im
Quartier.
Vor dem Weitemarsch wurde uns immer gesagt welche Truppe die Vorhut und welche Truppe die Nachhut übernehmen sollte.
Die Nachhut hielt immer Verbindung zu den nachrückenden Franzosen und man muss staunen wie alles reibungslos, ohne
Zwischenfälle von statten ging, was wir in erster Linie dem General-Feldmarschall Paul von Hindenburg zu verdanken
haben, der den Rückzug an der Westfront koordiniert hat.
In Köln angekommen, erhielten wir im Volkshaus unsere Entlassungspapiere, Eisenbahnfahrscheine, Reisepässe,
unterschrieben von Oberstleutnant Mann. Wir mussten Köln umgehend verlassen, weil schon am nächsten Tag die
französischen Besatzungstruppen in einmarschieren sollten. Wir fuhren mit einem Zug der bis Allenstein fuhr, dort
wurden unsere Papiere vom Soldatenrat kontrolliert. Die jüngren Jahrgänge wurden festgehalten, zu neuen Einheiten
zusammengestellt und zur Sicherung der Ostgrenze gegen die Bolschewisten abkommandiert. Ich hatte gesagt das ich noch
einen Schrapnellsplitter in der Kreuzbeingegend habe und durfte daraufhin nach Hause fahren.
Kaum in Ortelsburg angekommen fiel ich wieder dem Soldatenrat in die Hände. Sie haben alles durchsucht, haben mir mein
Seitengewehr und eine Decke abgenommen, aber ich durfte weiter und bin dann kurz vor Weihnachten 1918 auf dem
elterlichen Hof angekommen. Schon auf dem Hof habe ich meine Kleider vom Leib gerissen, weil vor Läusen und anderem
Ungeziefer nicht mehr aushalten konnte und mich erst gründlich gewaschen bevor ich das elterliche Haus betreten habe.
Die Freude über das Wiedersehen war sehr groß.
“ Unser Leben zwischen den beiden Weltkriegen.”
Endlich wieder zurück in der Heimat
Rohmanen war durch die Kampfhandlungen 1914/15 zu einem drittel zerstört worden, aber schon
wieder im Aufbau. Die Firma Grzella aus Ortelsburg hatte die Bauarbeiten übernommen. Unter der Aufsicht von Polier
Karl Kontor wurden die Dachstühle errichtet. Ich habe mich, nach kurzer Erholungspause, auch als Zimmermanngehilfe am
Wiederaufbau beteiligt. Die Firma Grzella hat das Material geliefert und auch unsere Löhne gezahlt. Wegen meinem
Steckschuss bin ich dem VDK beigetreten und habe mit dessen Hilfe eine Rente beantragt die mir auch bewilligt wurde.
Nach vier Jahren wurde ich nach Allenstein zur Nachuntersuchung vorgeladen. Die ärztliche Untersuchung hatte ergeben,
das Geschoß sei verkapselt, und nur das linke Bein etwas in Mitleidenschaft gezogen. Daraufhin wurde die Rentenzahlung
eingestellt.
Der Stellmacher Adam Ornowski war im Krieg als Sanitäter eingesetzt und hatte auf Grund seiner Erfahrungen,
 Beziehungen zum medizinischen Dienst in Ortelsburg aufgebaut. Es wurden dort Lehrgänge in Erster Hilfe angeboten,
die von Prof. Dr. Kutz geleitet wurden. Adam Ornowski hat dafür gesorgt das einige junge Männer aus Rohmanen daran
teilnehmen konnten. Adam Ornowski, August Linka, Emil Rosowski, Johann Dembek, Emil Baschek und ich sind dann dem
Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes beigetreten und mussten jeden Sonntag am Lehrgang teilnehmen. Unser
Gruppenführer war Kreisobersekretär Albrecht, Landrat von Poser, als unser Ehrenvorsitzender, hat viel zu unserer
finanziellen Unterstützung beigetragen und hat dafür gesorgt dass die Bereitschaft eingekleidet wurde.
Beziehungen zum medizinischen Dienst in Ortelsburg aufgebaut. Es wurden dort Lehrgänge in Erster Hilfe angeboten,
die von Prof. Dr. Kutz geleitet wurden. Adam Ornowski hat dafür gesorgt das einige junge Männer aus Rohmanen daran
teilnehmen konnten. Adam Ornowski, August Linka, Emil Rosowski, Johann Dembek, Emil Baschek und ich sind dann dem
Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes beigetreten und mussten jeden Sonntag am Lehrgang teilnehmen. Unser
Gruppenführer war Kreisobersekretär Albrecht, Landrat von Poser, als unser Ehrenvorsitzender, hat viel zu unserer
finanziellen Unterstützung beigetragen und hat dafür gesorgt dass die Bereitschaft eingekleidet wurde.
In jedem Dorf wurde eine Unfallstelle eingerichtet, mit einem Verbandskasten und mit Verbandsmaterial für die erste
Hilfe ausgerüstet. Die Unfallstelle in Rohmanen, die am Haus von der Straßenseite, durch eine Tafel mit einem roten
Kreuz gekennzeichnet war, hatte ich zu verantworten. An Sonntagen wurden wir an Badestellen und bei Fußballspielen
eingesetzt, haben viele Übungen bei Waldbränden durchgeführt und auch Ausflüge nach Rudzany am Niedersee gemacht. Bei
der Einweihung des Tannenbergdenkmals in der Nähe von Hohenstein kamen wir an Straßenkreuzungen zum Einsatz.
Rohmanen hatte auch eine freiwillige Feuerwehr. Bis zum ersten Weltkrieg hat Friedrich Biella als Brandmeister das
Kommando gehabt. Er war aktiver Unteroffizier, hatte gute Führungsqualitäten und die Männer, die allesamt aus dem
aktiven Militärdienst stammten hatten zu ihm ein großes Vertrauen. Nach dem Krieg wollten diese Männer,
(Friedrich Nickel, Friedrich Willam, Julius Wittkowski, Jakob Janowski, Johann Gloddek, Gustav Bednarz), nicht mehr
weitermachen. Friedrich Biella, der inzwischen zum Gemeindevorsteher gewählt wurde, hat sich dann auf einer
Gemeinderatsitzung vorgeschlagen, für die Freiwillige Feuerwehr jüngere Kräfte anzuwerben.
Zum Brandmeister hat er Herrn Wilhelm Pilath vorgeschlagen. Der wurde dann nach Königsberg zur Fortbildung geschickt.
Der Feuerwehr gehörten nun folgende Personen an: Wilhelm Pilath(Brandmeister), August Linka(Stellvertreter), Gustav
Deptolla, Julius Matzey, Johann Dembek, Willy Willam, Gustav Rattay. Der Kreisbrandmeister war Heinrich Thalmann aus
Ortelsburg, sein Stellvertreter war Kreisobersekretär Salzmann. Der Bezirks-Kommissar bei der Ostpreußischen
Feuersozität War Herr Ernst Trzaska. Er hat dafür gesorgt das die Wehr uniformiert und mit Löschgeräten ausgerüstet
wurde. Da die alten Schläuche schon sehr marode waren, wurden sie durch moderne ersetzt, deren Kupplungen auch mit der
Motorspritze übereinstimmten.
Ernst Trzaska hat bei der Feuersozität und beim Landratsamt Finanzmittel beantragt und auch genehmigt bekommen. Der
Schneidermeister Wilhelm Baran wurde beauftragt Tuch und Drillichanzüge nach Maas zu schneidern. Er hat uns
Stoffmuster vorgelegt aus denen wir wählen sollten. Feuerwehrhelme haben wir auch bekommen. Die Gemeinde musste
Finanzmittel bereitstellen, einen Prozentsatz vom Gemeindebudget. Im Brandfall mussten für den Spritzenwagen Pferde
zur Verfügung stehen, von Willy Willam, Gustav Rattay, Julius Matzey und Gustav Dorka, weil sie in der Nähe des
Spritzenhauses wohnten. Am Spritzenhaus wurde ein großer Baum mit Querleisten aufgestellt, wo nach jedem Brand oder
einer größeren Übung die Schläuche zum trocknen aufgehängt wurden.
Der Kreisbrandmeister hat mindestens 2-3-mal im Jahr die Wehren besichtigt. Das ganze Dorf war dann auf den Beinen,
die Bauern mit Pferden, und andere Dorfbewohner mit Eimern und Spaten, wurden dann in verschiedene Gruppen eingeteilt.
Erst hat die Wehr sämtliche Aufstellungen am Gerät geübt; Grundstellung Fahrstellung und Marschstellung. Dann wurde
ein Brand angekündigt, die Feuerwehr mit der Spritze an den Brunnen, die Gruppen dort wohin sie beordert wurden, die
Bauern brachten mit den Wasserkiwen Wasser aus dem Brunnen zum Brandort. Wenn das Wasser im Brunnen alle wurde hat
man den Saugkorb in die Kiewen gelegt und dort Wasser entnommen. Die Wassergruppe ging mit Eimern zum Dorfteich, holte
Wasser und füllte damit die leeren Kiewen.
Der Löschtrupp ging mit Feuerhaken und Löschpatschen auf die umliegenden Gehöfte und versuchte das vermeintliche Feuer
von ihnen fernzuhalten. Nach dem Alarm wurde wieder am Spritzenhaus angetreten. Die Gruppenführer mussten angeben ob
ihre Gruppe auch vollständig erschienen war, denn Übungen wurden nur vor, oder nach der Feldarbeit durchgeführt, so
dass niemand eine Entschuldigung vorbringen konnte. Wer ohne begründete Entschuldigung nicht anwesend war erhielt eine
Verwarnung. Der Kreisbrandmeister erklärte dann welche Handgriffe den Vorschriften entsprachen und welche nicht. Die
Schläuche wurden noch schnell zum Trocknen aufgehängt. Anschließend gingen wir alle in den Gasthof Trzaska, haben über
vorhandene Mängel diskutiert, Verbesserungsvorschläge unterbreitet und zwischendurch den Durst gelöscht. Der
Kreisbrandmeister ist dann, nach einer kurzen Verabschiedung, ins nächste Dorf gefahren, weil er an einem Tag mehrere
Feuerwehren betreuen musste.
Der Rohmaner Dorffriedhof

Einen Kilometer vom Ende des Dorfes entfernt, auf der rechten Seite der Landstraße in Richtung
Ortelsburg, befand sich der Rohmaner Dorffriedhof. Wann dieser Friedhof angelegt wurde entzieht sich meiner Kenntnis.
Nach Aussagen älterer Dorfbewohner soll davor auch schon eine Ruhestätte vorhanden gewesen sein, und
zwar auf der linken Straßenseite gegenüber dem jetzigen Friedhof. An dieser Stelle befand sich bis in die
Nachkriegszeit ein kleiner Brunnen, aus dem die Dorfbewohner, das Wasser zum begießen der Grabbepflanzung auf den
Gräbern ihrer verstorbenen Angehörigen holten. Der Friedhof war in einer Hanglage angelegt, wahrscheinlich weil diese
Parzelle für eine landwirtschaftliche Nutzung nicht geeignet war. Um das Gräberfeld vor herumstreunenden Tieren oder
von der Weide entlaufenen Kühen zu schützen, hat man das ganze Gelände mit einem Holzzaun umgeben. Der Zugang befand
sich von der Straßenseite. Unter einem Torbogen hindurch wurden die Verstorbenen zu Grabe getragen. Die Gräber der
einzelnen Familien waren nebeneinander angelegt, mache, wie zum Beispiel die der Familie Trzaska, sogar mit einem
schmiedeeisernen Zaun eingefasst.
Nach dem 2. Weltkrieg verfiel der Friedhof immer mehr. Die nötigen Finanzmittel für die Pflege der Einfriedung konnten
von den restlichen noch verbliebenen Deutschen nicht mehr aufgebracht werden. An den gepflegten Gräbern konnte man noch
erkennen dass es Verwandte von noch in Rohmanen wohnenden Deutschen waren, oder von bereits im Westen Deutschlands
lebenden, die ihre noch in Rohmanen wohnenden Nachbarn damit beauftragt hatten. Die übrigen Gräber wurden von Jahr zu
Jahr immer mehr von Wildkräutern überwuchert und schließlich auch von Sträuchern und schnell wachsenden Bäumen.
In den späteren Jahren konnte man nicht mehr erkennen dass dort vor Jahren Tote zur letzten Ruhe gebettet wurden. Die
Natur holte sich das ganze Gelände zurück und nur unter großen Schwierigkeiten konnten Besucher aus dem Westen das
Friedhofsgelände noch betreten.
Das Gasthaus Trzaska

Nach dem ersten Weltkrieg hat der Gastwirt Friedrich Trzaska neben dem Gasthof einen großen Saal
für Festlichkeiten und Vereinsfeiern gebaut, in dem schon mal Feuerwehrfeste veranstaltet wurden. Ernst Trzaska war
Feuerkommissar bei der Ostpreußischen Feuersozität. Erich Trzaska war Vollziehungsbeamter beim Amtsgericht in
Ortelsburg. Unser Feuerkommissar war uns beim organisieren der Veranstaltungen sehr behilflich, hat uns den Saal, die
Musik und die Theaterstücke besorgt und die Feuerwehren aus den Nachbardörfern eingeladen.
Zu Manöverzeiten, vor dem 2. Weltkrieg und dann auch während des Krieges, waren im Gasthof Soldaten, meist im Range
eines Offiziers, einquartiert. Fräulein Mariechen Trzaska hat die Poststelle im Dorf betreut. Nachdem ich 1939 zum
Militär eingezogen wurde, hat sie, nach einer Schulung im Ortelsburger Krankenhaus, auch die Unfallmeldestelle
übernommen. Nach dem Krieg, pflegte sie mit vielen Bekannten, die bereits in der Bundesrepublik wohnten, einen regen
Briefwechsel. Auf dem Rohmaner Friedhof hat sie viele Gräber, im Auftrag von Angehörigen, die auf Grund ihrer
Abwesenheit, dazu nicht mehr in der Lage waren, gepflegt. Der Bauunternehmer Kurnitzki aus Ortelsburg, äußerte die
Bitte, sie möchte ihm doch ein Blatt vom Rosenstrauch, der auf dem Grab seiner Eltern steht, in den Brief legen. Als
sie uns den Brief vorgelesen hat, waren wir zu Tränen Gerührt. Sie hat als Letzte aus ihrer Familie, bis zu ihrem Tod
im Jahre 1960, in Rohmanen, im Gebäude der Gastwirtschaft gewohnt und ist auf dem Rohmaner Friedhof beerdigt worden.
Fleisch und Wurstwaren Karl Pelkowski
Im Jahr 1931 hat der Fleischermeister Karl Pelkowski, aus Grammen, direkt neben unserem Hof ein
Anwesen gekauft und dort eine Fleischerei eingerichtet. Er war mit meiner Schwester Frieda, verheiratet. Am Anfang hat
er die Schweine noch auf seinem Hof geschlachtet, später dann im Ortelsburger Schlachthof. Jede Woche fuhr er 2-mal,
mit dem Pferdewagen(Einspänner), nach Ortelsburg zum Wochenmarkt, wo er seine Fleisch und Wurstwaren zu Verkauf anbot.
Am Tag davor, wenn er die Wurst gekocht hat, kamen viele Rohmaner mit Kannen oder anderen Gefäßen, wegen der guten
Wurstsuppe, die er umsonst unter die Leute verteilte. Als Karl Pelkowski, Ende August 1939 zum Militär eingezogen
wurde, hat seine Frau das Pferd verkauft und den Beitrieb stillgelegt. Am Haus hing, immer noch die Tafel mit der
Aufschrift: Karl Pelkowski, Fleisch und Wurstwaren. Ein Witzbold hat irgendwann darunter geschrieben; „Fleisch und
Wurst waren einmal”, drauf hin hat Frau Pelkowski die Tafel entfernen lassen. Karl Pelkowski ist im Mai 1946 in
französischer Gefangenschaft verstorben. Seine Ehefrau Frieda, verstarb an ihrem 85. Geburtstag in Mettmann bei
Düsseldorf.
Die steinreichen Rohmaner Felder
Die letzte Eiszeit hat bei der Schmelze, auf der Rohmaner Feldgemarkung viele Steine und
Granitblöcke zurück gelassen. Überirdisch, aber besonders unter der Erde, gab es viele kleine, aber auch große Steine,
die, den Bauern, beim Pflügen und anderen Feldarbeiten sehr viel Schweiß, abverlangten. In einer Kiesgrube, auf dem
Feld des Bauern August Radek, lag ein Granitblock, von schätzungsweise 100 cbm. Vor etwa 80 Jahren, als man für diese
Steine noch keine Verwendung hatte, griffen die Bauern zu einer „List”. Weil er sonst nicht pflügen konnte, hat mancher
seinem Nachbarn, die Steine in der Nacht auf dessen Feld abgeladen. Als diese Tätigkeit unter Strafe gestellt wurde,
hat man die Steine in Schluchten gekippt und mit Mutterboden zugeschüttet. In späteren Jahren kam diese jedoch beim
pflügen wieder an die Oberfläche. Dann hat man aber schon Steine für den Straßenbau gebraucht und konnte sie so zu Geld
machen. Besonders im Raum südlich von Ortelsburg, bis zur polnischen Grenze, wo Steine eine Rarität waren, kamen sie
jetzt zum Einsatz. Auch beim Bau von Häusern, besonders für die Fundamente, wurden sie eingesetzt, weil auf diese
Weise viel Ziegeln eingespart wurden. Die Firma Gribienski aus Ortelsburg hat die großen Steine mit Dynamit gesprengt
und auf diese Weise die weitere Verarbeitung erleichtert.
Die Steine welche beim Pflügen aus dem Boden geholt wurden, hat man am Feldrand auf große Haufen zusammen getragen.
Wenn die Feldarbeit beendet war, sowie auch in den Wintermonaten, waren wir jeden Tag mit Steinen unterwegs. Wir sind
vorwiegend am Abend los gefahren, weil unter der schweren Last die Wagenachsen so heiß wurden und die Gefahr bestand,
das durch die Dehnung, die Räder blockiert würden. Bei einer Fahrt konnte man bis zu 24 Reichsmark verdienen, wogegen
1 Zentner Roggen für 8 bis 9 Reichsmark zu haben war. Ich bin selbst, mit dem Pferdewagen bis Fürstenwalde, Radostowen,
Luka, Altkirchen, Höhenwerder, ja sogar bis Friedrichshof gefahren.
In Rohmanen wurden auch rote Ziegeln gebrannt. Viele Häuser wurden, mit Ziegeln erbaut, die nur wenige 100 Meter von
der Baustelle entfernt hergestellt wurden. Der Lehn wurde auf den Feldern in der näheren Umgebung entnommen, dann von
Ochsen solange getreten, bis er so geschmeidig war, das er sich in Formen einstreichen ließ. Wenn die Ziegel in der
Form trocken war, wurde sie entnommen und in einem Brennofen gestapelt. Um einen Ofen richtig anzufeuern, brauchte man
12 Raummeter Holz, das im Zeitraum von ein par Tagen verheizt wurde. Der Fischer Karl Glitza hatte schon eine
Knetmaschine, die von einem Pferd angetrieben wurde, das mit verbundenen Augen, den ganzen Tag in die Runde ging.
Im Dorf waren auch vier Kalköfen, in denen so genannte Kalksteine, die sich an gewissen Stellen, im Erdboden befanden,
gebrannt wurden. Nach dem Brennen wurden die Steine mit Wasser abgelöscht und die daraus entstandne Masse diente, nach
dem Beimischen einer gewissen Menge Sand, dann als Bindemittel beim Häuserbau. Das Gerichtsgebäude und das
Lehrerseminar in Ortelsburg wurden mit Kalk, aus dem Rohmaner Brennöfen erbaut. Auch zum Bau einer Eisenbahnbrücke, auf
der, der Zug, den Sawitzfluß, von Ortelsburg nach Allenstein überquerte, hat mein Großvater, mit einem Ochsengespann,
Kalk gefahren.
Hinter der Scheune, beim Bauern Johann Dembek hat man Tonerde gefördert, aus der man mit Hilfe einer Formerscheibe,
die von einem Arbeiter mit Muskelkraft(Fußbetrieb) angetrieben wurde, schöne Krüge, Schalen und Vasen geformt hat.
Die Töpferware wurde, nachdem sie trocken genug war, auch in einem Ofen gebrannt, anschließend mit einer Lasur
überzogen und wieder gebrannt. Es wurden auch Kacheln zum Bau von Kachelöfen hergestellt, die mit verschiedenen
Ornamenten versehen, die Wohnstuben unserer Vorfahren schmückten. So haben unsere Großväter ihr Leben gemeistert und
nach und nach, unsere Dörfer aus der Rückständigkeit in die Neuzeit geführt.
Das gesellschaftliche Leben nach dem 1. Weltkrieg

Als der Lehrer Alfred Dorka, ein Frontkämpfer des Ersten Weltkrieges und ein Sportsmann, als
zweite Lehrkraft an der Rohmaner Schule angestellt wurde, hat er die Sitten und Gebräuche aus früherer Zeit wieder zum
Leben erweckt. Zuerst hat er die Jugend zusammen gerufen, einen Jugendverein und einen Fußballclub, gegründet. Zum
Vorsitzenden des Fußballclubs wurde Johann Gloddek berufen, der ihn auch geleitet hat. Bauer Wilhelm Spittka, der am
Rohmaner See wohnte, stellte Land für einen Sportplatz unentgeltlich zur Verfügung. Lehrer Alfred Dorka hat am
Rohmaner See eine Badestelle ausgesucht und ein Sprungbrett bauen lassen. An jedem Sonnabend im Sommer, bevor die
Sonne unterging, versammelte sich die gestammte Jugend des Dorfes an der Badestelle am See. Es wurde gebadet,
Heimatlieder gesungen, gespielt, im Fackelschein eines großen Biwakfeuers, bis in die späte Nacht hinein. Der Fischer
Karl Glitza hat uns Kähne zur Verfügung gestellt, mit denen wir auf den See hinausgepaddelt sind, dabei hatten wir viel
Spaß, was wiederum den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft gefördert hat. Ich habe mit meiner Mandoline den Gesang von
Volks- und Heimatliedern begleitet.
Der Rohmaner See liegt in einem Tal, dessen Hänge zu beiden Seiten mit Kiefern und Tannen bewaldet sind. Wenn man
gesungen oder Musiziert hat, hallte es von den Hängen zurück. Die Ufer waren mit Kalmus und Schilf bewachsen, was für
die Fischaufzucht von Vorteil war. Wenn man an einem sonnigen, windstillen Tag, am Seeufer spazieren ging, traf man
oft auf Flachstellen, an denen sich die Fischbrut im Sonnenlicht wärmte, wie ein Mückenschwarm. Im See befanden sich
folgende Fische: Karpfen, Hechte, Schleie, Barsche Plötze, Rotaugen, Aale und Krebse. Am Sonntagmorgen brachten viele
Rohmaner ihre Pferde zum See um sie zu baden.
Es wurden dort, unter der Aufsicht von Lehrer Dorka, auch viele Jugendfeste mit Theatervorführungen veranstaltet, zu
denen er selbst die Vorlagen organisiert hat. Der am See wohnende Bauer Johann Nadrowski, hat uns ein Scheunentor, als
Tanzboden zur Verfügung gestellt. Der Zimmermann Wilhelm Wittek hat uns eine Windmühle gebaut, die am auf dem Boden
liegenden Scheunentor aufgestellt wurde, dazu kamen Noch Tannen und Fichten, die das Ganze wie ein Bühnenbild
erscheinen ließen. Es wunden viele Bühnenstücke aufgeführt, unter anderen >Alte Weiber werden jung gemahlen<. Dazu bot
die Windmühle die entsprechende Kulisse.
Nach der Vorführung wurde der Boden aufgeräumt, um dann als Tanzdiele zur Verfügung zu stehen. Der Gastwirt Trzaska
hatte Tische und Bänke aufgestellt, Speisen und Getränke angeboten, so dass sich die die Veranstaltung bis in die
späte Nacht hinein zog. Es waren auch Leute aus Ortelsburg und anderen Nachbardörfern dabei. Im Winter hat Lehrer
Dorka eine Kreisrodelbahn eingerichtet, die von Zeit zu Zeit mit Wasser besprengt wurde, um die Gleitfähigkeit zu
verbessern. Von einer Anhöhe ging hinunter bis auf den halben See, was für alle ein großes Vergnügen war. Es kamen
Lehrer mit Schulklassen aus der näheren Umgebung um hier zu Rodeln.
Als Herr Lehrer Jobski als Hauptlehrer nach Rohmanen kam hat er mit dem Bürgermeister und der Gemeindeverwaltung
beschlossen, in der Nähe des Dorfes, auf einem zur Schule gehörenden Grundstück, einen Sportplatz anzulegen. Dafür
wurde gleich hinter den Gärten, 6 Morgen Ackerland abgetrennt, und nach Feierabend hat Lehrer Dorka mit den
Jugendlichen eingeebnet und gleich nebenan einen Graben für Schützenstand und Kugelfang ausgehoben. Am Sonntagvormittag
wurde Fußball gespielt und um 15:00 Uhr war Kleinkalieberschießen angesagt. Es musste auch ein kleiner Beitrag erhoben
werden, um Munition kaufen zu können. Eine Büchse konnten wir aus beim Kleinkalieberverein in Ortelsburg ausleihen.
Nach Hitlers Machtergreifung
Als Adolf Hitler an die Macht kam wurde die SA gegründet. Der Bürgermeister Michael Kownatzki
wurde zum Gruppenführer ernannt und folgende Männer haben sich freiwillig gemeldet: Wilhelm Matzey, Johann Gloddek,
Gustav Nadrowski, August Buttler, Karl Baran, Emil Nickel, Wilhelm Jaschinski, Emil Bork, Ernst Rattay und Gustav Bach.
Bei Versammlungen war die SA in Uniform angetreten um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Wer versucht hat Unruhe zu
stiften, egal aus welchem Grunde, wurde aufgefordert den Saal zu verlassen, andernfalls wurde er mit Gewalt entfernt.
Herr Lehrer Jobski wurde zum politischen Leiter ernannt, seine Frau hat die NS-Frauenschaft gegründet, Lehrer Dorka
die HJ, und so bekam die Dorfgemeinschaft, nach und nach ein anderes Gesicht. Der Sportplatz und der Schützenstand
wurden jetzt mehr als früher in den Mittelpunkt gestellt. Nach der Feldarbeit hat der Bürgermeister Fuhrwerke bestellt
und den Sportplatz noch besser herrichten lassen.
Der Bauer Wilhelm Both wurde zum Ortsbauernführer ernannt, mit der Aufgabe alles Land für den Anbau von Getreide und
Futtermittel bereitzustellen, oder wenn das nicht möglich war mit Wald aufzuforsten. Durch den Einsatz von Kunstdüngern
sollten größere Erträge aus dem Boden geholt werden, um den Viehbestand zu vergrößern und mehr Milch und Butter zu
produzieren. Deutschland sollte im Stande sein sich selbst zu selbst zu ernähren, ohne auf Importe angewiesen zu sein.
Frau Jobski hat, innerhalb der der NS-Frauenschaft, mit Hilfe von Fachkräften aus Ortelsburg, Lehrgänge veranstaltet,
auf denen man Backen und Nähen lernte. Auf den Bauernhöfen befand sich auch immer mehr Rassegeflügel, das eine erhöhte
Produktion von Eiern und Geflügelfleisch sicherstellen sollte.
Die Rohmaner Bauern hatten, außer in der Landwirtschaft, noch andere Verdienstmöglichkeiten in der Kreisstadt. In
Ortelsburg wurden vier Sägewerke betrieben, die mit Langholz aus dem Walde versorgt werden mussten. Wir haben eine
Kiefer von über 8 Festmeter angefahren, der wir zuerst 6 Meter Spitze abschneiden mussten, um diese Last überhaupt
auf den Wagen zu bekommen. Sechs Pferde musste angespannt werden um den Wagen zur befestigten Straße zu bringen.
Fichten und Tannen wuchsen bis zu einer Länge von 30 Metern. Auch beim Transport von Ziegel, von der Ziegelei zum
Bahnhof, konnte man gutes Geld verdienen.
Im Jahr 1934 wurde Rohmanen an das überregionale Stromnetz angeschlossen und schaffte auf diese Weise den Sprung von
der Petroleumlampe zur Glühbirne. Neben dem Grundstück von Karl Pietzonka wurde ein Transformatorhäuschen errichtet,
in dem der ankommende Strom von einer Hochspannung auf eine Verbrauchsspannung transformiert wurde. Es gab schon eine
Überlandleitung, die aus Richtung Ortelsburg kommend, quer über die Felder, in Richtung Neu Keykuth weiter ging.
Durch eine Zwischenspanne wurde der Transformator, mit der Hauptleitung auf Kownatzkis Feld verbunden.
Ein Stromanschluss konnte die Arbeit im Haus und Hof auf vielfältige Weise erleichtern, doch nur die besser gestellten
Bauern, sowie noch manche Pensionäre, die ein festes Einkommen hatten, konnten sich dass leisten. Weil nur wenige an
der Elektrifizierung teilnahmen, war ein Stromanschluss mit hohen Kosten verbunden. Nur Gustav Pietzonka, Gasthof
Trzaska, Friedrich Nickel, die Schule und Wilhelm Both, wurden in der ersten Phase erfasst.
Im Jahr 1952 wurde von den polnischen Behörden die zweite Stufe der Elektrifizierung eingeleitet, in der alle im Dorf
stehen Gebäude erfasst wurden. Am Anfang wurden nur Leitungen für Lichtstrom gelegt und auch nur 3 Lichtstellen pro
Haushalt bewilligt. Doch im nachfolgenden Zeitraum wurden dann, wenn Material vorhanden war, weitere Lichtpunkte
angelegt. 1952, am zweiten Wochenende im Advent, wurden dann die Leitungen geschaltet und alle waren von der
plötzlichen Helligkeit sehr begeistert. Wenn man Glühbirnen auswechseln wollte musste man am Anfang weite Wege
zurücklegen, um welche zu bekommen. In den 60ger Jahren wurden dann immer mehr Starkstromleitungen gelegt, weil die
Bauern elektrische Geräte kaufen konnten. Ende der 60ger wurden auch die Abbauten an das Stromnetz angeschlossen.
Das Urnengrab auf unserem Feld
Auf unserem Feld, in Richtung Seelonken, bin ich oft beim pflügen gegen Steine gestoßen, manchmal
rissen sogar die Stränge am Pferdegeschirr. Eines Tages nahm ich einen Spaten, Brechstange und einen langen Baum, um
der Sache auf den Grund zu gehen. Als ich eine Menge Sand ausgehoben hatte stieß ich auf eine steile, aus Steinen
errichtete Wand, die ich auch mit dem Baum nicht aus der Fassung bringen konnte. Ich habe den ganzen Vormittag gegraben,
konnte jedoch nicht unter die Steine kommen. Einige Tage später hatten wir in der Schule eine Bauernversammlung, da
habe ich Herrn Biella und Herrn Lehrer Dorka von meinem Fund berichtet. Am nächsten Morgen kam der Lehrer Dorka mit der
ganzen Schulklasse, mit Spaten und Sieben ausgerüstet auf unser Feld und fingen an die ausgehobene Erde zu sieben.
Lehrer Dorka benachrichtigte daraufhin den Leiter des Ortelsburger Heimatmuseums, der am nächsten Morgen vorbei kam um
sich die Fundstelle genau anzusehen. Er beauftragte ihn 4 Mann zu besorgen, um die Steine ringsum frei zu schaufeln.
Zwischen den Steinen durften wir die Erde nur mit Esslöffeln ausheben. Als es plötzlich zu regnen anfing hat Lehrer
Dorka die Brauerei Daum, in Ortelsburg angerufen, die uns über der Fundstelle ein Zelt errichtet haben, damit wir
ungestört weiterarbeiten konnten. Wir fanden 8 flache und 8 hohe Urnen zu beiden Seiten am Körper. Die Urnen wurden in
Gipsbinden eingewickelt und ins Heimatmuseum nach Ortelsburg gebracht, wo sie durch einen Fachmann, der extra aus einem
Königsberger Museum angereist war. Nach Reinigung der Urnen hat er festgestellt, das die Grabstätte etwa 2000 Jahre vor
Christi Geburt angelegt wurde und ein Doppelgrab war, in dem ein Toter liegend und einer in Hochstellung beigesetzt
wurde.
Die Nachricht von der Fundstelle verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Es erschienen viele Schaulustige, ganze
Schulklassen aus der Umgebung, mit Autos und zu Fuß. Durch die vielen Menschen wurden die bestellten Ackerflächen auf
unserem Feld sehr in Mitleidenschaft gezogen, eine Entschädigung haben wir nicht erhalten. Das Grab wurde vor dem
Heimatmuseum in Ortelsburg wieder so aufgebaut wie man es auf unserem Feld vorgefunden hat. Für den Transport der
Steine wurde ich entlohnt. Die Urnen hat das Königsberger Museum an sich genommen und wollte sie nicht wieder hergeben,
weil die solch einen Fund noch nicht in ihrer Sammlung hatten.
Sonnenwendfeuer
Am 24 Juni fand eine Sonnenwendfeier statt. Ein Brauch der an die alten Germanen erinnern sollte.
Der Lehrer Dorka hat den Bürgermeister beauftragt 2 Fuhrwerke in den Wald zu schicken, die Holz und alten Reisig holen
und auf dem großen Schulberg abladen sollten. Das Straßenbauamt hat uns Teertonnen zur Verfügung gestellt. Die ganze
Dorfgemeinschaft wurde eingeladen, am Abend, nach der Feldarbeit, an der Sonnenwendfeier teilzunehmen. Lehrer Dorka
hielt zuerst eine Ansprache, in der er anschaulich erklärte wie unsere Vorfahren in grauer Vorzeit gefeiert haben.
Nach dem offiziellen Teil wurden das Holz und die Teertonnen angezündet, es wurden Heimatlieder gesungen, wie: Wild
flutet der See, drauf schaukelt der Schiffer den schwankenden Kahn, Schaum wälzt er wie Schnee, von grausiger Mitte
zum Ufer heran, wild fluten die Wellen auf Vaterlands See, wie schön, oh trag mich auf Spiegel zu Hügel, Masovias See.
Masovia Land, mein Heimatland, Masovia es lebe mein Vaterland.
Lehrer Alfred Dorka und sein Wirken für Rohmanen.

Friedrich Biella hatte auf seinem Feld einen Granitstein mit einer geraden Seite, den haben wir
mit viel Schweiß an den Dorfteich transportiert und auf einer Erhöhung abgelegt. Der Stein sollte zum Denkmahl für die
Gefallenen des Ersten Weltkrieges umgestaltet werden. Da zu Wenige daran ein Interesse zeigten, wurde diese Idee fallen
gelassen und der Stein irgendwann ins Wasser gerollt. Der Lehrer Dorka war viele Jahre in Rohmanen tätig, dort hat er
später seine ehemalige Schülerin, Lotte Biella geheiratet. Er hat sich sehr für die Entwicklung des Dorfes interessiert,
war bei jeder Gemeindeversammlung anwesend und hat auf Schwachstellen hingewiesen die den Fortschritt behinderten.
Gemeinsam mit den Schülern hat er den Ehrenfriedhof für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges gepflegt, an der
Wegegablung nach Eichtal und zu Ehren des Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg eine Eiche gepflanzt.
Zum Advent hat Lehrer Dorka mit der Jugend einen Adventstern, in verschiedenen Farben gebastelt.
Der Stern wurde auf einer 2 Meter langen Stange befestigt, in der Mitte wurde ein Wachslicht angezündet, am Stern
wurde eine Schnur angebracht, wenn man daran zog rollte der Stern hin und her. Am ersten Wochenende im Advent
versammelten sich jung und alt, um den Stern durch das Dorf zu tragen. Alle schlossen sich dem vorausgehenden
Sternträger an, der den Stern durch die Hauptstraße und die angrenzenden Wege trug. Dieser Sternmarsch wurde an den
folgenden Adventwochenenden wiederholt.
Am ersten Weihnachtfeiertag wurde um 4:00 Uhr morgens ein Frühgottesdienst gehalten. Zuerst hat der Pfarrer eine
Andacht gehalten, dann haben die Kinder ein Krippenspiel aufgeführt und die Gemeinde hat schöne Weihnachtslieder
gesungen. Der Gastwirt Trzaska hat uns den Saal zur Verfügung gestellt. Wir hatten eine Posaunen- u. eine
Gitarrengruppe. Unter der Leitung von Herrn Willi Doormann spielten: Gottlieb Brosch, Fritz Ollech,
Gustav Rattay(Sopran), Wilhelm Pilath, Gustav Brosch(Alt), Fritz Both(Tenor) und Fritz Brosch(Bass).
In der Gitarrengruppe wirkten mit: Martha Ollech, Hedwig Ollech, Martha Lekzik, Martha Michalick und Auguste Lekzick.
Willy Doormann hat sie auf der Geige begleitet.
Kurz vor Ausbruch des 2. Weltkrieges
Bei der Aufstellung des Grenzschutzes(Regiment Buchholz), hat er als Hauptfeldwebel die
Gruppenführerkurse überwacht und selbst die fähigsten Männer dafür vorgeschlagen. Das Ausbildungspersonal hat das
Jäger-Battalion gestellt. Wir kamen zuerst ins Stadion(Waldheim), wurden da eingekleidet und dann ging es gleich
kasernenmäßig zu, theoretisch und praktisch. Jeder musste vor die Front treten und nachweisen ob er im Stande ist,
Befehle zu erteilen. Abends wurden Filme vorgeführt die uns zeigen sollten wie eine Gruppe sich im Gelände entfalten
muss. Die Exerziervorschriften hatten sich, im Verhältnis zu Kaiser Wilhelms Zeiten, etwas geändert. Damals bestand
eine Gruppe aus 8 Mann und einem Unteroffizier, jetzt aus 10 Schützen, 3 für das leichte Maschinengewehr und einem
Unteroffizier(13 Mann). Nach der Schulung folgte eine Abschlussprüfung, danach ein gemütliches Beisammensein. Aus
Rohmanen haben folgende Männer die Prüfung bestanden: Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy, Gustav Rattay und
Gustav Deptolla. Unsere Uniformen waren alle zu klein und es gab viel zu lachen bei der Anprobe.
Die erste Übung habe ich mit Emil Rosowski, in Lenzinen gemacht. Der Gutsbesitzer Marzinzick hat seine Scheune als
Unterkunft zur Verfügung gestellt. Er war im Range eines Hauptfeldwebels. In seinem haus war die Schreibstube
untergebracht, die er selbst verwaltete. Ein Lastauto hatte Uniformen aus der Kaserne in Ortelsburg geholt, jeder
musste eine Uniform anlegen und dann wurde solange getauscht bis alle eine passende gefunden hatten. An den Namen des
Kompanieführers kann ich mich nicht mehr erinnern. 1935 wurden wir zu einer Übung in die Dragonerkaserne nach Lyk
einberufen. Die Gruppenführer, Zugführer, und Kompanieführer die schon Frontberührung im dem Ersten Weltkrieg hatten,
mussten eine Woche früher anreisen. Die Übungen waren auf 6 Wochen angelegt. Die meisten der einberufenen waren noch
nie mit dem Wehrdienst in Berührung gekommen. Jeder Gruppenführer bekam 13 Mann zugeteilt.
Unser Zugführer war Leutnant Neumann, Kompanieführer Oberleutnant Rutschko, Battalions-Kommandeur Major Gröning
(Regiment Buchholz). Hier ging es wieder Kasernenmäßig voran. Das Bataillon wurde hier vereidigt. Jeden zweiten
Sonntag durften unsere Frauen uns besuchen. Ein Jahr später wurden wir wieder zu einer Übung einberufen, auf den
Truppenübungsplatz nach Arys. Jeder Gruppenführer hatte den Auftrag die Gruppe zu entfalten, und auf bewegliche
Figuren zu schießen. Diese Übung musste später mit scharfer Munition wiederholt werden. Jedes Maschinengewehr bekam
50 Schuss, jeder Schütze 20 Schuss zugeteilt. Nach dem Abschießen wurden die Treffer gezählt und dem Kommandierenden
Bericht erstattet. In einiger Entfernung spaziert ein Storch umher, der gar nicht bemerkt hatte dass geschossen wurde,
was bei den Kameraden ein großes Gelächter hervorrief.
Nach der Übung wurde uns gesagt das jeder Gruppenführer eine arische Abstammung nachweisen sollte. Ich konnte in den
Rheinsweiner Kirchenbüchern meine Vorfahren aus Gellen, bis zum Jahr 1732 zurück, nachweisen und wurde zum
Unteroffizier befördert. Aus unserem Dorf wurden auch, Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy und Gustav Deptolla
befördert. Zwischendurch mussten wir schon mal in die Radfahrer-Kaserne nach Ortelsburg, Gewehre empfangen und im
Gelände üben. Am 31 Juli 1939 wurde mir von einem Soldaten ein Schreiben übereicht, das mich aufforderte, am 1. August
um 6:00 Uhr, bei der 3. Kompanie, des 2. Infanterieregiments zu erscheinen.
Um 5:30 hat mich meine Schwester in die Kaserne gebracht. Auf der Schreibstube erklärte mir der Hauptfeldwebel,
dass mir ab sofort der Dienstgrad eines Sanitäters zugewiesen wird, ich mich in der Kammer einzukleiden hätte und mir
in der Handwerkerstube die entsprechenden Schulterklappen annähen lassen sollte. Die aktiven Sanitäter wurden den
Feldlazaretten zugewiesen und wir kamen an ihre Stelle. Unser Bataillon wurde nach Schodmak zum Bunker bauen und
Stacheldraht verlegen eingeteilt. Wir zogen in Begleitung einer Musikkapelle bis zur Kreuzung am Krankenhaus, dann
weiter zu unserem Bestimmungsort, gefolgt von einer Gulaschkanone die in den nächsten Tagen für unsere Verpflegung
sorgen sollte.
Am 14 August haben wir die Jägerkaserne, begleitet von einer Musikkapelle endgültig verlassen und zogen zuerst durch
Ortelsburg, dann über Lehmanen ins Feldmanöver, hinter Rohmanen. Dort entfaltete sich das Bataillon im Gelände, die
Verwundetensammelstelle wurde auf dem Hof des Bauern Friedrich Neumann eingerichtet. Gegen Abend wurde zu Sammeln
geblasen und Biwak bezogen, wobei unsere 3.Kompanie, in einem kleinen Wallt, in der Nähe von Otto Nickels Gehöft
Stellung bezogen hatte. Die 2. und 4. Kompanie hatte sich in der Nähe vom Abbau Pallasch niedergelassen. Die Frau
Nickel hat am Abend ein Mädel in Dorf geschickt um meiner Frau Bescheid zu sagen, wo wir uns zurzeit befinden. Meine
Frau ist dann noch gekommen um sich von mir zu verabschieden, weil wir am nächsten Morgen um 3:00 Uhr Zelte abbrechen
und um 4:00 Uhr in Richtung Kaspersguth marschieren sollten.
Wir sind dann über Achodden, Seelonken, Lehmanen, Ortelsburg, bis nach Grammen und Schützendorf marschiert, wo wir an
einem See Biwak bezogen haben. Es wurde immer gesagt, wir kommen zum Tannenberg-Denkmal bei Hohenstein, wo ein Reichs
Kriegervereinsfest stattfinden sollte. Es wurden auch schon Vorkommandos aufgestellt, doch dann kamen wir nach Orlau
und Lahna-Mühle, da wo die Alle entspringt haben wir 2 Tage biwakiert. Unser Kompanieführer hat uns nach Waplitz auf
den Soldatenfriedhof des Ersten Weltkrieges geführt und uns erklärt wie das Jägerbataillon sich 1914 hier entfaltet
hat und aufgerieben wurde. Dann mussten wir in der Nähe von Gut Koslau über einen Fluss und bezogen in einem Waldstück,
vorbereitete Stellungen in der Nähe der polnischen Grenze. Herr und Frau Thalmann haben uns jeden Tag, bis zur Grenze,
mit Brötchen und Getränken versorgt. Es wurde scharfe Munition ausgegeben, weil wir am nächsten Morgen um 4:00 Uhr die
polnische Grenze überschreiten sollten.
Am nächsten Morgen um 10 Minuten vor 4:00 Uhr kam der Befehl; scharfe Munition abgeben, alles zurück in ein 6 Kilometer
entferntes Dorf, wo wir auch einquartiert wurden. Das alles geschah’ eine Woche vor dem 1. September 1939. Es wurde
gesagt dass der Führer dem polnischen Präsidenten Rid-Szmigly, ein Ultimatum gestellt hat und es wahrscheinlich nicht
zum Krieg mit Polen kommt. Genau nach 5 Tagen kehrten wir wieder in die gleichen Stellungen zurück, es wurde wieder
scharfe Munition ausgegeben und am nächsten Morgen um 4:00 Uhr überschritten wir die polnische Grenze.
“Der 2. Weltkrieg.”
Der erste Einsatz in Polen
Wir kamen zuerst in ein Dorf in dem sich nur alte Menschen befanden. Auf unsere Frage wo denn die Bewohner wären sagte
man uns dass alle geflohen sind, weil erzählt wurde, die Deutschen würden alle Polen misshandeln und verstümmeln. Ich
habe ihnen daraufhin gesagt dass uns, unter Androhung von Strafe verboten wurde, einem Zivilisten etwas anzutun. Das
Vieh, die Schweine und Hunde des Dorfes liefen frei herum und die Soldaten fingen an auf die Hunde zu schießen, bis
gesagt wurde es seien Meldehunde im Dienste der Deutschen Wehrmacht und dieser Unfug der eigenen Truppe schaden würde,
weil etwaige Querschläger eigene Kameraden verletzen könnten. Wir gingen weiter auf polnischer Seite entlang der Grenze,
bis wir am Nachmittag die ersten Vorposten der Festung Mlawa erreichten, da befanden wir uns plötzlich im Feuerhagel
polnischer Festungsflack.
Am nächsten Morgen hatte ich schon 3 Verwundete und wusste nicht wo sich eine Verwundeten Sammelstelle befindet. Ich
suchte den Bataillonsgefechtstand auf der sich auf einer Anhöhe befand. Ich habe unseren Oberstabsarzt gefragt wo denn
die Verwundetensammelstelle wäre. Er rief beim Tross an, wo er die Auskunft erhielt, das sich vor dem Dorf ein Bunker
befindet in dem man die Verwundeten sammeln sollte, die dann von Sanitätsautos abgeholt würden, weil das Dorf unter
Artilleriebeschuss stand. Am Sonnabend haben unsere Flieger die Bunkerstellungen bombardiert, konnten aber, trotz guter
Treffer nicht viel ausrichten, die Bunker wurden nur etwas angekratzt.
Der Beschuss unserer vordersten Linien ging mit unverminderter Heftigkeit weiter. Am Sonntag verkündete eine große
Staubwolke die Ankunft unserer Panzer, doch sie kamen nur bis zur Panzersperre und mussten wieder abdrehen ohne den
Polen einen schaden zuzufügen. Ein Panzer bekam einen Volltreffer, der Fahrer konnte noch umkehren. Er blutete am Kopf
und der Schütze war so eingeklemmt, das wir ihn nur mit einem Seil unter den Armen, durch die Luke nach oben ziehen
konnten. Ob er seine Verwundung überlebt hat ist mir nicht bekannt, denn in der Nacht wurden Panzergeschütze nach
vorne in Stellung gebracht, die direkt in die Schießscharten der Bunker geschossen und so die Verteidiger vertrieben
haben. Daraufhin sind wir weiter vorgerückt. Auf einer Wiese war ein tiefer Graben ausgehoben und mit Ästen getarnt,
da war ein Panzer hinein gefahren, so dass nur das Hinterteil herausragte und er sich nicht aus eigner Kraft befreien
konnte. In der Luft waren Flieger die Brandbomben abwarfen, ich habe mich auf den Boden geworfen weil ich dachte die
würden explodieren, aber sie zischten nur, so das Stoppeln und Graß rings herum in Brand gerieten.
Bei den Kampfhandlungen gab es mehrere Verwundete, denen ich gerade Verbände anlegen wollte, als unser Hauptmann zur
Trillerpfeife griff um mir klar zu machen, dass ich ihm folgen sollte. Die Polen fingen an zu schreien, ich sollte
sie ins Lazarett bringen denn hier im Wald würde sie niemand finden. Ich setzte mich aufs Fahrrad und folgte unserem
Kompanieführer, der mir sagte ich soll immer bei der kämpfenden Truppe bleiben, denn hinter der Front sind die
Sanitätsabteilungen, die werden die Verwundeten schon versorgen. Der Vormarsch dauerte bis in die späte Nacht. Auf
einem Gehöft, das nach allen Seiten durch Feldwachen abgesichert wurde, machten wir endlich Rast. Wir haben
Getreidegarben auf dem Hof ausgebreitet und uns zur Ruhe gelegt, als plötzlich um Mitternacht Leuchtraketen den Himmel
erhellten und Maschinengewehrfeuer uns aus dem Schlaf schreckte. Ein par polnische Soldaten hatten das Feuer eröffnet,
aber sich kurz darauf ergeben.
Die Narew-Überquerung
Als es hell wurde ging der Vormarsch weiter. Es wurde uns untersagt Tagebuch zu führen, darum
weiß ich nicht wie die Orte hießen, durch die wir marschiert sind. Als wir durch ein sumpfiges Gelände vor drangen
stand auf einer Anhöhe am Horizont, die polnische Artillerie, die uns sofort unter Beschuss nahm. Unser Hauptmann war
der Meinung dass wir schon in der Nähe des Flusses Narew sein müssten, als aus den Sträuchern ein mit Schlauchboten
beladenes Lastauto auftauchte. Wir wurden aufgefordert mit je 6 Mann ein Schlauchboot zu nehmen, an einem Aggregat
der daneben stand mit Luft zu füllen und zu Wasser zu lassen. In einer Stunde war das ganze Bataillon über die Narew,
wo der Vormarsch fortgesetzt wurde. In einem Dorf überraschte uns die polnische Kavallerie und fing sofort mit
Maschinengewehren zu schießen an. Da kam der Befehl: Alles wieder zurück. Es ging noch schneller als auf der Hinfahrt.
Wir sind erst einige Kilometer am Fluss entlang gegangen und haben dann zum zweiten Mal rüber gesetzt.
Die Gehöfte im Dorf standen alle in Brand. Auf einem waren viele Bienestöcke. 2 Kameraden wollten den Stöcken Waben
entnehmen, doch die Bienen durch das Feuer aufgeschreckt, überfielen sie sofort und stachen derart zu das sie nicht
mehr wieder zu erkennen waren. Ich habe die Einstichstellen mit Salmiak betupft, mehr konnte ich nicht tun. Wir mussten
auf unserem Vormarsch durch einen Wald der in Flammen stand, so dass man kaum atmen konnte. Es ging weiter in Richtung
Minsk und Warschau, wo schon die Sowjetische Armee durchgegangen war, die Pferde und Vieh von einem Gut mitgenommen
hatten. In einem Wald stießen wir unverhofft auf ein Kloster, in dem wir einige Gefangene machten. Dann trafen wir auf
eine gute Straße die nach Grochow ging.
Als wir dort einmarschierten wurden wir aus den oberen Stockwerken beschossen, so dass wir, um uns zu schützen, nur an
den Hauswänden entlang gehen konnten. Wir haben jedes Haus nach Feinden durchsucht. Vor einem Haus stand ein Hund der
niemanden reinlassen wollte, solange bis ihn eine Kugel traf. Die polnische Artillerie feuerte von Warschau aus, um
unseren Vormarsch zu stoppen. Wir hatten uns gerade eingegraben als plötzlich deutsche Flieger am Himmel erschienen,
die unsere Stellungen mit Bomben bewarfen und dabei viel Unheil anrichteten. Wir haben sofort Fliegertücher
ausgebreitet und Leuchtraketen abgeschossen. Da ich in dem Graben, den ich kurz zuvor ausgehoben hatte, sofort in
Deckung gegangen bin ist mir zum Glück nichts passiert. Unter den anderen Kameraden gab es viele Verwundete, so dass
ich nicht wusste wem ich zuerst helfen sollte.
Der Oberstabsarzt hat mich sofort tatkräftig unterstützt, so das bald alle Verwundeten versorgt waren, außer einem,
dem ein Bombensplitter den Arm abgerissen hat. Ich habe im 3 große Verbandspäckchen auf die Wunde gelegt, doch die
Blutung ließ sich trotzdem nicht stoppen, so dass er eine Stunde später auf der Krankensammelstelle verstarb. Wir
haben danach in einem Tomatenfeld einen Graben ausgehoben und eine neue Abwehrstellung bezogen. Die Gruppe Schwarz
bekam den Auftrag nach etwaigen versprengten polnischen Verbänden Ausschau zu halten, als sie unerwartet aus einer
Häuserreihe mit Maschinengewehrsalven überschüttet wurden. Der Gruppenführer und noch ein Soldat wurden dabei tödlich
verwundet. Danach wurde noch ein weiter Stoßtrupp, unter der Führung von Leutnant Briskorn, der sich dazu freiwillig
gemeldet hatte, hinaus geschickt um den Gruppenführer und den anderen Toten zu bergen.
Bei diesem Unternehmen, das erfolglos ausging, weil die Toten schon verscharrt waren, durchschlug eine Kugel den
Stahlhelm von Leutnant Briskorn, der auch sofort tot war. Alle Toten wurden später, an der Kirchenmauer in Grochow, in
Särgen beigesetzt: Hauptmann Schönwald sagte, das sie nach dem Kriege auf den Heldenfriedhof nach Ortelsburg überführt
werden. Drei Tage lagen wir bei Grochow in Stellungen, waren dem polnischen Maschinengewehrfeuer sowie den Bomben
deutscher Flugzeuge ausgesetzt. In der Nacht musste ich zu einem Verwundeten in die vorderste Linie und habe den
Rückweg nicht mehr finden können, als plötzlich Gewehrfeuer aufflammte habe ich in den Ruinen Schutz gesucht. Erst im
Morgengrauen konnte ich mich wieder orientieren und zu meinem Unterstand zurückfinden.
Warschau wurde tagelang bombardiert und stand auch unter Artilleriebeschuss. Aus dunklen Rauchwolken kamen oft ganze
Bündel von Papier angeflogen. Die Verwundeten kamen oft auf Krücken zu unserem Unterstand, ich habe sie dann zur
Krankensammelstelle hingeführt. Wir haben auch polnische Zivilpersonen betreut, die während der Kampfhandlungen
verwundet wurden. Als einmal 2 Jungen vorbeiliefen hat einer ihnen nachgerufen sie sollten seiner Frau Bescheid sagen,
er wäre auf der Krankensammelstelle an der Kirche. Als wir dort ankamen war seine Frau, mit einem Kind auf dem Arm,
schon da.
Nach der Kapitulation von Warschau, gingen wir über Sokolow zum Bug und haben dort Quartier bezogen. Der Russe hatte
sich bereits hinter den Fluss zurückgezogen, hatte alles Vieh und Pferde mitgenommen. Dort erreichte mich ein Telegramm
von zu Hause, dass meine Tochter gestorben ist. Es sprach sich auch herum dass verschiedene Heimaturlaub bekommen haben,
ich durfte auch für 14 Tage heim. Wir fuhren mit Lastautos nach Allenstein in die neue Reiterkaserne, zum
Ersatzbatallion, da haben wir unsere Gewehre und Munition abgeben, dann durften wir, jeder in seinen Heimatort
weiterfahren.
Als wir unsere Quartiere am Bug verlassen haben war sehr viel Schnee gefallen. Hier in Ortelsburg fanden wir die
gleiche Wetterlage vor, aber nach 3 Tagen war alles wieder weggetaut und wir konnten die Kartoffelernte, die durch den
frühen Wintereinbruch gestoppt wurde, zu Ende bringen. Ein Tag bevor ich zu Hause angekommen bin wurde die Tochter
beerdigt. Nach 14 Tagen mussten wir uns in Allenstein melden, Gewehre empfangen und wieder zurück zur Division an den
Bug 150 Kilometer hinter Warschau. Die elfte Division, zu der wir auch gehörten sollte in den Westen Deutschlands
verlegt werden und war schon unterwegs zur Verladestation Skiernewice 50 Kilometer vor Warschau.
Mein Dienst als Sanitätsunteroffizier
Unser Bataillon kam in das Städtchen Burscheid, im Kreis Opladen, wo wir in Privatquartieren
untergebracht wurden. Nach 3 Monaten, im Januar 1940, wurden wir nach Solingen verlegt, wo wir bis zum
Frankreichfeldzug stationiert waren. Wir mussten an Feldübungen teilnehmen, wie andere die in Kasernen untergebracht
waren. Während dieser Zeit musste jeder seine Zähne in Ordnung bringen lassen. Jeden Tag fuhren 20 Mann in die
Cäzilienstraße nach Köln, zur Zahnklinik. Im Rheinland wurde unsere Division neu aufgestellt. Ausfälle durch den
Polenfeldzug wurden durch neue Soldaten ergänzt. Ich kam nun zum Ersatzbatallion, war der Älteste in der ganzen
Kompanie. Als der Frankreichfeldzug losging wurde unser Ersatzbatallion mit den noch vorhandenen Verwundeten, in die
neue Reiterkaserne, nach Allenstein verlegt.
Meine Frau hat, mit Unterstützung der Bauernschaft, einen Antrag gestellt, daraufhin wurde ich zur Frühjahrsbestellung,
beurlaubt und später bis auf weiteres vom Militärdienst freigestellt. Als der Russlandfeldzug losging wurde ich von der
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg, für 14 Tage einberufen. Ich war seit 1922, Mitglied der freiwilligen
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg und habe jedes Jahr an Übungen teilgenommen. Jede Bereitschaft musste etliche Leute
stellen. Von Rohmanen wurden Emil Rosowski, Johann Dembek, und ich, zur Krankensammelstelle Wirballen, in Litauen,
abkommandiert. Dorthin kamen Lazarettzüge aus Russland mit der Breitspurbahn. Die Verwundeten wurden frisch verbunden
und auf Waggon mit Normalspur verladen und nach Deutschland gebracht.
Als die 14 Tage vergangen waren wollten wir wieder nach Haus zurück, doch man wollte uns nicht entlassen. Stattdessen
wurden wir dem Wehrkreisamt Königsberg zugeteilt, neu eingekleidet und zur Aushilfe ins Lazarett nach Gumbinnen
abkommandiert. Mehr als ein Jahr war ich in den Urlauber-Baracken, habe dort Krankenstube betreut. Später, bis zum
Dezember 1944, war ich im Reserve-Lazarett 4, in Königsberg tätig. Dort habe ich auch die Luftangriffe der Engländer,
vom 25 bis 26. August 1944 miterlebt.
Wir sollten gerade einen Lazarettzug in Rotenstein entladen, als plötzlich die Sirenen ertönten - Fliegeralarm. Im
gleichen Moment waren die ersten Flugzeuge auch schon da, zuerst warfen sie „Tannenbäume” und danach Foßforkanister ab.
Die Omnibusse standen schon zur Abfahrt bereit als es losging. Wir haben die Verwundeten schnell in den
Luftschutzkeller getragen, haben die Betten von den Fenstern weggerückt damit die Verwundeten nicht von den
Glasssplittern verletzt wurden. Im Kasernenhof brannten die Fosforkanister lichterloh. Unsere Unterkunft, die sich in
einer Baracke befand ist völlig abgebrannt, mit dem Wenigen was wir unser Eigen nannten. Am nächsten Tag wurden wir neu
eingekleidet und am 29. bis 30. kamen die englischen Bomber wieder, sie setzten genau da ihr Zerstörungswerk fort wo
sie vor 3 Tagen aufgehört hatten.
Anfang Dezember 1944 musste ich mich nach Stablack melden und musste dann zur Sanitätsabteilung 1, nach Gernau, das
liegt zwischen Lodz und Warschau. Vormittags hatten wir Felddienstübungen und nachmittags theoretischen Unterricht.
Jeden Tag wurden Gruppen zusammengestellt und zu anderen Einheiten abkommandiert. Ich kam zu einer Panzerabteilung, wo
wir an einem Morgen plötzlich auf dem Kasernenhof antreten mussten und zu unserer Überraschung mit der Nachricht
konfrontiert wurden, dass der Russe an mehreren Frontabschnitten durchgebrochen war. Wir bekamen sofort einen
Marschbefehl in Richtung Lodz, wo das Stadtbild noch intakt war, selbst die Straßenbahnen fuhren noch. In der Nacht
haben russische Flugzeuge die Stadt bombardiert. Die Kaserne in der wir untergebracht waren hatte keine
Luftschutzkeller, aber zum Glück blieben wir von Bombentreffern verschont. Am nächsten morgen bot sich uns ein Bild der
Verwüstung. Die entgleisten Straßenbahnwagen, sowie andere Fahrzeuge blockierten die Straßen. Die Älteren unter uns
bekamen Fahrscheine für einen Transportzug, der bereit hinter Lodz abfahrbereit, unter Dampf stehen sollte. Als
russische Panzer in den Straßen auftauchten, verbrannte die Schreibstube unsere Wehrpässe und andere wichtige
Dokumente. Wir liefen zu der Station auf der unser Transportzug bereitstehen sollte, aber da war kein Zug mehr zu sehen
und wir setzten unseren Rückzug zu Fuß fort.
Der Rückzug und Zusammenbruch der Ostfront
In Dobroschin, einer Stadt in Polen, wurde gerade ein Lazarettzug verladen, doch wir kamen nicht
mehr zum Einsatz, weil die russische Infanterie uns schon auf den Fersen war. Es ging weiter über den Fluss Bober,
Sagan, bis nach Glogau an der Oder. Dort wurden wir der 29. motorisierten Sanitätskompanie zugeteilt. Im
Garnisonslazarett wurden noch Operationen durchgeführt. Unsere Division hatte ihr eigenes Feldlazarett, so dass wir den
Befehl zu Weiterfahrt erhielten und noch unbeschadet die Oderbrücke passieren konnten, denn Glogau wurde zur Festung
erklärt. Wir haben 2 Pferdewagen organisiert und mit Verbänden, sowie medizinischen Instrumenten beladen. So kamen wir
bis nach Lübbenau im Spreewald, wo wir in einem Schloss, in zuvor ein Museum war, unser Lazarett untergebracht haben.
Weil die Amerikaner Cottbus bombardiert hatten, wurden die Verwundeten zu uns nach Lübbenau gebracht. Hier haben wir
Tag und Nacht gearbeitet, um die vielen Verwundeten, aus den schweren Kämpfen bei Grünberg und Sagan zu versorgen. Die
Soldaten von der Abwehrfront kamen schon mit abgestorbenen Armen oder Beinen bei uns an, weil in vorderster Linie keine
Frontlazarette mehr vorhanden waren; es mussten viele Amputationen durchgeführt werden. Als für unsere Pferde kein Heu
mehr vorhanden war, schickte mich unser Hauptfeldwebel, zu einem Bauern in den Spreewald, mit dem Auftrag, Futter zu
besorgen. Mit noch zwei Mann fuhren mit zwei Kähnen, zuerst den Hauptstrom entlang und dann in einen Nebenarm; da haben
wir die Boote beladen und brachten das Heu nach Lübbenau.
Als wir uns bei unser Einheit zurück melden wollten, war alles schon marschbereit. Ich bin schnell in einen Bus
eingestiegen der sofort losfuhr, weil russische Verbände schon in sichtweite waren. Russische Flugzeuge kreisten über
den Dächern und nahmen, mit ihren Bordwaffen jeden unter Beschuss, der sich irgendwo blicken ließ. Wir konnten nur
durch den Wald, oder in der Nacht vorwärts kommen, denn wenn ein Auto auf der Landstraße fuhr, war alsbald ein Flugzeug
hinter ihm her und schoss es in Brand. Als wir nach Tagen am Ufer der Elbe ankamen, war bereits eine Ponton-Brücke
erstellt worden, welche die zerstörte Brücke ersetzen sollte.
Durch die vielen Fahrzeuge waren in den Sand tiefe Spuren gefahren, so dass andere Fahrzeuge unsere Busse ins
Schlepptau nehmen mussten, weil wir mit eigener Kraft nicht mehr weiterkamen. Beiderseits der Trasse standen
Flüchtlingswagen, in der der Hoffnung die Brücke passieren zu können, doch SS-Polizei verhinderte das die Gespanne den
militärischen Rückzug zum Stillstand brachten. Es gelang uns die Elbe zu überqueren, um in einem Waldstück Schutz vor
feindlichen Fliegern zu suchen.
Als wir unsere Busse und Autos gut getarnt hatten, hat unser Bataillonschef die anwesenden Parteigrößen zu sich
gerufen und ihnen erklärt das wir eine Einheit des Roten Kreuzes sind und nach internationalem Recht keine Waffen
besitzen dürfen. Nach langer, erregter Diskussion wurde beschlossen einen Graben auszuheben und alles im Sand zu
verscharren. Als wir dann weiter, durch die Dörfer fuhren, sahen wir schon viele weiße Bettlaken, als Zeichen der
Kapitulation, aus den Fenstern hängen. Es wurde uns erzählt dass der Bürgermeister von der SS erschossen wurde, weil
er die Bevölkerung zu diesem Schritt ermutigt hatte. Jetzt waren hinter uns die Russen und vor uns schon die Amerikaner.
Amerikanische Panzer fuhren umher und schossen wild durch die Gegend, ohne ein Ziel anzuvisieren. Niemand wollte sich
dem Russen ergeben, doch der Weg der zu den Amerikanern führte, war durch abgesägte Bäume blockiert. Wir sind schnell
in das nächste Dorf gegangen, haben uns Sägen und Äxte besorgt, die Bäume durchgesägt und in den Straßengraben
geworfen.
“ Nach dem Ende des 2. Weltkrieges.”
In amerikanische Kriegsgefangenschaft
Dann fuhren wir unter internationaler Flagge an eine Mulde Brücke, vor der zwei amerikanische Soldaten, mit Zigarren,
zur Hälfte im Mund, standen. Sie rauchten und kauten gleichzeitig. Wir mussten auf einen freien Platz fahren, alle
aussteigen und rechts wieder antreten. Wäschebeutel und Tornister mussten wir abstellen; danach wurden wir nach Waffen
durchsucht, Wertsachen, Uhren und Messer wurden uns gleich abgenommen. Als wir anschließend an unserem Gepäck
vorbeigingen durfte niemand was mitnehmen. Als ich gebückt, nach meinem Wäschebeutel greifen wollte, in dem sich noch
3 Konservendosen und ein Brot befanden, bekam ich einen Fußtritt ins Gesicht, so dass mir ein Zahn ausgeschlagen wurde.
Wir wurden dann in einem Garten zusammen getrieben und gefragt ob jemand bei der SS gedient hat. Nachdem wir in Reihe
und Glied angetreten waren, mussten wir den Oberkörper freimachen und die Arme anheben. Es wurde nach SS-Zeichen
gesucht, die gewöhnlich unter dem Oberarm eintätowiert waren. Nachdem wir Grimma bei Leipzig, wo wir in amerikanische
Gefangenschaft geraten waren, verlassen hatten, mussten wir durch ganz Thüringen bis Hersfeld, an der Grenze zu Hessen,
marschieren. In Hersfeld wurden wir auf große Lastautos verladen, die von farbigen Soldaten gefahren wurden. Man hat
uns mit Stöcken hinauf getrieben, solange bis das Auto so voll war das man kaum stehen konnte. Die Soldaten fuhren, für
diese Straßenverhältnisse, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Wenn die Straße eine scharfe Kurve hatte, flogen
wir alle übereinander und mussten erst mit viel Kraftanstrengung auf die Beine kommen um diese Fahrt zu überstehen.
Da die Straßenränder in dieser Gegend mit Obstbäumen bepflanzt sind und deren Äste sehr niedrig hängen, hätten die
uns die Köpfe abgerissen, wenn wir uns nicht ständig geduckt hätten. Unsere Fahrt endete in Bad Kreuznach, in der Pfalz,
wo wir in ein Lager, in dem sich später 130.000 Mann und 6 Generäle befanden, eingepfercht wurden. Die Unterkunft der
Generäle befand sich unter einem Zelt, alle anderen mussten die Zeit unter freiem Himmel zubringen. Die Offiziere, die
Unteroffiziere, die Mannschaften; wurden in getrennten Camps untergebracht. Die Mannschaften wurden auch zur Arbeit
abkommandiert und konnten bei dieser Gelegenheit, Brot, Brötchen oder Zigarettenstummel organisieren, wogegen die
Offiziere und Unteroffiziere ihr Camp überhaupt nicht verlassen durften.
Die ersten Tage gab es kein Wasser und kein Brot, so dass die Kameraden vor Erschöpfung umfielen. Später standen wir
manchmal den ganzen Tag nach Wasser an, das von den, uns bewachenden Negern mit großen Wassertanks angefahren wurde. Am
dritten Tag bekamen wir mittags und abends etwas zu Essen; Brot bekamen wir erst nach zwei Wochen, nach dem aus der
Umgebung herbeigeholte Handwerker, Backöfen gebaut hatten. In den verschiedenen Gemeinden, die in den uns umgebenden
Weinbergen lagen, mussten sich alle Männer beim Bürgermeister melden. Als sie dann erschienen waren, wurden sie auf
bereitstehende Lastautos getrieben und zu uns ins Lager gebracht. Sie waren ohne Kopfbedeckung und ohne wärmere
Bekleidung angekommen, weil ihnen gesagt wurde, dass ihr Aufenthalt im Lager nur von kurzer Dauer sein würde. Man hat
uns, falls noch vorhanden, Decken und Mäntel abgenommen, mit der Begründung, sie würden für Kranke und Verwundete
gebraucht. Jeden Tag starben mehr als 200 Mann, die wir sofort in ein Zelt tragen mussten. In der Nacht wurden die
Toten dann mit unbekanntem Ziel, weggefahren.
Viele haben ihren Verstand verloren uns irrten im ganzen Camp ziellos umher. Als Latrinen wurden Gräben ausgehoben, in
die verschiedene Kameraden, bei der Verrichtung ihrer Notdurft, vor Schwäche hineingefallen sind und nicht mehr wieder
heraus kamen. Aus den Pfählen die, die jungen Obstbäume stützten, haben wir Krankentragen gebaut um unsere Kameraden,
bei Bedarf, zur Krankensammelstelle zu tragen. Es war in diesem Frühjahr auch sehr kalt, doch unsere Erdlöcher, die wir
zum Schutz vor Kälte und Wind, nur mit leeren Konservendosen ausgehoben hatten, durften nicht tiefer als 20 Zentimeter
sein. Nach jedem Regenguss mussten wir das Wasser ausschöpfen. Nach einem Gewitter, standen wir wiedermal, total
durchnässt in unserem Camp, als unerwartet am Horizont die Sonne hervortrat. Einer unserer Kameraden hatte noch eine
Trompete gerettet und fing, von dem Anblick völlig überwältigt, zu spielen an: "Es geht alles vorüber, es geht alles
vorbei, nach jedem Dezember, folgt wieder ein Mai". Daraufhin hob sich die Stimmung der tiefbetrübten Kriegsgefangenen,
so das Heimatlieder durch das ganze Camp erklangen, obwohl wir in den nassen Kleider herumgehen mussten, bis sie am
Körper trocken wurden.
In französischer Kriegsgefangenschaft
Nach etwa einem Monat, haben uns die Amerikaner, den Franzosen, zum Arbeitseinsatz, ausgeliefert.
Etwa 4 Kilometer von Bad Kreuznach entfernt, stand auf freier Strecke, ein Zug mit offenen Kohlenloren, auf den wir
verladen wurden. In jeden Waggon, wurde pro Person eine Tafel Schokolade und ein Päcken Zwieback rein geworfen, doch
viele Kameraden fanden nur leere Päckchen vor, weil die schon zuvor von der französischen Wachmannschaft geplündert
wurden. Wir haben uns darüber beschwert, doch die haben uns nur ausgelacht. Nachdem wir zunächst bei Mainz über den
Rhein fuhren, endete unsere Fahrt bei Paris in einem großen Zeltlager. Dort wurden wir auf andere Züge verladen, die uns
nach Südfrankreich, in ein Barackenlager, bei Mazarei, brachten.
Auf einer Zwischenstation hat man uns unter einer Pumpe, die Lokomotiven mit Wasser versorgt, abgestellt, den Kran
aufgedreht und uns anschließend ausgelacht, die Kinder Haben uns mit Steinen beworfen. Ein Wachmann kam in unseren
Waggon gekommen, hat unser Gepäck durchsucht, wenn er Tabak oder Zigaretten gefunden hat, nahm er sie mit. Die Kameraden
waren darüber so empört, dass sie vorhatten, ihn nachts unter den Waggon zu werfen. Wir haben sie gebeten dass zu
unterlassen, weil man uns in diesem Falle, alle erschießen würde.
Als wir ins Lager kamen wurden wir zuerst gezählt, dann mussten wir unser Gepäck stehen lassen und beiseite treten.
Wenn man bei der Nachkontrolle noch was in den Taschen fand, wurde das auch entwendet, selbst Esslöffel. Wir wurden
dann in drei Baracken, ohne Toiletten, eingeschlossen. Die Kameraden haben ihre Bedürfnisse in Kochgeschirre erledigt
und durch ein kleines Fenster, das sich fast unter der Decke befand, hinausgeworfen. Andere Fenster ließen sich nicht
öffnen, weil sie mit Stacheldraht zu geflochten waren. Als die Kameraden die Kochgeschirre auskippten, haben die
Wachposten geschossen und die Fenster zertrümmert. Sie waren der Meinung dass wir ausbrechen wollten. Es herrschte eine
große Hitze, in den überfüllten Baracken sind wir fast erstickt. Am nächsten Tag haben wir uns über fehlende Toilettem
beschwert, da haben sie Heringsfässer durch die Hälfte geschnitten und an der Ausgangstür hingestellt. Um bei den
überfüllten Räumen dort hinzukommen, musste man über die Köpfe der Anderen steigen. Viele hatten Fieber und Durchfall
und mussten in die Krankenstube eingeliefert werden, wo sie kurz darauf verstarben.
Besonders Raucher litten sehr an der Unterernährung, bekamen Wasser in den Beinen und waren die Ersten die verstarben.
Nach der Registrierung wurden wir auf andere Baracken verteilt. Die Zivilbevölkerung kam in die Räume und begann uns
auszuplündern. Wer noch gute Schuhe besaß musste sie ausziehen und bekam dafür die kaputten des Plünderers. Eine Woche
lang mussten wir diesen Zustand ertragen, erst als die Kameraden sich beschwerten, wurde am Eingang eine Tafel am
Eingang angebracht, dass die Zivilbevölkerung das Lager nicht betreten darf. Bis auf einige, wenige Ausnahmen wurde
diese Anweisung befolgt.
Als wir im Lager ankamen, war der französische Lagerkommandant, ein ehemaliger Kriegsgefangener, der bei einem Bauern
in Deutschland gearbeitet hatte. Dieser Bauer war jetzt als Kriegsgefangener in seinem Lager. Als er ihn erkannte, hat
er ihn gleich zum Küchendienst eingeteilt und mit dem nächsten Krankentransport nach Hause fahren lassen. Zu Mittag
bekamen wir nur gekochte Haferkörner, da schwamm alles oben, später war man dann auf Gerste umgestiegen. Als viele
daran gestorben waren, weil sie diese „Rohkost”, die nur ein Kuhmagen verträgt, nicht gegessen haben, hat man die
Körner durch eine Schrotmühle laufen lassen. Dann hat man uns Steckrüben gekocht; wir bekamen 250 Gramm Weißbrot,
etwas Quark und ein viertel Liter Magermilch. Später, als wir schon arbeiten mussten, hat man in unserem Essen einen
Kuhkopf mitgekocht, das hat dann bedeutend besser geschmeckt.
Bevor wir morgens zur Arbeit gingen, mussten wir zu Flaggenparade und abends, nach der Rückkehr, haben wir die Flagge
wieder eingeholt. Wir haben einen Kanal gereinigt, dessen Sohle 2 Meter dick mit Schlamm bedeckt war. Zuerst wurde das
Wasser abgelassen, dann haben wir, einer dem andern, den Schlamm mit der Schippe hoch gereicht. Der Letzte hat den
Schlamm, der so zäh war, dass er nicht von der Schippe wollte, oben am Rande abgelegt. Manchmal waren 10 Mann nötig um
den Höhenunterschied zu überwinden. Das Wachpersonal schoss über unsere Köpfe hinweg und rief: „schnell arbeiten”. Bei
der großen Hitze war das ein Ding der Unmöglichkeit, zumal es nichts zu Trinken gab. Auf dem Heimweg haben wir im Walde
Heilkräuter gesammelt, die man in der Küche getrocknet und als Tee zubereitet hat, den wir am nächsten tag zur Arbeit
mitnahmen, um unseren Durst zu stillen.
Unser Aufseher hatte einen Stock, an dem sich noch kurz abgeschnittene Äste befanden. Wer seiner Meinung nach, nicht
ordentlich gearbeitet hat, bekam gleich Schläge auf den Rücken. Die weißen Aufseher wurden irgendwann durch Neger
ersetzt, die uns bedeutend besser behandelt haben. Wenn irgendetwas schief ging, haben sie nichts gesagt, nur gelacht.
In den übrig gebliebenen Wassertümpeln hatten sich noch einige Aale versteckt, die wir zu fangen versuchten, was uns
auch manchmal gelang. Wir mussten ihnen das Genick brechen, damit sie uns nicht entwischen konnten. Wenn die Franzosen
bemerkten das wir Aale hatten, wurden sie uns abgenommen. Gelang es uns aber, sie ins Lager zu bringen, dann haben wir
uns eine köstliche Malzeit zubereitet.
Um sicherzustellen dass niemand geflüchtet ist, wurden wir, wenn wir abends ins Lager zurückkamen, zuerst gezählt.
Diese Zählung wurde mehrmals wiederholt, weil die Wachmannschaften sich immer wieder verzählt haben. Als einer von uns
hin ging, ihnen sagte dass alle da sind, wollten sie es nicht glauben und haben uns vor dem stehen lassen, bis es ihnen
irgendwann einfiel. uns doch das Tor zuöffnen. Einmal, als wir von der Arbeit zurückgekehrt waren, standen wir bis 23
Uhr neben der Flagge, weil uns niemand das Tor geöffnet hat. Als wir dann doch irgendwie ins Lager kamen haben wir
festgestellt, dass das ganze Wachpersonal betrunken war und niemand im Stande uns das Tor zu öffnen.
Eines Tages waren wir wieder abends zur Parole angetreten, als ein älterer Herr mit seinem Hund, am Stacheldraht
entlang, spazieren ging. Weil der Hund, unterm Stacheldraht hindurch, zu uns kam, hat ihn einer geschnappt, ihm das
Genick gebrochen und unter seiner Jacke versteckt. Der Franzose hat nach seinem Hund gerufen und gepfiffen, aber alles
vergebens, der Hund war nicht aufzufinden. Die Kameraden haben ihm gleich das Fell über die Ohren gezogen, das Fleisch
gekocht und das Fell in die Latrine geworfen. Das Fleisch wurde umgehend verspeist.
Als wir am nächsten Tag von der Arbeit zurückkehrten, war im Lager der Teufel los. Wir mussten sofort antreten und
wurden gefragt, wo der Hund geblieben ist, der Gestern Abend, mit seinem Herrchen, am Zaun entlang spazieren ging. Als
sich niemand dazu bekannte, mussten wir weiterhin stehen bleiben, während die Wachmannschaften von Baracke zu Baracke
gingen und alles durchsuchten. In einer Latrine hat man dann das Fell gefunden, was uns ein furchtbares „Donnerwetter”
einbrachte und in den nächsten Tagen, nach der Arbeit, unter dem Kommando eines Oberfeldwebels, eine Stunde
nachexerzieren.
In Südfrankreich regnet es den ganzen Sommer nicht; die Bauern haben da keine Scheunen und das Getreide wir nur in
Schobern aufgestellt und dann umgehend gedroschen. Vom Oktober bis Dezember regnete es fasst jeden Tag in Strömen.
Gesät wird nur im Frühjahr und im Herbst, weil im Sommer alles vertrocknet. Es wird viel Wein angebaut und die
Steckrübe wächst den ganzen Winter. Neben den Weinreben wurde aus Schieferplatten ein Zaun aufgestellt, um dem Wein
einen optimalen Standort zu sichern. Die Bauernwagen hatten nur zwei Räder und waren nur mit einem Pferd bespannt, das
die ganze Balance des Wagens zu halten hatte. Trotzdem haben sie soviel aufgeladen wie wir auf einen Leiterwagen. Viele
Kameraden wurden den Bauern zur Arbeit ausgeliehen. Wenn ein Bauer einen Arbeiter gebraucht hat und es wurde gefragt,
wer sich in der Landwirtschaft auskennt, da haben sich alle gemeldet. Der Bauer konnte sich dann aussuchen, wen er
mitnehmen wollte.
Wenn wir durch die Stadt zur Arbeit gingen, haben verschiedene Leute Fallobst in die Abfalleimer gelegt. Wenn das von
den Kameraden bemerkt wurde, schwenkten viele aus der Reihe, um sich etwas mit zunehmen, was von den Wachmannschaften
nicht gern gesehen wurde. Viele Kriegsgefangene hatten keine Schuhe mehr, sie haben die Füße nur mit Lumpen bewickelt.
Eines Tages kamen Kameraden aus Norwegen, die nach Deutschland entlassen werden sollten. Mann hat sie jedoch ins Lager
gesteckt und zur Arbeit eingeteilt. In Norwegen hatten sie Kleider und Stoffe eingekauft, hatten volle Seesäcke und
sogar Karren auf 2 Rädern, weil sie ja in die Heimat entlassen werden sollten. Als wir morgens zur Arbeit rausgeführt
wurden standen sie schon vor dem Lager. Wir haben ihnen zugerufen, dass sie uns etwas abgeben sollen, weil ihnen ja
sowieso alles abgenommen wird, aber sie haben uns nur ausgelacht. Als sie ins Lager Kamen mussten sie ihr Gepäck
ablegen, wurden dann wo anders hingeführt und haben es danach nie wieder gesehen.
Durch die vielen Läuse, Flöhe und Wanzen die wie im Lager hatten, kam es bei verschieden Kameraden, an den
Einstichstellen, zu eiternden Entzündungen. Um dem vorzubeugen hat man uns mit einem Pulver, das in Frankreich
hergestellt wurde, aber bei den Parasiten keine Wirkung zeigte, eingesprüht. Erst bei der Anwendung eines Mittels
amerikanischer Herkunft, war alles über Nacht verschwunden.
Der Sonntag war arbeitsfrei. Dann kam ein katholischer, französischer Pfarrer, eskortiert von 3 Mann, mit
aufgepflanztem Seitengewehr ins Lager und hat Gottesdienst gehalten. Einen evangelischen Pfarrer gab es nicht, nur
einen Baptisten Prediger. Der wurde würdevoll eingekleidet, bekam ein großes Kreuz und hat jeden Sonntag in einer
extra dafür hergerichteten Baracke Gottesdienst gehalten. Wer Theologie studiert hatte und sich meldete, wurde zu
einem Seminar geschickt und konnte sein Studium fortsetzen. Glasbläser durften das Lager auch verlassen und ihrem
erlernten Beruf wieder arbeiten.
Wer sich freiwillig, für 5 Jahre, zum Dienst in der Fremdenlegion verpflichtet hat, das waren etliche unter uns, wurde
neu eingekleidet, bekam gutes Essen und Rauchwaren soviel er wollte. Nach einem Jahr wurden, nach und nach, die
Kranken und Körperbehinderten in die Sowjetische Besatzungszone entlassen. Eine Entlassung von Kriegsgefangenen, die
in den Westzonen oder jenseits von Oder und Neise zu Hause waren, war nicht vorgesehen. Die Österreicher wurden alle,
unabhängig von ihrem Gesundheitszustand entlassen.
Ich habe Briefe nach Hause geschrieben, aber die kamen nur bis Allenstein und wurden wieder zurück geschickt. Als eine
Kommission des Roten Kreuzes aus der Schweiz unser Lager besichtigt hat, haben wir uns beschwert, das wir als
Sanitätsdienstgrade, zur Arbeit gehen müssen. Daraufhin erging ein Befehl: Wer einen vom Roten Kreuz, ausgestellten
Ausweis besitzt, gehört einem internationalen Verband an und braucht nicht zu Arbeit gehen. Aus unserem Lager hatten
sich 20 Mann gemeldet, die daraufhin Freigang, in Begleitung von zwei französischen Wachsoldaten erhielten. Als wir
gefragt wurden wo wir hin wollen, entschlossen wir uns, einen Soldatenfriedhof, auf dem unsere verstorbenen Kameraden
beerdigt waren, zu besuchen.
Da der Untergrund in dieser Gegend aus Felsen bestand, wurden die Gräben, in denen die Toten in selbst gezimmerten
Kisten nebeneinander gestellt wurden, mit Hilfe von Dynamit ausgehoben. Ein Leichenwagen, mit einem Pferd bespannt,
das mit einer schwarzen Decke abgedeckt war, wurde von einem Kutscher in angemessener Kleidung, gefahren. Der Wagen
konnte gleichzeitig 4 Kisten transportieren. Wenn wir von der Arbeit kommend, dem Leichenwagen begegneten, wurde
gehalten und mit einer Schweigeminute der Toten gedacht, bis der Wagen vorbei war. Die Zivilbevölkerung verharrte auch
im Schweigen, mit abgenommener Kopfbedeckung.
Ein Kamerad, der in Krottorf, Kreis Oschersleben, bei Magdeburg, zuhause war, sagte bei seiner Entlassung zu mir:
Sollte ich das Glück haben, meine Entlassungspapiere zu erhalten ohne eine Bleibe vorzuweisen, dann soll ich Krottorf
als Heimatadresse angeben. Auf der Krankenstube habe ich angegeben, dass sich noch ein Schrapnellsplitter, aus dem
Ersten Weltkrieg, in meiner Kreuzbeingegend befindet, er zwar verkapselt ist, aber immer noch Beschwerden verursacht.
Daraufhin wurde ich zur Entlassung vornotiert. Als bekannt wurde das ein Rückkehrertransport in die sowjetische
Besatzungszone zusammengestellt wird, habe ich mich sofort gemeldet und wurde für ein Entlassungslager in Angoleme
vorgesehen. War das eine Freude, als uns mitgeteilt wurde, wann der Rücktransport stattfindet.
In unserem Lager waren noch 2 Kameraden aus dem Kreis Ortelsburg: Ein Gustav Lumma aus Leynau und ein Alfred Moritz
aus Groß Schöndamerau. Sie mussten noch zurückbleiben und haben mir den Auftrag erteil, die Angehörigen in der Heimat
zu grüßen und ihnen die Anschrift mitzuteilen. Als wir im Entlassungslager ankamen, fragte man uns nach unserer
Heimatanschrift. Dann wurden die Entlassungspapiere angefertigt. Es wurde uns auch ein Barscheck, für die in Frankreich
geleistete Arbeit ausgehändigt, den wir bei jeder Kasse in Deutschland einlösen könnten. Ich habe ihn bis zum heutigen
Tage nicht einlösen können, obwohl ich irgendwann in der Zeitung gelesen habe, das Verrechnungschecks die den aus
französischer Kriegsgefangenschaft Entlassenen, ausgehändigt wurden, einzulösen sind.
Wir kamen zuerst nach Saar Elbe, dann in die Nähe der Zonengrenze zu Thüringen. Hier mussten wir 2 Tage warten, weil
aus der sowjetischen Besatzungszone keine Eisenbahnwagen bereitgestellt wurden. Angesichts dessen, das der Russe beim
letzten Transport die aus Frankreich kommenden Wagen kassiert und nicht mehr herausgeben wollte, bestand der Franzose
jetzt darauf, seine Wagen sofort wieder mitzunehmen. Als der sehnsüchtig erwartete Zug endlich eintraf, durften wir
umsteigen und kamen, immer noch hinter Stacheldraht, nach Erfurt. Von dort weiter ins Quarantänelager nach Prätsch an
der Elbe.
Unter Androhung von Strafe war es verboten das Lager zu verlassen, doch der Hunger zwang uns dazu, in den umliegenden
Dörfern um Lebensmittel zu betteln. Man drohte uns damit, dass Zuwiderhandlungen, mit einer 14-tägigen Verlängerung der
Quarantäne geahndet werden. Der Roggen war schon reif und wir haben, auf den umliegenden Feldern, die Ähren abgerissen,
das Korn, zwischen 2 Steinen zu Mehl zerrieben, um daraus eine Suppe zu kochen, denn von dem was unsere Lagerküche uns
bieten konnte, war es nicht möglich zu überleben. Als der Eigentümer bemerkte wer seine Roggenähren entwendet hat, kam
er ins Lager, gerade zu dem Zeitpunkt als wir mit dem Mahlen beschäftigt waren. Der Lagerkommandant, bei dem er sich
beschwerte, drohte uns zu bestrafen, wenn wir unsere „Rauzüge” nicht unmittelbar einstellen würden. Wir sagten ihm er
solle uns heimfahren lassen, da wir doch lange genug hinter Stacheldraht gesessen hätten.
Endlich wieder in Freiheit
14 Tage nach unserer Ankunft wurden uns Entlassungspapiere ausgehändigt, sowie auch Fahrscheine
zum den, von uns angegeben Heimatorten. So kam ich nach Krottof, Kreis Oschersleben, zu meinem ehemaligen
Kriegskameraden, bei dem ich einen Tag geblieben bin. Er hatte mir schon eine Stelle bei einem Bauern besorgt, der 70
Jahre alt und kinderlos war. Zum Hof, den er mit seiner Ehefrau bewirtschaftet hat, gehörten 36 Morgen Land, 2 Ochsen
und 3 Kühe. Das Ackerland bestand aus 17 Parzellen und sicherte mir einen Arbeitsplatz.
Jetzt, da ich ein Dach überm Kopf und genug zu essen hatte, fing ich an nach dem Verbleib meiner Familie zu forschen.
Bei meinem letzten Heimaturlaub hatte ich mit meiner Frau verabredet; falls wir uns in den Kriegswirren verlieren
sollten, unsere Kontaktadresse, die meiner Quartiersleute in Burscheid, Kreis Opladen, sein sollte. Ich habe zuerst
nach Rohmanen geschrieben, aber leider keine Antwort erhalten. Dann habe ich nach Burscheid geschrieben, und siehe, -
bei denen lag schon eine Anfrage meiner Frau vor, die nach mir gefragt, und ihre jetzige Anschrift hinterlassen hatte.
Ich habe dem Bauern erzählt dass meine Frau sich zurzeit, auf einem Gut, in Alt Steinhorst, im Kreis Rostock, befindet.
Er war sofort bereit uns ein Zimmer zur Verfügung zu stellen, wenn ich meine Frau nach Krottorf rüberholen wollte. Das
habe ich Ihr mitgeteilt und sie war sofort bereit ihren Wohnsitz nach Krottorf zu verlegen, denn sie wohnte dort in
einem kleinen Stübchen unterm Dach.
Im Herbst, als die Feldarbeit so ziemlich erledigt war, bin ich nach Alt Steinhorst gefahren, um meine Frau und meinen
Sohn Kurt, sowie meinen Sohn Manfred, den ich noch nicht kannte, weil er erst nach der Flucht, am 31. Januar, in Groß
Lüssewitz, geboren wurde, nach Krottorf zu holen. Meine Frau hatte schon Holz für den Winter besorgt und vom Gut, auf
dem sie im Sommer gearbeitet hatte, Mehl und Kartoffeln bekommen. Wir haben das Mehl und andere Habseligkeiten in
Kisten verpackt. Das Holz haben wir einem Bauern gegeben, der uns und unser Gepäck, mit seinem Pferdewagen, zum 14
Kilometer entfernten Bahnhof, nach Ribnitz gebracht hat. Wir sind auch gut in Krottorf angekommen, aber als wir am
nächsten Tag, unsere Kisten vom Bahnhof abholen wollten, haben wir zwar die Kisten vorgefunden, doch der gesamte Inhalt
wurde während der Bahnfahrt entwendet. Die Bahnstation in Krottorf hat die Vorkommnisse zur Kenntnis genommen und
protokolliert, aber unsere Sachen haben wir nie wieder gesehen und mussten wieder bei Null anfangen.
Im Winter musste ich auf der Genossenschaft, unentgeltlich, für die Russen Weizen einsacken. Ich hatte versucht eine
Arbeit als Zimmermann zu bekommen, doch auf dem Arbeitsamt wurde mir gesagt, ich bin Ladwirt und muss auf der
Landwirtschaft arbeiten. Da in den ersten Nachkriegsjahren, auch in der sowjetisch besetzten Zone Arbeitsplätze knapp
waren, mussten auch solche, die einen anderen Beruf erlernt hatten, jede zumutbare Arbeit annehmen. Aus der Heimat
erhielt ich einen Brief, von meiner dort noch lebenden Mutter. Sie schrieb das sie mich noch einmal sehen wollte und
ich sollte doch wieder zurück kommen; Unser Hof wäre nicht von Polen besetzt und sie wäre ganz alleine, weil der Vater
nach dem Durchzug der Front von den Russen erschlagen wurde. Daraufhin habe ich dem polnischen Konsulat in Magdeburg
mitgeteilt, dass ich in Rohmanen eine Landwirtschaft besitze, und um eine Einreisegenehmigung gebeten.
Nach 2 Monaten erhielt ich eine Postkarte, mit der Mitteilung, ich sollte mich persönlich beim Konsulat vorstellen.
Nach Aufnahme meiner Personalien, wurde mir gesagt, das ich benachrichtigt werde wenn mein Antrag genehmigt wird. Ende
Juli 1947 erhielten wir die Einreisegenehmigung nach Ostpreußen, das jetzt unter polnischer Verwaltung stand. Wir
mussten zuerst zum polnischen Konsulat in Berlin-Lichterfelde, wo wir umgeben von einer Trümmerlandschaft, gewartet
haben, bis alle Untersuchungen und Formalitäten erledigt waren.
“ Wieder zurück in Ostpreußen.”
Der schwere Wiederaufbau nach dem Kriege
Dann fuhren wir über Frankfurt/Oder, Posen, Thorn, Allenstein, nach Ortelsburg, wo wir am 2. August 1947 ankamen. Mit
einem zweirädrigen Karren, den ich mir von einem noch in Ortelsburg lebenden Bekanten ausgeliehen hatte und meinem
Sohn Manfred im Kinderwagen fuhren wir nach Rohmanen. Meine Mutter war inzwischen verstorben und auf dem Hof war nur
meine, inzwischen aus Russischer Gefangenschaft wiedergekehrte Schwester, Frieda Pelkowski.

Es war alles ausgeplündert; kein Vieh, keine Maschinen und der ganze Hof mit kniehohem Graß überwachsen. Nur schmale
Trampelpfade, vom Haus zum Holzschuppen und zum Klo, durchkreuzten das satte Grün. Ich habe das Gras auf dem Hof mit
einer Sense, die ich noch gefunden habe, abgemäht, damit der Hof nicht so verwahrlost aussah. Am nächsten Tag habe ich
mich bei der Polizei in Ortelsburg angemeldet, wo ich auch ein Startgeld von 100 Zloty erhielt und Gepäckstücke, die
ich in Krottorf aufgegeben, am Bahnhof abgeholt. Es hat mich sehr gewundert das, das Gepäck überhaupt angekommen ist.
Da man von der Landwirtschaft nicht Leben konnte, habe ich mich in den nächsten Tagen, bei der jetzt polnischen Bahn,
um Arbeit beworben und wurde auch angenommen. Wenn wir unseren Monatslohn bekamen, saß immer einer am Tisch, der von
uns 100 Zloty für den Wiederaufbau von Warschau verlangte. Wenn ich dran war, riefen die Anderen, ich hätte Warschau
zerstört und müsste deshalb 200 Zloty abgeben. Nach 3 Jahren kam eine Verfügung, die besagte, dass wer länger als 1
Jahr bei der Bahn beschäftigt ist, angestellt werden muss. Um diese Bestimmung zu umgehen hat man mich entlassen und
eine Woche später wieder eingestellt.
Als ich vor Ablauf des nächsten Jahres, aus dem gleichen Grunde wieder entlassen wurde, habe ich mich bei der
Stadtverwaltung in Ortelsburg(jetzt Szczytno)beworben, wo ich zuerst im Gaswerk als Heizer und später auf Baustellen
als Zimmermann gearbeitet habe. Wir haben durch den Krieg beschädigte Häuser repariert, in den ehemals touristischen
Zentren einige Ausbesserungen an den Einrichtungen durchgeführt, eine Ziegelei wieder in Betrieb gesetzt und andere
anfallende Arbeiten verrichtet. Im Dach des Rathausturmes war während der Kämpfe eine Granate eingeschlagen, die, die
Dachlatten und die Verschalung zerstört hatte. Da wir, unter schwersten Bedingungen, den Schaden repariert haben,
wurde uns eine Höhenzulage versprochen, die wir aber nicht bekommen haben.
Aus Verärgerung darüber habe ich bei der Stadtverwaltung gekündigt und bei einer Wiederaufbaufirma unter der Leitung
von Bauingenieur Laskowski wieder angefangen, wo ich bis 1954, als Zimmermann beschäftigt war. Ab da habe ich mich
nur um meinen Hof gekümmert, der wegen meiner Arbeitsstellen, gezwungenermaßen, sehr vernachlässigt wurde. Als wir
1947 zurückkamen, brachten wir unseren Sohn Manfred noch im Kinderwagen. Den hat meine Frau zum Markt gebracht,
verkauft, und dafür eine Ziege erworben, die dank guter Pflege, uns täglich mit 4 Liter Milch versorgte. Das war der
erste Baustein zum Wiederaufbau, unserer durch den Krieg zerstörten, und danach ausgeplünderten Landwirtschaft.
Während meiner Arbeit bei der Bahn haben wir uns eine Kuh gekauft, die nach einem halben Jahr, wegen nicht bezahlter
Grundsteuer, vom Gerichtsvollzieher gepfändet wurde. Man hat uns die Kuh weggenommen und bei einem Arbeiter, der in
der Ernst-Mey-Straße in Ortelsburg wohnte und sie wegen nicht vorhandener Futtermittel, nur mit Kartoffelkraut
gefüttert hat, untergestellt. Als ich bei der Bahn meinen Monatslohn bekommen habe, bin ich zur Gmina gegangen, habe
eine Rate angezahlt und durfte dann die Kuh wieder mit nach Hause nehmen. Durch die schlechte Ernährung war die Kuh
stark abgemagert und lieferte nur die Hälfte der ursprünglichen Milchleistung.
Später habe ich ein Pferd auf Abzahlung bekommen, das 140.000 alte Zloty gekostet hat. Die Stute war schwach und unser
Feld sehr hügelig, so dass man nur bergab pflügen konnte, was sehr beschwerlich war, bergauf ging es immer im Leerlauf.
Später habe ich die schweren Böden mit dem Traktor umpflügen, und in den letzten Jahren auch mit dem Binder mähen
lassen. Von der Stute habe ich 2 schöne Fohlen gezogen; ein davon habe ich bei der Ausreise in die Bundesrepublik
mitgebracht und bei der Viehverwertungs-Genossenschaft in Göttingen verkauft. In den ersten Nachkriegsjahren als noch
wenig Land bestellt wurde, breiteten sich auf den nicht beackerten Flächen, Wildkräuter aus. Disteln und andere
Schnellwachsende, erreichten manchmal eine Höhe von 2 Meter, besonders auf den schweren Böden.
Es hat viel Schweiß gekostet ehe man den Acker soweit hatte, das er auch befriedigende Erträge abwarf. Die
Währungsreform von 1950, hat unser weiniges Geld das wir schon gespart hatten, wieder vernichtet. Ich hatte 2 Pferde,
1 Fohlen, 2 Kühe und Schweine, als ich wieder aufgefordert wurde nicht bezahlte Grundsteuern nachzuzahlen. Als ich
nicht bezahlen konnte, hat der Vollziehungsbeamte, ein Fohlen, eine Kuh und ein Schwein gepfändet. Es gelang mir jedoch
nach längeren Verhandlungen, ohne größere Verluste, alles zu regeln. Später kam eine Verfügung, die besagte; wenn
jemand auf seinem Hof nur eine Kuh und ein Pferd hatte, durften sie nicht gepfändet werden. Einige haben ihr Inventar
dieser Verfügung angepasst und dadurch die Zahlung von Grundsteuer umgangen.

Wer seine Steuern pünktlich bezahlt und sein Kontingent an landwirtschaftlichen Produkten fristgerecht abgeliefert hat,
der konnte seine, darüber hinaus erwirtschafteten Produkte zu marktgerechten Preisen verkaufen. Für eine hochtragende
Sterke, mindestens 400 kg schwer, die auf ein staatliches Gut verkauft wurde, konnte man bis zu 12000 Zloty bekommen.
Unsere Böden waren kalkarm, doch durch den Einsatz von Kalk und Kunstdünger konnte man den Ertrag erheblich steigern.
Kalk und Kunstdünger konnte man bei der Genossenschaft(GS) bestellen, der dann auch direkt auf den Hof geliefert wurde.
Kalk wurde geliefert und gleich auf dem Feld ausgestreut. In den 1960ger Jahren waren alle Ackerflächen der Rohmaner
Felder bestellt.
Die nach dem Krieg zurückgebliebenen deutschen Bauernfamilien, aber auch die Polen, die während des Krieges beim Bauern
in Deutschland gearbeitet haben, versuchten mit teils bescheidenen, oder auch zusammen gesuchten, landwirtschaftlichen
Geräten, die bäuerlichen Betriebe aufrecht zu erhalten. Nach den schweren Anfängen in den ersten Nachkriegsjahren
erzielten sie schließlich einen beachtlichen Erfolg, der sich in wogenden Kornfeldern, sowie in grünen Wiesen auf
denen gut genährtes Vieh weidete, widerspiegelte.
Ein schwerer Einschnitt in meinem Leben.
Am 11. Mai 1956 verstarb nach langer schwerer Krankheit, meine liebe Ehefrau Marta Rattay,
geborene Brosch. Ein Jahr zuvor war schon mein Schwiegervater Gottlib Brosch verstorben. Die schweren Bedingungen
unter denen wir nach Kriegende leben mussten, haben ihrer bereits angegriffenen Gesundheit sehr zugesetzt. Sie
verstarb mit 44 Jahren und hinterließ in unserer Familie eine große Lücke, die nicht mehr zu Überbrücken war. Wir
haben sie unter großer Anteilnahme der noch verbliebenen deutschen Bevölkerung zu Grabe getragen und auf dem Rohmaner
Friedhof beigesetzt. Die Arbeit die sie sonst verrichtet hatte fiel jetzt auf mich und meine Söhne zurück. Meine
Schwester Frieda Pelkowski half auch wo sie nur konnte. Wir waren auf die Unterstützung durch Nachbarn und Freunde
angewiesen, die uns immer wenn es nötig war, tatkräftig unterstützt haben. Im laufe der Zeit haben wir wieder zum
Alltag zurück gefunden, haben sie noch etliche Jahre auf dem Friedhof besuchen können, bis wir, bedingt durch unsere
Ausreise uns endgültig von ihr trennen mussten.
Der endgültige Abschied von Ostpreußen
Ab 1956 begannen, durch die Vermittlung des Deutschen Roten Kreuzes, die ersten Ausreisen in die
Bundesrepublik Deutschland. Zuerst waren es Kinder die zu ihren Eltern ausreisen durften, Familien deren Väter aus der
Kriegsgefangenschaft in den Westen Deutschlands entlassen wurden und andere durch den Krieg getrennte
Familienangehörige. Ab 1960 erhöhte sich die Zahl der Ausreisewilligen aus dem polnisch besetzten Ostpreußen. Es setzte
sich die Überzeugung durch, dass unsere Angestammte Heimat, uns für die Zukunft keine Perspektive mehr bieten konnte.
Meistens wurden die Anträge, die wir an die Passabteilung in Allenstein stellen mussten, um einen Ausreisepass zu
bekommen, negativ beschieden. Nach mehrmaligen Versuchen gelang es dann doch, diese begehrte Ausreiseberechtigung in
Empfang zu nehmen. Die Enttäuschung der Zurückgebliebenen war groß, wenn wieder mal Verwandte oder Nachbarn, den Weg
in Richtung Bahnhof einschlugen.
Um einen Reisepass zu beantragen, musste man zuerst eine Einladung von Verwandten aus der Bundesrepublik vorlegen, in
der, diese sich verpflichten mussten, für Unterkunft und Verpflegung der Eingeladenen zu sorgen. Diese Einladung
musste durch ein Amt in der Bundesrepublik beglaubigt werden. Außerdem mussten die Kosten für die Bahnfahrt, ab
polnischer Grenze, bis zum Zielort, beim polnischen Reisebüro ORBIS, in Warschau, in DM eingezahlt werden.
Unseren ersten Ausreiseantrag haben wir 1964, bei der Kommandantur der polnischen Miliz in Allenstein eingereicht, der
nach einer gewissen Zeitspanne, ohne eine uns verständliche Begründung zu nennen, abgelehnt wurde. Gegen diese
Ablehnung wurde ein Widerspruch zugelassen, den wir sofort einreichten. Nach einer weiteren Zeitspanne erhielten wir
wieder eine Ablehnung, gegen die kein Widerspruch mehr zulässig war. Wer seine Ausreiseabsicht nicht aufgeben wollte,
musste einen neuen Antrag stellen. Es gab Familien die schon 10 Mal einen Ausreiseantrag gestellt hatten und immer
wieder abgewiesen wurden. Da meine Söhne, nicht die Absicht hatten in Rohmanen zu bleiben und ich nach 2 Weltkriegen,
an denen ich teilgenommen, die schwere Arbeit auf der Landwirtschaft, nicht aus eigener Kraft schaffen würde, haben wir
1966 wieder einen Antrag gestellt, der prompt abgelehnt wurde. Der Widerspruch auf diese Ablehnung wurde auch negativ
beantwortet, so dass wir 1968 wieder einen Antrag eingereicht haben.
Weil das Passamt in Allenstein lange nichts von sich hören ließ, hegten wir schon die Hoffnung das es jetzt klappen
würde und waren sehr enttäuscht als wieder eine Absage kam. In der Zwischenzeit sind viele Nachbarn und Bekannte aus
Rohmanen, sowie aus der näheren Umgebung, ausgereist und das Häuflein der noch verbliebenen Deutschen, wurde immer
kleiner. Die Motivation, die uns in früheren Jahren, über so manche schwierige Lage hinweg geholfen hat, ist einer
hoffnungslosen Resignation gewichen. Man war davon überzeugt, dass unser Leben, in unser Angestammten Heimat, keine
Zukunftsperspektive mehr haben konnte und wenn wir keine Ausreisegenehmigung bekommen, wir eines Tages die letzten
Deutschen in der ganzen Umgebung sein werden.
Die Ausreise-Heimat ade
Wir hatten die Hoffnung schon aufgegeben, als am 30. April 1969, der Briefträger unseren Hof
betrat und mir einen Brief überreichte, in dem uns das Passamt in Allenstein mitteilte, dass unsere Ausreise in die
Bundesrepublik Deutschland, genehmigt worden ist. Wir müssten, nach Aushändigung der Reisepapiere, den Geltungsbereich
der Volksrepublik Polen, innerhalb von 3 Monaten verlassen. Wir waren zuerst geschockt, über den Hinweis, das wir
unsere Heimat in 3 Monaten verlassen müssen, aber dann stellte sich die Zukunftsperspektive wieder ein und wir gingen,
wie von einem schweren Ballast befreit und gut gelaunt unser weiteren Tätigkeit nach.
Als der Briefträger unseren Hof betrat, waren ich und mein Sohn Kurt gerade dabei eine Fuhre Mist zu laden. Wir hatten
den Wagen gerade halb geladen und haben nach der frohen Kunde nicht mehr weiter gemacht, sondern die Pferde vorgespannt
und den Mist aufs Feld gefahren, damit wir den Wagen für alle Fälle frei hatten. Das war die letzte Tätigkeit für
unsere Landwirtschaft in Ostpreußen.
Die Nachricht von unserer Ausreise verbreitete sich, ohne dass wir darüber gesprochen haben, wie ein Lauffeuer.
Alsbald kamen Leute aus dem Dorf, die sich für das Vieh und für diverse Landwirtschaftliche Geräte interessierten.
Etliche wollten bestimmte Sachen sofort kaufen, andere haben nur zurücklegen lassen und wollten später kommen und
bezahlen, haben es aber dann doch nicht genommen.

Wenn man eine Landwirtschaft hatte, konnte man 2 Pferde, 2 Rinder, 3 Schweine, 5 Schafe und 10 Hühner, in einem
geschlossenen Viehwaggon, in die Bundesrepublik mitnehmen. Jeden Tag war man unterwegs, von einer Behörde zur Andern.
Die Aushändigung der Reisepapiere erfolgte nur nach Vorlage bestimmter Bescheinigungen: Es mussten alle Steuern bezahlt
sein, das Kontingent landwirtschaftlicher Erzeugnisse musste abgeliefert sein, je eine Bescheinigung vom Katasteramt
und vom Notar musste vorgelegt werden, das man dem polnischen Staat das Grundstück abgetreten hat. Die Gebühren für
die notarielle Beglaubigung mussten wir selbst bezahlen. Wenn man alle Bescheinigungen beisammen hatte, bekam man bei
der Kreisverwaltung eine Gesamtbescheinigung. Mit dieser Bescheinigung konnte man nach Allenstein, zur
Polizeikommandantur fahren, wo man nach dem schriftlichen Verzicht auf die polnische Staatsangehörigkeit, einen
Reisepass ausgehändigt bekam, der den Inhaber zum Grenzübertritt berechtigte, aber nicht zur Wiedereinreise.
Wir haben 2 Pferde, eine Sterke, einen Ochsen, 5 Schafe, 2 Schweine und 10 Hühner mitgenommen. Über die Schutzimpfung
der Rinder musste man eine, vom Kreistierarzt beglaubigte Bescheinigung vorweisen. Ich habe 5 Schafsböcke gekauft, die
ich in der Zwischenzeit, hinter der Scheune, zum Weiden angekettet hatte. Einer von denen hat sich losgerissen und
seinen Nachbarn getötet. Das Fleisch konnten wir noch verkaufen, mussten aber dafür einen anderen Schafsbock kaufen.
Innerhalb von 3 Monaten mussten wir alles regeln und zwei Tage vor der Abfahrt einen Eisenbahnwagen, bei der
Eisenbahndirektion in Allenstein bestellen. Reservierungen bei den polnischen Behörden waren meist immer mit
Schmiergeld verbunden, weil man sonst nie sicher sein konnte dass diese Vereinbarungen auch eingehalten werden. Schon
2 Wochen vor unserer Abfahrt, gab es in Ortelsburg keine alkoholischen Getränke zu kaufen. Meine Söhne mussten mit dem
Motorrad die umliegenden Dörfer abfahren, damit wir für die Reise einen Vorrat anlegen konnten; denn Wodka war zu der
Zeit, in Polen, wie eine zweite Währung.
Am 25. Juli haben wir zusammen, mit meinem Neffen Siegfried Brosch, unseren sonstigen Hausrat, der in Kisten verpackt
war, in einen Eisenbahnwagen, auf dem Allensteiner Bahnhof verladen. Alles musste zuerst durch den Zoll, wo die
Federbetten gewogen wurden und über das erlaubte hinausgehende Kissen, verzollt werden mussten. Dasselbe galt auch für
Fleisch und Räucherwaren.
Am 26. Juli, unserem Verladetag, kam der Eisenbahnwagen aus Allenstein, erst um 11 Uhr auf dem Ortelsburger Bahnhof an.
Die Rinder hatten wir zu Fuß, zum Bahnhof gebracht; Schweine, Schafe und Hühner auf dem Pferdewagen. Im Eisenbahnwagen
mussten, mit Hilfe von Brettern und Bohlen, Boxen für die verschiedenen Tiere erstellt werden. Jedes Pferd und jedes
Rind in eine Bucht. Die Schafe zwischen die Pferde, die Schweine zwischen die Rinder und die Hühner in einem Käfig,
unter der Decke über den Rindern. Die Hühner hatten unterwegs Eier gelegt, somit hatten wir jeden Tag frische
Verpflegung. Bei der Fahrt im Viehwagen, begleitete mich mein Sohn Manfred. Als die Lokomotive nahte, um den Wagen
abzuholen, wurden noch schnell die restlichen Sachen hinein geworfen und so mache Abschiedsträne rollte dann die Wange
hinab.
Unsere Nachbarn, Deutsche und Polen, halfen uns beim Verladen des lebendigen Inventars. Jetzt erinnerte ich mich
plötzlich, an die oft auch schönen, Ereignisse der letzten 22 Jahre. Einer Zeit, in der das Zusammenleben von
Deutschen und Polen, von Jahr zu Jahr, besser wurde. Man half sich beim einbringen der Getreideernte, beim Dreschen
des Getreides, bei der Kartoffelernte und bei anderen Arbeiten, wo viele Menschen zupacken mussten. Es war eine
Dorfgemeinschaft, in schweren Zeiten geboren; jeder half jedem wenn Hilfe nötig war. Es wurde mir plötzlich bewusst,
das jetzt ein Lebensabschnitt zu Ende ging, zu dem ich nicht mehr zurückkehren konnte. Unsere Existenzgrundlage war
jetzt ein Eisenbahnwagen auf einem Schienenstrang, dessen Ende irgendwo in weiter Ferne lag. Obwohl, von langer Hand
vorbereitet, war dieser Moment voller Wehmut.
Doch als der Zug sich plötzlich, in Bewegung setzte, war ich sofort wieder in der Gegenwart. Menschen, mit denen man
Jahrzehnte lang, in gutem Einvernehmen zusammen gelebt hat, blieben plötzlich am Bahnsteig zurück und die Entfernung
zwischen ihnen und mir vergrößerte sich mit jeder Sekunde, bis sie letztendlich aus meinem Blickfeld verschwanden.
Es war ein heißer Julitag, als wir unsere Reise gen Westen antraten. Für die Schweine, die besonders unter der Hitze
zu leiden hatten, haben wir 10 Flaschen Essig mitgenommen und sie von Zeit zu Zeit besprenkelt, damit sie besser atmen
konnten. Für die anderen Tiere war reichlich Heu und Hafer vorhanden. Eine großes Fas und zwei Milchkannen waren mit
Wasser gefüllt, die wir auf den an der Strecke liegenden Bahnstationen, bei Bedarf wieder nachgefüllt haben.
Da der Kreistierarzt nicht in seinem Büro war, konnten wir die Impfbescheinigung für das Vieh, nicht rechtzeitig
herbeischaffen. Der Zug setzte sich in Bewegung und die Bescheinigung war immer noch nicht da. Als die Bescheinigung
dann eingetroffen, wir aber schon unterwegs waren, ist mein Sohn Kurt mit dem Motorrad hinterher gefahren und hat uns
in Passenheim, wo der Zug noch andere Wagen angehängt bekam, die Impfbescheinigung übergeben. Wir waren sehr froh das
er es noch geschafft hat, denn in solch einer Situation fühlt man sich sicherer wenn man alle Bescheinigungen bei sich
hat. Auf der Rückfahrt, mit dem Motorrad hatte er noch eine Panne, musste das Motorrad stehen lassen und per Anhalter
nach Hause fahren. Am nächsten Tag kam er mit Siegfried Deptolla, der das Motorrad wieder flott machte und brachte es
wieder nach Rohmanen zurück.
Die Fahrt mit dem Viehwagen, gen Westen
Von Ortelsburg bis Allenstein(45 km) hat unser Zug 4 Stunden gebraucht, weil auf jedem Bahnhof
gehalten wurde, um neue Wagen anzuhängen. Nachdem wir in Allenstein angekommen waren, kam ein Rangierer und fragte
nach unserem Ziel. Als wir ihm mitteilten, das wir in die Bundesrepublik Deutschland wollen, sagte er nur: „In 10
Minuten fährt ein Zug los. Wenn ich von euch 500 Zloty und einen Liter Wodka bekomme, werde euch sofort anhängen,
andernfalls kommt ihr auf ein Nebengleis und müsst dann auf den nächsten Zug warten. Es blieb uns nichts anderes übrig
als seiner Forderung nachzukommen, denn über derartige Erpressungen hat man bereits von Anderen, die vor uns ausgereist
sind, gehört. Wir wurden auch sofort angehängt und fuhren dann die ganze Nacht, an Osterode, und Thorn vorbei bis
Gnesen. Dort wurde wieder rangiert.
Von einer Anhöhe wurden die einzelnen Wagen auf verschiedene Gleise verteilt und zu neuen Zügen zusammengestellt. Der
Aufprall der ungebremsten Wagen erzeugte eine derartige Erschütterung, dass manche Bretter an den Boxen geborsten waren.
Von Gnesen ging es dann in einem Zuge durch bis zur Grenzstation Reppen(Rzepin). Dort mussten wir zum Zollamt, wo
unsere Ausfuhrpapiere durch die Zollbeamten, und durch einen Tierarzt geprüft wurden. Bis Reppen(Rzepin) haben wir für
den Eisenbahnwagen 900 Zloty bezahlt; hier mussten wir noch einmal 650 Zloty bezahlen. Bei der Wagenkontrolle erklärte
uns ein Bahnbeamter das unser Wagen, sich nicht für den internationalen Transport eignet und wir deshalb den Inhalt in
einen Anderen umladen müssen, der irgendwann, auf dem Nebengleis bereitgestellt wird. Nach langer Verhandlung, sowie
einer Zulage von 500 Zloty und einem Liter Wodka haben wir ihn davon überzeugt, das der Wagen sich doch für die
Weiterfahrt eignet.
In der Nacht war Schichtwechsel, der unseren Wagen wieder abgehängt hat, weil er angeblich von der Reichsbahn der DDR,
wegen technischer Mängel nicht weiterbefördert würde. Wir mussten unsere Verhandlung vom Vorabend wiederholen, die mit
der Zusage endete, dass wir am frühen Morgen, über die Grenze auf DDR Gebiet, gebracht werden. Um 5 Uhr morgens kam
eine Lokomotive, die uns den letzten Abschnitt bis über die Grenze bringen sollte. Als der Zug hat noch einmal anhielt,
kamen polnische Grenzbeamte und Soldaten in den Wagen. Sie durchsuchten ihn und fragten, ob wir noch polnisches Geld
oder einen Grundbuchauszug bei uns hätten. Wir zeigten ihnen 800 Zloty, die sie uns, nach Ausstellung einer Quittung
über 500 Zloty, abnahmen. Die Grundbuchauszüge habe ich, im Stroh versteckt, dem Ochsen vor die Füße gelegt. Falls
jemand da suchen sollte, hätte ich gesagt, das das Tier bösartig veranlagt ist, und ich für seine Sicherheit nicht
garantieren könnte, deshalb sollte er vorsichtig sein.
Als die Grenzkontrolle den Zug verlassen hatte, setzte sich die Lokomotive wieder in Bewegung und überquerte nach
kurzer Zeit die Oderbrücke. Auf einer eingezäunten Fläche, jenseits der Grenze, hat man uns abgestellt hat und die
Lokomotive fuhr zurück auf polnisches Gebiet. Vor und hinter uns waren die Tore verschlossen. Auf den Wachtürmen,
links und Rechts von uns, standen Posten mit einem Gewehr im Anschlag. Vier Grenzbeamte der DDR, jeder mit einer
Leiter in der Hand, sowie ein Schäferhund, kamen zu unserem Wagen. Sie öffneten die Schiebetüre, stellten die Leiter
davor und ließen den Hund in den Wagen springen, der nur etwas herum schnupperte und wieder heraussprang. 2 Beamte
haben dann anschließend, die Papiere kontrolliert und das Inventar gezählt.
Nach einiger Zeit wurden wir an einen Güterzug der Reichsbahn angehängt und fuhren von Frankfurt an der Oder, vorbei
an Berlin, Ellingen und Nordhausen, über die Grenze zur Bundesrepublik bis Herzberg. Hier hat ein Zollbeamter der
Bundesrepublik, die Formalitäten erledigt und ein Tierarzt die Pferde, Rinder und Schweine gründlich untersucht. Ich
musste ihnen die Mäuler aufhalten und die Füße hochheben. Danach hat uns die Lokomotive zu einer Wasserzapfstelle
gebracht, wo wir die Tiere tränken und unsere Behälter mit Wasser auffüllen konnten. Anschließen fuhren wir über
Northeim nach Göttingen, zur Viehverwertungsgenossenschaft, die zuvor von unserer Ankunft in Kenntnis gesetzt wurde.
Der Ochse, die Sterke und die Schweine wurden, in Göttingen zum Schlachthof gebracht; die Pferde kamen nach Hannover
und die Schafsböcke nach Kassel. Wir waren mit dem Viehtransport 5 Tage unterwegs; hatten so manche Klippe umschifft
und Schwierigkeiten gemeistert, die im normalen Leben nicht vorkommen.
Wir wurden mit einem PKW, ins Durchgangslager Friedland bei Göttingen gefahren, wo mein Sohn Kurt, meine Schwester
Frieda Pelkowski und Siegfried Brosch mit Familie, die am 30 Juli, um 14 Uhr, von Warschau mit dem Zug abgefahren, und
hier am 31. Juli in den Morgenstunden eingetroffen sind, schon auf uns gewartet haben. In Friedland hat man uns mit
Familie Siegfried Brosch in einem Raum untergebracht, wir wurden registriert und erhielten 20 DM Überbrückungsgeld,
pro Person. Da wir erst am Freitag in Friedland eingetroffen sind, mussten wir hier über das Wochenende bleiben,
obwohl die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der Regel nur 3 bis 4 Tage beträgt.
Um einen Antrag für die Ausreise stellen zu können, brauchten wir eine Einladung von in der Bundesrepublik lebenden
Verwandten. Diese Einladung hat uns mein Bruder, Ernst Rattay, aus Ingelheim am Rhein zugeschickt. Ingelheim liegt im
Bundesland Rheinland-Pfalz. Das Geld für die Bahnfahrt, hat uns, Frieda Schellin, geb. Nickel, aus Duisburg, die
Tochter unseres Nachbarn, überwiesen. In Friedland wurden wir registriert. Im Registrierschein, war als unser
nächster Aufenthaltsort in der Bundesrepublik, das Durchgangslager Osthofen bei Worms, das alle Aussiedler für
Rheinland-Pfalz aufnehmen musste, eingetragen. Die Eintragung erfolgte deshalb, weil der Ort aus dem uns unsere
Einladung zugeschickt wurde, sich auch in Rheinland-Pfalz befand.
Da ich nach dem Polenfeldzug, als Soldat, ein Jahr im Kreis Opladen, im Rheinland gewesen bin, wäre ich sehr gerne in
diese Gegend gezogen, denn die Erinnerung an die schönen Tage die ich dort verlebt habe war in mir immer noch wach.
Ich versuchte die Eintragung in unseren Regiestierscheinen ändern zu lassen, was nach einigen, vielleicht auch
berechtigten Einwänden, am 4. August, vom Beauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen, genehmigt wurde. Anstelle von
Rheinlad-Pfalz stand da jetzt Nordrhein-Westfalen und am 7. August, fuhren wir, noch mit anderen Aussiedlern, ins
Durchgangslager Unna-Massen, am östlichen Rande des Ruhrgebietes gelegen. Hier wurden wir in einem Zimmer untergebracht
und konnten unser Essen in einer Gemeinschaftsküche zubereiten.
Am 8. August wurden wir in Unna-Massen, als Bürger der Bundesrepublik Deutschland registriert, erhielten
Einhundert DM Begrüßungsgeld, den Vertriebenen Ausweis -A -und 4 Wochen später den Bundespersonalausweis. In
Unna-Massen haben wir mehr als 4 Monate verbracht, weil mein Sohn Kurt, wegen fehlender Berufsausbildung, in Unna, an
einem Grundlehrgang für Metallarbeiter teilgenommen hat, der vom Arbeitsamt finanziert wurde. Am 11 Dezember 1969 sind
wir endlich an unserem vorläufigen Wohnsitz, im Durchgangswohnheim, an der Elisabethstraße 13, in Velbert angekommen.
Ab dem 5. Januar 1970 konnten meine Söhne, in der Zahnradfabrik Reining, in Velbert ihrer geregelten Arbeit nachgehen.
Von Bau- und Sparverein in Velbert wurde uns am 20. Juni 1970, unsere erste Wohnung zugewiesen.
Velbert im Februar 1972
gezeichnet: Gustav Rattay
Den ganzen Winter 1917/18 über plante der Generalquartiermeister Ludendorff die deutsche Offensive. Zwar hatten die
Vereinigten Staaten von Amerika dem Deutschen Reich am 6. April 1917 den Krieg erklärt, aber vor dem Sommer des
Jahres 1918 war mit dem Auftreten von US-Truppen in relevanter Größenordnung nicht zu rechnen. Der deutschen Führung
blieb nur ein schmales Zeitfenster, um die Niederlage und den zu erwartenden Diktatfrieden abzuwenden. Ypern,
Armentieres, Arras, Cambrai oder Verdun wurden ernsthaft als Schauplätze erwogen. Ludendorf entschied sich für einen
Angriff zwischen Cambrai und La Fere – genau an der Nahtstelle zwischen der Französischen Armee und dem britischen
Expeditionscorps.
Der Fluss Somme bildete die Grenze zwischen Franzosen und Briten. Die Briten – nicht die Franzosen – sollten das Ziel
des Vorstoßes werden. Ihre Stellungen waren nur 130 Kilometer von der Kanalküste entfernt. Beim erreichen der
Sommemündung wäre die gesamte britische Armee eingeschlossen gewesen, denn hinter ihnen lag die Straße von Dover.
Am 21. März 1918 begann die letzte entscheidende Offensive des deutschen Westheeres im Ersten Weltkrieg. Der
Angriffsstreifen war 75 Kilometer breit. Dort hatte Ludendorff 43 Angriffsdivisionen konzentriert, dahinter 30
weitere Reservedivisionen, ihnen standen lediglich 26 britische Divisionen gegenüber. „Michael“ – so der Deckname der
„Kaiserschlacht“ – lief dank Ludendorffs akribischer Vorbereitung gut an. Der britische Oberbefehlshaber General
Douglas Haig erkannte die Chance, welche die Deutschen in dieser Situation hatten. Wollten die Deutschen diese Chance
nutzen, mussten sie darauf verzichten die Somme zu überschreiten, wo sie auf die französischen Reserven treffen und
sich von der Küste entfernen würden. Genau diesen Fehler begingen jedoch die Deutschen.
Am dritten Tag überschritt der linke Flügel mit der 18. Armee die Somme. Ludendorf stellte die Taktik über die
Strategie, wie er das bei Tannenberg und der Schlacht an den Masurischen Seen auch schon getan hatte. Ludendorffs
Befehl an die 18. Armee vom Abend des 22. März 1918 lautete: „Jetzt gilt es den Sieg auszunutzen, den Feind nicht zum
Stehen kommen zu lassen, Somme und Crozat-Kanal zu überschreiten, bevor feindliche Verstärkungen wirksam werden“.
Was Haig befürchtet hatte, trat nicht ein. Die deutsche Offensive Lief weiter Richtung Süden und lief sich schließlich
tot. Am 31 März war Ludendorff zu der Erkenntnis gekommen, dass „Michael“ gescheitert war. Am 5. April wurde die
Einstellung der Offensive befohlen. Im Hochsommer waren die US-Truppen in Frankreich angekommen und gingen mit den
Franzosen zum Angriff vor. Nur mühsam konnten Hindenburg und Ludendorf den Zusammenhalt der Front waren. Am 24. Oktober
1918 forderte US-Präsident Woodrow Wilson die bedingungslose Kapitulation, am 11.Nuvember Wurde der Waffenstillstand
von Compiegne unterzeichnet.
Am 21. März 1918 begann die letzte entscheidende Offensive des deutschen Westheeres im Ersten Weltkrieg. Der
Angriffsstreifen war 75 Kilometer breit. Dort hatte Ludendorff 43 Angriffsdivisionen konzentriert, dahinter 30
weitere Reservedivisionen, ihnen standen lediglich 26 britische Divisionen gegenüber. „Michael“ – so der Deckname der
„Kaiserschlacht“ – lief dank Ludendorffs akribischer Vorbereitung gut an. Der britische Oberbefehlshaber General
Douglas Haig erkannte die Chance, welche die Deutschen in dieser Situation hatten. Wollten die Deutschen diese Chance
nutzen, mussten sie darauf verzichten die Somme zu überschreiten, wo sie auf die französischen Reserven treffen und
sich von der Küste entfernen würden. Genau diesen Fehler begingen jedoch die Deutschen.
Am dritten Tag überschritt der linke Flügel mit der 18. Armee die Somme. Ludendorf stellte die Taktik über die
Strategie, wie er das bei Tannenberg und der Schlacht an den Masurischen Seen auch schon getan hatte. Ludendorffs
Befehl an die 18. Armee vom Abend des 22. März 1918 lautete: „Jetzt gilt es den Sieg auszunutzen, den Feind nicht zum
Stehen kommen zu lassen, Somme und Crozat-Kanal zu überschreiten, bevor feindliche Verstärkungen wirksam werden“.
Was Haig befürchtet hatte, trat nicht ein. Die deutsche Offensive Lief weiter Richtung Süden und lief sich schließlich
tot. Am 31 März war Ludendorff zu der Erkenntnis gekommen, dass „Michael“ gescheitert war. Am 5. April wurde die
Einstellung der Offensive befohlen. Im Hochsommer waren die US-Truppen in Frankreich angekommen und gingen mit den
Franzosen zum Angriff vor. Nur mühsam konnten Hindenburg und Ludendorf den Zusammenhalt der Front waren. Am 24. Oktober
1918 forderte US-Präsident Woodrow Wilson die bedingungslose Kapitulation, am 11.Nuvember Wurde der Waffenstillstand
von Compiegne unterzeichnet.
Was Haig befürchtet hatte, trat nicht ein. Die deutsche Offensive Lief weiter Richtung Süden und lief sich schließlich tot. Am 31 März war Ludendorff zu der Erkenntnis gekommen, dass „Michael“ gescheitert war. Am 5. April wurde die Einstellung der Offensive befohlen. Im Hochsommer waren die US-Truppen in Frankreich angekommen und gingen mit den Franzosen zum Angriff vor. Nur mühsam konnten Hindenburg und Ludendorf den Zusammenhalt der Front waren. Am 24. Oktober 1918 forderte US-Präsident Woodrow Wilson die bedingungslose Kapitulation, am 11.Nuvember Wurde der Waffenstillstand von Compiegne unterzeichnet.
Zusammenbruch der Westfront und Waffenstillstand .
Als die Offensive dann letztendlich gescheitert war, wurden wir auf Eisenbahnwaggon verladen, in
eine Stellung vor Verdun gebracht und der siebenten bayerischen Division zugeteilt. Als wir ausgeladen wurden nahm der
Franzose den Bahnhof unter Beschuss. Eine Granate traf einen Waggon der mit Seifenpulver beladen war, so dass der ganze
Bahnhof aussah als wäre gerade Neuschnee gefallen. Wir gingen auf die Suche nach Kartoffeln. Als ich mit einem Sack,
vollbeladen die Böschung runter ging um zur Feldküche zu gelangen, schlug unweit von mir eine Granate ein und riss mir
den Sack vom Rücken. Ich bin mit dem Schrecken davon gekommen, mir war nichts passiert.
Der Bahnhof war menschenleer, nur ein par Kaninchen liefen verschreckt durch die Gegend und einigen Kameraden gelang
es welche einzufangen. Am nächsten Tag gelang es uns endlich die Feldküche zu erreichen. Als wir gerade beim Essen
fassen waren, schlug unweit eine Granate ein so dass Pflastersteine das Dach durchschlugen und wir das Weite suchen
mussten. und wir wieder nichts zu Essen bekamen. Ein Friseur aus unserer Kompanie fuhr immer ins Hinterland um uns
mit Proviant zu versorgen. Als er 14 Tage vor dem Zusammenbruch wieder mal zurückkam erzählte er uns schon das der
Krieg nicht mehr lange dauern würde, weil Kaiser Wilhelm mit Frack und Zylinder bekleidet, Deutschland verlassen und
ins Ausland gehen würde. In unserer Einheit hatten wir auch einen Juden der glaubte dass er sich alles erlauben darf.
Eines Morgens ging er in die Küche, als er keinen Koch vorfand stieg er auf die Gulaschkanone und hob den Deckel vom
Kessel in dem der Kaffee kochte an. Der kochende Kaffee verbrühte seine Füße so sehr das er sofort ins Lazarett musste,
für ihn war der Krieg somit zuende. Es kam noch ein Erlass, das Kameraden die 2 Jahre aktiv gedient hatten und
Gefreiter waren sofort zum Sergeanten befördert wurden. Für den 11. November 1918 war ein Waffenstillstand vereinbart
und ab 11 Uhr sollte nicht mehr geschossen werden. Wir hatten unsere Kopfkissen aufgetrennt und eine Kissenschlacht
veranstaltet, um auf diese Art und Weise unserer Freude Ausdruck zu verleihen. Als die Federn durch die Luft flogen
brachen wir in Tränen aus.
In jeder Kompanie wurde ein Soldatenrat gewählt, der aus drei Mann bestand. Wenn der Kompanieführer jemanden bestrafen
wollte, musste er erst den Soldatenrat fragen, der die Strafe befürworten, aber auch ablehnen konnte. Die Offiziere
durften keine Achselstücke mehr tragen, was für sie einer Degradierung gleich kam. Wir waren in einem Dorf
einquartiert und morgens zum Appell angetreten, als einer vom Soldatenrat sich stockbesoffen vor den auf dem Pferd
sitzenden Kompanieführer stellte und schrie: „Alles hört auf mein Kommando”. Der Kompaniechef war wie vom Blitz
getroffen, ihm versagte die Stimme. Wir sahen ein das dies nicht so weiter gehen kann und wählten einen neuen
Soldatenrat. Unser Rückzug begann bei Konflanz, einer Vorfestung von Metz und führte uns zunächst über die
luxemburgische Grenze, wo wir in einem Ort einquartiert wurden. Als wir für die Küche Holz aus dem Wald holen gingen,
entschieden wir uns eine Eiche abzusägen, ohne uns dessen bewusst zu sein, in welchem Forst wir uns befanden. Als wir
beim fällen waren fielen plötzlich Schüsse, die wir auch sofort erwiderten, bis uns ein Elsässer der sich in unserer
Kompanie befand aufklärte: „Kameraden, wir befinden uns hier auf Luxemburgischem Hoheitsgebiet”.
Wir sind dann weiter durch das Fürstentum Birkenfeld marschiert, wo das Städtchen Merzig für uns geflaggt hatte. Das
Elsass haben wir auch noch kurz gestreift. Wo wir bei einem Bauern, der uns kein Stroh für das Nachtlager geben wollte,
einquartiert wurden. Daraufhin gingen wir in die Scheune und haben uns selbst was besorgt. Wir haben dann noch erfahren,
sie hätten ein Schwein geschlachtet und warteten auf den Einzug der Franzosen. Als wir uns 1917, an der Ostfront, in
den in Karpaten, im Einsatz befanden, waren unter uns auch viele Elsässer. Sie durften ihre Heimatpost nicht in
französischer Sprache schreiben, mussten ihre Briefe offen auf der Schreibstube abgeben, wo sie zuerst kontrolliert
und dann abgeschickt wurden. Als ich in einer Nacht, mit einem Elsässer auf einem Vorposten Wache schieben musste,
wollte er mich überreden zum Russen überzulaufen. Als ich darauf nicht eingehen wollte verschwand er plötzlich in der
Dunkelheit und ich habe ihn nie wieder gesehen.
Wir sind dann weiter Richtung Worms und Ludwighafen gezogen, dort wurden wir bei einem Mühlenbesitzer einquartiert,
ein Unteroffizier und vier Mann. Obwohl wir verlaust und verdreckt waren bestand die Müllerin darauf das wir in ihren
Betten übernachteten. „Wenn alles durch ist”, sagte sie, „werde ich alles gründlich reinigen”. Der Müller brachte uns
eine Gießkanne voll Wein und sagte wir sollen es uns Schmecken lassen. Wir haben reichlich davon Gebrauch gemacht, so
dass ich gar nicht weiß wie ich ins Bett kam. Das war meine Erinnerung an die Pfalz. Manchmal waren wir auch 2 Tage im
Quartier.
Vor dem Weitemarsch wurde uns immer gesagt welche Truppe die Vorhut und welche Truppe die Nachhut übernehmen sollte.
Die Nachhut hielt immer Verbindung zu den nachrückenden Franzosen und man muss staunen wie alles reibungslos, ohne
Zwischenfälle von statten ging, was wir in erster Linie dem General-Feldmarschall Paul von Hindenburg zu verdanken
haben, der den Rückzug an der Westfront koordiniert hat.
In Köln angekommen, erhielten wir im Volkshaus unsere Entlassungspapiere, Eisenbahnfahrscheine, Reisepässe,
unterschrieben von Oberstleutnant Mann. Wir mussten Köln umgehend verlassen, weil schon am nächsten Tag die
französischen Besatzungstruppen in einmarschieren sollten. Wir fuhren mit einem Zug der bis Allenstein fuhr, dort
wurden unsere Papiere vom Soldatenrat kontrolliert. Die jüngren Jahrgänge wurden festgehalten, zu neuen Einheiten
zusammengestellt und zur Sicherung der Ostgrenze gegen die Bolschewisten abkommandiert. Ich hatte gesagt das ich noch
einen Schrapnellsplitter in der Kreuzbeingegend habe und durfte daraufhin nach Hause fahren.
Kaum in Ortelsburg angekommen fiel ich wieder dem Soldatenrat in die Hände. Sie haben alles durchsucht, haben mir mein
Seitengewehr und eine Decke abgenommen, aber ich durfte weiter und bin dann kurz vor Weihnachten 1918 auf dem
elterlichen Hof angekommen. Schon auf dem Hof habe ich meine Kleider vom Leib gerissen, weil vor Läusen und anderem
Ungeziefer nicht mehr aushalten konnte und mich erst gründlich gewaschen bevor ich das elterliche Haus betreten habe.
Die Freude über das Wiedersehen war sehr groß.
“ Unser Leben zwischen den beiden Weltkriegen.”
Endlich wieder zurück in der Heimat
Rohmanen war durch die Kampfhandlungen 1914/15 zu einem drittel zerstört worden, aber schon
wieder im Aufbau. Die Firma Grzella aus Ortelsburg hatte die Bauarbeiten übernommen. Unter der Aufsicht von Polier
Karl Kontor wurden die Dachstühle errichtet. Ich habe mich, nach kurzer Erholungspause, auch als Zimmermanngehilfe am
Wiederaufbau beteiligt. Die Firma Grzella hat das Material geliefert und auch unsere Löhne gezahlt. Wegen meinem
Steckschuss bin ich dem VDK beigetreten und habe mit dessen Hilfe eine Rente beantragt die mir auch bewilligt wurde.
Nach vier Jahren wurde ich nach Allenstein zur Nachuntersuchung vorgeladen. Die ärztliche Untersuchung hatte ergeben,
das Geschoß sei verkapselt, und nur das linke Bein etwas in Mitleidenschaft gezogen. Daraufhin wurde die Rentenzahlung
eingestellt.
Der Stellmacher Adam Ornowski war im Krieg als Sanitäter eingesetzt und hatte auf Grund seiner Erfahrungen,
 Beziehungen zum medizinischen Dienst in Ortelsburg aufgebaut. Es wurden dort Lehrgänge in Erster Hilfe angeboten,
die von Prof. Dr. Kutz geleitet wurden. Adam Ornowski hat dafür gesorgt das einige junge Männer aus Rohmanen daran
teilnehmen konnten. Adam Ornowski, August Linka, Emil Rosowski, Johann Dembek, Emil Baschek und ich sind dann dem
Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes beigetreten und mussten jeden Sonntag am Lehrgang teilnehmen. Unser
Gruppenführer war Kreisobersekretär Albrecht, Landrat von Poser, als unser Ehrenvorsitzender, hat viel zu unserer
finanziellen Unterstützung beigetragen und hat dafür gesorgt dass die Bereitschaft eingekleidet wurde.
Beziehungen zum medizinischen Dienst in Ortelsburg aufgebaut. Es wurden dort Lehrgänge in Erster Hilfe angeboten,
die von Prof. Dr. Kutz geleitet wurden. Adam Ornowski hat dafür gesorgt das einige junge Männer aus Rohmanen daran
teilnehmen konnten. Adam Ornowski, August Linka, Emil Rosowski, Johann Dembek, Emil Baschek und ich sind dann dem
Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes beigetreten und mussten jeden Sonntag am Lehrgang teilnehmen. Unser
Gruppenführer war Kreisobersekretär Albrecht, Landrat von Poser, als unser Ehrenvorsitzender, hat viel zu unserer
finanziellen Unterstützung beigetragen und hat dafür gesorgt dass die Bereitschaft eingekleidet wurde.
In jedem Dorf wurde eine Unfallstelle eingerichtet, mit einem Verbandskasten und mit Verbandsmaterial für die erste
Hilfe ausgerüstet. Die Unfallstelle in Rohmanen, die am Haus von der Straßenseite, durch eine Tafel mit einem roten
Kreuz gekennzeichnet war, hatte ich zu verantworten. An Sonntagen wurden wir an Badestellen und bei Fußballspielen
eingesetzt, haben viele Übungen bei Waldbränden durchgeführt und auch Ausflüge nach Rudzany am Niedersee gemacht. Bei
der Einweihung des Tannenbergdenkmals in der Nähe von Hohenstein kamen wir an Straßenkreuzungen zum Einsatz.
Rohmanen hatte auch eine freiwillige Feuerwehr. Bis zum ersten Weltkrieg hat Friedrich Biella als Brandmeister das
Kommando gehabt. Er war aktiver Unteroffizier, hatte gute Führungsqualitäten und die Männer, die allesamt aus dem
aktiven Militärdienst stammten hatten zu ihm ein großes Vertrauen. Nach dem Krieg wollten diese Männer,
(Friedrich Nickel, Friedrich Willam, Julius Wittkowski, Jakob Janowski, Johann Gloddek, Gustav Bednarz), nicht mehr
weitermachen. Friedrich Biella, der inzwischen zum Gemeindevorsteher gewählt wurde, hat sich dann auf einer
Gemeinderatsitzung vorgeschlagen, für die Freiwillige Feuerwehr jüngere Kräfte anzuwerben.
Zum Brandmeister hat er Herrn Wilhelm Pilath vorgeschlagen. Der wurde dann nach Königsberg zur Fortbildung geschickt.
Der Feuerwehr gehörten nun folgende Personen an: Wilhelm Pilath(Brandmeister), August Linka(Stellvertreter), Gustav
Deptolla, Julius Matzey, Johann Dembek, Willy Willam, Gustav Rattay. Der Kreisbrandmeister war Heinrich Thalmann aus
Ortelsburg, sein Stellvertreter war Kreisobersekretär Salzmann. Der Bezirks-Kommissar bei der Ostpreußischen
Feuersozität War Herr Ernst Trzaska. Er hat dafür gesorgt das die Wehr uniformiert und mit Löschgeräten ausgerüstet
wurde. Da die alten Schläuche schon sehr marode waren, wurden sie durch moderne ersetzt, deren Kupplungen auch mit der
Motorspritze übereinstimmten.
Ernst Trzaska hat bei der Feuersozität und beim Landratsamt Finanzmittel beantragt und auch genehmigt bekommen. Der
Schneidermeister Wilhelm Baran wurde beauftragt Tuch und Drillichanzüge nach Maas zu schneidern. Er hat uns
Stoffmuster vorgelegt aus denen wir wählen sollten. Feuerwehrhelme haben wir auch bekommen. Die Gemeinde musste
Finanzmittel bereitstellen, einen Prozentsatz vom Gemeindebudget. Im Brandfall mussten für den Spritzenwagen Pferde
zur Verfügung stehen, von Willy Willam, Gustav Rattay, Julius Matzey und Gustav Dorka, weil sie in der Nähe des
Spritzenhauses wohnten. Am Spritzenhaus wurde ein großer Baum mit Querleisten aufgestellt, wo nach jedem Brand oder
einer größeren Übung die Schläuche zum trocknen aufgehängt wurden.
Der Kreisbrandmeister hat mindestens 2-3-mal im Jahr die Wehren besichtigt. Das ganze Dorf war dann auf den Beinen,
die Bauern mit Pferden, und andere Dorfbewohner mit Eimern und Spaten, wurden dann in verschiedene Gruppen eingeteilt.
Erst hat die Wehr sämtliche Aufstellungen am Gerät geübt; Grundstellung Fahrstellung und Marschstellung. Dann wurde
ein Brand angekündigt, die Feuerwehr mit der Spritze an den Brunnen, die Gruppen dort wohin sie beordert wurden, die
Bauern brachten mit den Wasserkiwen Wasser aus dem Brunnen zum Brandort. Wenn das Wasser im Brunnen alle wurde hat
man den Saugkorb in die Kiewen gelegt und dort Wasser entnommen. Die Wassergruppe ging mit Eimern zum Dorfteich, holte
Wasser und füllte damit die leeren Kiewen.
Der Löschtrupp ging mit Feuerhaken und Löschpatschen auf die umliegenden Gehöfte und versuchte das vermeintliche Feuer
von ihnen fernzuhalten. Nach dem Alarm wurde wieder am Spritzenhaus angetreten. Die Gruppenführer mussten angeben ob
ihre Gruppe auch vollständig erschienen war, denn Übungen wurden nur vor, oder nach der Feldarbeit durchgeführt, so
dass niemand eine Entschuldigung vorbringen konnte. Wer ohne begründete Entschuldigung nicht anwesend war erhielt eine
Verwarnung. Der Kreisbrandmeister erklärte dann welche Handgriffe den Vorschriften entsprachen und welche nicht. Die
Schläuche wurden noch schnell zum Trocknen aufgehängt. Anschließend gingen wir alle in den Gasthof Trzaska, haben über
vorhandene Mängel diskutiert, Verbesserungsvorschläge unterbreitet und zwischendurch den Durst gelöscht. Der
Kreisbrandmeister ist dann, nach einer kurzen Verabschiedung, ins nächste Dorf gefahren, weil er an einem Tag mehrere
Feuerwehren betreuen musste.
Der Rohmaner Dorffriedhof

Einen Kilometer vom Ende des Dorfes entfernt, auf der rechten Seite der Landstraße in Richtung
Ortelsburg, befand sich der Rohmaner Dorffriedhof. Wann dieser Friedhof angelegt wurde entzieht sich meiner Kenntnis.
Nach Aussagen älterer Dorfbewohner soll davor auch schon eine Ruhestätte vorhanden gewesen sein, und
zwar auf der linken Straßenseite gegenüber dem jetzigen Friedhof. An dieser Stelle befand sich bis in die
Nachkriegszeit ein kleiner Brunnen, aus dem die Dorfbewohner, das Wasser zum begießen der Grabbepflanzung auf den
Gräbern ihrer verstorbenen Angehörigen holten. Der Friedhof war in einer Hanglage angelegt, wahrscheinlich weil diese
Parzelle für eine landwirtschaftliche Nutzung nicht geeignet war. Um das Gräberfeld vor herumstreunenden Tieren oder
von der Weide entlaufenen Kühen zu schützen, hat man das ganze Gelände mit einem Holzzaun umgeben. Der Zugang befand
sich von der Straßenseite. Unter einem Torbogen hindurch wurden die Verstorbenen zu Grabe getragen. Die Gräber der
einzelnen Familien waren nebeneinander angelegt, mache, wie zum Beispiel die der Familie Trzaska, sogar mit einem
schmiedeeisernen Zaun eingefasst.
Nach dem 2. Weltkrieg verfiel der Friedhof immer mehr. Die nötigen Finanzmittel für die Pflege der Einfriedung konnten
von den restlichen noch verbliebenen Deutschen nicht mehr aufgebracht werden. An den gepflegten Gräbern konnte man noch
erkennen dass es Verwandte von noch in Rohmanen wohnenden Deutschen waren, oder von bereits im Westen Deutschlands
lebenden, die ihre noch in Rohmanen wohnenden Nachbarn damit beauftragt hatten. Die übrigen Gräber wurden von Jahr zu
Jahr immer mehr von Wildkräutern überwuchert und schließlich auch von Sträuchern und schnell wachsenden Bäumen.
In den späteren Jahren konnte man nicht mehr erkennen dass dort vor Jahren Tote zur letzten Ruhe gebettet wurden. Die
Natur holte sich das ganze Gelände zurück und nur unter großen Schwierigkeiten konnten Besucher aus dem Westen das
Friedhofsgelände noch betreten.
Das Gasthaus Trzaska

Nach dem ersten Weltkrieg hat der Gastwirt Friedrich Trzaska neben dem Gasthof einen großen Saal
für Festlichkeiten und Vereinsfeiern gebaut, in dem schon mal Feuerwehrfeste veranstaltet wurden. Ernst Trzaska war
Feuerkommissar bei der Ostpreußischen Feuersozität. Erich Trzaska war Vollziehungsbeamter beim Amtsgericht in
Ortelsburg. Unser Feuerkommissar war uns beim organisieren der Veranstaltungen sehr behilflich, hat uns den Saal, die
Musik und die Theaterstücke besorgt und die Feuerwehren aus den Nachbardörfern eingeladen.
Zu Manöverzeiten, vor dem 2. Weltkrieg und dann auch während des Krieges, waren im Gasthof Soldaten, meist im Range
eines Offiziers, einquartiert. Fräulein Mariechen Trzaska hat die Poststelle im Dorf betreut. Nachdem ich 1939 zum
Militär eingezogen wurde, hat sie, nach einer Schulung im Ortelsburger Krankenhaus, auch die Unfallmeldestelle
übernommen. Nach dem Krieg, pflegte sie mit vielen Bekannten, die bereits in der Bundesrepublik wohnten, einen regen
Briefwechsel. Auf dem Rohmaner Friedhof hat sie viele Gräber, im Auftrag von Angehörigen, die auf Grund ihrer
Abwesenheit, dazu nicht mehr in der Lage waren, gepflegt. Der Bauunternehmer Kurnitzki aus Ortelsburg, äußerte die
Bitte, sie möchte ihm doch ein Blatt vom Rosenstrauch, der auf dem Grab seiner Eltern steht, in den Brief legen. Als
sie uns den Brief vorgelesen hat, waren wir zu Tränen Gerührt. Sie hat als Letzte aus ihrer Familie, bis zu ihrem Tod
im Jahre 1960, in Rohmanen, im Gebäude der Gastwirtschaft gewohnt und ist auf dem Rohmaner Friedhof beerdigt worden.
Fleisch und Wurstwaren Karl Pelkowski
Im Jahr 1931 hat der Fleischermeister Karl Pelkowski, aus Grammen, direkt neben unserem Hof ein
Anwesen gekauft und dort eine Fleischerei eingerichtet. Er war mit meiner Schwester Frieda, verheiratet. Am Anfang hat
er die Schweine noch auf seinem Hof geschlachtet, später dann im Ortelsburger Schlachthof. Jede Woche fuhr er 2-mal,
mit dem Pferdewagen(Einspänner), nach Ortelsburg zum Wochenmarkt, wo er seine Fleisch und Wurstwaren zu Verkauf anbot.
Am Tag davor, wenn er die Wurst gekocht hat, kamen viele Rohmaner mit Kannen oder anderen Gefäßen, wegen der guten
Wurstsuppe, die er umsonst unter die Leute verteilte. Als Karl Pelkowski, Ende August 1939 zum Militär eingezogen
wurde, hat seine Frau das Pferd verkauft und den Beitrieb stillgelegt. Am Haus hing, immer noch die Tafel mit der
Aufschrift: Karl Pelkowski, Fleisch und Wurstwaren. Ein Witzbold hat irgendwann darunter geschrieben; „Fleisch und
Wurst waren einmal”, drauf hin hat Frau Pelkowski die Tafel entfernen lassen. Karl Pelkowski ist im Mai 1946 in
französischer Gefangenschaft verstorben. Seine Ehefrau Frieda, verstarb an ihrem 85. Geburtstag in Mettmann bei
Düsseldorf.
Die steinreichen Rohmaner Felder
Die letzte Eiszeit hat bei der Schmelze, auf der Rohmaner Feldgemarkung viele Steine und
Granitblöcke zurück gelassen. Überirdisch, aber besonders unter der Erde, gab es viele kleine, aber auch große Steine,
die, den Bauern, beim Pflügen und anderen Feldarbeiten sehr viel Schweiß, abverlangten. In einer Kiesgrube, auf dem
Feld des Bauern August Radek, lag ein Granitblock, von schätzungsweise 100 cbm. Vor etwa 80 Jahren, als man für diese
Steine noch keine Verwendung hatte, griffen die Bauern zu einer „List”. Weil er sonst nicht pflügen konnte, hat mancher
seinem Nachbarn, die Steine in der Nacht auf dessen Feld abgeladen. Als diese Tätigkeit unter Strafe gestellt wurde,
hat man die Steine in Schluchten gekippt und mit Mutterboden zugeschüttet. In späteren Jahren kam diese jedoch beim
pflügen wieder an die Oberfläche. Dann hat man aber schon Steine für den Straßenbau gebraucht und konnte sie so zu Geld
machen. Besonders im Raum südlich von Ortelsburg, bis zur polnischen Grenze, wo Steine eine Rarität waren, kamen sie
jetzt zum Einsatz. Auch beim Bau von Häusern, besonders für die Fundamente, wurden sie eingesetzt, weil auf diese
Weise viel Ziegeln eingespart wurden. Die Firma Gribienski aus Ortelsburg hat die großen Steine mit Dynamit gesprengt
und auf diese Weise die weitere Verarbeitung erleichtert.
Die Steine welche beim Pflügen aus dem Boden geholt wurden, hat man am Feldrand auf große Haufen zusammen getragen.
Wenn die Feldarbeit beendet war, sowie auch in den Wintermonaten, waren wir jeden Tag mit Steinen unterwegs. Wir sind
vorwiegend am Abend los gefahren, weil unter der schweren Last die Wagenachsen so heiß wurden und die Gefahr bestand,
das durch die Dehnung, die Räder blockiert würden. Bei einer Fahrt konnte man bis zu 24 Reichsmark verdienen, wogegen
1 Zentner Roggen für 8 bis 9 Reichsmark zu haben war. Ich bin selbst, mit dem Pferdewagen bis Fürstenwalde, Radostowen,
Luka, Altkirchen, Höhenwerder, ja sogar bis Friedrichshof gefahren.
In Rohmanen wurden auch rote Ziegeln gebrannt. Viele Häuser wurden, mit Ziegeln erbaut, die nur wenige 100 Meter von
der Baustelle entfernt hergestellt wurden. Der Lehn wurde auf den Feldern in der näheren Umgebung entnommen, dann von
Ochsen solange getreten, bis er so geschmeidig war, das er sich in Formen einstreichen ließ. Wenn die Ziegel in der
Form trocken war, wurde sie entnommen und in einem Brennofen gestapelt. Um einen Ofen richtig anzufeuern, brauchte man
12 Raummeter Holz, das im Zeitraum von ein par Tagen verheizt wurde. Der Fischer Karl Glitza hatte schon eine
Knetmaschine, die von einem Pferd angetrieben wurde, das mit verbundenen Augen, den ganzen Tag in die Runde ging.
Im Dorf waren auch vier Kalköfen, in denen so genannte Kalksteine, die sich an gewissen Stellen, im Erdboden befanden,
gebrannt wurden. Nach dem Brennen wurden die Steine mit Wasser abgelöscht und die daraus entstandne Masse diente, nach
dem Beimischen einer gewissen Menge Sand, dann als Bindemittel beim Häuserbau. Das Gerichtsgebäude und das
Lehrerseminar in Ortelsburg wurden mit Kalk, aus dem Rohmaner Brennöfen erbaut. Auch zum Bau einer Eisenbahnbrücke, auf
der, der Zug, den Sawitzfluß, von Ortelsburg nach Allenstein überquerte, hat mein Großvater, mit einem Ochsengespann,
Kalk gefahren.
Hinter der Scheune, beim Bauern Johann Dembek hat man Tonerde gefördert, aus der man mit Hilfe einer Formerscheibe,
die von einem Arbeiter mit Muskelkraft(Fußbetrieb) angetrieben wurde, schöne Krüge, Schalen und Vasen geformt hat.
Die Töpferware wurde, nachdem sie trocken genug war, auch in einem Ofen gebrannt, anschließend mit einer Lasur
überzogen und wieder gebrannt. Es wurden auch Kacheln zum Bau von Kachelöfen hergestellt, die mit verschiedenen
Ornamenten versehen, die Wohnstuben unserer Vorfahren schmückten. So haben unsere Großväter ihr Leben gemeistert und
nach und nach, unsere Dörfer aus der Rückständigkeit in die Neuzeit geführt.
Das gesellschaftliche Leben nach dem 1. Weltkrieg

Als der Lehrer Alfred Dorka, ein Frontkämpfer des Ersten Weltkrieges und ein Sportsmann, als
zweite Lehrkraft an der Rohmaner Schule angestellt wurde, hat er die Sitten und Gebräuche aus früherer Zeit wieder zum
Leben erweckt. Zuerst hat er die Jugend zusammen gerufen, einen Jugendverein und einen Fußballclub, gegründet. Zum
Vorsitzenden des Fußballclubs wurde Johann Gloddek berufen, der ihn auch geleitet hat. Bauer Wilhelm Spittka, der am
Rohmaner See wohnte, stellte Land für einen Sportplatz unentgeltlich zur Verfügung. Lehrer Alfred Dorka hat am
Rohmaner See eine Badestelle ausgesucht und ein Sprungbrett bauen lassen. An jedem Sonnabend im Sommer, bevor die
Sonne unterging, versammelte sich die gestammte Jugend des Dorfes an der Badestelle am See. Es wurde gebadet,
Heimatlieder gesungen, gespielt, im Fackelschein eines großen Biwakfeuers, bis in die späte Nacht hinein. Der Fischer
Karl Glitza hat uns Kähne zur Verfügung gestellt, mit denen wir auf den See hinausgepaddelt sind, dabei hatten wir viel
Spaß, was wiederum den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft gefördert hat. Ich habe mit meiner Mandoline den Gesang von
Volks- und Heimatliedern begleitet.
Der Rohmaner See liegt in einem Tal, dessen Hänge zu beiden Seiten mit Kiefern und Tannen bewaldet sind. Wenn man
gesungen oder Musiziert hat, hallte es von den Hängen zurück. Die Ufer waren mit Kalmus und Schilf bewachsen, was für
die Fischaufzucht von Vorteil war. Wenn man an einem sonnigen, windstillen Tag, am Seeufer spazieren ging, traf man
oft auf Flachstellen, an denen sich die Fischbrut im Sonnenlicht wärmte, wie ein Mückenschwarm. Im See befanden sich
folgende Fische: Karpfen, Hechte, Schleie, Barsche Plötze, Rotaugen, Aale und Krebse. Am Sonntagmorgen brachten viele
Rohmaner ihre Pferde zum See um sie zu baden.
Es wurden dort, unter der Aufsicht von Lehrer Dorka, auch viele Jugendfeste mit Theatervorführungen veranstaltet, zu
denen er selbst die Vorlagen organisiert hat. Der am See wohnende Bauer Johann Nadrowski, hat uns ein Scheunentor, als
Tanzboden zur Verfügung gestellt. Der Zimmermann Wilhelm Wittek hat uns eine Windmühle gebaut, die am auf dem Boden
liegenden Scheunentor aufgestellt wurde, dazu kamen Noch Tannen und Fichten, die das Ganze wie ein Bühnenbild
erscheinen ließen. Es wunden viele Bühnenstücke aufgeführt, unter anderen >Alte Weiber werden jung gemahlen<. Dazu bot
die Windmühle die entsprechende Kulisse.
Nach der Vorführung wurde der Boden aufgeräumt, um dann als Tanzdiele zur Verfügung zu stehen. Der Gastwirt Trzaska
hatte Tische und Bänke aufgestellt, Speisen und Getränke angeboten, so dass sich die die Veranstaltung bis in die
späte Nacht hinein zog. Es waren auch Leute aus Ortelsburg und anderen Nachbardörfern dabei. Im Winter hat Lehrer
Dorka eine Kreisrodelbahn eingerichtet, die von Zeit zu Zeit mit Wasser besprengt wurde, um die Gleitfähigkeit zu
verbessern. Von einer Anhöhe ging hinunter bis auf den halben See, was für alle ein großes Vergnügen war. Es kamen
Lehrer mit Schulklassen aus der näheren Umgebung um hier zu Rodeln.
Als Herr Lehrer Jobski als Hauptlehrer nach Rohmanen kam hat er mit dem Bürgermeister und der Gemeindeverwaltung
beschlossen, in der Nähe des Dorfes, auf einem zur Schule gehörenden Grundstück, einen Sportplatz anzulegen. Dafür
wurde gleich hinter den Gärten, 6 Morgen Ackerland abgetrennt, und nach Feierabend hat Lehrer Dorka mit den
Jugendlichen eingeebnet und gleich nebenan einen Graben für Schützenstand und Kugelfang ausgehoben. Am Sonntagvormittag
wurde Fußball gespielt und um 15:00 Uhr war Kleinkalieberschießen angesagt. Es musste auch ein kleiner Beitrag erhoben
werden, um Munition kaufen zu können. Eine Büchse konnten wir aus beim Kleinkalieberverein in Ortelsburg ausleihen.
Nach Hitlers Machtergreifung
Als Adolf Hitler an die Macht kam wurde die SA gegründet. Der Bürgermeister Michael Kownatzki
wurde zum Gruppenführer ernannt und folgende Männer haben sich freiwillig gemeldet: Wilhelm Matzey, Johann Gloddek,
Gustav Nadrowski, August Buttler, Karl Baran, Emil Nickel, Wilhelm Jaschinski, Emil Bork, Ernst Rattay und Gustav Bach.
Bei Versammlungen war die SA in Uniform angetreten um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Wer versucht hat Unruhe zu
stiften, egal aus welchem Grunde, wurde aufgefordert den Saal zu verlassen, andernfalls wurde er mit Gewalt entfernt.
Herr Lehrer Jobski wurde zum politischen Leiter ernannt, seine Frau hat die NS-Frauenschaft gegründet, Lehrer Dorka
die HJ, und so bekam die Dorfgemeinschaft, nach und nach ein anderes Gesicht. Der Sportplatz und der Schützenstand
wurden jetzt mehr als früher in den Mittelpunkt gestellt. Nach der Feldarbeit hat der Bürgermeister Fuhrwerke bestellt
und den Sportplatz noch besser herrichten lassen.
Der Bauer Wilhelm Both wurde zum Ortsbauernführer ernannt, mit der Aufgabe alles Land für den Anbau von Getreide und
Futtermittel bereitzustellen, oder wenn das nicht möglich war mit Wald aufzuforsten. Durch den Einsatz von Kunstdüngern
sollten größere Erträge aus dem Boden geholt werden, um den Viehbestand zu vergrößern und mehr Milch und Butter zu
produzieren. Deutschland sollte im Stande sein sich selbst zu selbst zu ernähren, ohne auf Importe angewiesen zu sein.
Frau Jobski hat, innerhalb der der NS-Frauenschaft, mit Hilfe von Fachkräften aus Ortelsburg, Lehrgänge veranstaltet,
auf denen man Backen und Nähen lernte. Auf den Bauernhöfen befand sich auch immer mehr Rassegeflügel, das eine erhöhte
Produktion von Eiern und Geflügelfleisch sicherstellen sollte.
Die Rohmaner Bauern hatten, außer in der Landwirtschaft, noch andere Verdienstmöglichkeiten in der Kreisstadt. In
Ortelsburg wurden vier Sägewerke betrieben, die mit Langholz aus dem Walde versorgt werden mussten. Wir haben eine
Kiefer von über 8 Festmeter angefahren, der wir zuerst 6 Meter Spitze abschneiden mussten, um diese Last überhaupt
auf den Wagen zu bekommen. Sechs Pferde musste angespannt werden um den Wagen zur befestigten Straße zu bringen.
Fichten und Tannen wuchsen bis zu einer Länge von 30 Metern. Auch beim Transport von Ziegel, von der Ziegelei zum
Bahnhof, konnte man gutes Geld verdienen.
Im Jahr 1934 wurde Rohmanen an das überregionale Stromnetz angeschlossen und schaffte auf diese Weise den Sprung von
der Petroleumlampe zur Glühbirne. Neben dem Grundstück von Karl Pietzonka wurde ein Transformatorhäuschen errichtet,
in dem der ankommende Strom von einer Hochspannung auf eine Verbrauchsspannung transformiert wurde. Es gab schon eine
Überlandleitung, die aus Richtung Ortelsburg kommend, quer über die Felder, in Richtung Neu Keykuth weiter ging.
Durch eine Zwischenspanne wurde der Transformator, mit der Hauptleitung auf Kownatzkis Feld verbunden.
Ein Stromanschluss konnte die Arbeit im Haus und Hof auf vielfältige Weise erleichtern, doch nur die besser gestellten
Bauern, sowie noch manche Pensionäre, die ein festes Einkommen hatten, konnten sich dass leisten. Weil nur wenige an
der Elektrifizierung teilnahmen, war ein Stromanschluss mit hohen Kosten verbunden. Nur Gustav Pietzonka, Gasthof
Trzaska, Friedrich Nickel, die Schule und Wilhelm Both, wurden in der ersten Phase erfasst.
Im Jahr 1952 wurde von den polnischen Behörden die zweite Stufe der Elektrifizierung eingeleitet, in der alle im Dorf
stehen Gebäude erfasst wurden. Am Anfang wurden nur Leitungen für Lichtstrom gelegt und auch nur 3 Lichtstellen pro
Haushalt bewilligt. Doch im nachfolgenden Zeitraum wurden dann, wenn Material vorhanden war, weitere Lichtpunkte
angelegt. 1952, am zweiten Wochenende im Advent, wurden dann die Leitungen geschaltet und alle waren von der
plötzlichen Helligkeit sehr begeistert. Wenn man Glühbirnen auswechseln wollte musste man am Anfang weite Wege
zurücklegen, um welche zu bekommen. In den 60ger Jahren wurden dann immer mehr Starkstromleitungen gelegt, weil die
Bauern elektrische Geräte kaufen konnten. Ende der 60ger wurden auch die Abbauten an das Stromnetz angeschlossen.
Das Urnengrab auf unserem Feld
Auf unserem Feld, in Richtung Seelonken, bin ich oft beim pflügen gegen Steine gestoßen, manchmal
rissen sogar die Stränge am Pferdegeschirr. Eines Tages nahm ich einen Spaten, Brechstange und einen langen Baum, um
der Sache auf den Grund zu gehen. Als ich eine Menge Sand ausgehoben hatte stieß ich auf eine steile, aus Steinen
errichtete Wand, die ich auch mit dem Baum nicht aus der Fassung bringen konnte. Ich habe den ganzen Vormittag gegraben,
konnte jedoch nicht unter die Steine kommen. Einige Tage später hatten wir in der Schule eine Bauernversammlung, da
habe ich Herrn Biella und Herrn Lehrer Dorka von meinem Fund berichtet. Am nächsten Morgen kam der Lehrer Dorka mit der
ganzen Schulklasse, mit Spaten und Sieben ausgerüstet auf unser Feld und fingen an die ausgehobene Erde zu sieben.
Lehrer Dorka benachrichtigte daraufhin den Leiter des Ortelsburger Heimatmuseums, der am nächsten Morgen vorbei kam um
sich die Fundstelle genau anzusehen. Er beauftragte ihn 4 Mann zu besorgen, um die Steine ringsum frei zu schaufeln.
Zwischen den Steinen durften wir die Erde nur mit Esslöffeln ausheben. Als es plötzlich zu regnen anfing hat Lehrer
Dorka die Brauerei Daum, in Ortelsburg angerufen, die uns über der Fundstelle ein Zelt errichtet haben, damit wir
ungestört weiterarbeiten konnten. Wir fanden 8 flache und 8 hohe Urnen zu beiden Seiten am Körper. Die Urnen wurden in
Gipsbinden eingewickelt und ins Heimatmuseum nach Ortelsburg gebracht, wo sie durch einen Fachmann, der extra aus einem
Königsberger Museum angereist war. Nach Reinigung der Urnen hat er festgestellt, das die Grabstätte etwa 2000 Jahre vor
Christi Geburt angelegt wurde und ein Doppelgrab war, in dem ein Toter liegend und einer in Hochstellung beigesetzt
wurde.
Die Nachricht von der Fundstelle verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Es erschienen viele Schaulustige, ganze
Schulklassen aus der Umgebung, mit Autos und zu Fuß. Durch die vielen Menschen wurden die bestellten Ackerflächen auf
unserem Feld sehr in Mitleidenschaft gezogen, eine Entschädigung haben wir nicht erhalten. Das Grab wurde vor dem
Heimatmuseum in Ortelsburg wieder so aufgebaut wie man es auf unserem Feld vorgefunden hat. Für den Transport der
Steine wurde ich entlohnt. Die Urnen hat das Königsberger Museum an sich genommen und wollte sie nicht wieder hergeben,
weil die solch einen Fund noch nicht in ihrer Sammlung hatten.
Sonnenwendfeuer
Am 24 Juni fand eine Sonnenwendfeier statt. Ein Brauch der an die alten Germanen erinnern sollte.
Der Lehrer Dorka hat den Bürgermeister beauftragt 2 Fuhrwerke in den Wald zu schicken, die Holz und alten Reisig holen
und auf dem großen Schulberg abladen sollten. Das Straßenbauamt hat uns Teertonnen zur Verfügung gestellt. Die ganze
Dorfgemeinschaft wurde eingeladen, am Abend, nach der Feldarbeit, an der Sonnenwendfeier teilzunehmen. Lehrer Dorka
hielt zuerst eine Ansprache, in der er anschaulich erklärte wie unsere Vorfahren in grauer Vorzeit gefeiert haben.
Nach dem offiziellen Teil wurden das Holz und die Teertonnen angezündet, es wurden Heimatlieder gesungen, wie: Wild
flutet der See, drauf schaukelt der Schiffer den schwankenden Kahn, Schaum wälzt er wie Schnee, von grausiger Mitte
zum Ufer heran, wild fluten die Wellen auf Vaterlands See, wie schön, oh trag mich auf Spiegel zu Hügel, Masovias See.
Masovia Land, mein Heimatland, Masovia es lebe mein Vaterland.
Lehrer Alfred Dorka und sein Wirken für Rohmanen.

Friedrich Biella hatte auf seinem Feld einen Granitstein mit einer geraden Seite, den haben wir
mit viel Schweiß an den Dorfteich transportiert und auf einer Erhöhung abgelegt. Der Stein sollte zum Denkmahl für die
Gefallenen des Ersten Weltkrieges umgestaltet werden. Da zu Wenige daran ein Interesse zeigten, wurde diese Idee fallen
gelassen und der Stein irgendwann ins Wasser gerollt. Der Lehrer Dorka war viele Jahre in Rohmanen tätig, dort hat er
später seine ehemalige Schülerin, Lotte Biella geheiratet. Er hat sich sehr für die Entwicklung des Dorfes interessiert,
war bei jeder Gemeindeversammlung anwesend und hat auf Schwachstellen hingewiesen die den Fortschritt behinderten.
Gemeinsam mit den Schülern hat er den Ehrenfriedhof für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges gepflegt, an der
Wegegablung nach Eichtal und zu Ehren des Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg eine Eiche gepflanzt.
Zum Advent hat Lehrer Dorka mit der Jugend einen Adventstern, in verschiedenen Farben gebastelt.
Der Stern wurde auf einer 2 Meter langen Stange befestigt, in der Mitte wurde ein Wachslicht angezündet, am Stern
wurde eine Schnur angebracht, wenn man daran zog rollte der Stern hin und her. Am ersten Wochenende im Advent
versammelten sich jung und alt, um den Stern durch das Dorf zu tragen. Alle schlossen sich dem vorausgehenden
Sternträger an, der den Stern durch die Hauptstraße und die angrenzenden Wege trug. Dieser Sternmarsch wurde an den
folgenden Adventwochenenden wiederholt.
Am ersten Weihnachtfeiertag wurde um 4:00 Uhr morgens ein Frühgottesdienst gehalten. Zuerst hat der Pfarrer eine
Andacht gehalten, dann haben die Kinder ein Krippenspiel aufgeführt und die Gemeinde hat schöne Weihnachtslieder
gesungen. Der Gastwirt Trzaska hat uns den Saal zur Verfügung gestellt. Wir hatten eine Posaunen- u. eine
Gitarrengruppe. Unter der Leitung von Herrn Willi Doormann spielten: Gottlieb Brosch, Fritz Ollech,
Gustav Rattay(Sopran), Wilhelm Pilath, Gustav Brosch(Alt), Fritz Both(Tenor) und Fritz Brosch(Bass).
In der Gitarrengruppe wirkten mit: Martha Ollech, Hedwig Ollech, Martha Lekzik, Martha Michalick und Auguste Lekzick.
Willy Doormann hat sie auf der Geige begleitet.
Kurz vor Ausbruch des 2. Weltkrieges
Bei der Aufstellung des Grenzschutzes(Regiment Buchholz), hat er als Hauptfeldwebel die
Gruppenführerkurse überwacht und selbst die fähigsten Männer dafür vorgeschlagen. Das Ausbildungspersonal hat das
Jäger-Battalion gestellt. Wir kamen zuerst ins Stadion(Waldheim), wurden da eingekleidet und dann ging es gleich
kasernenmäßig zu, theoretisch und praktisch. Jeder musste vor die Front treten und nachweisen ob er im Stande ist,
Befehle zu erteilen. Abends wurden Filme vorgeführt die uns zeigen sollten wie eine Gruppe sich im Gelände entfalten
muss. Die Exerziervorschriften hatten sich, im Verhältnis zu Kaiser Wilhelms Zeiten, etwas geändert. Damals bestand
eine Gruppe aus 8 Mann und einem Unteroffizier, jetzt aus 10 Schützen, 3 für das leichte Maschinengewehr und einem
Unteroffizier(13 Mann). Nach der Schulung folgte eine Abschlussprüfung, danach ein gemütliches Beisammensein. Aus
Rohmanen haben folgende Männer die Prüfung bestanden: Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy, Gustav Rattay und
Gustav Deptolla. Unsere Uniformen waren alle zu klein und es gab viel zu lachen bei der Anprobe.
Die erste Übung habe ich mit Emil Rosowski, in Lenzinen gemacht. Der Gutsbesitzer Marzinzick hat seine Scheune als
Unterkunft zur Verfügung gestellt. Er war im Range eines Hauptfeldwebels. In seinem haus war die Schreibstube
untergebracht, die er selbst verwaltete. Ein Lastauto hatte Uniformen aus der Kaserne in Ortelsburg geholt, jeder
musste eine Uniform anlegen und dann wurde solange getauscht bis alle eine passende gefunden hatten. An den Namen des
Kompanieführers kann ich mich nicht mehr erinnern. 1935 wurden wir zu einer Übung in die Dragonerkaserne nach Lyk
einberufen. Die Gruppenführer, Zugführer, und Kompanieführer die schon Frontberührung im dem Ersten Weltkrieg hatten,
mussten eine Woche früher anreisen. Die Übungen waren auf 6 Wochen angelegt. Die meisten der einberufenen waren noch
nie mit dem Wehrdienst in Berührung gekommen. Jeder Gruppenführer bekam 13 Mann zugeteilt.
Unser Zugführer war Leutnant Neumann, Kompanieführer Oberleutnant Rutschko, Battalions-Kommandeur Major Gröning
(Regiment Buchholz). Hier ging es wieder Kasernenmäßig voran. Das Bataillon wurde hier vereidigt. Jeden zweiten
Sonntag durften unsere Frauen uns besuchen. Ein Jahr später wurden wir wieder zu einer Übung einberufen, auf den
Truppenübungsplatz nach Arys. Jeder Gruppenführer hatte den Auftrag die Gruppe zu entfalten, und auf bewegliche
Figuren zu schießen. Diese Übung musste später mit scharfer Munition wiederholt werden. Jedes Maschinengewehr bekam
50 Schuss, jeder Schütze 20 Schuss zugeteilt. Nach dem Abschießen wurden die Treffer gezählt und dem Kommandierenden
Bericht erstattet. In einiger Entfernung spaziert ein Storch umher, der gar nicht bemerkt hatte dass geschossen wurde,
was bei den Kameraden ein großes Gelächter hervorrief.
Nach der Übung wurde uns gesagt das jeder Gruppenführer eine arische Abstammung nachweisen sollte. Ich konnte in den
Rheinsweiner Kirchenbüchern meine Vorfahren aus Gellen, bis zum Jahr 1732 zurück, nachweisen und wurde zum
Unteroffizier befördert. Aus unserem Dorf wurden auch, Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy und Gustav Deptolla
befördert. Zwischendurch mussten wir schon mal in die Radfahrer-Kaserne nach Ortelsburg, Gewehre empfangen und im
Gelände üben. Am 31 Juli 1939 wurde mir von einem Soldaten ein Schreiben übereicht, das mich aufforderte, am 1. August
um 6:00 Uhr, bei der 3. Kompanie, des 2. Infanterieregiments zu erscheinen.
Um 5:30 hat mich meine Schwester in die Kaserne gebracht. Auf der Schreibstube erklärte mir der Hauptfeldwebel,
dass mir ab sofort der Dienstgrad eines Sanitäters zugewiesen wird, ich mich in der Kammer einzukleiden hätte und mir
in der Handwerkerstube die entsprechenden Schulterklappen annähen lassen sollte. Die aktiven Sanitäter wurden den
Feldlazaretten zugewiesen und wir kamen an ihre Stelle. Unser Bataillon wurde nach Schodmak zum Bunker bauen und
Stacheldraht verlegen eingeteilt. Wir zogen in Begleitung einer Musikkapelle bis zur Kreuzung am Krankenhaus, dann
weiter zu unserem Bestimmungsort, gefolgt von einer Gulaschkanone die in den nächsten Tagen für unsere Verpflegung
sorgen sollte.
Am 14 August haben wir die Jägerkaserne, begleitet von einer Musikkapelle endgültig verlassen und zogen zuerst durch
Ortelsburg, dann über Lehmanen ins Feldmanöver, hinter Rohmanen. Dort entfaltete sich das Bataillon im Gelände, die
Verwundetensammelstelle wurde auf dem Hof des Bauern Friedrich Neumann eingerichtet. Gegen Abend wurde zu Sammeln
geblasen und Biwak bezogen, wobei unsere 3.Kompanie, in einem kleinen Wallt, in der Nähe von Otto Nickels Gehöft
Stellung bezogen hatte. Die 2. und 4. Kompanie hatte sich in der Nähe vom Abbau Pallasch niedergelassen. Die Frau
Nickel hat am Abend ein Mädel in Dorf geschickt um meiner Frau Bescheid zu sagen, wo wir uns zurzeit befinden. Meine
Frau ist dann noch gekommen um sich von mir zu verabschieden, weil wir am nächsten Morgen um 3:00 Uhr Zelte abbrechen
und um 4:00 Uhr in Richtung Kaspersguth marschieren sollten.
Wir sind dann über Achodden, Seelonken, Lehmanen, Ortelsburg, bis nach Grammen und Schützendorf marschiert, wo wir an
einem See Biwak bezogen haben. Es wurde immer gesagt, wir kommen zum Tannenberg-Denkmal bei Hohenstein, wo ein Reichs
Kriegervereinsfest stattfinden sollte. Es wurden auch schon Vorkommandos aufgestellt, doch dann kamen wir nach Orlau
und Lahna-Mühle, da wo die Alle entspringt haben wir 2 Tage biwakiert. Unser Kompanieführer hat uns nach Waplitz auf
den Soldatenfriedhof des Ersten Weltkrieges geführt und uns erklärt wie das Jägerbataillon sich 1914 hier entfaltet
hat und aufgerieben wurde. Dann mussten wir in der Nähe von Gut Koslau über einen Fluss und bezogen in einem Waldstück,
vorbereitete Stellungen in der Nähe der polnischen Grenze. Herr und Frau Thalmann haben uns jeden Tag, bis zur Grenze,
mit Brötchen und Getränken versorgt. Es wurde scharfe Munition ausgegeben, weil wir am nächsten Morgen um 4:00 Uhr die
polnische Grenze überschreiten sollten.
Am nächsten Morgen um 10 Minuten vor 4:00 Uhr kam der Befehl; scharfe Munition abgeben, alles zurück in ein 6 Kilometer
entferntes Dorf, wo wir auch einquartiert wurden. Das alles geschah’ eine Woche vor dem 1. September 1939. Es wurde
gesagt dass der Führer dem polnischen Präsidenten Rid-Szmigly, ein Ultimatum gestellt hat und es wahrscheinlich nicht
zum Krieg mit Polen kommt. Genau nach 5 Tagen kehrten wir wieder in die gleichen Stellungen zurück, es wurde wieder
scharfe Munition ausgegeben und am nächsten Morgen um 4:00 Uhr überschritten wir die polnische Grenze.
“Der 2. Weltkrieg.”
Der erste Einsatz in Polen
Wir kamen zuerst in ein Dorf in dem sich nur alte Menschen befanden. Auf unsere Frage wo denn die Bewohner wären sagte
man uns dass alle geflohen sind, weil erzählt wurde, die Deutschen würden alle Polen misshandeln und verstümmeln. Ich
habe ihnen daraufhin gesagt dass uns, unter Androhung von Strafe verboten wurde, einem Zivilisten etwas anzutun. Das
Vieh, die Schweine und Hunde des Dorfes liefen frei herum und die Soldaten fingen an auf die Hunde zu schießen, bis
gesagt wurde es seien Meldehunde im Dienste der Deutschen Wehrmacht und dieser Unfug der eigenen Truppe schaden würde,
weil etwaige Querschläger eigene Kameraden verletzen könnten. Wir gingen weiter auf polnischer Seite entlang der Grenze,
bis wir am Nachmittag die ersten Vorposten der Festung Mlawa erreichten, da befanden wir uns plötzlich im Feuerhagel
polnischer Festungsflack.
Am nächsten Morgen hatte ich schon 3 Verwundete und wusste nicht wo sich eine Verwundeten Sammelstelle befindet. Ich
suchte den Bataillonsgefechtstand auf der sich auf einer Anhöhe befand. Ich habe unseren Oberstabsarzt gefragt wo denn
die Verwundetensammelstelle wäre. Er rief beim Tross an, wo er die Auskunft erhielt, das sich vor dem Dorf ein Bunker
befindet in dem man die Verwundeten sammeln sollte, die dann von Sanitätsautos abgeholt würden, weil das Dorf unter
Artilleriebeschuss stand. Am Sonnabend haben unsere Flieger die Bunkerstellungen bombardiert, konnten aber, trotz guter
Treffer nicht viel ausrichten, die Bunker wurden nur etwas angekratzt.
Der Beschuss unserer vordersten Linien ging mit unverminderter Heftigkeit weiter. Am Sonntag verkündete eine große
Staubwolke die Ankunft unserer Panzer, doch sie kamen nur bis zur Panzersperre und mussten wieder abdrehen ohne den
Polen einen schaden zuzufügen. Ein Panzer bekam einen Volltreffer, der Fahrer konnte noch umkehren. Er blutete am Kopf
und der Schütze war so eingeklemmt, das wir ihn nur mit einem Seil unter den Armen, durch die Luke nach oben ziehen
konnten. Ob er seine Verwundung überlebt hat ist mir nicht bekannt, denn in der Nacht wurden Panzergeschütze nach
vorne in Stellung gebracht, die direkt in die Schießscharten der Bunker geschossen und so die Verteidiger vertrieben
haben. Daraufhin sind wir weiter vorgerückt. Auf einer Wiese war ein tiefer Graben ausgehoben und mit Ästen getarnt,
da war ein Panzer hinein gefahren, so dass nur das Hinterteil herausragte und er sich nicht aus eigner Kraft befreien
konnte. In der Luft waren Flieger die Brandbomben abwarfen, ich habe mich auf den Boden geworfen weil ich dachte die
würden explodieren, aber sie zischten nur, so das Stoppeln und Graß rings herum in Brand gerieten.
Bei den Kampfhandlungen gab es mehrere Verwundete, denen ich gerade Verbände anlegen wollte, als unser Hauptmann zur
Trillerpfeife griff um mir klar zu machen, dass ich ihm folgen sollte. Die Polen fingen an zu schreien, ich sollte
sie ins Lazarett bringen denn hier im Wald würde sie niemand finden. Ich setzte mich aufs Fahrrad und folgte unserem
Kompanieführer, der mir sagte ich soll immer bei der kämpfenden Truppe bleiben, denn hinter der Front sind die
Sanitätsabteilungen, die werden die Verwundeten schon versorgen. Der Vormarsch dauerte bis in die späte Nacht. Auf
einem Gehöft, das nach allen Seiten durch Feldwachen abgesichert wurde, machten wir endlich Rast. Wir haben
Getreidegarben auf dem Hof ausgebreitet und uns zur Ruhe gelegt, als plötzlich um Mitternacht Leuchtraketen den Himmel
erhellten und Maschinengewehrfeuer uns aus dem Schlaf schreckte. Ein par polnische Soldaten hatten das Feuer eröffnet,
aber sich kurz darauf ergeben.
Die Narew-Überquerung
Als es hell wurde ging der Vormarsch weiter. Es wurde uns untersagt Tagebuch zu führen, darum
weiß ich nicht wie die Orte hießen, durch die wir marschiert sind. Als wir durch ein sumpfiges Gelände vor drangen
stand auf einer Anhöhe am Horizont, die polnische Artillerie, die uns sofort unter Beschuss nahm. Unser Hauptmann war
der Meinung dass wir schon in der Nähe des Flusses Narew sein müssten, als aus den Sträuchern ein mit Schlauchboten
beladenes Lastauto auftauchte. Wir wurden aufgefordert mit je 6 Mann ein Schlauchboot zu nehmen, an einem Aggregat
der daneben stand mit Luft zu füllen und zu Wasser zu lassen. In einer Stunde war das ganze Bataillon über die Narew,
wo der Vormarsch fortgesetzt wurde. In einem Dorf überraschte uns die polnische Kavallerie und fing sofort mit
Maschinengewehren zu schießen an. Da kam der Befehl: Alles wieder zurück. Es ging noch schneller als auf der Hinfahrt.
Wir sind erst einige Kilometer am Fluss entlang gegangen und haben dann zum zweiten Mal rüber gesetzt.
Die Gehöfte im Dorf standen alle in Brand. Auf einem waren viele Bienestöcke. 2 Kameraden wollten den Stöcken Waben
entnehmen, doch die Bienen durch das Feuer aufgeschreckt, überfielen sie sofort und stachen derart zu das sie nicht
mehr wieder zu erkennen waren. Ich habe die Einstichstellen mit Salmiak betupft, mehr konnte ich nicht tun. Wir mussten
auf unserem Vormarsch durch einen Wald der in Flammen stand, so dass man kaum atmen konnte. Es ging weiter in Richtung
Minsk und Warschau, wo schon die Sowjetische Armee durchgegangen war, die Pferde und Vieh von einem Gut mitgenommen
hatten. In einem Wald stießen wir unverhofft auf ein Kloster, in dem wir einige Gefangene machten. Dann trafen wir auf
eine gute Straße die nach Grochow ging.
Als wir dort einmarschierten wurden wir aus den oberen Stockwerken beschossen, so dass wir, um uns zu schützen, nur an
den Hauswänden entlang gehen konnten. Wir haben jedes Haus nach Feinden durchsucht. Vor einem Haus stand ein Hund der
niemanden reinlassen wollte, solange bis ihn eine Kugel traf. Die polnische Artillerie feuerte von Warschau aus, um
unseren Vormarsch zu stoppen. Wir hatten uns gerade eingegraben als plötzlich deutsche Flieger am Himmel erschienen,
die unsere Stellungen mit Bomben bewarfen und dabei viel Unheil anrichteten. Wir haben sofort Fliegertücher
ausgebreitet und Leuchtraketen abgeschossen. Da ich in dem Graben, den ich kurz zuvor ausgehoben hatte, sofort in
Deckung gegangen bin ist mir zum Glück nichts passiert. Unter den anderen Kameraden gab es viele Verwundete, so dass
ich nicht wusste wem ich zuerst helfen sollte.
Der Oberstabsarzt hat mich sofort tatkräftig unterstützt, so das bald alle Verwundeten versorgt waren, außer einem,
dem ein Bombensplitter den Arm abgerissen hat. Ich habe im 3 große Verbandspäckchen auf die Wunde gelegt, doch die
Blutung ließ sich trotzdem nicht stoppen, so dass er eine Stunde später auf der Krankensammelstelle verstarb. Wir
haben danach in einem Tomatenfeld einen Graben ausgehoben und eine neue Abwehrstellung bezogen. Die Gruppe Schwarz
bekam den Auftrag nach etwaigen versprengten polnischen Verbänden Ausschau zu halten, als sie unerwartet aus einer
Häuserreihe mit Maschinengewehrsalven überschüttet wurden. Der Gruppenführer und noch ein Soldat wurden dabei tödlich
verwundet. Danach wurde noch ein weiter Stoßtrupp, unter der Führung von Leutnant Briskorn, der sich dazu freiwillig
gemeldet hatte, hinaus geschickt um den Gruppenführer und den anderen Toten zu bergen.
Bei diesem Unternehmen, das erfolglos ausging, weil die Toten schon verscharrt waren, durchschlug eine Kugel den
Stahlhelm von Leutnant Briskorn, der auch sofort tot war. Alle Toten wurden später, an der Kirchenmauer in Grochow, in
Särgen beigesetzt: Hauptmann Schönwald sagte, das sie nach dem Kriege auf den Heldenfriedhof nach Ortelsburg überführt
werden. Drei Tage lagen wir bei Grochow in Stellungen, waren dem polnischen Maschinengewehrfeuer sowie den Bomben
deutscher Flugzeuge ausgesetzt. In der Nacht musste ich zu einem Verwundeten in die vorderste Linie und habe den
Rückweg nicht mehr finden können, als plötzlich Gewehrfeuer aufflammte habe ich in den Ruinen Schutz gesucht. Erst im
Morgengrauen konnte ich mich wieder orientieren und zu meinem Unterstand zurückfinden.
Warschau wurde tagelang bombardiert und stand auch unter Artilleriebeschuss. Aus dunklen Rauchwolken kamen oft ganze
Bündel von Papier angeflogen. Die Verwundeten kamen oft auf Krücken zu unserem Unterstand, ich habe sie dann zur
Krankensammelstelle hingeführt. Wir haben auch polnische Zivilpersonen betreut, die während der Kampfhandlungen
verwundet wurden. Als einmal 2 Jungen vorbeiliefen hat einer ihnen nachgerufen sie sollten seiner Frau Bescheid sagen,
er wäre auf der Krankensammelstelle an der Kirche. Als wir dort ankamen war seine Frau, mit einem Kind auf dem Arm,
schon da.
Nach der Kapitulation von Warschau, gingen wir über Sokolow zum Bug und haben dort Quartier bezogen. Der Russe hatte
sich bereits hinter den Fluss zurückgezogen, hatte alles Vieh und Pferde mitgenommen. Dort erreichte mich ein Telegramm
von zu Hause, dass meine Tochter gestorben ist. Es sprach sich auch herum dass verschiedene Heimaturlaub bekommen haben,
ich durfte auch für 14 Tage heim. Wir fuhren mit Lastautos nach Allenstein in die neue Reiterkaserne, zum
Ersatzbatallion, da haben wir unsere Gewehre und Munition abgeben, dann durften wir, jeder in seinen Heimatort
weiterfahren.
Als wir unsere Quartiere am Bug verlassen haben war sehr viel Schnee gefallen. Hier in Ortelsburg fanden wir die
gleiche Wetterlage vor, aber nach 3 Tagen war alles wieder weggetaut und wir konnten die Kartoffelernte, die durch den
frühen Wintereinbruch gestoppt wurde, zu Ende bringen. Ein Tag bevor ich zu Hause angekommen bin wurde die Tochter
beerdigt. Nach 14 Tagen mussten wir uns in Allenstein melden, Gewehre empfangen und wieder zurück zur Division an den
Bug 150 Kilometer hinter Warschau. Die elfte Division, zu der wir auch gehörten sollte in den Westen Deutschlands
verlegt werden und war schon unterwegs zur Verladestation Skiernewice 50 Kilometer vor Warschau.
Mein Dienst als Sanitätsunteroffizier
Unser Bataillon kam in das Städtchen Burscheid, im Kreis Opladen, wo wir in Privatquartieren
untergebracht wurden. Nach 3 Monaten, im Januar 1940, wurden wir nach Solingen verlegt, wo wir bis zum
Frankreichfeldzug stationiert waren. Wir mussten an Feldübungen teilnehmen, wie andere die in Kasernen untergebracht
waren. Während dieser Zeit musste jeder seine Zähne in Ordnung bringen lassen. Jeden Tag fuhren 20 Mann in die
Cäzilienstraße nach Köln, zur Zahnklinik. Im Rheinland wurde unsere Division neu aufgestellt. Ausfälle durch den
Polenfeldzug wurden durch neue Soldaten ergänzt. Ich kam nun zum Ersatzbatallion, war der Älteste in der ganzen
Kompanie. Als der Frankreichfeldzug losging wurde unser Ersatzbatallion mit den noch vorhandenen Verwundeten, in die
neue Reiterkaserne, nach Allenstein verlegt.
Meine Frau hat, mit Unterstützung der Bauernschaft, einen Antrag gestellt, daraufhin wurde ich zur Frühjahrsbestellung,
beurlaubt und später bis auf weiteres vom Militärdienst freigestellt. Als der Russlandfeldzug losging wurde ich von der
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg, für 14 Tage einberufen. Ich war seit 1922, Mitglied der freiwilligen
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg und habe jedes Jahr an Übungen teilgenommen. Jede Bereitschaft musste etliche Leute
stellen. Von Rohmanen wurden Emil Rosowski, Johann Dembek, und ich, zur Krankensammelstelle Wirballen, in Litauen,
abkommandiert. Dorthin kamen Lazarettzüge aus Russland mit der Breitspurbahn. Die Verwundeten wurden frisch verbunden
und auf Waggon mit Normalspur verladen und nach Deutschland gebracht.
Als die 14 Tage vergangen waren wollten wir wieder nach Haus zurück, doch man wollte uns nicht entlassen. Stattdessen
wurden wir dem Wehrkreisamt Königsberg zugeteilt, neu eingekleidet und zur Aushilfe ins Lazarett nach Gumbinnen
abkommandiert. Mehr als ein Jahr war ich in den Urlauber-Baracken, habe dort Krankenstube betreut. Später, bis zum
Dezember 1944, war ich im Reserve-Lazarett 4, in Königsberg tätig. Dort habe ich auch die Luftangriffe der Engländer,
vom 25 bis 26. August 1944 miterlebt.
Wir sollten gerade einen Lazarettzug in Rotenstein entladen, als plötzlich die Sirenen ertönten - Fliegeralarm. Im
gleichen Moment waren die ersten Flugzeuge auch schon da, zuerst warfen sie „Tannenbäume” und danach Foßforkanister ab.
Die Omnibusse standen schon zur Abfahrt bereit als es losging. Wir haben die Verwundeten schnell in den
Luftschutzkeller getragen, haben die Betten von den Fenstern weggerückt damit die Verwundeten nicht von den
Glasssplittern verletzt wurden. Im Kasernenhof brannten die Fosforkanister lichterloh. Unsere Unterkunft, die sich in
einer Baracke befand ist völlig abgebrannt, mit dem Wenigen was wir unser Eigen nannten. Am nächsten Tag wurden wir neu
eingekleidet und am 29. bis 30. kamen die englischen Bomber wieder, sie setzten genau da ihr Zerstörungswerk fort wo
sie vor 3 Tagen aufgehört hatten.
Anfang Dezember 1944 musste ich mich nach Stablack melden und musste dann zur Sanitätsabteilung 1, nach Gernau, das
liegt zwischen Lodz und Warschau. Vormittags hatten wir Felddienstübungen und nachmittags theoretischen Unterricht.
Jeden Tag wurden Gruppen zusammengestellt und zu anderen Einheiten abkommandiert. Ich kam zu einer Panzerabteilung, wo
wir an einem Morgen plötzlich auf dem Kasernenhof antreten mussten und zu unserer Überraschung mit der Nachricht
konfrontiert wurden, dass der Russe an mehreren Frontabschnitten durchgebrochen war. Wir bekamen sofort einen
Marschbefehl in Richtung Lodz, wo das Stadtbild noch intakt war, selbst die Straßenbahnen fuhren noch. In der Nacht
haben russische Flugzeuge die Stadt bombardiert. Die Kaserne in der wir untergebracht waren hatte keine
Luftschutzkeller, aber zum Glück blieben wir von Bombentreffern verschont. Am nächsten morgen bot sich uns ein Bild der
Verwüstung. Die entgleisten Straßenbahnwagen, sowie andere Fahrzeuge blockierten die Straßen. Die Älteren unter uns
bekamen Fahrscheine für einen Transportzug, der bereit hinter Lodz abfahrbereit, unter Dampf stehen sollte. Als
russische Panzer in den Straßen auftauchten, verbrannte die Schreibstube unsere Wehrpässe und andere wichtige
Dokumente. Wir liefen zu der Station auf der unser Transportzug bereitstehen sollte, aber da war kein Zug mehr zu sehen
und wir setzten unseren Rückzug zu Fuß fort.
Der Rückzug und Zusammenbruch der Ostfront
In Dobroschin, einer Stadt in Polen, wurde gerade ein Lazarettzug verladen, doch wir kamen nicht
mehr zum Einsatz, weil die russische Infanterie uns schon auf den Fersen war. Es ging weiter über den Fluss Bober,
Sagan, bis nach Glogau an der Oder. Dort wurden wir der 29. motorisierten Sanitätskompanie zugeteilt. Im
Garnisonslazarett wurden noch Operationen durchgeführt. Unsere Division hatte ihr eigenes Feldlazarett, so dass wir den
Befehl zu Weiterfahrt erhielten und noch unbeschadet die Oderbrücke passieren konnten, denn Glogau wurde zur Festung
erklärt. Wir haben 2 Pferdewagen organisiert und mit Verbänden, sowie medizinischen Instrumenten beladen. So kamen wir
bis nach Lübbenau im Spreewald, wo wir in einem Schloss, in zuvor ein Museum war, unser Lazarett untergebracht haben.
Weil die Amerikaner Cottbus bombardiert hatten, wurden die Verwundeten zu uns nach Lübbenau gebracht. Hier haben wir
Tag und Nacht gearbeitet, um die vielen Verwundeten, aus den schweren Kämpfen bei Grünberg und Sagan zu versorgen. Die
Soldaten von der Abwehrfront kamen schon mit abgestorbenen Armen oder Beinen bei uns an, weil in vorderster Linie keine
Frontlazarette mehr vorhanden waren; es mussten viele Amputationen durchgeführt werden. Als für unsere Pferde kein Heu
mehr vorhanden war, schickte mich unser Hauptfeldwebel, zu einem Bauern in den Spreewald, mit dem Auftrag, Futter zu
besorgen. Mit noch zwei Mann fuhren mit zwei Kähnen, zuerst den Hauptstrom entlang und dann in einen Nebenarm; da haben
wir die Boote beladen und brachten das Heu nach Lübbenau.
Als wir uns bei unser Einheit zurück melden wollten, war alles schon marschbereit. Ich bin schnell in einen Bus
eingestiegen der sofort losfuhr, weil russische Verbände schon in sichtweite waren. Russische Flugzeuge kreisten über
den Dächern und nahmen, mit ihren Bordwaffen jeden unter Beschuss, der sich irgendwo blicken ließ. Wir konnten nur
durch den Wald, oder in der Nacht vorwärts kommen, denn wenn ein Auto auf der Landstraße fuhr, war alsbald ein Flugzeug
hinter ihm her und schoss es in Brand. Als wir nach Tagen am Ufer der Elbe ankamen, war bereits eine Ponton-Brücke
erstellt worden, welche die zerstörte Brücke ersetzen sollte.
Durch die vielen Fahrzeuge waren in den Sand tiefe Spuren gefahren, so dass andere Fahrzeuge unsere Busse ins
Schlepptau nehmen mussten, weil wir mit eigener Kraft nicht mehr weiterkamen. Beiderseits der Trasse standen
Flüchtlingswagen, in der der Hoffnung die Brücke passieren zu können, doch SS-Polizei verhinderte das die Gespanne den
militärischen Rückzug zum Stillstand brachten. Es gelang uns die Elbe zu überqueren, um in einem Waldstück Schutz vor
feindlichen Fliegern zu suchen.
Als wir unsere Busse und Autos gut getarnt hatten, hat unser Bataillonschef die anwesenden Parteigrößen zu sich
gerufen und ihnen erklärt das wir eine Einheit des Roten Kreuzes sind und nach internationalem Recht keine Waffen
besitzen dürfen. Nach langer, erregter Diskussion wurde beschlossen einen Graben auszuheben und alles im Sand zu
verscharren. Als wir dann weiter, durch die Dörfer fuhren, sahen wir schon viele weiße Bettlaken, als Zeichen der
Kapitulation, aus den Fenstern hängen. Es wurde uns erzählt dass der Bürgermeister von der SS erschossen wurde, weil
er die Bevölkerung zu diesem Schritt ermutigt hatte. Jetzt waren hinter uns die Russen und vor uns schon die Amerikaner.
Amerikanische Panzer fuhren umher und schossen wild durch die Gegend, ohne ein Ziel anzuvisieren. Niemand wollte sich
dem Russen ergeben, doch der Weg der zu den Amerikanern führte, war durch abgesägte Bäume blockiert. Wir sind schnell
in das nächste Dorf gegangen, haben uns Sägen und Äxte besorgt, die Bäume durchgesägt und in den Straßengraben
geworfen.
“ Nach dem Ende des 2. Weltkrieges.”
In amerikanische Kriegsgefangenschaft
Dann fuhren wir unter internationaler Flagge an eine Mulde Brücke, vor der zwei amerikanische Soldaten, mit Zigarren,
zur Hälfte im Mund, standen. Sie rauchten und kauten gleichzeitig. Wir mussten auf einen freien Platz fahren, alle
aussteigen und rechts wieder antreten. Wäschebeutel und Tornister mussten wir abstellen; danach wurden wir nach Waffen
durchsucht, Wertsachen, Uhren und Messer wurden uns gleich abgenommen. Als wir anschließend an unserem Gepäck
vorbeigingen durfte niemand was mitnehmen. Als ich gebückt, nach meinem Wäschebeutel greifen wollte, in dem sich noch
3 Konservendosen und ein Brot befanden, bekam ich einen Fußtritt ins Gesicht, so dass mir ein Zahn ausgeschlagen wurde.
Wir wurden dann in einem Garten zusammen getrieben und gefragt ob jemand bei der SS gedient hat. Nachdem wir in Reihe
und Glied angetreten waren, mussten wir den Oberkörper freimachen und die Arme anheben. Es wurde nach SS-Zeichen
gesucht, die gewöhnlich unter dem Oberarm eintätowiert waren. Nachdem wir Grimma bei Leipzig, wo wir in amerikanische
Gefangenschaft geraten waren, verlassen hatten, mussten wir durch ganz Thüringen bis Hersfeld, an der Grenze zu Hessen,
marschieren. In Hersfeld wurden wir auf große Lastautos verladen, die von farbigen Soldaten gefahren wurden. Man hat
uns mit Stöcken hinauf getrieben, solange bis das Auto so voll war das man kaum stehen konnte. Die Soldaten fuhren, für
diese Straßenverhältnisse, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Wenn die Straße eine scharfe Kurve hatte, flogen
wir alle übereinander und mussten erst mit viel Kraftanstrengung auf die Beine kommen um diese Fahrt zu überstehen.
Da die Straßenränder in dieser Gegend mit Obstbäumen bepflanzt sind und deren Äste sehr niedrig hängen, hätten die
uns die Köpfe abgerissen, wenn wir uns nicht ständig geduckt hätten. Unsere Fahrt endete in Bad Kreuznach, in der Pfalz,
wo wir in ein Lager, in dem sich später 130.000 Mann und 6 Generäle befanden, eingepfercht wurden. Die Unterkunft der
Generäle befand sich unter einem Zelt, alle anderen mussten die Zeit unter freiem Himmel zubringen. Die Offiziere, die
Unteroffiziere, die Mannschaften; wurden in getrennten Camps untergebracht. Die Mannschaften wurden auch zur Arbeit
abkommandiert und konnten bei dieser Gelegenheit, Brot, Brötchen oder Zigarettenstummel organisieren, wogegen die
Offiziere und Unteroffiziere ihr Camp überhaupt nicht verlassen durften.
Die ersten Tage gab es kein Wasser und kein Brot, so dass die Kameraden vor Erschöpfung umfielen. Später standen wir
manchmal den ganzen Tag nach Wasser an, das von den, uns bewachenden Negern mit großen Wassertanks angefahren wurde. Am
dritten Tag bekamen wir mittags und abends etwas zu Essen; Brot bekamen wir erst nach zwei Wochen, nach dem aus der
Umgebung herbeigeholte Handwerker, Backöfen gebaut hatten. In den verschiedenen Gemeinden, die in den uns umgebenden
Weinbergen lagen, mussten sich alle Männer beim Bürgermeister melden. Als sie dann erschienen waren, wurden sie auf
bereitstehende Lastautos getrieben und zu uns ins Lager gebracht. Sie waren ohne Kopfbedeckung und ohne wärmere
Bekleidung angekommen, weil ihnen gesagt wurde, dass ihr Aufenthalt im Lager nur von kurzer Dauer sein würde. Man hat
uns, falls noch vorhanden, Decken und Mäntel abgenommen, mit der Begründung, sie würden für Kranke und Verwundete
gebraucht. Jeden Tag starben mehr als 200 Mann, die wir sofort in ein Zelt tragen mussten. In der Nacht wurden die
Toten dann mit unbekanntem Ziel, weggefahren.
Viele haben ihren Verstand verloren uns irrten im ganzen Camp ziellos umher. Als Latrinen wurden Gräben ausgehoben, in
die verschiedene Kameraden, bei der Verrichtung ihrer Notdurft, vor Schwäche hineingefallen sind und nicht mehr wieder
heraus kamen. Aus den Pfählen die, die jungen Obstbäume stützten, haben wir Krankentragen gebaut um unsere Kameraden,
bei Bedarf, zur Krankensammelstelle zu tragen. Es war in diesem Frühjahr auch sehr kalt, doch unsere Erdlöcher, die wir
zum Schutz vor Kälte und Wind, nur mit leeren Konservendosen ausgehoben hatten, durften nicht tiefer als 20 Zentimeter
sein. Nach jedem Regenguss mussten wir das Wasser ausschöpfen. Nach einem Gewitter, standen wir wiedermal, total
durchnässt in unserem Camp, als unerwartet am Horizont die Sonne hervortrat. Einer unserer Kameraden hatte noch eine
Trompete gerettet und fing, von dem Anblick völlig überwältigt, zu spielen an: "Es geht alles vorüber, es geht alles
vorbei, nach jedem Dezember, folgt wieder ein Mai". Daraufhin hob sich die Stimmung der tiefbetrübten Kriegsgefangenen,
so das Heimatlieder durch das ganze Camp erklangen, obwohl wir in den nassen Kleider herumgehen mussten, bis sie am
Körper trocken wurden.
In französischer Kriegsgefangenschaft
Nach etwa einem Monat, haben uns die Amerikaner, den Franzosen, zum Arbeitseinsatz, ausgeliefert.
Etwa 4 Kilometer von Bad Kreuznach entfernt, stand auf freier Strecke, ein Zug mit offenen Kohlenloren, auf den wir
verladen wurden. In jeden Waggon, wurde pro Person eine Tafel Schokolade und ein Päcken Zwieback rein geworfen, doch
viele Kameraden fanden nur leere Päckchen vor, weil die schon zuvor von der französischen Wachmannschaft geplündert
wurden. Wir haben uns darüber beschwert, doch die haben uns nur ausgelacht. Nachdem wir zunächst bei Mainz über den
Rhein fuhren, endete unsere Fahrt bei Paris in einem großen Zeltlager. Dort wurden wir auf andere Züge verladen, die uns
nach Südfrankreich, in ein Barackenlager, bei Mazarei, brachten.
Auf einer Zwischenstation hat man uns unter einer Pumpe, die Lokomotiven mit Wasser versorgt, abgestellt, den Kran
aufgedreht und uns anschließend ausgelacht, die Kinder Haben uns mit Steinen beworfen. Ein Wachmann kam in unseren
Waggon gekommen, hat unser Gepäck durchsucht, wenn er Tabak oder Zigaretten gefunden hat, nahm er sie mit. Die Kameraden
waren darüber so empört, dass sie vorhatten, ihn nachts unter den Waggon zu werfen. Wir haben sie gebeten dass zu
unterlassen, weil man uns in diesem Falle, alle erschießen würde.
Als wir ins Lager kamen wurden wir zuerst gezählt, dann mussten wir unser Gepäck stehen lassen und beiseite treten.
Wenn man bei der Nachkontrolle noch was in den Taschen fand, wurde das auch entwendet, selbst Esslöffel. Wir wurden
dann in drei Baracken, ohne Toiletten, eingeschlossen. Die Kameraden haben ihre Bedürfnisse in Kochgeschirre erledigt
und durch ein kleines Fenster, das sich fast unter der Decke befand, hinausgeworfen. Andere Fenster ließen sich nicht
öffnen, weil sie mit Stacheldraht zu geflochten waren. Als die Kameraden die Kochgeschirre auskippten, haben die
Wachposten geschossen und die Fenster zertrümmert. Sie waren der Meinung dass wir ausbrechen wollten. Es herrschte eine
große Hitze, in den überfüllten Baracken sind wir fast erstickt. Am nächsten Tag haben wir uns über fehlende Toilettem
beschwert, da haben sie Heringsfässer durch die Hälfte geschnitten und an der Ausgangstür hingestellt. Um bei den
überfüllten Räumen dort hinzukommen, musste man über die Köpfe der Anderen steigen. Viele hatten Fieber und Durchfall
und mussten in die Krankenstube eingeliefert werden, wo sie kurz darauf verstarben.
Besonders Raucher litten sehr an der Unterernährung, bekamen Wasser in den Beinen und waren die Ersten die verstarben.
Nach der Registrierung wurden wir auf andere Baracken verteilt. Die Zivilbevölkerung kam in die Räume und begann uns
auszuplündern. Wer noch gute Schuhe besaß musste sie ausziehen und bekam dafür die kaputten des Plünderers. Eine Woche
lang mussten wir diesen Zustand ertragen, erst als die Kameraden sich beschwerten, wurde am Eingang eine Tafel am
Eingang angebracht, dass die Zivilbevölkerung das Lager nicht betreten darf. Bis auf einige, wenige Ausnahmen wurde
diese Anweisung befolgt.
Als wir im Lager ankamen, war der französische Lagerkommandant, ein ehemaliger Kriegsgefangener, der bei einem Bauern
in Deutschland gearbeitet hatte. Dieser Bauer war jetzt als Kriegsgefangener in seinem Lager. Als er ihn erkannte, hat
er ihn gleich zum Küchendienst eingeteilt und mit dem nächsten Krankentransport nach Hause fahren lassen. Zu Mittag
bekamen wir nur gekochte Haferkörner, da schwamm alles oben, später war man dann auf Gerste umgestiegen. Als viele
daran gestorben waren, weil sie diese „Rohkost”, die nur ein Kuhmagen verträgt, nicht gegessen haben, hat man die
Körner durch eine Schrotmühle laufen lassen. Dann hat man uns Steckrüben gekocht; wir bekamen 250 Gramm Weißbrot,
etwas Quark und ein viertel Liter Magermilch. Später, als wir schon arbeiten mussten, hat man in unserem Essen einen
Kuhkopf mitgekocht, das hat dann bedeutend besser geschmeckt.
Bevor wir morgens zur Arbeit gingen, mussten wir zu Flaggenparade und abends, nach der Rückkehr, haben wir die Flagge
wieder eingeholt. Wir haben einen Kanal gereinigt, dessen Sohle 2 Meter dick mit Schlamm bedeckt war. Zuerst wurde das
Wasser abgelassen, dann haben wir, einer dem andern, den Schlamm mit der Schippe hoch gereicht. Der Letzte hat den
Schlamm, der so zäh war, dass er nicht von der Schippe wollte, oben am Rande abgelegt. Manchmal waren 10 Mann nötig um
den Höhenunterschied zu überwinden. Das Wachpersonal schoss über unsere Köpfe hinweg und rief: „schnell arbeiten”. Bei
der großen Hitze war das ein Ding der Unmöglichkeit, zumal es nichts zu Trinken gab. Auf dem Heimweg haben wir im Walde
Heilkräuter gesammelt, die man in der Küche getrocknet und als Tee zubereitet hat, den wir am nächsten tag zur Arbeit
mitnahmen, um unseren Durst zu stillen.
Unser Aufseher hatte einen Stock, an dem sich noch kurz abgeschnittene Äste befanden. Wer seiner Meinung nach, nicht
ordentlich gearbeitet hat, bekam gleich Schläge auf den Rücken. Die weißen Aufseher wurden irgendwann durch Neger
ersetzt, die uns bedeutend besser behandelt haben. Wenn irgendetwas schief ging, haben sie nichts gesagt, nur gelacht.
In den übrig gebliebenen Wassertümpeln hatten sich noch einige Aale versteckt, die wir zu fangen versuchten, was uns
auch manchmal gelang. Wir mussten ihnen das Genick brechen, damit sie uns nicht entwischen konnten. Wenn die Franzosen
bemerkten das wir Aale hatten, wurden sie uns abgenommen. Gelang es uns aber, sie ins Lager zu bringen, dann haben wir
uns eine köstliche Malzeit zubereitet.
Um sicherzustellen dass niemand geflüchtet ist, wurden wir, wenn wir abends ins Lager zurückkamen, zuerst gezählt.
Diese Zählung wurde mehrmals wiederholt, weil die Wachmannschaften sich immer wieder verzählt haben. Als einer von uns
hin ging, ihnen sagte dass alle da sind, wollten sie es nicht glauben und haben uns vor dem stehen lassen, bis es ihnen
irgendwann einfiel. uns doch das Tor zuöffnen. Einmal, als wir von der Arbeit zurückgekehrt waren, standen wir bis 23
Uhr neben der Flagge, weil uns niemand das Tor geöffnet hat. Als wir dann doch irgendwie ins Lager kamen haben wir
festgestellt, dass das ganze Wachpersonal betrunken war und niemand im Stande uns das Tor zu öffnen.
Eines Tages waren wir wieder abends zur Parole angetreten, als ein älterer Herr mit seinem Hund, am Stacheldraht
entlang, spazieren ging. Weil der Hund, unterm Stacheldraht hindurch, zu uns kam, hat ihn einer geschnappt, ihm das
Genick gebrochen und unter seiner Jacke versteckt. Der Franzose hat nach seinem Hund gerufen und gepfiffen, aber alles
vergebens, der Hund war nicht aufzufinden. Die Kameraden haben ihm gleich das Fell über die Ohren gezogen, das Fleisch
gekocht und das Fell in die Latrine geworfen. Das Fleisch wurde umgehend verspeist.
Als wir am nächsten Tag von der Arbeit zurückkehrten, war im Lager der Teufel los. Wir mussten sofort antreten und
wurden gefragt, wo der Hund geblieben ist, der Gestern Abend, mit seinem Herrchen, am Zaun entlang spazieren ging. Als
sich niemand dazu bekannte, mussten wir weiterhin stehen bleiben, während die Wachmannschaften von Baracke zu Baracke
gingen und alles durchsuchten. In einer Latrine hat man dann das Fell gefunden, was uns ein furchtbares „Donnerwetter”
einbrachte und in den nächsten Tagen, nach der Arbeit, unter dem Kommando eines Oberfeldwebels, eine Stunde
nachexerzieren.
In Südfrankreich regnet es den ganzen Sommer nicht; die Bauern haben da keine Scheunen und das Getreide wir nur in
Schobern aufgestellt und dann umgehend gedroschen. Vom Oktober bis Dezember regnete es fasst jeden Tag in Strömen.
Gesät wird nur im Frühjahr und im Herbst, weil im Sommer alles vertrocknet. Es wird viel Wein angebaut und die
Steckrübe wächst den ganzen Winter. Neben den Weinreben wurde aus Schieferplatten ein Zaun aufgestellt, um dem Wein
einen optimalen Standort zu sichern. Die Bauernwagen hatten nur zwei Räder und waren nur mit einem Pferd bespannt, das
die ganze Balance des Wagens zu halten hatte. Trotzdem haben sie soviel aufgeladen wie wir auf einen Leiterwagen. Viele
Kameraden wurden den Bauern zur Arbeit ausgeliehen. Wenn ein Bauer einen Arbeiter gebraucht hat und es wurde gefragt,
wer sich in der Landwirtschaft auskennt, da haben sich alle gemeldet. Der Bauer konnte sich dann aussuchen, wen er
mitnehmen wollte.
Wenn wir durch die Stadt zur Arbeit gingen, haben verschiedene Leute Fallobst in die Abfalleimer gelegt. Wenn das von
den Kameraden bemerkt wurde, schwenkten viele aus der Reihe, um sich etwas mit zunehmen, was von den Wachmannschaften
nicht gern gesehen wurde. Viele Kriegsgefangene hatten keine Schuhe mehr, sie haben die Füße nur mit Lumpen bewickelt.
Eines Tages kamen Kameraden aus Norwegen, die nach Deutschland entlassen werden sollten. Mann hat sie jedoch ins Lager
gesteckt und zur Arbeit eingeteilt. In Norwegen hatten sie Kleider und Stoffe eingekauft, hatten volle Seesäcke und
sogar Karren auf 2 Rädern, weil sie ja in die Heimat entlassen werden sollten. Als wir morgens zur Arbeit rausgeführt
wurden standen sie schon vor dem Lager. Wir haben ihnen zugerufen, dass sie uns etwas abgeben sollen, weil ihnen ja
sowieso alles abgenommen wird, aber sie haben uns nur ausgelacht. Als sie ins Lager Kamen mussten sie ihr Gepäck
ablegen, wurden dann wo anders hingeführt und haben es danach nie wieder gesehen.
Durch die vielen Läuse, Flöhe und Wanzen die wie im Lager hatten, kam es bei verschieden Kameraden, an den
Einstichstellen, zu eiternden Entzündungen. Um dem vorzubeugen hat man uns mit einem Pulver, das in Frankreich
hergestellt wurde, aber bei den Parasiten keine Wirkung zeigte, eingesprüht. Erst bei der Anwendung eines Mittels
amerikanischer Herkunft, war alles über Nacht verschwunden.
Der Sonntag war arbeitsfrei. Dann kam ein katholischer, französischer Pfarrer, eskortiert von 3 Mann, mit
aufgepflanztem Seitengewehr ins Lager und hat Gottesdienst gehalten. Einen evangelischen Pfarrer gab es nicht, nur
einen Baptisten Prediger. Der wurde würdevoll eingekleidet, bekam ein großes Kreuz und hat jeden Sonntag in einer
extra dafür hergerichteten Baracke Gottesdienst gehalten. Wer Theologie studiert hatte und sich meldete, wurde zu
einem Seminar geschickt und konnte sein Studium fortsetzen. Glasbläser durften das Lager auch verlassen und ihrem
erlernten Beruf wieder arbeiten.
Wer sich freiwillig, für 5 Jahre, zum Dienst in der Fremdenlegion verpflichtet hat, das waren etliche unter uns, wurde
neu eingekleidet, bekam gutes Essen und Rauchwaren soviel er wollte. Nach einem Jahr wurden, nach und nach, die
Kranken und Körperbehinderten in die Sowjetische Besatzungszone entlassen. Eine Entlassung von Kriegsgefangenen, die
in den Westzonen oder jenseits von Oder und Neise zu Hause waren, war nicht vorgesehen. Die Österreicher wurden alle,
unabhängig von ihrem Gesundheitszustand entlassen.
Ich habe Briefe nach Hause geschrieben, aber die kamen nur bis Allenstein und wurden wieder zurück geschickt. Als eine
Kommission des Roten Kreuzes aus der Schweiz unser Lager besichtigt hat, haben wir uns beschwert, das wir als
Sanitätsdienstgrade, zur Arbeit gehen müssen. Daraufhin erging ein Befehl: Wer einen vom Roten Kreuz, ausgestellten
Ausweis besitzt, gehört einem internationalen Verband an und braucht nicht zu Arbeit gehen. Aus unserem Lager hatten
sich 20 Mann gemeldet, die daraufhin Freigang, in Begleitung von zwei französischen Wachsoldaten erhielten. Als wir
gefragt wurden wo wir hin wollen, entschlossen wir uns, einen Soldatenfriedhof, auf dem unsere verstorbenen Kameraden
beerdigt waren, zu besuchen.
Da der Untergrund in dieser Gegend aus Felsen bestand, wurden die Gräben, in denen die Toten in selbst gezimmerten
Kisten nebeneinander gestellt wurden, mit Hilfe von Dynamit ausgehoben. Ein Leichenwagen, mit einem Pferd bespannt,
das mit einer schwarzen Decke abgedeckt war, wurde von einem Kutscher in angemessener Kleidung, gefahren. Der Wagen
konnte gleichzeitig 4 Kisten transportieren. Wenn wir von der Arbeit kommend, dem Leichenwagen begegneten, wurde
gehalten und mit einer Schweigeminute der Toten gedacht, bis der Wagen vorbei war. Die Zivilbevölkerung verharrte auch
im Schweigen, mit abgenommener Kopfbedeckung.
Ein Kamerad, der in Krottorf, Kreis Oschersleben, bei Magdeburg, zuhause war, sagte bei seiner Entlassung zu mir:
Sollte ich das Glück haben, meine Entlassungspapiere zu erhalten ohne eine Bleibe vorzuweisen, dann soll ich Krottorf
als Heimatadresse angeben. Auf der Krankenstube habe ich angegeben, dass sich noch ein Schrapnellsplitter, aus dem
Ersten Weltkrieg, in meiner Kreuzbeingegend befindet, er zwar verkapselt ist, aber immer noch Beschwerden verursacht.
Daraufhin wurde ich zur Entlassung vornotiert. Als bekannt wurde das ein Rückkehrertransport in die sowjetische
Besatzungszone zusammengestellt wird, habe ich mich sofort gemeldet und wurde für ein Entlassungslager in Angoleme
vorgesehen. War das eine Freude, als uns mitgeteilt wurde, wann der Rücktransport stattfindet.
In unserem Lager waren noch 2 Kameraden aus dem Kreis Ortelsburg: Ein Gustav Lumma aus Leynau und ein Alfred Moritz
aus Groß Schöndamerau. Sie mussten noch zurückbleiben und haben mir den Auftrag erteil, die Angehörigen in der Heimat
zu grüßen und ihnen die Anschrift mitzuteilen. Als wir im Entlassungslager ankamen, fragte man uns nach unserer
Heimatanschrift. Dann wurden die Entlassungspapiere angefertigt. Es wurde uns auch ein Barscheck, für die in Frankreich
geleistete Arbeit ausgehändigt, den wir bei jeder Kasse in Deutschland einlösen könnten. Ich habe ihn bis zum heutigen
Tage nicht einlösen können, obwohl ich irgendwann in der Zeitung gelesen habe, das Verrechnungschecks die den aus
französischer Kriegsgefangenschaft Entlassenen, ausgehändigt wurden, einzulösen sind.
Wir kamen zuerst nach Saar Elbe, dann in die Nähe der Zonengrenze zu Thüringen. Hier mussten wir 2 Tage warten, weil
aus der sowjetischen Besatzungszone keine Eisenbahnwagen bereitgestellt wurden. Angesichts dessen, das der Russe beim
letzten Transport die aus Frankreich kommenden Wagen kassiert und nicht mehr herausgeben wollte, bestand der Franzose
jetzt darauf, seine Wagen sofort wieder mitzunehmen. Als der sehnsüchtig erwartete Zug endlich eintraf, durften wir
umsteigen und kamen, immer noch hinter Stacheldraht, nach Erfurt. Von dort weiter ins Quarantänelager nach Prätsch an
der Elbe.
Unter Androhung von Strafe war es verboten das Lager zu verlassen, doch der Hunger zwang uns dazu, in den umliegenden
Dörfern um Lebensmittel zu betteln. Man drohte uns damit, dass Zuwiderhandlungen, mit einer 14-tägigen Verlängerung der
Quarantäne geahndet werden. Der Roggen war schon reif und wir haben, auf den umliegenden Feldern, die Ähren abgerissen,
das Korn, zwischen 2 Steinen zu Mehl zerrieben, um daraus eine Suppe zu kochen, denn von dem was unsere Lagerküche uns
bieten konnte, war es nicht möglich zu überleben. Als der Eigentümer bemerkte wer seine Roggenähren entwendet hat, kam
er ins Lager, gerade zu dem Zeitpunkt als wir mit dem Mahlen beschäftigt waren. Der Lagerkommandant, bei dem er sich
beschwerte, drohte uns zu bestrafen, wenn wir unsere „Rauzüge” nicht unmittelbar einstellen würden. Wir sagten ihm er
solle uns heimfahren lassen, da wir doch lange genug hinter Stacheldraht gesessen hätten.
Endlich wieder in Freiheit
14 Tage nach unserer Ankunft wurden uns Entlassungspapiere ausgehändigt, sowie auch Fahrscheine
zum den, von uns angegeben Heimatorten. So kam ich nach Krottof, Kreis Oschersleben, zu meinem ehemaligen
Kriegskameraden, bei dem ich einen Tag geblieben bin. Er hatte mir schon eine Stelle bei einem Bauern besorgt, der 70
Jahre alt und kinderlos war. Zum Hof, den er mit seiner Ehefrau bewirtschaftet hat, gehörten 36 Morgen Land, 2 Ochsen
und 3 Kühe. Das Ackerland bestand aus 17 Parzellen und sicherte mir einen Arbeitsplatz.
Jetzt, da ich ein Dach überm Kopf und genug zu essen hatte, fing ich an nach dem Verbleib meiner Familie zu forschen.
Bei meinem letzten Heimaturlaub hatte ich mit meiner Frau verabredet; falls wir uns in den Kriegswirren verlieren
sollten, unsere Kontaktadresse, die meiner Quartiersleute in Burscheid, Kreis Opladen, sein sollte. Ich habe zuerst
nach Rohmanen geschrieben, aber leider keine Antwort erhalten. Dann habe ich nach Burscheid geschrieben, und siehe, -
bei denen lag schon eine Anfrage meiner Frau vor, die nach mir gefragt, und ihre jetzige Anschrift hinterlassen hatte.
Ich habe dem Bauern erzählt dass meine Frau sich zurzeit, auf einem Gut, in Alt Steinhorst, im Kreis Rostock, befindet.
Er war sofort bereit uns ein Zimmer zur Verfügung zu stellen, wenn ich meine Frau nach Krottorf rüberholen wollte. Das
habe ich Ihr mitgeteilt und sie war sofort bereit ihren Wohnsitz nach Krottorf zu verlegen, denn sie wohnte dort in
einem kleinen Stübchen unterm Dach.
Im Herbst, als die Feldarbeit so ziemlich erledigt war, bin ich nach Alt Steinhorst gefahren, um meine Frau und meinen
Sohn Kurt, sowie meinen Sohn Manfred, den ich noch nicht kannte, weil er erst nach der Flucht, am 31. Januar, in Groß
Lüssewitz, geboren wurde, nach Krottorf zu holen. Meine Frau hatte schon Holz für den Winter besorgt und vom Gut, auf
dem sie im Sommer gearbeitet hatte, Mehl und Kartoffeln bekommen. Wir haben das Mehl und andere Habseligkeiten in
Kisten verpackt. Das Holz haben wir einem Bauern gegeben, der uns und unser Gepäck, mit seinem Pferdewagen, zum 14
Kilometer entfernten Bahnhof, nach Ribnitz gebracht hat. Wir sind auch gut in Krottorf angekommen, aber als wir am
nächsten Tag, unsere Kisten vom Bahnhof abholen wollten, haben wir zwar die Kisten vorgefunden, doch der gesamte Inhalt
wurde während der Bahnfahrt entwendet. Die Bahnstation in Krottorf hat die Vorkommnisse zur Kenntnis genommen und
protokolliert, aber unsere Sachen haben wir nie wieder gesehen und mussten wieder bei Null anfangen.
Im Winter musste ich auf der Genossenschaft, unentgeltlich, für die Russen Weizen einsacken. Ich hatte versucht eine
Arbeit als Zimmermann zu bekommen, doch auf dem Arbeitsamt wurde mir gesagt, ich bin Ladwirt und muss auf der
Landwirtschaft arbeiten. Da in den ersten Nachkriegsjahren, auch in der sowjetisch besetzten Zone Arbeitsplätze knapp
waren, mussten auch solche, die einen anderen Beruf erlernt hatten, jede zumutbare Arbeit annehmen. Aus der Heimat
erhielt ich einen Brief, von meiner dort noch lebenden Mutter. Sie schrieb das sie mich noch einmal sehen wollte und
ich sollte doch wieder zurück kommen; Unser Hof wäre nicht von Polen besetzt und sie wäre ganz alleine, weil der Vater
nach dem Durchzug der Front von den Russen erschlagen wurde. Daraufhin habe ich dem polnischen Konsulat in Magdeburg
mitgeteilt, dass ich in Rohmanen eine Landwirtschaft besitze, und um eine Einreisegenehmigung gebeten.
Nach 2 Monaten erhielt ich eine Postkarte, mit der Mitteilung, ich sollte mich persönlich beim Konsulat vorstellen.
Nach Aufnahme meiner Personalien, wurde mir gesagt, das ich benachrichtigt werde wenn mein Antrag genehmigt wird. Ende
Juli 1947 erhielten wir die Einreisegenehmigung nach Ostpreußen, das jetzt unter polnischer Verwaltung stand. Wir
mussten zuerst zum polnischen Konsulat in Berlin-Lichterfelde, wo wir umgeben von einer Trümmerlandschaft, gewartet
haben, bis alle Untersuchungen und Formalitäten erledigt waren.
“ Wieder zurück in Ostpreußen.”
Der schwere Wiederaufbau nach dem Kriege
Dann fuhren wir über Frankfurt/Oder, Posen, Thorn, Allenstein, nach Ortelsburg, wo wir am 2. August 1947 ankamen. Mit
einem zweirädrigen Karren, den ich mir von einem noch in Ortelsburg lebenden Bekanten ausgeliehen hatte und meinem
Sohn Manfred im Kinderwagen fuhren wir nach Rohmanen. Meine Mutter war inzwischen verstorben und auf dem Hof war nur
meine, inzwischen aus Russischer Gefangenschaft wiedergekehrte Schwester, Frieda Pelkowski.

Es war alles ausgeplündert; kein Vieh, keine Maschinen und der ganze Hof mit kniehohem Graß überwachsen. Nur schmale
Trampelpfade, vom Haus zum Holzschuppen und zum Klo, durchkreuzten das satte Grün. Ich habe das Gras auf dem Hof mit
einer Sense, die ich noch gefunden habe, abgemäht, damit der Hof nicht so verwahrlost aussah. Am nächsten Tag habe ich
mich bei der Polizei in Ortelsburg angemeldet, wo ich auch ein Startgeld von 100 Zloty erhielt und Gepäckstücke, die
ich in Krottorf aufgegeben, am Bahnhof abgeholt. Es hat mich sehr gewundert das, das Gepäck überhaupt angekommen ist.
Da man von der Landwirtschaft nicht Leben konnte, habe ich mich in den nächsten Tagen, bei der jetzt polnischen Bahn,
um Arbeit beworben und wurde auch angenommen. Wenn wir unseren Monatslohn bekamen, saß immer einer am Tisch, der von
uns 100 Zloty für den Wiederaufbau von Warschau verlangte. Wenn ich dran war, riefen die Anderen, ich hätte Warschau
zerstört und müsste deshalb 200 Zloty abgeben. Nach 3 Jahren kam eine Verfügung, die besagte, dass wer länger als 1
Jahr bei der Bahn beschäftigt ist, angestellt werden muss. Um diese Bestimmung zu umgehen hat man mich entlassen und
eine Woche später wieder eingestellt.
Als ich vor Ablauf des nächsten Jahres, aus dem gleichen Grunde wieder entlassen wurde, habe ich mich bei der
Stadtverwaltung in Ortelsburg(jetzt Szczytno)beworben, wo ich zuerst im Gaswerk als Heizer und später auf Baustellen
als Zimmermann gearbeitet habe. Wir haben durch den Krieg beschädigte Häuser repariert, in den ehemals touristischen
Zentren einige Ausbesserungen an den Einrichtungen durchgeführt, eine Ziegelei wieder in Betrieb gesetzt und andere
anfallende Arbeiten verrichtet. Im Dach des Rathausturmes war während der Kämpfe eine Granate eingeschlagen, die, die
Dachlatten und die Verschalung zerstört hatte. Da wir, unter schwersten Bedingungen, den Schaden repariert haben,
wurde uns eine Höhenzulage versprochen, die wir aber nicht bekommen haben.
Aus Verärgerung darüber habe ich bei der Stadtverwaltung gekündigt und bei einer Wiederaufbaufirma unter der Leitung
von Bauingenieur Laskowski wieder angefangen, wo ich bis 1954, als Zimmermann beschäftigt war. Ab da habe ich mich
nur um meinen Hof gekümmert, der wegen meiner Arbeitsstellen, gezwungenermaßen, sehr vernachlässigt wurde. Als wir
1947 zurückkamen, brachten wir unseren Sohn Manfred noch im Kinderwagen. Den hat meine Frau zum Markt gebracht,
verkauft, und dafür eine Ziege erworben, die dank guter Pflege, uns täglich mit 4 Liter Milch versorgte. Das war der
erste Baustein zum Wiederaufbau, unserer durch den Krieg zerstörten, und danach ausgeplünderten Landwirtschaft.
Während meiner Arbeit bei der Bahn haben wir uns eine Kuh gekauft, die nach einem halben Jahr, wegen nicht bezahlter
Grundsteuer, vom Gerichtsvollzieher gepfändet wurde. Man hat uns die Kuh weggenommen und bei einem Arbeiter, der in
der Ernst-Mey-Straße in Ortelsburg wohnte und sie wegen nicht vorhandener Futtermittel, nur mit Kartoffelkraut
gefüttert hat, untergestellt. Als ich bei der Bahn meinen Monatslohn bekommen habe, bin ich zur Gmina gegangen, habe
eine Rate angezahlt und durfte dann die Kuh wieder mit nach Hause nehmen. Durch die schlechte Ernährung war die Kuh
stark abgemagert und lieferte nur die Hälfte der ursprünglichen Milchleistung.
Später habe ich ein Pferd auf Abzahlung bekommen, das 140.000 alte Zloty gekostet hat. Die Stute war schwach und unser
Feld sehr hügelig, so dass man nur bergab pflügen konnte, was sehr beschwerlich war, bergauf ging es immer im Leerlauf.
Später habe ich die schweren Böden mit dem Traktor umpflügen, und in den letzten Jahren auch mit dem Binder mähen
lassen. Von der Stute habe ich 2 schöne Fohlen gezogen; ein davon habe ich bei der Ausreise in die Bundesrepublik
mitgebracht und bei der Viehverwertungs-Genossenschaft in Göttingen verkauft. In den ersten Nachkriegsjahren als noch
wenig Land bestellt wurde, breiteten sich auf den nicht beackerten Flächen, Wildkräuter aus. Disteln und andere
Schnellwachsende, erreichten manchmal eine Höhe von 2 Meter, besonders auf den schweren Böden.
Es hat viel Schweiß gekostet ehe man den Acker soweit hatte, das er auch befriedigende Erträge abwarf. Die
Währungsreform von 1950, hat unser weiniges Geld das wir schon gespart hatten, wieder vernichtet. Ich hatte 2 Pferde,
1 Fohlen, 2 Kühe und Schweine, als ich wieder aufgefordert wurde nicht bezahlte Grundsteuern nachzuzahlen. Als ich
nicht bezahlen konnte, hat der Vollziehungsbeamte, ein Fohlen, eine Kuh und ein Schwein gepfändet. Es gelang mir jedoch
nach längeren Verhandlungen, ohne größere Verluste, alles zu regeln. Später kam eine Verfügung, die besagte; wenn
jemand auf seinem Hof nur eine Kuh und ein Pferd hatte, durften sie nicht gepfändet werden. Einige haben ihr Inventar
dieser Verfügung angepasst und dadurch die Zahlung von Grundsteuer umgangen.

Wer seine Steuern pünktlich bezahlt und sein Kontingent an landwirtschaftlichen Produkten fristgerecht abgeliefert hat,
der konnte seine, darüber hinaus erwirtschafteten Produkte zu marktgerechten Preisen verkaufen. Für eine hochtragende
Sterke, mindestens 400 kg schwer, die auf ein staatliches Gut verkauft wurde, konnte man bis zu 12000 Zloty bekommen.
Unsere Böden waren kalkarm, doch durch den Einsatz von Kalk und Kunstdünger konnte man den Ertrag erheblich steigern.
Kalk und Kunstdünger konnte man bei der Genossenschaft(GS) bestellen, der dann auch direkt auf den Hof geliefert wurde.
Kalk wurde geliefert und gleich auf dem Feld ausgestreut. In den 1960ger Jahren waren alle Ackerflächen der Rohmaner
Felder bestellt.
Die nach dem Krieg zurückgebliebenen deutschen Bauernfamilien, aber auch die Polen, die während des Krieges beim Bauern
in Deutschland gearbeitet haben, versuchten mit teils bescheidenen, oder auch zusammen gesuchten, landwirtschaftlichen
Geräten, die bäuerlichen Betriebe aufrecht zu erhalten. Nach den schweren Anfängen in den ersten Nachkriegsjahren
erzielten sie schließlich einen beachtlichen Erfolg, der sich in wogenden Kornfeldern, sowie in grünen Wiesen auf
denen gut genährtes Vieh weidete, widerspiegelte.
Ein schwerer Einschnitt in meinem Leben.
Am 11. Mai 1956 verstarb nach langer schwerer Krankheit, meine liebe Ehefrau Marta Rattay,
geborene Brosch. Ein Jahr zuvor war schon mein Schwiegervater Gottlib Brosch verstorben. Die schweren Bedingungen
unter denen wir nach Kriegende leben mussten, haben ihrer bereits angegriffenen Gesundheit sehr zugesetzt. Sie
verstarb mit 44 Jahren und hinterließ in unserer Familie eine große Lücke, die nicht mehr zu Überbrücken war. Wir
haben sie unter großer Anteilnahme der noch verbliebenen deutschen Bevölkerung zu Grabe getragen und auf dem Rohmaner
Friedhof beigesetzt. Die Arbeit die sie sonst verrichtet hatte fiel jetzt auf mich und meine Söhne zurück. Meine
Schwester Frieda Pelkowski half auch wo sie nur konnte. Wir waren auf die Unterstützung durch Nachbarn und Freunde
angewiesen, die uns immer wenn es nötig war, tatkräftig unterstützt haben. Im laufe der Zeit haben wir wieder zum
Alltag zurück gefunden, haben sie noch etliche Jahre auf dem Friedhof besuchen können, bis wir, bedingt durch unsere
Ausreise uns endgültig von ihr trennen mussten.
Der endgültige Abschied von Ostpreußen
Ab 1956 begannen, durch die Vermittlung des Deutschen Roten Kreuzes, die ersten Ausreisen in die
Bundesrepublik Deutschland. Zuerst waren es Kinder die zu ihren Eltern ausreisen durften, Familien deren Väter aus der
Kriegsgefangenschaft in den Westen Deutschlands entlassen wurden und andere durch den Krieg getrennte
Familienangehörige. Ab 1960 erhöhte sich die Zahl der Ausreisewilligen aus dem polnisch besetzten Ostpreußen. Es setzte
sich die Überzeugung durch, dass unsere Angestammte Heimat, uns für die Zukunft keine Perspektive mehr bieten konnte.
Meistens wurden die Anträge, die wir an die Passabteilung in Allenstein stellen mussten, um einen Ausreisepass zu
bekommen, negativ beschieden. Nach mehrmaligen Versuchen gelang es dann doch, diese begehrte Ausreiseberechtigung in
Empfang zu nehmen. Die Enttäuschung der Zurückgebliebenen war groß, wenn wieder mal Verwandte oder Nachbarn, den Weg
in Richtung Bahnhof einschlugen.
Um einen Reisepass zu beantragen, musste man zuerst eine Einladung von Verwandten aus der Bundesrepublik vorlegen, in
der, diese sich verpflichten mussten, für Unterkunft und Verpflegung der Eingeladenen zu sorgen. Diese Einladung
musste durch ein Amt in der Bundesrepublik beglaubigt werden. Außerdem mussten die Kosten für die Bahnfahrt, ab
polnischer Grenze, bis zum Zielort, beim polnischen Reisebüro ORBIS, in Warschau, in DM eingezahlt werden.
Unseren ersten Ausreiseantrag haben wir 1964, bei der Kommandantur der polnischen Miliz in Allenstein eingereicht, der
nach einer gewissen Zeitspanne, ohne eine uns verständliche Begründung zu nennen, abgelehnt wurde. Gegen diese
Ablehnung wurde ein Widerspruch zugelassen, den wir sofort einreichten. Nach einer weiteren Zeitspanne erhielten wir
wieder eine Ablehnung, gegen die kein Widerspruch mehr zulässig war. Wer seine Ausreiseabsicht nicht aufgeben wollte,
musste einen neuen Antrag stellen. Es gab Familien die schon 10 Mal einen Ausreiseantrag gestellt hatten und immer
wieder abgewiesen wurden. Da meine Söhne, nicht die Absicht hatten in Rohmanen zu bleiben und ich nach 2 Weltkriegen,
an denen ich teilgenommen, die schwere Arbeit auf der Landwirtschaft, nicht aus eigener Kraft schaffen würde, haben wir
1966 wieder einen Antrag gestellt, der prompt abgelehnt wurde. Der Widerspruch auf diese Ablehnung wurde auch negativ
beantwortet, so dass wir 1968 wieder einen Antrag eingereicht haben.
Weil das Passamt in Allenstein lange nichts von sich hören ließ, hegten wir schon die Hoffnung das es jetzt klappen
würde und waren sehr enttäuscht als wieder eine Absage kam. In der Zwischenzeit sind viele Nachbarn und Bekannte aus
Rohmanen, sowie aus der näheren Umgebung, ausgereist und das Häuflein der noch verbliebenen Deutschen, wurde immer
kleiner. Die Motivation, die uns in früheren Jahren, über so manche schwierige Lage hinweg geholfen hat, ist einer
hoffnungslosen Resignation gewichen. Man war davon überzeugt, dass unser Leben, in unser Angestammten Heimat, keine
Zukunftsperspektive mehr haben konnte und wenn wir keine Ausreisegenehmigung bekommen, wir eines Tages die letzten
Deutschen in der ganzen Umgebung sein werden.
Die Ausreise-Heimat ade
Wir hatten die Hoffnung schon aufgegeben, als am 30. April 1969, der Briefträger unseren Hof
betrat und mir einen Brief überreichte, in dem uns das Passamt in Allenstein mitteilte, dass unsere Ausreise in die
Bundesrepublik Deutschland, genehmigt worden ist. Wir müssten, nach Aushändigung der Reisepapiere, den Geltungsbereich
der Volksrepublik Polen, innerhalb von 3 Monaten verlassen. Wir waren zuerst geschockt, über den Hinweis, das wir
unsere Heimat in 3 Monaten verlassen müssen, aber dann stellte sich die Zukunftsperspektive wieder ein und wir gingen,
wie von einem schweren Ballast befreit und gut gelaunt unser weiteren Tätigkeit nach.
Als der Briefträger unseren Hof betrat, waren ich und mein Sohn Kurt gerade dabei eine Fuhre Mist zu laden. Wir hatten
den Wagen gerade halb geladen und haben nach der frohen Kunde nicht mehr weiter gemacht, sondern die Pferde vorgespannt
und den Mist aufs Feld gefahren, damit wir den Wagen für alle Fälle frei hatten. Das war die letzte Tätigkeit für
unsere Landwirtschaft in Ostpreußen.
Die Nachricht von unserer Ausreise verbreitete sich, ohne dass wir darüber gesprochen haben, wie ein Lauffeuer.
Alsbald kamen Leute aus dem Dorf, die sich für das Vieh und für diverse Landwirtschaftliche Geräte interessierten.
Etliche wollten bestimmte Sachen sofort kaufen, andere haben nur zurücklegen lassen und wollten später kommen und
bezahlen, haben es aber dann doch nicht genommen.

Wenn man eine Landwirtschaft hatte, konnte man 2 Pferde, 2 Rinder, 3 Schweine, 5 Schafe und 10 Hühner, in einem
geschlossenen Viehwaggon, in die Bundesrepublik mitnehmen. Jeden Tag war man unterwegs, von einer Behörde zur Andern.
Die Aushändigung der Reisepapiere erfolgte nur nach Vorlage bestimmter Bescheinigungen: Es mussten alle Steuern bezahlt
sein, das Kontingent landwirtschaftlicher Erzeugnisse musste abgeliefert sein, je eine Bescheinigung vom Katasteramt
und vom Notar musste vorgelegt werden, das man dem polnischen Staat das Grundstück abgetreten hat. Die Gebühren für
die notarielle Beglaubigung mussten wir selbst bezahlen. Wenn man alle Bescheinigungen beisammen hatte, bekam man bei
der Kreisverwaltung eine Gesamtbescheinigung. Mit dieser Bescheinigung konnte man nach Allenstein, zur
Polizeikommandantur fahren, wo man nach dem schriftlichen Verzicht auf die polnische Staatsangehörigkeit, einen
Reisepass ausgehändigt bekam, der den Inhaber zum Grenzübertritt berechtigte, aber nicht zur Wiedereinreise.
Wir haben 2 Pferde, eine Sterke, einen Ochsen, 5 Schafe, 2 Schweine und 10 Hühner mitgenommen. Über die Schutzimpfung
der Rinder musste man eine, vom Kreistierarzt beglaubigte Bescheinigung vorweisen. Ich habe 5 Schafsböcke gekauft, die
ich in der Zwischenzeit, hinter der Scheune, zum Weiden angekettet hatte. Einer von denen hat sich losgerissen und
seinen Nachbarn getötet. Das Fleisch konnten wir noch verkaufen, mussten aber dafür einen anderen Schafsbock kaufen.
Innerhalb von 3 Monaten mussten wir alles regeln und zwei Tage vor der Abfahrt einen Eisenbahnwagen, bei der
Eisenbahndirektion in Allenstein bestellen. Reservierungen bei den polnischen Behörden waren meist immer mit
Schmiergeld verbunden, weil man sonst nie sicher sein konnte dass diese Vereinbarungen auch eingehalten werden. Schon
2 Wochen vor unserer Abfahrt, gab es in Ortelsburg keine alkoholischen Getränke zu kaufen. Meine Söhne mussten mit dem
Motorrad die umliegenden Dörfer abfahren, damit wir für die Reise einen Vorrat anlegen konnten; denn Wodka war zu der
Zeit, in Polen, wie eine zweite Währung.
Am 25. Juli haben wir zusammen, mit meinem Neffen Siegfried Brosch, unseren sonstigen Hausrat, der in Kisten verpackt
war, in einen Eisenbahnwagen, auf dem Allensteiner Bahnhof verladen. Alles musste zuerst durch den Zoll, wo die
Federbetten gewogen wurden und über das erlaubte hinausgehende Kissen, verzollt werden mussten. Dasselbe galt auch für
Fleisch und Räucherwaren.
Am 26. Juli, unserem Verladetag, kam der Eisenbahnwagen aus Allenstein, erst um 11 Uhr auf dem Ortelsburger Bahnhof an.
Die Rinder hatten wir zu Fuß, zum Bahnhof gebracht; Schweine, Schafe und Hühner auf dem Pferdewagen. Im Eisenbahnwagen
mussten, mit Hilfe von Brettern und Bohlen, Boxen für die verschiedenen Tiere erstellt werden. Jedes Pferd und jedes
Rind in eine Bucht. Die Schafe zwischen die Pferde, die Schweine zwischen die Rinder und die Hühner in einem Käfig,
unter der Decke über den Rindern. Die Hühner hatten unterwegs Eier gelegt, somit hatten wir jeden Tag frische
Verpflegung. Bei der Fahrt im Viehwagen, begleitete mich mein Sohn Manfred. Als die Lokomotive nahte, um den Wagen
abzuholen, wurden noch schnell die restlichen Sachen hinein geworfen und so mache Abschiedsträne rollte dann die Wange
hinab.
Unsere Nachbarn, Deutsche und Polen, halfen uns beim Verladen des lebendigen Inventars. Jetzt erinnerte ich mich
plötzlich, an die oft auch schönen, Ereignisse der letzten 22 Jahre. Einer Zeit, in der das Zusammenleben von
Deutschen und Polen, von Jahr zu Jahr, besser wurde. Man half sich beim einbringen der Getreideernte, beim Dreschen
des Getreides, bei der Kartoffelernte und bei anderen Arbeiten, wo viele Menschen zupacken mussten. Es war eine
Dorfgemeinschaft, in schweren Zeiten geboren; jeder half jedem wenn Hilfe nötig war. Es wurde mir plötzlich bewusst,
das jetzt ein Lebensabschnitt zu Ende ging, zu dem ich nicht mehr zurückkehren konnte. Unsere Existenzgrundlage war
jetzt ein Eisenbahnwagen auf einem Schienenstrang, dessen Ende irgendwo in weiter Ferne lag. Obwohl, von langer Hand
vorbereitet, war dieser Moment voller Wehmut.
Doch als der Zug sich plötzlich, in Bewegung setzte, war ich sofort wieder in der Gegenwart. Menschen, mit denen man
Jahrzehnte lang, in gutem Einvernehmen zusammen gelebt hat, blieben plötzlich am Bahnsteig zurück und die Entfernung
zwischen ihnen und mir vergrößerte sich mit jeder Sekunde, bis sie letztendlich aus meinem Blickfeld verschwanden.
Es war ein heißer Julitag, als wir unsere Reise gen Westen antraten. Für die Schweine, die besonders unter der Hitze
zu leiden hatten, haben wir 10 Flaschen Essig mitgenommen und sie von Zeit zu Zeit besprenkelt, damit sie besser atmen
konnten. Für die anderen Tiere war reichlich Heu und Hafer vorhanden. Eine großes Fas und zwei Milchkannen waren mit
Wasser gefüllt, die wir auf den an der Strecke liegenden Bahnstationen, bei Bedarf wieder nachgefüllt haben.
Da der Kreistierarzt nicht in seinem Büro war, konnten wir die Impfbescheinigung für das Vieh, nicht rechtzeitig
herbeischaffen. Der Zug setzte sich in Bewegung und die Bescheinigung war immer noch nicht da. Als die Bescheinigung
dann eingetroffen, wir aber schon unterwegs waren, ist mein Sohn Kurt mit dem Motorrad hinterher gefahren und hat uns
in Passenheim, wo der Zug noch andere Wagen angehängt bekam, die Impfbescheinigung übergeben. Wir waren sehr froh das
er es noch geschafft hat, denn in solch einer Situation fühlt man sich sicherer wenn man alle Bescheinigungen bei sich
hat. Auf der Rückfahrt, mit dem Motorrad hatte er noch eine Panne, musste das Motorrad stehen lassen und per Anhalter
nach Hause fahren. Am nächsten Tag kam er mit Siegfried Deptolla, der das Motorrad wieder flott machte und brachte es
wieder nach Rohmanen zurück.
Die Fahrt mit dem Viehwagen, gen Westen
Von Ortelsburg bis Allenstein(45 km) hat unser Zug 4 Stunden gebraucht, weil auf jedem Bahnhof
gehalten wurde, um neue Wagen anzuhängen. Nachdem wir in Allenstein angekommen waren, kam ein Rangierer und fragte
nach unserem Ziel. Als wir ihm mitteilten, das wir in die Bundesrepublik Deutschland wollen, sagte er nur: „In 10
Minuten fährt ein Zug los. Wenn ich von euch 500 Zloty und einen Liter Wodka bekomme, werde euch sofort anhängen,
andernfalls kommt ihr auf ein Nebengleis und müsst dann auf den nächsten Zug warten. Es blieb uns nichts anderes übrig
als seiner Forderung nachzukommen, denn über derartige Erpressungen hat man bereits von Anderen, die vor uns ausgereist
sind, gehört. Wir wurden auch sofort angehängt und fuhren dann die ganze Nacht, an Osterode, und Thorn vorbei bis
Gnesen. Dort wurde wieder rangiert.
Von einer Anhöhe wurden die einzelnen Wagen auf verschiedene Gleise verteilt und zu neuen Zügen zusammengestellt. Der
Aufprall der ungebremsten Wagen erzeugte eine derartige Erschütterung, dass manche Bretter an den Boxen geborsten waren.
Von Gnesen ging es dann in einem Zuge durch bis zur Grenzstation Reppen(Rzepin). Dort mussten wir zum Zollamt, wo
unsere Ausfuhrpapiere durch die Zollbeamten, und durch einen Tierarzt geprüft wurden. Bis Reppen(Rzepin) haben wir für
den Eisenbahnwagen 900 Zloty bezahlt; hier mussten wir noch einmal 650 Zloty bezahlen. Bei der Wagenkontrolle erklärte
uns ein Bahnbeamter das unser Wagen, sich nicht für den internationalen Transport eignet und wir deshalb den Inhalt in
einen Anderen umladen müssen, der irgendwann, auf dem Nebengleis bereitgestellt wird. Nach langer Verhandlung, sowie
einer Zulage von 500 Zloty und einem Liter Wodka haben wir ihn davon überzeugt, das der Wagen sich doch für die
Weiterfahrt eignet.
In der Nacht war Schichtwechsel, der unseren Wagen wieder abgehängt hat, weil er angeblich von der Reichsbahn der DDR,
wegen technischer Mängel nicht weiterbefördert würde. Wir mussten unsere Verhandlung vom Vorabend wiederholen, die mit
der Zusage endete, dass wir am frühen Morgen, über die Grenze auf DDR Gebiet, gebracht werden. Um 5 Uhr morgens kam
eine Lokomotive, die uns den letzten Abschnitt bis über die Grenze bringen sollte. Als der Zug hat noch einmal anhielt,
kamen polnische Grenzbeamte und Soldaten in den Wagen. Sie durchsuchten ihn und fragten, ob wir noch polnisches Geld
oder einen Grundbuchauszug bei uns hätten. Wir zeigten ihnen 800 Zloty, die sie uns, nach Ausstellung einer Quittung
über 500 Zloty, abnahmen. Die Grundbuchauszüge habe ich, im Stroh versteckt, dem Ochsen vor die Füße gelegt. Falls
jemand da suchen sollte, hätte ich gesagt, das das Tier bösartig veranlagt ist, und ich für seine Sicherheit nicht
garantieren könnte, deshalb sollte er vorsichtig sein.
Als die Grenzkontrolle den Zug verlassen hatte, setzte sich die Lokomotive wieder in Bewegung und überquerte nach
kurzer Zeit die Oderbrücke. Auf einer eingezäunten Fläche, jenseits der Grenze, hat man uns abgestellt hat und die
Lokomotive fuhr zurück auf polnisches Gebiet. Vor und hinter uns waren die Tore verschlossen. Auf den Wachtürmen,
links und Rechts von uns, standen Posten mit einem Gewehr im Anschlag. Vier Grenzbeamte der DDR, jeder mit einer
Leiter in der Hand, sowie ein Schäferhund, kamen zu unserem Wagen. Sie öffneten die Schiebetüre, stellten die Leiter
davor und ließen den Hund in den Wagen springen, der nur etwas herum schnupperte und wieder heraussprang. 2 Beamte
haben dann anschließend, die Papiere kontrolliert und das Inventar gezählt.
Nach einiger Zeit wurden wir an einen Güterzug der Reichsbahn angehängt und fuhren von Frankfurt an der Oder, vorbei
an Berlin, Ellingen und Nordhausen, über die Grenze zur Bundesrepublik bis Herzberg. Hier hat ein Zollbeamter der
Bundesrepublik, die Formalitäten erledigt und ein Tierarzt die Pferde, Rinder und Schweine gründlich untersucht. Ich
musste ihnen die Mäuler aufhalten und die Füße hochheben. Danach hat uns die Lokomotive zu einer Wasserzapfstelle
gebracht, wo wir die Tiere tränken und unsere Behälter mit Wasser auffüllen konnten. Anschließen fuhren wir über
Northeim nach Göttingen, zur Viehverwertungsgenossenschaft, die zuvor von unserer Ankunft in Kenntnis gesetzt wurde.
Der Ochse, die Sterke und die Schweine wurden, in Göttingen zum Schlachthof gebracht; die Pferde kamen nach Hannover
und die Schafsböcke nach Kassel. Wir waren mit dem Viehtransport 5 Tage unterwegs; hatten so manche Klippe umschifft
und Schwierigkeiten gemeistert, die im normalen Leben nicht vorkommen.
Wir wurden mit einem PKW, ins Durchgangslager Friedland bei Göttingen gefahren, wo mein Sohn Kurt, meine Schwester
Frieda Pelkowski und Siegfried Brosch mit Familie, die am 30 Juli, um 14 Uhr, von Warschau mit dem Zug abgefahren, und
hier am 31. Juli in den Morgenstunden eingetroffen sind, schon auf uns gewartet haben. In Friedland hat man uns mit
Familie Siegfried Brosch in einem Raum untergebracht, wir wurden registriert und erhielten 20 DM Überbrückungsgeld,
pro Person. Da wir erst am Freitag in Friedland eingetroffen sind, mussten wir hier über das Wochenende bleiben,
obwohl die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der Regel nur 3 bis 4 Tage beträgt.
Um einen Antrag für die Ausreise stellen zu können, brauchten wir eine Einladung von in der Bundesrepublik lebenden
Verwandten. Diese Einladung hat uns mein Bruder, Ernst Rattay, aus Ingelheim am Rhein zugeschickt. Ingelheim liegt im
Bundesland Rheinland-Pfalz. Das Geld für die Bahnfahrt, hat uns, Frieda Schellin, geb. Nickel, aus Duisburg, die
Tochter unseres Nachbarn, überwiesen. In Friedland wurden wir registriert. Im Registrierschein, war als unser
nächster Aufenthaltsort in der Bundesrepublik, das Durchgangslager Osthofen bei Worms, das alle Aussiedler für
Rheinland-Pfalz aufnehmen musste, eingetragen. Die Eintragung erfolgte deshalb, weil der Ort aus dem uns unsere
Einladung zugeschickt wurde, sich auch in Rheinland-Pfalz befand.
Da ich nach dem Polenfeldzug, als Soldat, ein Jahr im Kreis Opladen, im Rheinland gewesen bin, wäre ich sehr gerne in
diese Gegend gezogen, denn die Erinnerung an die schönen Tage die ich dort verlebt habe war in mir immer noch wach.
Ich versuchte die Eintragung in unseren Regiestierscheinen ändern zu lassen, was nach einigen, vielleicht auch
berechtigten Einwänden, am 4. August, vom Beauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen, genehmigt wurde. Anstelle von
Rheinlad-Pfalz stand da jetzt Nordrhein-Westfalen und am 7. August, fuhren wir, noch mit anderen Aussiedlern, ins
Durchgangslager Unna-Massen, am östlichen Rande des Ruhrgebietes gelegen. Hier wurden wir in einem Zimmer untergebracht
und konnten unser Essen in einer Gemeinschaftsküche zubereiten.
Am 8. August wurden wir in Unna-Massen, als Bürger der Bundesrepublik Deutschland registriert, erhielten
Einhundert DM Begrüßungsgeld, den Vertriebenen Ausweis -A -und 4 Wochen später den Bundespersonalausweis. In
Unna-Massen haben wir mehr als 4 Monate verbracht, weil mein Sohn Kurt, wegen fehlender Berufsausbildung, in Unna, an
einem Grundlehrgang für Metallarbeiter teilgenommen hat, der vom Arbeitsamt finanziert wurde. Am 11 Dezember 1969 sind
wir endlich an unserem vorläufigen Wohnsitz, im Durchgangswohnheim, an der Elisabethstraße 13, in Velbert angekommen.
Ab dem 5. Januar 1970 konnten meine Söhne, in der Zahnradfabrik Reining, in Velbert ihrer geregelten Arbeit nachgehen.
Von Bau- und Sparverein in Velbert wurde uns am 20. Juni 1970, unsere erste Wohnung zugewiesen.
Velbert im Februar 1972
gezeichnet: Gustav Rattay
Der Bahnhof war menschenleer, nur ein par Kaninchen liefen verschreckt durch die Gegend und einigen Kameraden gelang
es welche einzufangen. Am nächsten Tag gelang es uns endlich die Feldküche zu erreichen. Als wir gerade beim Essen
fassen waren, schlug unweit eine Granate ein so dass Pflastersteine das Dach durchschlugen und wir das Weite suchen
mussten. und wir wieder nichts zu Essen bekamen. Ein Friseur aus unserer Kompanie fuhr immer ins Hinterland um uns
mit Proviant zu versorgen. Als er 14 Tage vor dem Zusammenbruch wieder mal zurückkam erzählte er uns schon das der
Krieg nicht mehr lange dauern würde, weil Kaiser Wilhelm mit Frack und Zylinder bekleidet, Deutschland verlassen und
ins Ausland gehen würde. In unserer Einheit hatten wir auch einen Juden der glaubte dass er sich alles erlauben darf.
Eines Morgens ging er in die Küche, als er keinen Koch vorfand stieg er auf die Gulaschkanone und hob den Deckel vom
Kessel in dem der Kaffee kochte an. Der kochende Kaffee verbrühte seine Füße so sehr das er sofort ins Lazarett musste,
für ihn war der Krieg somit zuende. Es kam noch ein Erlass, das Kameraden die 2 Jahre aktiv gedient hatten und
Gefreiter waren sofort zum Sergeanten befördert wurden. Für den 11. November 1918 war ein Waffenstillstand vereinbart
und ab 11 Uhr sollte nicht mehr geschossen werden. Wir hatten unsere Kopfkissen aufgetrennt und eine Kissenschlacht
veranstaltet, um auf diese Art und Weise unserer Freude Ausdruck zu verleihen. Als die Federn durch die Luft flogen
brachen wir in Tränen aus.
In jeder Kompanie wurde ein Soldatenrat gewählt, der aus drei Mann bestand. Wenn der Kompanieführer jemanden bestrafen
wollte, musste er erst den Soldatenrat fragen, der die Strafe befürworten, aber auch ablehnen konnte. Die Offiziere
durften keine Achselstücke mehr tragen, was für sie einer Degradierung gleich kam. Wir waren in einem Dorf
einquartiert und morgens zum Appell angetreten, als einer vom Soldatenrat sich stockbesoffen vor den auf dem Pferd
sitzenden Kompanieführer stellte und schrie: „Alles hört auf mein Kommando”. Der Kompaniechef war wie vom Blitz
getroffen, ihm versagte die Stimme. Wir sahen ein das dies nicht so weiter gehen kann und wählten einen neuen
Soldatenrat. Unser Rückzug begann bei Konflanz, einer Vorfestung von Metz und führte uns zunächst über die
luxemburgische Grenze, wo wir in einem Ort einquartiert wurden. Als wir für die Küche Holz aus dem Wald holen gingen,
entschieden wir uns eine Eiche abzusägen, ohne uns dessen bewusst zu sein, in welchem Forst wir uns befanden. Als wir
beim fällen waren fielen plötzlich Schüsse, die wir auch sofort erwiderten, bis uns ein Elsässer der sich in unserer
Kompanie befand aufklärte: „Kameraden, wir befinden uns hier auf Luxemburgischem Hoheitsgebiet”.
Wir sind dann weiter durch das Fürstentum Birkenfeld marschiert, wo das Städtchen Merzig für uns geflaggt hatte. Das
Elsass haben wir auch noch kurz gestreift. Wo wir bei einem Bauern, der uns kein Stroh für das Nachtlager geben wollte,
einquartiert wurden. Daraufhin gingen wir in die Scheune und haben uns selbst was besorgt. Wir haben dann noch erfahren,
sie hätten ein Schwein geschlachtet und warteten auf den Einzug der Franzosen. Als wir uns 1917, an der Ostfront, in
den in Karpaten, im Einsatz befanden, waren unter uns auch viele Elsässer. Sie durften ihre Heimatpost nicht in
französischer Sprache schreiben, mussten ihre Briefe offen auf der Schreibstube abgeben, wo sie zuerst kontrolliert
und dann abgeschickt wurden. Als ich in einer Nacht, mit einem Elsässer auf einem Vorposten Wache schieben musste,
wollte er mich überreden zum Russen überzulaufen. Als ich darauf nicht eingehen wollte verschwand er plötzlich in der
Dunkelheit und ich habe ihn nie wieder gesehen.
Wir sind dann weiter Richtung Worms und Ludwighafen gezogen, dort wurden wir bei einem Mühlenbesitzer einquartiert,
ein Unteroffizier und vier Mann. Obwohl wir verlaust und verdreckt waren bestand die Müllerin darauf das wir in ihren
Betten übernachteten. „Wenn alles durch ist”, sagte sie, „werde ich alles gründlich reinigen”. Der Müller brachte uns
eine Gießkanne voll Wein und sagte wir sollen es uns Schmecken lassen. Wir haben reichlich davon Gebrauch gemacht, so
dass ich gar nicht weiß wie ich ins Bett kam. Das war meine Erinnerung an die Pfalz. Manchmal waren wir auch 2 Tage im
Quartier.
Vor dem Weitemarsch wurde uns immer gesagt welche Truppe die Vorhut und welche Truppe die Nachhut übernehmen sollte.
Die Nachhut hielt immer Verbindung zu den nachrückenden Franzosen und man muss staunen wie alles reibungslos, ohne
Zwischenfälle von statten ging, was wir in erster Linie dem General-Feldmarschall Paul von Hindenburg zu verdanken
haben, der den Rückzug an der Westfront koordiniert hat.
In Köln angekommen, erhielten wir im Volkshaus unsere Entlassungspapiere, Eisenbahnfahrscheine, Reisepässe,
unterschrieben von Oberstleutnant Mann. Wir mussten Köln umgehend verlassen, weil schon am nächsten Tag die
französischen Besatzungstruppen in einmarschieren sollten. Wir fuhren mit einem Zug der bis Allenstein fuhr, dort
wurden unsere Papiere vom Soldatenrat kontrolliert. Die jüngren Jahrgänge wurden festgehalten, zu neuen Einheiten
zusammengestellt und zur Sicherung der Ostgrenze gegen die Bolschewisten abkommandiert. Ich hatte gesagt das ich noch
einen Schrapnellsplitter in der Kreuzbeingegend habe und durfte daraufhin nach Hause fahren.
Kaum in Ortelsburg angekommen fiel ich wieder dem Soldatenrat in die Hände. Sie haben alles durchsucht, haben mir mein
Seitengewehr und eine Decke abgenommen, aber ich durfte weiter und bin dann kurz vor Weihnachten 1918 auf dem
elterlichen Hof angekommen. Schon auf dem Hof habe ich meine Kleider vom Leib gerissen, weil vor Läusen und anderem
Ungeziefer nicht mehr aushalten konnte und mich erst gründlich gewaschen bevor ich das elterliche Haus betreten habe.
Die Freude über das Wiedersehen war sehr groß.
Wir sind dann weiter durch das Fürstentum Birkenfeld marschiert, wo das Städtchen Merzig für uns geflaggt hatte. Das
Elsass haben wir auch noch kurz gestreift. Wo wir bei einem Bauern, der uns kein Stroh für das Nachtlager geben wollte,
einquartiert wurden. Daraufhin gingen wir in die Scheune und haben uns selbst was besorgt. Wir haben dann noch erfahren,
sie hätten ein Schwein geschlachtet und warteten auf den Einzug der Franzosen. Als wir uns 1917, an der Ostfront, in
den in Karpaten, im Einsatz befanden, waren unter uns auch viele Elsässer. Sie durften ihre Heimatpost nicht in
französischer Sprache schreiben, mussten ihre Briefe offen auf der Schreibstube abgeben, wo sie zuerst kontrolliert
und dann abgeschickt wurden. Als ich in einer Nacht, mit einem Elsässer auf einem Vorposten Wache schieben musste,
wollte er mich überreden zum Russen überzulaufen. Als ich darauf nicht eingehen wollte verschwand er plötzlich in der
Dunkelheit und ich habe ihn nie wieder gesehen.
Wir sind dann weiter Richtung Worms und Ludwighafen gezogen, dort wurden wir bei einem Mühlenbesitzer einquartiert,
ein Unteroffizier und vier Mann. Obwohl wir verlaust und verdreckt waren bestand die Müllerin darauf das wir in ihren
Betten übernachteten. „Wenn alles durch ist”, sagte sie, „werde ich alles gründlich reinigen”. Der Müller brachte uns
eine Gießkanne voll Wein und sagte wir sollen es uns Schmecken lassen. Wir haben reichlich davon Gebrauch gemacht, so
dass ich gar nicht weiß wie ich ins Bett kam. Das war meine Erinnerung an die Pfalz. Manchmal waren wir auch 2 Tage im
Quartier.
Vor dem Weitemarsch wurde uns immer gesagt welche Truppe die Vorhut und welche Truppe die Nachhut übernehmen sollte.
Die Nachhut hielt immer Verbindung zu den nachrückenden Franzosen und man muss staunen wie alles reibungslos, ohne
Zwischenfälle von statten ging, was wir in erster Linie dem General-Feldmarschall Paul von Hindenburg zu verdanken
haben, der den Rückzug an der Westfront koordiniert hat.
In Köln angekommen, erhielten wir im Volkshaus unsere Entlassungspapiere, Eisenbahnfahrscheine, Reisepässe,
unterschrieben von Oberstleutnant Mann. Wir mussten Köln umgehend verlassen, weil schon am nächsten Tag die
französischen Besatzungstruppen in einmarschieren sollten. Wir fuhren mit einem Zug der bis Allenstein fuhr, dort
wurden unsere Papiere vom Soldatenrat kontrolliert. Die jüngren Jahrgänge wurden festgehalten, zu neuen Einheiten
zusammengestellt und zur Sicherung der Ostgrenze gegen die Bolschewisten abkommandiert. Ich hatte gesagt das ich noch
einen Schrapnellsplitter in der Kreuzbeingegend habe und durfte daraufhin nach Hause fahren.
Kaum in Ortelsburg angekommen fiel ich wieder dem Soldatenrat in die Hände. Sie haben alles durchsucht, haben mir mein
Seitengewehr und eine Decke abgenommen, aber ich durfte weiter und bin dann kurz vor Weihnachten 1918 auf dem
elterlichen Hof angekommen. Schon auf dem Hof habe ich meine Kleider vom Leib gerissen, weil vor Läusen und anderem
Ungeziefer nicht mehr aushalten konnte und mich erst gründlich gewaschen bevor ich das elterliche Haus betreten habe.
Die Freude über das Wiedersehen war sehr groß.
Vor dem Weitemarsch wurde uns immer gesagt welche Truppe die Vorhut und welche Truppe die Nachhut übernehmen sollte.
Die Nachhut hielt immer Verbindung zu den nachrückenden Franzosen und man muss staunen wie alles reibungslos, ohne
Zwischenfälle von statten ging, was wir in erster Linie dem General-Feldmarschall Paul von Hindenburg zu verdanken
haben, der den Rückzug an der Westfront koordiniert hat.
In Köln angekommen, erhielten wir im Volkshaus unsere Entlassungspapiere, Eisenbahnfahrscheine, Reisepässe,
unterschrieben von Oberstleutnant Mann. Wir mussten Köln umgehend verlassen, weil schon am nächsten Tag die
französischen Besatzungstruppen in einmarschieren sollten. Wir fuhren mit einem Zug der bis Allenstein fuhr, dort
wurden unsere Papiere vom Soldatenrat kontrolliert. Die jüngren Jahrgänge wurden festgehalten, zu neuen Einheiten
zusammengestellt und zur Sicherung der Ostgrenze gegen die Bolschewisten abkommandiert. Ich hatte gesagt das ich noch
einen Schrapnellsplitter in der Kreuzbeingegend habe und durfte daraufhin nach Hause fahren.
Kaum in Ortelsburg angekommen fiel ich wieder dem Soldatenrat in die Hände. Sie haben alles durchsucht, haben mir mein
Seitengewehr und eine Decke abgenommen, aber ich durfte weiter und bin dann kurz vor Weihnachten 1918 auf dem
elterlichen Hof angekommen. Schon auf dem Hof habe ich meine Kleider vom Leib gerissen, weil vor Läusen und anderem
Ungeziefer nicht mehr aushalten konnte und mich erst gründlich gewaschen bevor ich das elterliche Haus betreten habe.
Die Freude über das Wiedersehen war sehr groß.
Kaum in Ortelsburg angekommen fiel ich wieder dem Soldatenrat in die Hände. Sie haben alles durchsucht, haben mir mein Seitengewehr und eine Decke abgenommen, aber ich durfte weiter und bin dann kurz vor Weihnachten 1918 auf dem elterlichen Hof angekommen. Schon auf dem Hof habe ich meine Kleider vom Leib gerissen, weil vor Läusen und anderem Ungeziefer nicht mehr aushalten konnte und mich erst gründlich gewaschen bevor ich das elterliche Haus betreten habe. Die Freude über das Wiedersehen war sehr groß.
“ Unser Leben zwischen den beiden Weltkriegen.”
Endlich wieder zurück in der Heimat
Rohmanen war durch die Kampfhandlungen 1914/15 zu einem drittel zerstört worden, aber schon
wieder im Aufbau. Die Firma Grzella aus Ortelsburg hatte die Bauarbeiten übernommen. Unter der Aufsicht von Polier
Karl Kontor wurden die Dachstühle errichtet. Ich habe mich, nach kurzer Erholungspause, auch als Zimmermanngehilfe am
Wiederaufbau beteiligt. Die Firma Grzella hat das Material geliefert und auch unsere Löhne gezahlt. Wegen meinem
Steckschuss bin ich dem VDK beigetreten und habe mit dessen Hilfe eine Rente beantragt die mir auch bewilligt wurde.
Nach vier Jahren wurde ich nach Allenstein zur Nachuntersuchung vorgeladen. Die ärztliche Untersuchung hatte ergeben,
das Geschoß sei verkapselt, und nur das linke Bein etwas in Mitleidenschaft gezogen. Daraufhin wurde die Rentenzahlung
eingestellt.
Der Stellmacher Adam Ornowski war im Krieg als Sanitäter eingesetzt und hatte auf Grund seiner Erfahrungen,
 Beziehungen zum medizinischen Dienst in Ortelsburg aufgebaut. Es wurden dort Lehrgänge in Erster Hilfe angeboten,
die von Prof. Dr. Kutz geleitet wurden. Adam Ornowski hat dafür gesorgt das einige junge Männer aus Rohmanen daran
teilnehmen konnten. Adam Ornowski, August Linka, Emil Rosowski, Johann Dembek, Emil Baschek und ich sind dann dem
Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes beigetreten und mussten jeden Sonntag am Lehrgang teilnehmen. Unser
Gruppenführer war Kreisobersekretär Albrecht, Landrat von Poser, als unser Ehrenvorsitzender, hat viel zu unserer
finanziellen Unterstützung beigetragen und hat dafür gesorgt dass die Bereitschaft eingekleidet wurde.
Beziehungen zum medizinischen Dienst in Ortelsburg aufgebaut. Es wurden dort Lehrgänge in Erster Hilfe angeboten,
die von Prof. Dr. Kutz geleitet wurden. Adam Ornowski hat dafür gesorgt das einige junge Männer aus Rohmanen daran
teilnehmen konnten. Adam Ornowski, August Linka, Emil Rosowski, Johann Dembek, Emil Baschek und ich sind dann dem
Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes beigetreten und mussten jeden Sonntag am Lehrgang teilnehmen. Unser
Gruppenführer war Kreisobersekretär Albrecht, Landrat von Poser, als unser Ehrenvorsitzender, hat viel zu unserer
finanziellen Unterstützung beigetragen und hat dafür gesorgt dass die Bereitschaft eingekleidet wurde.
In jedem Dorf wurde eine Unfallstelle eingerichtet, mit einem Verbandskasten und mit Verbandsmaterial für die erste
Hilfe ausgerüstet. Die Unfallstelle in Rohmanen, die am Haus von der Straßenseite, durch eine Tafel mit einem roten
Kreuz gekennzeichnet war, hatte ich zu verantworten. An Sonntagen wurden wir an Badestellen und bei Fußballspielen
eingesetzt, haben viele Übungen bei Waldbränden durchgeführt und auch Ausflüge nach Rudzany am Niedersee gemacht. Bei
der Einweihung des Tannenbergdenkmals in der Nähe von Hohenstein kamen wir an Straßenkreuzungen zum Einsatz.
Rohmanen hatte auch eine freiwillige Feuerwehr. Bis zum ersten Weltkrieg hat Friedrich Biella als Brandmeister das
Kommando gehabt. Er war aktiver Unteroffizier, hatte gute Führungsqualitäten und die Männer, die allesamt aus dem
aktiven Militärdienst stammten hatten zu ihm ein großes Vertrauen. Nach dem Krieg wollten diese Männer,
(Friedrich Nickel, Friedrich Willam, Julius Wittkowski, Jakob Janowski, Johann Gloddek, Gustav Bednarz), nicht mehr
weitermachen. Friedrich Biella, der inzwischen zum Gemeindevorsteher gewählt wurde, hat sich dann auf einer
Gemeinderatsitzung vorgeschlagen, für die Freiwillige Feuerwehr jüngere Kräfte anzuwerben.
Zum Brandmeister hat er Herrn Wilhelm Pilath vorgeschlagen. Der wurde dann nach Königsberg zur Fortbildung geschickt.
Der Feuerwehr gehörten nun folgende Personen an: Wilhelm Pilath(Brandmeister), August Linka(Stellvertreter), Gustav
Deptolla, Julius Matzey, Johann Dembek, Willy Willam, Gustav Rattay. Der Kreisbrandmeister war Heinrich Thalmann aus
Ortelsburg, sein Stellvertreter war Kreisobersekretär Salzmann. Der Bezirks-Kommissar bei der Ostpreußischen
Feuersozität War Herr Ernst Trzaska. Er hat dafür gesorgt das die Wehr uniformiert und mit Löschgeräten ausgerüstet
wurde. Da die alten Schläuche schon sehr marode waren, wurden sie durch moderne ersetzt, deren Kupplungen auch mit der
Motorspritze übereinstimmten.
Ernst Trzaska hat bei der Feuersozität und beim Landratsamt Finanzmittel beantragt und auch genehmigt bekommen. Der
Schneidermeister Wilhelm Baran wurde beauftragt Tuch und Drillichanzüge nach Maas zu schneidern. Er hat uns
Stoffmuster vorgelegt aus denen wir wählen sollten. Feuerwehrhelme haben wir auch bekommen. Die Gemeinde musste
Finanzmittel bereitstellen, einen Prozentsatz vom Gemeindebudget. Im Brandfall mussten für den Spritzenwagen Pferde
zur Verfügung stehen, von Willy Willam, Gustav Rattay, Julius Matzey und Gustav Dorka, weil sie in der Nähe des
Spritzenhauses wohnten. Am Spritzenhaus wurde ein großer Baum mit Querleisten aufgestellt, wo nach jedem Brand oder
einer größeren Übung die Schläuche zum trocknen aufgehängt wurden.
Der Kreisbrandmeister hat mindestens 2-3-mal im Jahr die Wehren besichtigt. Das ganze Dorf war dann auf den Beinen,
die Bauern mit Pferden, und andere Dorfbewohner mit Eimern und Spaten, wurden dann in verschiedene Gruppen eingeteilt.
Erst hat die Wehr sämtliche Aufstellungen am Gerät geübt; Grundstellung Fahrstellung und Marschstellung. Dann wurde
ein Brand angekündigt, die Feuerwehr mit der Spritze an den Brunnen, die Gruppen dort wohin sie beordert wurden, die
Bauern brachten mit den Wasserkiwen Wasser aus dem Brunnen zum Brandort. Wenn das Wasser im Brunnen alle wurde hat
man den Saugkorb in die Kiewen gelegt und dort Wasser entnommen. Die Wassergruppe ging mit Eimern zum Dorfteich, holte
Wasser und füllte damit die leeren Kiewen.
Der Löschtrupp ging mit Feuerhaken und Löschpatschen auf die umliegenden Gehöfte und versuchte das vermeintliche Feuer
von ihnen fernzuhalten. Nach dem Alarm wurde wieder am Spritzenhaus angetreten. Die Gruppenführer mussten angeben ob
ihre Gruppe auch vollständig erschienen war, denn Übungen wurden nur vor, oder nach der Feldarbeit durchgeführt, so
dass niemand eine Entschuldigung vorbringen konnte. Wer ohne begründete Entschuldigung nicht anwesend war erhielt eine
Verwarnung. Der Kreisbrandmeister erklärte dann welche Handgriffe den Vorschriften entsprachen und welche nicht. Die
Schläuche wurden noch schnell zum Trocknen aufgehängt. Anschließend gingen wir alle in den Gasthof Trzaska, haben über
vorhandene Mängel diskutiert, Verbesserungsvorschläge unterbreitet und zwischendurch den Durst gelöscht. Der
Kreisbrandmeister ist dann, nach einer kurzen Verabschiedung, ins nächste Dorf gefahren, weil er an einem Tag mehrere
Feuerwehren betreuen musste.
Der Rohmaner Dorffriedhof

Einen Kilometer vom Ende des Dorfes entfernt, auf der rechten Seite der Landstraße in Richtung
Ortelsburg, befand sich der Rohmaner Dorffriedhof. Wann dieser Friedhof angelegt wurde entzieht sich meiner Kenntnis.
Nach Aussagen älterer Dorfbewohner soll davor auch schon eine Ruhestätte vorhanden gewesen sein, und
zwar auf der linken Straßenseite gegenüber dem jetzigen Friedhof. An dieser Stelle befand sich bis in die
Nachkriegszeit ein kleiner Brunnen, aus dem die Dorfbewohner, das Wasser zum begießen der Grabbepflanzung auf den
Gräbern ihrer verstorbenen Angehörigen holten. Der Friedhof war in einer Hanglage angelegt, wahrscheinlich weil diese
Parzelle für eine landwirtschaftliche Nutzung nicht geeignet war. Um das Gräberfeld vor herumstreunenden Tieren oder
von der Weide entlaufenen Kühen zu schützen, hat man das ganze Gelände mit einem Holzzaun umgeben. Der Zugang befand
sich von der Straßenseite. Unter einem Torbogen hindurch wurden die Verstorbenen zu Grabe getragen. Die Gräber der
einzelnen Familien waren nebeneinander angelegt, mache, wie zum Beispiel die der Familie Trzaska, sogar mit einem
schmiedeeisernen Zaun eingefasst.
Nach dem 2. Weltkrieg verfiel der Friedhof immer mehr. Die nötigen Finanzmittel für die Pflege der Einfriedung konnten
von den restlichen noch verbliebenen Deutschen nicht mehr aufgebracht werden. An den gepflegten Gräbern konnte man noch
erkennen dass es Verwandte von noch in Rohmanen wohnenden Deutschen waren, oder von bereits im Westen Deutschlands
lebenden, die ihre noch in Rohmanen wohnenden Nachbarn damit beauftragt hatten. Die übrigen Gräber wurden von Jahr zu
Jahr immer mehr von Wildkräutern überwuchert und schließlich auch von Sträuchern und schnell wachsenden Bäumen.
In den späteren Jahren konnte man nicht mehr erkennen dass dort vor Jahren Tote zur letzten Ruhe gebettet wurden. Die
Natur holte sich das ganze Gelände zurück und nur unter großen Schwierigkeiten konnten Besucher aus dem Westen das
Friedhofsgelände noch betreten.
Das Gasthaus Trzaska

Nach dem ersten Weltkrieg hat der Gastwirt Friedrich Trzaska neben dem Gasthof einen großen Saal
für Festlichkeiten und Vereinsfeiern gebaut, in dem schon mal Feuerwehrfeste veranstaltet wurden. Ernst Trzaska war
Feuerkommissar bei der Ostpreußischen Feuersozität. Erich Trzaska war Vollziehungsbeamter beim Amtsgericht in
Ortelsburg. Unser Feuerkommissar war uns beim organisieren der Veranstaltungen sehr behilflich, hat uns den Saal, die
Musik und die Theaterstücke besorgt und die Feuerwehren aus den Nachbardörfern eingeladen.
Zu Manöverzeiten, vor dem 2. Weltkrieg und dann auch während des Krieges, waren im Gasthof Soldaten, meist im Range
eines Offiziers, einquartiert. Fräulein Mariechen Trzaska hat die Poststelle im Dorf betreut. Nachdem ich 1939 zum
Militär eingezogen wurde, hat sie, nach einer Schulung im Ortelsburger Krankenhaus, auch die Unfallmeldestelle
übernommen. Nach dem Krieg, pflegte sie mit vielen Bekannten, die bereits in der Bundesrepublik wohnten, einen regen
Briefwechsel. Auf dem Rohmaner Friedhof hat sie viele Gräber, im Auftrag von Angehörigen, die auf Grund ihrer
Abwesenheit, dazu nicht mehr in der Lage waren, gepflegt. Der Bauunternehmer Kurnitzki aus Ortelsburg, äußerte die
Bitte, sie möchte ihm doch ein Blatt vom Rosenstrauch, der auf dem Grab seiner Eltern steht, in den Brief legen. Als
sie uns den Brief vorgelesen hat, waren wir zu Tränen Gerührt. Sie hat als Letzte aus ihrer Familie, bis zu ihrem Tod
im Jahre 1960, in Rohmanen, im Gebäude der Gastwirtschaft gewohnt und ist auf dem Rohmaner Friedhof beerdigt worden.
Fleisch und Wurstwaren Karl Pelkowski
Im Jahr 1931 hat der Fleischermeister Karl Pelkowski, aus Grammen, direkt neben unserem Hof ein
Anwesen gekauft und dort eine Fleischerei eingerichtet. Er war mit meiner Schwester Frieda, verheiratet. Am Anfang hat
er die Schweine noch auf seinem Hof geschlachtet, später dann im Ortelsburger Schlachthof. Jede Woche fuhr er 2-mal,
mit dem Pferdewagen(Einspänner), nach Ortelsburg zum Wochenmarkt, wo er seine Fleisch und Wurstwaren zu Verkauf anbot.
Am Tag davor, wenn er die Wurst gekocht hat, kamen viele Rohmaner mit Kannen oder anderen Gefäßen, wegen der guten
Wurstsuppe, die er umsonst unter die Leute verteilte. Als Karl Pelkowski, Ende August 1939 zum Militär eingezogen
wurde, hat seine Frau das Pferd verkauft und den Beitrieb stillgelegt. Am Haus hing, immer noch die Tafel mit der
Aufschrift: Karl Pelkowski, Fleisch und Wurstwaren. Ein Witzbold hat irgendwann darunter geschrieben; „Fleisch und
Wurst waren einmal”, drauf hin hat Frau Pelkowski die Tafel entfernen lassen. Karl Pelkowski ist im Mai 1946 in
französischer Gefangenschaft verstorben. Seine Ehefrau Frieda, verstarb an ihrem 85. Geburtstag in Mettmann bei
Düsseldorf.
Die steinreichen Rohmaner Felder
Die letzte Eiszeit hat bei der Schmelze, auf der Rohmaner Feldgemarkung viele Steine und
Granitblöcke zurück gelassen. Überirdisch, aber besonders unter der Erde, gab es viele kleine, aber auch große Steine,
die, den Bauern, beim Pflügen und anderen Feldarbeiten sehr viel Schweiß, abverlangten. In einer Kiesgrube, auf dem
Feld des Bauern August Radek, lag ein Granitblock, von schätzungsweise 100 cbm. Vor etwa 80 Jahren, als man für diese
Steine noch keine Verwendung hatte, griffen die Bauern zu einer „List”. Weil er sonst nicht pflügen konnte, hat mancher
seinem Nachbarn, die Steine in der Nacht auf dessen Feld abgeladen. Als diese Tätigkeit unter Strafe gestellt wurde,
hat man die Steine in Schluchten gekippt und mit Mutterboden zugeschüttet. In späteren Jahren kam diese jedoch beim
pflügen wieder an die Oberfläche. Dann hat man aber schon Steine für den Straßenbau gebraucht und konnte sie so zu Geld
machen. Besonders im Raum südlich von Ortelsburg, bis zur polnischen Grenze, wo Steine eine Rarität waren, kamen sie
jetzt zum Einsatz. Auch beim Bau von Häusern, besonders für die Fundamente, wurden sie eingesetzt, weil auf diese
Weise viel Ziegeln eingespart wurden. Die Firma Gribienski aus Ortelsburg hat die großen Steine mit Dynamit gesprengt
und auf diese Weise die weitere Verarbeitung erleichtert.
Die Steine welche beim Pflügen aus dem Boden geholt wurden, hat man am Feldrand auf große Haufen zusammen getragen.
Wenn die Feldarbeit beendet war, sowie auch in den Wintermonaten, waren wir jeden Tag mit Steinen unterwegs. Wir sind
vorwiegend am Abend los gefahren, weil unter der schweren Last die Wagenachsen so heiß wurden und die Gefahr bestand,
das durch die Dehnung, die Räder blockiert würden. Bei einer Fahrt konnte man bis zu 24 Reichsmark verdienen, wogegen
1 Zentner Roggen für 8 bis 9 Reichsmark zu haben war. Ich bin selbst, mit dem Pferdewagen bis Fürstenwalde, Radostowen,
Luka, Altkirchen, Höhenwerder, ja sogar bis Friedrichshof gefahren.
In Rohmanen wurden auch rote Ziegeln gebrannt. Viele Häuser wurden, mit Ziegeln erbaut, die nur wenige 100 Meter von
der Baustelle entfernt hergestellt wurden. Der Lehn wurde auf den Feldern in der näheren Umgebung entnommen, dann von
Ochsen solange getreten, bis er so geschmeidig war, das er sich in Formen einstreichen ließ. Wenn die Ziegel in der
Form trocken war, wurde sie entnommen und in einem Brennofen gestapelt. Um einen Ofen richtig anzufeuern, brauchte man
12 Raummeter Holz, das im Zeitraum von ein par Tagen verheizt wurde. Der Fischer Karl Glitza hatte schon eine
Knetmaschine, die von einem Pferd angetrieben wurde, das mit verbundenen Augen, den ganzen Tag in die Runde ging.
Im Dorf waren auch vier Kalköfen, in denen so genannte Kalksteine, die sich an gewissen Stellen, im Erdboden befanden,
gebrannt wurden. Nach dem Brennen wurden die Steine mit Wasser abgelöscht und die daraus entstandne Masse diente, nach
dem Beimischen einer gewissen Menge Sand, dann als Bindemittel beim Häuserbau. Das Gerichtsgebäude und das
Lehrerseminar in Ortelsburg wurden mit Kalk, aus dem Rohmaner Brennöfen erbaut. Auch zum Bau einer Eisenbahnbrücke, auf
der, der Zug, den Sawitzfluß, von Ortelsburg nach Allenstein überquerte, hat mein Großvater, mit einem Ochsengespann,
Kalk gefahren.
Hinter der Scheune, beim Bauern Johann Dembek hat man Tonerde gefördert, aus der man mit Hilfe einer Formerscheibe,
die von einem Arbeiter mit Muskelkraft(Fußbetrieb) angetrieben wurde, schöne Krüge, Schalen und Vasen geformt hat.
Die Töpferware wurde, nachdem sie trocken genug war, auch in einem Ofen gebrannt, anschließend mit einer Lasur
überzogen und wieder gebrannt. Es wurden auch Kacheln zum Bau von Kachelöfen hergestellt, die mit verschiedenen
Ornamenten versehen, die Wohnstuben unserer Vorfahren schmückten. So haben unsere Großväter ihr Leben gemeistert und
nach und nach, unsere Dörfer aus der Rückständigkeit in die Neuzeit geführt.
Das gesellschaftliche Leben nach dem 1. Weltkrieg

Als der Lehrer Alfred Dorka, ein Frontkämpfer des Ersten Weltkrieges und ein Sportsmann, als
zweite Lehrkraft an der Rohmaner Schule angestellt wurde, hat er die Sitten und Gebräuche aus früherer Zeit wieder zum
Leben erweckt. Zuerst hat er die Jugend zusammen gerufen, einen Jugendverein und einen Fußballclub, gegründet. Zum
Vorsitzenden des Fußballclubs wurde Johann Gloddek berufen, der ihn auch geleitet hat. Bauer Wilhelm Spittka, der am
Rohmaner See wohnte, stellte Land für einen Sportplatz unentgeltlich zur Verfügung. Lehrer Alfred Dorka hat am
Rohmaner See eine Badestelle ausgesucht und ein Sprungbrett bauen lassen. An jedem Sonnabend im Sommer, bevor die
Sonne unterging, versammelte sich die gestammte Jugend des Dorfes an der Badestelle am See. Es wurde gebadet,
Heimatlieder gesungen, gespielt, im Fackelschein eines großen Biwakfeuers, bis in die späte Nacht hinein. Der Fischer
Karl Glitza hat uns Kähne zur Verfügung gestellt, mit denen wir auf den See hinausgepaddelt sind, dabei hatten wir viel
Spaß, was wiederum den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft gefördert hat. Ich habe mit meiner Mandoline den Gesang von
Volks- und Heimatliedern begleitet.
Der Rohmaner See liegt in einem Tal, dessen Hänge zu beiden Seiten mit Kiefern und Tannen bewaldet sind. Wenn man
gesungen oder Musiziert hat, hallte es von den Hängen zurück. Die Ufer waren mit Kalmus und Schilf bewachsen, was für
die Fischaufzucht von Vorteil war. Wenn man an einem sonnigen, windstillen Tag, am Seeufer spazieren ging, traf man
oft auf Flachstellen, an denen sich die Fischbrut im Sonnenlicht wärmte, wie ein Mückenschwarm. Im See befanden sich
folgende Fische: Karpfen, Hechte, Schleie, Barsche Plötze, Rotaugen, Aale und Krebse. Am Sonntagmorgen brachten viele
Rohmaner ihre Pferde zum See um sie zu baden.
Es wurden dort, unter der Aufsicht von Lehrer Dorka, auch viele Jugendfeste mit Theatervorführungen veranstaltet, zu
denen er selbst die Vorlagen organisiert hat. Der am See wohnende Bauer Johann Nadrowski, hat uns ein Scheunentor, als
Tanzboden zur Verfügung gestellt. Der Zimmermann Wilhelm Wittek hat uns eine Windmühle gebaut, die am auf dem Boden
liegenden Scheunentor aufgestellt wurde, dazu kamen Noch Tannen und Fichten, die das Ganze wie ein Bühnenbild
erscheinen ließen. Es wunden viele Bühnenstücke aufgeführt, unter anderen >Alte Weiber werden jung gemahlen<. Dazu bot
die Windmühle die entsprechende Kulisse.
Nach der Vorführung wurde der Boden aufgeräumt, um dann als Tanzdiele zur Verfügung zu stehen. Der Gastwirt Trzaska
hatte Tische und Bänke aufgestellt, Speisen und Getränke angeboten, so dass sich die die Veranstaltung bis in die
späte Nacht hinein zog. Es waren auch Leute aus Ortelsburg und anderen Nachbardörfern dabei. Im Winter hat Lehrer
Dorka eine Kreisrodelbahn eingerichtet, die von Zeit zu Zeit mit Wasser besprengt wurde, um die Gleitfähigkeit zu
verbessern. Von einer Anhöhe ging hinunter bis auf den halben See, was für alle ein großes Vergnügen war. Es kamen
Lehrer mit Schulklassen aus der näheren Umgebung um hier zu Rodeln.
Als Herr Lehrer Jobski als Hauptlehrer nach Rohmanen kam hat er mit dem Bürgermeister und der Gemeindeverwaltung
beschlossen, in der Nähe des Dorfes, auf einem zur Schule gehörenden Grundstück, einen Sportplatz anzulegen. Dafür
wurde gleich hinter den Gärten, 6 Morgen Ackerland abgetrennt, und nach Feierabend hat Lehrer Dorka mit den
Jugendlichen eingeebnet und gleich nebenan einen Graben für Schützenstand und Kugelfang ausgehoben. Am Sonntagvormittag
wurde Fußball gespielt und um 15:00 Uhr war Kleinkalieberschießen angesagt. Es musste auch ein kleiner Beitrag erhoben
werden, um Munition kaufen zu können. Eine Büchse konnten wir aus beim Kleinkalieberverein in Ortelsburg ausleihen.
Nach Hitlers Machtergreifung
Als Adolf Hitler an die Macht kam wurde die SA gegründet. Der Bürgermeister Michael Kownatzki
wurde zum Gruppenführer ernannt und folgende Männer haben sich freiwillig gemeldet: Wilhelm Matzey, Johann Gloddek,
Gustav Nadrowski, August Buttler, Karl Baran, Emil Nickel, Wilhelm Jaschinski, Emil Bork, Ernst Rattay und Gustav Bach.
Bei Versammlungen war die SA in Uniform angetreten um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Wer versucht hat Unruhe zu
stiften, egal aus welchem Grunde, wurde aufgefordert den Saal zu verlassen, andernfalls wurde er mit Gewalt entfernt.
Herr Lehrer Jobski wurde zum politischen Leiter ernannt, seine Frau hat die NS-Frauenschaft gegründet, Lehrer Dorka
die HJ, und so bekam die Dorfgemeinschaft, nach und nach ein anderes Gesicht. Der Sportplatz und der Schützenstand
wurden jetzt mehr als früher in den Mittelpunkt gestellt. Nach der Feldarbeit hat der Bürgermeister Fuhrwerke bestellt
und den Sportplatz noch besser herrichten lassen.
Der Bauer Wilhelm Both wurde zum Ortsbauernführer ernannt, mit der Aufgabe alles Land für den Anbau von Getreide und
Futtermittel bereitzustellen, oder wenn das nicht möglich war mit Wald aufzuforsten. Durch den Einsatz von Kunstdüngern
sollten größere Erträge aus dem Boden geholt werden, um den Viehbestand zu vergrößern und mehr Milch und Butter zu
produzieren. Deutschland sollte im Stande sein sich selbst zu selbst zu ernähren, ohne auf Importe angewiesen zu sein.
Frau Jobski hat, innerhalb der der NS-Frauenschaft, mit Hilfe von Fachkräften aus Ortelsburg, Lehrgänge veranstaltet,
auf denen man Backen und Nähen lernte. Auf den Bauernhöfen befand sich auch immer mehr Rassegeflügel, das eine erhöhte
Produktion von Eiern und Geflügelfleisch sicherstellen sollte.
Die Rohmaner Bauern hatten, außer in der Landwirtschaft, noch andere Verdienstmöglichkeiten in der Kreisstadt. In
Ortelsburg wurden vier Sägewerke betrieben, die mit Langholz aus dem Walde versorgt werden mussten. Wir haben eine
Kiefer von über 8 Festmeter angefahren, der wir zuerst 6 Meter Spitze abschneiden mussten, um diese Last überhaupt
auf den Wagen zu bekommen. Sechs Pferde musste angespannt werden um den Wagen zur befestigten Straße zu bringen.
Fichten und Tannen wuchsen bis zu einer Länge von 30 Metern. Auch beim Transport von Ziegel, von der Ziegelei zum
Bahnhof, konnte man gutes Geld verdienen.
Im Jahr 1934 wurde Rohmanen an das überregionale Stromnetz angeschlossen und schaffte auf diese Weise den Sprung von
der Petroleumlampe zur Glühbirne. Neben dem Grundstück von Karl Pietzonka wurde ein Transformatorhäuschen errichtet,
in dem der ankommende Strom von einer Hochspannung auf eine Verbrauchsspannung transformiert wurde. Es gab schon eine
Überlandleitung, die aus Richtung Ortelsburg kommend, quer über die Felder, in Richtung Neu Keykuth weiter ging.
Durch eine Zwischenspanne wurde der Transformator, mit der Hauptleitung auf Kownatzkis Feld verbunden.
Ein Stromanschluss konnte die Arbeit im Haus und Hof auf vielfältige Weise erleichtern, doch nur die besser gestellten
Bauern, sowie noch manche Pensionäre, die ein festes Einkommen hatten, konnten sich dass leisten. Weil nur wenige an
der Elektrifizierung teilnahmen, war ein Stromanschluss mit hohen Kosten verbunden. Nur Gustav Pietzonka, Gasthof
Trzaska, Friedrich Nickel, die Schule und Wilhelm Both, wurden in der ersten Phase erfasst.
Im Jahr 1952 wurde von den polnischen Behörden die zweite Stufe der Elektrifizierung eingeleitet, in der alle im Dorf
stehen Gebäude erfasst wurden. Am Anfang wurden nur Leitungen für Lichtstrom gelegt und auch nur 3 Lichtstellen pro
Haushalt bewilligt. Doch im nachfolgenden Zeitraum wurden dann, wenn Material vorhanden war, weitere Lichtpunkte
angelegt. 1952, am zweiten Wochenende im Advent, wurden dann die Leitungen geschaltet und alle waren von der
plötzlichen Helligkeit sehr begeistert. Wenn man Glühbirnen auswechseln wollte musste man am Anfang weite Wege
zurücklegen, um welche zu bekommen. In den 60ger Jahren wurden dann immer mehr Starkstromleitungen gelegt, weil die
Bauern elektrische Geräte kaufen konnten. Ende der 60ger wurden auch die Abbauten an das Stromnetz angeschlossen.
Das Urnengrab auf unserem Feld
Auf unserem Feld, in Richtung Seelonken, bin ich oft beim pflügen gegen Steine gestoßen, manchmal
rissen sogar die Stränge am Pferdegeschirr. Eines Tages nahm ich einen Spaten, Brechstange und einen langen Baum, um
der Sache auf den Grund zu gehen. Als ich eine Menge Sand ausgehoben hatte stieß ich auf eine steile, aus Steinen
errichtete Wand, die ich auch mit dem Baum nicht aus der Fassung bringen konnte. Ich habe den ganzen Vormittag gegraben,
konnte jedoch nicht unter die Steine kommen. Einige Tage später hatten wir in der Schule eine Bauernversammlung, da
habe ich Herrn Biella und Herrn Lehrer Dorka von meinem Fund berichtet. Am nächsten Morgen kam der Lehrer Dorka mit der
ganzen Schulklasse, mit Spaten und Sieben ausgerüstet auf unser Feld und fingen an die ausgehobene Erde zu sieben.
Lehrer Dorka benachrichtigte daraufhin den Leiter des Ortelsburger Heimatmuseums, der am nächsten Morgen vorbei kam um
sich die Fundstelle genau anzusehen. Er beauftragte ihn 4 Mann zu besorgen, um die Steine ringsum frei zu schaufeln.
Zwischen den Steinen durften wir die Erde nur mit Esslöffeln ausheben. Als es plötzlich zu regnen anfing hat Lehrer
Dorka die Brauerei Daum, in Ortelsburg angerufen, die uns über der Fundstelle ein Zelt errichtet haben, damit wir
ungestört weiterarbeiten konnten. Wir fanden 8 flache und 8 hohe Urnen zu beiden Seiten am Körper. Die Urnen wurden in
Gipsbinden eingewickelt und ins Heimatmuseum nach Ortelsburg gebracht, wo sie durch einen Fachmann, der extra aus einem
Königsberger Museum angereist war. Nach Reinigung der Urnen hat er festgestellt, das die Grabstätte etwa 2000 Jahre vor
Christi Geburt angelegt wurde und ein Doppelgrab war, in dem ein Toter liegend und einer in Hochstellung beigesetzt
wurde.
Die Nachricht von der Fundstelle verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Es erschienen viele Schaulustige, ganze
Schulklassen aus der Umgebung, mit Autos und zu Fuß. Durch die vielen Menschen wurden die bestellten Ackerflächen auf
unserem Feld sehr in Mitleidenschaft gezogen, eine Entschädigung haben wir nicht erhalten. Das Grab wurde vor dem
Heimatmuseum in Ortelsburg wieder so aufgebaut wie man es auf unserem Feld vorgefunden hat. Für den Transport der
Steine wurde ich entlohnt. Die Urnen hat das Königsberger Museum an sich genommen und wollte sie nicht wieder hergeben,
weil die solch einen Fund noch nicht in ihrer Sammlung hatten.
Sonnenwendfeuer
Am 24 Juni fand eine Sonnenwendfeier statt. Ein Brauch der an die alten Germanen erinnern sollte.
Der Lehrer Dorka hat den Bürgermeister beauftragt 2 Fuhrwerke in den Wald zu schicken, die Holz und alten Reisig holen
und auf dem großen Schulberg abladen sollten. Das Straßenbauamt hat uns Teertonnen zur Verfügung gestellt. Die ganze
Dorfgemeinschaft wurde eingeladen, am Abend, nach der Feldarbeit, an der Sonnenwendfeier teilzunehmen. Lehrer Dorka
hielt zuerst eine Ansprache, in der er anschaulich erklärte wie unsere Vorfahren in grauer Vorzeit gefeiert haben.
Nach dem offiziellen Teil wurden das Holz und die Teertonnen angezündet, es wurden Heimatlieder gesungen, wie: Wild
flutet der See, drauf schaukelt der Schiffer den schwankenden Kahn, Schaum wälzt er wie Schnee, von grausiger Mitte
zum Ufer heran, wild fluten die Wellen auf Vaterlands See, wie schön, oh trag mich auf Spiegel zu Hügel, Masovias See.
Masovia Land, mein Heimatland, Masovia es lebe mein Vaterland.
Lehrer Alfred Dorka und sein Wirken für Rohmanen.

Friedrich Biella hatte auf seinem Feld einen Granitstein mit einer geraden Seite, den haben wir
mit viel Schweiß an den Dorfteich transportiert und auf einer Erhöhung abgelegt. Der Stein sollte zum Denkmahl für die
Gefallenen des Ersten Weltkrieges umgestaltet werden. Da zu Wenige daran ein Interesse zeigten, wurde diese Idee fallen
gelassen und der Stein irgendwann ins Wasser gerollt. Der Lehrer Dorka war viele Jahre in Rohmanen tätig, dort hat er
später seine ehemalige Schülerin, Lotte Biella geheiratet. Er hat sich sehr für die Entwicklung des Dorfes interessiert,
war bei jeder Gemeindeversammlung anwesend und hat auf Schwachstellen hingewiesen die den Fortschritt behinderten.
Gemeinsam mit den Schülern hat er den Ehrenfriedhof für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges gepflegt, an der
Wegegablung nach Eichtal und zu Ehren des Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg eine Eiche gepflanzt.
Zum Advent hat Lehrer Dorka mit der Jugend einen Adventstern, in verschiedenen Farben gebastelt.
Der Stern wurde auf einer 2 Meter langen Stange befestigt, in der Mitte wurde ein Wachslicht angezündet, am Stern
wurde eine Schnur angebracht, wenn man daran zog rollte der Stern hin und her. Am ersten Wochenende im Advent
versammelten sich jung und alt, um den Stern durch das Dorf zu tragen. Alle schlossen sich dem vorausgehenden
Sternträger an, der den Stern durch die Hauptstraße und die angrenzenden Wege trug. Dieser Sternmarsch wurde an den
folgenden Adventwochenenden wiederholt.
Am ersten Weihnachtfeiertag wurde um 4:00 Uhr morgens ein Frühgottesdienst gehalten. Zuerst hat der Pfarrer eine
Andacht gehalten, dann haben die Kinder ein Krippenspiel aufgeführt und die Gemeinde hat schöne Weihnachtslieder
gesungen. Der Gastwirt Trzaska hat uns den Saal zur Verfügung gestellt. Wir hatten eine Posaunen- u. eine
Gitarrengruppe. Unter der Leitung von Herrn Willi Doormann spielten: Gottlieb Brosch, Fritz Ollech,
Gustav Rattay(Sopran), Wilhelm Pilath, Gustav Brosch(Alt), Fritz Both(Tenor) und Fritz Brosch(Bass).
In der Gitarrengruppe wirkten mit: Martha Ollech, Hedwig Ollech, Martha Lekzik, Martha Michalick und Auguste Lekzick.
Willy Doormann hat sie auf der Geige begleitet.
Kurz vor Ausbruch des 2. Weltkrieges
Bei der Aufstellung des Grenzschutzes(Regiment Buchholz), hat er als Hauptfeldwebel die
Gruppenführerkurse überwacht und selbst die fähigsten Männer dafür vorgeschlagen. Das Ausbildungspersonal hat das
Jäger-Battalion gestellt. Wir kamen zuerst ins Stadion(Waldheim), wurden da eingekleidet und dann ging es gleich
kasernenmäßig zu, theoretisch und praktisch. Jeder musste vor die Front treten und nachweisen ob er im Stande ist,
Befehle zu erteilen. Abends wurden Filme vorgeführt die uns zeigen sollten wie eine Gruppe sich im Gelände entfalten
muss. Die Exerziervorschriften hatten sich, im Verhältnis zu Kaiser Wilhelms Zeiten, etwas geändert. Damals bestand
eine Gruppe aus 8 Mann und einem Unteroffizier, jetzt aus 10 Schützen, 3 für das leichte Maschinengewehr und einem
Unteroffizier(13 Mann). Nach der Schulung folgte eine Abschlussprüfung, danach ein gemütliches Beisammensein. Aus
Rohmanen haben folgende Männer die Prüfung bestanden: Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy, Gustav Rattay und
Gustav Deptolla. Unsere Uniformen waren alle zu klein und es gab viel zu lachen bei der Anprobe.
Die erste Übung habe ich mit Emil Rosowski, in Lenzinen gemacht. Der Gutsbesitzer Marzinzick hat seine Scheune als
Unterkunft zur Verfügung gestellt. Er war im Range eines Hauptfeldwebels. In seinem haus war die Schreibstube
untergebracht, die er selbst verwaltete. Ein Lastauto hatte Uniformen aus der Kaserne in Ortelsburg geholt, jeder
musste eine Uniform anlegen und dann wurde solange getauscht bis alle eine passende gefunden hatten. An den Namen des
Kompanieführers kann ich mich nicht mehr erinnern. 1935 wurden wir zu einer Übung in die Dragonerkaserne nach Lyk
einberufen. Die Gruppenführer, Zugführer, und Kompanieführer die schon Frontberührung im dem Ersten Weltkrieg hatten,
mussten eine Woche früher anreisen. Die Übungen waren auf 6 Wochen angelegt. Die meisten der einberufenen waren noch
nie mit dem Wehrdienst in Berührung gekommen. Jeder Gruppenführer bekam 13 Mann zugeteilt.
Unser Zugführer war Leutnant Neumann, Kompanieführer Oberleutnant Rutschko, Battalions-Kommandeur Major Gröning
(Regiment Buchholz). Hier ging es wieder Kasernenmäßig voran. Das Bataillon wurde hier vereidigt. Jeden zweiten
Sonntag durften unsere Frauen uns besuchen. Ein Jahr später wurden wir wieder zu einer Übung einberufen, auf den
Truppenübungsplatz nach Arys. Jeder Gruppenführer hatte den Auftrag die Gruppe zu entfalten, und auf bewegliche
Figuren zu schießen. Diese Übung musste später mit scharfer Munition wiederholt werden. Jedes Maschinengewehr bekam
50 Schuss, jeder Schütze 20 Schuss zugeteilt. Nach dem Abschießen wurden die Treffer gezählt und dem Kommandierenden
Bericht erstattet. In einiger Entfernung spaziert ein Storch umher, der gar nicht bemerkt hatte dass geschossen wurde,
was bei den Kameraden ein großes Gelächter hervorrief.
Nach der Übung wurde uns gesagt das jeder Gruppenführer eine arische Abstammung nachweisen sollte. Ich konnte in den
Rheinsweiner Kirchenbüchern meine Vorfahren aus Gellen, bis zum Jahr 1732 zurück, nachweisen und wurde zum
Unteroffizier befördert. Aus unserem Dorf wurden auch, Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy und Gustav Deptolla
befördert. Zwischendurch mussten wir schon mal in die Radfahrer-Kaserne nach Ortelsburg, Gewehre empfangen und im
Gelände üben. Am 31 Juli 1939 wurde mir von einem Soldaten ein Schreiben übereicht, das mich aufforderte, am 1. August
um 6:00 Uhr, bei der 3. Kompanie, des 2. Infanterieregiments zu erscheinen.
Um 5:30 hat mich meine Schwester in die Kaserne gebracht. Auf der Schreibstube erklärte mir der Hauptfeldwebel,
dass mir ab sofort der Dienstgrad eines Sanitäters zugewiesen wird, ich mich in der Kammer einzukleiden hätte und mir
in der Handwerkerstube die entsprechenden Schulterklappen annähen lassen sollte. Die aktiven Sanitäter wurden den
Feldlazaretten zugewiesen und wir kamen an ihre Stelle. Unser Bataillon wurde nach Schodmak zum Bunker bauen und
Stacheldraht verlegen eingeteilt. Wir zogen in Begleitung einer Musikkapelle bis zur Kreuzung am Krankenhaus, dann
weiter zu unserem Bestimmungsort, gefolgt von einer Gulaschkanone die in den nächsten Tagen für unsere Verpflegung
sorgen sollte.
Am 14 August haben wir die Jägerkaserne, begleitet von einer Musikkapelle endgültig verlassen und zogen zuerst durch
Ortelsburg, dann über Lehmanen ins Feldmanöver, hinter Rohmanen. Dort entfaltete sich das Bataillon im Gelände, die
Verwundetensammelstelle wurde auf dem Hof des Bauern Friedrich Neumann eingerichtet. Gegen Abend wurde zu Sammeln
geblasen und Biwak bezogen, wobei unsere 3.Kompanie, in einem kleinen Wallt, in der Nähe von Otto Nickels Gehöft
Stellung bezogen hatte. Die 2. und 4. Kompanie hatte sich in der Nähe vom Abbau Pallasch niedergelassen. Die Frau
Nickel hat am Abend ein Mädel in Dorf geschickt um meiner Frau Bescheid zu sagen, wo wir uns zurzeit befinden. Meine
Frau ist dann noch gekommen um sich von mir zu verabschieden, weil wir am nächsten Morgen um 3:00 Uhr Zelte abbrechen
und um 4:00 Uhr in Richtung Kaspersguth marschieren sollten.
Wir sind dann über Achodden, Seelonken, Lehmanen, Ortelsburg, bis nach Grammen und Schützendorf marschiert, wo wir an
einem See Biwak bezogen haben. Es wurde immer gesagt, wir kommen zum Tannenberg-Denkmal bei Hohenstein, wo ein Reichs
Kriegervereinsfest stattfinden sollte. Es wurden auch schon Vorkommandos aufgestellt, doch dann kamen wir nach Orlau
und Lahna-Mühle, da wo die Alle entspringt haben wir 2 Tage biwakiert. Unser Kompanieführer hat uns nach Waplitz auf
den Soldatenfriedhof des Ersten Weltkrieges geführt und uns erklärt wie das Jägerbataillon sich 1914 hier entfaltet
hat und aufgerieben wurde. Dann mussten wir in der Nähe von Gut Koslau über einen Fluss und bezogen in einem Waldstück,
vorbereitete Stellungen in der Nähe der polnischen Grenze. Herr und Frau Thalmann haben uns jeden Tag, bis zur Grenze,
mit Brötchen und Getränken versorgt. Es wurde scharfe Munition ausgegeben, weil wir am nächsten Morgen um 4:00 Uhr die
polnische Grenze überschreiten sollten.
Am nächsten Morgen um 10 Minuten vor 4:00 Uhr kam der Befehl; scharfe Munition abgeben, alles zurück in ein 6 Kilometer
entferntes Dorf, wo wir auch einquartiert wurden. Das alles geschah’ eine Woche vor dem 1. September 1939. Es wurde
gesagt dass der Führer dem polnischen Präsidenten Rid-Szmigly, ein Ultimatum gestellt hat und es wahrscheinlich nicht
zum Krieg mit Polen kommt. Genau nach 5 Tagen kehrten wir wieder in die gleichen Stellungen zurück, es wurde wieder
scharfe Munition ausgegeben und am nächsten Morgen um 4:00 Uhr überschritten wir die polnische Grenze.
“Der 2. Weltkrieg.”
Der erste Einsatz in Polen
Wir kamen zuerst in ein Dorf in dem sich nur alte Menschen befanden. Auf unsere Frage wo denn die Bewohner wären sagte
man uns dass alle geflohen sind, weil erzählt wurde, die Deutschen würden alle Polen misshandeln und verstümmeln. Ich
habe ihnen daraufhin gesagt dass uns, unter Androhung von Strafe verboten wurde, einem Zivilisten etwas anzutun. Das
Vieh, die Schweine und Hunde des Dorfes liefen frei herum und die Soldaten fingen an auf die Hunde zu schießen, bis
gesagt wurde es seien Meldehunde im Dienste der Deutschen Wehrmacht und dieser Unfug der eigenen Truppe schaden würde,
weil etwaige Querschläger eigene Kameraden verletzen könnten. Wir gingen weiter auf polnischer Seite entlang der Grenze,
bis wir am Nachmittag die ersten Vorposten der Festung Mlawa erreichten, da befanden wir uns plötzlich im Feuerhagel
polnischer Festungsflack.
Am nächsten Morgen hatte ich schon 3 Verwundete und wusste nicht wo sich eine Verwundeten Sammelstelle befindet. Ich
suchte den Bataillonsgefechtstand auf der sich auf einer Anhöhe befand. Ich habe unseren Oberstabsarzt gefragt wo denn
die Verwundetensammelstelle wäre. Er rief beim Tross an, wo er die Auskunft erhielt, das sich vor dem Dorf ein Bunker
befindet in dem man die Verwundeten sammeln sollte, die dann von Sanitätsautos abgeholt würden, weil das Dorf unter
Artilleriebeschuss stand. Am Sonnabend haben unsere Flieger die Bunkerstellungen bombardiert, konnten aber, trotz guter
Treffer nicht viel ausrichten, die Bunker wurden nur etwas angekratzt.
Der Beschuss unserer vordersten Linien ging mit unverminderter Heftigkeit weiter. Am Sonntag verkündete eine große
Staubwolke die Ankunft unserer Panzer, doch sie kamen nur bis zur Panzersperre und mussten wieder abdrehen ohne den
Polen einen schaden zuzufügen. Ein Panzer bekam einen Volltreffer, der Fahrer konnte noch umkehren. Er blutete am Kopf
und der Schütze war so eingeklemmt, das wir ihn nur mit einem Seil unter den Armen, durch die Luke nach oben ziehen
konnten. Ob er seine Verwundung überlebt hat ist mir nicht bekannt, denn in der Nacht wurden Panzergeschütze nach
vorne in Stellung gebracht, die direkt in die Schießscharten der Bunker geschossen und so die Verteidiger vertrieben
haben. Daraufhin sind wir weiter vorgerückt. Auf einer Wiese war ein tiefer Graben ausgehoben und mit Ästen getarnt,
da war ein Panzer hinein gefahren, so dass nur das Hinterteil herausragte und er sich nicht aus eigner Kraft befreien
konnte. In der Luft waren Flieger die Brandbomben abwarfen, ich habe mich auf den Boden geworfen weil ich dachte die
würden explodieren, aber sie zischten nur, so das Stoppeln und Graß rings herum in Brand gerieten.
Bei den Kampfhandlungen gab es mehrere Verwundete, denen ich gerade Verbände anlegen wollte, als unser Hauptmann zur
Trillerpfeife griff um mir klar zu machen, dass ich ihm folgen sollte. Die Polen fingen an zu schreien, ich sollte
sie ins Lazarett bringen denn hier im Wald würde sie niemand finden. Ich setzte mich aufs Fahrrad und folgte unserem
Kompanieführer, der mir sagte ich soll immer bei der kämpfenden Truppe bleiben, denn hinter der Front sind die
Sanitätsabteilungen, die werden die Verwundeten schon versorgen. Der Vormarsch dauerte bis in die späte Nacht. Auf
einem Gehöft, das nach allen Seiten durch Feldwachen abgesichert wurde, machten wir endlich Rast. Wir haben
Getreidegarben auf dem Hof ausgebreitet und uns zur Ruhe gelegt, als plötzlich um Mitternacht Leuchtraketen den Himmel
erhellten und Maschinengewehrfeuer uns aus dem Schlaf schreckte. Ein par polnische Soldaten hatten das Feuer eröffnet,
aber sich kurz darauf ergeben.
Die Narew-Überquerung
Als es hell wurde ging der Vormarsch weiter. Es wurde uns untersagt Tagebuch zu führen, darum
weiß ich nicht wie die Orte hießen, durch die wir marschiert sind. Als wir durch ein sumpfiges Gelände vor drangen
stand auf einer Anhöhe am Horizont, die polnische Artillerie, die uns sofort unter Beschuss nahm. Unser Hauptmann war
der Meinung dass wir schon in der Nähe des Flusses Narew sein müssten, als aus den Sträuchern ein mit Schlauchboten
beladenes Lastauto auftauchte. Wir wurden aufgefordert mit je 6 Mann ein Schlauchboot zu nehmen, an einem Aggregat
der daneben stand mit Luft zu füllen und zu Wasser zu lassen. In einer Stunde war das ganze Bataillon über die Narew,
wo der Vormarsch fortgesetzt wurde. In einem Dorf überraschte uns die polnische Kavallerie und fing sofort mit
Maschinengewehren zu schießen an. Da kam der Befehl: Alles wieder zurück. Es ging noch schneller als auf der Hinfahrt.
Wir sind erst einige Kilometer am Fluss entlang gegangen und haben dann zum zweiten Mal rüber gesetzt.
Die Gehöfte im Dorf standen alle in Brand. Auf einem waren viele Bienestöcke. 2 Kameraden wollten den Stöcken Waben
entnehmen, doch die Bienen durch das Feuer aufgeschreckt, überfielen sie sofort und stachen derart zu das sie nicht
mehr wieder zu erkennen waren. Ich habe die Einstichstellen mit Salmiak betupft, mehr konnte ich nicht tun. Wir mussten
auf unserem Vormarsch durch einen Wald der in Flammen stand, so dass man kaum atmen konnte. Es ging weiter in Richtung
Minsk und Warschau, wo schon die Sowjetische Armee durchgegangen war, die Pferde und Vieh von einem Gut mitgenommen
hatten. In einem Wald stießen wir unverhofft auf ein Kloster, in dem wir einige Gefangene machten. Dann trafen wir auf
eine gute Straße die nach Grochow ging.
Als wir dort einmarschierten wurden wir aus den oberen Stockwerken beschossen, so dass wir, um uns zu schützen, nur an
den Hauswänden entlang gehen konnten. Wir haben jedes Haus nach Feinden durchsucht. Vor einem Haus stand ein Hund der
niemanden reinlassen wollte, solange bis ihn eine Kugel traf. Die polnische Artillerie feuerte von Warschau aus, um
unseren Vormarsch zu stoppen. Wir hatten uns gerade eingegraben als plötzlich deutsche Flieger am Himmel erschienen,
die unsere Stellungen mit Bomben bewarfen und dabei viel Unheil anrichteten. Wir haben sofort Fliegertücher
ausgebreitet und Leuchtraketen abgeschossen. Da ich in dem Graben, den ich kurz zuvor ausgehoben hatte, sofort in
Deckung gegangen bin ist mir zum Glück nichts passiert. Unter den anderen Kameraden gab es viele Verwundete, so dass
ich nicht wusste wem ich zuerst helfen sollte.
Der Oberstabsarzt hat mich sofort tatkräftig unterstützt, so das bald alle Verwundeten versorgt waren, außer einem,
dem ein Bombensplitter den Arm abgerissen hat. Ich habe im 3 große Verbandspäckchen auf die Wunde gelegt, doch die
Blutung ließ sich trotzdem nicht stoppen, so dass er eine Stunde später auf der Krankensammelstelle verstarb. Wir
haben danach in einem Tomatenfeld einen Graben ausgehoben und eine neue Abwehrstellung bezogen. Die Gruppe Schwarz
bekam den Auftrag nach etwaigen versprengten polnischen Verbänden Ausschau zu halten, als sie unerwartet aus einer
Häuserreihe mit Maschinengewehrsalven überschüttet wurden. Der Gruppenführer und noch ein Soldat wurden dabei tödlich
verwundet. Danach wurde noch ein weiter Stoßtrupp, unter der Führung von Leutnant Briskorn, der sich dazu freiwillig
gemeldet hatte, hinaus geschickt um den Gruppenführer und den anderen Toten zu bergen.
Bei diesem Unternehmen, das erfolglos ausging, weil die Toten schon verscharrt waren, durchschlug eine Kugel den
Stahlhelm von Leutnant Briskorn, der auch sofort tot war. Alle Toten wurden später, an der Kirchenmauer in Grochow, in
Särgen beigesetzt: Hauptmann Schönwald sagte, das sie nach dem Kriege auf den Heldenfriedhof nach Ortelsburg überführt
werden. Drei Tage lagen wir bei Grochow in Stellungen, waren dem polnischen Maschinengewehrfeuer sowie den Bomben
deutscher Flugzeuge ausgesetzt. In der Nacht musste ich zu einem Verwundeten in die vorderste Linie und habe den
Rückweg nicht mehr finden können, als plötzlich Gewehrfeuer aufflammte habe ich in den Ruinen Schutz gesucht. Erst im
Morgengrauen konnte ich mich wieder orientieren und zu meinem Unterstand zurückfinden.
Warschau wurde tagelang bombardiert und stand auch unter Artilleriebeschuss. Aus dunklen Rauchwolken kamen oft ganze
Bündel von Papier angeflogen. Die Verwundeten kamen oft auf Krücken zu unserem Unterstand, ich habe sie dann zur
Krankensammelstelle hingeführt. Wir haben auch polnische Zivilpersonen betreut, die während der Kampfhandlungen
verwundet wurden. Als einmal 2 Jungen vorbeiliefen hat einer ihnen nachgerufen sie sollten seiner Frau Bescheid sagen,
er wäre auf der Krankensammelstelle an der Kirche. Als wir dort ankamen war seine Frau, mit einem Kind auf dem Arm,
schon da.
Nach der Kapitulation von Warschau, gingen wir über Sokolow zum Bug und haben dort Quartier bezogen. Der Russe hatte
sich bereits hinter den Fluss zurückgezogen, hatte alles Vieh und Pferde mitgenommen. Dort erreichte mich ein Telegramm
von zu Hause, dass meine Tochter gestorben ist. Es sprach sich auch herum dass verschiedene Heimaturlaub bekommen haben,
ich durfte auch für 14 Tage heim. Wir fuhren mit Lastautos nach Allenstein in die neue Reiterkaserne, zum
Ersatzbatallion, da haben wir unsere Gewehre und Munition abgeben, dann durften wir, jeder in seinen Heimatort
weiterfahren.
Als wir unsere Quartiere am Bug verlassen haben war sehr viel Schnee gefallen. Hier in Ortelsburg fanden wir die
gleiche Wetterlage vor, aber nach 3 Tagen war alles wieder weggetaut und wir konnten die Kartoffelernte, die durch den
frühen Wintereinbruch gestoppt wurde, zu Ende bringen. Ein Tag bevor ich zu Hause angekommen bin wurde die Tochter
beerdigt. Nach 14 Tagen mussten wir uns in Allenstein melden, Gewehre empfangen und wieder zurück zur Division an den
Bug 150 Kilometer hinter Warschau. Die elfte Division, zu der wir auch gehörten sollte in den Westen Deutschlands
verlegt werden und war schon unterwegs zur Verladestation Skiernewice 50 Kilometer vor Warschau.
Mein Dienst als Sanitätsunteroffizier
Unser Bataillon kam in das Städtchen Burscheid, im Kreis Opladen, wo wir in Privatquartieren
untergebracht wurden. Nach 3 Monaten, im Januar 1940, wurden wir nach Solingen verlegt, wo wir bis zum
Frankreichfeldzug stationiert waren. Wir mussten an Feldübungen teilnehmen, wie andere die in Kasernen untergebracht
waren. Während dieser Zeit musste jeder seine Zähne in Ordnung bringen lassen. Jeden Tag fuhren 20 Mann in die
Cäzilienstraße nach Köln, zur Zahnklinik. Im Rheinland wurde unsere Division neu aufgestellt. Ausfälle durch den
Polenfeldzug wurden durch neue Soldaten ergänzt. Ich kam nun zum Ersatzbatallion, war der Älteste in der ganzen
Kompanie. Als der Frankreichfeldzug losging wurde unser Ersatzbatallion mit den noch vorhandenen Verwundeten, in die
neue Reiterkaserne, nach Allenstein verlegt.
Meine Frau hat, mit Unterstützung der Bauernschaft, einen Antrag gestellt, daraufhin wurde ich zur Frühjahrsbestellung,
beurlaubt und später bis auf weiteres vom Militärdienst freigestellt. Als der Russlandfeldzug losging wurde ich von der
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg, für 14 Tage einberufen. Ich war seit 1922, Mitglied der freiwilligen
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg und habe jedes Jahr an Übungen teilgenommen. Jede Bereitschaft musste etliche Leute
stellen. Von Rohmanen wurden Emil Rosowski, Johann Dembek, und ich, zur Krankensammelstelle Wirballen, in Litauen,
abkommandiert. Dorthin kamen Lazarettzüge aus Russland mit der Breitspurbahn. Die Verwundeten wurden frisch verbunden
und auf Waggon mit Normalspur verladen und nach Deutschland gebracht.
Als die 14 Tage vergangen waren wollten wir wieder nach Haus zurück, doch man wollte uns nicht entlassen. Stattdessen
wurden wir dem Wehrkreisamt Königsberg zugeteilt, neu eingekleidet und zur Aushilfe ins Lazarett nach Gumbinnen
abkommandiert. Mehr als ein Jahr war ich in den Urlauber-Baracken, habe dort Krankenstube betreut. Später, bis zum
Dezember 1944, war ich im Reserve-Lazarett 4, in Königsberg tätig. Dort habe ich auch die Luftangriffe der Engländer,
vom 25 bis 26. August 1944 miterlebt.
Wir sollten gerade einen Lazarettzug in Rotenstein entladen, als plötzlich die Sirenen ertönten - Fliegeralarm. Im
gleichen Moment waren die ersten Flugzeuge auch schon da, zuerst warfen sie „Tannenbäume” und danach Foßforkanister ab.
Die Omnibusse standen schon zur Abfahrt bereit als es losging. Wir haben die Verwundeten schnell in den
Luftschutzkeller getragen, haben die Betten von den Fenstern weggerückt damit die Verwundeten nicht von den
Glasssplittern verletzt wurden. Im Kasernenhof brannten die Fosforkanister lichterloh. Unsere Unterkunft, die sich in
einer Baracke befand ist völlig abgebrannt, mit dem Wenigen was wir unser Eigen nannten. Am nächsten Tag wurden wir neu
eingekleidet und am 29. bis 30. kamen die englischen Bomber wieder, sie setzten genau da ihr Zerstörungswerk fort wo
sie vor 3 Tagen aufgehört hatten.
Anfang Dezember 1944 musste ich mich nach Stablack melden und musste dann zur Sanitätsabteilung 1, nach Gernau, das
liegt zwischen Lodz und Warschau. Vormittags hatten wir Felddienstübungen und nachmittags theoretischen Unterricht.
Jeden Tag wurden Gruppen zusammengestellt und zu anderen Einheiten abkommandiert. Ich kam zu einer Panzerabteilung, wo
wir an einem Morgen plötzlich auf dem Kasernenhof antreten mussten und zu unserer Überraschung mit der Nachricht
konfrontiert wurden, dass der Russe an mehreren Frontabschnitten durchgebrochen war. Wir bekamen sofort einen
Marschbefehl in Richtung Lodz, wo das Stadtbild noch intakt war, selbst die Straßenbahnen fuhren noch. In der Nacht
haben russische Flugzeuge die Stadt bombardiert. Die Kaserne in der wir untergebracht waren hatte keine
Luftschutzkeller, aber zum Glück blieben wir von Bombentreffern verschont. Am nächsten morgen bot sich uns ein Bild der
Verwüstung. Die entgleisten Straßenbahnwagen, sowie andere Fahrzeuge blockierten die Straßen. Die Älteren unter uns
bekamen Fahrscheine für einen Transportzug, der bereit hinter Lodz abfahrbereit, unter Dampf stehen sollte. Als
russische Panzer in den Straßen auftauchten, verbrannte die Schreibstube unsere Wehrpässe und andere wichtige
Dokumente. Wir liefen zu der Station auf der unser Transportzug bereitstehen sollte, aber da war kein Zug mehr zu sehen
und wir setzten unseren Rückzug zu Fuß fort.
Der Rückzug und Zusammenbruch der Ostfront
In Dobroschin, einer Stadt in Polen, wurde gerade ein Lazarettzug verladen, doch wir kamen nicht
mehr zum Einsatz, weil die russische Infanterie uns schon auf den Fersen war. Es ging weiter über den Fluss Bober,
Sagan, bis nach Glogau an der Oder. Dort wurden wir der 29. motorisierten Sanitätskompanie zugeteilt. Im
Garnisonslazarett wurden noch Operationen durchgeführt. Unsere Division hatte ihr eigenes Feldlazarett, so dass wir den
Befehl zu Weiterfahrt erhielten und noch unbeschadet die Oderbrücke passieren konnten, denn Glogau wurde zur Festung
erklärt. Wir haben 2 Pferdewagen organisiert und mit Verbänden, sowie medizinischen Instrumenten beladen. So kamen wir
bis nach Lübbenau im Spreewald, wo wir in einem Schloss, in zuvor ein Museum war, unser Lazarett untergebracht haben.
Weil die Amerikaner Cottbus bombardiert hatten, wurden die Verwundeten zu uns nach Lübbenau gebracht. Hier haben wir
Tag und Nacht gearbeitet, um die vielen Verwundeten, aus den schweren Kämpfen bei Grünberg und Sagan zu versorgen. Die
Soldaten von der Abwehrfront kamen schon mit abgestorbenen Armen oder Beinen bei uns an, weil in vorderster Linie keine
Frontlazarette mehr vorhanden waren; es mussten viele Amputationen durchgeführt werden. Als für unsere Pferde kein Heu
mehr vorhanden war, schickte mich unser Hauptfeldwebel, zu einem Bauern in den Spreewald, mit dem Auftrag, Futter zu
besorgen. Mit noch zwei Mann fuhren mit zwei Kähnen, zuerst den Hauptstrom entlang und dann in einen Nebenarm; da haben
wir die Boote beladen und brachten das Heu nach Lübbenau.
Als wir uns bei unser Einheit zurück melden wollten, war alles schon marschbereit. Ich bin schnell in einen Bus
eingestiegen der sofort losfuhr, weil russische Verbände schon in sichtweite waren. Russische Flugzeuge kreisten über
den Dächern und nahmen, mit ihren Bordwaffen jeden unter Beschuss, der sich irgendwo blicken ließ. Wir konnten nur
durch den Wald, oder in der Nacht vorwärts kommen, denn wenn ein Auto auf der Landstraße fuhr, war alsbald ein Flugzeug
hinter ihm her und schoss es in Brand. Als wir nach Tagen am Ufer der Elbe ankamen, war bereits eine Ponton-Brücke
erstellt worden, welche die zerstörte Brücke ersetzen sollte.
Durch die vielen Fahrzeuge waren in den Sand tiefe Spuren gefahren, so dass andere Fahrzeuge unsere Busse ins
Schlepptau nehmen mussten, weil wir mit eigener Kraft nicht mehr weiterkamen. Beiderseits der Trasse standen
Flüchtlingswagen, in der der Hoffnung die Brücke passieren zu können, doch SS-Polizei verhinderte das die Gespanne den
militärischen Rückzug zum Stillstand brachten. Es gelang uns die Elbe zu überqueren, um in einem Waldstück Schutz vor
feindlichen Fliegern zu suchen.
Als wir unsere Busse und Autos gut getarnt hatten, hat unser Bataillonschef die anwesenden Parteigrößen zu sich
gerufen und ihnen erklärt das wir eine Einheit des Roten Kreuzes sind und nach internationalem Recht keine Waffen
besitzen dürfen. Nach langer, erregter Diskussion wurde beschlossen einen Graben auszuheben und alles im Sand zu
verscharren. Als wir dann weiter, durch die Dörfer fuhren, sahen wir schon viele weiße Bettlaken, als Zeichen der
Kapitulation, aus den Fenstern hängen. Es wurde uns erzählt dass der Bürgermeister von der SS erschossen wurde, weil
er die Bevölkerung zu diesem Schritt ermutigt hatte. Jetzt waren hinter uns die Russen und vor uns schon die Amerikaner.
Amerikanische Panzer fuhren umher und schossen wild durch die Gegend, ohne ein Ziel anzuvisieren. Niemand wollte sich
dem Russen ergeben, doch der Weg der zu den Amerikanern führte, war durch abgesägte Bäume blockiert. Wir sind schnell
in das nächste Dorf gegangen, haben uns Sägen und Äxte besorgt, die Bäume durchgesägt und in den Straßengraben
geworfen.
“ Nach dem Ende des 2. Weltkrieges.”
In amerikanische Kriegsgefangenschaft
Dann fuhren wir unter internationaler Flagge an eine Mulde Brücke, vor der zwei amerikanische Soldaten, mit Zigarren,
zur Hälfte im Mund, standen. Sie rauchten und kauten gleichzeitig. Wir mussten auf einen freien Platz fahren, alle
aussteigen und rechts wieder antreten. Wäschebeutel und Tornister mussten wir abstellen; danach wurden wir nach Waffen
durchsucht, Wertsachen, Uhren und Messer wurden uns gleich abgenommen. Als wir anschließend an unserem Gepäck
vorbeigingen durfte niemand was mitnehmen. Als ich gebückt, nach meinem Wäschebeutel greifen wollte, in dem sich noch
3 Konservendosen und ein Brot befanden, bekam ich einen Fußtritt ins Gesicht, so dass mir ein Zahn ausgeschlagen wurde.
Wir wurden dann in einem Garten zusammen getrieben und gefragt ob jemand bei der SS gedient hat. Nachdem wir in Reihe
und Glied angetreten waren, mussten wir den Oberkörper freimachen und die Arme anheben. Es wurde nach SS-Zeichen
gesucht, die gewöhnlich unter dem Oberarm eintätowiert waren. Nachdem wir Grimma bei Leipzig, wo wir in amerikanische
Gefangenschaft geraten waren, verlassen hatten, mussten wir durch ganz Thüringen bis Hersfeld, an der Grenze zu Hessen,
marschieren. In Hersfeld wurden wir auf große Lastautos verladen, die von farbigen Soldaten gefahren wurden. Man hat
uns mit Stöcken hinauf getrieben, solange bis das Auto so voll war das man kaum stehen konnte. Die Soldaten fuhren, für
diese Straßenverhältnisse, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Wenn die Straße eine scharfe Kurve hatte, flogen
wir alle übereinander und mussten erst mit viel Kraftanstrengung auf die Beine kommen um diese Fahrt zu überstehen.
Da die Straßenränder in dieser Gegend mit Obstbäumen bepflanzt sind und deren Äste sehr niedrig hängen, hätten die
uns die Köpfe abgerissen, wenn wir uns nicht ständig geduckt hätten. Unsere Fahrt endete in Bad Kreuznach, in der Pfalz,
wo wir in ein Lager, in dem sich später 130.000 Mann und 6 Generäle befanden, eingepfercht wurden. Die Unterkunft der
Generäle befand sich unter einem Zelt, alle anderen mussten die Zeit unter freiem Himmel zubringen. Die Offiziere, die
Unteroffiziere, die Mannschaften; wurden in getrennten Camps untergebracht. Die Mannschaften wurden auch zur Arbeit
abkommandiert und konnten bei dieser Gelegenheit, Brot, Brötchen oder Zigarettenstummel organisieren, wogegen die
Offiziere und Unteroffiziere ihr Camp überhaupt nicht verlassen durften.
Die ersten Tage gab es kein Wasser und kein Brot, so dass die Kameraden vor Erschöpfung umfielen. Später standen wir
manchmal den ganzen Tag nach Wasser an, das von den, uns bewachenden Negern mit großen Wassertanks angefahren wurde. Am
dritten Tag bekamen wir mittags und abends etwas zu Essen; Brot bekamen wir erst nach zwei Wochen, nach dem aus der
Umgebung herbeigeholte Handwerker, Backöfen gebaut hatten. In den verschiedenen Gemeinden, die in den uns umgebenden
Weinbergen lagen, mussten sich alle Männer beim Bürgermeister melden. Als sie dann erschienen waren, wurden sie auf
bereitstehende Lastautos getrieben und zu uns ins Lager gebracht. Sie waren ohne Kopfbedeckung und ohne wärmere
Bekleidung angekommen, weil ihnen gesagt wurde, dass ihr Aufenthalt im Lager nur von kurzer Dauer sein würde. Man hat
uns, falls noch vorhanden, Decken und Mäntel abgenommen, mit der Begründung, sie würden für Kranke und Verwundete
gebraucht. Jeden Tag starben mehr als 200 Mann, die wir sofort in ein Zelt tragen mussten. In der Nacht wurden die
Toten dann mit unbekanntem Ziel, weggefahren.
Viele haben ihren Verstand verloren uns irrten im ganzen Camp ziellos umher. Als Latrinen wurden Gräben ausgehoben, in
die verschiedene Kameraden, bei der Verrichtung ihrer Notdurft, vor Schwäche hineingefallen sind und nicht mehr wieder
heraus kamen. Aus den Pfählen die, die jungen Obstbäume stützten, haben wir Krankentragen gebaut um unsere Kameraden,
bei Bedarf, zur Krankensammelstelle zu tragen. Es war in diesem Frühjahr auch sehr kalt, doch unsere Erdlöcher, die wir
zum Schutz vor Kälte und Wind, nur mit leeren Konservendosen ausgehoben hatten, durften nicht tiefer als 20 Zentimeter
sein. Nach jedem Regenguss mussten wir das Wasser ausschöpfen. Nach einem Gewitter, standen wir wiedermal, total
durchnässt in unserem Camp, als unerwartet am Horizont die Sonne hervortrat. Einer unserer Kameraden hatte noch eine
Trompete gerettet und fing, von dem Anblick völlig überwältigt, zu spielen an: "Es geht alles vorüber, es geht alles
vorbei, nach jedem Dezember, folgt wieder ein Mai". Daraufhin hob sich die Stimmung der tiefbetrübten Kriegsgefangenen,
so das Heimatlieder durch das ganze Camp erklangen, obwohl wir in den nassen Kleider herumgehen mussten, bis sie am
Körper trocken wurden.
In französischer Kriegsgefangenschaft
Nach etwa einem Monat, haben uns die Amerikaner, den Franzosen, zum Arbeitseinsatz, ausgeliefert.
Etwa 4 Kilometer von Bad Kreuznach entfernt, stand auf freier Strecke, ein Zug mit offenen Kohlenloren, auf den wir
verladen wurden. In jeden Waggon, wurde pro Person eine Tafel Schokolade und ein Päcken Zwieback rein geworfen, doch
viele Kameraden fanden nur leere Päckchen vor, weil die schon zuvor von der französischen Wachmannschaft geplündert
wurden. Wir haben uns darüber beschwert, doch die haben uns nur ausgelacht. Nachdem wir zunächst bei Mainz über den
Rhein fuhren, endete unsere Fahrt bei Paris in einem großen Zeltlager. Dort wurden wir auf andere Züge verladen, die uns
nach Südfrankreich, in ein Barackenlager, bei Mazarei, brachten.
Auf einer Zwischenstation hat man uns unter einer Pumpe, die Lokomotiven mit Wasser versorgt, abgestellt, den Kran
aufgedreht und uns anschließend ausgelacht, die Kinder Haben uns mit Steinen beworfen. Ein Wachmann kam in unseren
Waggon gekommen, hat unser Gepäck durchsucht, wenn er Tabak oder Zigaretten gefunden hat, nahm er sie mit. Die Kameraden
waren darüber so empört, dass sie vorhatten, ihn nachts unter den Waggon zu werfen. Wir haben sie gebeten dass zu
unterlassen, weil man uns in diesem Falle, alle erschießen würde.
Als wir ins Lager kamen wurden wir zuerst gezählt, dann mussten wir unser Gepäck stehen lassen und beiseite treten.
Wenn man bei der Nachkontrolle noch was in den Taschen fand, wurde das auch entwendet, selbst Esslöffel. Wir wurden
dann in drei Baracken, ohne Toiletten, eingeschlossen. Die Kameraden haben ihre Bedürfnisse in Kochgeschirre erledigt
und durch ein kleines Fenster, das sich fast unter der Decke befand, hinausgeworfen. Andere Fenster ließen sich nicht
öffnen, weil sie mit Stacheldraht zu geflochten waren. Als die Kameraden die Kochgeschirre auskippten, haben die
Wachposten geschossen und die Fenster zertrümmert. Sie waren der Meinung dass wir ausbrechen wollten. Es herrschte eine
große Hitze, in den überfüllten Baracken sind wir fast erstickt. Am nächsten Tag haben wir uns über fehlende Toilettem
beschwert, da haben sie Heringsfässer durch die Hälfte geschnitten und an der Ausgangstür hingestellt. Um bei den
überfüllten Räumen dort hinzukommen, musste man über die Köpfe der Anderen steigen. Viele hatten Fieber und Durchfall
und mussten in die Krankenstube eingeliefert werden, wo sie kurz darauf verstarben.
Besonders Raucher litten sehr an der Unterernährung, bekamen Wasser in den Beinen und waren die Ersten die verstarben.
Nach der Registrierung wurden wir auf andere Baracken verteilt. Die Zivilbevölkerung kam in die Räume und begann uns
auszuplündern. Wer noch gute Schuhe besaß musste sie ausziehen und bekam dafür die kaputten des Plünderers. Eine Woche
lang mussten wir diesen Zustand ertragen, erst als die Kameraden sich beschwerten, wurde am Eingang eine Tafel am
Eingang angebracht, dass die Zivilbevölkerung das Lager nicht betreten darf. Bis auf einige, wenige Ausnahmen wurde
diese Anweisung befolgt.
Als wir im Lager ankamen, war der französische Lagerkommandant, ein ehemaliger Kriegsgefangener, der bei einem Bauern
in Deutschland gearbeitet hatte. Dieser Bauer war jetzt als Kriegsgefangener in seinem Lager. Als er ihn erkannte, hat
er ihn gleich zum Küchendienst eingeteilt und mit dem nächsten Krankentransport nach Hause fahren lassen. Zu Mittag
bekamen wir nur gekochte Haferkörner, da schwamm alles oben, später war man dann auf Gerste umgestiegen. Als viele
daran gestorben waren, weil sie diese „Rohkost”, die nur ein Kuhmagen verträgt, nicht gegessen haben, hat man die
Körner durch eine Schrotmühle laufen lassen. Dann hat man uns Steckrüben gekocht; wir bekamen 250 Gramm Weißbrot,
etwas Quark und ein viertel Liter Magermilch. Später, als wir schon arbeiten mussten, hat man in unserem Essen einen
Kuhkopf mitgekocht, das hat dann bedeutend besser geschmeckt.
Bevor wir morgens zur Arbeit gingen, mussten wir zu Flaggenparade und abends, nach der Rückkehr, haben wir die Flagge
wieder eingeholt. Wir haben einen Kanal gereinigt, dessen Sohle 2 Meter dick mit Schlamm bedeckt war. Zuerst wurde das
Wasser abgelassen, dann haben wir, einer dem andern, den Schlamm mit der Schippe hoch gereicht. Der Letzte hat den
Schlamm, der so zäh war, dass er nicht von der Schippe wollte, oben am Rande abgelegt. Manchmal waren 10 Mann nötig um
den Höhenunterschied zu überwinden. Das Wachpersonal schoss über unsere Köpfe hinweg und rief: „schnell arbeiten”. Bei
der großen Hitze war das ein Ding der Unmöglichkeit, zumal es nichts zu Trinken gab. Auf dem Heimweg haben wir im Walde
Heilkräuter gesammelt, die man in der Küche getrocknet und als Tee zubereitet hat, den wir am nächsten tag zur Arbeit
mitnahmen, um unseren Durst zu stillen.
Unser Aufseher hatte einen Stock, an dem sich noch kurz abgeschnittene Äste befanden. Wer seiner Meinung nach, nicht
ordentlich gearbeitet hat, bekam gleich Schläge auf den Rücken. Die weißen Aufseher wurden irgendwann durch Neger
ersetzt, die uns bedeutend besser behandelt haben. Wenn irgendetwas schief ging, haben sie nichts gesagt, nur gelacht.
In den übrig gebliebenen Wassertümpeln hatten sich noch einige Aale versteckt, die wir zu fangen versuchten, was uns
auch manchmal gelang. Wir mussten ihnen das Genick brechen, damit sie uns nicht entwischen konnten. Wenn die Franzosen
bemerkten das wir Aale hatten, wurden sie uns abgenommen. Gelang es uns aber, sie ins Lager zu bringen, dann haben wir
uns eine köstliche Malzeit zubereitet.
Um sicherzustellen dass niemand geflüchtet ist, wurden wir, wenn wir abends ins Lager zurückkamen, zuerst gezählt.
Diese Zählung wurde mehrmals wiederholt, weil die Wachmannschaften sich immer wieder verzählt haben. Als einer von uns
hin ging, ihnen sagte dass alle da sind, wollten sie es nicht glauben und haben uns vor dem stehen lassen, bis es ihnen
irgendwann einfiel. uns doch das Tor zuöffnen. Einmal, als wir von der Arbeit zurückgekehrt waren, standen wir bis 23
Uhr neben der Flagge, weil uns niemand das Tor geöffnet hat. Als wir dann doch irgendwie ins Lager kamen haben wir
festgestellt, dass das ganze Wachpersonal betrunken war und niemand im Stande uns das Tor zu öffnen.
Eines Tages waren wir wieder abends zur Parole angetreten, als ein älterer Herr mit seinem Hund, am Stacheldraht
entlang, spazieren ging. Weil der Hund, unterm Stacheldraht hindurch, zu uns kam, hat ihn einer geschnappt, ihm das
Genick gebrochen und unter seiner Jacke versteckt. Der Franzose hat nach seinem Hund gerufen und gepfiffen, aber alles
vergebens, der Hund war nicht aufzufinden. Die Kameraden haben ihm gleich das Fell über die Ohren gezogen, das Fleisch
gekocht und das Fell in die Latrine geworfen. Das Fleisch wurde umgehend verspeist.
Als wir am nächsten Tag von der Arbeit zurückkehrten, war im Lager der Teufel los. Wir mussten sofort antreten und
wurden gefragt, wo der Hund geblieben ist, der Gestern Abend, mit seinem Herrchen, am Zaun entlang spazieren ging. Als
sich niemand dazu bekannte, mussten wir weiterhin stehen bleiben, während die Wachmannschaften von Baracke zu Baracke
gingen und alles durchsuchten. In einer Latrine hat man dann das Fell gefunden, was uns ein furchtbares „Donnerwetter”
einbrachte und in den nächsten Tagen, nach der Arbeit, unter dem Kommando eines Oberfeldwebels, eine Stunde
nachexerzieren.
In Südfrankreich regnet es den ganzen Sommer nicht; die Bauern haben da keine Scheunen und das Getreide wir nur in
Schobern aufgestellt und dann umgehend gedroschen. Vom Oktober bis Dezember regnete es fasst jeden Tag in Strömen.
Gesät wird nur im Frühjahr und im Herbst, weil im Sommer alles vertrocknet. Es wird viel Wein angebaut und die
Steckrübe wächst den ganzen Winter. Neben den Weinreben wurde aus Schieferplatten ein Zaun aufgestellt, um dem Wein
einen optimalen Standort zu sichern. Die Bauernwagen hatten nur zwei Räder und waren nur mit einem Pferd bespannt, das
die ganze Balance des Wagens zu halten hatte. Trotzdem haben sie soviel aufgeladen wie wir auf einen Leiterwagen. Viele
Kameraden wurden den Bauern zur Arbeit ausgeliehen. Wenn ein Bauer einen Arbeiter gebraucht hat und es wurde gefragt,
wer sich in der Landwirtschaft auskennt, da haben sich alle gemeldet. Der Bauer konnte sich dann aussuchen, wen er
mitnehmen wollte.
Wenn wir durch die Stadt zur Arbeit gingen, haben verschiedene Leute Fallobst in die Abfalleimer gelegt. Wenn das von
den Kameraden bemerkt wurde, schwenkten viele aus der Reihe, um sich etwas mit zunehmen, was von den Wachmannschaften
nicht gern gesehen wurde. Viele Kriegsgefangene hatten keine Schuhe mehr, sie haben die Füße nur mit Lumpen bewickelt.
Eines Tages kamen Kameraden aus Norwegen, die nach Deutschland entlassen werden sollten. Mann hat sie jedoch ins Lager
gesteckt und zur Arbeit eingeteilt. In Norwegen hatten sie Kleider und Stoffe eingekauft, hatten volle Seesäcke und
sogar Karren auf 2 Rädern, weil sie ja in die Heimat entlassen werden sollten. Als wir morgens zur Arbeit rausgeführt
wurden standen sie schon vor dem Lager. Wir haben ihnen zugerufen, dass sie uns etwas abgeben sollen, weil ihnen ja
sowieso alles abgenommen wird, aber sie haben uns nur ausgelacht. Als sie ins Lager Kamen mussten sie ihr Gepäck
ablegen, wurden dann wo anders hingeführt und haben es danach nie wieder gesehen.
Durch die vielen Läuse, Flöhe und Wanzen die wie im Lager hatten, kam es bei verschieden Kameraden, an den
Einstichstellen, zu eiternden Entzündungen. Um dem vorzubeugen hat man uns mit einem Pulver, das in Frankreich
hergestellt wurde, aber bei den Parasiten keine Wirkung zeigte, eingesprüht. Erst bei der Anwendung eines Mittels
amerikanischer Herkunft, war alles über Nacht verschwunden.
Der Sonntag war arbeitsfrei. Dann kam ein katholischer, französischer Pfarrer, eskortiert von 3 Mann, mit
aufgepflanztem Seitengewehr ins Lager und hat Gottesdienst gehalten. Einen evangelischen Pfarrer gab es nicht, nur
einen Baptisten Prediger. Der wurde würdevoll eingekleidet, bekam ein großes Kreuz und hat jeden Sonntag in einer
extra dafür hergerichteten Baracke Gottesdienst gehalten. Wer Theologie studiert hatte und sich meldete, wurde zu
einem Seminar geschickt und konnte sein Studium fortsetzen. Glasbläser durften das Lager auch verlassen und ihrem
erlernten Beruf wieder arbeiten.
Wer sich freiwillig, für 5 Jahre, zum Dienst in der Fremdenlegion verpflichtet hat, das waren etliche unter uns, wurde
neu eingekleidet, bekam gutes Essen und Rauchwaren soviel er wollte. Nach einem Jahr wurden, nach und nach, die
Kranken und Körperbehinderten in die Sowjetische Besatzungszone entlassen. Eine Entlassung von Kriegsgefangenen, die
in den Westzonen oder jenseits von Oder und Neise zu Hause waren, war nicht vorgesehen. Die Österreicher wurden alle,
unabhängig von ihrem Gesundheitszustand entlassen.
Ich habe Briefe nach Hause geschrieben, aber die kamen nur bis Allenstein und wurden wieder zurück geschickt. Als eine
Kommission des Roten Kreuzes aus der Schweiz unser Lager besichtigt hat, haben wir uns beschwert, das wir als
Sanitätsdienstgrade, zur Arbeit gehen müssen. Daraufhin erging ein Befehl: Wer einen vom Roten Kreuz, ausgestellten
Ausweis besitzt, gehört einem internationalen Verband an und braucht nicht zu Arbeit gehen. Aus unserem Lager hatten
sich 20 Mann gemeldet, die daraufhin Freigang, in Begleitung von zwei französischen Wachsoldaten erhielten. Als wir
gefragt wurden wo wir hin wollen, entschlossen wir uns, einen Soldatenfriedhof, auf dem unsere verstorbenen Kameraden
beerdigt waren, zu besuchen.
Da der Untergrund in dieser Gegend aus Felsen bestand, wurden die Gräben, in denen die Toten in selbst gezimmerten
Kisten nebeneinander gestellt wurden, mit Hilfe von Dynamit ausgehoben. Ein Leichenwagen, mit einem Pferd bespannt,
das mit einer schwarzen Decke abgedeckt war, wurde von einem Kutscher in angemessener Kleidung, gefahren. Der Wagen
konnte gleichzeitig 4 Kisten transportieren. Wenn wir von der Arbeit kommend, dem Leichenwagen begegneten, wurde
gehalten und mit einer Schweigeminute der Toten gedacht, bis der Wagen vorbei war. Die Zivilbevölkerung verharrte auch
im Schweigen, mit abgenommener Kopfbedeckung.
Ein Kamerad, der in Krottorf, Kreis Oschersleben, bei Magdeburg, zuhause war, sagte bei seiner Entlassung zu mir:
Sollte ich das Glück haben, meine Entlassungspapiere zu erhalten ohne eine Bleibe vorzuweisen, dann soll ich Krottorf
als Heimatadresse angeben. Auf der Krankenstube habe ich angegeben, dass sich noch ein Schrapnellsplitter, aus dem
Ersten Weltkrieg, in meiner Kreuzbeingegend befindet, er zwar verkapselt ist, aber immer noch Beschwerden verursacht.
Daraufhin wurde ich zur Entlassung vornotiert. Als bekannt wurde das ein Rückkehrertransport in die sowjetische
Besatzungszone zusammengestellt wird, habe ich mich sofort gemeldet und wurde für ein Entlassungslager in Angoleme
vorgesehen. War das eine Freude, als uns mitgeteilt wurde, wann der Rücktransport stattfindet.
In unserem Lager waren noch 2 Kameraden aus dem Kreis Ortelsburg: Ein Gustav Lumma aus Leynau und ein Alfred Moritz
aus Groß Schöndamerau. Sie mussten noch zurückbleiben und haben mir den Auftrag erteil, die Angehörigen in der Heimat
zu grüßen und ihnen die Anschrift mitzuteilen. Als wir im Entlassungslager ankamen, fragte man uns nach unserer
Heimatanschrift. Dann wurden die Entlassungspapiere angefertigt. Es wurde uns auch ein Barscheck, für die in Frankreich
geleistete Arbeit ausgehändigt, den wir bei jeder Kasse in Deutschland einlösen könnten. Ich habe ihn bis zum heutigen
Tage nicht einlösen können, obwohl ich irgendwann in der Zeitung gelesen habe, das Verrechnungschecks die den aus
französischer Kriegsgefangenschaft Entlassenen, ausgehändigt wurden, einzulösen sind.
Wir kamen zuerst nach Saar Elbe, dann in die Nähe der Zonengrenze zu Thüringen. Hier mussten wir 2 Tage warten, weil
aus der sowjetischen Besatzungszone keine Eisenbahnwagen bereitgestellt wurden. Angesichts dessen, das der Russe beim
letzten Transport die aus Frankreich kommenden Wagen kassiert und nicht mehr herausgeben wollte, bestand der Franzose
jetzt darauf, seine Wagen sofort wieder mitzunehmen. Als der sehnsüchtig erwartete Zug endlich eintraf, durften wir
umsteigen und kamen, immer noch hinter Stacheldraht, nach Erfurt. Von dort weiter ins Quarantänelager nach Prätsch an
der Elbe.
Unter Androhung von Strafe war es verboten das Lager zu verlassen, doch der Hunger zwang uns dazu, in den umliegenden
Dörfern um Lebensmittel zu betteln. Man drohte uns damit, dass Zuwiderhandlungen, mit einer 14-tägigen Verlängerung der
Quarantäne geahndet werden. Der Roggen war schon reif und wir haben, auf den umliegenden Feldern, die Ähren abgerissen,
das Korn, zwischen 2 Steinen zu Mehl zerrieben, um daraus eine Suppe zu kochen, denn von dem was unsere Lagerküche uns
bieten konnte, war es nicht möglich zu überleben. Als der Eigentümer bemerkte wer seine Roggenähren entwendet hat, kam
er ins Lager, gerade zu dem Zeitpunkt als wir mit dem Mahlen beschäftigt waren. Der Lagerkommandant, bei dem er sich
beschwerte, drohte uns zu bestrafen, wenn wir unsere „Rauzüge” nicht unmittelbar einstellen würden. Wir sagten ihm er
solle uns heimfahren lassen, da wir doch lange genug hinter Stacheldraht gesessen hätten.
Endlich wieder in Freiheit
14 Tage nach unserer Ankunft wurden uns Entlassungspapiere ausgehändigt, sowie auch Fahrscheine
zum den, von uns angegeben Heimatorten. So kam ich nach Krottof, Kreis Oschersleben, zu meinem ehemaligen
Kriegskameraden, bei dem ich einen Tag geblieben bin. Er hatte mir schon eine Stelle bei einem Bauern besorgt, der 70
Jahre alt und kinderlos war. Zum Hof, den er mit seiner Ehefrau bewirtschaftet hat, gehörten 36 Morgen Land, 2 Ochsen
und 3 Kühe. Das Ackerland bestand aus 17 Parzellen und sicherte mir einen Arbeitsplatz.
Jetzt, da ich ein Dach überm Kopf und genug zu essen hatte, fing ich an nach dem Verbleib meiner Familie zu forschen.
Bei meinem letzten Heimaturlaub hatte ich mit meiner Frau verabredet; falls wir uns in den Kriegswirren verlieren
sollten, unsere Kontaktadresse, die meiner Quartiersleute in Burscheid, Kreis Opladen, sein sollte. Ich habe zuerst
nach Rohmanen geschrieben, aber leider keine Antwort erhalten. Dann habe ich nach Burscheid geschrieben, und siehe, -
bei denen lag schon eine Anfrage meiner Frau vor, die nach mir gefragt, und ihre jetzige Anschrift hinterlassen hatte.
Ich habe dem Bauern erzählt dass meine Frau sich zurzeit, auf einem Gut, in Alt Steinhorst, im Kreis Rostock, befindet.
Er war sofort bereit uns ein Zimmer zur Verfügung zu stellen, wenn ich meine Frau nach Krottorf rüberholen wollte. Das
habe ich Ihr mitgeteilt und sie war sofort bereit ihren Wohnsitz nach Krottorf zu verlegen, denn sie wohnte dort in
einem kleinen Stübchen unterm Dach.
Im Herbst, als die Feldarbeit so ziemlich erledigt war, bin ich nach Alt Steinhorst gefahren, um meine Frau und meinen
Sohn Kurt, sowie meinen Sohn Manfred, den ich noch nicht kannte, weil er erst nach der Flucht, am 31. Januar, in Groß
Lüssewitz, geboren wurde, nach Krottorf zu holen. Meine Frau hatte schon Holz für den Winter besorgt und vom Gut, auf
dem sie im Sommer gearbeitet hatte, Mehl und Kartoffeln bekommen. Wir haben das Mehl und andere Habseligkeiten in
Kisten verpackt. Das Holz haben wir einem Bauern gegeben, der uns und unser Gepäck, mit seinem Pferdewagen, zum 14
Kilometer entfernten Bahnhof, nach Ribnitz gebracht hat. Wir sind auch gut in Krottorf angekommen, aber als wir am
nächsten Tag, unsere Kisten vom Bahnhof abholen wollten, haben wir zwar die Kisten vorgefunden, doch der gesamte Inhalt
wurde während der Bahnfahrt entwendet. Die Bahnstation in Krottorf hat die Vorkommnisse zur Kenntnis genommen und
protokolliert, aber unsere Sachen haben wir nie wieder gesehen und mussten wieder bei Null anfangen.
Im Winter musste ich auf der Genossenschaft, unentgeltlich, für die Russen Weizen einsacken. Ich hatte versucht eine
Arbeit als Zimmermann zu bekommen, doch auf dem Arbeitsamt wurde mir gesagt, ich bin Ladwirt und muss auf der
Landwirtschaft arbeiten. Da in den ersten Nachkriegsjahren, auch in der sowjetisch besetzten Zone Arbeitsplätze knapp
waren, mussten auch solche, die einen anderen Beruf erlernt hatten, jede zumutbare Arbeit annehmen. Aus der Heimat
erhielt ich einen Brief, von meiner dort noch lebenden Mutter. Sie schrieb das sie mich noch einmal sehen wollte und
ich sollte doch wieder zurück kommen; Unser Hof wäre nicht von Polen besetzt und sie wäre ganz alleine, weil der Vater
nach dem Durchzug der Front von den Russen erschlagen wurde. Daraufhin habe ich dem polnischen Konsulat in Magdeburg
mitgeteilt, dass ich in Rohmanen eine Landwirtschaft besitze, und um eine Einreisegenehmigung gebeten.
Nach 2 Monaten erhielt ich eine Postkarte, mit der Mitteilung, ich sollte mich persönlich beim Konsulat vorstellen.
Nach Aufnahme meiner Personalien, wurde mir gesagt, das ich benachrichtigt werde wenn mein Antrag genehmigt wird. Ende
Juli 1947 erhielten wir die Einreisegenehmigung nach Ostpreußen, das jetzt unter polnischer Verwaltung stand. Wir
mussten zuerst zum polnischen Konsulat in Berlin-Lichterfelde, wo wir umgeben von einer Trümmerlandschaft, gewartet
haben, bis alle Untersuchungen und Formalitäten erledigt waren.
“ Wieder zurück in Ostpreußen.”
Der schwere Wiederaufbau nach dem Kriege
Dann fuhren wir über Frankfurt/Oder, Posen, Thorn, Allenstein, nach Ortelsburg, wo wir am 2. August 1947 ankamen. Mit
einem zweirädrigen Karren, den ich mir von einem noch in Ortelsburg lebenden Bekanten ausgeliehen hatte und meinem
Sohn Manfred im Kinderwagen fuhren wir nach Rohmanen. Meine Mutter war inzwischen verstorben und auf dem Hof war nur
meine, inzwischen aus Russischer Gefangenschaft wiedergekehrte Schwester, Frieda Pelkowski.

Es war alles ausgeplündert; kein Vieh, keine Maschinen und der ganze Hof mit kniehohem Graß überwachsen. Nur schmale
Trampelpfade, vom Haus zum Holzschuppen und zum Klo, durchkreuzten das satte Grün. Ich habe das Gras auf dem Hof mit
einer Sense, die ich noch gefunden habe, abgemäht, damit der Hof nicht so verwahrlost aussah. Am nächsten Tag habe ich
mich bei der Polizei in Ortelsburg angemeldet, wo ich auch ein Startgeld von 100 Zloty erhielt und Gepäckstücke, die
ich in Krottorf aufgegeben, am Bahnhof abgeholt. Es hat mich sehr gewundert das, das Gepäck überhaupt angekommen ist.
Da man von der Landwirtschaft nicht Leben konnte, habe ich mich in den nächsten Tagen, bei der jetzt polnischen Bahn,
um Arbeit beworben und wurde auch angenommen. Wenn wir unseren Monatslohn bekamen, saß immer einer am Tisch, der von
uns 100 Zloty für den Wiederaufbau von Warschau verlangte. Wenn ich dran war, riefen die Anderen, ich hätte Warschau
zerstört und müsste deshalb 200 Zloty abgeben. Nach 3 Jahren kam eine Verfügung, die besagte, dass wer länger als 1
Jahr bei der Bahn beschäftigt ist, angestellt werden muss. Um diese Bestimmung zu umgehen hat man mich entlassen und
eine Woche später wieder eingestellt.
Als ich vor Ablauf des nächsten Jahres, aus dem gleichen Grunde wieder entlassen wurde, habe ich mich bei der
Stadtverwaltung in Ortelsburg(jetzt Szczytno)beworben, wo ich zuerst im Gaswerk als Heizer und später auf Baustellen
als Zimmermann gearbeitet habe. Wir haben durch den Krieg beschädigte Häuser repariert, in den ehemals touristischen
Zentren einige Ausbesserungen an den Einrichtungen durchgeführt, eine Ziegelei wieder in Betrieb gesetzt und andere
anfallende Arbeiten verrichtet. Im Dach des Rathausturmes war während der Kämpfe eine Granate eingeschlagen, die, die
Dachlatten und die Verschalung zerstört hatte. Da wir, unter schwersten Bedingungen, den Schaden repariert haben,
wurde uns eine Höhenzulage versprochen, die wir aber nicht bekommen haben.
Aus Verärgerung darüber habe ich bei der Stadtverwaltung gekündigt und bei einer Wiederaufbaufirma unter der Leitung
von Bauingenieur Laskowski wieder angefangen, wo ich bis 1954, als Zimmermann beschäftigt war. Ab da habe ich mich
nur um meinen Hof gekümmert, der wegen meiner Arbeitsstellen, gezwungenermaßen, sehr vernachlässigt wurde. Als wir
1947 zurückkamen, brachten wir unseren Sohn Manfred noch im Kinderwagen. Den hat meine Frau zum Markt gebracht,
verkauft, und dafür eine Ziege erworben, die dank guter Pflege, uns täglich mit 4 Liter Milch versorgte. Das war der
erste Baustein zum Wiederaufbau, unserer durch den Krieg zerstörten, und danach ausgeplünderten Landwirtschaft.
Während meiner Arbeit bei der Bahn haben wir uns eine Kuh gekauft, die nach einem halben Jahr, wegen nicht bezahlter
Grundsteuer, vom Gerichtsvollzieher gepfändet wurde. Man hat uns die Kuh weggenommen und bei einem Arbeiter, der in
der Ernst-Mey-Straße in Ortelsburg wohnte und sie wegen nicht vorhandener Futtermittel, nur mit Kartoffelkraut
gefüttert hat, untergestellt. Als ich bei der Bahn meinen Monatslohn bekommen habe, bin ich zur Gmina gegangen, habe
eine Rate angezahlt und durfte dann die Kuh wieder mit nach Hause nehmen. Durch die schlechte Ernährung war die Kuh
stark abgemagert und lieferte nur die Hälfte der ursprünglichen Milchleistung.
Später habe ich ein Pferd auf Abzahlung bekommen, das 140.000 alte Zloty gekostet hat. Die Stute war schwach und unser
Feld sehr hügelig, so dass man nur bergab pflügen konnte, was sehr beschwerlich war, bergauf ging es immer im Leerlauf.
Später habe ich die schweren Böden mit dem Traktor umpflügen, und in den letzten Jahren auch mit dem Binder mähen
lassen. Von der Stute habe ich 2 schöne Fohlen gezogen; ein davon habe ich bei der Ausreise in die Bundesrepublik
mitgebracht und bei der Viehverwertungs-Genossenschaft in Göttingen verkauft. In den ersten Nachkriegsjahren als noch
wenig Land bestellt wurde, breiteten sich auf den nicht beackerten Flächen, Wildkräuter aus. Disteln und andere
Schnellwachsende, erreichten manchmal eine Höhe von 2 Meter, besonders auf den schweren Böden.
Es hat viel Schweiß gekostet ehe man den Acker soweit hatte, das er auch befriedigende Erträge abwarf. Die
Währungsreform von 1950, hat unser weiniges Geld das wir schon gespart hatten, wieder vernichtet. Ich hatte 2 Pferde,
1 Fohlen, 2 Kühe und Schweine, als ich wieder aufgefordert wurde nicht bezahlte Grundsteuern nachzuzahlen. Als ich
nicht bezahlen konnte, hat der Vollziehungsbeamte, ein Fohlen, eine Kuh und ein Schwein gepfändet. Es gelang mir jedoch
nach längeren Verhandlungen, ohne größere Verluste, alles zu regeln. Später kam eine Verfügung, die besagte; wenn
jemand auf seinem Hof nur eine Kuh und ein Pferd hatte, durften sie nicht gepfändet werden. Einige haben ihr Inventar
dieser Verfügung angepasst und dadurch die Zahlung von Grundsteuer umgangen.

Wer seine Steuern pünktlich bezahlt und sein Kontingent an landwirtschaftlichen Produkten fristgerecht abgeliefert hat,
der konnte seine, darüber hinaus erwirtschafteten Produkte zu marktgerechten Preisen verkaufen. Für eine hochtragende
Sterke, mindestens 400 kg schwer, die auf ein staatliches Gut verkauft wurde, konnte man bis zu 12000 Zloty bekommen.
Unsere Böden waren kalkarm, doch durch den Einsatz von Kalk und Kunstdünger konnte man den Ertrag erheblich steigern.
Kalk und Kunstdünger konnte man bei der Genossenschaft(GS) bestellen, der dann auch direkt auf den Hof geliefert wurde.
Kalk wurde geliefert und gleich auf dem Feld ausgestreut. In den 1960ger Jahren waren alle Ackerflächen der Rohmaner
Felder bestellt.
Die nach dem Krieg zurückgebliebenen deutschen Bauernfamilien, aber auch die Polen, die während des Krieges beim Bauern
in Deutschland gearbeitet haben, versuchten mit teils bescheidenen, oder auch zusammen gesuchten, landwirtschaftlichen
Geräten, die bäuerlichen Betriebe aufrecht zu erhalten. Nach den schweren Anfängen in den ersten Nachkriegsjahren
erzielten sie schließlich einen beachtlichen Erfolg, der sich in wogenden Kornfeldern, sowie in grünen Wiesen auf
denen gut genährtes Vieh weidete, widerspiegelte.
Ein schwerer Einschnitt in meinem Leben.
Am 11. Mai 1956 verstarb nach langer schwerer Krankheit, meine liebe Ehefrau Marta Rattay,
geborene Brosch. Ein Jahr zuvor war schon mein Schwiegervater Gottlib Brosch verstorben. Die schweren Bedingungen
unter denen wir nach Kriegende leben mussten, haben ihrer bereits angegriffenen Gesundheit sehr zugesetzt. Sie
verstarb mit 44 Jahren und hinterließ in unserer Familie eine große Lücke, die nicht mehr zu Überbrücken war. Wir
haben sie unter großer Anteilnahme der noch verbliebenen deutschen Bevölkerung zu Grabe getragen und auf dem Rohmaner
Friedhof beigesetzt. Die Arbeit die sie sonst verrichtet hatte fiel jetzt auf mich und meine Söhne zurück. Meine
Schwester Frieda Pelkowski half auch wo sie nur konnte. Wir waren auf die Unterstützung durch Nachbarn und Freunde
angewiesen, die uns immer wenn es nötig war, tatkräftig unterstützt haben. Im laufe der Zeit haben wir wieder zum
Alltag zurück gefunden, haben sie noch etliche Jahre auf dem Friedhof besuchen können, bis wir, bedingt durch unsere
Ausreise uns endgültig von ihr trennen mussten.
Der endgültige Abschied von Ostpreußen
Ab 1956 begannen, durch die Vermittlung des Deutschen Roten Kreuzes, die ersten Ausreisen in die
Bundesrepublik Deutschland. Zuerst waren es Kinder die zu ihren Eltern ausreisen durften, Familien deren Väter aus der
Kriegsgefangenschaft in den Westen Deutschlands entlassen wurden und andere durch den Krieg getrennte
Familienangehörige. Ab 1960 erhöhte sich die Zahl der Ausreisewilligen aus dem polnisch besetzten Ostpreußen. Es setzte
sich die Überzeugung durch, dass unsere Angestammte Heimat, uns für die Zukunft keine Perspektive mehr bieten konnte.
Meistens wurden die Anträge, die wir an die Passabteilung in Allenstein stellen mussten, um einen Ausreisepass zu
bekommen, negativ beschieden. Nach mehrmaligen Versuchen gelang es dann doch, diese begehrte Ausreiseberechtigung in
Empfang zu nehmen. Die Enttäuschung der Zurückgebliebenen war groß, wenn wieder mal Verwandte oder Nachbarn, den Weg
in Richtung Bahnhof einschlugen.
Um einen Reisepass zu beantragen, musste man zuerst eine Einladung von Verwandten aus der Bundesrepublik vorlegen, in
der, diese sich verpflichten mussten, für Unterkunft und Verpflegung der Eingeladenen zu sorgen. Diese Einladung
musste durch ein Amt in der Bundesrepublik beglaubigt werden. Außerdem mussten die Kosten für die Bahnfahrt, ab
polnischer Grenze, bis zum Zielort, beim polnischen Reisebüro ORBIS, in Warschau, in DM eingezahlt werden.
Unseren ersten Ausreiseantrag haben wir 1964, bei der Kommandantur der polnischen Miliz in Allenstein eingereicht, der
nach einer gewissen Zeitspanne, ohne eine uns verständliche Begründung zu nennen, abgelehnt wurde. Gegen diese
Ablehnung wurde ein Widerspruch zugelassen, den wir sofort einreichten. Nach einer weiteren Zeitspanne erhielten wir
wieder eine Ablehnung, gegen die kein Widerspruch mehr zulässig war. Wer seine Ausreiseabsicht nicht aufgeben wollte,
musste einen neuen Antrag stellen. Es gab Familien die schon 10 Mal einen Ausreiseantrag gestellt hatten und immer
wieder abgewiesen wurden. Da meine Söhne, nicht die Absicht hatten in Rohmanen zu bleiben und ich nach 2 Weltkriegen,
an denen ich teilgenommen, die schwere Arbeit auf der Landwirtschaft, nicht aus eigener Kraft schaffen würde, haben wir
1966 wieder einen Antrag gestellt, der prompt abgelehnt wurde. Der Widerspruch auf diese Ablehnung wurde auch negativ
beantwortet, so dass wir 1968 wieder einen Antrag eingereicht haben.
Weil das Passamt in Allenstein lange nichts von sich hören ließ, hegten wir schon die Hoffnung das es jetzt klappen
würde und waren sehr enttäuscht als wieder eine Absage kam. In der Zwischenzeit sind viele Nachbarn und Bekannte aus
Rohmanen, sowie aus der näheren Umgebung, ausgereist und das Häuflein der noch verbliebenen Deutschen, wurde immer
kleiner. Die Motivation, die uns in früheren Jahren, über so manche schwierige Lage hinweg geholfen hat, ist einer
hoffnungslosen Resignation gewichen. Man war davon überzeugt, dass unser Leben, in unser Angestammten Heimat, keine
Zukunftsperspektive mehr haben konnte und wenn wir keine Ausreisegenehmigung bekommen, wir eines Tages die letzten
Deutschen in der ganzen Umgebung sein werden.
Die Ausreise-Heimat ade
Wir hatten die Hoffnung schon aufgegeben, als am 30. April 1969, der Briefträger unseren Hof
betrat und mir einen Brief überreichte, in dem uns das Passamt in Allenstein mitteilte, dass unsere Ausreise in die
Bundesrepublik Deutschland, genehmigt worden ist. Wir müssten, nach Aushändigung der Reisepapiere, den Geltungsbereich
der Volksrepublik Polen, innerhalb von 3 Monaten verlassen. Wir waren zuerst geschockt, über den Hinweis, das wir
unsere Heimat in 3 Monaten verlassen müssen, aber dann stellte sich die Zukunftsperspektive wieder ein und wir gingen,
wie von einem schweren Ballast befreit und gut gelaunt unser weiteren Tätigkeit nach.
Als der Briefträger unseren Hof betrat, waren ich und mein Sohn Kurt gerade dabei eine Fuhre Mist zu laden. Wir hatten
den Wagen gerade halb geladen und haben nach der frohen Kunde nicht mehr weiter gemacht, sondern die Pferde vorgespannt
und den Mist aufs Feld gefahren, damit wir den Wagen für alle Fälle frei hatten. Das war die letzte Tätigkeit für
unsere Landwirtschaft in Ostpreußen.
Die Nachricht von unserer Ausreise verbreitete sich, ohne dass wir darüber gesprochen haben, wie ein Lauffeuer.
Alsbald kamen Leute aus dem Dorf, die sich für das Vieh und für diverse Landwirtschaftliche Geräte interessierten.
Etliche wollten bestimmte Sachen sofort kaufen, andere haben nur zurücklegen lassen und wollten später kommen und
bezahlen, haben es aber dann doch nicht genommen.

Wenn man eine Landwirtschaft hatte, konnte man 2 Pferde, 2 Rinder, 3 Schweine, 5 Schafe und 10 Hühner, in einem
geschlossenen Viehwaggon, in die Bundesrepublik mitnehmen. Jeden Tag war man unterwegs, von einer Behörde zur Andern.
Die Aushändigung der Reisepapiere erfolgte nur nach Vorlage bestimmter Bescheinigungen: Es mussten alle Steuern bezahlt
sein, das Kontingent landwirtschaftlicher Erzeugnisse musste abgeliefert sein, je eine Bescheinigung vom Katasteramt
und vom Notar musste vorgelegt werden, das man dem polnischen Staat das Grundstück abgetreten hat. Die Gebühren für
die notarielle Beglaubigung mussten wir selbst bezahlen. Wenn man alle Bescheinigungen beisammen hatte, bekam man bei
der Kreisverwaltung eine Gesamtbescheinigung. Mit dieser Bescheinigung konnte man nach Allenstein, zur
Polizeikommandantur fahren, wo man nach dem schriftlichen Verzicht auf die polnische Staatsangehörigkeit, einen
Reisepass ausgehändigt bekam, der den Inhaber zum Grenzübertritt berechtigte, aber nicht zur Wiedereinreise.
Wir haben 2 Pferde, eine Sterke, einen Ochsen, 5 Schafe, 2 Schweine und 10 Hühner mitgenommen. Über die Schutzimpfung
der Rinder musste man eine, vom Kreistierarzt beglaubigte Bescheinigung vorweisen. Ich habe 5 Schafsböcke gekauft, die
ich in der Zwischenzeit, hinter der Scheune, zum Weiden angekettet hatte. Einer von denen hat sich losgerissen und
seinen Nachbarn getötet. Das Fleisch konnten wir noch verkaufen, mussten aber dafür einen anderen Schafsbock kaufen.
Innerhalb von 3 Monaten mussten wir alles regeln und zwei Tage vor der Abfahrt einen Eisenbahnwagen, bei der
Eisenbahndirektion in Allenstein bestellen. Reservierungen bei den polnischen Behörden waren meist immer mit
Schmiergeld verbunden, weil man sonst nie sicher sein konnte dass diese Vereinbarungen auch eingehalten werden. Schon
2 Wochen vor unserer Abfahrt, gab es in Ortelsburg keine alkoholischen Getränke zu kaufen. Meine Söhne mussten mit dem
Motorrad die umliegenden Dörfer abfahren, damit wir für die Reise einen Vorrat anlegen konnten; denn Wodka war zu der
Zeit, in Polen, wie eine zweite Währung.
Am 25. Juli haben wir zusammen, mit meinem Neffen Siegfried Brosch, unseren sonstigen Hausrat, der in Kisten verpackt
war, in einen Eisenbahnwagen, auf dem Allensteiner Bahnhof verladen. Alles musste zuerst durch den Zoll, wo die
Federbetten gewogen wurden und über das erlaubte hinausgehende Kissen, verzollt werden mussten. Dasselbe galt auch für
Fleisch und Räucherwaren.
Am 26. Juli, unserem Verladetag, kam der Eisenbahnwagen aus Allenstein, erst um 11 Uhr auf dem Ortelsburger Bahnhof an.
Die Rinder hatten wir zu Fuß, zum Bahnhof gebracht; Schweine, Schafe und Hühner auf dem Pferdewagen. Im Eisenbahnwagen
mussten, mit Hilfe von Brettern und Bohlen, Boxen für die verschiedenen Tiere erstellt werden. Jedes Pferd und jedes
Rind in eine Bucht. Die Schafe zwischen die Pferde, die Schweine zwischen die Rinder und die Hühner in einem Käfig,
unter der Decke über den Rindern. Die Hühner hatten unterwegs Eier gelegt, somit hatten wir jeden Tag frische
Verpflegung. Bei der Fahrt im Viehwagen, begleitete mich mein Sohn Manfred. Als die Lokomotive nahte, um den Wagen
abzuholen, wurden noch schnell die restlichen Sachen hinein geworfen und so mache Abschiedsträne rollte dann die Wange
hinab.
Unsere Nachbarn, Deutsche und Polen, halfen uns beim Verladen des lebendigen Inventars. Jetzt erinnerte ich mich
plötzlich, an die oft auch schönen, Ereignisse der letzten 22 Jahre. Einer Zeit, in der das Zusammenleben von
Deutschen und Polen, von Jahr zu Jahr, besser wurde. Man half sich beim einbringen der Getreideernte, beim Dreschen
des Getreides, bei der Kartoffelernte und bei anderen Arbeiten, wo viele Menschen zupacken mussten. Es war eine
Dorfgemeinschaft, in schweren Zeiten geboren; jeder half jedem wenn Hilfe nötig war. Es wurde mir plötzlich bewusst,
das jetzt ein Lebensabschnitt zu Ende ging, zu dem ich nicht mehr zurückkehren konnte. Unsere Existenzgrundlage war
jetzt ein Eisenbahnwagen auf einem Schienenstrang, dessen Ende irgendwo in weiter Ferne lag. Obwohl, von langer Hand
vorbereitet, war dieser Moment voller Wehmut.
Doch als der Zug sich plötzlich, in Bewegung setzte, war ich sofort wieder in der Gegenwart. Menschen, mit denen man
Jahrzehnte lang, in gutem Einvernehmen zusammen gelebt hat, blieben plötzlich am Bahnsteig zurück und die Entfernung
zwischen ihnen und mir vergrößerte sich mit jeder Sekunde, bis sie letztendlich aus meinem Blickfeld verschwanden.
Es war ein heißer Julitag, als wir unsere Reise gen Westen antraten. Für die Schweine, die besonders unter der Hitze
zu leiden hatten, haben wir 10 Flaschen Essig mitgenommen und sie von Zeit zu Zeit besprenkelt, damit sie besser atmen
konnten. Für die anderen Tiere war reichlich Heu und Hafer vorhanden. Eine großes Fas und zwei Milchkannen waren mit
Wasser gefüllt, die wir auf den an der Strecke liegenden Bahnstationen, bei Bedarf wieder nachgefüllt haben.
Da der Kreistierarzt nicht in seinem Büro war, konnten wir die Impfbescheinigung für das Vieh, nicht rechtzeitig
herbeischaffen. Der Zug setzte sich in Bewegung und die Bescheinigung war immer noch nicht da. Als die Bescheinigung
dann eingetroffen, wir aber schon unterwegs waren, ist mein Sohn Kurt mit dem Motorrad hinterher gefahren und hat uns
in Passenheim, wo der Zug noch andere Wagen angehängt bekam, die Impfbescheinigung übergeben. Wir waren sehr froh das
er es noch geschafft hat, denn in solch einer Situation fühlt man sich sicherer wenn man alle Bescheinigungen bei sich
hat. Auf der Rückfahrt, mit dem Motorrad hatte er noch eine Panne, musste das Motorrad stehen lassen und per Anhalter
nach Hause fahren. Am nächsten Tag kam er mit Siegfried Deptolla, der das Motorrad wieder flott machte und brachte es
wieder nach Rohmanen zurück.
Die Fahrt mit dem Viehwagen, gen Westen
Von Ortelsburg bis Allenstein(45 km) hat unser Zug 4 Stunden gebraucht, weil auf jedem Bahnhof
gehalten wurde, um neue Wagen anzuhängen. Nachdem wir in Allenstein angekommen waren, kam ein Rangierer und fragte
nach unserem Ziel. Als wir ihm mitteilten, das wir in die Bundesrepublik Deutschland wollen, sagte er nur: „In 10
Minuten fährt ein Zug los. Wenn ich von euch 500 Zloty und einen Liter Wodka bekomme, werde euch sofort anhängen,
andernfalls kommt ihr auf ein Nebengleis und müsst dann auf den nächsten Zug warten. Es blieb uns nichts anderes übrig
als seiner Forderung nachzukommen, denn über derartige Erpressungen hat man bereits von Anderen, die vor uns ausgereist
sind, gehört. Wir wurden auch sofort angehängt und fuhren dann die ganze Nacht, an Osterode, und Thorn vorbei bis
Gnesen. Dort wurde wieder rangiert.
Von einer Anhöhe wurden die einzelnen Wagen auf verschiedene Gleise verteilt und zu neuen Zügen zusammengestellt. Der
Aufprall der ungebremsten Wagen erzeugte eine derartige Erschütterung, dass manche Bretter an den Boxen geborsten waren.
Von Gnesen ging es dann in einem Zuge durch bis zur Grenzstation Reppen(Rzepin). Dort mussten wir zum Zollamt, wo
unsere Ausfuhrpapiere durch die Zollbeamten, und durch einen Tierarzt geprüft wurden. Bis Reppen(Rzepin) haben wir für
den Eisenbahnwagen 900 Zloty bezahlt; hier mussten wir noch einmal 650 Zloty bezahlen. Bei der Wagenkontrolle erklärte
uns ein Bahnbeamter das unser Wagen, sich nicht für den internationalen Transport eignet und wir deshalb den Inhalt in
einen Anderen umladen müssen, der irgendwann, auf dem Nebengleis bereitgestellt wird. Nach langer Verhandlung, sowie
einer Zulage von 500 Zloty und einem Liter Wodka haben wir ihn davon überzeugt, das der Wagen sich doch für die
Weiterfahrt eignet.
In der Nacht war Schichtwechsel, der unseren Wagen wieder abgehängt hat, weil er angeblich von der Reichsbahn der DDR,
wegen technischer Mängel nicht weiterbefördert würde. Wir mussten unsere Verhandlung vom Vorabend wiederholen, die mit
der Zusage endete, dass wir am frühen Morgen, über die Grenze auf DDR Gebiet, gebracht werden. Um 5 Uhr morgens kam
eine Lokomotive, die uns den letzten Abschnitt bis über die Grenze bringen sollte. Als der Zug hat noch einmal anhielt,
kamen polnische Grenzbeamte und Soldaten in den Wagen. Sie durchsuchten ihn und fragten, ob wir noch polnisches Geld
oder einen Grundbuchauszug bei uns hätten. Wir zeigten ihnen 800 Zloty, die sie uns, nach Ausstellung einer Quittung
über 500 Zloty, abnahmen. Die Grundbuchauszüge habe ich, im Stroh versteckt, dem Ochsen vor die Füße gelegt. Falls
jemand da suchen sollte, hätte ich gesagt, das das Tier bösartig veranlagt ist, und ich für seine Sicherheit nicht
garantieren könnte, deshalb sollte er vorsichtig sein.
Als die Grenzkontrolle den Zug verlassen hatte, setzte sich die Lokomotive wieder in Bewegung und überquerte nach
kurzer Zeit die Oderbrücke. Auf einer eingezäunten Fläche, jenseits der Grenze, hat man uns abgestellt hat und die
Lokomotive fuhr zurück auf polnisches Gebiet. Vor und hinter uns waren die Tore verschlossen. Auf den Wachtürmen,
links und Rechts von uns, standen Posten mit einem Gewehr im Anschlag. Vier Grenzbeamte der DDR, jeder mit einer
Leiter in der Hand, sowie ein Schäferhund, kamen zu unserem Wagen. Sie öffneten die Schiebetüre, stellten die Leiter
davor und ließen den Hund in den Wagen springen, der nur etwas herum schnupperte und wieder heraussprang. 2 Beamte
haben dann anschließend, die Papiere kontrolliert und das Inventar gezählt.
Nach einiger Zeit wurden wir an einen Güterzug der Reichsbahn angehängt und fuhren von Frankfurt an der Oder, vorbei
an Berlin, Ellingen und Nordhausen, über die Grenze zur Bundesrepublik bis Herzberg. Hier hat ein Zollbeamter der
Bundesrepublik, die Formalitäten erledigt und ein Tierarzt die Pferde, Rinder und Schweine gründlich untersucht. Ich
musste ihnen die Mäuler aufhalten und die Füße hochheben. Danach hat uns die Lokomotive zu einer Wasserzapfstelle
gebracht, wo wir die Tiere tränken und unsere Behälter mit Wasser auffüllen konnten. Anschließen fuhren wir über
Northeim nach Göttingen, zur Viehverwertungsgenossenschaft, die zuvor von unserer Ankunft in Kenntnis gesetzt wurde.
Der Ochse, die Sterke und die Schweine wurden, in Göttingen zum Schlachthof gebracht; die Pferde kamen nach Hannover
und die Schafsböcke nach Kassel. Wir waren mit dem Viehtransport 5 Tage unterwegs; hatten so manche Klippe umschifft
und Schwierigkeiten gemeistert, die im normalen Leben nicht vorkommen.
Wir wurden mit einem PKW, ins Durchgangslager Friedland bei Göttingen gefahren, wo mein Sohn Kurt, meine Schwester
Frieda Pelkowski und Siegfried Brosch mit Familie, die am 30 Juli, um 14 Uhr, von Warschau mit dem Zug abgefahren, und
hier am 31. Juli in den Morgenstunden eingetroffen sind, schon auf uns gewartet haben. In Friedland hat man uns mit
Familie Siegfried Brosch in einem Raum untergebracht, wir wurden registriert und erhielten 20 DM Überbrückungsgeld,
pro Person. Da wir erst am Freitag in Friedland eingetroffen sind, mussten wir hier über das Wochenende bleiben,
obwohl die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der Regel nur 3 bis 4 Tage beträgt.
Um einen Antrag für die Ausreise stellen zu können, brauchten wir eine Einladung von in der Bundesrepublik lebenden
Verwandten. Diese Einladung hat uns mein Bruder, Ernst Rattay, aus Ingelheim am Rhein zugeschickt. Ingelheim liegt im
Bundesland Rheinland-Pfalz. Das Geld für die Bahnfahrt, hat uns, Frieda Schellin, geb. Nickel, aus Duisburg, die
Tochter unseres Nachbarn, überwiesen. In Friedland wurden wir registriert. Im Registrierschein, war als unser
nächster Aufenthaltsort in der Bundesrepublik, das Durchgangslager Osthofen bei Worms, das alle Aussiedler für
Rheinland-Pfalz aufnehmen musste, eingetragen. Die Eintragung erfolgte deshalb, weil der Ort aus dem uns unsere
Einladung zugeschickt wurde, sich auch in Rheinland-Pfalz befand.
Da ich nach dem Polenfeldzug, als Soldat, ein Jahr im Kreis Opladen, im Rheinland gewesen bin, wäre ich sehr gerne in
diese Gegend gezogen, denn die Erinnerung an die schönen Tage die ich dort verlebt habe war in mir immer noch wach.
Ich versuchte die Eintragung in unseren Regiestierscheinen ändern zu lassen, was nach einigen, vielleicht auch
berechtigten Einwänden, am 4. August, vom Beauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen, genehmigt wurde. Anstelle von
Rheinlad-Pfalz stand da jetzt Nordrhein-Westfalen und am 7. August, fuhren wir, noch mit anderen Aussiedlern, ins
Durchgangslager Unna-Massen, am östlichen Rande des Ruhrgebietes gelegen. Hier wurden wir in einem Zimmer untergebracht
und konnten unser Essen in einer Gemeinschaftsküche zubereiten.
Am 8. August wurden wir in Unna-Massen, als Bürger der Bundesrepublik Deutschland registriert, erhielten
Einhundert DM Begrüßungsgeld, den Vertriebenen Ausweis -A -und 4 Wochen später den Bundespersonalausweis. In
Unna-Massen haben wir mehr als 4 Monate verbracht, weil mein Sohn Kurt, wegen fehlender Berufsausbildung, in Unna, an
einem Grundlehrgang für Metallarbeiter teilgenommen hat, der vom Arbeitsamt finanziert wurde. Am 11 Dezember 1969 sind
wir endlich an unserem vorläufigen Wohnsitz, im Durchgangswohnheim, an der Elisabethstraße 13, in Velbert angekommen.
Ab dem 5. Januar 1970 konnten meine Söhne, in der Zahnradfabrik Reining, in Velbert ihrer geregelten Arbeit nachgehen.
Von Bau- und Sparverein in Velbert wurde uns am 20. Juni 1970, unsere erste Wohnung zugewiesen.
Velbert im Februar 1972
gezeichnet: Gustav Rattay
Rohmanen war durch die Kampfhandlungen 1914/15 zu einem drittel zerstört worden, aber schon
wieder im Aufbau. Die Firma Grzella aus Ortelsburg hatte die Bauarbeiten übernommen. Unter der Aufsicht von Polier
Karl Kontor wurden die Dachstühle errichtet. Ich habe mich, nach kurzer Erholungspause, auch als Zimmermanngehilfe am
Wiederaufbau beteiligt. Die Firma Grzella hat das Material geliefert und auch unsere Löhne gezahlt. Wegen meinem
Steckschuss bin ich dem VDK beigetreten und habe mit dessen Hilfe eine Rente beantragt die mir auch bewilligt wurde.
Nach vier Jahren wurde ich nach Allenstein zur Nachuntersuchung vorgeladen. Die ärztliche Untersuchung hatte ergeben,
das Geschoß sei verkapselt, und nur das linke Bein etwas in Mitleidenschaft gezogen. Daraufhin wurde die Rentenzahlung
eingestellt.
Der Stellmacher Adam Ornowski war im Krieg als Sanitäter eingesetzt und hatte auf Grund seiner Erfahrungen,
 Beziehungen zum medizinischen Dienst in Ortelsburg aufgebaut. Es wurden dort Lehrgänge in Erster Hilfe angeboten,
die von Prof. Dr. Kutz geleitet wurden. Adam Ornowski hat dafür gesorgt das einige junge Männer aus Rohmanen daran
teilnehmen konnten. Adam Ornowski, August Linka, Emil Rosowski, Johann Dembek, Emil Baschek und ich sind dann dem
Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes beigetreten und mussten jeden Sonntag am Lehrgang teilnehmen. Unser
Gruppenführer war Kreisobersekretär Albrecht, Landrat von Poser, als unser Ehrenvorsitzender, hat viel zu unserer
finanziellen Unterstützung beigetragen und hat dafür gesorgt dass die Bereitschaft eingekleidet wurde.
Beziehungen zum medizinischen Dienst in Ortelsburg aufgebaut. Es wurden dort Lehrgänge in Erster Hilfe angeboten,
die von Prof. Dr. Kutz geleitet wurden. Adam Ornowski hat dafür gesorgt das einige junge Männer aus Rohmanen daran
teilnehmen konnten. Adam Ornowski, August Linka, Emil Rosowski, Johann Dembek, Emil Baschek und ich sind dann dem
Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes beigetreten und mussten jeden Sonntag am Lehrgang teilnehmen. Unser
Gruppenführer war Kreisobersekretär Albrecht, Landrat von Poser, als unser Ehrenvorsitzender, hat viel zu unserer
finanziellen Unterstützung beigetragen und hat dafür gesorgt dass die Bereitschaft eingekleidet wurde.
In jedem Dorf wurde eine Unfallstelle eingerichtet, mit einem Verbandskasten und mit Verbandsmaterial für die erste
Hilfe ausgerüstet. Die Unfallstelle in Rohmanen, die am Haus von der Straßenseite, durch eine Tafel mit einem roten
Kreuz gekennzeichnet war, hatte ich zu verantworten. An Sonntagen wurden wir an Badestellen und bei Fußballspielen
eingesetzt, haben viele Übungen bei Waldbränden durchgeführt und auch Ausflüge nach Rudzany am Niedersee gemacht. Bei
der Einweihung des Tannenbergdenkmals in der Nähe von Hohenstein kamen wir an Straßenkreuzungen zum Einsatz.
Rohmanen hatte auch eine freiwillige Feuerwehr. Bis zum ersten Weltkrieg hat Friedrich Biella als Brandmeister das
Kommando gehabt. Er war aktiver Unteroffizier, hatte gute Führungsqualitäten und die Männer, die allesamt aus dem
aktiven Militärdienst stammten hatten zu ihm ein großes Vertrauen. Nach dem Krieg wollten diese Männer,
(Friedrich Nickel, Friedrich Willam, Julius Wittkowski, Jakob Janowski, Johann Gloddek, Gustav Bednarz), nicht mehr
weitermachen. Friedrich Biella, der inzwischen zum Gemeindevorsteher gewählt wurde, hat sich dann auf einer
Gemeinderatsitzung vorgeschlagen, für die Freiwillige Feuerwehr jüngere Kräfte anzuwerben.
Zum Brandmeister hat er Herrn Wilhelm Pilath vorgeschlagen. Der wurde dann nach Königsberg zur Fortbildung geschickt.
Der Feuerwehr gehörten nun folgende Personen an: Wilhelm Pilath(Brandmeister), August Linka(Stellvertreter), Gustav
Deptolla, Julius Matzey, Johann Dembek, Willy Willam, Gustav Rattay. Der Kreisbrandmeister war Heinrich Thalmann aus
Ortelsburg, sein Stellvertreter war Kreisobersekretär Salzmann. Der Bezirks-Kommissar bei der Ostpreußischen
Feuersozität War Herr Ernst Trzaska. Er hat dafür gesorgt das die Wehr uniformiert und mit Löschgeräten ausgerüstet
wurde. Da die alten Schläuche schon sehr marode waren, wurden sie durch moderne ersetzt, deren Kupplungen auch mit der
Motorspritze übereinstimmten.
Ernst Trzaska hat bei der Feuersozität und beim Landratsamt Finanzmittel beantragt und auch genehmigt bekommen. Der
Schneidermeister Wilhelm Baran wurde beauftragt Tuch und Drillichanzüge nach Maas zu schneidern. Er hat uns
Stoffmuster vorgelegt aus denen wir wählen sollten. Feuerwehrhelme haben wir auch bekommen. Die Gemeinde musste
Finanzmittel bereitstellen, einen Prozentsatz vom Gemeindebudget. Im Brandfall mussten für den Spritzenwagen Pferde
zur Verfügung stehen, von Willy Willam, Gustav Rattay, Julius Matzey und Gustav Dorka, weil sie in der Nähe des
Spritzenhauses wohnten. Am Spritzenhaus wurde ein großer Baum mit Querleisten aufgestellt, wo nach jedem Brand oder
einer größeren Übung die Schläuche zum trocknen aufgehängt wurden.
Der Kreisbrandmeister hat mindestens 2-3-mal im Jahr die Wehren besichtigt. Das ganze Dorf war dann auf den Beinen,
die Bauern mit Pferden, und andere Dorfbewohner mit Eimern und Spaten, wurden dann in verschiedene Gruppen eingeteilt.
Erst hat die Wehr sämtliche Aufstellungen am Gerät geübt; Grundstellung Fahrstellung und Marschstellung. Dann wurde
ein Brand angekündigt, die Feuerwehr mit der Spritze an den Brunnen, die Gruppen dort wohin sie beordert wurden, die
Bauern brachten mit den Wasserkiwen Wasser aus dem Brunnen zum Brandort. Wenn das Wasser im Brunnen alle wurde hat
man den Saugkorb in die Kiewen gelegt und dort Wasser entnommen. Die Wassergruppe ging mit Eimern zum Dorfteich, holte
Wasser und füllte damit die leeren Kiewen.
Der Löschtrupp ging mit Feuerhaken und Löschpatschen auf die umliegenden Gehöfte und versuchte das vermeintliche Feuer
von ihnen fernzuhalten. Nach dem Alarm wurde wieder am Spritzenhaus angetreten. Die Gruppenführer mussten angeben ob
ihre Gruppe auch vollständig erschienen war, denn Übungen wurden nur vor, oder nach der Feldarbeit durchgeführt, so
dass niemand eine Entschuldigung vorbringen konnte. Wer ohne begründete Entschuldigung nicht anwesend war erhielt eine
Verwarnung. Der Kreisbrandmeister erklärte dann welche Handgriffe den Vorschriften entsprachen und welche nicht. Die
Schläuche wurden noch schnell zum Trocknen aufgehängt. Anschließend gingen wir alle in den Gasthof Trzaska, haben über
vorhandene Mängel diskutiert, Verbesserungsvorschläge unterbreitet und zwischendurch den Durst gelöscht. Der
Kreisbrandmeister ist dann, nach einer kurzen Verabschiedung, ins nächste Dorf gefahren, weil er an einem Tag mehrere
Feuerwehren betreuen musste.
Der Rohmaner Dorffriedhof

Einen Kilometer vom Ende des Dorfes entfernt, auf der rechten Seite der Landstraße in Richtung
Ortelsburg, befand sich der Rohmaner Dorffriedhof. Wann dieser Friedhof angelegt wurde entzieht sich meiner Kenntnis.
Nach Aussagen älterer Dorfbewohner soll davor auch schon eine Ruhestätte vorhanden gewesen sein, und
zwar auf der linken Straßenseite gegenüber dem jetzigen Friedhof. An dieser Stelle befand sich bis in die
Nachkriegszeit ein kleiner Brunnen, aus dem die Dorfbewohner, das Wasser zum begießen der Grabbepflanzung auf den
Gräbern ihrer verstorbenen Angehörigen holten. Der Friedhof war in einer Hanglage angelegt, wahrscheinlich weil diese
Parzelle für eine landwirtschaftliche Nutzung nicht geeignet war. Um das Gräberfeld vor herumstreunenden Tieren oder
von der Weide entlaufenen Kühen zu schützen, hat man das ganze Gelände mit einem Holzzaun umgeben. Der Zugang befand
sich von der Straßenseite. Unter einem Torbogen hindurch wurden die Verstorbenen zu Grabe getragen. Die Gräber der
einzelnen Familien waren nebeneinander angelegt, mache, wie zum Beispiel die der Familie Trzaska, sogar mit einem
schmiedeeisernen Zaun eingefasst.
Nach dem 2. Weltkrieg verfiel der Friedhof immer mehr. Die nötigen Finanzmittel für die Pflege der Einfriedung konnten
von den restlichen noch verbliebenen Deutschen nicht mehr aufgebracht werden. An den gepflegten Gräbern konnte man noch
erkennen dass es Verwandte von noch in Rohmanen wohnenden Deutschen waren, oder von bereits im Westen Deutschlands
lebenden, die ihre noch in Rohmanen wohnenden Nachbarn damit beauftragt hatten. Die übrigen Gräber wurden von Jahr zu
Jahr immer mehr von Wildkräutern überwuchert und schließlich auch von Sträuchern und schnell wachsenden Bäumen.
In den späteren Jahren konnte man nicht mehr erkennen dass dort vor Jahren Tote zur letzten Ruhe gebettet wurden. Die
Natur holte sich das ganze Gelände zurück und nur unter großen Schwierigkeiten konnten Besucher aus dem Westen das
Friedhofsgelände noch betreten.
Das Gasthaus Trzaska

Nach dem ersten Weltkrieg hat der Gastwirt Friedrich Trzaska neben dem Gasthof einen großen Saal
für Festlichkeiten und Vereinsfeiern gebaut, in dem schon mal Feuerwehrfeste veranstaltet wurden. Ernst Trzaska war
Feuerkommissar bei der Ostpreußischen Feuersozität. Erich Trzaska war Vollziehungsbeamter beim Amtsgericht in
Ortelsburg. Unser Feuerkommissar war uns beim organisieren der Veranstaltungen sehr behilflich, hat uns den Saal, die
Musik und die Theaterstücke besorgt und die Feuerwehren aus den Nachbardörfern eingeladen.
Zu Manöverzeiten, vor dem 2. Weltkrieg und dann auch während des Krieges, waren im Gasthof Soldaten, meist im Range
eines Offiziers, einquartiert. Fräulein Mariechen Trzaska hat die Poststelle im Dorf betreut. Nachdem ich 1939 zum
Militär eingezogen wurde, hat sie, nach einer Schulung im Ortelsburger Krankenhaus, auch die Unfallmeldestelle
übernommen. Nach dem Krieg, pflegte sie mit vielen Bekannten, die bereits in der Bundesrepublik wohnten, einen regen
Briefwechsel. Auf dem Rohmaner Friedhof hat sie viele Gräber, im Auftrag von Angehörigen, die auf Grund ihrer
Abwesenheit, dazu nicht mehr in der Lage waren, gepflegt. Der Bauunternehmer Kurnitzki aus Ortelsburg, äußerte die
Bitte, sie möchte ihm doch ein Blatt vom Rosenstrauch, der auf dem Grab seiner Eltern steht, in den Brief legen. Als
sie uns den Brief vorgelesen hat, waren wir zu Tränen Gerührt. Sie hat als Letzte aus ihrer Familie, bis zu ihrem Tod
im Jahre 1960, in Rohmanen, im Gebäude der Gastwirtschaft gewohnt und ist auf dem Rohmaner Friedhof beerdigt worden.
Fleisch und Wurstwaren Karl Pelkowski
Im Jahr 1931 hat der Fleischermeister Karl Pelkowski, aus Grammen, direkt neben unserem Hof ein
Anwesen gekauft und dort eine Fleischerei eingerichtet. Er war mit meiner Schwester Frieda, verheiratet. Am Anfang hat
er die Schweine noch auf seinem Hof geschlachtet, später dann im Ortelsburger Schlachthof. Jede Woche fuhr er 2-mal,
mit dem Pferdewagen(Einspänner), nach Ortelsburg zum Wochenmarkt, wo er seine Fleisch und Wurstwaren zu Verkauf anbot.
Am Tag davor, wenn er die Wurst gekocht hat, kamen viele Rohmaner mit Kannen oder anderen Gefäßen, wegen der guten
Wurstsuppe, die er umsonst unter die Leute verteilte. Als Karl Pelkowski, Ende August 1939 zum Militär eingezogen
wurde, hat seine Frau das Pferd verkauft und den Beitrieb stillgelegt. Am Haus hing, immer noch die Tafel mit der
Aufschrift: Karl Pelkowski, Fleisch und Wurstwaren. Ein Witzbold hat irgendwann darunter geschrieben; „Fleisch und
Wurst waren einmal”, drauf hin hat Frau Pelkowski die Tafel entfernen lassen. Karl Pelkowski ist im Mai 1946 in
französischer Gefangenschaft verstorben. Seine Ehefrau Frieda, verstarb an ihrem 85. Geburtstag in Mettmann bei
Düsseldorf.
Die steinreichen Rohmaner Felder
Die letzte Eiszeit hat bei der Schmelze, auf der Rohmaner Feldgemarkung viele Steine und
Granitblöcke zurück gelassen. Überirdisch, aber besonders unter der Erde, gab es viele kleine, aber auch große Steine,
die, den Bauern, beim Pflügen und anderen Feldarbeiten sehr viel Schweiß, abverlangten. In einer Kiesgrube, auf dem
Feld des Bauern August Radek, lag ein Granitblock, von schätzungsweise 100 cbm. Vor etwa 80 Jahren, als man für diese
Steine noch keine Verwendung hatte, griffen die Bauern zu einer „List”. Weil er sonst nicht pflügen konnte, hat mancher
seinem Nachbarn, die Steine in der Nacht auf dessen Feld abgeladen. Als diese Tätigkeit unter Strafe gestellt wurde,
hat man die Steine in Schluchten gekippt und mit Mutterboden zugeschüttet. In späteren Jahren kam diese jedoch beim
pflügen wieder an die Oberfläche. Dann hat man aber schon Steine für den Straßenbau gebraucht und konnte sie so zu Geld
machen. Besonders im Raum südlich von Ortelsburg, bis zur polnischen Grenze, wo Steine eine Rarität waren, kamen sie
jetzt zum Einsatz. Auch beim Bau von Häusern, besonders für die Fundamente, wurden sie eingesetzt, weil auf diese
Weise viel Ziegeln eingespart wurden. Die Firma Gribienski aus Ortelsburg hat die großen Steine mit Dynamit gesprengt
und auf diese Weise die weitere Verarbeitung erleichtert.
Die Steine welche beim Pflügen aus dem Boden geholt wurden, hat man am Feldrand auf große Haufen zusammen getragen.
Wenn die Feldarbeit beendet war, sowie auch in den Wintermonaten, waren wir jeden Tag mit Steinen unterwegs. Wir sind
vorwiegend am Abend los gefahren, weil unter der schweren Last die Wagenachsen so heiß wurden und die Gefahr bestand,
das durch die Dehnung, die Räder blockiert würden. Bei einer Fahrt konnte man bis zu 24 Reichsmark verdienen, wogegen
1 Zentner Roggen für 8 bis 9 Reichsmark zu haben war. Ich bin selbst, mit dem Pferdewagen bis Fürstenwalde, Radostowen,
Luka, Altkirchen, Höhenwerder, ja sogar bis Friedrichshof gefahren.
In Rohmanen wurden auch rote Ziegeln gebrannt. Viele Häuser wurden, mit Ziegeln erbaut, die nur wenige 100 Meter von
der Baustelle entfernt hergestellt wurden. Der Lehn wurde auf den Feldern in der näheren Umgebung entnommen, dann von
Ochsen solange getreten, bis er so geschmeidig war, das er sich in Formen einstreichen ließ. Wenn die Ziegel in der
Form trocken war, wurde sie entnommen und in einem Brennofen gestapelt. Um einen Ofen richtig anzufeuern, brauchte man
12 Raummeter Holz, das im Zeitraum von ein par Tagen verheizt wurde. Der Fischer Karl Glitza hatte schon eine
Knetmaschine, die von einem Pferd angetrieben wurde, das mit verbundenen Augen, den ganzen Tag in die Runde ging.
Im Dorf waren auch vier Kalköfen, in denen so genannte Kalksteine, die sich an gewissen Stellen, im Erdboden befanden,
gebrannt wurden. Nach dem Brennen wurden die Steine mit Wasser abgelöscht und die daraus entstandne Masse diente, nach
dem Beimischen einer gewissen Menge Sand, dann als Bindemittel beim Häuserbau. Das Gerichtsgebäude und das
Lehrerseminar in Ortelsburg wurden mit Kalk, aus dem Rohmaner Brennöfen erbaut. Auch zum Bau einer Eisenbahnbrücke, auf
der, der Zug, den Sawitzfluß, von Ortelsburg nach Allenstein überquerte, hat mein Großvater, mit einem Ochsengespann,
Kalk gefahren.
Hinter der Scheune, beim Bauern Johann Dembek hat man Tonerde gefördert, aus der man mit Hilfe einer Formerscheibe,
die von einem Arbeiter mit Muskelkraft(Fußbetrieb) angetrieben wurde, schöne Krüge, Schalen und Vasen geformt hat.
Die Töpferware wurde, nachdem sie trocken genug war, auch in einem Ofen gebrannt, anschließend mit einer Lasur
überzogen und wieder gebrannt. Es wurden auch Kacheln zum Bau von Kachelöfen hergestellt, die mit verschiedenen
Ornamenten versehen, die Wohnstuben unserer Vorfahren schmückten. So haben unsere Großväter ihr Leben gemeistert und
nach und nach, unsere Dörfer aus der Rückständigkeit in die Neuzeit geführt.
Das gesellschaftliche Leben nach dem 1. Weltkrieg

Als der Lehrer Alfred Dorka, ein Frontkämpfer des Ersten Weltkrieges und ein Sportsmann, als
zweite Lehrkraft an der Rohmaner Schule angestellt wurde, hat er die Sitten und Gebräuche aus früherer Zeit wieder zum
Leben erweckt. Zuerst hat er die Jugend zusammen gerufen, einen Jugendverein und einen Fußballclub, gegründet. Zum
Vorsitzenden des Fußballclubs wurde Johann Gloddek berufen, der ihn auch geleitet hat. Bauer Wilhelm Spittka, der am
Rohmaner See wohnte, stellte Land für einen Sportplatz unentgeltlich zur Verfügung. Lehrer Alfred Dorka hat am
Rohmaner See eine Badestelle ausgesucht und ein Sprungbrett bauen lassen. An jedem Sonnabend im Sommer, bevor die
Sonne unterging, versammelte sich die gestammte Jugend des Dorfes an der Badestelle am See. Es wurde gebadet,
Heimatlieder gesungen, gespielt, im Fackelschein eines großen Biwakfeuers, bis in die späte Nacht hinein. Der Fischer
Karl Glitza hat uns Kähne zur Verfügung gestellt, mit denen wir auf den See hinausgepaddelt sind, dabei hatten wir viel
Spaß, was wiederum den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft gefördert hat. Ich habe mit meiner Mandoline den Gesang von
Volks- und Heimatliedern begleitet.
Der Rohmaner See liegt in einem Tal, dessen Hänge zu beiden Seiten mit Kiefern und Tannen bewaldet sind. Wenn man
gesungen oder Musiziert hat, hallte es von den Hängen zurück. Die Ufer waren mit Kalmus und Schilf bewachsen, was für
die Fischaufzucht von Vorteil war. Wenn man an einem sonnigen, windstillen Tag, am Seeufer spazieren ging, traf man
oft auf Flachstellen, an denen sich die Fischbrut im Sonnenlicht wärmte, wie ein Mückenschwarm. Im See befanden sich
folgende Fische: Karpfen, Hechte, Schleie, Barsche Plötze, Rotaugen, Aale und Krebse. Am Sonntagmorgen brachten viele
Rohmaner ihre Pferde zum See um sie zu baden.
Es wurden dort, unter der Aufsicht von Lehrer Dorka, auch viele Jugendfeste mit Theatervorführungen veranstaltet, zu
denen er selbst die Vorlagen organisiert hat. Der am See wohnende Bauer Johann Nadrowski, hat uns ein Scheunentor, als
Tanzboden zur Verfügung gestellt. Der Zimmermann Wilhelm Wittek hat uns eine Windmühle gebaut, die am auf dem Boden
liegenden Scheunentor aufgestellt wurde, dazu kamen Noch Tannen und Fichten, die das Ganze wie ein Bühnenbild
erscheinen ließen. Es wunden viele Bühnenstücke aufgeführt, unter anderen >Alte Weiber werden jung gemahlen<. Dazu bot
die Windmühle die entsprechende Kulisse.
Nach der Vorführung wurde der Boden aufgeräumt, um dann als Tanzdiele zur Verfügung zu stehen. Der Gastwirt Trzaska
hatte Tische und Bänke aufgestellt, Speisen und Getränke angeboten, so dass sich die die Veranstaltung bis in die
späte Nacht hinein zog. Es waren auch Leute aus Ortelsburg und anderen Nachbardörfern dabei. Im Winter hat Lehrer
Dorka eine Kreisrodelbahn eingerichtet, die von Zeit zu Zeit mit Wasser besprengt wurde, um die Gleitfähigkeit zu
verbessern. Von einer Anhöhe ging hinunter bis auf den halben See, was für alle ein großes Vergnügen war. Es kamen
Lehrer mit Schulklassen aus der näheren Umgebung um hier zu Rodeln.
Als Herr Lehrer Jobski als Hauptlehrer nach Rohmanen kam hat er mit dem Bürgermeister und der Gemeindeverwaltung
beschlossen, in der Nähe des Dorfes, auf einem zur Schule gehörenden Grundstück, einen Sportplatz anzulegen. Dafür
wurde gleich hinter den Gärten, 6 Morgen Ackerland abgetrennt, und nach Feierabend hat Lehrer Dorka mit den
Jugendlichen eingeebnet und gleich nebenan einen Graben für Schützenstand und Kugelfang ausgehoben. Am Sonntagvormittag
wurde Fußball gespielt und um 15:00 Uhr war Kleinkalieberschießen angesagt. Es musste auch ein kleiner Beitrag erhoben
werden, um Munition kaufen zu können. Eine Büchse konnten wir aus beim Kleinkalieberverein in Ortelsburg ausleihen.
Nach Hitlers Machtergreifung
Als Adolf Hitler an die Macht kam wurde die SA gegründet. Der Bürgermeister Michael Kownatzki
wurde zum Gruppenführer ernannt und folgende Männer haben sich freiwillig gemeldet: Wilhelm Matzey, Johann Gloddek,
Gustav Nadrowski, August Buttler, Karl Baran, Emil Nickel, Wilhelm Jaschinski, Emil Bork, Ernst Rattay und Gustav Bach.
Bei Versammlungen war die SA in Uniform angetreten um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Wer versucht hat Unruhe zu
stiften, egal aus welchem Grunde, wurde aufgefordert den Saal zu verlassen, andernfalls wurde er mit Gewalt entfernt.
Herr Lehrer Jobski wurde zum politischen Leiter ernannt, seine Frau hat die NS-Frauenschaft gegründet, Lehrer Dorka
die HJ, und so bekam die Dorfgemeinschaft, nach und nach ein anderes Gesicht. Der Sportplatz und der Schützenstand
wurden jetzt mehr als früher in den Mittelpunkt gestellt. Nach der Feldarbeit hat der Bürgermeister Fuhrwerke bestellt
und den Sportplatz noch besser herrichten lassen.
Der Bauer Wilhelm Both wurde zum Ortsbauernführer ernannt, mit der Aufgabe alles Land für den Anbau von Getreide und
Futtermittel bereitzustellen, oder wenn das nicht möglich war mit Wald aufzuforsten. Durch den Einsatz von Kunstdüngern
sollten größere Erträge aus dem Boden geholt werden, um den Viehbestand zu vergrößern und mehr Milch und Butter zu
produzieren. Deutschland sollte im Stande sein sich selbst zu selbst zu ernähren, ohne auf Importe angewiesen zu sein.
Frau Jobski hat, innerhalb der der NS-Frauenschaft, mit Hilfe von Fachkräften aus Ortelsburg, Lehrgänge veranstaltet,
auf denen man Backen und Nähen lernte. Auf den Bauernhöfen befand sich auch immer mehr Rassegeflügel, das eine erhöhte
Produktion von Eiern und Geflügelfleisch sicherstellen sollte.
Die Rohmaner Bauern hatten, außer in der Landwirtschaft, noch andere Verdienstmöglichkeiten in der Kreisstadt. In
Ortelsburg wurden vier Sägewerke betrieben, die mit Langholz aus dem Walde versorgt werden mussten. Wir haben eine
Kiefer von über 8 Festmeter angefahren, der wir zuerst 6 Meter Spitze abschneiden mussten, um diese Last überhaupt
auf den Wagen zu bekommen. Sechs Pferde musste angespannt werden um den Wagen zur befestigten Straße zu bringen.
Fichten und Tannen wuchsen bis zu einer Länge von 30 Metern. Auch beim Transport von Ziegel, von der Ziegelei zum
Bahnhof, konnte man gutes Geld verdienen.
Im Jahr 1934 wurde Rohmanen an das überregionale Stromnetz angeschlossen und schaffte auf diese Weise den Sprung von
der Petroleumlampe zur Glühbirne. Neben dem Grundstück von Karl Pietzonka wurde ein Transformatorhäuschen errichtet,
in dem der ankommende Strom von einer Hochspannung auf eine Verbrauchsspannung transformiert wurde. Es gab schon eine
Überlandleitung, die aus Richtung Ortelsburg kommend, quer über die Felder, in Richtung Neu Keykuth weiter ging.
Durch eine Zwischenspanne wurde der Transformator, mit der Hauptleitung auf Kownatzkis Feld verbunden.
Ein Stromanschluss konnte die Arbeit im Haus und Hof auf vielfältige Weise erleichtern, doch nur die besser gestellten
Bauern, sowie noch manche Pensionäre, die ein festes Einkommen hatten, konnten sich dass leisten. Weil nur wenige an
der Elektrifizierung teilnahmen, war ein Stromanschluss mit hohen Kosten verbunden. Nur Gustav Pietzonka, Gasthof
Trzaska, Friedrich Nickel, die Schule und Wilhelm Both, wurden in der ersten Phase erfasst.
Im Jahr 1952 wurde von den polnischen Behörden die zweite Stufe der Elektrifizierung eingeleitet, in der alle im Dorf
stehen Gebäude erfasst wurden. Am Anfang wurden nur Leitungen für Lichtstrom gelegt und auch nur 3 Lichtstellen pro
Haushalt bewilligt. Doch im nachfolgenden Zeitraum wurden dann, wenn Material vorhanden war, weitere Lichtpunkte
angelegt. 1952, am zweiten Wochenende im Advent, wurden dann die Leitungen geschaltet und alle waren von der
plötzlichen Helligkeit sehr begeistert. Wenn man Glühbirnen auswechseln wollte musste man am Anfang weite Wege
zurücklegen, um welche zu bekommen. In den 60ger Jahren wurden dann immer mehr Starkstromleitungen gelegt, weil die
Bauern elektrische Geräte kaufen konnten. Ende der 60ger wurden auch die Abbauten an das Stromnetz angeschlossen.
Das Urnengrab auf unserem Feld
Auf unserem Feld, in Richtung Seelonken, bin ich oft beim pflügen gegen Steine gestoßen, manchmal
rissen sogar die Stränge am Pferdegeschirr. Eines Tages nahm ich einen Spaten, Brechstange und einen langen Baum, um
der Sache auf den Grund zu gehen. Als ich eine Menge Sand ausgehoben hatte stieß ich auf eine steile, aus Steinen
errichtete Wand, die ich auch mit dem Baum nicht aus der Fassung bringen konnte. Ich habe den ganzen Vormittag gegraben,
konnte jedoch nicht unter die Steine kommen. Einige Tage später hatten wir in der Schule eine Bauernversammlung, da
habe ich Herrn Biella und Herrn Lehrer Dorka von meinem Fund berichtet. Am nächsten Morgen kam der Lehrer Dorka mit der
ganzen Schulklasse, mit Spaten und Sieben ausgerüstet auf unser Feld und fingen an die ausgehobene Erde zu sieben.
Lehrer Dorka benachrichtigte daraufhin den Leiter des Ortelsburger Heimatmuseums, der am nächsten Morgen vorbei kam um
sich die Fundstelle genau anzusehen. Er beauftragte ihn 4 Mann zu besorgen, um die Steine ringsum frei zu schaufeln.
Zwischen den Steinen durften wir die Erde nur mit Esslöffeln ausheben. Als es plötzlich zu regnen anfing hat Lehrer
Dorka die Brauerei Daum, in Ortelsburg angerufen, die uns über der Fundstelle ein Zelt errichtet haben, damit wir
ungestört weiterarbeiten konnten. Wir fanden 8 flache und 8 hohe Urnen zu beiden Seiten am Körper. Die Urnen wurden in
Gipsbinden eingewickelt und ins Heimatmuseum nach Ortelsburg gebracht, wo sie durch einen Fachmann, der extra aus einem
Königsberger Museum angereist war. Nach Reinigung der Urnen hat er festgestellt, das die Grabstätte etwa 2000 Jahre vor
Christi Geburt angelegt wurde und ein Doppelgrab war, in dem ein Toter liegend und einer in Hochstellung beigesetzt
wurde.
Die Nachricht von der Fundstelle verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Es erschienen viele Schaulustige, ganze
Schulklassen aus der Umgebung, mit Autos und zu Fuß. Durch die vielen Menschen wurden die bestellten Ackerflächen auf
unserem Feld sehr in Mitleidenschaft gezogen, eine Entschädigung haben wir nicht erhalten. Das Grab wurde vor dem
Heimatmuseum in Ortelsburg wieder so aufgebaut wie man es auf unserem Feld vorgefunden hat. Für den Transport der
Steine wurde ich entlohnt. Die Urnen hat das Königsberger Museum an sich genommen und wollte sie nicht wieder hergeben,
weil die solch einen Fund noch nicht in ihrer Sammlung hatten.
Sonnenwendfeuer
Am 24 Juni fand eine Sonnenwendfeier statt. Ein Brauch der an die alten Germanen erinnern sollte.
Der Lehrer Dorka hat den Bürgermeister beauftragt 2 Fuhrwerke in den Wald zu schicken, die Holz und alten Reisig holen
und auf dem großen Schulberg abladen sollten. Das Straßenbauamt hat uns Teertonnen zur Verfügung gestellt. Die ganze
Dorfgemeinschaft wurde eingeladen, am Abend, nach der Feldarbeit, an der Sonnenwendfeier teilzunehmen. Lehrer Dorka
hielt zuerst eine Ansprache, in der er anschaulich erklärte wie unsere Vorfahren in grauer Vorzeit gefeiert haben.
Nach dem offiziellen Teil wurden das Holz und die Teertonnen angezündet, es wurden Heimatlieder gesungen, wie: Wild
flutet der See, drauf schaukelt der Schiffer den schwankenden Kahn, Schaum wälzt er wie Schnee, von grausiger Mitte
zum Ufer heran, wild fluten die Wellen auf Vaterlands See, wie schön, oh trag mich auf Spiegel zu Hügel, Masovias See.
Masovia Land, mein Heimatland, Masovia es lebe mein Vaterland.
Lehrer Alfred Dorka und sein Wirken für Rohmanen.

Friedrich Biella hatte auf seinem Feld einen Granitstein mit einer geraden Seite, den haben wir
mit viel Schweiß an den Dorfteich transportiert und auf einer Erhöhung abgelegt. Der Stein sollte zum Denkmahl für die
Gefallenen des Ersten Weltkrieges umgestaltet werden. Da zu Wenige daran ein Interesse zeigten, wurde diese Idee fallen
gelassen und der Stein irgendwann ins Wasser gerollt. Der Lehrer Dorka war viele Jahre in Rohmanen tätig, dort hat er
später seine ehemalige Schülerin, Lotte Biella geheiratet. Er hat sich sehr für die Entwicklung des Dorfes interessiert,
war bei jeder Gemeindeversammlung anwesend und hat auf Schwachstellen hingewiesen die den Fortschritt behinderten.
Gemeinsam mit den Schülern hat er den Ehrenfriedhof für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges gepflegt, an der
Wegegablung nach Eichtal und zu Ehren des Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg eine Eiche gepflanzt.
Zum Advent hat Lehrer Dorka mit der Jugend einen Adventstern, in verschiedenen Farben gebastelt.
Der Stern wurde auf einer 2 Meter langen Stange befestigt, in der Mitte wurde ein Wachslicht angezündet, am Stern
wurde eine Schnur angebracht, wenn man daran zog rollte der Stern hin und her. Am ersten Wochenende im Advent
versammelten sich jung und alt, um den Stern durch das Dorf zu tragen. Alle schlossen sich dem vorausgehenden
Sternträger an, der den Stern durch die Hauptstraße und die angrenzenden Wege trug. Dieser Sternmarsch wurde an den
folgenden Adventwochenenden wiederholt.
Am ersten Weihnachtfeiertag wurde um 4:00 Uhr morgens ein Frühgottesdienst gehalten. Zuerst hat der Pfarrer eine
Andacht gehalten, dann haben die Kinder ein Krippenspiel aufgeführt und die Gemeinde hat schöne Weihnachtslieder
gesungen. Der Gastwirt Trzaska hat uns den Saal zur Verfügung gestellt. Wir hatten eine Posaunen- u. eine
Gitarrengruppe. Unter der Leitung von Herrn Willi Doormann spielten: Gottlieb Brosch, Fritz Ollech,
Gustav Rattay(Sopran), Wilhelm Pilath, Gustav Brosch(Alt), Fritz Both(Tenor) und Fritz Brosch(Bass).
In der Gitarrengruppe wirkten mit: Martha Ollech, Hedwig Ollech, Martha Lekzik, Martha Michalick und Auguste Lekzick.
Willy Doormann hat sie auf der Geige begleitet.
Kurz vor Ausbruch des 2. Weltkrieges
Bei der Aufstellung des Grenzschutzes(Regiment Buchholz), hat er als Hauptfeldwebel die
Gruppenführerkurse überwacht und selbst die fähigsten Männer dafür vorgeschlagen. Das Ausbildungspersonal hat das
Jäger-Battalion gestellt. Wir kamen zuerst ins Stadion(Waldheim), wurden da eingekleidet und dann ging es gleich
kasernenmäßig zu, theoretisch und praktisch. Jeder musste vor die Front treten und nachweisen ob er im Stande ist,
Befehle zu erteilen. Abends wurden Filme vorgeführt die uns zeigen sollten wie eine Gruppe sich im Gelände entfalten
muss. Die Exerziervorschriften hatten sich, im Verhältnis zu Kaiser Wilhelms Zeiten, etwas geändert. Damals bestand
eine Gruppe aus 8 Mann und einem Unteroffizier, jetzt aus 10 Schützen, 3 für das leichte Maschinengewehr und einem
Unteroffizier(13 Mann). Nach der Schulung folgte eine Abschlussprüfung, danach ein gemütliches Beisammensein. Aus
Rohmanen haben folgende Männer die Prüfung bestanden: Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy, Gustav Rattay und
Gustav Deptolla. Unsere Uniformen waren alle zu klein und es gab viel zu lachen bei der Anprobe.
Die erste Übung habe ich mit Emil Rosowski, in Lenzinen gemacht. Der Gutsbesitzer Marzinzick hat seine Scheune als
Unterkunft zur Verfügung gestellt. Er war im Range eines Hauptfeldwebels. In seinem haus war die Schreibstube
untergebracht, die er selbst verwaltete. Ein Lastauto hatte Uniformen aus der Kaserne in Ortelsburg geholt, jeder
musste eine Uniform anlegen und dann wurde solange getauscht bis alle eine passende gefunden hatten. An den Namen des
Kompanieführers kann ich mich nicht mehr erinnern. 1935 wurden wir zu einer Übung in die Dragonerkaserne nach Lyk
einberufen. Die Gruppenführer, Zugführer, und Kompanieführer die schon Frontberührung im dem Ersten Weltkrieg hatten,
mussten eine Woche früher anreisen. Die Übungen waren auf 6 Wochen angelegt. Die meisten der einberufenen waren noch
nie mit dem Wehrdienst in Berührung gekommen. Jeder Gruppenführer bekam 13 Mann zugeteilt.
Unser Zugführer war Leutnant Neumann, Kompanieführer Oberleutnant Rutschko, Battalions-Kommandeur Major Gröning
(Regiment Buchholz). Hier ging es wieder Kasernenmäßig voran. Das Bataillon wurde hier vereidigt. Jeden zweiten
Sonntag durften unsere Frauen uns besuchen. Ein Jahr später wurden wir wieder zu einer Übung einberufen, auf den
Truppenübungsplatz nach Arys. Jeder Gruppenführer hatte den Auftrag die Gruppe zu entfalten, und auf bewegliche
Figuren zu schießen. Diese Übung musste später mit scharfer Munition wiederholt werden. Jedes Maschinengewehr bekam
50 Schuss, jeder Schütze 20 Schuss zugeteilt. Nach dem Abschießen wurden die Treffer gezählt und dem Kommandierenden
Bericht erstattet. In einiger Entfernung spaziert ein Storch umher, der gar nicht bemerkt hatte dass geschossen wurde,
was bei den Kameraden ein großes Gelächter hervorrief.
Nach der Übung wurde uns gesagt das jeder Gruppenführer eine arische Abstammung nachweisen sollte. Ich konnte in den
Rheinsweiner Kirchenbüchern meine Vorfahren aus Gellen, bis zum Jahr 1732 zurück, nachweisen und wurde zum
Unteroffizier befördert. Aus unserem Dorf wurden auch, Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy und Gustav Deptolla
befördert. Zwischendurch mussten wir schon mal in die Radfahrer-Kaserne nach Ortelsburg, Gewehre empfangen und im
Gelände üben. Am 31 Juli 1939 wurde mir von einem Soldaten ein Schreiben übereicht, das mich aufforderte, am 1. August
um 6:00 Uhr, bei der 3. Kompanie, des 2. Infanterieregiments zu erscheinen.
Um 5:30 hat mich meine Schwester in die Kaserne gebracht. Auf der Schreibstube erklärte mir der Hauptfeldwebel,
dass mir ab sofort der Dienstgrad eines Sanitäters zugewiesen wird, ich mich in der Kammer einzukleiden hätte und mir
in der Handwerkerstube die entsprechenden Schulterklappen annähen lassen sollte. Die aktiven Sanitäter wurden den
Feldlazaretten zugewiesen und wir kamen an ihre Stelle. Unser Bataillon wurde nach Schodmak zum Bunker bauen und
Stacheldraht verlegen eingeteilt. Wir zogen in Begleitung einer Musikkapelle bis zur Kreuzung am Krankenhaus, dann
weiter zu unserem Bestimmungsort, gefolgt von einer Gulaschkanone die in den nächsten Tagen für unsere Verpflegung
sorgen sollte.
Am 14 August haben wir die Jägerkaserne, begleitet von einer Musikkapelle endgültig verlassen und zogen zuerst durch
Ortelsburg, dann über Lehmanen ins Feldmanöver, hinter Rohmanen. Dort entfaltete sich das Bataillon im Gelände, die
Verwundetensammelstelle wurde auf dem Hof des Bauern Friedrich Neumann eingerichtet. Gegen Abend wurde zu Sammeln
geblasen und Biwak bezogen, wobei unsere 3.Kompanie, in einem kleinen Wallt, in der Nähe von Otto Nickels Gehöft
Stellung bezogen hatte. Die 2. und 4. Kompanie hatte sich in der Nähe vom Abbau Pallasch niedergelassen. Die Frau
Nickel hat am Abend ein Mädel in Dorf geschickt um meiner Frau Bescheid zu sagen, wo wir uns zurzeit befinden. Meine
Frau ist dann noch gekommen um sich von mir zu verabschieden, weil wir am nächsten Morgen um 3:00 Uhr Zelte abbrechen
und um 4:00 Uhr in Richtung Kaspersguth marschieren sollten.
Wir sind dann über Achodden, Seelonken, Lehmanen, Ortelsburg, bis nach Grammen und Schützendorf marschiert, wo wir an
einem See Biwak bezogen haben. Es wurde immer gesagt, wir kommen zum Tannenberg-Denkmal bei Hohenstein, wo ein Reichs
Kriegervereinsfest stattfinden sollte. Es wurden auch schon Vorkommandos aufgestellt, doch dann kamen wir nach Orlau
und Lahna-Mühle, da wo die Alle entspringt haben wir 2 Tage biwakiert. Unser Kompanieführer hat uns nach Waplitz auf
den Soldatenfriedhof des Ersten Weltkrieges geführt und uns erklärt wie das Jägerbataillon sich 1914 hier entfaltet
hat und aufgerieben wurde. Dann mussten wir in der Nähe von Gut Koslau über einen Fluss und bezogen in einem Waldstück,
vorbereitete Stellungen in der Nähe der polnischen Grenze. Herr und Frau Thalmann haben uns jeden Tag, bis zur Grenze,
mit Brötchen und Getränken versorgt. Es wurde scharfe Munition ausgegeben, weil wir am nächsten Morgen um 4:00 Uhr die
polnische Grenze überschreiten sollten.
Am nächsten Morgen um 10 Minuten vor 4:00 Uhr kam der Befehl; scharfe Munition abgeben, alles zurück in ein 6 Kilometer
entferntes Dorf, wo wir auch einquartiert wurden. Das alles geschah’ eine Woche vor dem 1. September 1939. Es wurde
gesagt dass der Führer dem polnischen Präsidenten Rid-Szmigly, ein Ultimatum gestellt hat und es wahrscheinlich nicht
zum Krieg mit Polen kommt. Genau nach 5 Tagen kehrten wir wieder in die gleichen Stellungen zurück, es wurde wieder
scharfe Munition ausgegeben und am nächsten Morgen um 4:00 Uhr überschritten wir die polnische Grenze.
“Der 2. Weltkrieg.”
Der erste Einsatz in Polen
Wir kamen zuerst in ein Dorf in dem sich nur alte Menschen befanden. Auf unsere Frage wo denn die Bewohner wären sagte
man uns dass alle geflohen sind, weil erzählt wurde, die Deutschen würden alle Polen misshandeln und verstümmeln. Ich
habe ihnen daraufhin gesagt dass uns, unter Androhung von Strafe verboten wurde, einem Zivilisten etwas anzutun. Das
Vieh, die Schweine und Hunde des Dorfes liefen frei herum und die Soldaten fingen an auf die Hunde zu schießen, bis
gesagt wurde es seien Meldehunde im Dienste der Deutschen Wehrmacht und dieser Unfug der eigenen Truppe schaden würde,
weil etwaige Querschläger eigene Kameraden verletzen könnten. Wir gingen weiter auf polnischer Seite entlang der Grenze,
bis wir am Nachmittag die ersten Vorposten der Festung Mlawa erreichten, da befanden wir uns plötzlich im Feuerhagel
polnischer Festungsflack.
Am nächsten Morgen hatte ich schon 3 Verwundete und wusste nicht wo sich eine Verwundeten Sammelstelle befindet. Ich
suchte den Bataillonsgefechtstand auf der sich auf einer Anhöhe befand. Ich habe unseren Oberstabsarzt gefragt wo denn
die Verwundetensammelstelle wäre. Er rief beim Tross an, wo er die Auskunft erhielt, das sich vor dem Dorf ein Bunker
befindet in dem man die Verwundeten sammeln sollte, die dann von Sanitätsautos abgeholt würden, weil das Dorf unter
Artilleriebeschuss stand. Am Sonnabend haben unsere Flieger die Bunkerstellungen bombardiert, konnten aber, trotz guter
Treffer nicht viel ausrichten, die Bunker wurden nur etwas angekratzt.
Der Beschuss unserer vordersten Linien ging mit unverminderter Heftigkeit weiter. Am Sonntag verkündete eine große
Staubwolke die Ankunft unserer Panzer, doch sie kamen nur bis zur Panzersperre und mussten wieder abdrehen ohne den
Polen einen schaden zuzufügen. Ein Panzer bekam einen Volltreffer, der Fahrer konnte noch umkehren. Er blutete am Kopf
und der Schütze war so eingeklemmt, das wir ihn nur mit einem Seil unter den Armen, durch die Luke nach oben ziehen
konnten. Ob er seine Verwundung überlebt hat ist mir nicht bekannt, denn in der Nacht wurden Panzergeschütze nach
vorne in Stellung gebracht, die direkt in die Schießscharten der Bunker geschossen und so die Verteidiger vertrieben
haben. Daraufhin sind wir weiter vorgerückt. Auf einer Wiese war ein tiefer Graben ausgehoben und mit Ästen getarnt,
da war ein Panzer hinein gefahren, so dass nur das Hinterteil herausragte und er sich nicht aus eigner Kraft befreien
konnte. In der Luft waren Flieger die Brandbomben abwarfen, ich habe mich auf den Boden geworfen weil ich dachte die
würden explodieren, aber sie zischten nur, so das Stoppeln und Graß rings herum in Brand gerieten.
Bei den Kampfhandlungen gab es mehrere Verwundete, denen ich gerade Verbände anlegen wollte, als unser Hauptmann zur
Trillerpfeife griff um mir klar zu machen, dass ich ihm folgen sollte. Die Polen fingen an zu schreien, ich sollte
sie ins Lazarett bringen denn hier im Wald würde sie niemand finden. Ich setzte mich aufs Fahrrad und folgte unserem
Kompanieführer, der mir sagte ich soll immer bei der kämpfenden Truppe bleiben, denn hinter der Front sind die
Sanitätsabteilungen, die werden die Verwundeten schon versorgen. Der Vormarsch dauerte bis in die späte Nacht. Auf
einem Gehöft, das nach allen Seiten durch Feldwachen abgesichert wurde, machten wir endlich Rast. Wir haben
Getreidegarben auf dem Hof ausgebreitet und uns zur Ruhe gelegt, als plötzlich um Mitternacht Leuchtraketen den Himmel
erhellten und Maschinengewehrfeuer uns aus dem Schlaf schreckte. Ein par polnische Soldaten hatten das Feuer eröffnet,
aber sich kurz darauf ergeben.
Die Narew-Überquerung
Als es hell wurde ging der Vormarsch weiter. Es wurde uns untersagt Tagebuch zu führen, darum
weiß ich nicht wie die Orte hießen, durch die wir marschiert sind. Als wir durch ein sumpfiges Gelände vor drangen
stand auf einer Anhöhe am Horizont, die polnische Artillerie, die uns sofort unter Beschuss nahm. Unser Hauptmann war
der Meinung dass wir schon in der Nähe des Flusses Narew sein müssten, als aus den Sträuchern ein mit Schlauchboten
beladenes Lastauto auftauchte. Wir wurden aufgefordert mit je 6 Mann ein Schlauchboot zu nehmen, an einem Aggregat
der daneben stand mit Luft zu füllen und zu Wasser zu lassen. In einer Stunde war das ganze Bataillon über die Narew,
wo der Vormarsch fortgesetzt wurde. In einem Dorf überraschte uns die polnische Kavallerie und fing sofort mit
Maschinengewehren zu schießen an. Da kam der Befehl: Alles wieder zurück. Es ging noch schneller als auf der Hinfahrt.
Wir sind erst einige Kilometer am Fluss entlang gegangen und haben dann zum zweiten Mal rüber gesetzt.
Die Gehöfte im Dorf standen alle in Brand. Auf einem waren viele Bienestöcke. 2 Kameraden wollten den Stöcken Waben
entnehmen, doch die Bienen durch das Feuer aufgeschreckt, überfielen sie sofort und stachen derart zu das sie nicht
mehr wieder zu erkennen waren. Ich habe die Einstichstellen mit Salmiak betupft, mehr konnte ich nicht tun. Wir mussten
auf unserem Vormarsch durch einen Wald der in Flammen stand, so dass man kaum atmen konnte. Es ging weiter in Richtung
Minsk und Warschau, wo schon die Sowjetische Armee durchgegangen war, die Pferde und Vieh von einem Gut mitgenommen
hatten. In einem Wald stießen wir unverhofft auf ein Kloster, in dem wir einige Gefangene machten. Dann trafen wir auf
eine gute Straße die nach Grochow ging.
Als wir dort einmarschierten wurden wir aus den oberen Stockwerken beschossen, so dass wir, um uns zu schützen, nur an
den Hauswänden entlang gehen konnten. Wir haben jedes Haus nach Feinden durchsucht. Vor einem Haus stand ein Hund der
niemanden reinlassen wollte, solange bis ihn eine Kugel traf. Die polnische Artillerie feuerte von Warschau aus, um
unseren Vormarsch zu stoppen. Wir hatten uns gerade eingegraben als plötzlich deutsche Flieger am Himmel erschienen,
die unsere Stellungen mit Bomben bewarfen und dabei viel Unheil anrichteten. Wir haben sofort Fliegertücher
ausgebreitet und Leuchtraketen abgeschossen. Da ich in dem Graben, den ich kurz zuvor ausgehoben hatte, sofort in
Deckung gegangen bin ist mir zum Glück nichts passiert. Unter den anderen Kameraden gab es viele Verwundete, so dass
ich nicht wusste wem ich zuerst helfen sollte.
Der Oberstabsarzt hat mich sofort tatkräftig unterstützt, so das bald alle Verwundeten versorgt waren, außer einem,
dem ein Bombensplitter den Arm abgerissen hat. Ich habe im 3 große Verbandspäckchen auf die Wunde gelegt, doch die
Blutung ließ sich trotzdem nicht stoppen, so dass er eine Stunde später auf der Krankensammelstelle verstarb. Wir
haben danach in einem Tomatenfeld einen Graben ausgehoben und eine neue Abwehrstellung bezogen. Die Gruppe Schwarz
bekam den Auftrag nach etwaigen versprengten polnischen Verbänden Ausschau zu halten, als sie unerwartet aus einer
Häuserreihe mit Maschinengewehrsalven überschüttet wurden. Der Gruppenführer und noch ein Soldat wurden dabei tödlich
verwundet. Danach wurde noch ein weiter Stoßtrupp, unter der Führung von Leutnant Briskorn, der sich dazu freiwillig
gemeldet hatte, hinaus geschickt um den Gruppenführer und den anderen Toten zu bergen.
Bei diesem Unternehmen, das erfolglos ausging, weil die Toten schon verscharrt waren, durchschlug eine Kugel den
Stahlhelm von Leutnant Briskorn, der auch sofort tot war. Alle Toten wurden später, an der Kirchenmauer in Grochow, in
Särgen beigesetzt: Hauptmann Schönwald sagte, das sie nach dem Kriege auf den Heldenfriedhof nach Ortelsburg überführt
werden. Drei Tage lagen wir bei Grochow in Stellungen, waren dem polnischen Maschinengewehrfeuer sowie den Bomben
deutscher Flugzeuge ausgesetzt. In der Nacht musste ich zu einem Verwundeten in die vorderste Linie und habe den
Rückweg nicht mehr finden können, als plötzlich Gewehrfeuer aufflammte habe ich in den Ruinen Schutz gesucht. Erst im
Morgengrauen konnte ich mich wieder orientieren und zu meinem Unterstand zurückfinden.
Warschau wurde tagelang bombardiert und stand auch unter Artilleriebeschuss. Aus dunklen Rauchwolken kamen oft ganze
Bündel von Papier angeflogen. Die Verwundeten kamen oft auf Krücken zu unserem Unterstand, ich habe sie dann zur
Krankensammelstelle hingeführt. Wir haben auch polnische Zivilpersonen betreut, die während der Kampfhandlungen
verwundet wurden. Als einmal 2 Jungen vorbeiliefen hat einer ihnen nachgerufen sie sollten seiner Frau Bescheid sagen,
er wäre auf der Krankensammelstelle an der Kirche. Als wir dort ankamen war seine Frau, mit einem Kind auf dem Arm,
schon da.
Nach der Kapitulation von Warschau, gingen wir über Sokolow zum Bug und haben dort Quartier bezogen. Der Russe hatte
sich bereits hinter den Fluss zurückgezogen, hatte alles Vieh und Pferde mitgenommen. Dort erreichte mich ein Telegramm
von zu Hause, dass meine Tochter gestorben ist. Es sprach sich auch herum dass verschiedene Heimaturlaub bekommen haben,
ich durfte auch für 14 Tage heim. Wir fuhren mit Lastautos nach Allenstein in die neue Reiterkaserne, zum
Ersatzbatallion, da haben wir unsere Gewehre und Munition abgeben, dann durften wir, jeder in seinen Heimatort
weiterfahren.
Als wir unsere Quartiere am Bug verlassen haben war sehr viel Schnee gefallen. Hier in Ortelsburg fanden wir die
gleiche Wetterlage vor, aber nach 3 Tagen war alles wieder weggetaut und wir konnten die Kartoffelernte, die durch den
frühen Wintereinbruch gestoppt wurde, zu Ende bringen. Ein Tag bevor ich zu Hause angekommen bin wurde die Tochter
beerdigt. Nach 14 Tagen mussten wir uns in Allenstein melden, Gewehre empfangen und wieder zurück zur Division an den
Bug 150 Kilometer hinter Warschau. Die elfte Division, zu der wir auch gehörten sollte in den Westen Deutschlands
verlegt werden und war schon unterwegs zur Verladestation Skiernewice 50 Kilometer vor Warschau.
Mein Dienst als Sanitätsunteroffizier
Unser Bataillon kam in das Städtchen Burscheid, im Kreis Opladen, wo wir in Privatquartieren
untergebracht wurden. Nach 3 Monaten, im Januar 1940, wurden wir nach Solingen verlegt, wo wir bis zum
Frankreichfeldzug stationiert waren. Wir mussten an Feldübungen teilnehmen, wie andere die in Kasernen untergebracht
waren. Während dieser Zeit musste jeder seine Zähne in Ordnung bringen lassen. Jeden Tag fuhren 20 Mann in die
Cäzilienstraße nach Köln, zur Zahnklinik. Im Rheinland wurde unsere Division neu aufgestellt. Ausfälle durch den
Polenfeldzug wurden durch neue Soldaten ergänzt. Ich kam nun zum Ersatzbatallion, war der Älteste in der ganzen
Kompanie. Als der Frankreichfeldzug losging wurde unser Ersatzbatallion mit den noch vorhandenen Verwundeten, in die
neue Reiterkaserne, nach Allenstein verlegt.
Meine Frau hat, mit Unterstützung der Bauernschaft, einen Antrag gestellt, daraufhin wurde ich zur Frühjahrsbestellung,
beurlaubt und später bis auf weiteres vom Militärdienst freigestellt. Als der Russlandfeldzug losging wurde ich von der
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg, für 14 Tage einberufen. Ich war seit 1922, Mitglied der freiwilligen
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg und habe jedes Jahr an Übungen teilgenommen. Jede Bereitschaft musste etliche Leute
stellen. Von Rohmanen wurden Emil Rosowski, Johann Dembek, und ich, zur Krankensammelstelle Wirballen, in Litauen,
abkommandiert. Dorthin kamen Lazarettzüge aus Russland mit der Breitspurbahn. Die Verwundeten wurden frisch verbunden
und auf Waggon mit Normalspur verladen und nach Deutschland gebracht.
Als die 14 Tage vergangen waren wollten wir wieder nach Haus zurück, doch man wollte uns nicht entlassen. Stattdessen
wurden wir dem Wehrkreisamt Königsberg zugeteilt, neu eingekleidet und zur Aushilfe ins Lazarett nach Gumbinnen
abkommandiert. Mehr als ein Jahr war ich in den Urlauber-Baracken, habe dort Krankenstube betreut. Später, bis zum
Dezember 1944, war ich im Reserve-Lazarett 4, in Königsberg tätig. Dort habe ich auch die Luftangriffe der Engländer,
vom 25 bis 26. August 1944 miterlebt.
Wir sollten gerade einen Lazarettzug in Rotenstein entladen, als plötzlich die Sirenen ertönten - Fliegeralarm. Im
gleichen Moment waren die ersten Flugzeuge auch schon da, zuerst warfen sie „Tannenbäume” und danach Foßforkanister ab.
Die Omnibusse standen schon zur Abfahrt bereit als es losging. Wir haben die Verwundeten schnell in den
Luftschutzkeller getragen, haben die Betten von den Fenstern weggerückt damit die Verwundeten nicht von den
Glasssplittern verletzt wurden. Im Kasernenhof brannten die Fosforkanister lichterloh. Unsere Unterkunft, die sich in
einer Baracke befand ist völlig abgebrannt, mit dem Wenigen was wir unser Eigen nannten. Am nächsten Tag wurden wir neu
eingekleidet und am 29. bis 30. kamen die englischen Bomber wieder, sie setzten genau da ihr Zerstörungswerk fort wo
sie vor 3 Tagen aufgehört hatten.
Anfang Dezember 1944 musste ich mich nach Stablack melden und musste dann zur Sanitätsabteilung 1, nach Gernau, das
liegt zwischen Lodz und Warschau. Vormittags hatten wir Felddienstübungen und nachmittags theoretischen Unterricht.
Jeden Tag wurden Gruppen zusammengestellt und zu anderen Einheiten abkommandiert. Ich kam zu einer Panzerabteilung, wo
wir an einem Morgen plötzlich auf dem Kasernenhof antreten mussten und zu unserer Überraschung mit der Nachricht
konfrontiert wurden, dass der Russe an mehreren Frontabschnitten durchgebrochen war. Wir bekamen sofort einen
Marschbefehl in Richtung Lodz, wo das Stadtbild noch intakt war, selbst die Straßenbahnen fuhren noch. In der Nacht
haben russische Flugzeuge die Stadt bombardiert. Die Kaserne in der wir untergebracht waren hatte keine
Luftschutzkeller, aber zum Glück blieben wir von Bombentreffern verschont. Am nächsten morgen bot sich uns ein Bild der
Verwüstung. Die entgleisten Straßenbahnwagen, sowie andere Fahrzeuge blockierten die Straßen. Die Älteren unter uns
bekamen Fahrscheine für einen Transportzug, der bereit hinter Lodz abfahrbereit, unter Dampf stehen sollte. Als
russische Panzer in den Straßen auftauchten, verbrannte die Schreibstube unsere Wehrpässe und andere wichtige
Dokumente. Wir liefen zu der Station auf der unser Transportzug bereitstehen sollte, aber da war kein Zug mehr zu sehen
und wir setzten unseren Rückzug zu Fuß fort.
Der Rückzug und Zusammenbruch der Ostfront
In Dobroschin, einer Stadt in Polen, wurde gerade ein Lazarettzug verladen, doch wir kamen nicht
mehr zum Einsatz, weil die russische Infanterie uns schon auf den Fersen war. Es ging weiter über den Fluss Bober,
Sagan, bis nach Glogau an der Oder. Dort wurden wir der 29. motorisierten Sanitätskompanie zugeteilt. Im
Garnisonslazarett wurden noch Operationen durchgeführt. Unsere Division hatte ihr eigenes Feldlazarett, so dass wir den
Befehl zu Weiterfahrt erhielten und noch unbeschadet die Oderbrücke passieren konnten, denn Glogau wurde zur Festung
erklärt. Wir haben 2 Pferdewagen organisiert und mit Verbänden, sowie medizinischen Instrumenten beladen. So kamen wir
bis nach Lübbenau im Spreewald, wo wir in einem Schloss, in zuvor ein Museum war, unser Lazarett untergebracht haben.
Weil die Amerikaner Cottbus bombardiert hatten, wurden die Verwundeten zu uns nach Lübbenau gebracht. Hier haben wir
Tag und Nacht gearbeitet, um die vielen Verwundeten, aus den schweren Kämpfen bei Grünberg und Sagan zu versorgen. Die
Soldaten von der Abwehrfront kamen schon mit abgestorbenen Armen oder Beinen bei uns an, weil in vorderster Linie keine
Frontlazarette mehr vorhanden waren; es mussten viele Amputationen durchgeführt werden. Als für unsere Pferde kein Heu
mehr vorhanden war, schickte mich unser Hauptfeldwebel, zu einem Bauern in den Spreewald, mit dem Auftrag, Futter zu
besorgen. Mit noch zwei Mann fuhren mit zwei Kähnen, zuerst den Hauptstrom entlang und dann in einen Nebenarm; da haben
wir die Boote beladen und brachten das Heu nach Lübbenau.
Als wir uns bei unser Einheit zurück melden wollten, war alles schon marschbereit. Ich bin schnell in einen Bus
eingestiegen der sofort losfuhr, weil russische Verbände schon in sichtweite waren. Russische Flugzeuge kreisten über
den Dächern und nahmen, mit ihren Bordwaffen jeden unter Beschuss, der sich irgendwo blicken ließ. Wir konnten nur
durch den Wald, oder in der Nacht vorwärts kommen, denn wenn ein Auto auf der Landstraße fuhr, war alsbald ein Flugzeug
hinter ihm her und schoss es in Brand. Als wir nach Tagen am Ufer der Elbe ankamen, war bereits eine Ponton-Brücke
erstellt worden, welche die zerstörte Brücke ersetzen sollte.
Durch die vielen Fahrzeuge waren in den Sand tiefe Spuren gefahren, so dass andere Fahrzeuge unsere Busse ins
Schlepptau nehmen mussten, weil wir mit eigener Kraft nicht mehr weiterkamen. Beiderseits der Trasse standen
Flüchtlingswagen, in der der Hoffnung die Brücke passieren zu können, doch SS-Polizei verhinderte das die Gespanne den
militärischen Rückzug zum Stillstand brachten. Es gelang uns die Elbe zu überqueren, um in einem Waldstück Schutz vor
feindlichen Fliegern zu suchen.
Als wir unsere Busse und Autos gut getarnt hatten, hat unser Bataillonschef die anwesenden Parteigrößen zu sich
gerufen und ihnen erklärt das wir eine Einheit des Roten Kreuzes sind und nach internationalem Recht keine Waffen
besitzen dürfen. Nach langer, erregter Diskussion wurde beschlossen einen Graben auszuheben und alles im Sand zu
verscharren. Als wir dann weiter, durch die Dörfer fuhren, sahen wir schon viele weiße Bettlaken, als Zeichen der
Kapitulation, aus den Fenstern hängen. Es wurde uns erzählt dass der Bürgermeister von der SS erschossen wurde, weil
er die Bevölkerung zu diesem Schritt ermutigt hatte. Jetzt waren hinter uns die Russen und vor uns schon die Amerikaner.
Amerikanische Panzer fuhren umher und schossen wild durch die Gegend, ohne ein Ziel anzuvisieren. Niemand wollte sich
dem Russen ergeben, doch der Weg der zu den Amerikanern führte, war durch abgesägte Bäume blockiert. Wir sind schnell
in das nächste Dorf gegangen, haben uns Sägen und Äxte besorgt, die Bäume durchgesägt und in den Straßengraben
geworfen.
“ Nach dem Ende des 2. Weltkrieges.”
In amerikanische Kriegsgefangenschaft
Dann fuhren wir unter internationaler Flagge an eine Mulde Brücke, vor der zwei amerikanische Soldaten, mit Zigarren,
zur Hälfte im Mund, standen. Sie rauchten und kauten gleichzeitig. Wir mussten auf einen freien Platz fahren, alle
aussteigen und rechts wieder antreten. Wäschebeutel und Tornister mussten wir abstellen; danach wurden wir nach Waffen
durchsucht, Wertsachen, Uhren und Messer wurden uns gleich abgenommen. Als wir anschließend an unserem Gepäck
vorbeigingen durfte niemand was mitnehmen. Als ich gebückt, nach meinem Wäschebeutel greifen wollte, in dem sich noch
3 Konservendosen und ein Brot befanden, bekam ich einen Fußtritt ins Gesicht, so dass mir ein Zahn ausgeschlagen wurde.
Wir wurden dann in einem Garten zusammen getrieben und gefragt ob jemand bei der SS gedient hat. Nachdem wir in Reihe
und Glied angetreten waren, mussten wir den Oberkörper freimachen und die Arme anheben. Es wurde nach SS-Zeichen
gesucht, die gewöhnlich unter dem Oberarm eintätowiert waren. Nachdem wir Grimma bei Leipzig, wo wir in amerikanische
Gefangenschaft geraten waren, verlassen hatten, mussten wir durch ganz Thüringen bis Hersfeld, an der Grenze zu Hessen,
marschieren. In Hersfeld wurden wir auf große Lastautos verladen, die von farbigen Soldaten gefahren wurden. Man hat
uns mit Stöcken hinauf getrieben, solange bis das Auto so voll war das man kaum stehen konnte. Die Soldaten fuhren, für
diese Straßenverhältnisse, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Wenn die Straße eine scharfe Kurve hatte, flogen
wir alle übereinander und mussten erst mit viel Kraftanstrengung auf die Beine kommen um diese Fahrt zu überstehen.
Da die Straßenränder in dieser Gegend mit Obstbäumen bepflanzt sind und deren Äste sehr niedrig hängen, hätten die
uns die Köpfe abgerissen, wenn wir uns nicht ständig geduckt hätten. Unsere Fahrt endete in Bad Kreuznach, in der Pfalz,
wo wir in ein Lager, in dem sich später 130.000 Mann und 6 Generäle befanden, eingepfercht wurden. Die Unterkunft der
Generäle befand sich unter einem Zelt, alle anderen mussten die Zeit unter freiem Himmel zubringen. Die Offiziere, die
Unteroffiziere, die Mannschaften; wurden in getrennten Camps untergebracht. Die Mannschaften wurden auch zur Arbeit
abkommandiert und konnten bei dieser Gelegenheit, Brot, Brötchen oder Zigarettenstummel organisieren, wogegen die
Offiziere und Unteroffiziere ihr Camp überhaupt nicht verlassen durften.
Die ersten Tage gab es kein Wasser und kein Brot, so dass die Kameraden vor Erschöpfung umfielen. Später standen wir
manchmal den ganzen Tag nach Wasser an, das von den, uns bewachenden Negern mit großen Wassertanks angefahren wurde. Am
dritten Tag bekamen wir mittags und abends etwas zu Essen; Brot bekamen wir erst nach zwei Wochen, nach dem aus der
Umgebung herbeigeholte Handwerker, Backöfen gebaut hatten. In den verschiedenen Gemeinden, die in den uns umgebenden
Weinbergen lagen, mussten sich alle Männer beim Bürgermeister melden. Als sie dann erschienen waren, wurden sie auf
bereitstehende Lastautos getrieben und zu uns ins Lager gebracht. Sie waren ohne Kopfbedeckung und ohne wärmere
Bekleidung angekommen, weil ihnen gesagt wurde, dass ihr Aufenthalt im Lager nur von kurzer Dauer sein würde. Man hat
uns, falls noch vorhanden, Decken und Mäntel abgenommen, mit der Begründung, sie würden für Kranke und Verwundete
gebraucht. Jeden Tag starben mehr als 200 Mann, die wir sofort in ein Zelt tragen mussten. In der Nacht wurden die
Toten dann mit unbekanntem Ziel, weggefahren.
Viele haben ihren Verstand verloren uns irrten im ganzen Camp ziellos umher. Als Latrinen wurden Gräben ausgehoben, in
die verschiedene Kameraden, bei der Verrichtung ihrer Notdurft, vor Schwäche hineingefallen sind und nicht mehr wieder
heraus kamen. Aus den Pfählen die, die jungen Obstbäume stützten, haben wir Krankentragen gebaut um unsere Kameraden,
bei Bedarf, zur Krankensammelstelle zu tragen. Es war in diesem Frühjahr auch sehr kalt, doch unsere Erdlöcher, die wir
zum Schutz vor Kälte und Wind, nur mit leeren Konservendosen ausgehoben hatten, durften nicht tiefer als 20 Zentimeter
sein. Nach jedem Regenguss mussten wir das Wasser ausschöpfen. Nach einem Gewitter, standen wir wiedermal, total
durchnässt in unserem Camp, als unerwartet am Horizont die Sonne hervortrat. Einer unserer Kameraden hatte noch eine
Trompete gerettet und fing, von dem Anblick völlig überwältigt, zu spielen an: "Es geht alles vorüber, es geht alles
vorbei, nach jedem Dezember, folgt wieder ein Mai". Daraufhin hob sich die Stimmung der tiefbetrübten Kriegsgefangenen,
so das Heimatlieder durch das ganze Camp erklangen, obwohl wir in den nassen Kleider herumgehen mussten, bis sie am
Körper trocken wurden.
In französischer Kriegsgefangenschaft
Nach etwa einem Monat, haben uns die Amerikaner, den Franzosen, zum Arbeitseinsatz, ausgeliefert.
Etwa 4 Kilometer von Bad Kreuznach entfernt, stand auf freier Strecke, ein Zug mit offenen Kohlenloren, auf den wir
verladen wurden. In jeden Waggon, wurde pro Person eine Tafel Schokolade und ein Päcken Zwieback rein geworfen, doch
viele Kameraden fanden nur leere Päckchen vor, weil die schon zuvor von der französischen Wachmannschaft geplündert
wurden. Wir haben uns darüber beschwert, doch die haben uns nur ausgelacht. Nachdem wir zunächst bei Mainz über den
Rhein fuhren, endete unsere Fahrt bei Paris in einem großen Zeltlager. Dort wurden wir auf andere Züge verladen, die uns
nach Südfrankreich, in ein Barackenlager, bei Mazarei, brachten.
Auf einer Zwischenstation hat man uns unter einer Pumpe, die Lokomotiven mit Wasser versorgt, abgestellt, den Kran
aufgedreht und uns anschließend ausgelacht, die Kinder Haben uns mit Steinen beworfen. Ein Wachmann kam in unseren
Waggon gekommen, hat unser Gepäck durchsucht, wenn er Tabak oder Zigaretten gefunden hat, nahm er sie mit. Die Kameraden
waren darüber so empört, dass sie vorhatten, ihn nachts unter den Waggon zu werfen. Wir haben sie gebeten dass zu
unterlassen, weil man uns in diesem Falle, alle erschießen würde.
Als wir ins Lager kamen wurden wir zuerst gezählt, dann mussten wir unser Gepäck stehen lassen und beiseite treten.
Wenn man bei der Nachkontrolle noch was in den Taschen fand, wurde das auch entwendet, selbst Esslöffel. Wir wurden
dann in drei Baracken, ohne Toiletten, eingeschlossen. Die Kameraden haben ihre Bedürfnisse in Kochgeschirre erledigt
und durch ein kleines Fenster, das sich fast unter der Decke befand, hinausgeworfen. Andere Fenster ließen sich nicht
öffnen, weil sie mit Stacheldraht zu geflochten waren. Als die Kameraden die Kochgeschirre auskippten, haben die
Wachposten geschossen und die Fenster zertrümmert. Sie waren der Meinung dass wir ausbrechen wollten. Es herrschte eine
große Hitze, in den überfüllten Baracken sind wir fast erstickt. Am nächsten Tag haben wir uns über fehlende Toilettem
beschwert, da haben sie Heringsfässer durch die Hälfte geschnitten und an der Ausgangstür hingestellt. Um bei den
überfüllten Räumen dort hinzukommen, musste man über die Köpfe der Anderen steigen. Viele hatten Fieber und Durchfall
und mussten in die Krankenstube eingeliefert werden, wo sie kurz darauf verstarben.
Besonders Raucher litten sehr an der Unterernährung, bekamen Wasser in den Beinen und waren die Ersten die verstarben.
Nach der Registrierung wurden wir auf andere Baracken verteilt. Die Zivilbevölkerung kam in die Räume und begann uns
auszuplündern. Wer noch gute Schuhe besaß musste sie ausziehen und bekam dafür die kaputten des Plünderers. Eine Woche
lang mussten wir diesen Zustand ertragen, erst als die Kameraden sich beschwerten, wurde am Eingang eine Tafel am
Eingang angebracht, dass die Zivilbevölkerung das Lager nicht betreten darf. Bis auf einige, wenige Ausnahmen wurde
diese Anweisung befolgt.
Als wir im Lager ankamen, war der französische Lagerkommandant, ein ehemaliger Kriegsgefangener, der bei einem Bauern
in Deutschland gearbeitet hatte. Dieser Bauer war jetzt als Kriegsgefangener in seinem Lager. Als er ihn erkannte, hat
er ihn gleich zum Küchendienst eingeteilt und mit dem nächsten Krankentransport nach Hause fahren lassen. Zu Mittag
bekamen wir nur gekochte Haferkörner, da schwamm alles oben, später war man dann auf Gerste umgestiegen. Als viele
daran gestorben waren, weil sie diese „Rohkost”, die nur ein Kuhmagen verträgt, nicht gegessen haben, hat man die
Körner durch eine Schrotmühle laufen lassen. Dann hat man uns Steckrüben gekocht; wir bekamen 250 Gramm Weißbrot,
etwas Quark und ein viertel Liter Magermilch. Später, als wir schon arbeiten mussten, hat man in unserem Essen einen
Kuhkopf mitgekocht, das hat dann bedeutend besser geschmeckt.
Bevor wir morgens zur Arbeit gingen, mussten wir zu Flaggenparade und abends, nach der Rückkehr, haben wir die Flagge
wieder eingeholt. Wir haben einen Kanal gereinigt, dessen Sohle 2 Meter dick mit Schlamm bedeckt war. Zuerst wurde das
Wasser abgelassen, dann haben wir, einer dem andern, den Schlamm mit der Schippe hoch gereicht. Der Letzte hat den
Schlamm, der so zäh war, dass er nicht von der Schippe wollte, oben am Rande abgelegt. Manchmal waren 10 Mann nötig um
den Höhenunterschied zu überwinden. Das Wachpersonal schoss über unsere Köpfe hinweg und rief: „schnell arbeiten”. Bei
der großen Hitze war das ein Ding der Unmöglichkeit, zumal es nichts zu Trinken gab. Auf dem Heimweg haben wir im Walde
Heilkräuter gesammelt, die man in der Küche getrocknet und als Tee zubereitet hat, den wir am nächsten tag zur Arbeit
mitnahmen, um unseren Durst zu stillen.
Unser Aufseher hatte einen Stock, an dem sich noch kurz abgeschnittene Äste befanden. Wer seiner Meinung nach, nicht
ordentlich gearbeitet hat, bekam gleich Schläge auf den Rücken. Die weißen Aufseher wurden irgendwann durch Neger
ersetzt, die uns bedeutend besser behandelt haben. Wenn irgendetwas schief ging, haben sie nichts gesagt, nur gelacht.
In den übrig gebliebenen Wassertümpeln hatten sich noch einige Aale versteckt, die wir zu fangen versuchten, was uns
auch manchmal gelang. Wir mussten ihnen das Genick brechen, damit sie uns nicht entwischen konnten. Wenn die Franzosen
bemerkten das wir Aale hatten, wurden sie uns abgenommen. Gelang es uns aber, sie ins Lager zu bringen, dann haben wir
uns eine köstliche Malzeit zubereitet.
Um sicherzustellen dass niemand geflüchtet ist, wurden wir, wenn wir abends ins Lager zurückkamen, zuerst gezählt.
Diese Zählung wurde mehrmals wiederholt, weil die Wachmannschaften sich immer wieder verzählt haben. Als einer von uns
hin ging, ihnen sagte dass alle da sind, wollten sie es nicht glauben und haben uns vor dem stehen lassen, bis es ihnen
irgendwann einfiel. uns doch das Tor zuöffnen. Einmal, als wir von der Arbeit zurückgekehrt waren, standen wir bis 23
Uhr neben der Flagge, weil uns niemand das Tor geöffnet hat. Als wir dann doch irgendwie ins Lager kamen haben wir
festgestellt, dass das ganze Wachpersonal betrunken war und niemand im Stande uns das Tor zu öffnen.
Eines Tages waren wir wieder abends zur Parole angetreten, als ein älterer Herr mit seinem Hund, am Stacheldraht
entlang, spazieren ging. Weil der Hund, unterm Stacheldraht hindurch, zu uns kam, hat ihn einer geschnappt, ihm das
Genick gebrochen und unter seiner Jacke versteckt. Der Franzose hat nach seinem Hund gerufen und gepfiffen, aber alles
vergebens, der Hund war nicht aufzufinden. Die Kameraden haben ihm gleich das Fell über die Ohren gezogen, das Fleisch
gekocht und das Fell in die Latrine geworfen. Das Fleisch wurde umgehend verspeist.
Als wir am nächsten Tag von der Arbeit zurückkehrten, war im Lager der Teufel los. Wir mussten sofort antreten und
wurden gefragt, wo der Hund geblieben ist, der Gestern Abend, mit seinem Herrchen, am Zaun entlang spazieren ging. Als
sich niemand dazu bekannte, mussten wir weiterhin stehen bleiben, während die Wachmannschaften von Baracke zu Baracke
gingen und alles durchsuchten. In einer Latrine hat man dann das Fell gefunden, was uns ein furchtbares „Donnerwetter”
einbrachte und in den nächsten Tagen, nach der Arbeit, unter dem Kommando eines Oberfeldwebels, eine Stunde
nachexerzieren.
In Südfrankreich regnet es den ganzen Sommer nicht; die Bauern haben da keine Scheunen und das Getreide wir nur in
Schobern aufgestellt und dann umgehend gedroschen. Vom Oktober bis Dezember regnete es fasst jeden Tag in Strömen.
Gesät wird nur im Frühjahr und im Herbst, weil im Sommer alles vertrocknet. Es wird viel Wein angebaut und die
Steckrübe wächst den ganzen Winter. Neben den Weinreben wurde aus Schieferplatten ein Zaun aufgestellt, um dem Wein
einen optimalen Standort zu sichern. Die Bauernwagen hatten nur zwei Räder und waren nur mit einem Pferd bespannt, das
die ganze Balance des Wagens zu halten hatte. Trotzdem haben sie soviel aufgeladen wie wir auf einen Leiterwagen. Viele
Kameraden wurden den Bauern zur Arbeit ausgeliehen. Wenn ein Bauer einen Arbeiter gebraucht hat und es wurde gefragt,
wer sich in der Landwirtschaft auskennt, da haben sich alle gemeldet. Der Bauer konnte sich dann aussuchen, wen er
mitnehmen wollte.
Wenn wir durch die Stadt zur Arbeit gingen, haben verschiedene Leute Fallobst in die Abfalleimer gelegt. Wenn das von
den Kameraden bemerkt wurde, schwenkten viele aus der Reihe, um sich etwas mit zunehmen, was von den Wachmannschaften
nicht gern gesehen wurde. Viele Kriegsgefangene hatten keine Schuhe mehr, sie haben die Füße nur mit Lumpen bewickelt.
Eines Tages kamen Kameraden aus Norwegen, die nach Deutschland entlassen werden sollten. Mann hat sie jedoch ins Lager
gesteckt und zur Arbeit eingeteilt. In Norwegen hatten sie Kleider und Stoffe eingekauft, hatten volle Seesäcke und
sogar Karren auf 2 Rädern, weil sie ja in die Heimat entlassen werden sollten. Als wir morgens zur Arbeit rausgeführt
wurden standen sie schon vor dem Lager. Wir haben ihnen zugerufen, dass sie uns etwas abgeben sollen, weil ihnen ja
sowieso alles abgenommen wird, aber sie haben uns nur ausgelacht. Als sie ins Lager Kamen mussten sie ihr Gepäck
ablegen, wurden dann wo anders hingeführt und haben es danach nie wieder gesehen.
Durch die vielen Läuse, Flöhe und Wanzen die wie im Lager hatten, kam es bei verschieden Kameraden, an den
Einstichstellen, zu eiternden Entzündungen. Um dem vorzubeugen hat man uns mit einem Pulver, das in Frankreich
hergestellt wurde, aber bei den Parasiten keine Wirkung zeigte, eingesprüht. Erst bei der Anwendung eines Mittels
amerikanischer Herkunft, war alles über Nacht verschwunden.
Der Sonntag war arbeitsfrei. Dann kam ein katholischer, französischer Pfarrer, eskortiert von 3 Mann, mit
aufgepflanztem Seitengewehr ins Lager und hat Gottesdienst gehalten. Einen evangelischen Pfarrer gab es nicht, nur
einen Baptisten Prediger. Der wurde würdevoll eingekleidet, bekam ein großes Kreuz und hat jeden Sonntag in einer
extra dafür hergerichteten Baracke Gottesdienst gehalten. Wer Theologie studiert hatte und sich meldete, wurde zu
einem Seminar geschickt und konnte sein Studium fortsetzen. Glasbläser durften das Lager auch verlassen und ihrem
erlernten Beruf wieder arbeiten.
Wer sich freiwillig, für 5 Jahre, zum Dienst in der Fremdenlegion verpflichtet hat, das waren etliche unter uns, wurde
neu eingekleidet, bekam gutes Essen und Rauchwaren soviel er wollte. Nach einem Jahr wurden, nach und nach, die
Kranken und Körperbehinderten in die Sowjetische Besatzungszone entlassen. Eine Entlassung von Kriegsgefangenen, die
in den Westzonen oder jenseits von Oder und Neise zu Hause waren, war nicht vorgesehen. Die Österreicher wurden alle,
unabhängig von ihrem Gesundheitszustand entlassen.
Ich habe Briefe nach Hause geschrieben, aber die kamen nur bis Allenstein und wurden wieder zurück geschickt. Als eine
Kommission des Roten Kreuzes aus der Schweiz unser Lager besichtigt hat, haben wir uns beschwert, das wir als
Sanitätsdienstgrade, zur Arbeit gehen müssen. Daraufhin erging ein Befehl: Wer einen vom Roten Kreuz, ausgestellten
Ausweis besitzt, gehört einem internationalen Verband an und braucht nicht zu Arbeit gehen. Aus unserem Lager hatten
sich 20 Mann gemeldet, die daraufhin Freigang, in Begleitung von zwei französischen Wachsoldaten erhielten. Als wir
gefragt wurden wo wir hin wollen, entschlossen wir uns, einen Soldatenfriedhof, auf dem unsere verstorbenen Kameraden
beerdigt waren, zu besuchen.
Da der Untergrund in dieser Gegend aus Felsen bestand, wurden die Gräben, in denen die Toten in selbst gezimmerten
Kisten nebeneinander gestellt wurden, mit Hilfe von Dynamit ausgehoben. Ein Leichenwagen, mit einem Pferd bespannt,
das mit einer schwarzen Decke abgedeckt war, wurde von einem Kutscher in angemessener Kleidung, gefahren. Der Wagen
konnte gleichzeitig 4 Kisten transportieren. Wenn wir von der Arbeit kommend, dem Leichenwagen begegneten, wurde
gehalten und mit einer Schweigeminute der Toten gedacht, bis der Wagen vorbei war. Die Zivilbevölkerung verharrte auch
im Schweigen, mit abgenommener Kopfbedeckung.
Ein Kamerad, der in Krottorf, Kreis Oschersleben, bei Magdeburg, zuhause war, sagte bei seiner Entlassung zu mir:
Sollte ich das Glück haben, meine Entlassungspapiere zu erhalten ohne eine Bleibe vorzuweisen, dann soll ich Krottorf
als Heimatadresse angeben. Auf der Krankenstube habe ich angegeben, dass sich noch ein Schrapnellsplitter, aus dem
Ersten Weltkrieg, in meiner Kreuzbeingegend befindet, er zwar verkapselt ist, aber immer noch Beschwerden verursacht.
Daraufhin wurde ich zur Entlassung vornotiert. Als bekannt wurde das ein Rückkehrertransport in die sowjetische
Besatzungszone zusammengestellt wird, habe ich mich sofort gemeldet und wurde für ein Entlassungslager in Angoleme
vorgesehen. War das eine Freude, als uns mitgeteilt wurde, wann der Rücktransport stattfindet.
In unserem Lager waren noch 2 Kameraden aus dem Kreis Ortelsburg: Ein Gustav Lumma aus Leynau und ein Alfred Moritz
aus Groß Schöndamerau. Sie mussten noch zurückbleiben und haben mir den Auftrag erteil, die Angehörigen in der Heimat
zu grüßen und ihnen die Anschrift mitzuteilen. Als wir im Entlassungslager ankamen, fragte man uns nach unserer
Heimatanschrift. Dann wurden die Entlassungspapiere angefertigt. Es wurde uns auch ein Barscheck, für die in Frankreich
geleistete Arbeit ausgehändigt, den wir bei jeder Kasse in Deutschland einlösen könnten. Ich habe ihn bis zum heutigen
Tage nicht einlösen können, obwohl ich irgendwann in der Zeitung gelesen habe, das Verrechnungschecks die den aus
französischer Kriegsgefangenschaft Entlassenen, ausgehändigt wurden, einzulösen sind.
Wir kamen zuerst nach Saar Elbe, dann in die Nähe der Zonengrenze zu Thüringen. Hier mussten wir 2 Tage warten, weil
aus der sowjetischen Besatzungszone keine Eisenbahnwagen bereitgestellt wurden. Angesichts dessen, das der Russe beim
letzten Transport die aus Frankreich kommenden Wagen kassiert und nicht mehr herausgeben wollte, bestand der Franzose
jetzt darauf, seine Wagen sofort wieder mitzunehmen. Als der sehnsüchtig erwartete Zug endlich eintraf, durften wir
umsteigen und kamen, immer noch hinter Stacheldraht, nach Erfurt. Von dort weiter ins Quarantänelager nach Prätsch an
der Elbe.
Unter Androhung von Strafe war es verboten das Lager zu verlassen, doch der Hunger zwang uns dazu, in den umliegenden
Dörfern um Lebensmittel zu betteln. Man drohte uns damit, dass Zuwiderhandlungen, mit einer 14-tägigen Verlängerung der
Quarantäne geahndet werden. Der Roggen war schon reif und wir haben, auf den umliegenden Feldern, die Ähren abgerissen,
das Korn, zwischen 2 Steinen zu Mehl zerrieben, um daraus eine Suppe zu kochen, denn von dem was unsere Lagerküche uns
bieten konnte, war es nicht möglich zu überleben. Als der Eigentümer bemerkte wer seine Roggenähren entwendet hat, kam
er ins Lager, gerade zu dem Zeitpunkt als wir mit dem Mahlen beschäftigt waren. Der Lagerkommandant, bei dem er sich
beschwerte, drohte uns zu bestrafen, wenn wir unsere „Rauzüge” nicht unmittelbar einstellen würden. Wir sagten ihm er
solle uns heimfahren lassen, da wir doch lange genug hinter Stacheldraht gesessen hätten.
Endlich wieder in Freiheit
14 Tage nach unserer Ankunft wurden uns Entlassungspapiere ausgehändigt, sowie auch Fahrscheine
zum den, von uns angegeben Heimatorten. So kam ich nach Krottof, Kreis Oschersleben, zu meinem ehemaligen
Kriegskameraden, bei dem ich einen Tag geblieben bin. Er hatte mir schon eine Stelle bei einem Bauern besorgt, der 70
Jahre alt und kinderlos war. Zum Hof, den er mit seiner Ehefrau bewirtschaftet hat, gehörten 36 Morgen Land, 2 Ochsen
und 3 Kühe. Das Ackerland bestand aus 17 Parzellen und sicherte mir einen Arbeitsplatz.
Jetzt, da ich ein Dach überm Kopf und genug zu essen hatte, fing ich an nach dem Verbleib meiner Familie zu forschen.
Bei meinem letzten Heimaturlaub hatte ich mit meiner Frau verabredet; falls wir uns in den Kriegswirren verlieren
sollten, unsere Kontaktadresse, die meiner Quartiersleute in Burscheid, Kreis Opladen, sein sollte. Ich habe zuerst
nach Rohmanen geschrieben, aber leider keine Antwort erhalten. Dann habe ich nach Burscheid geschrieben, und siehe, -
bei denen lag schon eine Anfrage meiner Frau vor, die nach mir gefragt, und ihre jetzige Anschrift hinterlassen hatte.
Ich habe dem Bauern erzählt dass meine Frau sich zurzeit, auf einem Gut, in Alt Steinhorst, im Kreis Rostock, befindet.
Er war sofort bereit uns ein Zimmer zur Verfügung zu stellen, wenn ich meine Frau nach Krottorf rüberholen wollte. Das
habe ich Ihr mitgeteilt und sie war sofort bereit ihren Wohnsitz nach Krottorf zu verlegen, denn sie wohnte dort in
einem kleinen Stübchen unterm Dach.
Im Herbst, als die Feldarbeit so ziemlich erledigt war, bin ich nach Alt Steinhorst gefahren, um meine Frau und meinen
Sohn Kurt, sowie meinen Sohn Manfred, den ich noch nicht kannte, weil er erst nach der Flucht, am 31. Januar, in Groß
Lüssewitz, geboren wurde, nach Krottorf zu holen. Meine Frau hatte schon Holz für den Winter besorgt und vom Gut, auf
dem sie im Sommer gearbeitet hatte, Mehl und Kartoffeln bekommen. Wir haben das Mehl und andere Habseligkeiten in
Kisten verpackt. Das Holz haben wir einem Bauern gegeben, der uns und unser Gepäck, mit seinem Pferdewagen, zum 14
Kilometer entfernten Bahnhof, nach Ribnitz gebracht hat. Wir sind auch gut in Krottorf angekommen, aber als wir am
nächsten Tag, unsere Kisten vom Bahnhof abholen wollten, haben wir zwar die Kisten vorgefunden, doch der gesamte Inhalt
wurde während der Bahnfahrt entwendet. Die Bahnstation in Krottorf hat die Vorkommnisse zur Kenntnis genommen und
protokolliert, aber unsere Sachen haben wir nie wieder gesehen und mussten wieder bei Null anfangen.
Im Winter musste ich auf der Genossenschaft, unentgeltlich, für die Russen Weizen einsacken. Ich hatte versucht eine
Arbeit als Zimmermann zu bekommen, doch auf dem Arbeitsamt wurde mir gesagt, ich bin Ladwirt und muss auf der
Landwirtschaft arbeiten. Da in den ersten Nachkriegsjahren, auch in der sowjetisch besetzten Zone Arbeitsplätze knapp
waren, mussten auch solche, die einen anderen Beruf erlernt hatten, jede zumutbare Arbeit annehmen. Aus der Heimat
erhielt ich einen Brief, von meiner dort noch lebenden Mutter. Sie schrieb das sie mich noch einmal sehen wollte und
ich sollte doch wieder zurück kommen; Unser Hof wäre nicht von Polen besetzt und sie wäre ganz alleine, weil der Vater
nach dem Durchzug der Front von den Russen erschlagen wurde. Daraufhin habe ich dem polnischen Konsulat in Magdeburg
mitgeteilt, dass ich in Rohmanen eine Landwirtschaft besitze, und um eine Einreisegenehmigung gebeten.
Nach 2 Monaten erhielt ich eine Postkarte, mit der Mitteilung, ich sollte mich persönlich beim Konsulat vorstellen.
Nach Aufnahme meiner Personalien, wurde mir gesagt, das ich benachrichtigt werde wenn mein Antrag genehmigt wird. Ende
Juli 1947 erhielten wir die Einreisegenehmigung nach Ostpreußen, das jetzt unter polnischer Verwaltung stand. Wir
mussten zuerst zum polnischen Konsulat in Berlin-Lichterfelde, wo wir umgeben von einer Trümmerlandschaft, gewartet
haben, bis alle Untersuchungen und Formalitäten erledigt waren.
“ Wieder zurück in Ostpreußen.”
Der schwere Wiederaufbau nach dem Kriege
Dann fuhren wir über Frankfurt/Oder, Posen, Thorn, Allenstein, nach Ortelsburg, wo wir am 2. August 1947 ankamen. Mit
einem zweirädrigen Karren, den ich mir von einem noch in Ortelsburg lebenden Bekanten ausgeliehen hatte und meinem
Sohn Manfred im Kinderwagen fuhren wir nach Rohmanen. Meine Mutter war inzwischen verstorben und auf dem Hof war nur
meine, inzwischen aus Russischer Gefangenschaft wiedergekehrte Schwester, Frieda Pelkowski.

Es war alles ausgeplündert; kein Vieh, keine Maschinen und der ganze Hof mit kniehohem Graß überwachsen. Nur schmale
Trampelpfade, vom Haus zum Holzschuppen und zum Klo, durchkreuzten das satte Grün. Ich habe das Gras auf dem Hof mit
einer Sense, die ich noch gefunden habe, abgemäht, damit der Hof nicht so verwahrlost aussah. Am nächsten Tag habe ich
mich bei der Polizei in Ortelsburg angemeldet, wo ich auch ein Startgeld von 100 Zloty erhielt und Gepäckstücke, die
ich in Krottorf aufgegeben, am Bahnhof abgeholt. Es hat mich sehr gewundert das, das Gepäck überhaupt angekommen ist.
Da man von der Landwirtschaft nicht Leben konnte, habe ich mich in den nächsten Tagen, bei der jetzt polnischen Bahn,
um Arbeit beworben und wurde auch angenommen. Wenn wir unseren Monatslohn bekamen, saß immer einer am Tisch, der von
uns 100 Zloty für den Wiederaufbau von Warschau verlangte. Wenn ich dran war, riefen die Anderen, ich hätte Warschau
zerstört und müsste deshalb 200 Zloty abgeben. Nach 3 Jahren kam eine Verfügung, die besagte, dass wer länger als 1
Jahr bei der Bahn beschäftigt ist, angestellt werden muss. Um diese Bestimmung zu umgehen hat man mich entlassen und
eine Woche später wieder eingestellt.
Als ich vor Ablauf des nächsten Jahres, aus dem gleichen Grunde wieder entlassen wurde, habe ich mich bei der
Stadtverwaltung in Ortelsburg(jetzt Szczytno)beworben, wo ich zuerst im Gaswerk als Heizer und später auf Baustellen
als Zimmermann gearbeitet habe. Wir haben durch den Krieg beschädigte Häuser repariert, in den ehemals touristischen
Zentren einige Ausbesserungen an den Einrichtungen durchgeführt, eine Ziegelei wieder in Betrieb gesetzt und andere
anfallende Arbeiten verrichtet. Im Dach des Rathausturmes war während der Kämpfe eine Granate eingeschlagen, die, die
Dachlatten und die Verschalung zerstört hatte. Da wir, unter schwersten Bedingungen, den Schaden repariert haben,
wurde uns eine Höhenzulage versprochen, die wir aber nicht bekommen haben.
Aus Verärgerung darüber habe ich bei der Stadtverwaltung gekündigt und bei einer Wiederaufbaufirma unter der Leitung
von Bauingenieur Laskowski wieder angefangen, wo ich bis 1954, als Zimmermann beschäftigt war. Ab da habe ich mich
nur um meinen Hof gekümmert, der wegen meiner Arbeitsstellen, gezwungenermaßen, sehr vernachlässigt wurde. Als wir
1947 zurückkamen, brachten wir unseren Sohn Manfred noch im Kinderwagen. Den hat meine Frau zum Markt gebracht,
verkauft, und dafür eine Ziege erworben, die dank guter Pflege, uns täglich mit 4 Liter Milch versorgte. Das war der
erste Baustein zum Wiederaufbau, unserer durch den Krieg zerstörten, und danach ausgeplünderten Landwirtschaft.
Während meiner Arbeit bei der Bahn haben wir uns eine Kuh gekauft, die nach einem halben Jahr, wegen nicht bezahlter
Grundsteuer, vom Gerichtsvollzieher gepfändet wurde. Man hat uns die Kuh weggenommen und bei einem Arbeiter, der in
der Ernst-Mey-Straße in Ortelsburg wohnte und sie wegen nicht vorhandener Futtermittel, nur mit Kartoffelkraut
gefüttert hat, untergestellt. Als ich bei der Bahn meinen Monatslohn bekommen habe, bin ich zur Gmina gegangen, habe
eine Rate angezahlt und durfte dann die Kuh wieder mit nach Hause nehmen. Durch die schlechte Ernährung war die Kuh
stark abgemagert und lieferte nur die Hälfte der ursprünglichen Milchleistung.
Später habe ich ein Pferd auf Abzahlung bekommen, das 140.000 alte Zloty gekostet hat. Die Stute war schwach und unser
Feld sehr hügelig, so dass man nur bergab pflügen konnte, was sehr beschwerlich war, bergauf ging es immer im Leerlauf.
Später habe ich die schweren Böden mit dem Traktor umpflügen, und in den letzten Jahren auch mit dem Binder mähen
lassen. Von der Stute habe ich 2 schöne Fohlen gezogen; ein davon habe ich bei der Ausreise in die Bundesrepublik
mitgebracht und bei der Viehverwertungs-Genossenschaft in Göttingen verkauft. In den ersten Nachkriegsjahren als noch
wenig Land bestellt wurde, breiteten sich auf den nicht beackerten Flächen, Wildkräuter aus. Disteln und andere
Schnellwachsende, erreichten manchmal eine Höhe von 2 Meter, besonders auf den schweren Böden.
Es hat viel Schweiß gekostet ehe man den Acker soweit hatte, das er auch befriedigende Erträge abwarf. Die
Währungsreform von 1950, hat unser weiniges Geld das wir schon gespart hatten, wieder vernichtet. Ich hatte 2 Pferde,
1 Fohlen, 2 Kühe und Schweine, als ich wieder aufgefordert wurde nicht bezahlte Grundsteuern nachzuzahlen. Als ich
nicht bezahlen konnte, hat der Vollziehungsbeamte, ein Fohlen, eine Kuh und ein Schwein gepfändet. Es gelang mir jedoch
nach längeren Verhandlungen, ohne größere Verluste, alles zu regeln. Später kam eine Verfügung, die besagte; wenn
jemand auf seinem Hof nur eine Kuh und ein Pferd hatte, durften sie nicht gepfändet werden. Einige haben ihr Inventar
dieser Verfügung angepasst und dadurch die Zahlung von Grundsteuer umgangen.

Wer seine Steuern pünktlich bezahlt und sein Kontingent an landwirtschaftlichen Produkten fristgerecht abgeliefert hat,
der konnte seine, darüber hinaus erwirtschafteten Produkte zu marktgerechten Preisen verkaufen. Für eine hochtragende
Sterke, mindestens 400 kg schwer, die auf ein staatliches Gut verkauft wurde, konnte man bis zu 12000 Zloty bekommen.
Unsere Böden waren kalkarm, doch durch den Einsatz von Kalk und Kunstdünger konnte man den Ertrag erheblich steigern.
Kalk und Kunstdünger konnte man bei der Genossenschaft(GS) bestellen, der dann auch direkt auf den Hof geliefert wurde.
Kalk wurde geliefert und gleich auf dem Feld ausgestreut. In den 1960ger Jahren waren alle Ackerflächen der Rohmaner
Felder bestellt.
Die nach dem Krieg zurückgebliebenen deutschen Bauernfamilien, aber auch die Polen, die während des Krieges beim Bauern
in Deutschland gearbeitet haben, versuchten mit teils bescheidenen, oder auch zusammen gesuchten, landwirtschaftlichen
Geräten, die bäuerlichen Betriebe aufrecht zu erhalten. Nach den schweren Anfängen in den ersten Nachkriegsjahren
erzielten sie schließlich einen beachtlichen Erfolg, der sich in wogenden Kornfeldern, sowie in grünen Wiesen auf
denen gut genährtes Vieh weidete, widerspiegelte.
Ein schwerer Einschnitt in meinem Leben.
Am 11. Mai 1956 verstarb nach langer schwerer Krankheit, meine liebe Ehefrau Marta Rattay,
geborene Brosch. Ein Jahr zuvor war schon mein Schwiegervater Gottlib Brosch verstorben. Die schweren Bedingungen
unter denen wir nach Kriegende leben mussten, haben ihrer bereits angegriffenen Gesundheit sehr zugesetzt. Sie
verstarb mit 44 Jahren und hinterließ in unserer Familie eine große Lücke, die nicht mehr zu Überbrücken war. Wir
haben sie unter großer Anteilnahme der noch verbliebenen deutschen Bevölkerung zu Grabe getragen und auf dem Rohmaner
Friedhof beigesetzt. Die Arbeit die sie sonst verrichtet hatte fiel jetzt auf mich und meine Söhne zurück. Meine
Schwester Frieda Pelkowski half auch wo sie nur konnte. Wir waren auf die Unterstützung durch Nachbarn und Freunde
angewiesen, die uns immer wenn es nötig war, tatkräftig unterstützt haben. Im laufe der Zeit haben wir wieder zum
Alltag zurück gefunden, haben sie noch etliche Jahre auf dem Friedhof besuchen können, bis wir, bedingt durch unsere
Ausreise uns endgültig von ihr trennen mussten.
Der endgültige Abschied von Ostpreußen
Ab 1956 begannen, durch die Vermittlung des Deutschen Roten Kreuzes, die ersten Ausreisen in die
Bundesrepublik Deutschland. Zuerst waren es Kinder die zu ihren Eltern ausreisen durften, Familien deren Väter aus der
Kriegsgefangenschaft in den Westen Deutschlands entlassen wurden und andere durch den Krieg getrennte
Familienangehörige. Ab 1960 erhöhte sich die Zahl der Ausreisewilligen aus dem polnisch besetzten Ostpreußen. Es setzte
sich die Überzeugung durch, dass unsere Angestammte Heimat, uns für die Zukunft keine Perspektive mehr bieten konnte.
Meistens wurden die Anträge, die wir an die Passabteilung in Allenstein stellen mussten, um einen Ausreisepass zu
bekommen, negativ beschieden. Nach mehrmaligen Versuchen gelang es dann doch, diese begehrte Ausreiseberechtigung in
Empfang zu nehmen. Die Enttäuschung der Zurückgebliebenen war groß, wenn wieder mal Verwandte oder Nachbarn, den Weg
in Richtung Bahnhof einschlugen.
Um einen Reisepass zu beantragen, musste man zuerst eine Einladung von Verwandten aus der Bundesrepublik vorlegen, in
der, diese sich verpflichten mussten, für Unterkunft und Verpflegung der Eingeladenen zu sorgen. Diese Einladung
musste durch ein Amt in der Bundesrepublik beglaubigt werden. Außerdem mussten die Kosten für die Bahnfahrt, ab
polnischer Grenze, bis zum Zielort, beim polnischen Reisebüro ORBIS, in Warschau, in DM eingezahlt werden.
Unseren ersten Ausreiseantrag haben wir 1964, bei der Kommandantur der polnischen Miliz in Allenstein eingereicht, der
nach einer gewissen Zeitspanne, ohne eine uns verständliche Begründung zu nennen, abgelehnt wurde. Gegen diese
Ablehnung wurde ein Widerspruch zugelassen, den wir sofort einreichten. Nach einer weiteren Zeitspanne erhielten wir
wieder eine Ablehnung, gegen die kein Widerspruch mehr zulässig war. Wer seine Ausreiseabsicht nicht aufgeben wollte,
musste einen neuen Antrag stellen. Es gab Familien die schon 10 Mal einen Ausreiseantrag gestellt hatten und immer
wieder abgewiesen wurden. Da meine Söhne, nicht die Absicht hatten in Rohmanen zu bleiben und ich nach 2 Weltkriegen,
an denen ich teilgenommen, die schwere Arbeit auf der Landwirtschaft, nicht aus eigener Kraft schaffen würde, haben wir
1966 wieder einen Antrag gestellt, der prompt abgelehnt wurde. Der Widerspruch auf diese Ablehnung wurde auch negativ
beantwortet, so dass wir 1968 wieder einen Antrag eingereicht haben.
Weil das Passamt in Allenstein lange nichts von sich hören ließ, hegten wir schon die Hoffnung das es jetzt klappen
würde und waren sehr enttäuscht als wieder eine Absage kam. In der Zwischenzeit sind viele Nachbarn und Bekannte aus
Rohmanen, sowie aus der näheren Umgebung, ausgereist und das Häuflein der noch verbliebenen Deutschen, wurde immer
kleiner. Die Motivation, die uns in früheren Jahren, über so manche schwierige Lage hinweg geholfen hat, ist einer
hoffnungslosen Resignation gewichen. Man war davon überzeugt, dass unser Leben, in unser Angestammten Heimat, keine
Zukunftsperspektive mehr haben konnte und wenn wir keine Ausreisegenehmigung bekommen, wir eines Tages die letzten
Deutschen in der ganzen Umgebung sein werden.
Die Ausreise-Heimat ade
Wir hatten die Hoffnung schon aufgegeben, als am 30. April 1969, der Briefträger unseren Hof
betrat und mir einen Brief überreichte, in dem uns das Passamt in Allenstein mitteilte, dass unsere Ausreise in die
Bundesrepublik Deutschland, genehmigt worden ist. Wir müssten, nach Aushändigung der Reisepapiere, den Geltungsbereich
der Volksrepublik Polen, innerhalb von 3 Monaten verlassen. Wir waren zuerst geschockt, über den Hinweis, das wir
unsere Heimat in 3 Monaten verlassen müssen, aber dann stellte sich die Zukunftsperspektive wieder ein und wir gingen,
wie von einem schweren Ballast befreit und gut gelaunt unser weiteren Tätigkeit nach.
Als der Briefträger unseren Hof betrat, waren ich und mein Sohn Kurt gerade dabei eine Fuhre Mist zu laden. Wir hatten
den Wagen gerade halb geladen und haben nach der frohen Kunde nicht mehr weiter gemacht, sondern die Pferde vorgespannt
und den Mist aufs Feld gefahren, damit wir den Wagen für alle Fälle frei hatten. Das war die letzte Tätigkeit für
unsere Landwirtschaft in Ostpreußen.
Die Nachricht von unserer Ausreise verbreitete sich, ohne dass wir darüber gesprochen haben, wie ein Lauffeuer.
Alsbald kamen Leute aus dem Dorf, die sich für das Vieh und für diverse Landwirtschaftliche Geräte interessierten.
Etliche wollten bestimmte Sachen sofort kaufen, andere haben nur zurücklegen lassen und wollten später kommen und
bezahlen, haben es aber dann doch nicht genommen.

Wenn man eine Landwirtschaft hatte, konnte man 2 Pferde, 2 Rinder, 3 Schweine, 5 Schafe und 10 Hühner, in einem
geschlossenen Viehwaggon, in die Bundesrepublik mitnehmen. Jeden Tag war man unterwegs, von einer Behörde zur Andern.
Die Aushändigung der Reisepapiere erfolgte nur nach Vorlage bestimmter Bescheinigungen: Es mussten alle Steuern bezahlt
sein, das Kontingent landwirtschaftlicher Erzeugnisse musste abgeliefert sein, je eine Bescheinigung vom Katasteramt
und vom Notar musste vorgelegt werden, das man dem polnischen Staat das Grundstück abgetreten hat. Die Gebühren für
die notarielle Beglaubigung mussten wir selbst bezahlen. Wenn man alle Bescheinigungen beisammen hatte, bekam man bei
der Kreisverwaltung eine Gesamtbescheinigung. Mit dieser Bescheinigung konnte man nach Allenstein, zur
Polizeikommandantur fahren, wo man nach dem schriftlichen Verzicht auf die polnische Staatsangehörigkeit, einen
Reisepass ausgehändigt bekam, der den Inhaber zum Grenzübertritt berechtigte, aber nicht zur Wiedereinreise.
Wir haben 2 Pferde, eine Sterke, einen Ochsen, 5 Schafe, 2 Schweine und 10 Hühner mitgenommen. Über die Schutzimpfung
der Rinder musste man eine, vom Kreistierarzt beglaubigte Bescheinigung vorweisen. Ich habe 5 Schafsböcke gekauft, die
ich in der Zwischenzeit, hinter der Scheune, zum Weiden angekettet hatte. Einer von denen hat sich losgerissen und
seinen Nachbarn getötet. Das Fleisch konnten wir noch verkaufen, mussten aber dafür einen anderen Schafsbock kaufen.
Innerhalb von 3 Monaten mussten wir alles regeln und zwei Tage vor der Abfahrt einen Eisenbahnwagen, bei der
Eisenbahndirektion in Allenstein bestellen. Reservierungen bei den polnischen Behörden waren meist immer mit
Schmiergeld verbunden, weil man sonst nie sicher sein konnte dass diese Vereinbarungen auch eingehalten werden. Schon
2 Wochen vor unserer Abfahrt, gab es in Ortelsburg keine alkoholischen Getränke zu kaufen. Meine Söhne mussten mit dem
Motorrad die umliegenden Dörfer abfahren, damit wir für die Reise einen Vorrat anlegen konnten; denn Wodka war zu der
Zeit, in Polen, wie eine zweite Währung.
Am 25. Juli haben wir zusammen, mit meinem Neffen Siegfried Brosch, unseren sonstigen Hausrat, der in Kisten verpackt
war, in einen Eisenbahnwagen, auf dem Allensteiner Bahnhof verladen. Alles musste zuerst durch den Zoll, wo die
Federbetten gewogen wurden und über das erlaubte hinausgehende Kissen, verzollt werden mussten. Dasselbe galt auch für
Fleisch und Räucherwaren.
Am 26. Juli, unserem Verladetag, kam der Eisenbahnwagen aus Allenstein, erst um 11 Uhr auf dem Ortelsburger Bahnhof an.
Die Rinder hatten wir zu Fuß, zum Bahnhof gebracht; Schweine, Schafe und Hühner auf dem Pferdewagen. Im Eisenbahnwagen
mussten, mit Hilfe von Brettern und Bohlen, Boxen für die verschiedenen Tiere erstellt werden. Jedes Pferd und jedes
Rind in eine Bucht. Die Schafe zwischen die Pferde, die Schweine zwischen die Rinder und die Hühner in einem Käfig,
unter der Decke über den Rindern. Die Hühner hatten unterwegs Eier gelegt, somit hatten wir jeden Tag frische
Verpflegung. Bei der Fahrt im Viehwagen, begleitete mich mein Sohn Manfred. Als die Lokomotive nahte, um den Wagen
abzuholen, wurden noch schnell die restlichen Sachen hinein geworfen und so mache Abschiedsträne rollte dann die Wange
hinab.
Unsere Nachbarn, Deutsche und Polen, halfen uns beim Verladen des lebendigen Inventars. Jetzt erinnerte ich mich
plötzlich, an die oft auch schönen, Ereignisse der letzten 22 Jahre. Einer Zeit, in der das Zusammenleben von
Deutschen und Polen, von Jahr zu Jahr, besser wurde. Man half sich beim einbringen der Getreideernte, beim Dreschen
des Getreides, bei der Kartoffelernte und bei anderen Arbeiten, wo viele Menschen zupacken mussten. Es war eine
Dorfgemeinschaft, in schweren Zeiten geboren; jeder half jedem wenn Hilfe nötig war. Es wurde mir plötzlich bewusst,
das jetzt ein Lebensabschnitt zu Ende ging, zu dem ich nicht mehr zurückkehren konnte. Unsere Existenzgrundlage war
jetzt ein Eisenbahnwagen auf einem Schienenstrang, dessen Ende irgendwo in weiter Ferne lag. Obwohl, von langer Hand
vorbereitet, war dieser Moment voller Wehmut.
Doch als der Zug sich plötzlich, in Bewegung setzte, war ich sofort wieder in der Gegenwart. Menschen, mit denen man
Jahrzehnte lang, in gutem Einvernehmen zusammen gelebt hat, blieben plötzlich am Bahnsteig zurück und die Entfernung
zwischen ihnen und mir vergrößerte sich mit jeder Sekunde, bis sie letztendlich aus meinem Blickfeld verschwanden.
Es war ein heißer Julitag, als wir unsere Reise gen Westen antraten. Für die Schweine, die besonders unter der Hitze
zu leiden hatten, haben wir 10 Flaschen Essig mitgenommen und sie von Zeit zu Zeit besprenkelt, damit sie besser atmen
konnten. Für die anderen Tiere war reichlich Heu und Hafer vorhanden. Eine großes Fas und zwei Milchkannen waren mit
Wasser gefüllt, die wir auf den an der Strecke liegenden Bahnstationen, bei Bedarf wieder nachgefüllt haben.
Da der Kreistierarzt nicht in seinem Büro war, konnten wir die Impfbescheinigung für das Vieh, nicht rechtzeitig
herbeischaffen. Der Zug setzte sich in Bewegung und die Bescheinigung war immer noch nicht da. Als die Bescheinigung
dann eingetroffen, wir aber schon unterwegs waren, ist mein Sohn Kurt mit dem Motorrad hinterher gefahren und hat uns
in Passenheim, wo der Zug noch andere Wagen angehängt bekam, die Impfbescheinigung übergeben. Wir waren sehr froh das
er es noch geschafft hat, denn in solch einer Situation fühlt man sich sicherer wenn man alle Bescheinigungen bei sich
hat. Auf der Rückfahrt, mit dem Motorrad hatte er noch eine Panne, musste das Motorrad stehen lassen und per Anhalter
nach Hause fahren. Am nächsten Tag kam er mit Siegfried Deptolla, der das Motorrad wieder flott machte und brachte es
wieder nach Rohmanen zurück.
Die Fahrt mit dem Viehwagen, gen Westen
Von Ortelsburg bis Allenstein(45 km) hat unser Zug 4 Stunden gebraucht, weil auf jedem Bahnhof
gehalten wurde, um neue Wagen anzuhängen. Nachdem wir in Allenstein angekommen waren, kam ein Rangierer und fragte
nach unserem Ziel. Als wir ihm mitteilten, das wir in die Bundesrepublik Deutschland wollen, sagte er nur: „In 10
Minuten fährt ein Zug los. Wenn ich von euch 500 Zloty und einen Liter Wodka bekomme, werde euch sofort anhängen,
andernfalls kommt ihr auf ein Nebengleis und müsst dann auf den nächsten Zug warten. Es blieb uns nichts anderes übrig
als seiner Forderung nachzukommen, denn über derartige Erpressungen hat man bereits von Anderen, die vor uns ausgereist
sind, gehört. Wir wurden auch sofort angehängt und fuhren dann die ganze Nacht, an Osterode, und Thorn vorbei bis
Gnesen. Dort wurde wieder rangiert.
Von einer Anhöhe wurden die einzelnen Wagen auf verschiedene Gleise verteilt und zu neuen Zügen zusammengestellt. Der
Aufprall der ungebremsten Wagen erzeugte eine derartige Erschütterung, dass manche Bretter an den Boxen geborsten waren.
Von Gnesen ging es dann in einem Zuge durch bis zur Grenzstation Reppen(Rzepin). Dort mussten wir zum Zollamt, wo
unsere Ausfuhrpapiere durch die Zollbeamten, und durch einen Tierarzt geprüft wurden. Bis Reppen(Rzepin) haben wir für
den Eisenbahnwagen 900 Zloty bezahlt; hier mussten wir noch einmal 650 Zloty bezahlen. Bei der Wagenkontrolle erklärte
uns ein Bahnbeamter das unser Wagen, sich nicht für den internationalen Transport eignet und wir deshalb den Inhalt in
einen Anderen umladen müssen, der irgendwann, auf dem Nebengleis bereitgestellt wird. Nach langer Verhandlung, sowie
einer Zulage von 500 Zloty und einem Liter Wodka haben wir ihn davon überzeugt, das der Wagen sich doch für die
Weiterfahrt eignet.
In der Nacht war Schichtwechsel, der unseren Wagen wieder abgehängt hat, weil er angeblich von der Reichsbahn der DDR,
wegen technischer Mängel nicht weiterbefördert würde. Wir mussten unsere Verhandlung vom Vorabend wiederholen, die mit
der Zusage endete, dass wir am frühen Morgen, über die Grenze auf DDR Gebiet, gebracht werden. Um 5 Uhr morgens kam
eine Lokomotive, die uns den letzten Abschnitt bis über die Grenze bringen sollte. Als der Zug hat noch einmal anhielt,
kamen polnische Grenzbeamte und Soldaten in den Wagen. Sie durchsuchten ihn und fragten, ob wir noch polnisches Geld
oder einen Grundbuchauszug bei uns hätten. Wir zeigten ihnen 800 Zloty, die sie uns, nach Ausstellung einer Quittung
über 500 Zloty, abnahmen. Die Grundbuchauszüge habe ich, im Stroh versteckt, dem Ochsen vor die Füße gelegt. Falls
jemand da suchen sollte, hätte ich gesagt, das das Tier bösartig veranlagt ist, und ich für seine Sicherheit nicht
garantieren könnte, deshalb sollte er vorsichtig sein.
Als die Grenzkontrolle den Zug verlassen hatte, setzte sich die Lokomotive wieder in Bewegung und überquerte nach
kurzer Zeit die Oderbrücke. Auf einer eingezäunten Fläche, jenseits der Grenze, hat man uns abgestellt hat und die
Lokomotive fuhr zurück auf polnisches Gebiet. Vor und hinter uns waren die Tore verschlossen. Auf den Wachtürmen,
links und Rechts von uns, standen Posten mit einem Gewehr im Anschlag. Vier Grenzbeamte der DDR, jeder mit einer
Leiter in der Hand, sowie ein Schäferhund, kamen zu unserem Wagen. Sie öffneten die Schiebetüre, stellten die Leiter
davor und ließen den Hund in den Wagen springen, der nur etwas herum schnupperte und wieder heraussprang. 2 Beamte
haben dann anschließend, die Papiere kontrolliert und das Inventar gezählt.
Nach einiger Zeit wurden wir an einen Güterzug der Reichsbahn angehängt und fuhren von Frankfurt an der Oder, vorbei
an Berlin, Ellingen und Nordhausen, über die Grenze zur Bundesrepublik bis Herzberg. Hier hat ein Zollbeamter der
Bundesrepublik, die Formalitäten erledigt und ein Tierarzt die Pferde, Rinder und Schweine gründlich untersucht. Ich
musste ihnen die Mäuler aufhalten und die Füße hochheben. Danach hat uns die Lokomotive zu einer Wasserzapfstelle
gebracht, wo wir die Tiere tränken und unsere Behälter mit Wasser auffüllen konnten. Anschließen fuhren wir über
Northeim nach Göttingen, zur Viehverwertungsgenossenschaft, die zuvor von unserer Ankunft in Kenntnis gesetzt wurde.
Der Ochse, die Sterke und die Schweine wurden, in Göttingen zum Schlachthof gebracht; die Pferde kamen nach Hannover
und die Schafsböcke nach Kassel. Wir waren mit dem Viehtransport 5 Tage unterwegs; hatten so manche Klippe umschifft
und Schwierigkeiten gemeistert, die im normalen Leben nicht vorkommen.
Wir wurden mit einem PKW, ins Durchgangslager Friedland bei Göttingen gefahren, wo mein Sohn Kurt, meine Schwester
Frieda Pelkowski und Siegfried Brosch mit Familie, die am 30 Juli, um 14 Uhr, von Warschau mit dem Zug abgefahren, und
hier am 31. Juli in den Morgenstunden eingetroffen sind, schon auf uns gewartet haben. In Friedland hat man uns mit
Familie Siegfried Brosch in einem Raum untergebracht, wir wurden registriert und erhielten 20 DM Überbrückungsgeld,
pro Person. Da wir erst am Freitag in Friedland eingetroffen sind, mussten wir hier über das Wochenende bleiben,
obwohl die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der Regel nur 3 bis 4 Tage beträgt.
Um einen Antrag für die Ausreise stellen zu können, brauchten wir eine Einladung von in der Bundesrepublik lebenden
Verwandten. Diese Einladung hat uns mein Bruder, Ernst Rattay, aus Ingelheim am Rhein zugeschickt. Ingelheim liegt im
Bundesland Rheinland-Pfalz. Das Geld für die Bahnfahrt, hat uns, Frieda Schellin, geb. Nickel, aus Duisburg, die
Tochter unseres Nachbarn, überwiesen. In Friedland wurden wir registriert. Im Registrierschein, war als unser
nächster Aufenthaltsort in der Bundesrepublik, das Durchgangslager Osthofen bei Worms, das alle Aussiedler für
Rheinland-Pfalz aufnehmen musste, eingetragen. Die Eintragung erfolgte deshalb, weil der Ort aus dem uns unsere
Einladung zugeschickt wurde, sich auch in Rheinland-Pfalz befand.
Da ich nach dem Polenfeldzug, als Soldat, ein Jahr im Kreis Opladen, im Rheinland gewesen bin, wäre ich sehr gerne in
diese Gegend gezogen, denn die Erinnerung an die schönen Tage die ich dort verlebt habe war in mir immer noch wach.
Ich versuchte die Eintragung in unseren Regiestierscheinen ändern zu lassen, was nach einigen, vielleicht auch
berechtigten Einwänden, am 4. August, vom Beauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen, genehmigt wurde. Anstelle von
Rheinlad-Pfalz stand da jetzt Nordrhein-Westfalen und am 7. August, fuhren wir, noch mit anderen Aussiedlern, ins
Durchgangslager Unna-Massen, am östlichen Rande des Ruhrgebietes gelegen. Hier wurden wir in einem Zimmer untergebracht
und konnten unser Essen in einer Gemeinschaftsküche zubereiten.
Am 8. August wurden wir in Unna-Massen, als Bürger der Bundesrepublik Deutschland registriert, erhielten
Einhundert DM Begrüßungsgeld, den Vertriebenen Ausweis -A -und 4 Wochen später den Bundespersonalausweis. In
Unna-Massen haben wir mehr als 4 Monate verbracht, weil mein Sohn Kurt, wegen fehlender Berufsausbildung, in Unna, an
einem Grundlehrgang für Metallarbeiter teilgenommen hat, der vom Arbeitsamt finanziert wurde. Am 11 Dezember 1969 sind
wir endlich an unserem vorläufigen Wohnsitz, im Durchgangswohnheim, an der Elisabethstraße 13, in Velbert angekommen.
Ab dem 5. Januar 1970 konnten meine Söhne, in der Zahnradfabrik Reining, in Velbert ihrer geregelten Arbeit nachgehen.
Von Bau- und Sparverein in Velbert wurde uns am 20. Juni 1970, unsere erste Wohnung zugewiesen.
Velbert im Februar 1972
gezeichnet: Gustav Rattay
 Beziehungen zum medizinischen Dienst in Ortelsburg aufgebaut. Es wurden dort Lehrgänge in Erster Hilfe angeboten,
die von Prof. Dr. Kutz geleitet wurden. Adam Ornowski hat dafür gesorgt das einige junge Männer aus Rohmanen daran
teilnehmen konnten. Adam Ornowski, August Linka, Emil Rosowski, Johann Dembek, Emil Baschek und ich sind dann dem
Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes beigetreten und mussten jeden Sonntag am Lehrgang teilnehmen. Unser
Gruppenführer war Kreisobersekretär Albrecht, Landrat von Poser, als unser Ehrenvorsitzender, hat viel zu unserer
finanziellen Unterstützung beigetragen und hat dafür gesorgt dass die Bereitschaft eingekleidet wurde.
Beziehungen zum medizinischen Dienst in Ortelsburg aufgebaut. Es wurden dort Lehrgänge in Erster Hilfe angeboten,
die von Prof. Dr. Kutz geleitet wurden. Adam Ornowski hat dafür gesorgt das einige junge Männer aus Rohmanen daran
teilnehmen konnten. Adam Ornowski, August Linka, Emil Rosowski, Johann Dembek, Emil Baschek und ich sind dann dem
Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes beigetreten und mussten jeden Sonntag am Lehrgang teilnehmen. Unser
Gruppenführer war Kreisobersekretär Albrecht, Landrat von Poser, als unser Ehrenvorsitzender, hat viel zu unserer
finanziellen Unterstützung beigetragen und hat dafür gesorgt dass die Bereitschaft eingekleidet wurde.
In jedem Dorf wurde eine Unfallstelle eingerichtet, mit einem Verbandskasten und mit Verbandsmaterial für die erste
Hilfe ausgerüstet. Die Unfallstelle in Rohmanen, die am Haus von der Straßenseite, durch eine Tafel mit einem roten
Kreuz gekennzeichnet war, hatte ich zu verantworten. An Sonntagen wurden wir an Badestellen und bei Fußballspielen
eingesetzt, haben viele Übungen bei Waldbränden durchgeführt und auch Ausflüge nach Rudzany am Niedersee gemacht. Bei
der Einweihung des Tannenbergdenkmals in der Nähe von Hohenstein kamen wir an Straßenkreuzungen zum Einsatz.
Rohmanen hatte auch eine freiwillige Feuerwehr. Bis zum ersten Weltkrieg hat Friedrich Biella als Brandmeister das
Kommando gehabt. Er war aktiver Unteroffizier, hatte gute Führungsqualitäten und die Männer, die allesamt aus dem
aktiven Militärdienst stammten hatten zu ihm ein großes Vertrauen. Nach dem Krieg wollten diese Männer,
(Friedrich Nickel, Friedrich Willam, Julius Wittkowski, Jakob Janowski, Johann Gloddek, Gustav Bednarz), nicht mehr
weitermachen. Friedrich Biella, der inzwischen zum Gemeindevorsteher gewählt wurde, hat sich dann auf einer
Gemeinderatsitzung vorgeschlagen, für die Freiwillige Feuerwehr jüngere Kräfte anzuwerben.
Zum Brandmeister hat er Herrn Wilhelm Pilath vorgeschlagen. Der wurde dann nach Königsberg zur Fortbildung geschickt.
Der Feuerwehr gehörten nun folgende Personen an: Wilhelm Pilath(Brandmeister), August Linka(Stellvertreter), Gustav
Deptolla, Julius Matzey, Johann Dembek, Willy Willam, Gustav Rattay. Der Kreisbrandmeister war Heinrich Thalmann aus
Ortelsburg, sein Stellvertreter war Kreisobersekretär Salzmann. Der Bezirks-Kommissar bei der Ostpreußischen
Feuersozität War Herr Ernst Trzaska. Er hat dafür gesorgt das die Wehr uniformiert und mit Löschgeräten ausgerüstet
wurde. Da die alten Schläuche schon sehr marode waren, wurden sie durch moderne ersetzt, deren Kupplungen auch mit der
Motorspritze übereinstimmten.
Ernst Trzaska hat bei der Feuersozität und beim Landratsamt Finanzmittel beantragt und auch genehmigt bekommen. Der
Schneidermeister Wilhelm Baran wurde beauftragt Tuch und Drillichanzüge nach Maas zu schneidern. Er hat uns
Stoffmuster vorgelegt aus denen wir wählen sollten. Feuerwehrhelme haben wir auch bekommen. Die Gemeinde musste
Finanzmittel bereitstellen, einen Prozentsatz vom Gemeindebudget. Im Brandfall mussten für den Spritzenwagen Pferde
zur Verfügung stehen, von Willy Willam, Gustav Rattay, Julius Matzey und Gustav Dorka, weil sie in der Nähe des
Spritzenhauses wohnten. Am Spritzenhaus wurde ein großer Baum mit Querleisten aufgestellt, wo nach jedem Brand oder
einer größeren Übung die Schläuche zum trocknen aufgehängt wurden.
Der Kreisbrandmeister hat mindestens 2-3-mal im Jahr die Wehren besichtigt. Das ganze Dorf war dann auf den Beinen,
die Bauern mit Pferden, und andere Dorfbewohner mit Eimern und Spaten, wurden dann in verschiedene Gruppen eingeteilt.
Erst hat die Wehr sämtliche Aufstellungen am Gerät geübt; Grundstellung Fahrstellung und Marschstellung. Dann wurde
ein Brand angekündigt, die Feuerwehr mit der Spritze an den Brunnen, die Gruppen dort wohin sie beordert wurden, die
Bauern brachten mit den Wasserkiwen Wasser aus dem Brunnen zum Brandort. Wenn das Wasser im Brunnen alle wurde hat
man den Saugkorb in die Kiewen gelegt und dort Wasser entnommen. Die Wassergruppe ging mit Eimern zum Dorfteich, holte
Wasser und füllte damit die leeren Kiewen.
Der Löschtrupp ging mit Feuerhaken und Löschpatschen auf die umliegenden Gehöfte und versuchte das vermeintliche Feuer
von ihnen fernzuhalten. Nach dem Alarm wurde wieder am Spritzenhaus angetreten. Die Gruppenführer mussten angeben ob
ihre Gruppe auch vollständig erschienen war, denn Übungen wurden nur vor, oder nach der Feldarbeit durchgeführt, so
dass niemand eine Entschuldigung vorbringen konnte. Wer ohne begründete Entschuldigung nicht anwesend war erhielt eine
Verwarnung. Der Kreisbrandmeister erklärte dann welche Handgriffe den Vorschriften entsprachen und welche nicht. Die
Schläuche wurden noch schnell zum Trocknen aufgehängt. Anschließend gingen wir alle in den Gasthof Trzaska, haben über
vorhandene Mängel diskutiert, Verbesserungsvorschläge unterbreitet und zwischendurch den Durst gelöscht. Der
Kreisbrandmeister ist dann, nach einer kurzen Verabschiedung, ins nächste Dorf gefahren, weil er an einem Tag mehrere
Feuerwehren betreuen musste.
Zum Brandmeister hat er Herrn Wilhelm Pilath vorgeschlagen. Der wurde dann nach Königsberg zur Fortbildung geschickt.
Der Feuerwehr gehörten nun folgende Personen an: Wilhelm Pilath(Brandmeister), August Linka(Stellvertreter), Gustav
Deptolla, Julius Matzey, Johann Dembek, Willy Willam, Gustav Rattay. Der Kreisbrandmeister war Heinrich Thalmann aus
Ortelsburg, sein Stellvertreter war Kreisobersekretär Salzmann. Der Bezirks-Kommissar bei der Ostpreußischen
Feuersozität War Herr Ernst Trzaska. Er hat dafür gesorgt das die Wehr uniformiert und mit Löschgeräten ausgerüstet
wurde. Da die alten Schläuche schon sehr marode waren, wurden sie durch moderne ersetzt, deren Kupplungen auch mit der
Motorspritze übereinstimmten.
Ernst Trzaska hat bei der Feuersozität und beim Landratsamt Finanzmittel beantragt und auch genehmigt bekommen. Der
Schneidermeister Wilhelm Baran wurde beauftragt Tuch und Drillichanzüge nach Maas zu schneidern. Er hat uns
Stoffmuster vorgelegt aus denen wir wählen sollten. Feuerwehrhelme haben wir auch bekommen. Die Gemeinde musste
Finanzmittel bereitstellen, einen Prozentsatz vom Gemeindebudget. Im Brandfall mussten für den Spritzenwagen Pferde
zur Verfügung stehen, von Willy Willam, Gustav Rattay, Julius Matzey und Gustav Dorka, weil sie in der Nähe des
Spritzenhauses wohnten. Am Spritzenhaus wurde ein großer Baum mit Querleisten aufgestellt, wo nach jedem Brand oder
einer größeren Übung die Schläuche zum trocknen aufgehängt wurden.
Der Kreisbrandmeister hat mindestens 2-3-mal im Jahr die Wehren besichtigt. Das ganze Dorf war dann auf den Beinen,
die Bauern mit Pferden, und andere Dorfbewohner mit Eimern und Spaten, wurden dann in verschiedene Gruppen eingeteilt.
Erst hat die Wehr sämtliche Aufstellungen am Gerät geübt; Grundstellung Fahrstellung und Marschstellung. Dann wurde
ein Brand angekündigt, die Feuerwehr mit der Spritze an den Brunnen, die Gruppen dort wohin sie beordert wurden, die
Bauern brachten mit den Wasserkiwen Wasser aus dem Brunnen zum Brandort. Wenn das Wasser im Brunnen alle wurde hat
man den Saugkorb in die Kiewen gelegt und dort Wasser entnommen. Die Wassergruppe ging mit Eimern zum Dorfteich, holte
Wasser und füllte damit die leeren Kiewen.
Der Löschtrupp ging mit Feuerhaken und Löschpatschen auf die umliegenden Gehöfte und versuchte das vermeintliche Feuer
von ihnen fernzuhalten. Nach dem Alarm wurde wieder am Spritzenhaus angetreten. Die Gruppenführer mussten angeben ob
ihre Gruppe auch vollständig erschienen war, denn Übungen wurden nur vor, oder nach der Feldarbeit durchgeführt, so
dass niemand eine Entschuldigung vorbringen konnte. Wer ohne begründete Entschuldigung nicht anwesend war erhielt eine
Verwarnung. Der Kreisbrandmeister erklärte dann welche Handgriffe den Vorschriften entsprachen und welche nicht. Die
Schläuche wurden noch schnell zum Trocknen aufgehängt. Anschließend gingen wir alle in den Gasthof Trzaska, haben über
vorhandene Mängel diskutiert, Verbesserungsvorschläge unterbreitet und zwischendurch den Durst gelöscht. Der
Kreisbrandmeister ist dann, nach einer kurzen Verabschiedung, ins nächste Dorf gefahren, weil er an einem Tag mehrere
Feuerwehren betreuen musste.
Der Kreisbrandmeister hat mindestens 2-3-mal im Jahr die Wehren besichtigt. Das ganze Dorf war dann auf den Beinen,
die Bauern mit Pferden, und andere Dorfbewohner mit Eimern und Spaten, wurden dann in verschiedene Gruppen eingeteilt.
Erst hat die Wehr sämtliche Aufstellungen am Gerät geübt; Grundstellung Fahrstellung und Marschstellung. Dann wurde
ein Brand angekündigt, die Feuerwehr mit der Spritze an den Brunnen, die Gruppen dort wohin sie beordert wurden, die
Bauern brachten mit den Wasserkiwen Wasser aus dem Brunnen zum Brandort. Wenn das Wasser im Brunnen alle wurde hat
man den Saugkorb in die Kiewen gelegt und dort Wasser entnommen. Die Wassergruppe ging mit Eimern zum Dorfteich, holte
Wasser und füllte damit die leeren Kiewen.
Der Löschtrupp ging mit Feuerhaken und Löschpatschen auf die umliegenden Gehöfte und versuchte das vermeintliche Feuer
von ihnen fernzuhalten. Nach dem Alarm wurde wieder am Spritzenhaus angetreten. Die Gruppenführer mussten angeben ob
ihre Gruppe auch vollständig erschienen war, denn Übungen wurden nur vor, oder nach der Feldarbeit durchgeführt, so
dass niemand eine Entschuldigung vorbringen konnte. Wer ohne begründete Entschuldigung nicht anwesend war erhielt eine
Verwarnung. Der Kreisbrandmeister erklärte dann welche Handgriffe den Vorschriften entsprachen und welche nicht. Die
Schläuche wurden noch schnell zum Trocknen aufgehängt. Anschließend gingen wir alle in den Gasthof Trzaska, haben über
vorhandene Mängel diskutiert, Verbesserungsvorschläge unterbreitet und zwischendurch den Durst gelöscht. Der
Kreisbrandmeister ist dann, nach einer kurzen Verabschiedung, ins nächste Dorf gefahren, weil er an einem Tag mehrere
Feuerwehren betreuen musste.

Einen Kilometer vom Ende des Dorfes entfernt, auf der rechten Seite der Landstraße in Richtung
Ortelsburg, befand sich der Rohmaner Dorffriedhof. Wann dieser Friedhof angelegt wurde entzieht sich meiner Kenntnis.
Nach Aussagen älterer Dorfbewohner soll davor auch schon eine Ruhestätte vorhanden gewesen sein, und
zwar auf der linken Straßenseite gegenüber dem jetzigen Friedhof. An dieser Stelle befand sich bis in die
Nachkriegszeit ein kleiner Brunnen, aus dem die Dorfbewohner, das Wasser zum begießen der Grabbepflanzung auf den
Gräbern ihrer verstorbenen Angehörigen holten. Der Friedhof war in einer Hanglage angelegt, wahrscheinlich weil diese
Parzelle für eine landwirtschaftliche Nutzung nicht geeignet war. Um das Gräberfeld vor herumstreunenden Tieren oder
von der Weide entlaufenen Kühen zu schützen, hat man das ganze Gelände mit einem Holzzaun umgeben. Der Zugang befand
sich von der Straßenseite. Unter einem Torbogen hindurch wurden die Verstorbenen zu Grabe getragen. Die Gräber der
einzelnen Familien waren nebeneinander angelegt, mache, wie zum Beispiel die der Familie Trzaska, sogar mit einem
schmiedeeisernen Zaun eingefasst.
Nach dem 2. Weltkrieg verfiel der Friedhof immer mehr. Die nötigen Finanzmittel für die Pflege der Einfriedung konnten
von den restlichen noch verbliebenen Deutschen nicht mehr aufgebracht werden. An den gepflegten Gräbern konnte man noch
erkennen dass es Verwandte von noch in Rohmanen wohnenden Deutschen waren, oder von bereits im Westen Deutschlands
lebenden, die ihre noch in Rohmanen wohnenden Nachbarn damit beauftragt hatten. Die übrigen Gräber wurden von Jahr zu
Jahr immer mehr von Wildkräutern überwuchert und schließlich auch von Sträuchern und schnell wachsenden Bäumen.
In den späteren Jahren konnte man nicht mehr erkennen dass dort vor Jahren Tote zur letzten Ruhe gebettet wurden. Die
Natur holte sich das ganze Gelände zurück und nur unter großen Schwierigkeiten konnten Besucher aus dem Westen das
Friedhofsgelände noch betreten.
Das Gasthaus Trzaska

Nach dem ersten Weltkrieg hat der Gastwirt Friedrich Trzaska neben dem Gasthof einen großen Saal
für Festlichkeiten und Vereinsfeiern gebaut, in dem schon mal Feuerwehrfeste veranstaltet wurden. Ernst Trzaska war
Feuerkommissar bei der Ostpreußischen Feuersozität. Erich Trzaska war Vollziehungsbeamter beim Amtsgericht in
Ortelsburg. Unser Feuerkommissar war uns beim organisieren der Veranstaltungen sehr behilflich, hat uns den Saal, die
Musik und die Theaterstücke besorgt und die Feuerwehren aus den Nachbardörfern eingeladen.
Zu Manöverzeiten, vor dem 2. Weltkrieg und dann auch während des Krieges, waren im Gasthof Soldaten, meist im Range
eines Offiziers, einquartiert. Fräulein Mariechen Trzaska hat die Poststelle im Dorf betreut. Nachdem ich 1939 zum
Militär eingezogen wurde, hat sie, nach einer Schulung im Ortelsburger Krankenhaus, auch die Unfallmeldestelle
übernommen. Nach dem Krieg, pflegte sie mit vielen Bekannten, die bereits in der Bundesrepublik wohnten, einen regen
Briefwechsel. Auf dem Rohmaner Friedhof hat sie viele Gräber, im Auftrag von Angehörigen, die auf Grund ihrer
Abwesenheit, dazu nicht mehr in der Lage waren, gepflegt. Der Bauunternehmer Kurnitzki aus Ortelsburg, äußerte die
Bitte, sie möchte ihm doch ein Blatt vom Rosenstrauch, der auf dem Grab seiner Eltern steht, in den Brief legen. Als
sie uns den Brief vorgelesen hat, waren wir zu Tränen Gerührt. Sie hat als Letzte aus ihrer Familie, bis zu ihrem Tod
im Jahre 1960, in Rohmanen, im Gebäude der Gastwirtschaft gewohnt und ist auf dem Rohmaner Friedhof beerdigt worden.
Fleisch und Wurstwaren Karl Pelkowski
Im Jahr 1931 hat der Fleischermeister Karl Pelkowski, aus Grammen, direkt neben unserem Hof ein
Anwesen gekauft und dort eine Fleischerei eingerichtet. Er war mit meiner Schwester Frieda, verheiratet. Am Anfang hat
er die Schweine noch auf seinem Hof geschlachtet, später dann im Ortelsburger Schlachthof. Jede Woche fuhr er 2-mal,
mit dem Pferdewagen(Einspänner), nach Ortelsburg zum Wochenmarkt, wo er seine Fleisch und Wurstwaren zu Verkauf anbot.
Am Tag davor, wenn er die Wurst gekocht hat, kamen viele Rohmaner mit Kannen oder anderen Gefäßen, wegen der guten
Wurstsuppe, die er umsonst unter die Leute verteilte. Als Karl Pelkowski, Ende August 1939 zum Militär eingezogen
wurde, hat seine Frau das Pferd verkauft und den Beitrieb stillgelegt. Am Haus hing, immer noch die Tafel mit der
Aufschrift: Karl Pelkowski, Fleisch und Wurstwaren. Ein Witzbold hat irgendwann darunter geschrieben; „Fleisch und
Wurst waren einmal”, drauf hin hat Frau Pelkowski die Tafel entfernen lassen. Karl Pelkowski ist im Mai 1946 in
französischer Gefangenschaft verstorben. Seine Ehefrau Frieda, verstarb an ihrem 85. Geburtstag in Mettmann bei
Düsseldorf.
Die steinreichen Rohmaner Felder
Die letzte Eiszeit hat bei der Schmelze, auf der Rohmaner Feldgemarkung viele Steine und
Granitblöcke zurück gelassen. Überirdisch, aber besonders unter der Erde, gab es viele kleine, aber auch große Steine,
die, den Bauern, beim Pflügen und anderen Feldarbeiten sehr viel Schweiß, abverlangten. In einer Kiesgrube, auf dem
Feld des Bauern August Radek, lag ein Granitblock, von schätzungsweise 100 cbm. Vor etwa 80 Jahren, als man für diese
Steine noch keine Verwendung hatte, griffen die Bauern zu einer „List”. Weil er sonst nicht pflügen konnte, hat mancher
seinem Nachbarn, die Steine in der Nacht auf dessen Feld abgeladen. Als diese Tätigkeit unter Strafe gestellt wurde,
hat man die Steine in Schluchten gekippt und mit Mutterboden zugeschüttet. In späteren Jahren kam diese jedoch beim
pflügen wieder an die Oberfläche. Dann hat man aber schon Steine für den Straßenbau gebraucht und konnte sie so zu Geld
machen. Besonders im Raum südlich von Ortelsburg, bis zur polnischen Grenze, wo Steine eine Rarität waren, kamen sie
jetzt zum Einsatz. Auch beim Bau von Häusern, besonders für die Fundamente, wurden sie eingesetzt, weil auf diese
Weise viel Ziegeln eingespart wurden. Die Firma Gribienski aus Ortelsburg hat die großen Steine mit Dynamit gesprengt
und auf diese Weise die weitere Verarbeitung erleichtert.
Die Steine welche beim Pflügen aus dem Boden geholt wurden, hat man am Feldrand auf große Haufen zusammen getragen.
Wenn die Feldarbeit beendet war, sowie auch in den Wintermonaten, waren wir jeden Tag mit Steinen unterwegs. Wir sind
vorwiegend am Abend los gefahren, weil unter der schweren Last die Wagenachsen so heiß wurden und die Gefahr bestand,
das durch die Dehnung, die Räder blockiert würden. Bei einer Fahrt konnte man bis zu 24 Reichsmark verdienen, wogegen
1 Zentner Roggen für 8 bis 9 Reichsmark zu haben war. Ich bin selbst, mit dem Pferdewagen bis Fürstenwalde, Radostowen,
Luka, Altkirchen, Höhenwerder, ja sogar bis Friedrichshof gefahren.
In Rohmanen wurden auch rote Ziegeln gebrannt. Viele Häuser wurden, mit Ziegeln erbaut, die nur wenige 100 Meter von
der Baustelle entfernt hergestellt wurden. Der Lehn wurde auf den Feldern in der näheren Umgebung entnommen, dann von
Ochsen solange getreten, bis er so geschmeidig war, das er sich in Formen einstreichen ließ. Wenn die Ziegel in der
Form trocken war, wurde sie entnommen und in einem Brennofen gestapelt. Um einen Ofen richtig anzufeuern, brauchte man
12 Raummeter Holz, das im Zeitraum von ein par Tagen verheizt wurde. Der Fischer Karl Glitza hatte schon eine
Knetmaschine, die von einem Pferd angetrieben wurde, das mit verbundenen Augen, den ganzen Tag in die Runde ging.
Im Dorf waren auch vier Kalköfen, in denen so genannte Kalksteine, die sich an gewissen Stellen, im Erdboden befanden,
gebrannt wurden. Nach dem Brennen wurden die Steine mit Wasser abgelöscht und die daraus entstandne Masse diente, nach
dem Beimischen einer gewissen Menge Sand, dann als Bindemittel beim Häuserbau. Das Gerichtsgebäude und das
Lehrerseminar in Ortelsburg wurden mit Kalk, aus dem Rohmaner Brennöfen erbaut. Auch zum Bau einer Eisenbahnbrücke, auf
der, der Zug, den Sawitzfluß, von Ortelsburg nach Allenstein überquerte, hat mein Großvater, mit einem Ochsengespann,
Kalk gefahren.
Hinter der Scheune, beim Bauern Johann Dembek hat man Tonerde gefördert, aus der man mit Hilfe einer Formerscheibe,
die von einem Arbeiter mit Muskelkraft(Fußbetrieb) angetrieben wurde, schöne Krüge, Schalen und Vasen geformt hat.
Die Töpferware wurde, nachdem sie trocken genug war, auch in einem Ofen gebrannt, anschließend mit einer Lasur
überzogen und wieder gebrannt. Es wurden auch Kacheln zum Bau von Kachelöfen hergestellt, die mit verschiedenen
Ornamenten versehen, die Wohnstuben unserer Vorfahren schmückten. So haben unsere Großväter ihr Leben gemeistert und
nach und nach, unsere Dörfer aus der Rückständigkeit in die Neuzeit geführt.
Das gesellschaftliche Leben nach dem 1. Weltkrieg

Als der Lehrer Alfred Dorka, ein Frontkämpfer des Ersten Weltkrieges und ein Sportsmann, als
zweite Lehrkraft an der Rohmaner Schule angestellt wurde, hat er die Sitten und Gebräuche aus früherer Zeit wieder zum
Leben erweckt. Zuerst hat er die Jugend zusammen gerufen, einen Jugendverein und einen Fußballclub, gegründet. Zum
Vorsitzenden des Fußballclubs wurde Johann Gloddek berufen, der ihn auch geleitet hat. Bauer Wilhelm Spittka, der am
Rohmaner See wohnte, stellte Land für einen Sportplatz unentgeltlich zur Verfügung. Lehrer Alfred Dorka hat am
Rohmaner See eine Badestelle ausgesucht und ein Sprungbrett bauen lassen. An jedem Sonnabend im Sommer, bevor die
Sonne unterging, versammelte sich die gestammte Jugend des Dorfes an der Badestelle am See. Es wurde gebadet,
Heimatlieder gesungen, gespielt, im Fackelschein eines großen Biwakfeuers, bis in die späte Nacht hinein. Der Fischer
Karl Glitza hat uns Kähne zur Verfügung gestellt, mit denen wir auf den See hinausgepaddelt sind, dabei hatten wir viel
Spaß, was wiederum den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft gefördert hat. Ich habe mit meiner Mandoline den Gesang von
Volks- und Heimatliedern begleitet.
Der Rohmaner See liegt in einem Tal, dessen Hänge zu beiden Seiten mit Kiefern und Tannen bewaldet sind. Wenn man
gesungen oder Musiziert hat, hallte es von den Hängen zurück. Die Ufer waren mit Kalmus und Schilf bewachsen, was für
die Fischaufzucht von Vorteil war. Wenn man an einem sonnigen, windstillen Tag, am Seeufer spazieren ging, traf man
oft auf Flachstellen, an denen sich die Fischbrut im Sonnenlicht wärmte, wie ein Mückenschwarm. Im See befanden sich
folgende Fische: Karpfen, Hechte, Schleie, Barsche Plötze, Rotaugen, Aale und Krebse. Am Sonntagmorgen brachten viele
Rohmaner ihre Pferde zum See um sie zu baden.
Es wurden dort, unter der Aufsicht von Lehrer Dorka, auch viele Jugendfeste mit Theatervorführungen veranstaltet, zu
denen er selbst die Vorlagen organisiert hat. Der am See wohnende Bauer Johann Nadrowski, hat uns ein Scheunentor, als
Tanzboden zur Verfügung gestellt. Der Zimmermann Wilhelm Wittek hat uns eine Windmühle gebaut, die am auf dem Boden
liegenden Scheunentor aufgestellt wurde, dazu kamen Noch Tannen und Fichten, die das Ganze wie ein Bühnenbild
erscheinen ließen. Es wunden viele Bühnenstücke aufgeführt, unter anderen >Alte Weiber werden jung gemahlen<. Dazu bot
die Windmühle die entsprechende Kulisse.
Nach der Vorführung wurde der Boden aufgeräumt, um dann als Tanzdiele zur Verfügung zu stehen. Der Gastwirt Trzaska
hatte Tische und Bänke aufgestellt, Speisen und Getränke angeboten, so dass sich die die Veranstaltung bis in die
späte Nacht hinein zog. Es waren auch Leute aus Ortelsburg und anderen Nachbardörfern dabei. Im Winter hat Lehrer
Dorka eine Kreisrodelbahn eingerichtet, die von Zeit zu Zeit mit Wasser besprengt wurde, um die Gleitfähigkeit zu
verbessern. Von einer Anhöhe ging hinunter bis auf den halben See, was für alle ein großes Vergnügen war. Es kamen
Lehrer mit Schulklassen aus der näheren Umgebung um hier zu Rodeln.
Als Herr Lehrer Jobski als Hauptlehrer nach Rohmanen kam hat er mit dem Bürgermeister und der Gemeindeverwaltung
beschlossen, in der Nähe des Dorfes, auf einem zur Schule gehörenden Grundstück, einen Sportplatz anzulegen. Dafür
wurde gleich hinter den Gärten, 6 Morgen Ackerland abgetrennt, und nach Feierabend hat Lehrer Dorka mit den
Jugendlichen eingeebnet und gleich nebenan einen Graben für Schützenstand und Kugelfang ausgehoben. Am Sonntagvormittag
wurde Fußball gespielt und um 15:00 Uhr war Kleinkalieberschießen angesagt. Es musste auch ein kleiner Beitrag erhoben
werden, um Munition kaufen zu können. Eine Büchse konnten wir aus beim Kleinkalieberverein in Ortelsburg ausleihen.
Nach Hitlers Machtergreifung
Als Adolf Hitler an die Macht kam wurde die SA gegründet. Der Bürgermeister Michael Kownatzki
wurde zum Gruppenführer ernannt und folgende Männer haben sich freiwillig gemeldet: Wilhelm Matzey, Johann Gloddek,
Gustav Nadrowski, August Buttler, Karl Baran, Emil Nickel, Wilhelm Jaschinski, Emil Bork, Ernst Rattay und Gustav Bach.
Bei Versammlungen war die SA in Uniform angetreten um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Wer versucht hat Unruhe zu
stiften, egal aus welchem Grunde, wurde aufgefordert den Saal zu verlassen, andernfalls wurde er mit Gewalt entfernt.
Herr Lehrer Jobski wurde zum politischen Leiter ernannt, seine Frau hat die NS-Frauenschaft gegründet, Lehrer Dorka
die HJ, und so bekam die Dorfgemeinschaft, nach und nach ein anderes Gesicht. Der Sportplatz und der Schützenstand
wurden jetzt mehr als früher in den Mittelpunkt gestellt. Nach der Feldarbeit hat der Bürgermeister Fuhrwerke bestellt
und den Sportplatz noch besser herrichten lassen.
Der Bauer Wilhelm Both wurde zum Ortsbauernführer ernannt, mit der Aufgabe alles Land für den Anbau von Getreide und
Futtermittel bereitzustellen, oder wenn das nicht möglich war mit Wald aufzuforsten. Durch den Einsatz von Kunstdüngern
sollten größere Erträge aus dem Boden geholt werden, um den Viehbestand zu vergrößern und mehr Milch und Butter zu
produzieren. Deutschland sollte im Stande sein sich selbst zu selbst zu ernähren, ohne auf Importe angewiesen zu sein.
Frau Jobski hat, innerhalb der der NS-Frauenschaft, mit Hilfe von Fachkräften aus Ortelsburg, Lehrgänge veranstaltet,
auf denen man Backen und Nähen lernte. Auf den Bauernhöfen befand sich auch immer mehr Rassegeflügel, das eine erhöhte
Produktion von Eiern und Geflügelfleisch sicherstellen sollte.
Die Rohmaner Bauern hatten, außer in der Landwirtschaft, noch andere Verdienstmöglichkeiten in der Kreisstadt. In
Ortelsburg wurden vier Sägewerke betrieben, die mit Langholz aus dem Walde versorgt werden mussten. Wir haben eine
Kiefer von über 8 Festmeter angefahren, der wir zuerst 6 Meter Spitze abschneiden mussten, um diese Last überhaupt
auf den Wagen zu bekommen. Sechs Pferde musste angespannt werden um den Wagen zur befestigten Straße zu bringen.
Fichten und Tannen wuchsen bis zu einer Länge von 30 Metern. Auch beim Transport von Ziegel, von der Ziegelei zum
Bahnhof, konnte man gutes Geld verdienen.
Im Jahr 1934 wurde Rohmanen an das überregionale Stromnetz angeschlossen und schaffte auf diese Weise den Sprung von
der Petroleumlampe zur Glühbirne. Neben dem Grundstück von Karl Pietzonka wurde ein Transformatorhäuschen errichtet,
in dem der ankommende Strom von einer Hochspannung auf eine Verbrauchsspannung transformiert wurde. Es gab schon eine
Überlandleitung, die aus Richtung Ortelsburg kommend, quer über die Felder, in Richtung Neu Keykuth weiter ging.
Durch eine Zwischenspanne wurde der Transformator, mit der Hauptleitung auf Kownatzkis Feld verbunden.
Ein Stromanschluss konnte die Arbeit im Haus und Hof auf vielfältige Weise erleichtern, doch nur die besser gestellten
Bauern, sowie noch manche Pensionäre, die ein festes Einkommen hatten, konnten sich dass leisten. Weil nur wenige an
der Elektrifizierung teilnahmen, war ein Stromanschluss mit hohen Kosten verbunden. Nur Gustav Pietzonka, Gasthof
Trzaska, Friedrich Nickel, die Schule und Wilhelm Both, wurden in der ersten Phase erfasst.
Im Jahr 1952 wurde von den polnischen Behörden die zweite Stufe der Elektrifizierung eingeleitet, in der alle im Dorf
stehen Gebäude erfasst wurden. Am Anfang wurden nur Leitungen für Lichtstrom gelegt und auch nur 3 Lichtstellen pro
Haushalt bewilligt. Doch im nachfolgenden Zeitraum wurden dann, wenn Material vorhanden war, weitere Lichtpunkte
angelegt. 1952, am zweiten Wochenende im Advent, wurden dann die Leitungen geschaltet und alle waren von der
plötzlichen Helligkeit sehr begeistert. Wenn man Glühbirnen auswechseln wollte musste man am Anfang weite Wege
zurücklegen, um welche zu bekommen. In den 60ger Jahren wurden dann immer mehr Starkstromleitungen gelegt, weil die
Bauern elektrische Geräte kaufen konnten. Ende der 60ger wurden auch die Abbauten an das Stromnetz angeschlossen.
Das Urnengrab auf unserem Feld
Auf unserem Feld, in Richtung Seelonken, bin ich oft beim pflügen gegen Steine gestoßen, manchmal
rissen sogar die Stränge am Pferdegeschirr. Eines Tages nahm ich einen Spaten, Brechstange und einen langen Baum, um
der Sache auf den Grund zu gehen. Als ich eine Menge Sand ausgehoben hatte stieß ich auf eine steile, aus Steinen
errichtete Wand, die ich auch mit dem Baum nicht aus der Fassung bringen konnte. Ich habe den ganzen Vormittag gegraben,
konnte jedoch nicht unter die Steine kommen. Einige Tage später hatten wir in der Schule eine Bauernversammlung, da
habe ich Herrn Biella und Herrn Lehrer Dorka von meinem Fund berichtet. Am nächsten Morgen kam der Lehrer Dorka mit der
ganzen Schulklasse, mit Spaten und Sieben ausgerüstet auf unser Feld und fingen an die ausgehobene Erde zu sieben.
Lehrer Dorka benachrichtigte daraufhin den Leiter des Ortelsburger Heimatmuseums, der am nächsten Morgen vorbei kam um
sich die Fundstelle genau anzusehen. Er beauftragte ihn 4 Mann zu besorgen, um die Steine ringsum frei zu schaufeln.
Zwischen den Steinen durften wir die Erde nur mit Esslöffeln ausheben. Als es plötzlich zu regnen anfing hat Lehrer
Dorka die Brauerei Daum, in Ortelsburg angerufen, die uns über der Fundstelle ein Zelt errichtet haben, damit wir
ungestört weiterarbeiten konnten. Wir fanden 8 flache und 8 hohe Urnen zu beiden Seiten am Körper. Die Urnen wurden in
Gipsbinden eingewickelt und ins Heimatmuseum nach Ortelsburg gebracht, wo sie durch einen Fachmann, der extra aus einem
Königsberger Museum angereist war. Nach Reinigung der Urnen hat er festgestellt, das die Grabstätte etwa 2000 Jahre vor
Christi Geburt angelegt wurde und ein Doppelgrab war, in dem ein Toter liegend und einer in Hochstellung beigesetzt
wurde.
Die Nachricht von der Fundstelle verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Es erschienen viele Schaulustige, ganze
Schulklassen aus der Umgebung, mit Autos und zu Fuß. Durch die vielen Menschen wurden die bestellten Ackerflächen auf
unserem Feld sehr in Mitleidenschaft gezogen, eine Entschädigung haben wir nicht erhalten. Das Grab wurde vor dem
Heimatmuseum in Ortelsburg wieder so aufgebaut wie man es auf unserem Feld vorgefunden hat. Für den Transport der
Steine wurde ich entlohnt. Die Urnen hat das Königsberger Museum an sich genommen und wollte sie nicht wieder hergeben,
weil die solch einen Fund noch nicht in ihrer Sammlung hatten.
Sonnenwendfeuer
Am 24 Juni fand eine Sonnenwendfeier statt. Ein Brauch der an die alten Germanen erinnern sollte.
Der Lehrer Dorka hat den Bürgermeister beauftragt 2 Fuhrwerke in den Wald zu schicken, die Holz und alten Reisig holen
und auf dem großen Schulberg abladen sollten. Das Straßenbauamt hat uns Teertonnen zur Verfügung gestellt. Die ganze
Dorfgemeinschaft wurde eingeladen, am Abend, nach der Feldarbeit, an der Sonnenwendfeier teilzunehmen. Lehrer Dorka
hielt zuerst eine Ansprache, in der er anschaulich erklärte wie unsere Vorfahren in grauer Vorzeit gefeiert haben.
Nach dem offiziellen Teil wurden das Holz und die Teertonnen angezündet, es wurden Heimatlieder gesungen, wie: Wild
flutet der See, drauf schaukelt der Schiffer den schwankenden Kahn, Schaum wälzt er wie Schnee, von grausiger Mitte
zum Ufer heran, wild fluten die Wellen auf Vaterlands See, wie schön, oh trag mich auf Spiegel zu Hügel, Masovias See.
Masovia Land, mein Heimatland, Masovia es lebe mein Vaterland.
Lehrer Alfred Dorka und sein Wirken für Rohmanen.

Friedrich Biella hatte auf seinem Feld einen Granitstein mit einer geraden Seite, den haben wir
mit viel Schweiß an den Dorfteich transportiert und auf einer Erhöhung abgelegt. Der Stein sollte zum Denkmahl für die
Gefallenen des Ersten Weltkrieges umgestaltet werden. Da zu Wenige daran ein Interesse zeigten, wurde diese Idee fallen
gelassen und der Stein irgendwann ins Wasser gerollt. Der Lehrer Dorka war viele Jahre in Rohmanen tätig, dort hat er
später seine ehemalige Schülerin, Lotte Biella geheiratet. Er hat sich sehr für die Entwicklung des Dorfes interessiert,
war bei jeder Gemeindeversammlung anwesend und hat auf Schwachstellen hingewiesen die den Fortschritt behinderten.
Gemeinsam mit den Schülern hat er den Ehrenfriedhof für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges gepflegt, an der
Wegegablung nach Eichtal und zu Ehren des Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg eine Eiche gepflanzt.
Zum Advent hat Lehrer Dorka mit der Jugend einen Adventstern, in verschiedenen Farben gebastelt.
Der Stern wurde auf einer 2 Meter langen Stange befestigt, in der Mitte wurde ein Wachslicht angezündet, am Stern
wurde eine Schnur angebracht, wenn man daran zog rollte der Stern hin und her. Am ersten Wochenende im Advent
versammelten sich jung und alt, um den Stern durch das Dorf zu tragen. Alle schlossen sich dem vorausgehenden
Sternträger an, der den Stern durch die Hauptstraße und die angrenzenden Wege trug. Dieser Sternmarsch wurde an den
folgenden Adventwochenenden wiederholt.
Am ersten Weihnachtfeiertag wurde um 4:00 Uhr morgens ein Frühgottesdienst gehalten. Zuerst hat der Pfarrer eine
Andacht gehalten, dann haben die Kinder ein Krippenspiel aufgeführt und die Gemeinde hat schöne Weihnachtslieder
gesungen. Der Gastwirt Trzaska hat uns den Saal zur Verfügung gestellt. Wir hatten eine Posaunen- u. eine
Gitarrengruppe. Unter der Leitung von Herrn Willi Doormann spielten: Gottlieb Brosch, Fritz Ollech,
Gustav Rattay(Sopran), Wilhelm Pilath, Gustav Brosch(Alt), Fritz Both(Tenor) und Fritz Brosch(Bass).
In der Gitarrengruppe wirkten mit: Martha Ollech, Hedwig Ollech, Martha Lekzik, Martha Michalick und Auguste Lekzick.
Willy Doormann hat sie auf der Geige begleitet.
Kurz vor Ausbruch des 2. Weltkrieges
Bei der Aufstellung des Grenzschutzes(Regiment Buchholz), hat er als Hauptfeldwebel die
Gruppenführerkurse überwacht und selbst die fähigsten Männer dafür vorgeschlagen. Das Ausbildungspersonal hat das
Jäger-Battalion gestellt. Wir kamen zuerst ins Stadion(Waldheim), wurden da eingekleidet und dann ging es gleich
kasernenmäßig zu, theoretisch und praktisch. Jeder musste vor die Front treten und nachweisen ob er im Stande ist,
Befehle zu erteilen. Abends wurden Filme vorgeführt die uns zeigen sollten wie eine Gruppe sich im Gelände entfalten
muss. Die Exerziervorschriften hatten sich, im Verhältnis zu Kaiser Wilhelms Zeiten, etwas geändert. Damals bestand
eine Gruppe aus 8 Mann und einem Unteroffizier, jetzt aus 10 Schützen, 3 für das leichte Maschinengewehr und einem
Unteroffizier(13 Mann). Nach der Schulung folgte eine Abschlussprüfung, danach ein gemütliches Beisammensein. Aus
Rohmanen haben folgende Männer die Prüfung bestanden: Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy, Gustav Rattay und
Gustav Deptolla. Unsere Uniformen waren alle zu klein und es gab viel zu lachen bei der Anprobe.
Die erste Übung habe ich mit Emil Rosowski, in Lenzinen gemacht. Der Gutsbesitzer Marzinzick hat seine Scheune als
Unterkunft zur Verfügung gestellt. Er war im Range eines Hauptfeldwebels. In seinem haus war die Schreibstube
untergebracht, die er selbst verwaltete. Ein Lastauto hatte Uniformen aus der Kaserne in Ortelsburg geholt, jeder
musste eine Uniform anlegen und dann wurde solange getauscht bis alle eine passende gefunden hatten. An den Namen des
Kompanieführers kann ich mich nicht mehr erinnern. 1935 wurden wir zu einer Übung in die Dragonerkaserne nach Lyk
einberufen. Die Gruppenführer, Zugführer, und Kompanieführer die schon Frontberührung im dem Ersten Weltkrieg hatten,
mussten eine Woche früher anreisen. Die Übungen waren auf 6 Wochen angelegt. Die meisten der einberufenen waren noch
nie mit dem Wehrdienst in Berührung gekommen. Jeder Gruppenführer bekam 13 Mann zugeteilt.
Unser Zugführer war Leutnant Neumann, Kompanieführer Oberleutnant Rutschko, Battalions-Kommandeur Major Gröning
(Regiment Buchholz). Hier ging es wieder Kasernenmäßig voran. Das Bataillon wurde hier vereidigt. Jeden zweiten
Sonntag durften unsere Frauen uns besuchen. Ein Jahr später wurden wir wieder zu einer Übung einberufen, auf den
Truppenübungsplatz nach Arys. Jeder Gruppenführer hatte den Auftrag die Gruppe zu entfalten, und auf bewegliche
Figuren zu schießen. Diese Übung musste später mit scharfer Munition wiederholt werden. Jedes Maschinengewehr bekam
50 Schuss, jeder Schütze 20 Schuss zugeteilt. Nach dem Abschießen wurden die Treffer gezählt und dem Kommandierenden
Bericht erstattet. In einiger Entfernung spaziert ein Storch umher, der gar nicht bemerkt hatte dass geschossen wurde,
was bei den Kameraden ein großes Gelächter hervorrief.
Nach der Übung wurde uns gesagt das jeder Gruppenführer eine arische Abstammung nachweisen sollte. Ich konnte in den
Rheinsweiner Kirchenbüchern meine Vorfahren aus Gellen, bis zum Jahr 1732 zurück, nachweisen und wurde zum
Unteroffizier befördert. Aus unserem Dorf wurden auch, Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy und Gustav Deptolla
befördert. Zwischendurch mussten wir schon mal in die Radfahrer-Kaserne nach Ortelsburg, Gewehre empfangen und im
Gelände üben. Am 31 Juli 1939 wurde mir von einem Soldaten ein Schreiben übereicht, das mich aufforderte, am 1. August
um 6:00 Uhr, bei der 3. Kompanie, des 2. Infanterieregiments zu erscheinen.
Um 5:30 hat mich meine Schwester in die Kaserne gebracht. Auf der Schreibstube erklärte mir der Hauptfeldwebel,
dass mir ab sofort der Dienstgrad eines Sanitäters zugewiesen wird, ich mich in der Kammer einzukleiden hätte und mir
in der Handwerkerstube die entsprechenden Schulterklappen annähen lassen sollte. Die aktiven Sanitäter wurden den
Feldlazaretten zugewiesen und wir kamen an ihre Stelle. Unser Bataillon wurde nach Schodmak zum Bunker bauen und
Stacheldraht verlegen eingeteilt. Wir zogen in Begleitung einer Musikkapelle bis zur Kreuzung am Krankenhaus, dann
weiter zu unserem Bestimmungsort, gefolgt von einer Gulaschkanone die in den nächsten Tagen für unsere Verpflegung
sorgen sollte.
Am 14 August haben wir die Jägerkaserne, begleitet von einer Musikkapelle endgültig verlassen und zogen zuerst durch
Ortelsburg, dann über Lehmanen ins Feldmanöver, hinter Rohmanen. Dort entfaltete sich das Bataillon im Gelände, die
Verwundetensammelstelle wurde auf dem Hof des Bauern Friedrich Neumann eingerichtet. Gegen Abend wurde zu Sammeln
geblasen und Biwak bezogen, wobei unsere 3.Kompanie, in einem kleinen Wallt, in der Nähe von Otto Nickels Gehöft
Stellung bezogen hatte. Die 2. und 4. Kompanie hatte sich in der Nähe vom Abbau Pallasch niedergelassen. Die Frau
Nickel hat am Abend ein Mädel in Dorf geschickt um meiner Frau Bescheid zu sagen, wo wir uns zurzeit befinden. Meine
Frau ist dann noch gekommen um sich von mir zu verabschieden, weil wir am nächsten Morgen um 3:00 Uhr Zelte abbrechen
und um 4:00 Uhr in Richtung Kaspersguth marschieren sollten.
Wir sind dann über Achodden, Seelonken, Lehmanen, Ortelsburg, bis nach Grammen und Schützendorf marschiert, wo wir an
einem See Biwak bezogen haben. Es wurde immer gesagt, wir kommen zum Tannenberg-Denkmal bei Hohenstein, wo ein Reichs
Kriegervereinsfest stattfinden sollte. Es wurden auch schon Vorkommandos aufgestellt, doch dann kamen wir nach Orlau
und Lahna-Mühle, da wo die Alle entspringt haben wir 2 Tage biwakiert. Unser Kompanieführer hat uns nach Waplitz auf
den Soldatenfriedhof des Ersten Weltkrieges geführt und uns erklärt wie das Jägerbataillon sich 1914 hier entfaltet
hat und aufgerieben wurde. Dann mussten wir in der Nähe von Gut Koslau über einen Fluss und bezogen in einem Waldstück,
vorbereitete Stellungen in der Nähe der polnischen Grenze. Herr und Frau Thalmann haben uns jeden Tag, bis zur Grenze,
mit Brötchen und Getränken versorgt. Es wurde scharfe Munition ausgegeben, weil wir am nächsten Morgen um 4:00 Uhr die
polnische Grenze überschreiten sollten.
Am nächsten Morgen um 10 Minuten vor 4:00 Uhr kam der Befehl; scharfe Munition abgeben, alles zurück in ein 6 Kilometer
entferntes Dorf, wo wir auch einquartiert wurden. Das alles geschah’ eine Woche vor dem 1. September 1939. Es wurde
gesagt dass der Führer dem polnischen Präsidenten Rid-Szmigly, ein Ultimatum gestellt hat und es wahrscheinlich nicht
zum Krieg mit Polen kommt. Genau nach 5 Tagen kehrten wir wieder in die gleichen Stellungen zurück, es wurde wieder
scharfe Munition ausgegeben und am nächsten Morgen um 4:00 Uhr überschritten wir die polnische Grenze.
“Der 2. Weltkrieg.”
Der erste Einsatz in Polen
Wir kamen zuerst in ein Dorf in dem sich nur alte Menschen befanden. Auf unsere Frage wo denn die Bewohner wären sagte
man uns dass alle geflohen sind, weil erzählt wurde, die Deutschen würden alle Polen misshandeln und verstümmeln. Ich
habe ihnen daraufhin gesagt dass uns, unter Androhung von Strafe verboten wurde, einem Zivilisten etwas anzutun. Das
Vieh, die Schweine und Hunde des Dorfes liefen frei herum und die Soldaten fingen an auf die Hunde zu schießen, bis
gesagt wurde es seien Meldehunde im Dienste der Deutschen Wehrmacht und dieser Unfug der eigenen Truppe schaden würde,
weil etwaige Querschläger eigene Kameraden verletzen könnten. Wir gingen weiter auf polnischer Seite entlang der Grenze,
bis wir am Nachmittag die ersten Vorposten der Festung Mlawa erreichten, da befanden wir uns plötzlich im Feuerhagel
polnischer Festungsflack.
Am nächsten Morgen hatte ich schon 3 Verwundete und wusste nicht wo sich eine Verwundeten Sammelstelle befindet. Ich
suchte den Bataillonsgefechtstand auf der sich auf einer Anhöhe befand. Ich habe unseren Oberstabsarzt gefragt wo denn
die Verwundetensammelstelle wäre. Er rief beim Tross an, wo er die Auskunft erhielt, das sich vor dem Dorf ein Bunker
befindet in dem man die Verwundeten sammeln sollte, die dann von Sanitätsautos abgeholt würden, weil das Dorf unter
Artilleriebeschuss stand. Am Sonnabend haben unsere Flieger die Bunkerstellungen bombardiert, konnten aber, trotz guter
Treffer nicht viel ausrichten, die Bunker wurden nur etwas angekratzt.
Der Beschuss unserer vordersten Linien ging mit unverminderter Heftigkeit weiter. Am Sonntag verkündete eine große
Staubwolke die Ankunft unserer Panzer, doch sie kamen nur bis zur Panzersperre und mussten wieder abdrehen ohne den
Polen einen schaden zuzufügen. Ein Panzer bekam einen Volltreffer, der Fahrer konnte noch umkehren. Er blutete am Kopf
und der Schütze war so eingeklemmt, das wir ihn nur mit einem Seil unter den Armen, durch die Luke nach oben ziehen
konnten. Ob er seine Verwundung überlebt hat ist mir nicht bekannt, denn in der Nacht wurden Panzergeschütze nach
vorne in Stellung gebracht, die direkt in die Schießscharten der Bunker geschossen und so die Verteidiger vertrieben
haben. Daraufhin sind wir weiter vorgerückt. Auf einer Wiese war ein tiefer Graben ausgehoben und mit Ästen getarnt,
da war ein Panzer hinein gefahren, so dass nur das Hinterteil herausragte und er sich nicht aus eigner Kraft befreien
konnte. In der Luft waren Flieger die Brandbomben abwarfen, ich habe mich auf den Boden geworfen weil ich dachte die
würden explodieren, aber sie zischten nur, so das Stoppeln und Graß rings herum in Brand gerieten.
Bei den Kampfhandlungen gab es mehrere Verwundete, denen ich gerade Verbände anlegen wollte, als unser Hauptmann zur
Trillerpfeife griff um mir klar zu machen, dass ich ihm folgen sollte. Die Polen fingen an zu schreien, ich sollte
sie ins Lazarett bringen denn hier im Wald würde sie niemand finden. Ich setzte mich aufs Fahrrad und folgte unserem
Kompanieführer, der mir sagte ich soll immer bei der kämpfenden Truppe bleiben, denn hinter der Front sind die
Sanitätsabteilungen, die werden die Verwundeten schon versorgen. Der Vormarsch dauerte bis in die späte Nacht. Auf
einem Gehöft, das nach allen Seiten durch Feldwachen abgesichert wurde, machten wir endlich Rast. Wir haben
Getreidegarben auf dem Hof ausgebreitet und uns zur Ruhe gelegt, als plötzlich um Mitternacht Leuchtraketen den Himmel
erhellten und Maschinengewehrfeuer uns aus dem Schlaf schreckte. Ein par polnische Soldaten hatten das Feuer eröffnet,
aber sich kurz darauf ergeben.
Die Narew-Überquerung
Als es hell wurde ging der Vormarsch weiter. Es wurde uns untersagt Tagebuch zu führen, darum
weiß ich nicht wie die Orte hießen, durch die wir marschiert sind. Als wir durch ein sumpfiges Gelände vor drangen
stand auf einer Anhöhe am Horizont, die polnische Artillerie, die uns sofort unter Beschuss nahm. Unser Hauptmann war
der Meinung dass wir schon in der Nähe des Flusses Narew sein müssten, als aus den Sträuchern ein mit Schlauchboten
beladenes Lastauto auftauchte. Wir wurden aufgefordert mit je 6 Mann ein Schlauchboot zu nehmen, an einem Aggregat
der daneben stand mit Luft zu füllen und zu Wasser zu lassen. In einer Stunde war das ganze Bataillon über die Narew,
wo der Vormarsch fortgesetzt wurde. In einem Dorf überraschte uns die polnische Kavallerie und fing sofort mit
Maschinengewehren zu schießen an. Da kam der Befehl: Alles wieder zurück. Es ging noch schneller als auf der Hinfahrt.
Wir sind erst einige Kilometer am Fluss entlang gegangen und haben dann zum zweiten Mal rüber gesetzt.
Die Gehöfte im Dorf standen alle in Brand. Auf einem waren viele Bienestöcke. 2 Kameraden wollten den Stöcken Waben
entnehmen, doch die Bienen durch das Feuer aufgeschreckt, überfielen sie sofort und stachen derart zu das sie nicht
mehr wieder zu erkennen waren. Ich habe die Einstichstellen mit Salmiak betupft, mehr konnte ich nicht tun. Wir mussten
auf unserem Vormarsch durch einen Wald der in Flammen stand, so dass man kaum atmen konnte. Es ging weiter in Richtung
Minsk und Warschau, wo schon die Sowjetische Armee durchgegangen war, die Pferde und Vieh von einem Gut mitgenommen
hatten. In einem Wald stießen wir unverhofft auf ein Kloster, in dem wir einige Gefangene machten. Dann trafen wir auf
eine gute Straße die nach Grochow ging.
Als wir dort einmarschierten wurden wir aus den oberen Stockwerken beschossen, so dass wir, um uns zu schützen, nur an
den Hauswänden entlang gehen konnten. Wir haben jedes Haus nach Feinden durchsucht. Vor einem Haus stand ein Hund der
niemanden reinlassen wollte, solange bis ihn eine Kugel traf. Die polnische Artillerie feuerte von Warschau aus, um
unseren Vormarsch zu stoppen. Wir hatten uns gerade eingegraben als plötzlich deutsche Flieger am Himmel erschienen,
die unsere Stellungen mit Bomben bewarfen und dabei viel Unheil anrichteten. Wir haben sofort Fliegertücher
ausgebreitet und Leuchtraketen abgeschossen. Da ich in dem Graben, den ich kurz zuvor ausgehoben hatte, sofort in
Deckung gegangen bin ist mir zum Glück nichts passiert. Unter den anderen Kameraden gab es viele Verwundete, so dass
ich nicht wusste wem ich zuerst helfen sollte.
Der Oberstabsarzt hat mich sofort tatkräftig unterstützt, so das bald alle Verwundeten versorgt waren, außer einem,
dem ein Bombensplitter den Arm abgerissen hat. Ich habe im 3 große Verbandspäckchen auf die Wunde gelegt, doch die
Blutung ließ sich trotzdem nicht stoppen, so dass er eine Stunde später auf der Krankensammelstelle verstarb. Wir
haben danach in einem Tomatenfeld einen Graben ausgehoben und eine neue Abwehrstellung bezogen. Die Gruppe Schwarz
bekam den Auftrag nach etwaigen versprengten polnischen Verbänden Ausschau zu halten, als sie unerwartet aus einer
Häuserreihe mit Maschinengewehrsalven überschüttet wurden. Der Gruppenführer und noch ein Soldat wurden dabei tödlich
verwundet. Danach wurde noch ein weiter Stoßtrupp, unter der Führung von Leutnant Briskorn, der sich dazu freiwillig
gemeldet hatte, hinaus geschickt um den Gruppenführer und den anderen Toten zu bergen.
Bei diesem Unternehmen, das erfolglos ausging, weil die Toten schon verscharrt waren, durchschlug eine Kugel den
Stahlhelm von Leutnant Briskorn, der auch sofort tot war. Alle Toten wurden später, an der Kirchenmauer in Grochow, in
Särgen beigesetzt: Hauptmann Schönwald sagte, das sie nach dem Kriege auf den Heldenfriedhof nach Ortelsburg überführt
werden. Drei Tage lagen wir bei Grochow in Stellungen, waren dem polnischen Maschinengewehrfeuer sowie den Bomben
deutscher Flugzeuge ausgesetzt. In der Nacht musste ich zu einem Verwundeten in die vorderste Linie und habe den
Rückweg nicht mehr finden können, als plötzlich Gewehrfeuer aufflammte habe ich in den Ruinen Schutz gesucht. Erst im
Morgengrauen konnte ich mich wieder orientieren und zu meinem Unterstand zurückfinden.
Warschau wurde tagelang bombardiert und stand auch unter Artilleriebeschuss. Aus dunklen Rauchwolken kamen oft ganze
Bündel von Papier angeflogen. Die Verwundeten kamen oft auf Krücken zu unserem Unterstand, ich habe sie dann zur
Krankensammelstelle hingeführt. Wir haben auch polnische Zivilpersonen betreut, die während der Kampfhandlungen
verwundet wurden. Als einmal 2 Jungen vorbeiliefen hat einer ihnen nachgerufen sie sollten seiner Frau Bescheid sagen,
er wäre auf der Krankensammelstelle an der Kirche. Als wir dort ankamen war seine Frau, mit einem Kind auf dem Arm,
schon da.
Nach der Kapitulation von Warschau, gingen wir über Sokolow zum Bug und haben dort Quartier bezogen. Der Russe hatte
sich bereits hinter den Fluss zurückgezogen, hatte alles Vieh und Pferde mitgenommen. Dort erreichte mich ein Telegramm
von zu Hause, dass meine Tochter gestorben ist. Es sprach sich auch herum dass verschiedene Heimaturlaub bekommen haben,
ich durfte auch für 14 Tage heim. Wir fuhren mit Lastautos nach Allenstein in die neue Reiterkaserne, zum
Ersatzbatallion, da haben wir unsere Gewehre und Munition abgeben, dann durften wir, jeder in seinen Heimatort
weiterfahren.
Als wir unsere Quartiere am Bug verlassen haben war sehr viel Schnee gefallen. Hier in Ortelsburg fanden wir die
gleiche Wetterlage vor, aber nach 3 Tagen war alles wieder weggetaut und wir konnten die Kartoffelernte, die durch den
frühen Wintereinbruch gestoppt wurde, zu Ende bringen. Ein Tag bevor ich zu Hause angekommen bin wurde die Tochter
beerdigt. Nach 14 Tagen mussten wir uns in Allenstein melden, Gewehre empfangen und wieder zurück zur Division an den
Bug 150 Kilometer hinter Warschau. Die elfte Division, zu der wir auch gehörten sollte in den Westen Deutschlands
verlegt werden und war schon unterwegs zur Verladestation Skiernewice 50 Kilometer vor Warschau.
Mein Dienst als Sanitätsunteroffizier
Unser Bataillon kam in das Städtchen Burscheid, im Kreis Opladen, wo wir in Privatquartieren
untergebracht wurden. Nach 3 Monaten, im Januar 1940, wurden wir nach Solingen verlegt, wo wir bis zum
Frankreichfeldzug stationiert waren. Wir mussten an Feldübungen teilnehmen, wie andere die in Kasernen untergebracht
waren. Während dieser Zeit musste jeder seine Zähne in Ordnung bringen lassen. Jeden Tag fuhren 20 Mann in die
Cäzilienstraße nach Köln, zur Zahnklinik. Im Rheinland wurde unsere Division neu aufgestellt. Ausfälle durch den
Polenfeldzug wurden durch neue Soldaten ergänzt. Ich kam nun zum Ersatzbatallion, war der Älteste in der ganzen
Kompanie. Als der Frankreichfeldzug losging wurde unser Ersatzbatallion mit den noch vorhandenen Verwundeten, in die
neue Reiterkaserne, nach Allenstein verlegt.
Meine Frau hat, mit Unterstützung der Bauernschaft, einen Antrag gestellt, daraufhin wurde ich zur Frühjahrsbestellung,
beurlaubt und später bis auf weiteres vom Militärdienst freigestellt. Als der Russlandfeldzug losging wurde ich von der
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg, für 14 Tage einberufen. Ich war seit 1922, Mitglied der freiwilligen
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg und habe jedes Jahr an Übungen teilgenommen. Jede Bereitschaft musste etliche Leute
stellen. Von Rohmanen wurden Emil Rosowski, Johann Dembek, und ich, zur Krankensammelstelle Wirballen, in Litauen,
abkommandiert. Dorthin kamen Lazarettzüge aus Russland mit der Breitspurbahn. Die Verwundeten wurden frisch verbunden
und auf Waggon mit Normalspur verladen und nach Deutschland gebracht.
Als die 14 Tage vergangen waren wollten wir wieder nach Haus zurück, doch man wollte uns nicht entlassen. Stattdessen
wurden wir dem Wehrkreisamt Königsberg zugeteilt, neu eingekleidet und zur Aushilfe ins Lazarett nach Gumbinnen
abkommandiert. Mehr als ein Jahr war ich in den Urlauber-Baracken, habe dort Krankenstube betreut. Später, bis zum
Dezember 1944, war ich im Reserve-Lazarett 4, in Königsberg tätig. Dort habe ich auch die Luftangriffe der Engländer,
vom 25 bis 26. August 1944 miterlebt.
Wir sollten gerade einen Lazarettzug in Rotenstein entladen, als plötzlich die Sirenen ertönten - Fliegeralarm. Im
gleichen Moment waren die ersten Flugzeuge auch schon da, zuerst warfen sie „Tannenbäume” und danach Foßforkanister ab.
Die Omnibusse standen schon zur Abfahrt bereit als es losging. Wir haben die Verwundeten schnell in den
Luftschutzkeller getragen, haben die Betten von den Fenstern weggerückt damit die Verwundeten nicht von den
Glasssplittern verletzt wurden. Im Kasernenhof brannten die Fosforkanister lichterloh. Unsere Unterkunft, die sich in
einer Baracke befand ist völlig abgebrannt, mit dem Wenigen was wir unser Eigen nannten. Am nächsten Tag wurden wir neu
eingekleidet und am 29. bis 30. kamen die englischen Bomber wieder, sie setzten genau da ihr Zerstörungswerk fort wo
sie vor 3 Tagen aufgehört hatten.
Anfang Dezember 1944 musste ich mich nach Stablack melden und musste dann zur Sanitätsabteilung 1, nach Gernau, das
liegt zwischen Lodz und Warschau. Vormittags hatten wir Felddienstübungen und nachmittags theoretischen Unterricht.
Jeden Tag wurden Gruppen zusammengestellt und zu anderen Einheiten abkommandiert. Ich kam zu einer Panzerabteilung, wo
wir an einem Morgen plötzlich auf dem Kasernenhof antreten mussten und zu unserer Überraschung mit der Nachricht
konfrontiert wurden, dass der Russe an mehreren Frontabschnitten durchgebrochen war. Wir bekamen sofort einen
Marschbefehl in Richtung Lodz, wo das Stadtbild noch intakt war, selbst die Straßenbahnen fuhren noch. In der Nacht
haben russische Flugzeuge die Stadt bombardiert. Die Kaserne in der wir untergebracht waren hatte keine
Luftschutzkeller, aber zum Glück blieben wir von Bombentreffern verschont. Am nächsten morgen bot sich uns ein Bild der
Verwüstung. Die entgleisten Straßenbahnwagen, sowie andere Fahrzeuge blockierten die Straßen. Die Älteren unter uns
bekamen Fahrscheine für einen Transportzug, der bereit hinter Lodz abfahrbereit, unter Dampf stehen sollte. Als
russische Panzer in den Straßen auftauchten, verbrannte die Schreibstube unsere Wehrpässe und andere wichtige
Dokumente. Wir liefen zu der Station auf der unser Transportzug bereitstehen sollte, aber da war kein Zug mehr zu sehen
und wir setzten unseren Rückzug zu Fuß fort.
Der Rückzug und Zusammenbruch der Ostfront
In Dobroschin, einer Stadt in Polen, wurde gerade ein Lazarettzug verladen, doch wir kamen nicht
mehr zum Einsatz, weil die russische Infanterie uns schon auf den Fersen war. Es ging weiter über den Fluss Bober,
Sagan, bis nach Glogau an der Oder. Dort wurden wir der 29. motorisierten Sanitätskompanie zugeteilt. Im
Garnisonslazarett wurden noch Operationen durchgeführt. Unsere Division hatte ihr eigenes Feldlazarett, so dass wir den
Befehl zu Weiterfahrt erhielten und noch unbeschadet die Oderbrücke passieren konnten, denn Glogau wurde zur Festung
erklärt. Wir haben 2 Pferdewagen organisiert und mit Verbänden, sowie medizinischen Instrumenten beladen. So kamen wir
bis nach Lübbenau im Spreewald, wo wir in einem Schloss, in zuvor ein Museum war, unser Lazarett untergebracht haben.
Weil die Amerikaner Cottbus bombardiert hatten, wurden die Verwundeten zu uns nach Lübbenau gebracht. Hier haben wir
Tag und Nacht gearbeitet, um die vielen Verwundeten, aus den schweren Kämpfen bei Grünberg und Sagan zu versorgen. Die
Soldaten von der Abwehrfront kamen schon mit abgestorbenen Armen oder Beinen bei uns an, weil in vorderster Linie keine
Frontlazarette mehr vorhanden waren; es mussten viele Amputationen durchgeführt werden. Als für unsere Pferde kein Heu
mehr vorhanden war, schickte mich unser Hauptfeldwebel, zu einem Bauern in den Spreewald, mit dem Auftrag, Futter zu
besorgen. Mit noch zwei Mann fuhren mit zwei Kähnen, zuerst den Hauptstrom entlang und dann in einen Nebenarm; da haben
wir die Boote beladen und brachten das Heu nach Lübbenau.
Als wir uns bei unser Einheit zurück melden wollten, war alles schon marschbereit. Ich bin schnell in einen Bus
eingestiegen der sofort losfuhr, weil russische Verbände schon in sichtweite waren. Russische Flugzeuge kreisten über
den Dächern und nahmen, mit ihren Bordwaffen jeden unter Beschuss, der sich irgendwo blicken ließ. Wir konnten nur
durch den Wald, oder in der Nacht vorwärts kommen, denn wenn ein Auto auf der Landstraße fuhr, war alsbald ein Flugzeug
hinter ihm her und schoss es in Brand. Als wir nach Tagen am Ufer der Elbe ankamen, war bereits eine Ponton-Brücke
erstellt worden, welche die zerstörte Brücke ersetzen sollte.
Durch die vielen Fahrzeuge waren in den Sand tiefe Spuren gefahren, so dass andere Fahrzeuge unsere Busse ins
Schlepptau nehmen mussten, weil wir mit eigener Kraft nicht mehr weiterkamen. Beiderseits der Trasse standen
Flüchtlingswagen, in der der Hoffnung die Brücke passieren zu können, doch SS-Polizei verhinderte das die Gespanne den
militärischen Rückzug zum Stillstand brachten. Es gelang uns die Elbe zu überqueren, um in einem Waldstück Schutz vor
feindlichen Fliegern zu suchen.
Als wir unsere Busse und Autos gut getarnt hatten, hat unser Bataillonschef die anwesenden Parteigrößen zu sich
gerufen und ihnen erklärt das wir eine Einheit des Roten Kreuzes sind und nach internationalem Recht keine Waffen
besitzen dürfen. Nach langer, erregter Diskussion wurde beschlossen einen Graben auszuheben und alles im Sand zu
verscharren. Als wir dann weiter, durch die Dörfer fuhren, sahen wir schon viele weiße Bettlaken, als Zeichen der
Kapitulation, aus den Fenstern hängen. Es wurde uns erzählt dass der Bürgermeister von der SS erschossen wurde, weil
er die Bevölkerung zu diesem Schritt ermutigt hatte. Jetzt waren hinter uns die Russen und vor uns schon die Amerikaner.
Amerikanische Panzer fuhren umher und schossen wild durch die Gegend, ohne ein Ziel anzuvisieren. Niemand wollte sich
dem Russen ergeben, doch der Weg der zu den Amerikanern führte, war durch abgesägte Bäume blockiert. Wir sind schnell
in das nächste Dorf gegangen, haben uns Sägen und Äxte besorgt, die Bäume durchgesägt und in den Straßengraben
geworfen.
“ Nach dem Ende des 2. Weltkrieges.”
In amerikanische Kriegsgefangenschaft
Dann fuhren wir unter internationaler Flagge an eine Mulde Brücke, vor der zwei amerikanische Soldaten, mit Zigarren,
zur Hälfte im Mund, standen. Sie rauchten und kauten gleichzeitig. Wir mussten auf einen freien Platz fahren, alle
aussteigen und rechts wieder antreten. Wäschebeutel und Tornister mussten wir abstellen; danach wurden wir nach Waffen
durchsucht, Wertsachen, Uhren und Messer wurden uns gleich abgenommen. Als wir anschließend an unserem Gepäck
vorbeigingen durfte niemand was mitnehmen. Als ich gebückt, nach meinem Wäschebeutel greifen wollte, in dem sich noch
3 Konservendosen und ein Brot befanden, bekam ich einen Fußtritt ins Gesicht, so dass mir ein Zahn ausgeschlagen wurde.
Wir wurden dann in einem Garten zusammen getrieben und gefragt ob jemand bei der SS gedient hat. Nachdem wir in Reihe
und Glied angetreten waren, mussten wir den Oberkörper freimachen und die Arme anheben. Es wurde nach SS-Zeichen
gesucht, die gewöhnlich unter dem Oberarm eintätowiert waren. Nachdem wir Grimma bei Leipzig, wo wir in amerikanische
Gefangenschaft geraten waren, verlassen hatten, mussten wir durch ganz Thüringen bis Hersfeld, an der Grenze zu Hessen,
marschieren. In Hersfeld wurden wir auf große Lastautos verladen, die von farbigen Soldaten gefahren wurden. Man hat
uns mit Stöcken hinauf getrieben, solange bis das Auto so voll war das man kaum stehen konnte. Die Soldaten fuhren, für
diese Straßenverhältnisse, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Wenn die Straße eine scharfe Kurve hatte, flogen
wir alle übereinander und mussten erst mit viel Kraftanstrengung auf die Beine kommen um diese Fahrt zu überstehen.
Da die Straßenränder in dieser Gegend mit Obstbäumen bepflanzt sind und deren Äste sehr niedrig hängen, hätten die
uns die Köpfe abgerissen, wenn wir uns nicht ständig geduckt hätten. Unsere Fahrt endete in Bad Kreuznach, in der Pfalz,
wo wir in ein Lager, in dem sich später 130.000 Mann und 6 Generäle befanden, eingepfercht wurden. Die Unterkunft der
Generäle befand sich unter einem Zelt, alle anderen mussten die Zeit unter freiem Himmel zubringen. Die Offiziere, die
Unteroffiziere, die Mannschaften; wurden in getrennten Camps untergebracht. Die Mannschaften wurden auch zur Arbeit
abkommandiert und konnten bei dieser Gelegenheit, Brot, Brötchen oder Zigarettenstummel organisieren, wogegen die
Offiziere und Unteroffiziere ihr Camp überhaupt nicht verlassen durften.
Die ersten Tage gab es kein Wasser und kein Brot, so dass die Kameraden vor Erschöpfung umfielen. Später standen wir
manchmal den ganzen Tag nach Wasser an, das von den, uns bewachenden Negern mit großen Wassertanks angefahren wurde. Am
dritten Tag bekamen wir mittags und abends etwas zu Essen; Brot bekamen wir erst nach zwei Wochen, nach dem aus der
Umgebung herbeigeholte Handwerker, Backöfen gebaut hatten. In den verschiedenen Gemeinden, die in den uns umgebenden
Weinbergen lagen, mussten sich alle Männer beim Bürgermeister melden. Als sie dann erschienen waren, wurden sie auf
bereitstehende Lastautos getrieben und zu uns ins Lager gebracht. Sie waren ohne Kopfbedeckung und ohne wärmere
Bekleidung angekommen, weil ihnen gesagt wurde, dass ihr Aufenthalt im Lager nur von kurzer Dauer sein würde. Man hat
uns, falls noch vorhanden, Decken und Mäntel abgenommen, mit der Begründung, sie würden für Kranke und Verwundete
gebraucht. Jeden Tag starben mehr als 200 Mann, die wir sofort in ein Zelt tragen mussten. In der Nacht wurden die
Toten dann mit unbekanntem Ziel, weggefahren.
Viele haben ihren Verstand verloren uns irrten im ganzen Camp ziellos umher. Als Latrinen wurden Gräben ausgehoben, in
die verschiedene Kameraden, bei der Verrichtung ihrer Notdurft, vor Schwäche hineingefallen sind und nicht mehr wieder
heraus kamen. Aus den Pfählen die, die jungen Obstbäume stützten, haben wir Krankentragen gebaut um unsere Kameraden,
bei Bedarf, zur Krankensammelstelle zu tragen. Es war in diesem Frühjahr auch sehr kalt, doch unsere Erdlöcher, die wir
zum Schutz vor Kälte und Wind, nur mit leeren Konservendosen ausgehoben hatten, durften nicht tiefer als 20 Zentimeter
sein. Nach jedem Regenguss mussten wir das Wasser ausschöpfen. Nach einem Gewitter, standen wir wiedermal, total
durchnässt in unserem Camp, als unerwartet am Horizont die Sonne hervortrat. Einer unserer Kameraden hatte noch eine
Trompete gerettet und fing, von dem Anblick völlig überwältigt, zu spielen an: "Es geht alles vorüber, es geht alles
vorbei, nach jedem Dezember, folgt wieder ein Mai". Daraufhin hob sich die Stimmung der tiefbetrübten Kriegsgefangenen,
so das Heimatlieder durch das ganze Camp erklangen, obwohl wir in den nassen Kleider herumgehen mussten, bis sie am
Körper trocken wurden.
In französischer Kriegsgefangenschaft
Nach etwa einem Monat, haben uns die Amerikaner, den Franzosen, zum Arbeitseinsatz, ausgeliefert.
Etwa 4 Kilometer von Bad Kreuznach entfernt, stand auf freier Strecke, ein Zug mit offenen Kohlenloren, auf den wir
verladen wurden. In jeden Waggon, wurde pro Person eine Tafel Schokolade und ein Päcken Zwieback rein geworfen, doch
viele Kameraden fanden nur leere Päckchen vor, weil die schon zuvor von der französischen Wachmannschaft geplündert
wurden. Wir haben uns darüber beschwert, doch die haben uns nur ausgelacht. Nachdem wir zunächst bei Mainz über den
Rhein fuhren, endete unsere Fahrt bei Paris in einem großen Zeltlager. Dort wurden wir auf andere Züge verladen, die uns
nach Südfrankreich, in ein Barackenlager, bei Mazarei, brachten.
Auf einer Zwischenstation hat man uns unter einer Pumpe, die Lokomotiven mit Wasser versorgt, abgestellt, den Kran
aufgedreht und uns anschließend ausgelacht, die Kinder Haben uns mit Steinen beworfen. Ein Wachmann kam in unseren
Waggon gekommen, hat unser Gepäck durchsucht, wenn er Tabak oder Zigaretten gefunden hat, nahm er sie mit. Die Kameraden
waren darüber so empört, dass sie vorhatten, ihn nachts unter den Waggon zu werfen. Wir haben sie gebeten dass zu
unterlassen, weil man uns in diesem Falle, alle erschießen würde.
Als wir ins Lager kamen wurden wir zuerst gezählt, dann mussten wir unser Gepäck stehen lassen und beiseite treten.
Wenn man bei der Nachkontrolle noch was in den Taschen fand, wurde das auch entwendet, selbst Esslöffel. Wir wurden
dann in drei Baracken, ohne Toiletten, eingeschlossen. Die Kameraden haben ihre Bedürfnisse in Kochgeschirre erledigt
und durch ein kleines Fenster, das sich fast unter der Decke befand, hinausgeworfen. Andere Fenster ließen sich nicht
öffnen, weil sie mit Stacheldraht zu geflochten waren. Als die Kameraden die Kochgeschirre auskippten, haben die
Wachposten geschossen und die Fenster zertrümmert. Sie waren der Meinung dass wir ausbrechen wollten. Es herrschte eine
große Hitze, in den überfüllten Baracken sind wir fast erstickt. Am nächsten Tag haben wir uns über fehlende Toilettem
beschwert, da haben sie Heringsfässer durch die Hälfte geschnitten und an der Ausgangstür hingestellt. Um bei den
überfüllten Räumen dort hinzukommen, musste man über die Köpfe der Anderen steigen. Viele hatten Fieber und Durchfall
und mussten in die Krankenstube eingeliefert werden, wo sie kurz darauf verstarben.
Besonders Raucher litten sehr an der Unterernährung, bekamen Wasser in den Beinen und waren die Ersten die verstarben.
Nach der Registrierung wurden wir auf andere Baracken verteilt. Die Zivilbevölkerung kam in die Räume und begann uns
auszuplündern. Wer noch gute Schuhe besaß musste sie ausziehen und bekam dafür die kaputten des Plünderers. Eine Woche
lang mussten wir diesen Zustand ertragen, erst als die Kameraden sich beschwerten, wurde am Eingang eine Tafel am
Eingang angebracht, dass die Zivilbevölkerung das Lager nicht betreten darf. Bis auf einige, wenige Ausnahmen wurde
diese Anweisung befolgt.
Als wir im Lager ankamen, war der französische Lagerkommandant, ein ehemaliger Kriegsgefangener, der bei einem Bauern
in Deutschland gearbeitet hatte. Dieser Bauer war jetzt als Kriegsgefangener in seinem Lager. Als er ihn erkannte, hat
er ihn gleich zum Küchendienst eingeteilt und mit dem nächsten Krankentransport nach Hause fahren lassen. Zu Mittag
bekamen wir nur gekochte Haferkörner, da schwamm alles oben, später war man dann auf Gerste umgestiegen. Als viele
daran gestorben waren, weil sie diese „Rohkost”, die nur ein Kuhmagen verträgt, nicht gegessen haben, hat man die
Körner durch eine Schrotmühle laufen lassen. Dann hat man uns Steckrüben gekocht; wir bekamen 250 Gramm Weißbrot,
etwas Quark und ein viertel Liter Magermilch. Später, als wir schon arbeiten mussten, hat man in unserem Essen einen
Kuhkopf mitgekocht, das hat dann bedeutend besser geschmeckt.
Bevor wir morgens zur Arbeit gingen, mussten wir zu Flaggenparade und abends, nach der Rückkehr, haben wir die Flagge
wieder eingeholt. Wir haben einen Kanal gereinigt, dessen Sohle 2 Meter dick mit Schlamm bedeckt war. Zuerst wurde das
Wasser abgelassen, dann haben wir, einer dem andern, den Schlamm mit der Schippe hoch gereicht. Der Letzte hat den
Schlamm, der so zäh war, dass er nicht von der Schippe wollte, oben am Rande abgelegt. Manchmal waren 10 Mann nötig um
den Höhenunterschied zu überwinden. Das Wachpersonal schoss über unsere Köpfe hinweg und rief: „schnell arbeiten”. Bei
der großen Hitze war das ein Ding der Unmöglichkeit, zumal es nichts zu Trinken gab. Auf dem Heimweg haben wir im Walde
Heilkräuter gesammelt, die man in der Küche getrocknet und als Tee zubereitet hat, den wir am nächsten tag zur Arbeit
mitnahmen, um unseren Durst zu stillen.
Unser Aufseher hatte einen Stock, an dem sich noch kurz abgeschnittene Äste befanden. Wer seiner Meinung nach, nicht
ordentlich gearbeitet hat, bekam gleich Schläge auf den Rücken. Die weißen Aufseher wurden irgendwann durch Neger
ersetzt, die uns bedeutend besser behandelt haben. Wenn irgendetwas schief ging, haben sie nichts gesagt, nur gelacht.
In den übrig gebliebenen Wassertümpeln hatten sich noch einige Aale versteckt, die wir zu fangen versuchten, was uns
auch manchmal gelang. Wir mussten ihnen das Genick brechen, damit sie uns nicht entwischen konnten. Wenn die Franzosen
bemerkten das wir Aale hatten, wurden sie uns abgenommen. Gelang es uns aber, sie ins Lager zu bringen, dann haben wir
uns eine köstliche Malzeit zubereitet.
Um sicherzustellen dass niemand geflüchtet ist, wurden wir, wenn wir abends ins Lager zurückkamen, zuerst gezählt.
Diese Zählung wurde mehrmals wiederholt, weil die Wachmannschaften sich immer wieder verzählt haben. Als einer von uns
hin ging, ihnen sagte dass alle da sind, wollten sie es nicht glauben und haben uns vor dem stehen lassen, bis es ihnen
irgendwann einfiel. uns doch das Tor zuöffnen. Einmal, als wir von der Arbeit zurückgekehrt waren, standen wir bis 23
Uhr neben der Flagge, weil uns niemand das Tor geöffnet hat. Als wir dann doch irgendwie ins Lager kamen haben wir
festgestellt, dass das ganze Wachpersonal betrunken war und niemand im Stande uns das Tor zu öffnen.
Eines Tages waren wir wieder abends zur Parole angetreten, als ein älterer Herr mit seinem Hund, am Stacheldraht
entlang, spazieren ging. Weil der Hund, unterm Stacheldraht hindurch, zu uns kam, hat ihn einer geschnappt, ihm das
Genick gebrochen und unter seiner Jacke versteckt. Der Franzose hat nach seinem Hund gerufen und gepfiffen, aber alles
vergebens, der Hund war nicht aufzufinden. Die Kameraden haben ihm gleich das Fell über die Ohren gezogen, das Fleisch
gekocht und das Fell in die Latrine geworfen. Das Fleisch wurde umgehend verspeist.
Als wir am nächsten Tag von der Arbeit zurückkehrten, war im Lager der Teufel los. Wir mussten sofort antreten und
wurden gefragt, wo der Hund geblieben ist, der Gestern Abend, mit seinem Herrchen, am Zaun entlang spazieren ging. Als
sich niemand dazu bekannte, mussten wir weiterhin stehen bleiben, während die Wachmannschaften von Baracke zu Baracke
gingen und alles durchsuchten. In einer Latrine hat man dann das Fell gefunden, was uns ein furchtbares „Donnerwetter”
einbrachte und in den nächsten Tagen, nach der Arbeit, unter dem Kommando eines Oberfeldwebels, eine Stunde
nachexerzieren.
In Südfrankreich regnet es den ganzen Sommer nicht; die Bauern haben da keine Scheunen und das Getreide wir nur in
Schobern aufgestellt und dann umgehend gedroschen. Vom Oktober bis Dezember regnete es fasst jeden Tag in Strömen.
Gesät wird nur im Frühjahr und im Herbst, weil im Sommer alles vertrocknet. Es wird viel Wein angebaut und die
Steckrübe wächst den ganzen Winter. Neben den Weinreben wurde aus Schieferplatten ein Zaun aufgestellt, um dem Wein
einen optimalen Standort zu sichern. Die Bauernwagen hatten nur zwei Räder und waren nur mit einem Pferd bespannt, das
die ganze Balance des Wagens zu halten hatte. Trotzdem haben sie soviel aufgeladen wie wir auf einen Leiterwagen. Viele
Kameraden wurden den Bauern zur Arbeit ausgeliehen. Wenn ein Bauer einen Arbeiter gebraucht hat und es wurde gefragt,
wer sich in der Landwirtschaft auskennt, da haben sich alle gemeldet. Der Bauer konnte sich dann aussuchen, wen er
mitnehmen wollte.
Wenn wir durch die Stadt zur Arbeit gingen, haben verschiedene Leute Fallobst in die Abfalleimer gelegt. Wenn das von
den Kameraden bemerkt wurde, schwenkten viele aus der Reihe, um sich etwas mit zunehmen, was von den Wachmannschaften
nicht gern gesehen wurde. Viele Kriegsgefangene hatten keine Schuhe mehr, sie haben die Füße nur mit Lumpen bewickelt.
Eines Tages kamen Kameraden aus Norwegen, die nach Deutschland entlassen werden sollten. Mann hat sie jedoch ins Lager
gesteckt und zur Arbeit eingeteilt. In Norwegen hatten sie Kleider und Stoffe eingekauft, hatten volle Seesäcke und
sogar Karren auf 2 Rädern, weil sie ja in die Heimat entlassen werden sollten. Als wir morgens zur Arbeit rausgeführt
wurden standen sie schon vor dem Lager. Wir haben ihnen zugerufen, dass sie uns etwas abgeben sollen, weil ihnen ja
sowieso alles abgenommen wird, aber sie haben uns nur ausgelacht. Als sie ins Lager Kamen mussten sie ihr Gepäck
ablegen, wurden dann wo anders hingeführt und haben es danach nie wieder gesehen.
Durch die vielen Läuse, Flöhe und Wanzen die wie im Lager hatten, kam es bei verschieden Kameraden, an den
Einstichstellen, zu eiternden Entzündungen. Um dem vorzubeugen hat man uns mit einem Pulver, das in Frankreich
hergestellt wurde, aber bei den Parasiten keine Wirkung zeigte, eingesprüht. Erst bei der Anwendung eines Mittels
amerikanischer Herkunft, war alles über Nacht verschwunden.
Der Sonntag war arbeitsfrei. Dann kam ein katholischer, französischer Pfarrer, eskortiert von 3 Mann, mit
aufgepflanztem Seitengewehr ins Lager und hat Gottesdienst gehalten. Einen evangelischen Pfarrer gab es nicht, nur
einen Baptisten Prediger. Der wurde würdevoll eingekleidet, bekam ein großes Kreuz und hat jeden Sonntag in einer
extra dafür hergerichteten Baracke Gottesdienst gehalten. Wer Theologie studiert hatte und sich meldete, wurde zu
einem Seminar geschickt und konnte sein Studium fortsetzen. Glasbläser durften das Lager auch verlassen und ihrem
erlernten Beruf wieder arbeiten.
Wer sich freiwillig, für 5 Jahre, zum Dienst in der Fremdenlegion verpflichtet hat, das waren etliche unter uns, wurde
neu eingekleidet, bekam gutes Essen und Rauchwaren soviel er wollte. Nach einem Jahr wurden, nach und nach, die
Kranken und Körperbehinderten in die Sowjetische Besatzungszone entlassen. Eine Entlassung von Kriegsgefangenen, die
in den Westzonen oder jenseits von Oder und Neise zu Hause waren, war nicht vorgesehen. Die Österreicher wurden alle,
unabhängig von ihrem Gesundheitszustand entlassen.
Ich habe Briefe nach Hause geschrieben, aber die kamen nur bis Allenstein und wurden wieder zurück geschickt. Als eine
Kommission des Roten Kreuzes aus der Schweiz unser Lager besichtigt hat, haben wir uns beschwert, das wir als
Sanitätsdienstgrade, zur Arbeit gehen müssen. Daraufhin erging ein Befehl: Wer einen vom Roten Kreuz, ausgestellten
Ausweis besitzt, gehört einem internationalen Verband an und braucht nicht zu Arbeit gehen. Aus unserem Lager hatten
sich 20 Mann gemeldet, die daraufhin Freigang, in Begleitung von zwei französischen Wachsoldaten erhielten. Als wir
gefragt wurden wo wir hin wollen, entschlossen wir uns, einen Soldatenfriedhof, auf dem unsere verstorbenen Kameraden
beerdigt waren, zu besuchen.
Da der Untergrund in dieser Gegend aus Felsen bestand, wurden die Gräben, in denen die Toten in selbst gezimmerten
Kisten nebeneinander gestellt wurden, mit Hilfe von Dynamit ausgehoben. Ein Leichenwagen, mit einem Pferd bespannt,
das mit einer schwarzen Decke abgedeckt war, wurde von einem Kutscher in angemessener Kleidung, gefahren. Der Wagen
konnte gleichzeitig 4 Kisten transportieren. Wenn wir von der Arbeit kommend, dem Leichenwagen begegneten, wurde
gehalten und mit einer Schweigeminute der Toten gedacht, bis der Wagen vorbei war. Die Zivilbevölkerung verharrte auch
im Schweigen, mit abgenommener Kopfbedeckung.
Ein Kamerad, der in Krottorf, Kreis Oschersleben, bei Magdeburg, zuhause war, sagte bei seiner Entlassung zu mir:
Sollte ich das Glück haben, meine Entlassungspapiere zu erhalten ohne eine Bleibe vorzuweisen, dann soll ich Krottorf
als Heimatadresse angeben. Auf der Krankenstube habe ich angegeben, dass sich noch ein Schrapnellsplitter, aus dem
Ersten Weltkrieg, in meiner Kreuzbeingegend befindet, er zwar verkapselt ist, aber immer noch Beschwerden verursacht.
Daraufhin wurde ich zur Entlassung vornotiert. Als bekannt wurde das ein Rückkehrertransport in die sowjetische
Besatzungszone zusammengestellt wird, habe ich mich sofort gemeldet und wurde für ein Entlassungslager in Angoleme
vorgesehen. War das eine Freude, als uns mitgeteilt wurde, wann der Rücktransport stattfindet.
In unserem Lager waren noch 2 Kameraden aus dem Kreis Ortelsburg: Ein Gustav Lumma aus Leynau und ein Alfred Moritz
aus Groß Schöndamerau. Sie mussten noch zurückbleiben und haben mir den Auftrag erteil, die Angehörigen in der Heimat
zu grüßen und ihnen die Anschrift mitzuteilen. Als wir im Entlassungslager ankamen, fragte man uns nach unserer
Heimatanschrift. Dann wurden die Entlassungspapiere angefertigt. Es wurde uns auch ein Barscheck, für die in Frankreich
geleistete Arbeit ausgehändigt, den wir bei jeder Kasse in Deutschland einlösen könnten. Ich habe ihn bis zum heutigen
Tage nicht einlösen können, obwohl ich irgendwann in der Zeitung gelesen habe, das Verrechnungschecks die den aus
französischer Kriegsgefangenschaft Entlassenen, ausgehändigt wurden, einzulösen sind.
Wir kamen zuerst nach Saar Elbe, dann in die Nähe der Zonengrenze zu Thüringen. Hier mussten wir 2 Tage warten, weil
aus der sowjetischen Besatzungszone keine Eisenbahnwagen bereitgestellt wurden. Angesichts dessen, das der Russe beim
letzten Transport die aus Frankreich kommenden Wagen kassiert und nicht mehr herausgeben wollte, bestand der Franzose
jetzt darauf, seine Wagen sofort wieder mitzunehmen. Als der sehnsüchtig erwartete Zug endlich eintraf, durften wir
umsteigen und kamen, immer noch hinter Stacheldraht, nach Erfurt. Von dort weiter ins Quarantänelager nach Prätsch an
der Elbe.
Unter Androhung von Strafe war es verboten das Lager zu verlassen, doch der Hunger zwang uns dazu, in den umliegenden
Dörfern um Lebensmittel zu betteln. Man drohte uns damit, dass Zuwiderhandlungen, mit einer 14-tägigen Verlängerung der
Quarantäne geahndet werden. Der Roggen war schon reif und wir haben, auf den umliegenden Feldern, die Ähren abgerissen,
das Korn, zwischen 2 Steinen zu Mehl zerrieben, um daraus eine Suppe zu kochen, denn von dem was unsere Lagerküche uns
bieten konnte, war es nicht möglich zu überleben. Als der Eigentümer bemerkte wer seine Roggenähren entwendet hat, kam
er ins Lager, gerade zu dem Zeitpunkt als wir mit dem Mahlen beschäftigt waren. Der Lagerkommandant, bei dem er sich
beschwerte, drohte uns zu bestrafen, wenn wir unsere „Rauzüge” nicht unmittelbar einstellen würden. Wir sagten ihm er
solle uns heimfahren lassen, da wir doch lange genug hinter Stacheldraht gesessen hätten.
Endlich wieder in Freiheit
14 Tage nach unserer Ankunft wurden uns Entlassungspapiere ausgehändigt, sowie auch Fahrscheine
zum den, von uns angegeben Heimatorten. So kam ich nach Krottof, Kreis Oschersleben, zu meinem ehemaligen
Kriegskameraden, bei dem ich einen Tag geblieben bin. Er hatte mir schon eine Stelle bei einem Bauern besorgt, der 70
Jahre alt und kinderlos war. Zum Hof, den er mit seiner Ehefrau bewirtschaftet hat, gehörten 36 Morgen Land, 2 Ochsen
und 3 Kühe. Das Ackerland bestand aus 17 Parzellen und sicherte mir einen Arbeitsplatz.
Jetzt, da ich ein Dach überm Kopf und genug zu essen hatte, fing ich an nach dem Verbleib meiner Familie zu forschen.
Bei meinem letzten Heimaturlaub hatte ich mit meiner Frau verabredet; falls wir uns in den Kriegswirren verlieren
sollten, unsere Kontaktadresse, die meiner Quartiersleute in Burscheid, Kreis Opladen, sein sollte. Ich habe zuerst
nach Rohmanen geschrieben, aber leider keine Antwort erhalten. Dann habe ich nach Burscheid geschrieben, und siehe, -
bei denen lag schon eine Anfrage meiner Frau vor, die nach mir gefragt, und ihre jetzige Anschrift hinterlassen hatte.
Ich habe dem Bauern erzählt dass meine Frau sich zurzeit, auf einem Gut, in Alt Steinhorst, im Kreis Rostock, befindet.
Er war sofort bereit uns ein Zimmer zur Verfügung zu stellen, wenn ich meine Frau nach Krottorf rüberholen wollte. Das
habe ich Ihr mitgeteilt und sie war sofort bereit ihren Wohnsitz nach Krottorf zu verlegen, denn sie wohnte dort in
einem kleinen Stübchen unterm Dach.
Im Herbst, als die Feldarbeit so ziemlich erledigt war, bin ich nach Alt Steinhorst gefahren, um meine Frau und meinen
Sohn Kurt, sowie meinen Sohn Manfred, den ich noch nicht kannte, weil er erst nach der Flucht, am 31. Januar, in Groß
Lüssewitz, geboren wurde, nach Krottorf zu holen. Meine Frau hatte schon Holz für den Winter besorgt und vom Gut, auf
dem sie im Sommer gearbeitet hatte, Mehl und Kartoffeln bekommen. Wir haben das Mehl und andere Habseligkeiten in
Kisten verpackt. Das Holz haben wir einem Bauern gegeben, der uns und unser Gepäck, mit seinem Pferdewagen, zum 14
Kilometer entfernten Bahnhof, nach Ribnitz gebracht hat. Wir sind auch gut in Krottorf angekommen, aber als wir am
nächsten Tag, unsere Kisten vom Bahnhof abholen wollten, haben wir zwar die Kisten vorgefunden, doch der gesamte Inhalt
wurde während der Bahnfahrt entwendet. Die Bahnstation in Krottorf hat die Vorkommnisse zur Kenntnis genommen und
protokolliert, aber unsere Sachen haben wir nie wieder gesehen und mussten wieder bei Null anfangen.
Im Winter musste ich auf der Genossenschaft, unentgeltlich, für die Russen Weizen einsacken. Ich hatte versucht eine
Arbeit als Zimmermann zu bekommen, doch auf dem Arbeitsamt wurde mir gesagt, ich bin Ladwirt und muss auf der
Landwirtschaft arbeiten. Da in den ersten Nachkriegsjahren, auch in der sowjetisch besetzten Zone Arbeitsplätze knapp
waren, mussten auch solche, die einen anderen Beruf erlernt hatten, jede zumutbare Arbeit annehmen. Aus der Heimat
erhielt ich einen Brief, von meiner dort noch lebenden Mutter. Sie schrieb das sie mich noch einmal sehen wollte und
ich sollte doch wieder zurück kommen; Unser Hof wäre nicht von Polen besetzt und sie wäre ganz alleine, weil der Vater
nach dem Durchzug der Front von den Russen erschlagen wurde. Daraufhin habe ich dem polnischen Konsulat in Magdeburg
mitgeteilt, dass ich in Rohmanen eine Landwirtschaft besitze, und um eine Einreisegenehmigung gebeten.
Nach 2 Monaten erhielt ich eine Postkarte, mit der Mitteilung, ich sollte mich persönlich beim Konsulat vorstellen.
Nach Aufnahme meiner Personalien, wurde mir gesagt, das ich benachrichtigt werde wenn mein Antrag genehmigt wird. Ende
Juli 1947 erhielten wir die Einreisegenehmigung nach Ostpreußen, das jetzt unter polnischer Verwaltung stand. Wir
mussten zuerst zum polnischen Konsulat in Berlin-Lichterfelde, wo wir umgeben von einer Trümmerlandschaft, gewartet
haben, bis alle Untersuchungen und Formalitäten erledigt waren.
“ Wieder zurück in Ostpreußen.”
Der schwere Wiederaufbau nach dem Kriege
Dann fuhren wir über Frankfurt/Oder, Posen, Thorn, Allenstein, nach Ortelsburg, wo wir am 2. August 1947 ankamen. Mit
einem zweirädrigen Karren, den ich mir von einem noch in Ortelsburg lebenden Bekanten ausgeliehen hatte und meinem
Sohn Manfred im Kinderwagen fuhren wir nach Rohmanen. Meine Mutter war inzwischen verstorben und auf dem Hof war nur
meine, inzwischen aus Russischer Gefangenschaft wiedergekehrte Schwester, Frieda Pelkowski.

Es war alles ausgeplündert; kein Vieh, keine Maschinen und der ganze Hof mit kniehohem Graß überwachsen. Nur schmale
Trampelpfade, vom Haus zum Holzschuppen und zum Klo, durchkreuzten das satte Grün. Ich habe das Gras auf dem Hof mit
einer Sense, die ich noch gefunden habe, abgemäht, damit der Hof nicht so verwahrlost aussah. Am nächsten Tag habe ich
mich bei der Polizei in Ortelsburg angemeldet, wo ich auch ein Startgeld von 100 Zloty erhielt und Gepäckstücke, die
ich in Krottorf aufgegeben, am Bahnhof abgeholt. Es hat mich sehr gewundert das, das Gepäck überhaupt angekommen ist.
Da man von der Landwirtschaft nicht Leben konnte, habe ich mich in den nächsten Tagen, bei der jetzt polnischen Bahn,
um Arbeit beworben und wurde auch angenommen. Wenn wir unseren Monatslohn bekamen, saß immer einer am Tisch, der von
uns 100 Zloty für den Wiederaufbau von Warschau verlangte. Wenn ich dran war, riefen die Anderen, ich hätte Warschau
zerstört und müsste deshalb 200 Zloty abgeben. Nach 3 Jahren kam eine Verfügung, die besagte, dass wer länger als 1
Jahr bei der Bahn beschäftigt ist, angestellt werden muss. Um diese Bestimmung zu umgehen hat man mich entlassen und
eine Woche später wieder eingestellt.
Als ich vor Ablauf des nächsten Jahres, aus dem gleichen Grunde wieder entlassen wurde, habe ich mich bei der
Stadtverwaltung in Ortelsburg(jetzt Szczytno)beworben, wo ich zuerst im Gaswerk als Heizer und später auf Baustellen
als Zimmermann gearbeitet habe. Wir haben durch den Krieg beschädigte Häuser repariert, in den ehemals touristischen
Zentren einige Ausbesserungen an den Einrichtungen durchgeführt, eine Ziegelei wieder in Betrieb gesetzt und andere
anfallende Arbeiten verrichtet. Im Dach des Rathausturmes war während der Kämpfe eine Granate eingeschlagen, die, die
Dachlatten und die Verschalung zerstört hatte. Da wir, unter schwersten Bedingungen, den Schaden repariert haben,
wurde uns eine Höhenzulage versprochen, die wir aber nicht bekommen haben.
Aus Verärgerung darüber habe ich bei der Stadtverwaltung gekündigt und bei einer Wiederaufbaufirma unter der Leitung
von Bauingenieur Laskowski wieder angefangen, wo ich bis 1954, als Zimmermann beschäftigt war. Ab da habe ich mich
nur um meinen Hof gekümmert, der wegen meiner Arbeitsstellen, gezwungenermaßen, sehr vernachlässigt wurde. Als wir
1947 zurückkamen, brachten wir unseren Sohn Manfred noch im Kinderwagen. Den hat meine Frau zum Markt gebracht,
verkauft, und dafür eine Ziege erworben, die dank guter Pflege, uns täglich mit 4 Liter Milch versorgte. Das war der
erste Baustein zum Wiederaufbau, unserer durch den Krieg zerstörten, und danach ausgeplünderten Landwirtschaft.
Während meiner Arbeit bei der Bahn haben wir uns eine Kuh gekauft, die nach einem halben Jahr, wegen nicht bezahlter
Grundsteuer, vom Gerichtsvollzieher gepfändet wurde. Man hat uns die Kuh weggenommen und bei einem Arbeiter, der in
der Ernst-Mey-Straße in Ortelsburg wohnte und sie wegen nicht vorhandener Futtermittel, nur mit Kartoffelkraut
gefüttert hat, untergestellt. Als ich bei der Bahn meinen Monatslohn bekommen habe, bin ich zur Gmina gegangen, habe
eine Rate angezahlt und durfte dann die Kuh wieder mit nach Hause nehmen. Durch die schlechte Ernährung war die Kuh
stark abgemagert und lieferte nur die Hälfte der ursprünglichen Milchleistung.
Später habe ich ein Pferd auf Abzahlung bekommen, das 140.000 alte Zloty gekostet hat. Die Stute war schwach und unser
Feld sehr hügelig, so dass man nur bergab pflügen konnte, was sehr beschwerlich war, bergauf ging es immer im Leerlauf.
Später habe ich die schweren Böden mit dem Traktor umpflügen, und in den letzten Jahren auch mit dem Binder mähen
lassen. Von der Stute habe ich 2 schöne Fohlen gezogen; ein davon habe ich bei der Ausreise in die Bundesrepublik
mitgebracht und bei der Viehverwertungs-Genossenschaft in Göttingen verkauft. In den ersten Nachkriegsjahren als noch
wenig Land bestellt wurde, breiteten sich auf den nicht beackerten Flächen, Wildkräuter aus. Disteln und andere
Schnellwachsende, erreichten manchmal eine Höhe von 2 Meter, besonders auf den schweren Böden.
Es hat viel Schweiß gekostet ehe man den Acker soweit hatte, das er auch befriedigende Erträge abwarf. Die
Währungsreform von 1950, hat unser weiniges Geld das wir schon gespart hatten, wieder vernichtet. Ich hatte 2 Pferde,
1 Fohlen, 2 Kühe und Schweine, als ich wieder aufgefordert wurde nicht bezahlte Grundsteuern nachzuzahlen. Als ich
nicht bezahlen konnte, hat der Vollziehungsbeamte, ein Fohlen, eine Kuh und ein Schwein gepfändet. Es gelang mir jedoch
nach längeren Verhandlungen, ohne größere Verluste, alles zu regeln. Später kam eine Verfügung, die besagte; wenn
jemand auf seinem Hof nur eine Kuh und ein Pferd hatte, durften sie nicht gepfändet werden. Einige haben ihr Inventar
dieser Verfügung angepasst und dadurch die Zahlung von Grundsteuer umgangen.

Wer seine Steuern pünktlich bezahlt und sein Kontingent an landwirtschaftlichen Produkten fristgerecht abgeliefert hat,
der konnte seine, darüber hinaus erwirtschafteten Produkte zu marktgerechten Preisen verkaufen. Für eine hochtragende
Sterke, mindestens 400 kg schwer, die auf ein staatliches Gut verkauft wurde, konnte man bis zu 12000 Zloty bekommen.
Unsere Böden waren kalkarm, doch durch den Einsatz von Kalk und Kunstdünger konnte man den Ertrag erheblich steigern.
Kalk und Kunstdünger konnte man bei der Genossenschaft(GS) bestellen, der dann auch direkt auf den Hof geliefert wurde.
Kalk wurde geliefert und gleich auf dem Feld ausgestreut. In den 1960ger Jahren waren alle Ackerflächen der Rohmaner
Felder bestellt.
Die nach dem Krieg zurückgebliebenen deutschen Bauernfamilien, aber auch die Polen, die während des Krieges beim Bauern
in Deutschland gearbeitet haben, versuchten mit teils bescheidenen, oder auch zusammen gesuchten, landwirtschaftlichen
Geräten, die bäuerlichen Betriebe aufrecht zu erhalten. Nach den schweren Anfängen in den ersten Nachkriegsjahren
erzielten sie schließlich einen beachtlichen Erfolg, der sich in wogenden Kornfeldern, sowie in grünen Wiesen auf
denen gut genährtes Vieh weidete, widerspiegelte.
Ein schwerer Einschnitt in meinem Leben.
Am 11. Mai 1956 verstarb nach langer schwerer Krankheit, meine liebe Ehefrau Marta Rattay,
geborene Brosch. Ein Jahr zuvor war schon mein Schwiegervater Gottlib Brosch verstorben. Die schweren Bedingungen
unter denen wir nach Kriegende leben mussten, haben ihrer bereits angegriffenen Gesundheit sehr zugesetzt. Sie
verstarb mit 44 Jahren und hinterließ in unserer Familie eine große Lücke, die nicht mehr zu Überbrücken war. Wir
haben sie unter großer Anteilnahme der noch verbliebenen deutschen Bevölkerung zu Grabe getragen und auf dem Rohmaner
Friedhof beigesetzt. Die Arbeit die sie sonst verrichtet hatte fiel jetzt auf mich und meine Söhne zurück. Meine
Schwester Frieda Pelkowski half auch wo sie nur konnte. Wir waren auf die Unterstützung durch Nachbarn und Freunde
angewiesen, die uns immer wenn es nötig war, tatkräftig unterstützt haben. Im laufe der Zeit haben wir wieder zum
Alltag zurück gefunden, haben sie noch etliche Jahre auf dem Friedhof besuchen können, bis wir, bedingt durch unsere
Ausreise uns endgültig von ihr trennen mussten.
Der endgültige Abschied von Ostpreußen
Ab 1956 begannen, durch die Vermittlung des Deutschen Roten Kreuzes, die ersten Ausreisen in die
Bundesrepublik Deutschland. Zuerst waren es Kinder die zu ihren Eltern ausreisen durften, Familien deren Väter aus der
Kriegsgefangenschaft in den Westen Deutschlands entlassen wurden und andere durch den Krieg getrennte
Familienangehörige. Ab 1960 erhöhte sich die Zahl der Ausreisewilligen aus dem polnisch besetzten Ostpreußen. Es setzte
sich die Überzeugung durch, dass unsere Angestammte Heimat, uns für die Zukunft keine Perspektive mehr bieten konnte.
Meistens wurden die Anträge, die wir an die Passabteilung in Allenstein stellen mussten, um einen Ausreisepass zu
bekommen, negativ beschieden. Nach mehrmaligen Versuchen gelang es dann doch, diese begehrte Ausreiseberechtigung in
Empfang zu nehmen. Die Enttäuschung der Zurückgebliebenen war groß, wenn wieder mal Verwandte oder Nachbarn, den Weg
in Richtung Bahnhof einschlugen.
Um einen Reisepass zu beantragen, musste man zuerst eine Einladung von Verwandten aus der Bundesrepublik vorlegen, in
der, diese sich verpflichten mussten, für Unterkunft und Verpflegung der Eingeladenen zu sorgen. Diese Einladung
musste durch ein Amt in der Bundesrepublik beglaubigt werden. Außerdem mussten die Kosten für die Bahnfahrt, ab
polnischer Grenze, bis zum Zielort, beim polnischen Reisebüro ORBIS, in Warschau, in DM eingezahlt werden.
Unseren ersten Ausreiseantrag haben wir 1964, bei der Kommandantur der polnischen Miliz in Allenstein eingereicht, der
nach einer gewissen Zeitspanne, ohne eine uns verständliche Begründung zu nennen, abgelehnt wurde. Gegen diese
Ablehnung wurde ein Widerspruch zugelassen, den wir sofort einreichten. Nach einer weiteren Zeitspanne erhielten wir
wieder eine Ablehnung, gegen die kein Widerspruch mehr zulässig war. Wer seine Ausreiseabsicht nicht aufgeben wollte,
musste einen neuen Antrag stellen. Es gab Familien die schon 10 Mal einen Ausreiseantrag gestellt hatten und immer
wieder abgewiesen wurden. Da meine Söhne, nicht die Absicht hatten in Rohmanen zu bleiben und ich nach 2 Weltkriegen,
an denen ich teilgenommen, die schwere Arbeit auf der Landwirtschaft, nicht aus eigener Kraft schaffen würde, haben wir
1966 wieder einen Antrag gestellt, der prompt abgelehnt wurde. Der Widerspruch auf diese Ablehnung wurde auch negativ
beantwortet, so dass wir 1968 wieder einen Antrag eingereicht haben.
Weil das Passamt in Allenstein lange nichts von sich hören ließ, hegten wir schon die Hoffnung das es jetzt klappen
würde und waren sehr enttäuscht als wieder eine Absage kam. In der Zwischenzeit sind viele Nachbarn und Bekannte aus
Rohmanen, sowie aus der näheren Umgebung, ausgereist und das Häuflein der noch verbliebenen Deutschen, wurde immer
kleiner. Die Motivation, die uns in früheren Jahren, über so manche schwierige Lage hinweg geholfen hat, ist einer
hoffnungslosen Resignation gewichen. Man war davon überzeugt, dass unser Leben, in unser Angestammten Heimat, keine
Zukunftsperspektive mehr haben konnte und wenn wir keine Ausreisegenehmigung bekommen, wir eines Tages die letzten
Deutschen in der ganzen Umgebung sein werden.
Die Ausreise-Heimat ade
Wir hatten die Hoffnung schon aufgegeben, als am 30. April 1969, der Briefträger unseren Hof
betrat und mir einen Brief überreichte, in dem uns das Passamt in Allenstein mitteilte, dass unsere Ausreise in die
Bundesrepublik Deutschland, genehmigt worden ist. Wir müssten, nach Aushändigung der Reisepapiere, den Geltungsbereich
der Volksrepublik Polen, innerhalb von 3 Monaten verlassen. Wir waren zuerst geschockt, über den Hinweis, das wir
unsere Heimat in 3 Monaten verlassen müssen, aber dann stellte sich die Zukunftsperspektive wieder ein und wir gingen,
wie von einem schweren Ballast befreit und gut gelaunt unser weiteren Tätigkeit nach.
Als der Briefträger unseren Hof betrat, waren ich und mein Sohn Kurt gerade dabei eine Fuhre Mist zu laden. Wir hatten
den Wagen gerade halb geladen und haben nach der frohen Kunde nicht mehr weiter gemacht, sondern die Pferde vorgespannt
und den Mist aufs Feld gefahren, damit wir den Wagen für alle Fälle frei hatten. Das war die letzte Tätigkeit für
unsere Landwirtschaft in Ostpreußen.
Die Nachricht von unserer Ausreise verbreitete sich, ohne dass wir darüber gesprochen haben, wie ein Lauffeuer.
Alsbald kamen Leute aus dem Dorf, die sich für das Vieh und für diverse Landwirtschaftliche Geräte interessierten.
Etliche wollten bestimmte Sachen sofort kaufen, andere haben nur zurücklegen lassen und wollten später kommen und
bezahlen, haben es aber dann doch nicht genommen.

Wenn man eine Landwirtschaft hatte, konnte man 2 Pferde, 2 Rinder, 3 Schweine, 5 Schafe und 10 Hühner, in einem
geschlossenen Viehwaggon, in die Bundesrepublik mitnehmen. Jeden Tag war man unterwegs, von einer Behörde zur Andern.
Die Aushändigung der Reisepapiere erfolgte nur nach Vorlage bestimmter Bescheinigungen: Es mussten alle Steuern bezahlt
sein, das Kontingent landwirtschaftlicher Erzeugnisse musste abgeliefert sein, je eine Bescheinigung vom Katasteramt
und vom Notar musste vorgelegt werden, das man dem polnischen Staat das Grundstück abgetreten hat. Die Gebühren für
die notarielle Beglaubigung mussten wir selbst bezahlen. Wenn man alle Bescheinigungen beisammen hatte, bekam man bei
der Kreisverwaltung eine Gesamtbescheinigung. Mit dieser Bescheinigung konnte man nach Allenstein, zur
Polizeikommandantur fahren, wo man nach dem schriftlichen Verzicht auf die polnische Staatsangehörigkeit, einen
Reisepass ausgehändigt bekam, der den Inhaber zum Grenzübertritt berechtigte, aber nicht zur Wiedereinreise.
Wir haben 2 Pferde, eine Sterke, einen Ochsen, 5 Schafe, 2 Schweine und 10 Hühner mitgenommen. Über die Schutzimpfung
der Rinder musste man eine, vom Kreistierarzt beglaubigte Bescheinigung vorweisen. Ich habe 5 Schafsböcke gekauft, die
ich in der Zwischenzeit, hinter der Scheune, zum Weiden angekettet hatte. Einer von denen hat sich losgerissen und
seinen Nachbarn getötet. Das Fleisch konnten wir noch verkaufen, mussten aber dafür einen anderen Schafsbock kaufen.
Innerhalb von 3 Monaten mussten wir alles regeln und zwei Tage vor der Abfahrt einen Eisenbahnwagen, bei der
Eisenbahndirektion in Allenstein bestellen. Reservierungen bei den polnischen Behörden waren meist immer mit
Schmiergeld verbunden, weil man sonst nie sicher sein konnte dass diese Vereinbarungen auch eingehalten werden. Schon
2 Wochen vor unserer Abfahrt, gab es in Ortelsburg keine alkoholischen Getränke zu kaufen. Meine Söhne mussten mit dem
Motorrad die umliegenden Dörfer abfahren, damit wir für die Reise einen Vorrat anlegen konnten; denn Wodka war zu der
Zeit, in Polen, wie eine zweite Währung.
Am 25. Juli haben wir zusammen, mit meinem Neffen Siegfried Brosch, unseren sonstigen Hausrat, der in Kisten verpackt
war, in einen Eisenbahnwagen, auf dem Allensteiner Bahnhof verladen. Alles musste zuerst durch den Zoll, wo die
Federbetten gewogen wurden und über das erlaubte hinausgehende Kissen, verzollt werden mussten. Dasselbe galt auch für
Fleisch und Räucherwaren.
Am 26. Juli, unserem Verladetag, kam der Eisenbahnwagen aus Allenstein, erst um 11 Uhr auf dem Ortelsburger Bahnhof an.
Die Rinder hatten wir zu Fuß, zum Bahnhof gebracht; Schweine, Schafe und Hühner auf dem Pferdewagen. Im Eisenbahnwagen
mussten, mit Hilfe von Brettern und Bohlen, Boxen für die verschiedenen Tiere erstellt werden. Jedes Pferd und jedes
Rind in eine Bucht. Die Schafe zwischen die Pferde, die Schweine zwischen die Rinder und die Hühner in einem Käfig,
unter der Decke über den Rindern. Die Hühner hatten unterwegs Eier gelegt, somit hatten wir jeden Tag frische
Verpflegung. Bei der Fahrt im Viehwagen, begleitete mich mein Sohn Manfred. Als die Lokomotive nahte, um den Wagen
abzuholen, wurden noch schnell die restlichen Sachen hinein geworfen und so mache Abschiedsträne rollte dann die Wange
hinab.
Unsere Nachbarn, Deutsche und Polen, halfen uns beim Verladen des lebendigen Inventars. Jetzt erinnerte ich mich
plötzlich, an die oft auch schönen, Ereignisse der letzten 22 Jahre. Einer Zeit, in der das Zusammenleben von
Deutschen und Polen, von Jahr zu Jahr, besser wurde. Man half sich beim einbringen der Getreideernte, beim Dreschen
des Getreides, bei der Kartoffelernte und bei anderen Arbeiten, wo viele Menschen zupacken mussten. Es war eine
Dorfgemeinschaft, in schweren Zeiten geboren; jeder half jedem wenn Hilfe nötig war. Es wurde mir plötzlich bewusst,
das jetzt ein Lebensabschnitt zu Ende ging, zu dem ich nicht mehr zurückkehren konnte. Unsere Existenzgrundlage war
jetzt ein Eisenbahnwagen auf einem Schienenstrang, dessen Ende irgendwo in weiter Ferne lag. Obwohl, von langer Hand
vorbereitet, war dieser Moment voller Wehmut.
Doch als der Zug sich plötzlich, in Bewegung setzte, war ich sofort wieder in der Gegenwart. Menschen, mit denen man
Jahrzehnte lang, in gutem Einvernehmen zusammen gelebt hat, blieben plötzlich am Bahnsteig zurück und die Entfernung
zwischen ihnen und mir vergrößerte sich mit jeder Sekunde, bis sie letztendlich aus meinem Blickfeld verschwanden.
Es war ein heißer Julitag, als wir unsere Reise gen Westen antraten. Für die Schweine, die besonders unter der Hitze
zu leiden hatten, haben wir 10 Flaschen Essig mitgenommen und sie von Zeit zu Zeit besprenkelt, damit sie besser atmen
konnten. Für die anderen Tiere war reichlich Heu und Hafer vorhanden. Eine großes Fas und zwei Milchkannen waren mit
Wasser gefüllt, die wir auf den an der Strecke liegenden Bahnstationen, bei Bedarf wieder nachgefüllt haben.
Da der Kreistierarzt nicht in seinem Büro war, konnten wir die Impfbescheinigung für das Vieh, nicht rechtzeitig
herbeischaffen. Der Zug setzte sich in Bewegung und die Bescheinigung war immer noch nicht da. Als die Bescheinigung
dann eingetroffen, wir aber schon unterwegs waren, ist mein Sohn Kurt mit dem Motorrad hinterher gefahren und hat uns
in Passenheim, wo der Zug noch andere Wagen angehängt bekam, die Impfbescheinigung übergeben. Wir waren sehr froh das
er es noch geschafft hat, denn in solch einer Situation fühlt man sich sicherer wenn man alle Bescheinigungen bei sich
hat. Auf der Rückfahrt, mit dem Motorrad hatte er noch eine Panne, musste das Motorrad stehen lassen und per Anhalter
nach Hause fahren. Am nächsten Tag kam er mit Siegfried Deptolla, der das Motorrad wieder flott machte und brachte es
wieder nach Rohmanen zurück.
Die Fahrt mit dem Viehwagen, gen Westen
Von Ortelsburg bis Allenstein(45 km) hat unser Zug 4 Stunden gebraucht, weil auf jedem Bahnhof
gehalten wurde, um neue Wagen anzuhängen. Nachdem wir in Allenstein angekommen waren, kam ein Rangierer und fragte
nach unserem Ziel. Als wir ihm mitteilten, das wir in die Bundesrepublik Deutschland wollen, sagte er nur: „In 10
Minuten fährt ein Zug los. Wenn ich von euch 500 Zloty und einen Liter Wodka bekomme, werde euch sofort anhängen,
andernfalls kommt ihr auf ein Nebengleis und müsst dann auf den nächsten Zug warten. Es blieb uns nichts anderes übrig
als seiner Forderung nachzukommen, denn über derartige Erpressungen hat man bereits von Anderen, die vor uns ausgereist
sind, gehört. Wir wurden auch sofort angehängt und fuhren dann die ganze Nacht, an Osterode, und Thorn vorbei bis
Gnesen. Dort wurde wieder rangiert.
Von einer Anhöhe wurden die einzelnen Wagen auf verschiedene Gleise verteilt und zu neuen Zügen zusammengestellt. Der
Aufprall der ungebremsten Wagen erzeugte eine derartige Erschütterung, dass manche Bretter an den Boxen geborsten waren.
Von Gnesen ging es dann in einem Zuge durch bis zur Grenzstation Reppen(Rzepin). Dort mussten wir zum Zollamt, wo
unsere Ausfuhrpapiere durch die Zollbeamten, und durch einen Tierarzt geprüft wurden. Bis Reppen(Rzepin) haben wir für
den Eisenbahnwagen 900 Zloty bezahlt; hier mussten wir noch einmal 650 Zloty bezahlen. Bei der Wagenkontrolle erklärte
uns ein Bahnbeamter das unser Wagen, sich nicht für den internationalen Transport eignet und wir deshalb den Inhalt in
einen Anderen umladen müssen, der irgendwann, auf dem Nebengleis bereitgestellt wird. Nach langer Verhandlung, sowie
einer Zulage von 500 Zloty und einem Liter Wodka haben wir ihn davon überzeugt, das der Wagen sich doch für die
Weiterfahrt eignet.
In der Nacht war Schichtwechsel, der unseren Wagen wieder abgehängt hat, weil er angeblich von der Reichsbahn der DDR,
wegen technischer Mängel nicht weiterbefördert würde. Wir mussten unsere Verhandlung vom Vorabend wiederholen, die mit
der Zusage endete, dass wir am frühen Morgen, über die Grenze auf DDR Gebiet, gebracht werden. Um 5 Uhr morgens kam
eine Lokomotive, die uns den letzten Abschnitt bis über die Grenze bringen sollte. Als der Zug hat noch einmal anhielt,
kamen polnische Grenzbeamte und Soldaten in den Wagen. Sie durchsuchten ihn und fragten, ob wir noch polnisches Geld
oder einen Grundbuchauszug bei uns hätten. Wir zeigten ihnen 800 Zloty, die sie uns, nach Ausstellung einer Quittung
über 500 Zloty, abnahmen. Die Grundbuchauszüge habe ich, im Stroh versteckt, dem Ochsen vor die Füße gelegt. Falls
jemand da suchen sollte, hätte ich gesagt, das das Tier bösartig veranlagt ist, und ich für seine Sicherheit nicht
garantieren könnte, deshalb sollte er vorsichtig sein.
Als die Grenzkontrolle den Zug verlassen hatte, setzte sich die Lokomotive wieder in Bewegung und überquerte nach
kurzer Zeit die Oderbrücke. Auf einer eingezäunten Fläche, jenseits der Grenze, hat man uns abgestellt hat und die
Lokomotive fuhr zurück auf polnisches Gebiet. Vor und hinter uns waren die Tore verschlossen. Auf den Wachtürmen,
links und Rechts von uns, standen Posten mit einem Gewehr im Anschlag. Vier Grenzbeamte der DDR, jeder mit einer
Leiter in der Hand, sowie ein Schäferhund, kamen zu unserem Wagen. Sie öffneten die Schiebetüre, stellten die Leiter
davor und ließen den Hund in den Wagen springen, der nur etwas herum schnupperte und wieder heraussprang. 2 Beamte
haben dann anschließend, die Papiere kontrolliert und das Inventar gezählt.
Nach einiger Zeit wurden wir an einen Güterzug der Reichsbahn angehängt und fuhren von Frankfurt an der Oder, vorbei
an Berlin, Ellingen und Nordhausen, über die Grenze zur Bundesrepublik bis Herzberg. Hier hat ein Zollbeamter der
Bundesrepublik, die Formalitäten erledigt und ein Tierarzt die Pferde, Rinder und Schweine gründlich untersucht. Ich
musste ihnen die Mäuler aufhalten und die Füße hochheben. Danach hat uns die Lokomotive zu einer Wasserzapfstelle
gebracht, wo wir die Tiere tränken und unsere Behälter mit Wasser auffüllen konnten. Anschließen fuhren wir über
Northeim nach Göttingen, zur Viehverwertungsgenossenschaft, die zuvor von unserer Ankunft in Kenntnis gesetzt wurde.
Der Ochse, die Sterke und die Schweine wurden, in Göttingen zum Schlachthof gebracht; die Pferde kamen nach Hannover
und die Schafsböcke nach Kassel. Wir waren mit dem Viehtransport 5 Tage unterwegs; hatten so manche Klippe umschifft
und Schwierigkeiten gemeistert, die im normalen Leben nicht vorkommen.
Wir wurden mit einem PKW, ins Durchgangslager Friedland bei Göttingen gefahren, wo mein Sohn Kurt, meine Schwester
Frieda Pelkowski und Siegfried Brosch mit Familie, die am 30 Juli, um 14 Uhr, von Warschau mit dem Zug abgefahren, und
hier am 31. Juli in den Morgenstunden eingetroffen sind, schon auf uns gewartet haben. In Friedland hat man uns mit
Familie Siegfried Brosch in einem Raum untergebracht, wir wurden registriert und erhielten 20 DM Überbrückungsgeld,
pro Person. Da wir erst am Freitag in Friedland eingetroffen sind, mussten wir hier über das Wochenende bleiben,
obwohl die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der Regel nur 3 bis 4 Tage beträgt.
Um einen Antrag für die Ausreise stellen zu können, brauchten wir eine Einladung von in der Bundesrepublik lebenden
Verwandten. Diese Einladung hat uns mein Bruder, Ernst Rattay, aus Ingelheim am Rhein zugeschickt. Ingelheim liegt im
Bundesland Rheinland-Pfalz. Das Geld für die Bahnfahrt, hat uns, Frieda Schellin, geb. Nickel, aus Duisburg, die
Tochter unseres Nachbarn, überwiesen. In Friedland wurden wir registriert. Im Registrierschein, war als unser
nächster Aufenthaltsort in der Bundesrepublik, das Durchgangslager Osthofen bei Worms, das alle Aussiedler für
Rheinland-Pfalz aufnehmen musste, eingetragen. Die Eintragung erfolgte deshalb, weil der Ort aus dem uns unsere
Einladung zugeschickt wurde, sich auch in Rheinland-Pfalz befand.
Da ich nach dem Polenfeldzug, als Soldat, ein Jahr im Kreis Opladen, im Rheinland gewesen bin, wäre ich sehr gerne in
diese Gegend gezogen, denn die Erinnerung an die schönen Tage die ich dort verlebt habe war in mir immer noch wach.
Ich versuchte die Eintragung in unseren Regiestierscheinen ändern zu lassen, was nach einigen, vielleicht auch
berechtigten Einwänden, am 4. August, vom Beauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen, genehmigt wurde. Anstelle von
Rheinlad-Pfalz stand da jetzt Nordrhein-Westfalen und am 7. August, fuhren wir, noch mit anderen Aussiedlern, ins
Durchgangslager Unna-Massen, am östlichen Rande des Ruhrgebietes gelegen. Hier wurden wir in einem Zimmer untergebracht
und konnten unser Essen in einer Gemeinschaftsküche zubereiten.
Am 8. August wurden wir in Unna-Massen, als Bürger der Bundesrepublik Deutschland registriert, erhielten
Einhundert DM Begrüßungsgeld, den Vertriebenen Ausweis -A -und 4 Wochen später den Bundespersonalausweis. In
Unna-Massen haben wir mehr als 4 Monate verbracht, weil mein Sohn Kurt, wegen fehlender Berufsausbildung, in Unna, an
einem Grundlehrgang für Metallarbeiter teilgenommen hat, der vom Arbeitsamt finanziert wurde. Am 11 Dezember 1969 sind
wir endlich an unserem vorläufigen Wohnsitz, im Durchgangswohnheim, an der Elisabethstraße 13, in Velbert angekommen.
Ab dem 5. Januar 1970 konnten meine Söhne, in der Zahnradfabrik Reining, in Velbert ihrer geregelten Arbeit nachgehen.
Von Bau- und Sparverein in Velbert wurde uns am 20. Juni 1970, unsere erste Wohnung zugewiesen.
Velbert im Februar 1972
gezeichnet: Gustav Rattay
In den späteren Jahren konnte man nicht mehr erkennen dass dort vor Jahren Tote zur letzten Ruhe gebettet wurden. Die
Natur holte sich das ganze Gelände zurück und nur unter großen Schwierigkeiten konnten Besucher aus dem Westen das
Friedhofsgelände noch betreten.
Das Gasthaus Trzaska

Nach dem ersten Weltkrieg hat der Gastwirt Friedrich Trzaska neben dem Gasthof einen großen Saal
für Festlichkeiten und Vereinsfeiern gebaut, in dem schon mal Feuerwehrfeste veranstaltet wurden. Ernst Trzaska war
Feuerkommissar bei der Ostpreußischen Feuersozität. Erich Trzaska war Vollziehungsbeamter beim Amtsgericht in
Ortelsburg. Unser Feuerkommissar war uns beim organisieren der Veranstaltungen sehr behilflich, hat uns den Saal, die
Musik und die Theaterstücke besorgt und die Feuerwehren aus den Nachbardörfern eingeladen.
Zu Manöverzeiten, vor dem 2. Weltkrieg und dann auch während des Krieges, waren im Gasthof Soldaten, meist im Range
eines Offiziers, einquartiert. Fräulein Mariechen Trzaska hat die Poststelle im Dorf betreut. Nachdem ich 1939 zum
Militär eingezogen wurde, hat sie, nach einer Schulung im Ortelsburger Krankenhaus, auch die Unfallmeldestelle
übernommen. Nach dem Krieg, pflegte sie mit vielen Bekannten, die bereits in der Bundesrepublik wohnten, einen regen
Briefwechsel. Auf dem Rohmaner Friedhof hat sie viele Gräber, im Auftrag von Angehörigen, die auf Grund ihrer
Abwesenheit, dazu nicht mehr in der Lage waren, gepflegt. Der Bauunternehmer Kurnitzki aus Ortelsburg, äußerte die
Bitte, sie möchte ihm doch ein Blatt vom Rosenstrauch, der auf dem Grab seiner Eltern steht, in den Brief legen. Als
sie uns den Brief vorgelesen hat, waren wir zu Tränen Gerührt. Sie hat als Letzte aus ihrer Familie, bis zu ihrem Tod
im Jahre 1960, in Rohmanen, im Gebäude der Gastwirtschaft gewohnt und ist auf dem Rohmaner Friedhof beerdigt worden.
Fleisch und Wurstwaren Karl Pelkowski
Im Jahr 1931 hat der Fleischermeister Karl Pelkowski, aus Grammen, direkt neben unserem Hof ein
Anwesen gekauft und dort eine Fleischerei eingerichtet. Er war mit meiner Schwester Frieda, verheiratet. Am Anfang hat
er die Schweine noch auf seinem Hof geschlachtet, später dann im Ortelsburger Schlachthof. Jede Woche fuhr er 2-mal,
mit dem Pferdewagen(Einspänner), nach Ortelsburg zum Wochenmarkt, wo er seine Fleisch und Wurstwaren zu Verkauf anbot.
Am Tag davor, wenn er die Wurst gekocht hat, kamen viele Rohmaner mit Kannen oder anderen Gefäßen, wegen der guten
Wurstsuppe, die er umsonst unter die Leute verteilte. Als Karl Pelkowski, Ende August 1939 zum Militär eingezogen
wurde, hat seine Frau das Pferd verkauft und den Beitrieb stillgelegt. Am Haus hing, immer noch die Tafel mit der
Aufschrift: Karl Pelkowski, Fleisch und Wurstwaren. Ein Witzbold hat irgendwann darunter geschrieben; „Fleisch und
Wurst waren einmal”, drauf hin hat Frau Pelkowski die Tafel entfernen lassen. Karl Pelkowski ist im Mai 1946 in
französischer Gefangenschaft verstorben. Seine Ehefrau Frieda, verstarb an ihrem 85. Geburtstag in Mettmann bei
Düsseldorf.
Die steinreichen Rohmaner Felder
Die letzte Eiszeit hat bei der Schmelze, auf der Rohmaner Feldgemarkung viele Steine und
Granitblöcke zurück gelassen. Überirdisch, aber besonders unter der Erde, gab es viele kleine, aber auch große Steine,
die, den Bauern, beim Pflügen und anderen Feldarbeiten sehr viel Schweiß, abverlangten. In einer Kiesgrube, auf dem
Feld des Bauern August Radek, lag ein Granitblock, von schätzungsweise 100 cbm. Vor etwa 80 Jahren, als man für diese
Steine noch keine Verwendung hatte, griffen die Bauern zu einer „List”. Weil er sonst nicht pflügen konnte, hat mancher
seinem Nachbarn, die Steine in der Nacht auf dessen Feld abgeladen. Als diese Tätigkeit unter Strafe gestellt wurde,
hat man die Steine in Schluchten gekippt und mit Mutterboden zugeschüttet. In späteren Jahren kam diese jedoch beim
pflügen wieder an die Oberfläche. Dann hat man aber schon Steine für den Straßenbau gebraucht und konnte sie so zu Geld
machen. Besonders im Raum südlich von Ortelsburg, bis zur polnischen Grenze, wo Steine eine Rarität waren, kamen sie
jetzt zum Einsatz. Auch beim Bau von Häusern, besonders für die Fundamente, wurden sie eingesetzt, weil auf diese
Weise viel Ziegeln eingespart wurden. Die Firma Gribienski aus Ortelsburg hat die großen Steine mit Dynamit gesprengt
und auf diese Weise die weitere Verarbeitung erleichtert.
Die Steine welche beim Pflügen aus dem Boden geholt wurden, hat man am Feldrand auf große Haufen zusammen getragen.
Wenn die Feldarbeit beendet war, sowie auch in den Wintermonaten, waren wir jeden Tag mit Steinen unterwegs. Wir sind
vorwiegend am Abend los gefahren, weil unter der schweren Last die Wagenachsen so heiß wurden und die Gefahr bestand,
das durch die Dehnung, die Räder blockiert würden. Bei einer Fahrt konnte man bis zu 24 Reichsmark verdienen, wogegen
1 Zentner Roggen für 8 bis 9 Reichsmark zu haben war. Ich bin selbst, mit dem Pferdewagen bis Fürstenwalde, Radostowen,
Luka, Altkirchen, Höhenwerder, ja sogar bis Friedrichshof gefahren.
In Rohmanen wurden auch rote Ziegeln gebrannt. Viele Häuser wurden, mit Ziegeln erbaut, die nur wenige 100 Meter von
der Baustelle entfernt hergestellt wurden. Der Lehn wurde auf den Feldern in der näheren Umgebung entnommen, dann von
Ochsen solange getreten, bis er so geschmeidig war, das er sich in Formen einstreichen ließ. Wenn die Ziegel in der
Form trocken war, wurde sie entnommen und in einem Brennofen gestapelt. Um einen Ofen richtig anzufeuern, brauchte man
12 Raummeter Holz, das im Zeitraum von ein par Tagen verheizt wurde. Der Fischer Karl Glitza hatte schon eine
Knetmaschine, die von einem Pferd angetrieben wurde, das mit verbundenen Augen, den ganzen Tag in die Runde ging.
Im Dorf waren auch vier Kalköfen, in denen so genannte Kalksteine, die sich an gewissen Stellen, im Erdboden befanden,
gebrannt wurden. Nach dem Brennen wurden die Steine mit Wasser abgelöscht und die daraus entstandne Masse diente, nach
dem Beimischen einer gewissen Menge Sand, dann als Bindemittel beim Häuserbau. Das Gerichtsgebäude und das
Lehrerseminar in Ortelsburg wurden mit Kalk, aus dem Rohmaner Brennöfen erbaut. Auch zum Bau einer Eisenbahnbrücke, auf
der, der Zug, den Sawitzfluß, von Ortelsburg nach Allenstein überquerte, hat mein Großvater, mit einem Ochsengespann,
Kalk gefahren.
Hinter der Scheune, beim Bauern Johann Dembek hat man Tonerde gefördert, aus der man mit Hilfe einer Formerscheibe,
die von einem Arbeiter mit Muskelkraft(Fußbetrieb) angetrieben wurde, schöne Krüge, Schalen und Vasen geformt hat.
Die Töpferware wurde, nachdem sie trocken genug war, auch in einem Ofen gebrannt, anschließend mit einer Lasur
überzogen und wieder gebrannt. Es wurden auch Kacheln zum Bau von Kachelöfen hergestellt, die mit verschiedenen
Ornamenten versehen, die Wohnstuben unserer Vorfahren schmückten. So haben unsere Großväter ihr Leben gemeistert und
nach und nach, unsere Dörfer aus der Rückständigkeit in die Neuzeit geführt.
Das gesellschaftliche Leben nach dem 1. Weltkrieg

Als der Lehrer Alfred Dorka, ein Frontkämpfer des Ersten Weltkrieges und ein Sportsmann, als
zweite Lehrkraft an der Rohmaner Schule angestellt wurde, hat er die Sitten und Gebräuche aus früherer Zeit wieder zum
Leben erweckt. Zuerst hat er die Jugend zusammen gerufen, einen Jugendverein und einen Fußballclub, gegründet. Zum
Vorsitzenden des Fußballclubs wurde Johann Gloddek berufen, der ihn auch geleitet hat. Bauer Wilhelm Spittka, der am
Rohmaner See wohnte, stellte Land für einen Sportplatz unentgeltlich zur Verfügung. Lehrer Alfred Dorka hat am
Rohmaner See eine Badestelle ausgesucht und ein Sprungbrett bauen lassen. An jedem Sonnabend im Sommer, bevor die
Sonne unterging, versammelte sich die gestammte Jugend des Dorfes an der Badestelle am See. Es wurde gebadet,
Heimatlieder gesungen, gespielt, im Fackelschein eines großen Biwakfeuers, bis in die späte Nacht hinein. Der Fischer
Karl Glitza hat uns Kähne zur Verfügung gestellt, mit denen wir auf den See hinausgepaddelt sind, dabei hatten wir viel
Spaß, was wiederum den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft gefördert hat. Ich habe mit meiner Mandoline den Gesang von
Volks- und Heimatliedern begleitet.
Der Rohmaner See liegt in einem Tal, dessen Hänge zu beiden Seiten mit Kiefern und Tannen bewaldet sind. Wenn man
gesungen oder Musiziert hat, hallte es von den Hängen zurück. Die Ufer waren mit Kalmus und Schilf bewachsen, was für
die Fischaufzucht von Vorteil war. Wenn man an einem sonnigen, windstillen Tag, am Seeufer spazieren ging, traf man
oft auf Flachstellen, an denen sich die Fischbrut im Sonnenlicht wärmte, wie ein Mückenschwarm. Im See befanden sich
folgende Fische: Karpfen, Hechte, Schleie, Barsche Plötze, Rotaugen, Aale und Krebse. Am Sonntagmorgen brachten viele
Rohmaner ihre Pferde zum See um sie zu baden.
Es wurden dort, unter der Aufsicht von Lehrer Dorka, auch viele Jugendfeste mit Theatervorführungen veranstaltet, zu
denen er selbst die Vorlagen organisiert hat. Der am See wohnende Bauer Johann Nadrowski, hat uns ein Scheunentor, als
Tanzboden zur Verfügung gestellt. Der Zimmermann Wilhelm Wittek hat uns eine Windmühle gebaut, die am auf dem Boden
liegenden Scheunentor aufgestellt wurde, dazu kamen Noch Tannen und Fichten, die das Ganze wie ein Bühnenbild
erscheinen ließen. Es wunden viele Bühnenstücke aufgeführt, unter anderen >Alte Weiber werden jung gemahlen<. Dazu bot
die Windmühle die entsprechende Kulisse.
Nach der Vorführung wurde der Boden aufgeräumt, um dann als Tanzdiele zur Verfügung zu stehen. Der Gastwirt Trzaska
hatte Tische und Bänke aufgestellt, Speisen und Getränke angeboten, so dass sich die die Veranstaltung bis in die
späte Nacht hinein zog. Es waren auch Leute aus Ortelsburg und anderen Nachbardörfern dabei. Im Winter hat Lehrer
Dorka eine Kreisrodelbahn eingerichtet, die von Zeit zu Zeit mit Wasser besprengt wurde, um die Gleitfähigkeit zu
verbessern. Von einer Anhöhe ging hinunter bis auf den halben See, was für alle ein großes Vergnügen war. Es kamen
Lehrer mit Schulklassen aus der näheren Umgebung um hier zu Rodeln.
Als Herr Lehrer Jobski als Hauptlehrer nach Rohmanen kam hat er mit dem Bürgermeister und der Gemeindeverwaltung
beschlossen, in der Nähe des Dorfes, auf einem zur Schule gehörenden Grundstück, einen Sportplatz anzulegen. Dafür
wurde gleich hinter den Gärten, 6 Morgen Ackerland abgetrennt, und nach Feierabend hat Lehrer Dorka mit den
Jugendlichen eingeebnet und gleich nebenan einen Graben für Schützenstand und Kugelfang ausgehoben. Am Sonntagvormittag
wurde Fußball gespielt und um 15:00 Uhr war Kleinkalieberschießen angesagt. Es musste auch ein kleiner Beitrag erhoben
werden, um Munition kaufen zu können. Eine Büchse konnten wir aus beim Kleinkalieberverein in Ortelsburg ausleihen.
Nach Hitlers Machtergreifung
Als Adolf Hitler an die Macht kam wurde die SA gegründet. Der Bürgermeister Michael Kownatzki
wurde zum Gruppenführer ernannt und folgende Männer haben sich freiwillig gemeldet: Wilhelm Matzey, Johann Gloddek,
Gustav Nadrowski, August Buttler, Karl Baran, Emil Nickel, Wilhelm Jaschinski, Emil Bork, Ernst Rattay und Gustav Bach.
Bei Versammlungen war die SA in Uniform angetreten um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Wer versucht hat Unruhe zu
stiften, egal aus welchem Grunde, wurde aufgefordert den Saal zu verlassen, andernfalls wurde er mit Gewalt entfernt.
Herr Lehrer Jobski wurde zum politischen Leiter ernannt, seine Frau hat die NS-Frauenschaft gegründet, Lehrer Dorka
die HJ, und so bekam die Dorfgemeinschaft, nach und nach ein anderes Gesicht. Der Sportplatz und der Schützenstand
wurden jetzt mehr als früher in den Mittelpunkt gestellt. Nach der Feldarbeit hat der Bürgermeister Fuhrwerke bestellt
und den Sportplatz noch besser herrichten lassen.
Der Bauer Wilhelm Both wurde zum Ortsbauernführer ernannt, mit der Aufgabe alles Land für den Anbau von Getreide und
Futtermittel bereitzustellen, oder wenn das nicht möglich war mit Wald aufzuforsten. Durch den Einsatz von Kunstdüngern
sollten größere Erträge aus dem Boden geholt werden, um den Viehbestand zu vergrößern und mehr Milch und Butter zu
produzieren. Deutschland sollte im Stande sein sich selbst zu selbst zu ernähren, ohne auf Importe angewiesen zu sein.
Frau Jobski hat, innerhalb der der NS-Frauenschaft, mit Hilfe von Fachkräften aus Ortelsburg, Lehrgänge veranstaltet,
auf denen man Backen und Nähen lernte. Auf den Bauernhöfen befand sich auch immer mehr Rassegeflügel, das eine erhöhte
Produktion von Eiern und Geflügelfleisch sicherstellen sollte.
Die Rohmaner Bauern hatten, außer in der Landwirtschaft, noch andere Verdienstmöglichkeiten in der Kreisstadt. In
Ortelsburg wurden vier Sägewerke betrieben, die mit Langholz aus dem Walde versorgt werden mussten. Wir haben eine
Kiefer von über 8 Festmeter angefahren, der wir zuerst 6 Meter Spitze abschneiden mussten, um diese Last überhaupt
auf den Wagen zu bekommen. Sechs Pferde musste angespannt werden um den Wagen zur befestigten Straße zu bringen.
Fichten und Tannen wuchsen bis zu einer Länge von 30 Metern. Auch beim Transport von Ziegel, von der Ziegelei zum
Bahnhof, konnte man gutes Geld verdienen.
Im Jahr 1934 wurde Rohmanen an das überregionale Stromnetz angeschlossen und schaffte auf diese Weise den Sprung von
der Petroleumlampe zur Glühbirne. Neben dem Grundstück von Karl Pietzonka wurde ein Transformatorhäuschen errichtet,
in dem der ankommende Strom von einer Hochspannung auf eine Verbrauchsspannung transformiert wurde. Es gab schon eine
Überlandleitung, die aus Richtung Ortelsburg kommend, quer über die Felder, in Richtung Neu Keykuth weiter ging.
Durch eine Zwischenspanne wurde der Transformator, mit der Hauptleitung auf Kownatzkis Feld verbunden.
Ein Stromanschluss konnte die Arbeit im Haus und Hof auf vielfältige Weise erleichtern, doch nur die besser gestellten
Bauern, sowie noch manche Pensionäre, die ein festes Einkommen hatten, konnten sich dass leisten. Weil nur wenige an
der Elektrifizierung teilnahmen, war ein Stromanschluss mit hohen Kosten verbunden. Nur Gustav Pietzonka, Gasthof
Trzaska, Friedrich Nickel, die Schule und Wilhelm Both, wurden in der ersten Phase erfasst.
Im Jahr 1952 wurde von den polnischen Behörden die zweite Stufe der Elektrifizierung eingeleitet, in der alle im Dorf
stehen Gebäude erfasst wurden. Am Anfang wurden nur Leitungen für Lichtstrom gelegt und auch nur 3 Lichtstellen pro
Haushalt bewilligt. Doch im nachfolgenden Zeitraum wurden dann, wenn Material vorhanden war, weitere Lichtpunkte
angelegt. 1952, am zweiten Wochenende im Advent, wurden dann die Leitungen geschaltet und alle waren von der
plötzlichen Helligkeit sehr begeistert. Wenn man Glühbirnen auswechseln wollte musste man am Anfang weite Wege
zurücklegen, um welche zu bekommen. In den 60ger Jahren wurden dann immer mehr Starkstromleitungen gelegt, weil die
Bauern elektrische Geräte kaufen konnten. Ende der 60ger wurden auch die Abbauten an das Stromnetz angeschlossen.
Das Urnengrab auf unserem Feld
Auf unserem Feld, in Richtung Seelonken, bin ich oft beim pflügen gegen Steine gestoßen, manchmal
rissen sogar die Stränge am Pferdegeschirr. Eines Tages nahm ich einen Spaten, Brechstange und einen langen Baum, um
der Sache auf den Grund zu gehen. Als ich eine Menge Sand ausgehoben hatte stieß ich auf eine steile, aus Steinen
errichtete Wand, die ich auch mit dem Baum nicht aus der Fassung bringen konnte. Ich habe den ganzen Vormittag gegraben,
konnte jedoch nicht unter die Steine kommen. Einige Tage später hatten wir in der Schule eine Bauernversammlung, da
habe ich Herrn Biella und Herrn Lehrer Dorka von meinem Fund berichtet. Am nächsten Morgen kam der Lehrer Dorka mit der
ganzen Schulklasse, mit Spaten und Sieben ausgerüstet auf unser Feld und fingen an die ausgehobene Erde zu sieben.
Lehrer Dorka benachrichtigte daraufhin den Leiter des Ortelsburger Heimatmuseums, der am nächsten Morgen vorbei kam um
sich die Fundstelle genau anzusehen. Er beauftragte ihn 4 Mann zu besorgen, um die Steine ringsum frei zu schaufeln.
Zwischen den Steinen durften wir die Erde nur mit Esslöffeln ausheben. Als es plötzlich zu regnen anfing hat Lehrer
Dorka die Brauerei Daum, in Ortelsburg angerufen, die uns über der Fundstelle ein Zelt errichtet haben, damit wir
ungestört weiterarbeiten konnten. Wir fanden 8 flache und 8 hohe Urnen zu beiden Seiten am Körper. Die Urnen wurden in
Gipsbinden eingewickelt und ins Heimatmuseum nach Ortelsburg gebracht, wo sie durch einen Fachmann, der extra aus einem
Königsberger Museum angereist war. Nach Reinigung der Urnen hat er festgestellt, das die Grabstätte etwa 2000 Jahre vor
Christi Geburt angelegt wurde und ein Doppelgrab war, in dem ein Toter liegend und einer in Hochstellung beigesetzt
wurde.
Die Nachricht von der Fundstelle verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Es erschienen viele Schaulustige, ganze
Schulklassen aus der Umgebung, mit Autos und zu Fuß. Durch die vielen Menschen wurden die bestellten Ackerflächen auf
unserem Feld sehr in Mitleidenschaft gezogen, eine Entschädigung haben wir nicht erhalten. Das Grab wurde vor dem
Heimatmuseum in Ortelsburg wieder so aufgebaut wie man es auf unserem Feld vorgefunden hat. Für den Transport der
Steine wurde ich entlohnt. Die Urnen hat das Königsberger Museum an sich genommen und wollte sie nicht wieder hergeben,
weil die solch einen Fund noch nicht in ihrer Sammlung hatten.
Sonnenwendfeuer
Am 24 Juni fand eine Sonnenwendfeier statt. Ein Brauch der an die alten Germanen erinnern sollte.
Der Lehrer Dorka hat den Bürgermeister beauftragt 2 Fuhrwerke in den Wald zu schicken, die Holz und alten Reisig holen
und auf dem großen Schulberg abladen sollten. Das Straßenbauamt hat uns Teertonnen zur Verfügung gestellt. Die ganze
Dorfgemeinschaft wurde eingeladen, am Abend, nach der Feldarbeit, an der Sonnenwendfeier teilzunehmen. Lehrer Dorka
hielt zuerst eine Ansprache, in der er anschaulich erklärte wie unsere Vorfahren in grauer Vorzeit gefeiert haben.
Nach dem offiziellen Teil wurden das Holz und die Teertonnen angezündet, es wurden Heimatlieder gesungen, wie: Wild
flutet der See, drauf schaukelt der Schiffer den schwankenden Kahn, Schaum wälzt er wie Schnee, von grausiger Mitte
zum Ufer heran, wild fluten die Wellen auf Vaterlands See, wie schön, oh trag mich auf Spiegel zu Hügel, Masovias See.
Masovia Land, mein Heimatland, Masovia es lebe mein Vaterland.
Lehrer Alfred Dorka und sein Wirken für Rohmanen.

Friedrich Biella hatte auf seinem Feld einen Granitstein mit einer geraden Seite, den haben wir
mit viel Schweiß an den Dorfteich transportiert und auf einer Erhöhung abgelegt. Der Stein sollte zum Denkmahl für die
Gefallenen des Ersten Weltkrieges umgestaltet werden. Da zu Wenige daran ein Interesse zeigten, wurde diese Idee fallen
gelassen und der Stein irgendwann ins Wasser gerollt. Der Lehrer Dorka war viele Jahre in Rohmanen tätig, dort hat er
später seine ehemalige Schülerin, Lotte Biella geheiratet. Er hat sich sehr für die Entwicklung des Dorfes interessiert,
war bei jeder Gemeindeversammlung anwesend und hat auf Schwachstellen hingewiesen die den Fortschritt behinderten.
Gemeinsam mit den Schülern hat er den Ehrenfriedhof für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges gepflegt, an der
Wegegablung nach Eichtal und zu Ehren des Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg eine Eiche gepflanzt.
Zum Advent hat Lehrer Dorka mit der Jugend einen Adventstern, in verschiedenen Farben gebastelt.
Der Stern wurde auf einer 2 Meter langen Stange befestigt, in der Mitte wurde ein Wachslicht angezündet, am Stern
wurde eine Schnur angebracht, wenn man daran zog rollte der Stern hin und her. Am ersten Wochenende im Advent
versammelten sich jung und alt, um den Stern durch das Dorf zu tragen. Alle schlossen sich dem vorausgehenden
Sternträger an, der den Stern durch die Hauptstraße und die angrenzenden Wege trug. Dieser Sternmarsch wurde an den
folgenden Adventwochenenden wiederholt.
Am ersten Weihnachtfeiertag wurde um 4:00 Uhr morgens ein Frühgottesdienst gehalten. Zuerst hat der Pfarrer eine
Andacht gehalten, dann haben die Kinder ein Krippenspiel aufgeführt und die Gemeinde hat schöne Weihnachtslieder
gesungen. Der Gastwirt Trzaska hat uns den Saal zur Verfügung gestellt. Wir hatten eine Posaunen- u. eine
Gitarrengruppe. Unter der Leitung von Herrn Willi Doormann spielten: Gottlieb Brosch, Fritz Ollech,
Gustav Rattay(Sopran), Wilhelm Pilath, Gustav Brosch(Alt), Fritz Both(Tenor) und Fritz Brosch(Bass).
In der Gitarrengruppe wirkten mit: Martha Ollech, Hedwig Ollech, Martha Lekzik, Martha Michalick und Auguste Lekzick.
Willy Doormann hat sie auf der Geige begleitet.
Kurz vor Ausbruch des 2. Weltkrieges
Bei der Aufstellung des Grenzschutzes(Regiment Buchholz), hat er als Hauptfeldwebel die
Gruppenführerkurse überwacht und selbst die fähigsten Männer dafür vorgeschlagen. Das Ausbildungspersonal hat das
Jäger-Battalion gestellt. Wir kamen zuerst ins Stadion(Waldheim), wurden da eingekleidet und dann ging es gleich
kasernenmäßig zu, theoretisch und praktisch. Jeder musste vor die Front treten und nachweisen ob er im Stande ist,
Befehle zu erteilen. Abends wurden Filme vorgeführt die uns zeigen sollten wie eine Gruppe sich im Gelände entfalten
muss. Die Exerziervorschriften hatten sich, im Verhältnis zu Kaiser Wilhelms Zeiten, etwas geändert. Damals bestand
eine Gruppe aus 8 Mann und einem Unteroffizier, jetzt aus 10 Schützen, 3 für das leichte Maschinengewehr und einem
Unteroffizier(13 Mann). Nach der Schulung folgte eine Abschlussprüfung, danach ein gemütliches Beisammensein. Aus
Rohmanen haben folgende Männer die Prüfung bestanden: Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy, Gustav Rattay und
Gustav Deptolla. Unsere Uniformen waren alle zu klein und es gab viel zu lachen bei der Anprobe.
Die erste Übung habe ich mit Emil Rosowski, in Lenzinen gemacht. Der Gutsbesitzer Marzinzick hat seine Scheune als
Unterkunft zur Verfügung gestellt. Er war im Range eines Hauptfeldwebels. In seinem haus war die Schreibstube
untergebracht, die er selbst verwaltete. Ein Lastauto hatte Uniformen aus der Kaserne in Ortelsburg geholt, jeder
musste eine Uniform anlegen und dann wurde solange getauscht bis alle eine passende gefunden hatten. An den Namen des
Kompanieführers kann ich mich nicht mehr erinnern. 1935 wurden wir zu einer Übung in die Dragonerkaserne nach Lyk
einberufen. Die Gruppenführer, Zugführer, und Kompanieführer die schon Frontberührung im dem Ersten Weltkrieg hatten,
mussten eine Woche früher anreisen. Die Übungen waren auf 6 Wochen angelegt. Die meisten der einberufenen waren noch
nie mit dem Wehrdienst in Berührung gekommen. Jeder Gruppenführer bekam 13 Mann zugeteilt.
Unser Zugführer war Leutnant Neumann, Kompanieführer Oberleutnant Rutschko, Battalions-Kommandeur Major Gröning
(Regiment Buchholz). Hier ging es wieder Kasernenmäßig voran. Das Bataillon wurde hier vereidigt. Jeden zweiten
Sonntag durften unsere Frauen uns besuchen. Ein Jahr später wurden wir wieder zu einer Übung einberufen, auf den
Truppenübungsplatz nach Arys. Jeder Gruppenführer hatte den Auftrag die Gruppe zu entfalten, und auf bewegliche
Figuren zu schießen. Diese Übung musste später mit scharfer Munition wiederholt werden. Jedes Maschinengewehr bekam
50 Schuss, jeder Schütze 20 Schuss zugeteilt. Nach dem Abschießen wurden die Treffer gezählt und dem Kommandierenden
Bericht erstattet. In einiger Entfernung spaziert ein Storch umher, der gar nicht bemerkt hatte dass geschossen wurde,
was bei den Kameraden ein großes Gelächter hervorrief.
Nach der Übung wurde uns gesagt das jeder Gruppenführer eine arische Abstammung nachweisen sollte. Ich konnte in den
Rheinsweiner Kirchenbüchern meine Vorfahren aus Gellen, bis zum Jahr 1732 zurück, nachweisen und wurde zum
Unteroffizier befördert. Aus unserem Dorf wurden auch, Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy und Gustav Deptolla
befördert. Zwischendurch mussten wir schon mal in die Radfahrer-Kaserne nach Ortelsburg, Gewehre empfangen und im
Gelände üben. Am 31 Juli 1939 wurde mir von einem Soldaten ein Schreiben übereicht, das mich aufforderte, am 1. August
um 6:00 Uhr, bei der 3. Kompanie, des 2. Infanterieregiments zu erscheinen.
Um 5:30 hat mich meine Schwester in die Kaserne gebracht. Auf der Schreibstube erklärte mir der Hauptfeldwebel,
dass mir ab sofort der Dienstgrad eines Sanitäters zugewiesen wird, ich mich in der Kammer einzukleiden hätte und mir
in der Handwerkerstube die entsprechenden Schulterklappen annähen lassen sollte. Die aktiven Sanitäter wurden den
Feldlazaretten zugewiesen und wir kamen an ihre Stelle. Unser Bataillon wurde nach Schodmak zum Bunker bauen und
Stacheldraht verlegen eingeteilt. Wir zogen in Begleitung einer Musikkapelle bis zur Kreuzung am Krankenhaus, dann
weiter zu unserem Bestimmungsort, gefolgt von einer Gulaschkanone die in den nächsten Tagen für unsere Verpflegung
sorgen sollte.
Am 14 August haben wir die Jägerkaserne, begleitet von einer Musikkapelle endgültig verlassen und zogen zuerst durch
Ortelsburg, dann über Lehmanen ins Feldmanöver, hinter Rohmanen. Dort entfaltete sich das Bataillon im Gelände, die
Verwundetensammelstelle wurde auf dem Hof des Bauern Friedrich Neumann eingerichtet. Gegen Abend wurde zu Sammeln
geblasen und Biwak bezogen, wobei unsere 3.Kompanie, in einem kleinen Wallt, in der Nähe von Otto Nickels Gehöft
Stellung bezogen hatte. Die 2. und 4. Kompanie hatte sich in der Nähe vom Abbau Pallasch niedergelassen. Die Frau
Nickel hat am Abend ein Mädel in Dorf geschickt um meiner Frau Bescheid zu sagen, wo wir uns zurzeit befinden. Meine
Frau ist dann noch gekommen um sich von mir zu verabschieden, weil wir am nächsten Morgen um 3:00 Uhr Zelte abbrechen
und um 4:00 Uhr in Richtung Kaspersguth marschieren sollten.
Wir sind dann über Achodden, Seelonken, Lehmanen, Ortelsburg, bis nach Grammen und Schützendorf marschiert, wo wir an
einem See Biwak bezogen haben. Es wurde immer gesagt, wir kommen zum Tannenberg-Denkmal bei Hohenstein, wo ein Reichs
Kriegervereinsfest stattfinden sollte. Es wurden auch schon Vorkommandos aufgestellt, doch dann kamen wir nach Orlau
und Lahna-Mühle, da wo die Alle entspringt haben wir 2 Tage biwakiert. Unser Kompanieführer hat uns nach Waplitz auf
den Soldatenfriedhof des Ersten Weltkrieges geführt und uns erklärt wie das Jägerbataillon sich 1914 hier entfaltet
hat und aufgerieben wurde. Dann mussten wir in der Nähe von Gut Koslau über einen Fluss und bezogen in einem Waldstück,
vorbereitete Stellungen in der Nähe der polnischen Grenze. Herr und Frau Thalmann haben uns jeden Tag, bis zur Grenze,
mit Brötchen und Getränken versorgt. Es wurde scharfe Munition ausgegeben, weil wir am nächsten Morgen um 4:00 Uhr die
polnische Grenze überschreiten sollten.
Am nächsten Morgen um 10 Minuten vor 4:00 Uhr kam der Befehl; scharfe Munition abgeben, alles zurück in ein 6 Kilometer
entferntes Dorf, wo wir auch einquartiert wurden. Das alles geschah’ eine Woche vor dem 1. September 1939. Es wurde
gesagt dass der Führer dem polnischen Präsidenten Rid-Szmigly, ein Ultimatum gestellt hat und es wahrscheinlich nicht
zum Krieg mit Polen kommt. Genau nach 5 Tagen kehrten wir wieder in die gleichen Stellungen zurück, es wurde wieder
scharfe Munition ausgegeben und am nächsten Morgen um 4:00 Uhr überschritten wir die polnische Grenze.
“Der 2. Weltkrieg.”
Der erste Einsatz in Polen
Wir kamen zuerst in ein Dorf in dem sich nur alte Menschen befanden. Auf unsere Frage wo denn die Bewohner wären sagte
man uns dass alle geflohen sind, weil erzählt wurde, die Deutschen würden alle Polen misshandeln und verstümmeln. Ich
habe ihnen daraufhin gesagt dass uns, unter Androhung von Strafe verboten wurde, einem Zivilisten etwas anzutun. Das
Vieh, die Schweine und Hunde des Dorfes liefen frei herum und die Soldaten fingen an auf die Hunde zu schießen, bis
gesagt wurde es seien Meldehunde im Dienste der Deutschen Wehrmacht und dieser Unfug der eigenen Truppe schaden würde,
weil etwaige Querschläger eigene Kameraden verletzen könnten. Wir gingen weiter auf polnischer Seite entlang der Grenze,
bis wir am Nachmittag die ersten Vorposten der Festung Mlawa erreichten, da befanden wir uns plötzlich im Feuerhagel
polnischer Festungsflack.
Am nächsten Morgen hatte ich schon 3 Verwundete und wusste nicht wo sich eine Verwundeten Sammelstelle befindet. Ich
suchte den Bataillonsgefechtstand auf der sich auf einer Anhöhe befand. Ich habe unseren Oberstabsarzt gefragt wo denn
die Verwundetensammelstelle wäre. Er rief beim Tross an, wo er die Auskunft erhielt, das sich vor dem Dorf ein Bunker
befindet in dem man die Verwundeten sammeln sollte, die dann von Sanitätsautos abgeholt würden, weil das Dorf unter
Artilleriebeschuss stand. Am Sonnabend haben unsere Flieger die Bunkerstellungen bombardiert, konnten aber, trotz guter
Treffer nicht viel ausrichten, die Bunker wurden nur etwas angekratzt.
Der Beschuss unserer vordersten Linien ging mit unverminderter Heftigkeit weiter. Am Sonntag verkündete eine große
Staubwolke die Ankunft unserer Panzer, doch sie kamen nur bis zur Panzersperre und mussten wieder abdrehen ohne den
Polen einen schaden zuzufügen. Ein Panzer bekam einen Volltreffer, der Fahrer konnte noch umkehren. Er blutete am Kopf
und der Schütze war so eingeklemmt, das wir ihn nur mit einem Seil unter den Armen, durch die Luke nach oben ziehen
konnten. Ob er seine Verwundung überlebt hat ist mir nicht bekannt, denn in der Nacht wurden Panzergeschütze nach
vorne in Stellung gebracht, die direkt in die Schießscharten der Bunker geschossen und so die Verteidiger vertrieben
haben. Daraufhin sind wir weiter vorgerückt. Auf einer Wiese war ein tiefer Graben ausgehoben und mit Ästen getarnt,
da war ein Panzer hinein gefahren, so dass nur das Hinterteil herausragte und er sich nicht aus eigner Kraft befreien
konnte. In der Luft waren Flieger die Brandbomben abwarfen, ich habe mich auf den Boden geworfen weil ich dachte die
würden explodieren, aber sie zischten nur, so das Stoppeln und Graß rings herum in Brand gerieten.
Bei den Kampfhandlungen gab es mehrere Verwundete, denen ich gerade Verbände anlegen wollte, als unser Hauptmann zur
Trillerpfeife griff um mir klar zu machen, dass ich ihm folgen sollte. Die Polen fingen an zu schreien, ich sollte
sie ins Lazarett bringen denn hier im Wald würde sie niemand finden. Ich setzte mich aufs Fahrrad und folgte unserem
Kompanieführer, der mir sagte ich soll immer bei der kämpfenden Truppe bleiben, denn hinter der Front sind die
Sanitätsabteilungen, die werden die Verwundeten schon versorgen. Der Vormarsch dauerte bis in die späte Nacht. Auf
einem Gehöft, das nach allen Seiten durch Feldwachen abgesichert wurde, machten wir endlich Rast. Wir haben
Getreidegarben auf dem Hof ausgebreitet und uns zur Ruhe gelegt, als plötzlich um Mitternacht Leuchtraketen den Himmel
erhellten und Maschinengewehrfeuer uns aus dem Schlaf schreckte. Ein par polnische Soldaten hatten das Feuer eröffnet,
aber sich kurz darauf ergeben.
Die Narew-Überquerung
Als es hell wurde ging der Vormarsch weiter. Es wurde uns untersagt Tagebuch zu führen, darum
weiß ich nicht wie die Orte hießen, durch die wir marschiert sind. Als wir durch ein sumpfiges Gelände vor drangen
stand auf einer Anhöhe am Horizont, die polnische Artillerie, die uns sofort unter Beschuss nahm. Unser Hauptmann war
der Meinung dass wir schon in der Nähe des Flusses Narew sein müssten, als aus den Sträuchern ein mit Schlauchboten
beladenes Lastauto auftauchte. Wir wurden aufgefordert mit je 6 Mann ein Schlauchboot zu nehmen, an einem Aggregat
der daneben stand mit Luft zu füllen und zu Wasser zu lassen. In einer Stunde war das ganze Bataillon über die Narew,
wo der Vormarsch fortgesetzt wurde. In einem Dorf überraschte uns die polnische Kavallerie und fing sofort mit
Maschinengewehren zu schießen an. Da kam der Befehl: Alles wieder zurück. Es ging noch schneller als auf der Hinfahrt.
Wir sind erst einige Kilometer am Fluss entlang gegangen und haben dann zum zweiten Mal rüber gesetzt.
Die Gehöfte im Dorf standen alle in Brand. Auf einem waren viele Bienestöcke. 2 Kameraden wollten den Stöcken Waben
entnehmen, doch die Bienen durch das Feuer aufgeschreckt, überfielen sie sofort und stachen derart zu das sie nicht
mehr wieder zu erkennen waren. Ich habe die Einstichstellen mit Salmiak betupft, mehr konnte ich nicht tun. Wir mussten
auf unserem Vormarsch durch einen Wald der in Flammen stand, so dass man kaum atmen konnte. Es ging weiter in Richtung
Minsk und Warschau, wo schon die Sowjetische Armee durchgegangen war, die Pferde und Vieh von einem Gut mitgenommen
hatten. In einem Wald stießen wir unverhofft auf ein Kloster, in dem wir einige Gefangene machten. Dann trafen wir auf
eine gute Straße die nach Grochow ging.
Als wir dort einmarschierten wurden wir aus den oberen Stockwerken beschossen, so dass wir, um uns zu schützen, nur an
den Hauswänden entlang gehen konnten. Wir haben jedes Haus nach Feinden durchsucht. Vor einem Haus stand ein Hund der
niemanden reinlassen wollte, solange bis ihn eine Kugel traf. Die polnische Artillerie feuerte von Warschau aus, um
unseren Vormarsch zu stoppen. Wir hatten uns gerade eingegraben als plötzlich deutsche Flieger am Himmel erschienen,
die unsere Stellungen mit Bomben bewarfen und dabei viel Unheil anrichteten. Wir haben sofort Fliegertücher
ausgebreitet und Leuchtraketen abgeschossen. Da ich in dem Graben, den ich kurz zuvor ausgehoben hatte, sofort in
Deckung gegangen bin ist mir zum Glück nichts passiert. Unter den anderen Kameraden gab es viele Verwundete, so dass
ich nicht wusste wem ich zuerst helfen sollte.
Der Oberstabsarzt hat mich sofort tatkräftig unterstützt, so das bald alle Verwundeten versorgt waren, außer einem,
dem ein Bombensplitter den Arm abgerissen hat. Ich habe im 3 große Verbandspäckchen auf die Wunde gelegt, doch die
Blutung ließ sich trotzdem nicht stoppen, so dass er eine Stunde später auf der Krankensammelstelle verstarb. Wir
haben danach in einem Tomatenfeld einen Graben ausgehoben und eine neue Abwehrstellung bezogen. Die Gruppe Schwarz
bekam den Auftrag nach etwaigen versprengten polnischen Verbänden Ausschau zu halten, als sie unerwartet aus einer
Häuserreihe mit Maschinengewehrsalven überschüttet wurden. Der Gruppenführer und noch ein Soldat wurden dabei tödlich
verwundet. Danach wurde noch ein weiter Stoßtrupp, unter der Führung von Leutnant Briskorn, der sich dazu freiwillig
gemeldet hatte, hinaus geschickt um den Gruppenführer und den anderen Toten zu bergen.
Bei diesem Unternehmen, das erfolglos ausging, weil die Toten schon verscharrt waren, durchschlug eine Kugel den
Stahlhelm von Leutnant Briskorn, der auch sofort tot war. Alle Toten wurden später, an der Kirchenmauer in Grochow, in
Särgen beigesetzt: Hauptmann Schönwald sagte, das sie nach dem Kriege auf den Heldenfriedhof nach Ortelsburg überführt
werden. Drei Tage lagen wir bei Grochow in Stellungen, waren dem polnischen Maschinengewehrfeuer sowie den Bomben
deutscher Flugzeuge ausgesetzt. In der Nacht musste ich zu einem Verwundeten in die vorderste Linie und habe den
Rückweg nicht mehr finden können, als plötzlich Gewehrfeuer aufflammte habe ich in den Ruinen Schutz gesucht. Erst im
Morgengrauen konnte ich mich wieder orientieren und zu meinem Unterstand zurückfinden.
Warschau wurde tagelang bombardiert und stand auch unter Artilleriebeschuss. Aus dunklen Rauchwolken kamen oft ganze
Bündel von Papier angeflogen. Die Verwundeten kamen oft auf Krücken zu unserem Unterstand, ich habe sie dann zur
Krankensammelstelle hingeführt. Wir haben auch polnische Zivilpersonen betreut, die während der Kampfhandlungen
verwundet wurden. Als einmal 2 Jungen vorbeiliefen hat einer ihnen nachgerufen sie sollten seiner Frau Bescheid sagen,
er wäre auf der Krankensammelstelle an der Kirche. Als wir dort ankamen war seine Frau, mit einem Kind auf dem Arm,
schon da.
Nach der Kapitulation von Warschau, gingen wir über Sokolow zum Bug und haben dort Quartier bezogen. Der Russe hatte
sich bereits hinter den Fluss zurückgezogen, hatte alles Vieh und Pferde mitgenommen. Dort erreichte mich ein Telegramm
von zu Hause, dass meine Tochter gestorben ist. Es sprach sich auch herum dass verschiedene Heimaturlaub bekommen haben,
ich durfte auch für 14 Tage heim. Wir fuhren mit Lastautos nach Allenstein in die neue Reiterkaserne, zum
Ersatzbatallion, da haben wir unsere Gewehre und Munition abgeben, dann durften wir, jeder in seinen Heimatort
weiterfahren.
Als wir unsere Quartiere am Bug verlassen haben war sehr viel Schnee gefallen. Hier in Ortelsburg fanden wir die
gleiche Wetterlage vor, aber nach 3 Tagen war alles wieder weggetaut und wir konnten die Kartoffelernte, die durch den
frühen Wintereinbruch gestoppt wurde, zu Ende bringen. Ein Tag bevor ich zu Hause angekommen bin wurde die Tochter
beerdigt. Nach 14 Tagen mussten wir uns in Allenstein melden, Gewehre empfangen und wieder zurück zur Division an den
Bug 150 Kilometer hinter Warschau. Die elfte Division, zu der wir auch gehörten sollte in den Westen Deutschlands
verlegt werden und war schon unterwegs zur Verladestation Skiernewice 50 Kilometer vor Warschau.
Mein Dienst als Sanitätsunteroffizier
Unser Bataillon kam in das Städtchen Burscheid, im Kreis Opladen, wo wir in Privatquartieren
untergebracht wurden. Nach 3 Monaten, im Januar 1940, wurden wir nach Solingen verlegt, wo wir bis zum
Frankreichfeldzug stationiert waren. Wir mussten an Feldübungen teilnehmen, wie andere die in Kasernen untergebracht
waren. Während dieser Zeit musste jeder seine Zähne in Ordnung bringen lassen. Jeden Tag fuhren 20 Mann in die
Cäzilienstraße nach Köln, zur Zahnklinik. Im Rheinland wurde unsere Division neu aufgestellt. Ausfälle durch den
Polenfeldzug wurden durch neue Soldaten ergänzt. Ich kam nun zum Ersatzbatallion, war der Älteste in der ganzen
Kompanie. Als der Frankreichfeldzug losging wurde unser Ersatzbatallion mit den noch vorhandenen Verwundeten, in die
neue Reiterkaserne, nach Allenstein verlegt.
Meine Frau hat, mit Unterstützung der Bauernschaft, einen Antrag gestellt, daraufhin wurde ich zur Frühjahrsbestellung,
beurlaubt und später bis auf weiteres vom Militärdienst freigestellt. Als der Russlandfeldzug losging wurde ich von der
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg, für 14 Tage einberufen. Ich war seit 1922, Mitglied der freiwilligen
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg und habe jedes Jahr an Übungen teilgenommen. Jede Bereitschaft musste etliche Leute
stellen. Von Rohmanen wurden Emil Rosowski, Johann Dembek, und ich, zur Krankensammelstelle Wirballen, in Litauen,
abkommandiert. Dorthin kamen Lazarettzüge aus Russland mit der Breitspurbahn. Die Verwundeten wurden frisch verbunden
und auf Waggon mit Normalspur verladen und nach Deutschland gebracht.
Als die 14 Tage vergangen waren wollten wir wieder nach Haus zurück, doch man wollte uns nicht entlassen. Stattdessen
wurden wir dem Wehrkreisamt Königsberg zugeteilt, neu eingekleidet und zur Aushilfe ins Lazarett nach Gumbinnen
abkommandiert. Mehr als ein Jahr war ich in den Urlauber-Baracken, habe dort Krankenstube betreut. Später, bis zum
Dezember 1944, war ich im Reserve-Lazarett 4, in Königsberg tätig. Dort habe ich auch die Luftangriffe der Engländer,
vom 25 bis 26. August 1944 miterlebt.
Wir sollten gerade einen Lazarettzug in Rotenstein entladen, als plötzlich die Sirenen ertönten - Fliegeralarm. Im
gleichen Moment waren die ersten Flugzeuge auch schon da, zuerst warfen sie „Tannenbäume” und danach Foßforkanister ab.
Die Omnibusse standen schon zur Abfahrt bereit als es losging. Wir haben die Verwundeten schnell in den
Luftschutzkeller getragen, haben die Betten von den Fenstern weggerückt damit die Verwundeten nicht von den
Glasssplittern verletzt wurden. Im Kasernenhof brannten die Fosforkanister lichterloh. Unsere Unterkunft, die sich in
einer Baracke befand ist völlig abgebrannt, mit dem Wenigen was wir unser Eigen nannten. Am nächsten Tag wurden wir neu
eingekleidet und am 29. bis 30. kamen die englischen Bomber wieder, sie setzten genau da ihr Zerstörungswerk fort wo
sie vor 3 Tagen aufgehört hatten.
Anfang Dezember 1944 musste ich mich nach Stablack melden und musste dann zur Sanitätsabteilung 1, nach Gernau, das
liegt zwischen Lodz und Warschau. Vormittags hatten wir Felddienstübungen und nachmittags theoretischen Unterricht.
Jeden Tag wurden Gruppen zusammengestellt und zu anderen Einheiten abkommandiert. Ich kam zu einer Panzerabteilung, wo
wir an einem Morgen plötzlich auf dem Kasernenhof antreten mussten und zu unserer Überraschung mit der Nachricht
konfrontiert wurden, dass der Russe an mehreren Frontabschnitten durchgebrochen war. Wir bekamen sofort einen
Marschbefehl in Richtung Lodz, wo das Stadtbild noch intakt war, selbst die Straßenbahnen fuhren noch. In der Nacht
haben russische Flugzeuge die Stadt bombardiert. Die Kaserne in der wir untergebracht waren hatte keine
Luftschutzkeller, aber zum Glück blieben wir von Bombentreffern verschont. Am nächsten morgen bot sich uns ein Bild der
Verwüstung. Die entgleisten Straßenbahnwagen, sowie andere Fahrzeuge blockierten die Straßen. Die Älteren unter uns
bekamen Fahrscheine für einen Transportzug, der bereit hinter Lodz abfahrbereit, unter Dampf stehen sollte. Als
russische Panzer in den Straßen auftauchten, verbrannte die Schreibstube unsere Wehrpässe und andere wichtige
Dokumente. Wir liefen zu der Station auf der unser Transportzug bereitstehen sollte, aber da war kein Zug mehr zu sehen
und wir setzten unseren Rückzug zu Fuß fort.
Der Rückzug und Zusammenbruch der Ostfront
In Dobroschin, einer Stadt in Polen, wurde gerade ein Lazarettzug verladen, doch wir kamen nicht
mehr zum Einsatz, weil die russische Infanterie uns schon auf den Fersen war. Es ging weiter über den Fluss Bober,
Sagan, bis nach Glogau an der Oder. Dort wurden wir der 29. motorisierten Sanitätskompanie zugeteilt. Im
Garnisonslazarett wurden noch Operationen durchgeführt. Unsere Division hatte ihr eigenes Feldlazarett, so dass wir den
Befehl zu Weiterfahrt erhielten und noch unbeschadet die Oderbrücke passieren konnten, denn Glogau wurde zur Festung
erklärt. Wir haben 2 Pferdewagen organisiert und mit Verbänden, sowie medizinischen Instrumenten beladen. So kamen wir
bis nach Lübbenau im Spreewald, wo wir in einem Schloss, in zuvor ein Museum war, unser Lazarett untergebracht haben.
Weil die Amerikaner Cottbus bombardiert hatten, wurden die Verwundeten zu uns nach Lübbenau gebracht. Hier haben wir
Tag und Nacht gearbeitet, um die vielen Verwundeten, aus den schweren Kämpfen bei Grünberg und Sagan zu versorgen. Die
Soldaten von der Abwehrfront kamen schon mit abgestorbenen Armen oder Beinen bei uns an, weil in vorderster Linie keine
Frontlazarette mehr vorhanden waren; es mussten viele Amputationen durchgeführt werden. Als für unsere Pferde kein Heu
mehr vorhanden war, schickte mich unser Hauptfeldwebel, zu einem Bauern in den Spreewald, mit dem Auftrag, Futter zu
besorgen. Mit noch zwei Mann fuhren mit zwei Kähnen, zuerst den Hauptstrom entlang und dann in einen Nebenarm; da haben
wir die Boote beladen und brachten das Heu nach Lübbenau.
Als wir uns bei unser Einheit zurück melden wollten, war alles schon marschbereit. Ich bin schnell in einen Bus
eingestiegen der sofort losfuhr, weil russische Verbände schon in sichtweite waren. Russische Flugzeuge kreisten über
den Dächern und nahmen, mit ihren Bordwaffen jeden unter Beschuss, der sich irgendwo blicken ließ. Wir konnten nur
durch den Wald, oder in der Nacht vorwärts kommen, denn wenn ein Auto auf der Landstraße fuhr, war alsbald ein Flugzeug
hinter ihm her und schoss es in Brand. Als wir nach Tagen am Ufer der Elbe ankamen, war bereits eine Ponton-Brücke
erstellt worden, welche die zerstörte Brücke ersetzen sollte.
Durch die vielen Fahrzeuge waren in den Sand tiefe Spuren gefahren, so dass andere Fahrzeuge unsere Busse ins
Schlepptau nehmen mussten, weil wir mit eigener Kraft nicht mehr weiterkamen. Beiderseits der Trasse standen
Flüchtlingswagen, in der der Hoffnung die Brücke passieren zu können, doch SS-Polizei verhinderte das die Gespanne den
militärischen Rückzug zum Stillstand brachten. Es gelang uns die Elbe zu überqueren, um in einem Waldstück Schutz vor
feindlichen Fliegern zu suchen.
Als wir unsere Busse und Autos gut getarnt hatten, hat unser Bataillonschef die anwesenden Parteigrößen zu sich
gerufen und ihnen erklärt das wir eine Einheit des Roten Kreuzes sind und nach internationalem Recht keine Waffen
besitzen dürfen. Nach langer, erregter Diskussion wurde beschlossen einen Graben auszuheben und alles im Sand zu
verscharren. Als wir dann weiter, durch die Dörfer fuhren, sahen wir schon viele weiße Bettlaken, als Zeichen der
Kapitulation, aus den Fenstern hängen. Es wurde uns erzählt dass der Bürgermeister von der SS erschossen wurde, weil
er die Bevölkerung zu diesem Schritt ermutigt hatte. Jetzt waren hinter uns die Russen und vor uns schon die Amerikaner.
Amerikanische Panzer fuhren umher und schossen wild durch die Gegend, ohne ein Ziel anzuvisieren. Niemand wollte sich
dem Russen ergeben, doch der Weg der zu den Amerikanern führte, war durch abgesägte Bäume blockiert. Wir sind schnell
in das nächste Dorf gegangen, haben uns Sägen und Äxte besorgt, die Bäume durchgesägt und in den Straßengraben
geworfen.
“ Nach dem Ende des 2. Weltkrieges.”
In amerikanische Kriegsgefangenschaft
Dann fuhren wir unter internationaler Flagge an eine Mulde Brücke, vor der zwei amerikanische Soldaten, mit Zigarren,
zur Hälfte im Mund, standen. Sie rauchten und kauten gleichzeitig. Wir mussten auf einen freien Platz fahren, alle
aussteigen und rechts wieder antreten. Wäschebeutel und Tornister mussten wir abstellen; danach wurden wir nach Waffen
durchsucht, Wertsachen, Uhren und Messer wurden uns gleich abgenommen. Als wir anschließend an unserem Gepäck
vorbeigingen durfte niemand was mitnehmen. Als ich gebückt, nach meinem Wäschebeutel greifen wollte, in dem sich noch
3 Konservendosen und ein Brot befanden, bekam ich einen Fußtritt ins Gesicht, so dass mir ein Zahn ausgeschlagen wurde.
Wir wurden dann in einem Garten zusammen getrieben und gefragt ob jemand bei der SS gedient hat. Nachdem wir in Reihe
und Glied angetreten waren, mussten wir den Oberkörper freimachen und die Arme anheben. Es wurde nach SS-Zeichen
gesucht, die gewöhnlich unter dem Oberarm eintätowiert waren. Nachdem wir Grimma bei Leipzig, wo wir in amerikanische
Gefangenschaft geraten waren, verlassen hatten, mussten wir durch ganz Thüringen bis Hersfeld, an der Grenze zu Hessen,
marschieren. In Hersfeld wurden wir auf große Lastautos verladen, die von farbigen Soldaten gefahren wurden. Man hat
uns mit Stöcken hinauf getrieben, solange bis das Auto so voll war das man kaum stehen konnte. Die Soldaten fuhren, für
diese Straßenverhältnisse, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Wenn die Straße eine scharfe Kurve hatte, flogen
wir alle übereinander und mussten erst mit viel Kraftanstrengung auf die Beine kommen um diese Fahrt zu überstehen.
Da die Straßenränder in dieser Gegend mit Obstbäumen bepflanzt sind und deren Äste sehr niedrig hängen, hätten die
uns die Köpfe abgerissen, wenn wir uns nicht ständig geduckt hätten. Unsere Fahrt endete in Bad Kreuznach, in der Pfalz,
wo wir in ein Lager, in dem sich später 130.000 Mann und 6 Generäle befanden, eingepfercht wurden. Die Unterkunft der
Generäle befand sich unter einem Zelt, alle anderen mussten die Zeit unter freiem Himmel zubringen. Die Offiziere, die
Unteroffiziere, die Mannschaften; wurden in getrennten Camps untergebracht. Die Mannschaften wurden auch zur Arbeit
abkommandiert und konnten bei dieser Gelegenheit, Brot, Brötchen oder Zigarettenstummel organisieren, wogegen die
Offiziere und Unteroffiziere ihr Camp überhaupt nicht verlassen durften.
Die ersten Tage gab es kein Wasser und kein Brot, so dass die Kameraden vor Erschöpfung umfielen. Später standen wir
manchmal den ganzen Tag nach Wasser an, das von den, uns bewachenden Negern mit großen Wassertanks angefahren wurde. Am
dritten Tag bekamen wir mittags und abends etwas zu Essen; Brot bekamen wir erst nach zwei Wochen, nach dem aus der
Umgebung herbeigeholte Handwerker, Backöfen gebaut hatten. In den verschiedenen Gemeinden, die in den uns umgebenden
Weinbergen lagen, mussten sich alle Männer beim Bürgermeister melden. Als sie dann erschienen waren, wurden sie auf
bereitstehende Lastautos getrieben und zu uns ins Lager gebracht. Sie waren ohne Kopfbedeckung und ohne wärmere
Bekleidung angekommen, weil ihnen gesagt wurde, dass ihr Aufenthalt im Lager nur von kurzer Dauer sein würde. Man hat
uns, falls noch vorhanden, Decken und Mäntel abgenommen, mit der Begründung, sie würden für Kranke und Verwundete
gebraucht. Jeden Tag starben mehr als 200 Mann, die wir sofort in ein Zelt tragen mussten. In der Nacht wurden die
Toten dann mit unbekanntem Ziel, weggefahren.
Viele haben ihren Verstand verloren uns irrten im ganzen Camp ziellos umher. Als Latrinen wurden Gräben ausgehoben, in
die verschiedene Kameraden, bei der Verrichtung ihrer Notdurft, vor Schwäche hineingefallen sind und nicht mehr wieder
heraus kamen. Aus den Pfählen die, die jungen Obstbäume stützten, haben wir Krankentragen gebaut um unsere Kameraden,
bei Bedarf, zur Krankensammelstelle zu tragen. Es war in diesem Frühjahr auch sehr kalt, doch unsere Erdlöcher, die wir
zum Schutz vor Kälte und Wind, nur mit leeren Konservendosen ausgehoben hatten, durften nicht tiefer als 20 Zentimeter
sein. Nach jedem Regenguss mussten wir das Wasser ausschöpfen. Nach einem Gewitter, standen wir wiedermal, total
durchnässt in unserem Camp, als unerwartet am Horizont die Sonne hervortrat. Einer unserer Kameraden hatte noch eine
Trompete gerettet und fing, von dem Anblick völlig überwältigt, zu spielen an: "Es geht alles vorüber, es geht alles
vorbei, nach jedem Dezember, folgt wieder ein Mai". Daraufhin hob sich die Stimmung der tiefbetrübten Kriegsgefangenen,
so das Heimatlieder durch das ganze Camp erklangen, obwohl wir in den nassen Kleider herumgehen mussten, bis sie am
Körper trocken wurden.

Nach dem ersten Weltkrieg hat der Gastwirt Friedrich Trzaska neben dem Gasthof einen großen Saal
für Festlichkeiten und Vereinsfeiern gebaut, in dem schon mal Feuerwehrfeste veranstaltet wurden. Ernst Trzaska war
Feuerkommissar bei der Ostpreußischen Feuersozität. Erich Trzaska war Vollziehungsbeamter beim Amtsgericht in
Ortelsburg. Unser Feuerkommissar war uns beim organisieren der Veranstaltungen sehr behilflich, hat uns den Saal, die
Musik und die Theaterstücke besorgt und die Feuerwehren aus den Nachbardörfern eingeladen.
Zu Manöverzeiten, vor dem 2. Weltkrieg und dann auch während des Krieges, waren im Gasthof Soldaten, meist im Range
eines Offiziers, einquartiert. Fräulein Mariechen Trzaska hat die Poststelle im Dorf betreut. Nachdem ich 1939 zum
Militär eingezogen wurde, hat sie, nach einer Schulung im Ortelsburger Krankenhaus, auch die Unfallmeldestelle
übernommen. Nach dem Krieg, pflegte sie mit vielen Bekannten, die bereits in der Bundesrepublik wohnten, einen regen
Briefwechsel. Auf dem Rohmaner Friedhof hat sie viele Gräber, im Auftrag von Angehörigen, die auf Grund ihrer
Abwesenheit, dazu nicht mehr in der Lage waren, gepflegt. Der Bauunternehmer Kurnitzki aus Ortelsburg, äußerte die
Bitte, sie möchte ihm doch ein Blatt vom Rosenstrauch, der auf dem Grab seiner Eltern steht, in den Brief legen. Als
sie uns den Brief vorgelesen hat, waren wir zu Tränen Gerührt. Sie hat als Letzte aus ihrer Familie, bis zu ihrem Tod
im Jahre 1960, in Rohmanen, im Gebäude der Gastwirtschaft gewohnt und ist auf dem Rohmaner Friedhof beerdigt worden.
Fleisch und Wurstwaren Karl Pelkowski
Im Jahr 1931 hat der Fleischermeister Karl Pelkowski, aus Grammen, direkt neben unserem Hof ein
Anwesen gekauft und dort eine Fleischerei eingerichtet. Er war mit meiner Schwester Frieda, verheiratet. Am Anfang hat
er die Schweine noch auf seinem Hof geschlachtet, später dann im Ortelsburger Schlachthof. Jede Woche fuhr er 2-mal,
mit dem Pferdewagen(Einspänner), nach Ortelsburg zum Wochenmarkt, wo er seine Fleisch und Wurstwaren zu Verkauf anbot.
Am Tag davor, wenn er die Wurst gekocht hat, kamen viele Rohmaner mit Kannen oder anderen Gefäßen, wegen der guten
Wurstsuppe, die er umsonst unter die Leute verteilte. Als Karl Pelkowski, Ende August 1939 zum Militär eingezogen
wurde, hat seine Frau das Pferd verkauft und den Beitrieb stillgelegt. Am Haus hing, immer noch die Tafel mit der
Aufschrift: Karl Pelkowski, Fleisch und Wurstwaren. Ein Witzbold hat irgendwann darunter geschrieben; „Fleisch und
Wurst waren einmal”, drauf hin hat Frau Pelkowski die Tafel entfernen lassen. Karl Pelkowski ist im Mai 1946 in
französischer Gefangenschaft verstorben. Seine Ehefrau Frieda, verstarb an ihrem 85. Geburtstag in Mettmann bei
Düsseldorf.
Die steinreichen Rohmaner Felder
Die letzte Eiszeit hat bei der Schmelze, auf der Rohmaner Feldgemarkung viele Steine und
Granitblöcke zurück gelassen. Überirdisch, aber besonders unter der Erde, gab es viele kleine, aber auch große Steine,
die, den Bauern, beim Pflügen und anderen Feldarbeiten sehr viel Schweiß, abverlangten. In einer Kiesgrube, auf dem
Feld des Bauern August Radek, lag ein Granitblock, von schätzungsweise 100 cbm. Vor etwa 80 Jahren, als man für diese
Steine noch keine Verwendung hatte, griffen die Bauern zu einer „List”. Weil er sonst nicht pflügen konnte, hat mancher
seinem Nachbarn, die Steine in der Nacht auf dessen Feld abgeladen. Als diese Tätigkeit unter Strafe gestellt wurde,
hat man die Steine in Schluchten gekippt und mit Mutterboden zugeschüttet. In späteren Jahren kam diese jedoch beim
pflügen wieder an die Oberfläche. Dann hat man aber schon Steine für den Straßenbau gebraucht und konnte sie so zu Geld
machen. Besonders im Raum südlich von Ortelsburg, bis zur polnischen Grenze, wo Steine eine Rarität waren, kamen sie
jetzt zum Einsatz. Auch beim Bau von Häusern, besonders für die Fundamente, wurden sie eingesetzt, weil auf diese
Weise viel Ziegeln eingespart wurden. Die Firma Gribienski aus Ortelsburg hat die großen Steine mit Dynamit gesprengt
und auf diese Weise die weitere Verarbeitung erleichtert.
Die Steine welche beim Pflügen aus dem Boden geholt wurden, hat man am Feldrand auf große Haufen zusammen getragen.
Wenn die Feldarbeit beendet war, sowie auch in den Wintermonaten, waren wir jeden Tag mit Steinen unterwegs. Wir sind
vorwiegend am Abend los gefahren, weil unter der schweren Last die Wagenachsen so heiß wurden und die Gefahr bestand,
das durch die Dehnung, die Räder blockiert würden. Bei einer Fahrt konnte man bis zu 24 Reichsmark verdienen, wogegen
1 Zentner Roggen für 8 bis 9 Reichsmark zu haben war. Ich bin selbst, mit dem Pferdewagen bis Fürstenwalde, Radostowen,
Luka, Altkirchen, Höhenwerder, ja sogar bis Friedrichshof gefahren.
In Rohmanen wurden auch rote Ziegeln gebrannt. Viele Häuser wurden, mit Ziegeln erbaut, die nur wenige 100 Meter von
der Baustelle entfernt hergestellt wurden. Der Lehn wurde auf den Feldern in der näheren Umgebung entnommen, dann von
Ochsen solange getreten, bis er so geschmeidig war, das er sich in Formen einstreichen ließ. Wenn die Ziegel in der
Form trocken war, wurde sie entnommen und in einem Brennofen gestapelt. Um einen Ofen richtig anzufeuern, brauchte man
12 Raummeter Holz, das im Zeitraum von ein par Tagen verheizt wurde. Der Fischer Karl Glitza hatte schon eine
Knetmaschine, die von einem Pferd angetrieben wurde, das mit verbundenen Augen, den ganzen Tag in die Runde ging.
Im Dorf waren auch vier Kalköfen, in denen so genannte Kalksteine, die sich an gewissen Stellen, im Erdboden befanden,
gebrannt wurden. Nach dem Brennen wurden die Steine mit Wasser abgelöscht und die daraus entstandne Masse diente, nach
dem Beimischen einer gewissen Menge Sand, dann als Bindemittel beim Häuserbau. Das Gerichtsgebäude und das
Lehrerseminar in Ortelsburg wurden mit Kalk, aus dem Rohmaner Brennöfen erbaut. Auch zum Bau einer Eisenbahnbrücke, auf
der, der Zug, den Sawitzfluß, von Ortelsburg nach Allenstein überquerte, hat mein Großvater, mit einem Ochsengespann,
Kalk gefahren.
Hinter der Scheune, beim Bauern Johann Dembek hat man Tonerde gefördert, aus der man mit Hilfe einer Formerscheibe,
die von einem Arbeiter mit Muskelkraft(Fußbetrieb) angetrieben wurde, schöne Krüge, Schalen und Vasen geformt hat.
Die Töpferware wurde, nachdem sie trocken genug war, auch in einem Ofen gebrannt, anschließend mit einer Lasur
überzogen und wieder gebrannt. Es wurden auch Kacheln zum Bau von Kachelöfen hergestellt, die mit verschiedenen
Ornamenten versehen, die Wohnstuben unserer Vorfahren schmückten. So haben unsere Großväter ihr Leben gemeistert und
nach und nach, unsere Dörfer aus der Rückständigkeit in die Neuzeit geführt.
Das gesellschaftliche Leben nach dem 1. Weltkrieg

Als der Lehrer Alfred Dorka, ein Frontkämpfer des Ersten Weltkrieges und ein Sportsmann, als
zweite Lehrkraft an der Rohmaner Schule angestellt wurde, hat er die Sitten und Gebräuche aus früherer Zeit wieder zum
Leben erweckt. Zuerst hat er die Jugend zusammen gerufen, einen Jugendverein und einen Fußballclub, gegründet. Zum
Vorsitzenden des Fußballclubs wurde Johann Gloddek berufen, der ihn auch geleitet hat. Bauer Wilhelm Spittka, der am
Rohmaner See wohnte, stellte Land für einen Sportplatz unentgeltlich zur Verfügung. Lehrer Alfred Dorka hat am
Rohmaner See eine Badestelle ausgesucht und ein Sprungbrett bauen lassen. An jedem Sonnabend im Sommer, bevor die
Sonne unterging, versammelte sich die gestammte Jugend des Dorfes an der Badestelle am See. Es wurde gebadet,
Heimatlieder gesungen, gespielt, im Fackelschein eines großen Biwakfeuers, bis in die späte Nacht hinein. Der Fischer
Karl Glitza hat uns Kähne zur Verfügung gestellt, mit denen wir auf den See hinausgepaddelt sind, dabei hatten wir viel
Spaß, was wiederum den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft gefördert hat. Ich habe mit meiner Mandoline den Gesang von
Volks- und Heimatliedern begleitet.
Der Rohmaner See liegt in einem Tal, dessen Hänge zu beiden Seiten mit Kiefern und Tannen bewaldet sind. Wenn man
gesungen oder Musiziert hat, hallte es von den Hängen zurück. Die Ufer waren mit Kalmus und Schilf bewachsen, was für
die Fischaufzucht von Vorteil war. Wenn man an einem sonnigen, windstillen Tag, am Seeufer spazieren ging, traf man
oft auf Flachstellen, an denen sich die Fischbrut im Sonnenlicht wärmte, wie ein Mückenschwarm. Im See befanden sich
folgende Fische: Karpfen, Hechte, Schleie, Barsche Plötze, Rotaugen, Aale und Krebse. Am Sonntagmorgen brachten viele
Rohmaner ihre Pferde zum See um sie zu baden.
Es wurden dort, unter der Aufsicht von Lehrer Dorka, auch viele Jugendfeste mit Theatervorführungen veranstaltet, zu
denen er selbst die Vorlagen organisiert hat. Der am See wohnende Bauer Johann Nadrowski, hat uns ein Scheunentor, als
Tanzboden zur Verfügung gestellt. Der Zimmermann Wilhelm Wittek hat uns eine Windmühle gebaut, die am auf dem Boden
liegenden Scheunentor aufgestellt wurde, dazu kamen Noch Tannen und Fichten, die das Ganze wie ein Bühnenbild
erscheinen ließen. Es wunden viele Bühnenstücke aufgeführt, unter anderen >Alte Weiber werden jung gemahlen<. Dazu bot
die Windmühle die entsprechende Kulisse.
Nach der Vorführung wurde der Boden aufgeräumt, um dann als Tanzdiele zur Verfügung zu stehen. Der Gastwirt Trzaska
hatte Tische und Bänke aufgestellt, Speisen und Getränke angeboten, so dass sich die die Veranstaltung bis in die
späte Nacht hinein zog. Es waren auch Leute aus Ortelsburg und anderen Nachbardörfern dabei. Im Winter hat Lehrer
Dorka eine Kreisrodelbahn eingerichtet, die von Zeit zu Zeit mit Wasser besprengt wurde, um die Gleitfähigkeit zu
verbessern. Von einer Anhöhe ging hinunter bis auf den halben See, was für alle ein großes Vergnügen war. Es kamen
Lehrer mit Schulklassen aus der näheren Umgebung um hier zu Rodeln.
Als Herr Lehrer Jobski als Hauptlehrer nach Rohmanen kam hat er mit dem Bürgermeister und der Gemeindeverwaltung
beschlossen, in der Nähe des Dorfes, auf einem zur Schule gehörenden Grundstück, einen Sportplatz anzulegen. Dafür
wurde gleich hinter den Gärten, 6 Morgen Ackerland abgetrennt, und nach Feierabend hat Lehrer Dorka mit den
Jugendlichen eingeebnet und gleich nebenan einen Graben für Schützenstand und Kugelfang ausgehoben. Am Sonntagvormittag
wurde Fußball gespielt und um 15:00 Uhr war Kleinkalieberschießen angesagt. Es musste auch ein kleiner Beitrag erhoben
werden, um Munition kaufen zu können. Eine Büchse konnten wir aus beim Kleinkalieberverein in Ortelsburg ausleihen.
Nach Hitlers Machtergreifung
Als Adolf Hitler an die Macht kam wurde die SA gegründet. Der Bürgermeister Michael Kownatzki
wurde zum Gruppenführer ernannt und folgende Männer haben sich freiwillig gemeldet: Wilhelm Matzey, Johann Gloddek,
Gustav Nadrowski, August Buttler, Karl Baran, Emil Nickel, Wilhelm Jaschinski, Emil Bork, Ernst Rattay und Gustav Bach.
Bei Versammlungen war die SA in Uniform angetreten um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Wer versucht hat Unruhe zu
stiften, egal aus welchem Grunde, wurde aufgefordert den Saal zu verlassen, andernfalls wurde er mit Gewalt entfernt.
Herr Lehrer Jobski wurde zum politischen Leiter ernannt, seine Frau hat die NS-Frauenschaft gegründet, Lehrer Dorka
die HJ, und so bekam die Dorfgemeinschaft, nach und nach ein anderes Gesicht. Der Sportplatz und der Schützenstand
wurden jetzt mehr als früher in den Mittelpunkt gestellt. Nach der Feldarbeit hat der Bürgermeister Fuhrwerke bestellt
und den Sportplatz noch besser herrichten lassen.
Der Bauer Wilhelm Both wurde zum Ortsbauernführer ernannt, mit der Aufgabe alles Land für den Anbau von Getreide und
Futtermittel bereitzustellen, oder wenn das nicht möglich war mit Wald aufzuforsten. Durch den Einsatz von Kunstdüngern
sollten größere Erträge aus dem Boden geholt werden, um den Viehbestand zu vergrößern und mehr Milch und Butter zu
produzieren. Deutschland sollte im Stande sein sich selbst zu selbst zu ernähren, ohne auf Importe angewiesen zu sein.
Frau Jobski hat, innerhalb der der NS-Frauenschaft, mit Hilfe von Fachkräften aus Ortelsburg, Lehrgänge veranstaltet,
auf denen man Backen und Nähen lernte. Auf den Bauernhöfen befand sich auch immer mehr Rassegeflügel, das eine erhöhte
Produktion von Eiern und Geflügelfleisch sicherstellen sollte.
Die Rohmaner Bauern hatten, außer in der Landwirtschaft, noch andere Verdienstmöglichkeiten in der Kreisstadt. In
Ortelsburg wurden vier Sägewerke betrieben, die mit Langholz aus dem Walde versorgt werden mussten. Wir haben eine
Kiefer von über 8 Festmeter angefahren, der wir zuerst 6 Meter Spitze abschneiden mussten, um diese Last überhaupt
auf den Wagen zu bekommen. Sechs Pferde musste angespannt werden um den Wagen zur befestigten Straße zu bringen.
Fichten und Tannen wuchsen bis zu einer Länge von 30 Metern. Auch beim Transport von Ziegel, von der Ziegelei zum
Bahnhof, konnte man gutes Geld verdienen.
Im Jahr 1934 wurde Rohmanen an das überregionale Stromnetz angeschlossen und schaffte auf diese Weise den Sprung von
der Petroleumlampe zur Glühbirne. Neben dem Grundstück von Karl Pietzonka wurde ein Transformatorhäuschen errichtet,
in dem der ankommende Strom von einer Hochspannung auf eine Verbrauchsspannung transformiert wurde. Es gab schon eine
Überlandleitung, die aus Richtung Ortelsburg kommend, quer über die Felder, in Richtung Neu Keykuth weiter ging.
Durch eine Zwischenspanne wurde der Transformator, mit der Hauptleitung auf Kownatzkis Feld verbunden.
Ein Stromanschluss konnte die Arbeit im Haus und Hof auf vielfältige Weise erleichtern, doch nur die besser gestellten
Bauern, sowie noch manche Pensionäre, die ein festes Einkommen hatten, konnten sich dass leisten. Weil nur wenige an
der Elektrifizierung teilnahmen, war ein Stromanschluss mit hohen Kosten verbunden. Nur Gustav Pietzonka, Gasthof
Trzaska, Friedrich Nickel, die Schule und Wilhelm Both, wurden in der ersten Phase erfasst.
Im Jahr 1952 wurde von den polnischen Behörden die zweite Stufe der Elektrifizierung eingeleitet, in der alle im Dorf
stehen Gebäude erfasst wurden. Am Anfang wurden nur Leitungen für Lichtstrom gelegt und auch nur 3 Lichtstellen pro
Haushalt bewilligt. Doch im nachfolgenden Zeitraum wurden dann, wenn Material vorhanden war, weitere Lichtpunkte
angelegt. 1952, am zweiten Wochenende im Advent, wurden dann die Leitungen geschaltet und alle waren von der
plötzlichen Helligkeit sehr begeistert. Wenn man Glühbirnen auswechseln wollte musste man am Anfang weite Wege
zurücklegen, um welche zu bekommen. In den 60ger Jahren wurden dann immer mehr Starkstromleitungen gelegt, weil die
Bauern elektrische Geräte kaufen konnten. Ende der 60ger wurden auch die Abbauten an das Stromnetz angeschlossen.
Das Urnengrab auf unserem Feld
Auf unserem Feld, in Richtung Seelonken, bin ich oft beim pflügen gegen Steine gestoßen, manchmal
rissen sogar die Stränge am Pferdegeschirr. Eines Tages nahm ich einen Spaten, Brechstange und einen langen Baum, um
der Sache auf den Grund zu gehen. Als ich eine Menge Sand ausgehoben hatte stieß ich auf eine steile, aus Steinen
errichtete Wand, die ich auch mit dem Baum nicht aus der Fassung bringen konnte. Ich habe den ganzen Vormittag gegraben,
konnte jedoch nicht unter die Steine kommen. Einige Tage später hatten wir in der Schule eine Bauernversammlung, da
habe ich Herrn Biella und Herrn Lehrer Dorka von meinem Fund berichtet. Am nächsten Morgen kam der Lehrer Dorka mit der
ganzen Schulklasse, mit Spaten und Sieben ausgerüstet auf unser Feld und fingen an die ausgehobene Erde zu sieben.
Lehrer Dorka benachrichtigte daraufhin den Leiter des Ortelsburger Heimatmuseums, der am nächsten Morgen vorbei kam um
sich die Fundstelle genau anzusehen. Er beauftragte ihn 4 Mann zu besorgen, um die Steine ringsum frei zu schaufeln.
Zwischen den Steinen durften wir die Erde nur mit Esslöffeln ausheben. Als es plötzlich zu regnen anfing hat Lehrer
Dorka die Brauerei Daum, in Ortelsburg angerufen, die uns über der Fundstelle ein Zelt errichtet haben, damit wir
ungestört weiterarbeiten konnten. Wir fanden 8 flache und 8 hohe Urnen zu beiden Seiten am Körper. Die Urnen wurden in
Gipsbinden eingewickelt und ins Heimatmuseum nach Ortelsburg gebracht, wo sie durch einen Fachmann, der extra aus einem
Königsberger Museum angereist war. Nach Reinigung der Urnen hat er festgestellt, das die Grabstätte etwa 2000 Jahre vor
Christi Geburt angelegt wurde und ein Doppelgrab war, in dem ein Toter liegend und einer in Hochstellung beigesetzt
wurde.
Die Nachricht von der Fundstelle verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Es erschienen viele Schaulustige, ganze
Schulklassen aus der Umgebung, mit Autos und zu Fuß. Durch die vielen Menschen wurden die bestellten Ackerflächen auf
unserem Feld sehr in Mitleidenschaft gezogen, eine Entschädigung haben wir nicht erhalten. Das Grab wurde vor dem
Heimatmuseum in Ortelsburg wieder so aufgebaut wie man es auf unserem Feld vorgefunden hat. Für den Transport der
Steine wurde ich entlohnt. Die Urnen hat das Königsberger Museum an sich genommen und wollte sie nicht wieder hergeben,
weil die solch einen Fund noch nicht in ihrer Sammlung hatten.
Sonnenwendfeuer
Am 24 Juni fand eine Sonnenwendfeier statt. Ein Brauch der an die alten Germanen erinnern sollte.
Der Lehrer Dorka hat den Bürgermeister beauftragt 2 Fuhrwerke in den Wald zu schicken, die Holz und alten Reisig holen
und auf dem großen Schulberg abladen sollten. Das Straßenbauamt hat uns Teertonnen zur Verfügung gestellt. Die ganze
Dorfgemeinschaft wurde eingeladen, am Abend, nach der Feldarbeit, an der Sonnenwendfeier teilzunehmen. Lehrer Dorka
hielt zuerst eine Ansprache, in der er anschaulich erklärte wie unsere Vorfahren in grauer Vorzeit gefeiert haben.
Nach dem offiziellen Teil wurden das Holz und die Teertonnen angezündet, es wurden Heimatlieder gesungen, wie: Wild
flutet der See, drauf schaukelt der Schiffer den schwankenden Kahn, Schaum wälzt er wie Schnee, von grausiger Mitte
zum Ufer heran, wild fluten die Wellen auf Vaterlands See, wie schön, oh trag mich auf Spiegel zu Hügel, Masovias See.
Masovia Land, mein Heimatland, Masovia es lebe mein Vaterland.
Lehrer Alfred Dorka und sein Wirken für Rohmanen.

Friedrich Biella hatte auf seinem Feld einen Granitstein mit einer geraden Seite, den haben wir
mit viel Schweiß an den Dorfteich transportiert und auf einer Erhöhung abgelegt. Der Stein sollte zum Denkmahl für die
Gefallenen des Ersten Weltkrieges umgestaltet werden. Da zu Wenige daran ein Interesse zeigten, wurde diese Idee fallen
gelassen und der Stein irgendwann ins Wasser gerollt. Der Lehrer Dorka war viele Jahre in Rohmanen tätig, dort hat er
später seine ehemalige Schülerin, Lotte Biella geheiratet. Er hat sich sehr für die Entwicklung des Dorfes interessiert,
war bei jeder Gemeindeversammlung anwesend und hat auf Schwachstellen hingewiesen die den Fortschritt behinderten.
Gemeinsam mit den Schülern hat er den Ehrenfriedhof für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges gepflegt, an der
Wegegablung nach Eichtal und zu Ehren des Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg eine Eiche gepflanzt.
Zum Advent hat Lehrer Dorka mit der Jugend einen Adventstern, in verschiedenen Farben gebastelt.
Der Stern wurde auf einer 2 Meter langen Stange befestigt, in der Mitte wurde ein Wachslicht angezündet, am Stern
wurde eine Schnur angebracht, wenn man daran zog rollte der Stern hin und her. Am ersten Wochenende im Advent
versammelten sich jung und alt, um den Stern durch das Dorf zu tragen. Alle schlossen sich dem vorausgehenden
Sternträger an, der den Stern durch die Hauptstraße und die angrenzenden Wege trug. Dieser Sternmarsch wurde an den
folgenden Adventwochenenden wiederholt.
Am ersten Weihnachtfeiertag wurde um 4:00 Uhr morgens ein Frühgottesdienst gehalten. Zuerst hat der Pfarrer eine
Andacht gehalten, dann haben die Kinder ein Krippenspiel aufgeführt und die Gemeinde hat schöne Weihnachtslieder
gesungen. Der Gastwirt Trzaska hat uns den Saal zur Verfügung gestellt. Wir hatten eine Posaunen- u. eine
Gitarrengruppe. Unter der Leitung von Herrn Willi Doormann spielten: Gottlieb Brosch, Fritz Ollech,
Gustav Rattay(Sopran), Wilhelm Pilath, Gustav Brosch(Alt), Fritz Both(Tenor) und Fritz Brosch(Bass).
In der Gitarrengruppe wirkten mit: Martha Ollech, Hedwig Ollech, Martha Lekzik, Martha Michalick und Auguste Lekzick.
Willy Doormann hat sie auf der Geige begleitet.
Kurz vor Ausbruch des 2. Weltkrieges
Bei der Aufstellung des Grenzschutzes(Regiment Buchholz), hat er als Hauptfeldwebel die
Gruppenführerkurse überwacht und selbst die fähigsten Männer dafür vorgeschlagen. Das Ausbildungspersonal hat das
Jäger-Battalion gestellt. Wir kamen zuerst ins Stadion(Waldheim), wurden da eingekleidet und dann ging es gleich
kasernenmäßig zu, theoretisch und praktisch. Jeder musste vor die Front treten und nachweisen ob er im Stande ist,
Befehle zu erteilen. Abends wurden Filme vorgeführt die uns zeigen sollten wie eine Gruppe sich im Gelände entfalten
muss. Die Exerziervorschriften hatten sich, im Verhältnis zu Kaiser Wilhelms Zeiten, etwas geändert. Damals bestand
eine Gruppe aus 8 Mann und einem Unteroffizier, jetzt aus 10 Schützen, 3 für das leichte Maschinengewehr und einem
Unteroffizier(13 Mann). Nach der Schulung folgte eine Abschlussprüfung, danach ein gemütliches Beisammensein. Aus
Rohmanen haben folgende Männer die Prüfung bestanden: Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy, Gustav Rattay und
Gustav Deptolla. Unsere Uniformen waren alle zu klein und es gab viel zu lachen bei der Anprobe.
Die erste Übung habe ich mit Emil Rosowski, in Lenzinen gemacht. Der Gutsbesitzer Marzinzick hat seine Scheune als
Unterkunft zur Verfügung gestellt. Er war im Range eines Hauptfeldwebels. In seinem haus war die Schreibstube
untergebracht, die er selbst verwaltete. Ein Lastauto hatte Uniformen aus der Kaserne in Ortelsburg geholt, jeder
musste eine Uniform anlegen und dann wurde solange getauscht bis alle eine passende gefunden hatten. An den Namen des
Kompanieführers kann ich mich nicht mehr erinnern. 1935 wurden wir zu einer Übung in die Dragonerkaserne nach Lyk
einberufen. Die Gruppenführer, Zugführer, und Kompanieführer die schon Frontberührung im dem Ersten Weltkrieg hatten,
mussten eine Woche früher anreisen. Die Übungen waren auf 6 Wochen angelegt. Die meisten der einberufenen waren noch
nie mit dem Wehrdienst in Berührung gekommen. Jeder Gruppenführer bekam 13 Mann zugeteilt.
Unser Zugführer war Leutnant Neumann, Kompanieführer Oberleutnant Rutschko, Battalions-Kommandeur Major Gröning
(Regiment Buchholz). Hier ging es wieder Kasernenmäßig voran. Das Bataillon wurde hier vereidigt. Jeden zweiten
Sonntag durften unsere Frauen uns besuchen. Ein Jahr später wurden wir wieder zu einer Übung einberufen, auf den
Truppenübungsplatz nach Arys. Jeder Gruppenführer hatte den Auftrag die Gruppe zu entfalten, und auf bewegliche
Figuren zu schießen. Diese Übung musste später mit scharfer Munition wiederholt werden. Jedes Maschinengewehr bekam
50 Schuss, jeder Schütze 20 Schuss zugeteilt. Nach dem Abschießen wurden die Treffer gezählt und dem Kommandierenden
Bericht erstattet. In einiger Entfernung spaziert ein Storch umher, der gar nicht bemerkt hatte dass geschossen wurde,
was bei den Kameraden ein großes Gelächter hervorrief.
Nach der Übung wurde uns gesagt das jeder Gruppenführer eine arische Abstammung nachweisen sollte. Ich konnte in den
Rheinsweiner Kirchenbüchern meine Vorfahren aus Gellen, bis zum Jahr 1732 zurück, nachweisen und wurde zum
Unteroffizier befördert. Aus unserem Dorf wurden auch, Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy und Gustav Deptolla
befördert. Zwischendurch mussten wir schon mal in die Radfahrer-Kaserne nach Ortelsburg, Gewehre empfangen und im
Gelände üben. Am 31 Juli 1939 wurde mir von einem Soldaten ein Schreiben übereicht, das mich aufforderte, am 1. August
um 6:00 Uhr, bei der 3. Kompanie, des 2. Infanterieregiments zu erscheinen.
Um 5:30 hat mich meine Schwester in die Kaserne gebracht. Auf der Schreibstube erklärte mir der Hauptfeldwebel,
dass mir ab sofort der Dienstgrad eines Sanitäters zugewiesen wird, ich mich in der Kammer einzukleiden hätte und mir
in der Handwerkerstube die entsprechenden Schulterklappen annähen lassen sollte. Die aktiven Sanitäter wurden den
Feldlazaretten zugewiesen und wir kamen an ihre Stelle. Unser Bataillon wurde nach Schodmak zum Bunker bauen und
Stacheldraht verlegen eingeteilt. Wir zogen in Begleitung einer Musikkapelle bis zur Kreuzung am Krankenhaus, dann
weiter zu unserem Bestimmungsort, gefolgt von einer Gulaschkanone die in den nächsten Tagen für unsere Verpflegung
sorgen sollte.
Am 14 August haben wir die Jägerkaserne, begleitet von einer Musikkapelle endgültig verlassen und zogen zuerst durch
Ortelsburg, dann über Lehmanen ins Feldmanöver, hinter Rohmanen. Dort entfaltete sich das Bataillon im Gelände, die
Verwundetensammelstelle wurde auf dem Hof des Bauern Friedrich Neumann eingerichtet. Gegen Abend wurde zu Sammeln
geblasen und Biwak bezogen, wobei unsere 3.Kompanie, in einem kleinen Wallt, in der Nähe von Otto Nickels Gehöft
Stellung bezogen hatte. Die 2. und 4. Kompanie hatte sich in der Nähe vom Abbau Pallasch niedergelassen. Die Frau
Nickel hat am Abend ein Mädel in Dorf geschickt um meiner Frau Bescheid zu sagen, wo wir uns zurzeit befinden. Meine
Frau ist dann noch gekommen um sich von mir zu verabschieden, weil wir am nächsten Morgen um 3:00 Uhr Zelte abbrechen
und um 4:00 Uhr in Richtung Kaspersguth marschieren sollten.
Wir sind dann über Achodden, Seelonken, Lehmanen, Ortelsburg, bis nach Grammen und Schützendorf marschiert, wo wir an
einem See Biwak bezogen haben. Es wurde immer gesagt, wir kommen zum Tannenberg-Denkmal bei Hohenstein, wo ein Reichs
Kriegervereinsfest stattfinden sollte. Es wurden auch schon Vorkommandos aufgestellt, doch dann kamen wir nach Orlau
und Lahna-Mühle, da wo die Alle entspringt haben wir 2 Tage biwakiert. Unser Kompanieführer hat uns nach Waplitz auf
den Soldatenfriedhof des Ersten Weltkrieges geführt und uns erklärt wie das Jägerbataillon sich 1914 hier entfaltet
hat und aufgerieben wurde. Dann mussten wir in der Nähe von Gut Koslau über einen Fluss und bezogen in einem Waldstück,
vorbereitete Stellungen in der Nähe der polnischen Grenze. Herr und Frau Thalmann haben uns jeden Tag, bis zur Grenze,
mit Brötchen und Getränken versorgt. Es wurde scharfe Munition ausgegeben, weil wir am nächsten Morgen um 4:00 Uhr die
polnische Grenze überschreiten sollten.
Am nächsten Morgen um 10 Minuten vor 4:00 Uhr kam der Befehl; scharfe Munition abgeben, alles zurück in ein 6 Kilometer
entferntes Dorf, wo wir auch einquartiert wurden. Das alles geschah’ eine Woche vor dem 1. September 1939. Es wurde
gesagt dass der Führer dem polnischen Präsidenten Rid-Szmigly, ein Ultimatum gestellt hat und es wahrscheinlich nicht
zum Krieg mit Polen kommt. Genau nach 5 Tagen kehrten wir wieder in die gleichen Stellungen zurück, es wurde wieder
scharfe Munition ausgegeben und am nächsten Morgen um 4:00 Uhr überschritten wir die polnische Grenze.
“Der 2. Weltkrieg.”
Der erste Einsatz in Polen
Wir kamen zuerst in ein Dorf in dem sich nur alte Menschen befanden. Auf unsere Frage wo denn die Bewohner wären sagte
man uns dass alle geflohen sind, weil erzählt wurde, die Deutschen würden alle Polen misshandeln und verstümmeln. Ich
habe ihnen daraufhin gesagt dass uns, unter Androhung von Strafe verboten wurde, einem Zivilisten etwas anzutun. Das
Vieh, die Schweine und Hunde des Dorfes liefen frei herum und die Soldaten fingen an auf die Hunde zu schießen, bis
gesagt wurde es seien Meldehunde im Dienste der Deutschen Wehrmacht und dieser Unfug der eigenen Truppe schaden würde,
weil etwaige Querschläger eigene Kameraden verletzen könnten. Wir gingen weiter auf polnischer Seite entlang der Grenze,
bis wir am Nachmittag die ersten Vorposten der Festung Mlawa erreichten, da befanden wir uns plötzlich im Feuerhagel
polnischer Festungsflack.
Am nächsten Morgen hatte ich schon 3 Verwundete und wusste nicht wo sich eine Verwundeten Sammelstelle befindet. Ich
suchte den Bataillonsgefechtstand auf der sich auf einer Anhöhe befand. Ich habe unseren Oberstabsarzt gefragt wo denn
die Verwundetensammelstelle wäre. Er rief beim Tross an, wo er die Auskunft erhielt, das sich vor dem Dorf ein Bunker
befindet in dem man die Verwundeten sammeln sollte, die dann von Sanitätsautos abgeholt würden, weil das Dorf unter
Artilleriebeschuss stand. Am Sonnabend haben unsere Flieger die Bunkerstellungen bombardiert, konnten aber, trotz guter
Treffer nicht viel ausrichten, die Bunker wurden nur etwas angekratzt.
Der Beschuss unserer vordersten Linien ging mit unverminderter Heftigkeit weiter. Am Sonntag verkündete eine große
Staubwolke die Ankunft unserer Panzer, doch sie kamen nur bis zur Panzersperre und mussten wieder abdrehen ohne den
Polen einen schaden zuzufügen. Ein Panzer bekam einen Volltreffer, der Fahrer konnte noch umkehren. Er blutete am Kopf
und der Schütze war so eingeklemmt, das wir ihn nur mit einem Seil unter den Armen, durch die Luke nach oben ziehen
konnten. Ob er seine Verwundung überlebt hat ist mir nicht bekannt, denn in der Nacht wurden Panzergeschütze nach
vorne in Stellung gebracht, die direkt in die Schießscharten der Bunker geschossen und so die Verteidiger vertrieben
haben. Daraufhin sind wir weiter vorgerückt. Auf einer Wiese war ein tiefer Graben ausgehoben und mit Ästen getarnt,
da war ein Panzer hinein gefahren, so dass nur das Hinterteil herausragte und er sich nicht aus eigner Kraft befreien
konnte. In der Luft waren Flieger die Brandbomben abwarfen, ich habe mich auf den Boden geworfen weil ich dachte die
würden explodieren, aber sie zischten nur, so das Stoppeln und Graß rings herum in Brand gerieten.
Bei den Kampfhandlungen gab es mehrere Verwundete, denen ich gerade Verbände anlegen wollte, als unser Hauptmann zur
Trillerpfeife griff um mir klar zu machen, dass ich ihm folgen sollte. Die Polen fingen an zu schreien, ich sollte
sie ins Lazarett bringen denn hier im Wald würde sie niemand finden. Ich setzte mich aufs Fahrrad und folgte unserem
Kompanieführer, der mir sagte ich soll immer bei der kämpfenden Truppe bleiben, denn hinter der Front sind die
Sanitätsabteilungen, die werden die Verwundeten schon versorgen. Der Vormarsch dauerte bis in die späte Nacht. Auf
einem Gehöft, das nach allen Seiten durch Feldwachen abgesichert wurde, machten wir endlich Rast. Wir haben
Getreidegarben auf dem Hof ausgebreitet und uns zur Ruhe gelegt, als plötzlich um Mitternacht Leuchtraketen den Himmel
erhellten und Maschinengewehrfeuer uns aus dem Schlaf schreckte. Ein par polnische Soldaten hatten das Feuer eröffnet,
aber sich kurz darauf ergeben.
Die Narew-Überquerung
Als es hell wurde ging der Vormarsch weiter. Es wurde uns untersagt Tagebuch zu führen, darum
weiß ich nicht wie die Orte hießen, durch die wir marschiert sind. Als wir durch ein sumpfiges Gelände vor drangen
stand auf einer Anhöhe am Horizont, die polnische Artillerie, die uns sofort unter Beschuss nahm. Unser Hauptmann war
der Meinung dass wir schon in der Nähe des Flusses Narew sein müssten, als aus den Sträuchern ein mit Schlauchboten
beladenes Lastauto auftauchte. Wir wurden aufgefordert mit je 6 Mann ein Schlauchboot zu nehmen, an einem Aggregat
der daneben stand mit Luft zu füllen und zu Wasser zu lassen. In einer Stunde war das ganze Bataillon über die Narew,
wo der Vormarsch fortgesetzt wurde. In einem Dorf überraschte uns die polnische Kavallerie und fing sofort mit
Maschinengewehren zu schießen an. Da kam der Befehl: Alles wieder zurück. Es ging noch schneller als auf der Hinfahrt.
Wir sind erst einige Kilometer am Fluss entlang gegangen und haben dann zum zweiten Mal rüber gesetzt.
Die Gehöfte im Dorf standen alle in Brand. Auf einem waren viele Bienestöcke. 2 Kameraden wollten den Stöcken Waben
entnehmen, doch die Bienen durch das Feuer aufgeschreckt, überfielen sie sofort und stachen derart zu das sie nicht
mehr wieder zu erkennen waren. Ich habe die Einstichstellen mit Salmiak betupft, mehr konnte ich nicht tun. Wir mussten
auf unserem Vormarsch durch einen Wald der in Flammen stand, so dass man kaum atmen konnte. Es ging weiter in Richtung
Minsk und Warschau, wo schon die Sowjetische Armee durchgegangen war, die Pferde und Vieh von einem Gut mitgenommen
hatten. In einem Wald stießen wir unverhofft auf ein Kloster, in dem wir einige Gefangene machten. Dann trafen wir auf
eine gute Straße die nach Grochow ging.
Als wir dort einmarschierten wurden wir aus den oberen Stockwerken beschossen, so dass wir, um uns zu schützen, nur an
den Hauswänden entlang gehen konnten. Wir haben jedes Haus nach Feinden durchsucht. Vor einem Haus stand ein Hund der
niemanden reinlassen wollte, solange bis ihn eine Kugel traf. Die polnische Artillerie feuerte von Warschau aus, um
unseren Vormarsch zu stoppen. Wir hatten uns gerade eingegraben als plötzlich deutsche Flieger am Himmel erschienen,
die unsere Stellungen mit Bomben bewarfen und dabei viel Unheil anrichteten. Wir haben sofort Fliegertücher
ausgebreitet und Leuchtraketen abgeschossen. Da ich in dem Graben, den ich kurz zuvor ausgehoben hatte, sofort in
Deckung gegangen bin ist mir zum Glück nichts passiert. Unter den anderen Kameraden gab es viele Verwundete, so dass
ich nicht wusste wem ich zuerst helfen sollte.
Der Oberstabsarzt hat mich sofort tatkräftig unterstützt, so das bald alle Verwundeten versorgt waren, außer einem,
dem ein Bombensplitter den Arm abgerissen hat. Ich habe im 3 große Verbandspäckchen auf die Wunde gelegt, doch die
Blutung ließ sich trotzdem nicht stoppen, so dass er eine Stunde später auf der Krankensammelstelle verstarb. Wir
haben danach in einem Tomatenfeld einen Graben ausgehoben und eine neue Abwehrstellung bezogen. Die Gruppe Schwarz
bekam den Auftrag nach etwaigen versprengten polnischen Verbänden Ausschau zu halten, als sie unerwartet aus einer
Häuserreihe mit Maschinengewehrsalven überschüttet wurden. Der Gruppenführer und noch ein Soldat wurden dabei tödlich
verwundet. Danach wurde noch ein weiter Stoßtrupp, unter der Führung von Leutnant Briskorn, der sich dazu freiwillig
gemeldet hatte, hinaus geschickt um den Gruppenführer und den anderen Toten zu bergen.
Bei diesem Unternehmen, das erfolglos ausging, weil die Toten schon verscharrt waren, durchschlug eine Kugel den
Stahlhelm von Leutnant Briskorn, der auch sofort tot war. Alle Toten wurden später, an der Kirchenmauer in Grochow, in
Särgen beigesetzt: Hauptmann Schönwald sagte, das sie nach dem Kriege auf den Heldenfriedhof nach Ortelsburg überführt
werden. Drei Tage lagen wir bei Grochow in Stellungen, waren dem polnischen Maschinengewehrfeuer sowie den Bomben
deutscher Flugzeuge ausgesetzt. In der Nacht musste ich zu einem Verwundeten in die vorderste Linie und habe den
Rückweg nicht mehr finden können, als plötzlich Gewehrfeuer aufflammte habe ich in den Ruinen Schutz gesucht. Erst im
Morgengrauen konnte ich mich wieder orientieren und zu meinem Unterstand zurückfinden.
Warschau wurde tagelang bombardiert und stand auch unter Artilleriebeschuss. Aus dunklen Rauchwolken kamen oft ganze
Bündel von Papier angeflogen. Die Verwundeten kamen oft auf Krücken zu unserem Unterstand, ich habe sie dann zur
Krankensammelstelle hingeführt. Wir haben auch polnische Zivilpersonen betreut, die während der Kampfhandlungen
verwundet wurden. Als einmal 2 Jungen vorbeiliefen hat einer ihnen nachgerufen sie sollten seiner Frau Bescheid sagen,
er wäre auf der Krankensammelstelle an der Kirche. Als wir dort ankamen war seine Frau, mit einem Kind auf dem Arm,
schon da.
Nach der Kapitulation von Warschau, gingen wir über Sokolow zum Bug und haben dort Quartier bezogen. Der Russe hatte
sich bereits hinter den Fluss zurückgezogen, hatte alles Vieh und Pferde mitgenommen. Dort erreichte mich ein Telegramm
von zu Hause, dass meine Tochter gestorben ist. Es sprach sich auch herum dass verschiedene Heimaturlaub bekommen haben,
ich durfte auch für 14 Tage heim. Wir fuhren mit Lastautos nach Allenstein in die neue Reiterkaserne, zum
Ersatzbatallion, da haben wir unsere Gewehre und Munition abgeben, dann durften wir, jeder in seinen Heimatort
weiterfahren.
Als wir unsere Quartiere am Bug verlassen haben war sehr viel Schnee gefallen. Hier in Ortelsburg fanden wir die
gleiche Wetterlage vor, aber nach 3 Tagen war alles wieder weggetaut und wir konnten die Kartoffelernte, die durch den
frühen Wintereinbruch gestoppt wurde, zu Ende bringen. Ein Tag bevor ich zu Hause angekommen bin wurde die Tochter
beerdigt. Nach 14 Tagen mussten wir uns in Allenstein melden, Gewehre empfangen und wieder zurück zur Division an den
Bug 150 Kilometer hinter Warschau. Die elfte Division, zu der wir auch gehörten sollte in den Westen Deutschlands
verlegt werden und war schon unterwegs zur Verladestation Skiernewice 50 Kilometer vor Warschau.
Mein Dienst als Sanitätsunteroffizier
Unser Bataillon kam in das Städtchen Burscheid, im Kreis Opladen, wo wir in Privatquartieren
untergebracht wurden. Nach 3 Monaten, im Januar 1940, wurden wir nach Solingen verlegt, wo wir bis zum
Frankreichfeldzug stationiert waren. Wir mussten an Feldübungen teilnehmen, wie andere die in Kasernen untergebracht
waren. Während dieser Zeit musste jeder seine Zähne in Ordnung bringen lassen. Jeden Tag fuhren 20 Mann in die
Cäzilienstraße nach Köln, zur Zahnklinik. Im Rheinland wurde unsere Division neu aufgestellt. Ausfälle durch den
Polenfeldzug wurden durch neue Soldaten ergänzt. Ich kam nun zum Ersatzbatallion, war der Älteste in der ganzen
Kompanie. Als der Frankreichfeldzug losging wurde unser Ersatzbatallion mit den noch vorhandenen Verwundeten, in die
neue Reiterkaserne, nach Allenstein verlegt.
Meine Frau hat, mit Unterstützung der Bauernschaft, einen Antrag gestellt, daraufhin wurde ich zur Frühjahrsbestellung,
beurlaubt und später bis auf weiteres vom Militärdienst freigestellt. Als der Russlandfeldzug losging wurde ich von der
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg, für 14 Tage einberufen. Ich war seit 1922, Mitglied der freiwilligen
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg und habe jedes Jahr an Übungen teilgenommen. Jede Bereitschaft musste etliche Leute
stellen. Von Rohmanen wurden Emil Rosowski, Johann Dembek, und ich, zur Krankensammelstelle Wirballen, in Litauen,
abkommandiert. Dorthin kamen Lazarettzüge aus Russland mit der Breitspurbahn. Die Verwundeten wurden frisch verbunden
und auf Waggon mit Normalspur verladen und nach Deutschland gebracht.
Als die 14 Tage vergangen waren wollten wir wieder nach Haus zurück, doch man wollte uns nicht entlassen. Stattdessen
wurden wir dem Wehrkreisamt Königsberg zugeteilt, neu eingekleidet und zur Aushilfe ins Lazarett nach Gumbinnen
abkommandiert. Mehr als ein Jahr war ich in den Urlauber-Baracken, habe dort Krankenstube betreut. Später, bis zum
Dezember 1944, war ich im Reserve-Lazarett 4, in Königsberg tätig. Dort habe ich auch die Luftangriffe der Engländer,
vom 25 bis 26. August 1944 miterlebt.
Wir sollten gerade einen Lazarettzug in Rotenstein entladen, als plötzlich die Sirenen ertönten - Fliegeralarm. Im
gleichen Moment waren die ersten Flugzeuge auch schon da, zuerst warfen sie „Tannenbäume” und danach Foßforkanister ab.
Die Omnibusse standen schon zur Abfahrt bereit als es losging. Wir haben die Verwundeten schnell in den
Luftschutzkeller getragen, haben die Betten von den Fenstern weggerückt damit die Verwundeten nicht von den
Glasssplittern verletzt wurden. Im Kasernenhof brannten die Fosforkanister lichterloh. Unsere Unterkunft, die sich in
einer Baracke befand ist völlig abgebrannt, mit dem Wenigen was wir unser Eigen nannten. Am nächsten Tag wurden wir neu
eingekleidet und am 29. bis 30. kamen die englischen Bomber wieder, sie setzten genau da ihr Zerstörungswerk fort wo
sie vor 3 Tagen aufgehört hatten.
Anfang Dezember 1944 musste ich mich nach Stablack melden und musste dann zur Sanitätsabteilung 1, nach Gernau, das
liegt zwischen Lodz und Warschau. Vormittags hatten wir Felddienstübungen und nachmittags theoretischen Unterricht.
Jeden Tag wurden Gruppen zusammengestellt und zu anderen Einheiten abkommandiert. Ich kam zu einer Panzerabteilung, wo
wir an einem Morgen plötzlich auf dem Kasernenhof antreten mussten und zu unserer Überraschung mit der Nachricht
konfrontiert wurden, dass der Russe an mehreren Frontabschnitten durchgebrochen war. Wir bekamen sofort einen
Marschbefehl in Richtung Lodz, wo das Stadtbild noch intakt war, selbst die Straßenbahnen fuhren noch. In der Nacht
haben russische Flugzeuge die Stadt bombardiert. Die Kaserne in der wir untergebracht waren hatte keine
Luftschutzkeller, aber zum Glück blieben wir von Bombentreffern verschont. Am nächsten morgen bot sich uns ein Bild der
Verwüstung. Die entgleisten Straßenbahnwagen, sowie andere Fahrzeuge blockierten die Straßen. Die Älteren unter uns
bekamen Fahrscheine für einen Transportzug, der bereit hinter Lodz abfahrbereit, unter Dampf stehen sollte. Als
russische Panzer in den Straßen auftauchten, verbrannte die Schreibstube unsere Wehrpässe und andere wichtige
Dokumente. Wir liefen zu der Station auf der unser Transportzug bereitstehen sollte, aber da war kein Zug mehr zu sehen
und wir setzten unseren Rückzug zu Fuß fort.
Der Rückzug und Zusammenbruch der Ostfront
In Dobroschin, einer Stadt in Polen, wurde gerade ein Lazarettzug verladen, doch wir kamen nicht
mehr zum Einsatz, weil die russische Infanterie uns schon auf den Fersen war. Es ging weiter über den Fluss Bober,
Sagan, bis nach Glogau an der Oder. Dort wurden wir der 29. motorisierten Sanitätskompanie zugeteilt. Im
Garnisonslazarett wurden noch Operationen durchgeführt. Unsere Division hatte ihr eigenes Feldlazarett, so dass wir den
Befehl zu Weiterfahrt erhielten und noch unbeschadet die Oderbrücke passieren konnten, denn Glogau wurde zur Festung
erklärt. Wir haben 2 Pferdewagen organisiert und mit Verbänden, sowie medizinischen Instrumenten beladen. So kamen wir
bis nach Lübbenau im Spreewald, wo wir in einem Schloss, in zuvor ein Museum war, unser Lazarett untergebracht haben.
Weil die Amerikaner Cottbus bombardiert hatten, wurden die Verwundeten zu uns nach Lübbenau gebracht. Hier haben wir
Tag und Nacht gearbeitet, um die vielen Verwundeten, aus den schweren Kämpfen bei Grünberg und Sagan zu versorgen. Die
Soldaten von der Abwehrfront kamen schon mit abgestorbenen Armen oder Beinen bei uns an, weil in vorderster Linie keine
Frontlazarette mehr vorhanden waren; es mussten viele Amputationen durchgeführt werden. Als für unsere Pferde kein Heu
mehr vorhanden war, schickte mich unser Hauptfeldwebel, zu einem Bauern in den Spreewald, mit dem Auftrag, Futter zu
besorgen. Mit noch zwei Mann fuhren mit zwei Kähnen, zuerst den Hauptstrom entlang und dann in einen Nebenarm; da haben
wir die Boote beladen und brachten das Heu nach Lübbenau.
Als wir uns bei unser Einheit zurück melden wollten, war alles schon marschbereit. Ich bin schnell in einen Bus
eingestiegen der sofort losfuhr, weil russische Verbände schon in sichtweite waren. Russische Flugzeuge kreisten über
den Dächern und nahmen, mit ihren Bordwaffen jeden unter Beschuss, der sich irgendwo blicken ließ. Wir konnten nur
durch den Wald, oder in der Nacht vorwärts kommen, denn wenn ein Auto auf der Landstraße fuhr, war alsbald ein Flugzeug
hinter ihm her und schoss es in Brand. Als wir nach Tagen am Ufer der Elbe ankamen, war bereits eine Ponton-Brücke
erstellt worden, welche die zerstörte Brücke ersetzen sollte.
Durch die vielen Fahrzeuge waren in den Sand tiefe Spuren gefahren, so dass andere Fahrzeuge unsere Busse ins
Schlepptau nehmen mussten, weil wir mit eigener Kraft nicht mehr weiterkamen. Beiderseits der Trasse standen
Flüchtlingswagen, in der der Hoffnung die Brücke passieren zu können, doch SS-Polizei verhinderte das die Gespanne den
militärischen Rückzug zum Stillstand brachten. Es gelang uns die Elbe zu überqueren, um in einem Waldstück Schutz vor
feindlichen Fliegern zu suchen.
Als wir unsere Busse und Autos gut getarnt hatten, hat unser Bataillonschef die anwesenden Parteigrößen zu sich
gerufen und ihnen erklärt das wir eine Einheit des Roten Kreuzes sind und nach internationalem Recht keine Waffen
besitzen dürfen. Nach langer, erregter Diskussion wurde beschlossen einen Graben auszuheben und alles im Sand zu
verscharren. Als wir dann weiter, durch die Dörfer fuhren, sahen wir schon viele weiße Bettlaken, als Zeichen der
Kapitulation, aus den Fenstern hängen. Es wurde uns erzählt dass der Bürgermeister von der SS erschossen wurde, weil
er die Bevölkerung zu diesem Schritt ermutigt hatte. Jetzt waren hinter uns die Russen und vor uns schon die Amerikaner.
Amerikanische Panzer fuhren umher und schossen wild durch die Gegend, ohne ein Ziel anzuvisieren. Niemand wollte sich
dem Russen ergeben, doch der Weg der zu den Amerikanern führte, war durch abgesägte Bäume blockiert. Wir sind schnell
in das nächste Dorf gegangen, haben uns Sägen und Äxte besorgt, die Bäume durchgesägt und in den Straßengraben
geworfen.
“ Nach dem Ende des 2. Weltkrieges.”
In amerikanische Kriegsgefangenschaft
Dann fuhren wir unter internationaler Flagge an eine Mulde Brücke, vor der zwei amerikanische Soldaten, mit Zigarren,
zur Hälfte im Mund, standen. Sie rauchten und kauten gleichzeitig. Wir mussten auf einen freien Platz fahren, alle
aussteigen und rechts wieder antreten. Wäschebeutel und Tornister mussten wir abstellen; danach wurden wir nach Waffen
durchsucht, Wertsachen, Uhren und Messer wurden uns gleich abgenommen. Als wir anschließend an unserem Gepäck
vorbeigingen durfte niemand was mitnehmen. Als ich gebückt, nach meinem Wäschebeutel greifen wollte, in dem sich noch
3 Konservendosen und ein Brot befanden, bekam ich einen Fußtritt ins Gesicht, so dass mir ein Zahn ausgeschlagen wurde.
Wir wurden dann in einem Garten zusammen getrieben und gefragt ob jemand bei der SS gedient hat. Nachdem wir in Reihe
und Glied angetreten waren, mussten wir den Oberkörper freimachen und die Arme anheben. Es wurde nach SS-Zeichen
gesucht, die gewöhnlich unter dem Oberarm eintätowiert waren. Nachdem wir Grimma bei Leipzig, wo wir in amerikanische
Gefangenschaft geraten waren, verlassen hatten, mussten wir durch ganz Thüringen bis Hersfeld, an der Grenze zu Hessen,
marschieren. In Hersfeld wurden wir auf große Lastautos verladen, die von farbigen Soldaten gefahren wurden. Man hat
uns mit Stöcken hinauf getrieben, solange bis das Auto so voll war das man kaum stehen konnte. Die Soldaten fuhren, für
diese Straßenverhältnisse, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Wenn die Straße eine scharfe Kurve hatte, flogen
wir alle übereinander und mussten erst mit viel Kraftanstrengung auf die Beine kommen um diese Fahrt zu überstehen.
Da die Straßenränder in dieser Gegend mit Obstbäumen bepflanzt sind und deren Äste sehr niedrig hängen, hätten die
uns die Köpfe abgerissen, wenn wir uns nicht ständig geduckt hätten. Unsere Fahrt endete in Bad Kreuznach, in der Pfalz,
wo wir in ein Lager, in dem sich später 130.000 Mann und 6 Generäle befanden, eingepfercht wurden. Die Unterkunft der
Generäle befand sich unter einem Zelt, alle anderen mussten die Zeit unter freiem Himmel zubringen. Die Offiziere, die
Unteroffiziere, die Mannschaften; wurden in getrennten Camps untergebracht. Die Mannschaften wurden auch zur Arbeit
abkommandiert und konnten bei dieser Gelegenheit, Brot, Brötchen oder Zigarettenstummel organisieren, wogegen die
Offiziere und Unteroffiziere ihr Camp überhaupt nicht verlassen durften.
Die ersten Tage gab es kein Wasser und kein Brot, so dass die Kameraden vor Erschöpfung umfielen. Später standen wir
manchmal den ganzen Tag nach Wasser an, das von den, uns bewachenden Negern mit großen Wassertanks angefahren wurde. Am
dritten Tag bekamen wir mittags und abends etwas zu Essen; Brot bekamen wir erst nach zwei Wochen, nach dem aus der
Umgebung herbeigeholte Handwerker, Backöfen gebaut hatten. In den verschiedenen Gemeinden, die in den uns umgebenden
Weinbergen lagen, mussten sich alle Männer beim Bürgermeister melden. Als sie dann erschienen waren, wurden sie auf
bereitstehende Lastautos getrieben und zu uns ins Lager gebracht. Sie waren ohne Kopfbedeckung und ohne wärmere
Bekleidung angekommen, weil ihnen gesagt wurde, dass ihr Aufenthalt im Lager nur von kurzer Dauer sein würde. Man hat
uns, falls noch vorhanden, Decken und Mäntel abgenommen, mit der Begründung, sie würden für Kranke und Verwundete
gebraucht. Jeden Tag starben mehr als 200 Mann, die wir sofort in ein Zelt tragen mussten. In der Nacht wurden die
Toten dann mit unbekanntem Ziel, weggefahren.
Viele haben ihren Verstand verloren uns irrten im ganzen Camp ziellos umher. Als Latrinen wurden Gräben ausgehoben, in
die verschiedene Kameraden, bei der Verrichtung ihrer Notdurft, vor Schwäche hineingefallen sind und nicht mehr wieder
heraus kamen. Aus den Pfählen die, die jungen Obstbäume stützten, haben wir Krankentragen gebaut um unsere Kameraden,
bei Bedarf, zur Krankensammelstelle zu tragen. Es war in diesem Frühjahr auch sehr kalt, doch unsere Erdlöcher, die wir
zum Schutz vor Kälte und Wind, nur mit leeren Konservendosen ausgehoben hatten, durften nicht tiefer als 20 Zentimeter
sein. Nach jedem Regenguss mussten wir das Wasser ausschöpfen. Nach einem Gewitter, standen wir wiedermal, total
durchnässt in unserem Camp, als unerwartet am Horizont die Sonne hervortrat. Einer unserer Kameraden hatte noch eine
Trompete gerettet und fing, von dem Anblick völlig überwältigt, zu spielen an: "Es geht alles vorüber, es geht alles
vorbei, nach jedem Dezember, folgt wieder ein Mai". Daraufhin hob sich die Stimmung der tiefbetrübten Kriegsgefangenen,
so das Heimatlieder durch das ganze Camp erklangen, obwohl wir in den nassen Kleider herumgehen mussten, bis sie am
Körper trocken wurden.
Im Jahr 1931 hat der Fleischermeister Karl Pelkowski, aus Grammen, direkt neben unserem Hof ein
Anwesen gekauft und dort eine Fleischerei eingerichtet. Er war mit meiner Schwester Frieda, verheiratet. Am Anfang hat
er die Schweine noch auf seinem Hof geschlachtet, später dann im Ortelsburger Schlachthof. Jede Woche fuhr er 2-mal,
mit dem Pferdewagen(Einspänner), nach Ortelsburg zum Wochenmarkt, wo er seine Fleisch und Wurstwaren zu Verkauf anbot.
Am Tag davor, wenn er die Wurst gekocht hat, kamen viele Rohmaner mit Kannen oder anderen Gefäßen, wegen der guten
Wurstsuppe, die er umsonst unter die Leute verteilte. Als Karl Pelkowski, Ende August 1939 zum Militär eingezogen
wurde, hat seine Frau das Pferd verkauft und den Beitrieb stillgelegt. Am Haus hing, immer noch die Tafel mit der
Aufschrift: Karl Pelkowski, Fleisch und Wurstwaren. Ein Witzbold hat irgendwann darunter geschrieben; „Fleisch und
Wurst waren einmal”, drauf hin hat Frau Pelkowski die Tafel entfernen lassen. Karl Pelkowski ist im Mai 1946 in
französischer Gefangenschaft verstorben. Seine Ehefrau Frieda, verstarb an ihrem 85. Geburtstag in Mettmann bei
Düsseldorf.
Die steinreichen Rohmaner Felder
Die letzte Eiszeit hat bei der Schmelze, auf der Rohmaner Feldgemarkung viele Steine und
Granitblöcke zurück gelassen. Überirdisch, aber besonders unter der Erde, gab es viele kleine, aber auch große Steine,
die, den Bauern, beim Pflügen und anderen Feldarbeiten sehr viel Schweiß, abverlangten. In einer Kiesgrube, auf dem
Feld des Bauern August Radek, lag ein Granitblock, von schätzungsweise 100 cbm. Vor etwa 80 Jahren, als man für diese
Steine noch keine Verwendung hatte, griffen die Bauern zu einer „List”. Weil er sonst nicht pflügen konnte, hat mancher
seinem Nachbarn, die Steine in der Nacht auf dessen Feld abgeladen. Als diese Tätigkeit unter Strafe gestellt wurde,
hat man die Steine in Schluchten gekippt und mit Mutterboden zugeschüttet. In späteren Jahren kam diese jedoch beim
pflügen wieder an die Oberfläche. Dann hat man aber schon Steine für den Straßenbau gebraucht und konnte sie so zu Geld
machen. Besonders im Raum südlich von Ortelsburg, bis zur polnischen Grenze, wo Steine eine Rarität waren, kamen sie
jetzt zum Einsatz. Auch beim Bau von Häusern, besonders für die Fundamente, wurden sie eingesetzt, weil auf diese
Weise viel Ziegeln eingespart wurden. Die Firma Gribienski aus Ortelsburg hat die großen Steine mit Dynamit gesprengt
und auf diese Weise die weitere Verarbeitung erleichtert.
Die Steine welche beim Pflügen aus dem Boden geholt wurden, hat man am Feldrand auf große Haufen zusammen getragen.
Wenn die Feldarbeit beendet war, sowie auch in den Wintermonaten, waren wir jeden Tag mit Steinen unterwegs. Wir sind
vorwiegend am Abend los gefahren, weil unter der schweren Last die Wagenachsen so heiß wurden und die Gefahr bestand,
das durch die Dehnung, die Räder blockiert würden. Bei einer Fahrt konnte man bis zu 24 Reichsmark verdienen, wogegen
1 Zentner Roggen für 8 bis 9 Reichsmark zu haben war. Ich bin selbst, mit dem Pferdewagen bis Fürstenwalde, Radostowen,
Luka, Altkirchen, Höhenwerder, ja sogar bis Friedrichshof gefahren.
In Rohmanen wurden auch rote Ziegeln gebrannt. Viele Häuser wurden, mit Ziegeln erbaut, die nur wenige 100 Meter von
der Baustelle entfernt hergestellt wurden. Der Lehn wurde auf den Feldern in der näheren Umgebung entnommen, dann von
Ochsen solange getreten, bis er so geschmeidig war, das er sich in Formen einstreichen ließ. Wenn die Ziegel in der
Form trocken war, wurde sie entnommen und in einem Brennofen gestapelt. Um einen Ofen richtig anzufeuern, brauchte man
12 Raummeter Holz, das im Zeitraum von ein par Tagen verheizt wurde. Der Fischer Karl Glitza hatte schon eine
Knetmaschine, die von einem Pferd angetrieben wurde, das mit verbundenen Augen, den ganzen Tag in die Runde ging.
Im Dorf waren auch vier Kalköfen, in denen so genannte Kalksteine, die sich an gewissen Stellen, im Erdboden befanden,
gebrannt wurden. Nach dem Brennen wurden die Steine mit Wasser abgelöscht und die daraus entstandne Masse diente, nach
dem Beimischen einer gewissen Menge Sand, dann als Bindemittel beim Häuserbau. Das Gerichtsgebäude und das
Lehrerseminar in Ortelsburg wurden mit Kalk, aus dem Rohmaner Brennöfen erbaut. Auch zum Bau einer Eisenbahnbrücke, auf
der, der Zug, den Sawitzfluß, von Ortelsburg nach Allenstein überquerte, hat mein Großvater, mit einem Ochsengespann,
Kalk gefahren.
Hinter der Scheune, beim Bauern Johann Dembek hat man Tonerde gefördert, aus der man mit Hilfe einer Formerscheibe,
die von einem Arbeiter mit Muskelkraft(Fußbetrieb) angetrieben wurde, schöne Krüge, Schalen und Vasen geformt hat.
Die Töpferware wurde, nachdem sie trocken genug war, auch in einem Ofen gebrannt, anschließend mit einer Lasur
überzogen und wieder gebrannt. Es wurden auch Kacheln zum Bau von Kachelöfen hergestellt, die mit verschiedenen
Ornamenten versehen, die Wohnstuben unserer Vorfahren schmückten. So haben unsere Großväter ihr Leben gemeistert und
nach und nach, unsere Dörfer aus der Rückständigkeit in die Neuzeit geführt.
Das gesellschaftliche Leben nach dem 1. Weltkrieg

Als der Lehrer Alfred Dorka, ein Frontkämpfer des Ersten Weltkrieges und ein Sportsmann, als
zweite Lehrkraft an der Rohmaner Schule angestellt wurde, hat er die Sitten und Gebräuche aus früherer Zeit wieder zum
Leben erweckt. Zuerst hat er die Jugend zusammen gerufen, einen Jugendverein und einen Fußballclub, gegründet. Zum
Vorsitzenden des Fußballclubs wurde Johann Gloddek berufen, der ihn auch geleitet hat. Bauer Wilhelm Spittka, der am
Rohmaner See wohnte, stellte Land für einen Sportplatz unentgeltlich zur Verfügung. Lehrer Alfred Dorka hat am
Rohmaner See eine Badestelle ausgesucht und ein Sprungbrett bauen lassen. An jedem Sonnabend im Sommer, bevor die
Sonne unterging, versammelte sich die gestammte Jugend des Dorfes an der Badestelle am See. Es wurde gebadet,
Heimatlieder gesungen, gespielt, im Fackelschein eines großen Biwakfeuers, bis in die späte Nacht hinein. Der Fischer
Karl Glitza hat uns Kähne zur Verfügung gestellt, mit denen wir auf den See hinausgepaddelt sind, dabei hatten wir viel
Spaß, was wiederum den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft gefördert hat. Ich habe mit meiner Mandoline den Gesang von
Volks- und Heimatliedern begleitet.
Der Rohmaner See liegt in einem Tal, dessen Hänge zu beiden Seiten mit Kiefern und Tannen bewaldet sind. Wenn man
gesungen oder Musiziert hat, hallte es von den Hängen zurück. Die Ufer waren mit Kalmus und Schilf bewachsen, was für
die Fischaufzucht von Vorteil war. Wenn man an einem sonnigen, windstillen Tag, am Seeufer spazieren ging, traf man
oft auf Flachstellen, an denen sich die Fischbrut im Sonnenlicht wärmte, wie ein Mückenschwarm. Im See befanden sich
folgende Fische: Karpfen, Hechte, Schleie, Barsche Plötze, Rotaugen, Aale und Krebse. Am Sonntagmorgen brachten viele
Rohmaner ihre Pferde zum See um sie zu baden.
Es wurden dort, unter der Aufsicht von Lehrer Dorka, auch viele Jugendfeste mit Theatervorführungen veranstaltet, zu
denen er selbst die Vorlagen organisiert hat. Der am See wohnende Bauer Johann Nadrowski, hat uns ein Scheunentor, als
Tanzboden zur Verfügung gestellt. Der Zimmermann Wilhelm Wittek hat uns eine Windmühle gebaut, die am auf dem Boden
liegenden Scheunentor aufgestellt wurde, dazu kamen Noch Tannen und Fichten, die das Ganze wie ein Bühnenbild
erscheinen ließen. Es wunden viele Bühnenstücke aufgeführt, unter anderen >Alte Weiber werden jung gemahlen<. Dazu bot
die Windmühle die entsprechende Kulisse.
Nach der Vorführung wurde der Boden aufgeräumt, um dann als Tanzdiele zur Verfügung zu stehen. Der Gastwirt Trzaska
hatte Tische und Bänke aufgestellt, Speisen und Getränke angeboten, so dass sich die die Veranstaltung bis in die
späte Nacht hinein zog. Es waren auch Leute aus Ortelsburg und anderen Nachbardörfern dabei. Im Winter hat Lehrer
Dorka eine Kreisrodelbahn eingerichtet, die von Zeit zu Zeit mit Wasser besprengt wurde, um die Gleitfähigkeit zu
verbessern. Von einer Anhöhe ging hinunter bis auf den halben See, was für alle ein großes Vergnügen war. Es kamen
Lehrer mit Schulklassen aus der näheren Umgebung um hier zu Rodeln.
Als Herr Lehrer Jobski als Hauptlehrer nach Rohmanen kam hat er mit dem Bürgermeister und der Gemeindeverwaltung
beschlossen, in der Nähe des Dorfes, auf einem zur Schule gehörenden Grundstück, einen Sportplatz anzulegen. Dafür
wurde gleich hinter den Gärten, 6 Morgen Ackerland abgetrennt, und nach Feierabend hat Lehrer Dorka mit den
Jugendlichen eingeebnet und gleich nebenan einen Graben für Schützenstand und Kugelfang ausgehoben. Am Sonntagvormittag
wurde Fußball gespielt und um 15:00 Uhr war Kleinkalieberschießen angesagt. Es musste auch ein kleiner Beitrag erhoben
werden, um Munition kaufen zu können. Eine Büchse konnten wir aus beim Kleinkalieberverein in Ortelsburg ausleihen.
Nach Hitlers Machtergreifung
Als Adolf Hitler an die Macht kam wurde die SA gegründet. Der Bürgermeister Michael Kownatzki
wurde zum Gruppenführer ernannt und folgende Männer haben sich freiwillig gemeldet: Wilhelm Matzey, Johann Gloddek,
Gustav Nadrowski, August Buttler, Karl Baran, Emil Nickel, Wilhelm Jaschinski, Emil Bork, Ernst Rattay und Gustav Bach.
Bei Versammlungen war die SA in Uniform angetreten um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Wer versucht hat Unruhe zu
stiften, egal aus welchem Grunde, wurde aufgefordert den Saal zu verlassen, andernfalls wurde er mit Gewalt entfernt.
Herr Lehrer Jobski wurde zum politischen Leiter ernannt, seine Frau hat die NS-Frauenschaft gegründet, Lehrer Dorka
die HJ, und so bekam die Dorfgemeinschaft, nach und nach ein anderes Gesicht. Der Sportplatz und der Schützenstand
wurden jetzt mehr als früher in den Mittelpunkt gestellt. Nach der Feldarbeit hat der Bürgermeister Fuhrwerke bestellt
und den Sportplatz noch besser herrichten lassen.
Der Bauer Wilhelm Both wurde zum Ortsbauernführer ernannt, mit der Aufgabe alles Land für den Anbau von Getreide und
Futtermittel bereitzustellen, oder wenn das nicht möglich war mit Wald aufzuforsten. Durch den Einsatz von Kunstdüngern
sollten größere Erträge aus dem Boden geholt werden, um den Viehbestand zu vergrößern und mehr Milch und Butter zu
produzieren. Deutschland sollte im Stande sein sich selbst zu selbst zu ernähren, ohne auf Importe angewiesen zu sein.
Frau Jobski hat, innerhalb der der NS-Frauenschaft, mit Hilfe von Fachkräften aus Ortelsburg, Lehrgänge veranstaltet,
auf denen man Backen und Nähen lernte. Auf den Bauernhöfen befand sich auch immer mehr Rassegeflügel, das eine erhöhte
Produktion von Eiern und Geflügelfleisch sicherstellen sollte.
Die Rohmaner Bauern hatten, außer in der Landwirtschaft, noch andere Verdienstmöglichkeiten in der Kreisstadt. In
Ortelsburg wurden vier Sägewerke betrieben, die mit Langholz aus dem Walde versorgt werden mussten. Wir haben eine
Kiefer von über 8 Festmeter angefahren, der wir zuerst 6 Meter Spitze abschneiden mussten, um diese Last überhaupt
auf den Wagen zu bekommen. Sechs Pferde musste angespannt werden um den Wagen zur befestigten Straße zu bringen.
Fichten und Tannen wuchsen bis zu einer Länge von 30 Metern. Auch beim Transport von Ziegel, von der Ziegelei zum
Bahnhof, konnte man gutes Geld verdienen.
Im Jahr 1934 wurde Rohmanen an das überregionale Stromnetz angeschlossen und schaffte auf diese Weise den Sprung von
der Petroleumlampe zur Glühbirne. Neben dem Grundstück von Karl Pietzonka wurde ein Transformatorhäuschen errichtet,
in dem der ankommende Strom von einer Hochspannung auf eine Verbrauchsspannung transformiert wurde. Es gab schon eine
Überlandleitung, die aus Richtung Ortelsburg kommend, quer über die Felder, in Richtung Neu Keykuth weiter ging.
Durch eine Zwischenspanne wurde der Transformator, mit der Hauptleitung auf Kownatzkis Feld verbunden.
Ein Stromanschluss konnte die Arbeit im Haus und Hof auf vielfältige Weise erleichtern, doch nur die besser gestellten
Bauern, sowie noch manche Pensionäre, die ein festes Einkommen hatten, konnten sich dass leisten. Weil nur wenige an
der Elektrifizierung teilnahmen, war ein Stromanschluss mit hohen Kosten verbunden. Nur Gustav Pietzonka, Gasthof
Trzaska, Friedrich Nickel, die Schule und Wilhelm Both, wurden in der ersten Phase erfasst.
Im Jahr 1952 wurde von den polnischen Behörden die zweite Stufe der Elektrifizierung eingeleitet, in der alle im Dorf
stehen Gebäude erfasst wurden. Am Anfang wurden nur Leitungen für Lichtstrom gelegt und auch nur 3 Lichtstellen pro
Haushalt bewilligt. Doch im nachfolgenden Zeitraum wurden dann, wenn Material vorhanden war, weitere Lichtpunkte
angelegt. 1952, am zweiten Wochenende im Advent, wurden dann die Leitungen geschaltet und alle waren von der
plötzlichen Helligkeit sehr begeistert. Wenn man Glühbirnen auswechseln wollte musste man am Anfang weite Wege
zurücklegen, um welche zu bekommen. In den 60ger Jahren wurden dann immer mehr Starkstromleitungen gelegt, weil die
Bauern elektrische Geräte kaufen konnten. Ende der 60ger wurden auch die Abbauten an das Stromnetz angeschlossen.
Das Urnengrab auf unserem Feld
Auf unserem Feld, in Richtung Seelonken, bin ich oft beim pflügen gegen Steine gestoßen, manchmal
rissen sogar die Stränge am Pferdegeschirr. Eines Tages nahm ich einen Spaten, Brechstange und einen langen Baum, um
der Sache auf den Grund zu gehen. Als ich eine Menge Sand ausgehoben hatte stieß ich auf eine steile, aus Steinen
errichtete Wand, die ich auch mit dem Baum nicht aus der Fassung bringen konnte. Ich habe den ganzen Vormittag gegraben,
konnte jedoch nicht unter die Steine kommen. Einige Tage später hatten wir in der Schule eine Bauernversammlung, da
habe ich Herrn Biella und Herrn Lehrer Dorka von meinem Fund berichtet. Am nächsten Morgen kam der Lehrer Dorka mit der
ganzen Schulklasse, mit Spaten und Sieben ausgerüstet auf unser Feld und fingen an die ausgehobene Erde zu sieben.
Lehrer Dorka benachrichtigte daraufhin den Leiter des Ortelsburger Heimatmuseums, der am nächsten Morgen vorbei kam um
sich die Fundstelle genau anzusehen. Er beauftragte ihn 4 Mann zu besorgen, um die Steine ringsum frei zu schaufeln.
Zwischen den Steinen durften wir die Erde nur mit Esslöffeln ausheben. Als es plötzlich zu regnen anfing hat Lehrer
Dorka die Brauerei Daum, in Ortelsburg angerufen, die uns über der Fundstelle ein Zelt errichtet haben, damit wir
ungestört weiterarbeiten konnten. Wir fanden 8 flache und 8 hohe Urnen zu beiden Seiten am Körper. Die Urnen wurden in
Gipsbinden eingewickelt und ins Heimatmuseum nach Ortelsburg gebracht, wo sie durch einen Fachmann, der extra aus einem
Königsberger Museum angereist war. Nach Reinigung der Urnen hat er festgestellt, das die Grabstätte etwa 2000 Jahre vor
Christi Geburt angelegt wurde und ein Doppelgrab war, in dem ein Toter liegend und einer in Hochstellung beigesetzt
wurde.
Die Nachricht von der Fundstelle verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Es erschienen viele Schaulustige, ganze
Schulklassen aus der Umgebung, mit Autos und zu Fuß. Durch die vielen Menschen wurden die bestellten Ackerflächen auf
unserem Feld sehr in Mitleidenschaft gezogen, eine Entschädigung haben wir nicht erhalten. Das Grab wurde vor dem
Heimatmuseum in Ortelsburg wieder so aufgebaut wie man es auf unserem Feld vorgefunden hat. Für den Transport der
Steine wurde ich entlohnt. Die Urnen hat das Königsberger Museum an sich genommen und wollte sie nicht wieder hergeben,
weil die solch einen Fund noch nicht in ihrer Sammlung hatten.
Sonnenwendfeuer
Am 24 Juni fand eine Sonnenwendfeier statt. Ein Brauch der an die alten Germanen erinnern sollte.
Der Lehrer Dorka hat den Bürgermeister beauftragt 2 Fuhrwerke in den Wald zu schicken, die Holz und alten Reisig holen
und auf dem großen Schulberg abladen sollten. Das Straßenbauamt hat uns Teertonnen zur Verfügung gestellt. Die ganze
Dorfgemeinschaft wurde eingeladen, am Abend, nach der Feldarbeit, an der Sonnenwendfeier teilzunehmen. Lehrer Dorka
hielt zuerst eine Ansprache, in der er anschaulich erklärte wie unsere Vorfahren in grauer Vorzeit gefeiert haben.
Nach dem offiziellen Teil wurden das Holz und die Teertonnen angezündet, es wurden Heimatlieder gesungen, wie: Wild
flutet der See, drauf schaukelt der Schiffer den schwankenden Kahn, Schaum wälzt er wie Schnee, von grausiger Mitte
zum Ufer heran, wild fluten die Wellen auf Vaterlands See, wie schön, oh trag mich auf Spiegel zu Hügel, Masovias See.
Masovia Land, mein Heimatland, Masovia es lebe mein Vaterland.
Lehrer Alfred Dorka und sein Wirken für Rohmanen.

Friedrich Biella hatte auf seinem Feld einen Granitstein mit einer geraden Seite, den haben wir
mit viel Schweiß an den Dorfteich transportiert und auf einer Erhöhung abgelegt. Der Stein sollte zum Denkmahl für die
Gefallenen des Ersten Weltkrieges umgestaltet werden. Da zu Wenige daran ein Interesse zeigten, wurde diese Idee fallen
gelassen und der Stein irgendwann ins Wasser gerollt. Der Lehrer Dorka war viele Jahre in Rohmanen tätig, dort hat er
später seine ehemalige Schülerin, Lotte Biella geheiratet. Er hat sich sehr für die Entwicklung des Dorfes interessiert,
war bei jeder Gemeindeversammlung anwesend und hat auf Schwachstellen hingewiesen die den Fortschritt behinderten.
Gemeinsam mit den Schülern hat er den Ehrenfriedhof für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges gepflegt, an der
Wegegablung nach Eichtal und zu Ehren des Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg eine Eiche gepflanzt.
Zum Advent hat Lehrer Dorka mit der Jugend einen Adventstern, in verschiedenen Farben gebastelt.
Der Stern wurde auf einer 2 Meter langen Stange befestigt, in der Mitte wurde ein Wachslicht angezündet, am Stern
wurde eine Schnur angebracht, wenn man daran zog rollte der Stern hin und her. Am ersten Wochenende im Advent
versammelten sich jung und alt, um den Stern durch das Dorf zu tragen. Alle schlossen sich dem vorausgehenden
Sternträger an, der den Stern durch die Hauptstraße und die angrenzenden Wege trug. Dieser Sternmarsch wurde an den
folgenden Adventwochenenden wiederholt.
Am ersten Weihnachtfeiertag wurde um 4:00 Uhr morgens ein Frühgottesdienst gehalten. Zuerst hat der Pfarrer eine
Andacht gehalten, dann haben die Kinder ein Krippenspiel aufgeführt und die Gemeinde hat schöne Weihnachtslieder
gesungen. Der Gastwirt Trzaska hat uns den Saal zur Verfügung gestellt. Wir hatten eine Posaunen- u. eine
Gitarrengruppe. Unter der Leitung von Herrn Willi Doormann spielten: Gottlieb Brosch, Fritz Ollech,
Gustav Rattay(Sopran), Wilhelm Pilath, Gustav Brosch(Alt), Fritz Both(Tenor) und Fritz Brosch(Bass).
In der Gitarrengruppe wirkten mit: Martha Ollech, Hedwig Ollech, Martha Lekzik, Martha Michalick und Auguste Lekzick.
Willy Doormann hat sie auf der Geige begleitet.
Kurz vor Ausbruch des 2. Weltkrieges
Bei der Aufstellung des Grenzschutzes(Regiment Buchholz), hat er als Hauptfeldwebel die
Gruppenführerkurse überwacht und selbst die fähigsten Männer dafür vorgeschlagen. Das Ausbildungspersonal hat das
Jäger-Battalion gestellt. Wir kamen zuerst ins Stadion(Waldheim), wurden da eingekleidet und dann ging es gleich
kasernenmäßig zu, theoretisch und praktisch. Jeder musste vor die Front treten und nachweisen ob er im Stande ist,
Befehle zu erteilen. Abends wurden Filme vorgeführt die uns zeigen sollten wie eine Gruppe sich im Gelände entfalten
muss. Die Exerziervorschriften hatten sich, im Verhältnis zu Kaiser Wilhelms Zeiten, etwas geändert. Damals bestand
eine Gruppe aus 8 Mann und einem Unteroffizier, jetzt aus 10 Schützen, 3 für das leichte Maschinengewehr und einem
Unteroffizier(13 Mann). Nach der Schulung folgte eine Abschlussprüfung, danach ein gemütliches Beisammensein. Aus
Rohmanen haben folgende Männer die Prüfung bestanden: Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy, Gustav Rattay und
Gustav Deptolla. Unsere Uniformen waren alle zu klein und es gab viel zu lachen bei der Anprobe.
Die erste Übung habe ich mit Emil Rosowski, in Lenzinen gemacht. Der Gutsbesitzer Marzinzick hat seine Scheune als
Unterkunft zur Verfügung gestellt. Er war im Range eines Hauptfeldwebels. In seinem haus war die Schreibstube
untergebracht, die er selbst verwaltete. Ein Lastauto hatte Uniformen aus der Kaserne in Ortelsburg geholt, jeder
musste eine Uniform anlegen und dann wurde solange getauscht bis alle eine passende gefunden hatten. An den Namen des
Kompanieführers kann ich mich nicht mehr erinnern. 1935 wurden wir zu einer Übung in die Dragonerkaserne nach Lyk
einberufen. Die Gruppenführer, Zugführer, und Kompanieführer die schon Frontberührung im dem Ersten Weltkrieg hatten,
mussten eine Woche früher anreisen. Die Übungen waren auf 6 Wochen angelegt. Die meisten der einberufenen waren noch
nie mit dem Wehrdienst in Berührung gekommen. Jeder Gruppenführer bekam 13 Mann zugeteilt.
Unser Zugführer war Leutnant Neumann, Kompanieführer Oberleutnant Rutschko, Battalions-Kommandeur Major Gröning
(Regiment Buchholz). Hier ging es wieder Kasernenmäßig voran. Das Bataillon wurde hier vereidigt. Jeden zweiten
Sonntag durften unsere Frauen uns besuchen. Ein Jahr später wurden wir wieder zu einer Übung einberufen, auf den
Truppenübungsplatz nach Arys. Jeder Gruppenführer hatte den Auftrag die Gruppe zu entfalten, und auf bewegliche
Figuren zu schießen. Diese Übung musste später mit scharfer Munition wiederholt werden. Jedes Maschinengewehr bekam
50 Schuss, jeder Schütze 20 Schuss zugeteilt. Nach dem Abschießen wurden die Treffer gezählt und dem Kommandierenden
Bericht erstattet. In einiger Entfernung spaziert ein Storch umher, der gar nicht bemerkt hatte dass geschossen wurde,
was bei den Kameraden ein großes Gelächter hervorrief.
Nach der Übung wurde uns gesagt das jeder Gruppenführer eine arische Abstammung nachweisen sollte. Ich konnte in den
Rheinsweiner Kirchenbüchern meine Vorfahren aus Gellen, bis zum Jahr 1732 zurück, nachweisen und wurde zum
Unteroffizier befördert. Aus unserem Dorf wurden auch, Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy und Gustav Deptolla
befördert. Zwischendurch mussten wir schon mal in die Radfahrer-Kaserne nach Ortelsburg, Gewehre empfangen und im
Gelände üben. Am 31 Juli 1939 wurde mir von einem Soldaten ein Schreiben übereicht, das mich aufforderte, am 1. August
um 6:00 Uhr, bei der 3. Kompanie, des 2. Infanterieregiments zu erscheinen.
Um 5:30 hat mich meine Schwester in die Kaserne gebracht. Auf der Schreibstube erklärte mir der Hauptfeldwebel,
dass mir ab sofort der Dienstgrad eines Sanitäters zugewiesen wird, ich mich in der Kammer einzukleiden hätte und mir
in der Handwerkerstube die entsprechenden Schulterklappen annähen lassen sollte. Die aktiven Sanitäter wurden den
Feldlazaretten zugewiesen und wir kamen an ihre Stelle. Unser Bataillon wurde nach Schodmak zum Bunker bauen und
Stacheldraht verlegen eingeteilt. Wir zogen in Begleitung einer Musikkapelle bis zur Kreuzung am Krankenhaus, dann
weiter zu unserem Bestimmungsort, gefolgt von einer Gulaschkanone die in den nächsten Tagen für unsere Verpflegung
sorgen sollte.
Am 14 August haben wir die Jägerkaserne, begleitet von einer Musikkapelle endgültig verlassen und zogen zuerst durch
Ortelsburg, dann über Lehmanen ins Feldmanöver, hinter Rohmanen. Dort entfaltete sich das Bataillon im Gelände, die
Verwundetensammelstelle wurde auf dem Hof des Bauern Friedrich Neumann eingerichtet. Gegen Abend wurde zu Sammeln
geblasen und Biwak bezogen, wobei unsere 3.Kompanie, in einem kleinen Wallt, in der Nähe von Otto Nickels Gehöft
Stellung bezogen hatte. Die 2. und 4. Kompanie hatte sich in der Nähe vom Abbau Pallasch niedergelassen. Die Frau
Nickel hat am Abend ein Mädel in Dorf geschickt um meiner Frau Bescheid zu sagen, wo wir uns zurzeit befinden. Meine
Frau ist dann noch gekommen um sich von mir zu verabschieden, weil wir am nächsten Morgen um 3:00 Uhr Zelte abbrechen
und um 4:00 Uhr in Richtung Kaspersguth marschieren sollten.
Wir sind dann über Achodden, Seelonken, Lehmanen, Ortelsburg, bis nach Grammen und Schützendorf marschiert, wo wir an
einem See Biwak bezogen haben. Es wurde immer gesagt, wir kommen zum Tannenberg-Denkmal bei Hohenstein, wo ein Reichs
Kriegervereinsfest stattfinden sollte. Es wurden auch schon Vorkommandos aufgestellt, doch dann kamen wir nach Orlau
und Lahna-Mühle, da wo die Alle entspringt haben wir 2 Tage biwakiert. Unser Kompanieführer hat uns nach Waplitz auf
den Soldatenfriedhof des Ersten Weltkrieges geführt und uns erklärt wie das Jägerbataillon sich 1914 hier entfaltet
hat und aufgerieben wurde. Dann mussten wir in der Nähe von Gut Koslau über einen Fluss und bezogen in einem Waldstück,
vorbereitete Stellungen in der Nähe der polnischen Grenze. Herr und Frau Thalmann haben uns jeden Tag, bis zur Grenze,
mit Brötchen und Getränken versorgt. Es wurde scharfe Munition ausgegeben, weil wir am nächsten Morgen um 4:00 Uhr die
polnische Grenze überschreiten sollten.
Am nächsten Morgen um 10 Minuten vor 4:00 Uhr kam der Befehl; scharfe Munition abgeben, alles zurück in ein 6 Kilometer
entferntes Dorf, wo wir auch einquartiert wurden. Das alles geschah’ eine Woche vor dem 1. September 1939. Es wurde
gesagt dass der Führer dem polnischen Präsidenten Rid-Szmigly, ein Ultimatum gestellt hat und es wahrscheinlich nicht
zum Krieg mit Polen kommt. Genau nach 5 Tagen kehrten wir wieder in die gleichen Stellungen zurück, es wurde wieder
scharfe Munition ausgegeben und am nächsten Morgen um 4:00 Uhr überschritten wir die polnische Grenze.
“Der 2. Weltkrieg.”
Der erste Einsatz in Polen
Wir kamen zuerst in ein Dorf in dem sich nur alte Menschen befanden. Auf unsere Frage wo denn die Bewohner wären sagte
man uns dass alle geflohen sind, weil erzählt wurde, die Deutschen würden alle Polen misshandeln und verstümmeln. Ich
habe ihnen daraufhin gesagt dass uns, unter Androhung von Strafe verboten wurde, einem Zivilisten etwas anzutun. Das
Vieh, die Schweine und Hunde des Dorfes liefen frei herum und die Soldaten fingen an auf die Hunde zu schießen, bis
gesagt wurde es seien Meldehunde im Dienste der Deutschen Wehrmacht und dieser Unfug der eigenen Truppe schaden würde,
weil etwaige Querschläger eigene Kameraden verletzen könnten. Wir gingen weiter auf polnischer Seite entlang der Grenze,
bis wir am Nachmittag die ersten Vorposten der Festung Mlawa erreichten, da befanden wir uns plötzlich im Feuerhagel
polnischer Festungsflack.
Am nächsten Morgen hatte ich schon 3 Verwundete und wusste nicht wo sich eine Verwundeten Sammelstelle befindet. Ich
suchte den Bataillonsgefechtstand auf der sich auf einer Anhöhe befand. Ich habe unseren Oberstabsarzt gefragt wo denn
die Verwundetensammelstelle wäre. Er rief beim Tross an, wo er die Auskunft erhielt, das sich vor dem Dorf ein Bunker
befindet in dem man die Verwundeten sammeln sollte, die dann von Sanitätsautos abgeholt würden, weil das Dorf unter
Artilleriebeschuss stand. Am Sonnabend haben unsere Flieger die Bunkerstellungen bombardiert, konnten aber, trotz guter
Treffer nicht viel ausrichten, die Bunker wurden nur etwas angekratzt.
Der Beschuss unserer vordersten Linien ging mit unverminderter Heftigkeit weiter. Am Sonntag verkündete eine große
Staubwolke die Ankunft unserer Panzer, doch sie kamen nur bis zur Panzersperre und mussten wieder abdrehen ohne den
Polen einen schaden zuzufügen. Ein Panzer bekam einen Volltreffer, der Fahrer konnte noch umkehren. Er blutete am Kopf
und der Schütze war so eingeklemmt, das wir ihn nur mit einem Seil unter den Armen, durch die Luke nach oben ziehen
konnten. Ob er seine Verwundung überlebt hat ist mir nicht bekannt, denn in der Nacht wurden Panzergeschütze nach
vorne in Stellung gebracht, die direkt in die Schießscharten der Bunker geschossen und so die Verteidiger vertrieben
haben. Daraufhin sind wir weiter vorgerückt. Auf einer Wiese war ein tiefer Graben ausgehoben und mit Ästen getarnt,
da war ein Panzer hinein gefahren, so dass nur das Hinterteil herausragte und er sich nicht aus eigner Kraft befreien
konnte. In der Luft waren Flieger die Brandbomben abwarfen, ich habe mich auf den Boden geworfen weil ich dachte die
würden explodieren, aber sie zischten nur, so das Stoppeln und Graß rings herum in Brand gerieten.
Bei den Kampfhandlungen gab es mehrere Verwundete, denen ich gerade Verbände anlegen wollte, als unser Hauptmann zur
Trillerpfeife griff um mir klar zu machen, dass ich ihm folgen sollte. Die Polen fingen an zu schreien, ich sollte
sie ins Lazarett bringen denn hier im Wald würde sie niemand finden. Ich setzte mich aufs Fahrrad und folgte unserem
Kompanieführer, der mir sagte ich soll immer bei der kämpfenden Truppe bleiben, denn hinter der Front sind die
Sanitätsabteilungen, die werden die Verwundeten schon versorgen. Der Vormarsch dauerte bis in die späte Nacht. Auf
einem Gehöft, das nach allen Seiten durch Feldwachen abgesichert wurde, machten wir endlich Rast. Wir haben
Getreidegarben auf dem Hof ausgebreitet und uns zur Ruhe gelegt, als plötzlich um Mitternacht Leuchtraketen den Himmel
erhellten und Maschinengewehrfeuer uns aus dem Schlaf schreckte. Ein par polnische Soldaten hatten das Feuer eröffnet,
aber sich kurz darauf ergeben.
Die Narew-Überquerung
Als es hell wurde ging der Vormarsch weiter. Es wurde uns untersagt Tagebuch zu führen, darum
weiß ich nicht wie die Orte hießen, durch die wir marschiert sind. Als wir durch ein sumpfiges Gelände vor drangen
stand auf einer Anhöhe am Horizont, die polnische Artillerie, die uns sofort unter Beschuss nahm. Unser Hauptmann war
der Meinung dass wir schon in der Nähe des Flusses Narew sein müssten, als aus den Sträuchern ein mit Schlauchboten
beladenes Lastauto auftauchte. Wir wurden aufgefordert mit je 6 Mann ein Schlauchboot zu nehmen, an einem Aggregat
der daneben stand mit Luft zu füllen und zu Wasser zu lassen. In einer Stunde war das ganze Bataillon über die Narew,
wo der Vormarsch fortgesetzt wurde. In einem Dorf überraschte uns die polnische Kavallerie und fing sofort mit
Maschinengewehren zu schießen an. Da kam der Befehl: Alles wieder zurück. Es ging noch schneller als auf der Hinfahrt.
Wir sind erst einige Kilometer am Fluss entlang gegangen und haben dann zum zweiten Mal rüber gesetzt.
Die Gehöfte im Dorf standen alle in Brand. Auf einem waren viele Bienestöcke. 2 Kameraden wollten den Stöcken Waben
entnehmen, doch die Bienen durch das Feuer aufgeschreckt, überfielen sie sofort und stachen derart zu das sie nicht
mehr wieder zu erkennen waren. Ich habe die Einstichstellen mit Salmiak betupft, mehr konnte ich nicht tun. Wir mussten
auf unserem Vormarsch durch einen Wald der in Flammen stand, so dass man kaum atmen konnte. Es ging weiter in Richtung
Minsk und Warschau, wo schon die Sowjetische Armee durchgegangen war, die Pferde und Vieh von einem Gut mitgenommen
hatten. In einem Wald stießen wir unverhofft auf ein Kloster, in dem wir einige Gefangene machten. Dann trafen wir auf
eine gute Straße die nach Grochow ging.
Als wir dort einmarschierten wurden wir aus den oberen Stockwerken beschossen, so dass wir, um uns zu schützen, nur an
den Hauswänden entlang gehen konnten. Wir haben jedes Haus nach Feinden durchsucht. Vor einem Haus stand ein Hund der
niemanden reinlassen wollte, solange bis ihn eine Kugel traf. Die polnische Artillerie feuerte von Warschau aus, um
unseren Vormarsch zu stoppen. Wir hatten uns gerade eingegraben als plötzlich deutsche Flieger am Himmel erschienen,
die unsere Stellungen mit Bomben bewarfen und dabei viel Unheil anrichteten. Wir haben sofort Fliegertücher
ausgebreitet und Leuchtraketen abgeschossen. Da ich in dem Graben, den ich kurz zuvor ausgehoben hatte, sofort in
Deckung gegangen bin ist mir zum Glück nichts passiert. Unter den anderen Kameraden gab es viele Verwundete, so dass
ich nicht wusste wem ich zuerst helfen sollte.
Der Oberstabsarzt hat mich sofort tatkräftig unterstützt, so das bald alle Verwundeten versorgt waren, außer einem,
dem ein Bombensplitter den Arm abgerissen hat. Ich habe im 3 große Verbandspäckchen auf die Wunde gelegt, doch die
Blutung ließ sich trotzdem nicht stoppen, so dass er eine Stunde später auf der Krankensammelstelle verstarb. Wir
haben danach in einem Tomatenfeld einen Graben ausgehoben und eine neue Abwehrstellung bezogen. Die Gruppe Schwarz
bekam den Auftrag nach etwaigen versprengten polnischen Verbänden Ausschau zu halten, als sie unerwartet aus einer
Häuserreihe mit Maschinengewehrsalven überschüttet wurden. Der Gruppenführer und noch ein Soldat wurden dabei tödlich
verwundet. Danach wurde noch ein weiter Stoßtrupp, unter der Führung von Leutnant Briskorn, der sich dazu freiwillig
gemeldet hatte, hinaus geschickt um den Gruppenführer und den anderen Toten zu bergen.
Bei diesem Unternehmen, das erfolglos ausging, weil die Toten schon verscharrt waren, durchschlug eine Kugel den
Stahlhelm von Leutnant Briskorn, der auch sofort tot war. Alle Toten wurden später, an der Kirchenmauer in Grochow, in
Särgen beigesetzt: Hauptmann Schönwald sagte, das sie nach dem Kriege auf den Heldenfriedhof nach Ortelsburg überführt
werden. Drei Tage lagen wir bei Grochow in Stellungen, waren dem polnischen Maschinengewehrfeuer sowie den Bomben
deutscher Flugzeuge ausgesetzt. In der Nacht musste ich zu einem Verwundeten in die vorderste Linie und habe den
Rückweg nicht mehr finden können, als plötzlich Gewehrfeuer aufflammte habe ich in den Ruinen Schutz gesucht. Erst im
Morgengrauen konnte ich mich wieder orientieren und zu meinem Unterstand zurückfinden.
Warschau wurde tagelang bombardiert und stand auch unter Artilleriebeschuss. Aus dunklen Rauchwolken kamen oft ganze
Bündel von Papier angeflogen. Die Verwundeten kamen oft auf Krücken zu unserem Unterstand, ich habe sie dann zur
Krankensammelstelle hingeführt. Wir haben auch polnische Zivilpersonen betreut, die während der Kampfhandlungen
verwundet wurden. Als einmal 2 Jungen vorbeiliefen hat einer ihnen nachgerufen sie sollten seiner Frau Bescheid sagen,
er wäre auf der Krankensammelstelle an der Kirche. Als wir dort ankamen war seine Frau, mit einem Kind auf dem Arm,
schon da.
Nach der Kapitulation von Warschau, gingen wir über Sokolow zum Bug und haben dort Quartier bezogen. Der Russe hatte
sich bereits hinter den Fluss zurückgezogen, hatte alles Vieh und Pferde mitgenommen. Dort erreichte mich ein Telegramm
von zu Hause, dass meine Tochter gestorben ist. Es sprach sich auch herum dass verschiedene Heimaturlaub bekommen haben,
ich durfte auch für 14 Tage heim. Wir fuhren mit Lastautos nach Allenstein in die neue Reiterkaserne, zum
Ersatzbatallion, da haben wir unsere Gewehre und Munition abgeben, dann durften wir, jeder in seinen Heimatort
weiterfahren.
Als wir unsere Quartiere am Bug verlassen haben war sehr viel Schnee gefallen. Hier in Ortelsburg fanden wir die
gleiche Wetterlage vor, aber nach 3 Tagen war alles wieder weggetaut und wir konnten die Kartoffelernte, die durch den
frühen Wintereinbruch gestoppt wurde, zu Ende bringen. Ein Tag bevor ich zu Hause angekommen bin wurde die Tochter
beerdigt. Nach 14 Tagen mussten wir uns in Allenstein melden, Gewehre empfangen und wieder zurück zur Division an den
Bug 150 Kilometer hinter Warschau. Die elfte Division, zu der wir auch gehörten sollte in den Westen Deutschlands
verlegt werden und war schon unterwegs zur Verladestation Skiernewice 50 Kilometer vor Warschau.
Mein Dienst als Sanitätsunteroffizier
Unser Bataillon kam in das Städtchen Burscheid, im Kreis Opladen, wo wir in Privatquartieren
untergebracht wurden. Nach 3 Monaten, im Januar 1940, wurden wir nach Solingen verlegt, wo wir bis zum
Frankreichfeldzug stationiert waren. Wir mussten an Feldübungen teilnehmen, wie andere die in Kasernen untergebracht
waren. Während dieser Zeit musste jeder seine Zähne in Ordnung bringen lassen. Jeden Tag fuhren 20 Mann in die
Cäzilienstraße nach Köln, zur Zahnklinik. Im Rheinland wurde unsere Division neu aufgestellt. Ausfälle durch den
Polenfeldzug wurden durch neue Soldaten ergänzt. Ich kam nun zum Ersatzbatallion, war der Älteste in der ganzen
Kompanie. Als der Frankreichfeldzug losging wurde unser Ersatzbatallion mit den noch vorhandenen Verwundeten, in die
neue Reiterkaserne, nach Allenstein verlegt.
Meine Frau hat, mit Unterstützung der Bauernschaft, einen Antrag gestellt, daraufhin wurde ich zur Frühjahrsbestellung,
beurlaubt und später bis auf weiteres vom Militärdienst freigestellt. Als der Russlandfeldzug losging wurde ich von der
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg, für 14 Tage einberufen. Ich war seit 1922, Mitglied der freiwilligen
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg und habe jedes Jahr an Übungen teilgenommen. Jede Bereitschaft musste etliche Leute
stellen. Von Rohmanen wurden Emil Rosowski, Johann Dembek, und ich, zur Krankensammelstelle Wirballen, in Litauen,
abkommandiert. Dorthin kamen Lazarettzüge aus Russland mit der Breitspurbahn. Die Verwundeten wurden frisch verbunden
und auf Waggon mit Normalspur verladen und nach Deutschland gebracht.
Als die 14 Tage vergangen waren wollten wir wieder nach Haus zurück, doch man wollte uns nicht entlassen. Stattdessen
wurden wir dem Wehrkreisamt Königsberg zugeteilt, neu eingekleidet und zur Aushilfe ins Lazarett nach Gumbinnen
abkommandiert. Mehr als ein Jahr war ich in den Urlauber-Baracken, habe dort Krankenstube betreut. Später, bis zum
Dezember 1944, war ich im Reserve-Lazarett 4, in Königsberg tätig. Dort habe ich auch die Luftangriffe der Engländer,
vom 25 bis 26. August 1944 miterlebt.
Wir sollten gerade einen Lazarettzug in Rotenstein entladen, als plötzlich die Sirenen ertönten - Fliegeralarm. Im
gleichen Moment waren die ersten Flugzeuge auch schon da, zuerst warfen sie „Tannenbäume” und danach Foßforkanister ab.
Die Omnibusse standen schon zur Abfahrt bereit als es losging. Wir haben die Verwundeten schnell in den
Luftschutzkeller getragen, haben die Betten von den Fenstern weggerückt damit die Verwundeten nicht von den
Glasssplittern verletzt wurden. Im Kasernenhof brannten die Fosforkanister lichterloh. Unsere Unterkunft, die sich in
einer Baracke befand ist völlig abgebrannt, mit dem Wenigen was wir unser Eigen nannten. Am nächsten Tag wurden wir neu
eingekleidet und am 29. bis 30. kamen die englischen Bomber wieder, sie setzten genau da ihr Zerstörungswerk fort wo
sie vor 3 Tagen aufgehört hatten.
Anfang Dezember 1944 musste ich mich nach Stablack melden und musste dann zur Sanitätsabteilung 1, nach Gernau, das
liegt zwischen Lodz und Warschau. Vormittags hatten wir Felddienstübungen und nachmittags theoretischen Unterricht.
Jeden Tag wurden Gruppen zusammengestellt und zu anderen Einheiten abkommandiert. Ich kam zu einer Panzerabteilung, wo
wir an einem Morgen plötzlich auf dem Kasernenhof antreten mussten und zu unserer Überraschung mit der Nachricht
konfrontiert wurden, dass der Russe an mehreren Frontabschnitten durchgebrochen war. Wir bekamen sofort einen
Marschbefehl in Richtung Lodz, wo das Stadtbild noch intakt war, selbst die Straßenbahnen fuhren noch. In der Nacht
haben russische Flugzeuge die Stadt bombardiert. Die Kaserne in der wir untergebracht waren hatte keine
Luftschutzkeller, aber zum Glück blieben wir von Bombentreffern verschont. Am nächsten morgen bot sich uns ein Bild der
Verwüstung. Die entgleisten Straßenbahnwagen, sowie andere Fahrzeuge blockierten die Straßen. Die Älteren unter uns
bekamen Fahrscheine für einen Transportzug, der bereit hinter Lodz abfahrbereit, unter Dampf stehen sollte. Als
russische Panzer in den Straßen auftauchten, verbrannte die Schreibstube unsere Wehrpässe und andere wichtige
Dokumente. Wir liefen zu der Station auf der unser Transportzug bereitstehen sollte, aber da war kein Zug mehr zu sehen
und wir setzten unseren Rückzug zu Fuß fort.
Der Rückzug und Zusammenbruch der Ostfront
In Dobroschin, einer Stadt in Polen, wurde gerade ein Lazarettzug verladen, doch wir kamen nicht
mehr zum Einsatz, weil die russische Infanterie uns schon auf den Fersen war. Es ging weiter über den Fluss Bober,
Sagan, bis nach Glogau an der Oder. Dort wurden wir der 29. motorisierten Sanitätskompanie zugeteilt. Im
Garnisonslazarett wurden noch Operationen durchgeführt. Unsere Division hatte ihr eigenes Feldlazarett, so dass wir den
Befehl zu Weiterfahrt erhielten und noch unbeschadet die Oderbrücke passieren konnten, denn Glogau wurde zur Festung
erklärt. Wir haben 2 Pferdewagen organisiert und mit Verbänden, sowie medizinischen Instrumenten beladen. So kamen wir
bis nach Lübbenau im Spreewald, wo wir in einem Schloss, in zuvor ein Museum war, unser Lazarett untergebracht haben.
Weil die Amerikaner Cottbus bombardiert hatten, wurden die Verwundeten zu uns nach Lübbenau gebracht. Hier haben wir
Tag und Nacht gearbeitet, um die vielen Verwundeten, aus den schweren Kämpfen bei Grünberg und Sagan zu versorgen. Die
Soldaten von der Abwehrfront kamen schon mit abgestorbenen Armen oder Beinen bei uns an, weil in vorderster Linie keine
Frontlazarette mehr vorhanden waren; es mussten viele Amputationen durchgeführt werden. Als für unsere Pferde kein Heu
mehr vorhanden war, schickte mich unser Hauptfeldwebel, zu einem Bauern in den Spreewald, mit dem Auftrag, Futter zu
besorgen. Mit noch zwei Mann fuhren mit zwei Kähnen, zuerst den Hauptstrom entlang und dann in einen Nebenarm; da haben
wir die Boote beladen und brachten das Heu nach Lübbenau.
Als wir uns bei unser Einheit zurück melden wollten, war alles schon marschbereit. Ich bin schnell in einen Bus
eingestiegen der sofort losfuhr, weil russische Verbände schon in sichtweite waren. Russische Flugzeuge kreisten über
den Dächern und nahmen, mit ihren Bordwaffen jeden unter Beschuss, der sich irgendwo blicken ließ. Wir konnten nur
durch den Wald, oder in der Nacht vorwärts kommen, denn wenn ein Auto auf der Landstraße fuhr, war alsbald ein Flugzeug
hinter ihm her und schoss es in Brand. Als wir nach Tagen am Ufer der Elbe ankamen, war bereits eine Ponton-Brücke
erstellt worden, welche die zerstörte Brücke ersetzen sollte.
Durch die vielen Fahrzeuge waren in den Sand tiefe Spuren gefahren, so dass andere Fahrzeuge unsere Busse ins
Schlepptau nehmen mussten, weil wir mit eigener Kraft nicht mehr weiterkamen. Beiderseits der Trasse standen
Flüchtlingswagen, in der der Hoffnung die Brücke passieren zu können, doch SS-Polizei verhinderte das die Gespanne den
militärischen Rückzug zum Stillstand brachten. Es gelang uns die Elbe zu überqueren, um in einem Waldstück Schutz vor
feindlichen Fliegern zu suchen.
Als wir unsere Busse und Autos gut getarnt hatten, hat unser Bataillonschef die anwesenden Parteigrößen zu sich
gerufen und ihnen erklärt das wir eine Einheit des Roten Kreuzes sind und nach internationalem Recht keine Waffen
besitzen dürfen. Nach langer, erregter Diskussion wurde beschlossen einen Graben auszuheben und alles im Sand zu
verscharren. Als wir dann weiter, durch die Dörfer fuhren, sahen wir schon viele weiße Bettlaken, als Zeichen der
Kapitulation, aus den Fenstern hängen. Es wurde uns erzählt dass der Bürgermeister von der SS erschossen wurde, weil
er die Bevölkerung zu diesem Schritt ermutigt hatte. Jetzt waren hinter uns die Russen und vor uns schon die Amerikaner.
Amerikanische Panzer fuhren umher und schossen wild durch die Gegend, ohne ein Ziel anzuvisieren. Niemand wollte sich
dem Russen ergeben, doch der Weg der zu den Amerikanern führte, war durch abgesägte Bäume blockiert. Wir sind schnell
in das nächste Dorf gegangen, haben uns Sägen und Äxte besorgt, die Bäume durchgesägt und in den Straßengraben
geworfen.
“ Nach dem Ende des 2. Weltkrieges.”
In amerikanische Kriegsgefangenschaft
Dann fuhren wir unter internationaler Flagge an eine Mulde Brücke, vor der zwei amerikanische Soldaten, mit Zigarren,
zur Hälfte im Mund, standen. Sie rauchten und kauten gleichzeitig. Wir mussten auf einen freien Platz fahren, alle
aussteigen und rechts wieder antreten. Wäschebeutel und Tornister mussten wir abstellen; danach wurden wir nach Waffen
durchsucht, Wertsachen, Uhren und Messer wurden uns gleich abgenommen. Als wir anschließend an unserem Gepäck
vorbeigingen durfte niemand was mitnehmen. Als ich gebückt, nach meinem Wäschebeutel greifen wollte, in dem sich noch
3 Konservendosen und ein Brot befanden, bekam ich einen Fußtritt ins Gesicht, so dass mir ein Zahn ausgeschlagen wurde.
Wir wurden dann in einem Garten zusammen getrieben und gefragt ob jemand bei der SS gedient hat. Nachdem wir in Reihe
und Glied angetreten waren, mussten wir den Oberkörper freimachen und die Arme anheben. Es wurde nach SS-Zeichen
gesucht, die gewöhnlich unter dem Oberarm eintätowiert waren. Nachdem wir Grimma bei Leipzig, wo wir in amerikanische
Gefangenschaft geraten waren, verlassen hatten, mussten wir durch ganz Thüringen bis Hersfeld, an der Grenze zu Hessen,
marschieren. In Hersfeld wurden wir auf große Lastautos verladen, die von farbigen Soldaten gefahren wurden. Man hat
uns mit Stöcken hinauf getrieben, solange bis das Auto so voll war das man kaum stehen konnte. Die Soldaten fuhren, für
diese Straßenverhältnisse, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Wenn die Straße eine scharfe Kurve hatte, flogen
wir alle übereinander und mussten erst mit viel Kraftanstrengung auf die Beine kommen um diese Fahrt zu überstehen.
Da die Straßenränder in dieser Gegend mit Obstbäumen bepflanzt sind und deren Äste sehr niedrig hängen, hätten die
uns die Köpfe abgerissen, wenn wir uns nicht ständig geduckt hätten. Unsere Fahrt endete in Bad Kreuznach, in der Pfalz,
wo wir in ein Lager, in dem sich später 130.000 Mann und 6 Generäle befanden, eingepfercht wurden. Die Unterkunft der
Generäle befand sich unter einem Zelt, alle anderen mussten die Zeit unter freiem Himmel zubringen. Die Offiziere, die
Unteroffiziere, die Mannschaften; wurden in getrennten Camps untergebracht. Die Mannschaften wurden auch zur Arbeit
abkommandiert und konnten bei dieser Gelegenheit, Brot, Brötchen oder Zigarettenstummel organisieren, wogegen die
Offiziere und Unteroffiziere ihr Camp überhaupt nicht verlassen durften.
Die ersten Tage gab es kein Wasser und kein Brot, so dass die Kameraden vor Erschöpfung umfielen. Später standen wir
manchmal den ganzen Tag nach Wasser an, das von den, uns bewachenden Negern mit großen Wassertanks angefahren wurde. Am
dritten Tag bekamen wir mittags und abends etwas zu Essen; Brot bekamen wir erst nach zwei Wochen, nach dem aus der
Umgebung herbeigeholte Handwerker, Backöfen gebaut hatten. In den verschiedenen Gemeinden, die in den uns umgebenden
Weinbergen lagen, mussten sich alle Männer beim Bürgermeister melden. Als sie dann erschienen waren, wurden sie auf
bereitstehende Lastautos getrieben und zu uns ins Lager gebracht. Sie waren ohne Kopfbedeckung und ohne wärmere
Bekleidung angekommen, weil ihnen gesagt wurde, dass ihr Aufenthalt im Lager nur von kurzer Dauer sein würde. Man hat
uns, falls noch vorhanden, Decken und Mäntel abgenommen, mit der Begründung, sie würden für Kranke und Verwundete
gebraucht. Jeden Tag starben mehr als 200 Mann, die wir sofort in ein Zelt tragen mussten. In der Nacht wurden die
Toten dann mit unbekanntem Ziel, weggefahren.
Viele haben ihren Verstand verloren uns irrten im ganzen Camp ziellos umher. Als Latrinen wurden Gräben ausgehoben, in
die verschiedene Kameraden, bei der Verrichtung ihrer Notdurft, vor Schwäche hineingefallen sind und nicht mehr wieder
heraus kamen. Aus den Pfählen die, die jungen Obstbäume stützten, haben wir Krankentragen gebaut um unsere Kameraden,
bei Bedarf, zur Krankensammelstelle zu tragen. Es war in diesem Frühjahr auch sehr kalt, doch unsere Erdlöcher, die wir
zum Schutz vor Kälte und Wind, nur mit leeren Konservendosen ausgehoben hatten, durften nicht tiefer als 20 Zentimeter
sein. Nach jedem Regenguss mussten wir das Wasser ausschöpfen. Nach einem Gewitter, standen wir wiedermal, total
durchnässt in unserem Camp, als unerwartet am Horizont die Sonne hervortrat. Einer unserer Kameraden hatte noch eine
Trompete gerettet und fing, von dem Anblick völlig überwältigt, zu spielen an: "Es geht alles vorüber, es geht alles
vorbei, nach jedem Dezember, folgt wieder ein Mai". Daraufhin hob sich die Stimmung der tiefbetrübten Kriegsgefangenen,
so das Heimatlieder durch das ganze Camp erklangen, obwohl wir in den nassen Kleider herumgehen mussten, bis sie am
Körper trocken wurden.
Die letzte Eiszeit hat bei der Schmelze, auf der Rohmaner Feldgemarkung viele Steine und
Granitblöcke zurück gelassen. Überirdisch, aber besonders unter der Erde, gab es viele kleine, aber auch große Steine,
die, den Bauern, beim Pflügen und anderen Feldarbeiten sehr viel Schweiß, abverlangten. In einer Kiesgrube, auf dem
Feld des Bauern August Radek, lag ein Granitblock, von schätzungsweise 100 cbm. Vor etwa 80 Jahren, als man für diese
Steine noch keine Verwendung hatte, griffen die Bauern zu einer „List”. Weil er sonst nicht pflügen konnte, hat mancher
seinem Nachbarn, die Steine in der Nacht auf dessen Feld abgeladen. Als diese Tätigkeit unter Strafe gestellt wurde,
hat man die Steine in Schluchten gekippt und mit Mutterboden zugeschüttet. In späteren Jahren kam diese jedoch beim
pflügen wieder an die Oberfläche. Dann hat man aber schon Steine für den Straßenbau gebraucht und konnte sie so zu Geld
machen. Besonders im Raum südlich von Ortelsburg, bis zur polnischen Grenze, wo Steine eine Rarität waren, kamen sie
jetzt zum Einsatz. Auch beim Bau von Häusern, besonders für die Fundamente, wurden sie eingesetzt, weil auf diese
Weise viel Ziegeln eingespart wurden. Die Firma Gribienski aus Ortelsburg hat die großen Steine mit Dynamit gesprengt
und auf diese Weise die weitere Verarbeitung erleichtert.
Die Steine welche beim Pflügen aus dem Boden geholt wurden, hat man am Feldrand auf große Haufen zusammen getragen.
Wenn die Feldarbeit beendet war, sowie auch in den Wintermonaten, waren wir jeden Tag mit Steinen unterwegs. Wir sind
vorwiegend am Abend los gefahren, weil unter der schweren Last die Wagenachsen so heiß wurden und die Gefahr bestand,
das durch die Dehnung, die Räder blockiert würden. Bei einer Fahrt konnte man bis zu 24 Reichsmark verdienen, wogegen
1 Zentner Roggen für 8 bis 9 Reichsmark zu haben war. Ich bin selbst, mit dem Pferdewagen bis Fürstenwalde, Radostowen,
Luka, Altkirchen, Höhenwerder, ja sogar bis Friedrichshof gefahren.
In Rohmanen wurden auch rote Ziegeln gebrannt. Viele Häuser wurden, mit Ziegeln erbaut, die nur wenige 100 Meter von
der Baustelle entfernt hergestellt wurden. Der Lehn wurde auf den Feldern in der näheren Umgebung entnommen, dann von
Ochsen solange getreten, bis er so geschmeidig war, das er sich in Formen einstreichen ließ. Wenn die Ziegel in der
Form trocken war, wurde sie entnommen und in einem Brennofen gestapelt. Um einen Ofen richtig anzufeuern, brauchte man
12 Raummeter Holz, das im Zeitraum von ein par Tagen verheizt wurde. Der Fischer Karl Glitza hatte schon eine
Knetmaschine, die von einem Pferd angetrieben wurde, das mit verbundenen Augen, den ganzen Tag in die Runde ging.
Im Dorf waren auch vier Kalköfen, in denen so genannte Kalksteine, die sich an gewissen Stellen, im Erdboden befanden,
gebrannt wurden. Nach dem Brennen wurden die Steine mit Wasser abgelöscht und die daraus entstandne Masse diente, nach
dem Beimischen einer gewissen Menge Sand, dann als Bindemittel beim Häuserbau. Das Gerichtsgebäude und das
Lehrerseminar in Ortelsburg wurden mit Kalk, aus dem Rohmaner Brennöfen erbaut. Auch zum Bau einer Eisenbahnbrücke, auf
der, der Zug, den Sawitzfluß, von Ortelsburg nach Allenstein überquerte, hat mein Großvater, mit einem Ochsengespann,
Kalk gefahren.
Hinter der Scheune, beim Bauern Johann Dembek hat man Tonerde gefördert, aus der man mit Hilfe einer Formerscheibe,
die von einem Arbeiter mit Muskelkraft(Fußbetrieb) angetrieben wurde, schöne Krüge, Schalen und Vasen geformt hat.
Die Töpferware wurde, nachdem sie trocken genug war, auch in einem Ofen gebrannt, anschließend mit einer Lasur
überzogen und wieder gebrannt. Es wurden auch Kacheln zum Bau von Kachelöfen hergestellt, die mit verschiedenen
Ornamenten versehen, die Wohnstuben unserer Vorfahren schmückten. So haben unsere Großväter ihr Leben gemeistert und
nach und nach, unsere Dörfer aus der Rückständigkeit in die Neuzeit geführt.
Das gesellschaftliche Leben nach dem 1. Weltkrieg

Als der Lehrer Alfred Dorka, ein Frontkämpfer des Ersten Weltkrieges und ein Sportsmann, als
zweite Lehrkraft an der Rohmaner Schule angestellt wurde, hat er die Sitten und Gebräuche aus früherer Zeit wieder zum
Leben erweckt. Zuerst hat er die Jugend zusammen gerufen, einen Jugendverein und einen Fußballclub, gegründet. Zum
Vorsitzenden des Fußballclubs wurde Johann Gloddek berufen, der ihn auch geleitet hat. Bauer Wilhelm Spittka, der am
Rohmaner See wohnte, stellte Land für einen Sportplatz unentgeltlich zur Verfügung. Lehrer Alfred Dorka hat am
Rohmaner See eine Badestelle ausgesucht und ein Sprungbrett bauen lassen. An jedem Sonnabend im Sommer, bevor die
Sonne unterging, versammelte sich die gestammte Jugend des Dorfes an der Badestelle am See. Es wurde gebadet,
Heimatlieder gesungen, gespielt, im Fackelschein eines großen Biwakfeuers, bis in die späte Nacht hinein. Der Fischer
Karl Glitza hat uns Kähne zur Verfügung gestellt, mit denen wir auf den See hinausgepaddelt sind, dabei hatten wir viel
Spaß, was wiederum den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft gefördert hat. Ich habe mit meiner Mandoline den Gesang von
Volks- und Heimatliedern begleitet.
Der Rohmaner See liegt in einem Tal, dessen Hänge zu beiden Seiten mit Kiefern und Tannen bewaldet sind. Wenn man
gesungen oder Musiziert hat, hallte es von den Hängen zurück. Die Ufer waren mit Kalmus und Schilf bewachsen, was für
die Fischaufzucht von Vorteil war. Wenn man an einem sonnigen, windstillen Tag, am Seeufer spazieren ging, traf man
oft auf Flachstellen, an denen sich die Fischbrut im Sonnenlicht wärmte, wie ein Mückenschwarm. Im See befanden sich
folgende Fische: Karpfen, Hechte, Schleie, Barsche Plötze, Rotaugen, Aale und Krebse. Am Sonntagmorgen brachten viele
Rohmaner ihre Pferde zum See um sie zu baden.
Es wurden dort, unter der Aufsicht von Lehrer Dorka, auch viele Jugendfeste mit Theatervorführungen veranstaltet, zu
denen er selbst die Vorlagen organisiert hat. Der am See wohnende Bauer Johann Nadrowski, hat uns ein Scheunentor, als
Tanzboden zur Verfügung gestellt. Der Zimmermann Wilhelm Wittek hat uns eine Windmühle gebaut, die am auf dem Boden
liegenden Scheunentor aufgestellt wurde, dazu kamen Noch Tannen und Fichten, die das Ganze wie ein Bühnenbild
erscheinen ließen. Es wunden viele Bühnenstücke aufgeführt, unter anderen >Alte Weiber werden jung gemahlen<. Dazu bot
die Windmühle die entsprechende Kulisse.
Nach der Vorführung wurde der Boden aufgeräumt, um dann als Tanzdiele zur Verfügung zu stehen. Der Gastwirt Trzaska
hatte Tische und Bänke aufgestellt, Speisen und Getränke angeboten, so dass sich die die Veranstaltung bis in die
späte Nacht hinein zog. Es waren auch Leute aus Ortelsburg und anderen Nachbardörfern dabei. Im Winter hat Lehrer
Dorka eine Kreisrodelbahn eingerichtet, die von Zeit zu Zeit mit Wasser besprengt wurde, um die Gleitfähigkeit zu
verbessern. Von einer Anhöhe ging hinunter bis auf den halben See, was für alle ein großes Vergnügen war. Es kamen
Lehrer mit Schulklassen aus der näheren Umgebung um hier zu Rodeln.
Als Herr Lehrer Jobski als Hauptlehrer nach Rohmanen kam hat er mit dem Bürgermeister und der Gemeindeverwaltung
beschlossen, in der Nähe des Dorfes, auf einem zur Schule gehörenden Grundstück, einen Sportplatz anzulegen. Dafür
wurde gleich hinter den Gärten, 6 Morgen Ackerland abgetrennt, und nach Feierabend hat Lehrer Dorka mit den
Jugendlichen eingeebnet und gleich nebenan einen Graben für Schützenstand und Kugelfang ausgehoben. Am Sonntagvormittag
wurde Fußball gespielt und um 15:00 Uhr war Kleinkalieberschießen angesagt. Es musste auch ein kleiner Beitrag erhoben
werden, um Munition kaufen zu können. Eine Büchse konnten wir aus beim Kleinkalieberverein in Ortelsburg ausleihen.
Nach Hitlers Machtergreifung
Als Adolf Hitler an die Macht kam wurde die SA gegründet. Der Bürgermeister Michael Kownatzki
wurde zum Gruppenführer ernannt und folgende Männer haben sich freiwillig gemeldet: Wilhelm Matzey, Johann Gloddek,
Gustav Nadrowski, August Buttler, Karl Baran, Emil Nickel, Wilhelm Jaschinski, Emil Bork, Ernst Rattay und Gustav Bach.
Bei Versammlungen war die SA in Uniform angetreten um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Wer versucht hat Unruhe zu
stiften, egal aus welchem Grunde, wurde aufgefordert den Saal zu verlassen, andernfalls wurde er mit Gewalt entfernt.
Herr Lehrer Jobski wurde zum politischen Leiter ernannt, seine Frau hat die NS-Frauenschaft gegründet, Lehrer Dorka
die HJ, und so bekam die Dorfgemeinschaft, nach und nach ein anderes Gesicht. Der Sportplatz und der Schützenstand
wurden jetzt mehr als früher in den Mittelpunkt gestellt. Nach der Feldarbeit hat der Bürgermeister Fuhrwerke bestellt
und den Sportplatz noch besser herrichten lassen.
Der Bauer Wilhelm Both wurde zum Ortsbauernführer ernannt, mit der Aufgabe alles Land für den Anbau von Getreide und
Futtermittel bereitzustellen, oder wenn das nicht möglich war mit Wald aufzuforsten. Durch den Einsatz von Kunstdüngern
sollten größere Erträge aus dem Boden geholt werden, um den Viehbestand zu vergrößern und mehr Milch und Butter zu
produzieren. Deutschland sollte im Stande sein sich selbst zu selbst zu ernähren, ohne auf Importe angewiesen zu sein.
Frau Jobski hat, innerhalb der der NS-Frauenschaft, mit Hilfe von Fachkräften aus Ortelsburg, Lehrgänge veranstaltet,
auf denen man Backen und Nähen lernte. Auf den Bauernhöfen befand sich auch immer mehr Rassegeflügel, das eine erhöhte
Produktion von Eiern und Geflügelfleisch sicherstellen sollte.
Die Rohmaner Bauern hatten, außer in der Landwirtschaft, noch andere Verdienstmöglichkeiten in der Kreisstadt. In
Ortelsburg wurden vier Sägewerke betrieben, die mit Langholz aus dem Walde versorgt werden mussten. Wir haben eine
Kiefer von über 8 Festmeter angefahren, der wir zuerst 6 Meter Spitze abschneiden mussten, um diese Last überhaupt
auf den Wagen zu bekommen. Sechs Pferde musste angespannt werden um den Wagen zur befestigten Straße zu bringen.
Fichten und Tannen wuchsen bis zu einer Länge von 30 Metern. Auch beim Transport von Ziegel, von der Ziegelei zum
Bahnhof, konnte man gutes Geld verdienen.
Im Jahr 1934 wurde Rohmanen an das überregionale Stromnetz angeschlossen und schaffte auf diese Weise den Sprung von
der Petroleumlampe zur Glühbirne. Neben dem Grundstück von Karl Pietzonka wurde ein Transformatorhäuschen errichtet,
in dem der ankommende Strom von einer Hochspannung auf eine Verbrauchsspannung transformiert wurde. Es gab schon eine
Überlandleitung, die aus Richtung Ortelsburg kommend, quer über die Felder, in Richtung Neu Keykuth weiter ging.
Durch eine Zwischenspanne wurde der Transformator, mit der Hauptleitung auf Kownatzkis Feld verbunden.
Ein Stromanschluss konnte die Arbeit im Haus und Hof auf vielfältige Weise erleichtern, doch nur die besser gestellten
Bauern, sowie noch manche Pensionäre, die ein festes Einkommen hatten, konnten sich dass leisten. Weil nur wenige an
der Elektrifizierung teilnahmen, war ein Stromanschluss mit hohen Kosten verbunden. Nur Gustav Pietzonka, Gasthof
Trzaska, Friedrich Nickel, die Schule und Wilhelm Both, wurden in der ersten Phase erfasst.
Im Jahr 1952 wurde von den polnischen Behörden die zweite Stufe der Elektrifizierung eingeleitet, in der alle im Dorf
stehen Gebäude erfasst wurden. Am Anfang wurden nur Leitungen für Lichtstrom gelegt und auch nur 3 Lichtstellen pro
Haushalt bewilligt. Doch im nachfolgenden Zeitraum wurden dann, wenn Material vorhanden war, weitere Lichtpunkte
angelegt. 1952, am zweiten Wochenende im Advent, wurden dann die Leitungen geschaltet und alle waren von der
plötzlichen Helligkeit sehr begeistert. Wenn man Glühbirnen auswechseln wollte musste man am Anfang weite Wege
zurücklegen, um welche zu bekommen. In den 60ger Jahren wurden dann immer mehr Starkstromleitungen gelegt, weil die
Bauern elektrische Geräte kaufen konnten. Ende der 60ger wurden auch die Abbauten an das Stromnetz angeschlossen.
Das Urnengrab auf unserem Feld
Auf unserem Feld, in Richtung Seelonken, bin ich oft beim pflügen gegen Steine gestoßen, manchmal
rissen sogar die Stränge am Pferdegeschirr. Eines Tages nahm ich einen Spaten, Brechstange und einen langen Baum, um
der Sache auf den Grund zu gehen. Als ich eine Menge Sand ausgehoben hatte stieß ich auf eine steile, aus Steinen
errichtete Wand, die ich auch mit dem Baum nicht aus der Fassung bringen konnte. Ich habe den ganzen Vormittag gegraben,
konnte jedoch nicht unter die Steine kommen. Einige Tage später hatten wir in der Schule eine Bauernversammlung, da
habe ich Herrn Biella und Herrn Lehrer Dorka von meinem Fund berichtet. Am nächsten Morgen kam der Lehrer Dorka mit der
ganzen Schulklasse, mit Spaten und Sieben ausgerüstet auf unser Feld und fingen an die ausgehobene Erde zu sieben.
Lehrer Dorka benachrichtigte daraufhin den Leiter des Ortelsburger Heimatmuseums, der am nächsten Morgen vorbei kam um
sich die Fundstelle genau anzusehen. Er beauftragte ihn 4 Mann zu besorgen, um die Steine ringsum frei zu schaufeln.
Zwischen den Steinen durften wir die Erde nur mit Esslöffeln ausheben. Als es plötzlich zu regnen anfing hat Lehrer
Dorka die Brauerei Daum, in Ortelsburg angerufen, die uns über der Fundstelle ein Zelt errichtet haben, damit wir
ungestört weiterarbeiten konnten. Wir fanden 8 flache und 8 hohe Urnen zu beiden Seiten am Körper. Die Urnen wurden in
Gipsbinden eingewickelt und ins Heimatmuseum nach Ortelsburg gebracht, wo sie durch einen Fachmann, der extra aus einem
Königsberger Museum angereist war. Nach Reinigung der Urnen hat er festgestellt, das die Grabstätte etwa 2000 Jahre vor
Christi Geburt angelegt wurde und ein Doppelgrab war, in dem ein Toter liegend und einer in Hochstellung beigesetzt
wurde.
Die Nachricht von der Fundstelle verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Es erschienen viele Schaulustige, ganze
Schulklassen aus der Umgebung, mit Autos und zu Fuß. Durch die vielen Menschen wurden die bestellten Ackerflächen auf
unserem Feld sehr in Mitleidenschaft gezogen, eine Entschädigung haben wir nicht erhalten. Das Grab wurde vor dem
Heimatmuseum in Ortelsburg wieder so aufgebaut wie man es auf unserem Feld vorgefunden hat. Für den Transport der
Steine wurde ich entlohnt. Die Urnen hat das Königsberger Museum an sich genommen und wollte sie nicht wieder hergeben,
weil die solch einen Fund noch nicht in ihrer Sammlung hatten.
Sonnenwendfeuer
Am 24 Juni fand eine Sonnenwendfeier statt. Ein Brauch der an die alten Germanen erinnern sollte.
Der Lehrer Dorka hat den Bürgermeister beauftragt 2 Fuhrwerke in den Wald zu schicken, die Holz und alten Reisig holen
und auf dem großen Schulberg abladen sollten. Das Straßenbauamt hat uns Teertonnen zur Verfügung gestellt. Die ganze
Dorfgemeinschaft wurde eingeladen, am Abend, nach der Feldarbeit, an der Sonnenwendfeier teilzunehmen. Lehrer Dorka
hielt zuerst eine Ansprache, in der er anschaulich erklärte wie unsere Vorfahren in grauer Vorzeit gefeiert haben.
Nach dem offiziellen Teil wurden das Holz und die Teertonnen angezündet, es wurden Heimatlieder gesungen, wie: Wild
flutet der See, drauf schaukelt der Schiffer den schwankenden Kahn, Schaum wälzt er wie Schnee, von grausiger Mitte
zum Ufer heran, wild fluten die Wellen auf Vaterlands See, wie schön, oh trag mich auf Spiegel zu Hügel, Masovias See.
Masovia Land, mein Heimatland, Masovia es lebe mein Vaterland.
Lehrer Alfred Dorka und sein Wirken für Rohmanen.

Friedrich Biella hatte auf seinem Feld einen Granitstein mit einer geraden Seite, den haben wir
mit viel Schweiß an den Dorfteich transportiert und auf einer Erhöhung abgelegt. Der Stein sollte zum Denkmahl für die
Gefallenen des Ersten Weltkrieges umgestaltet werden. Da zu Wenige daran ein Interesse zeigten, wurde diese Idee fallen
gelassen und der Stein irgendwann ins Wasser gerollt. Der Lehrer Dorka war viele Jahre in Rohmanen tätig, dort hat er
später seine ehemalige Schülerin, Lotte Biella geheiratet. Er hat sich sehr für die Entwicklung des Dorfes interessiert,
war bei jeder Gemeindeversammlung anwesend und hat auf Schwachstellen hingewiesen die den Fortschritt behinderten.
Gemeinsam mit den Schülern hat er den Ehrenfriedhof für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges gepflegt, an der
Wegegablung nach Eichtal und zu Ehren des Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg eine Eiche gepflanzt.
Zum Advent hat Lehrer Dorka mit der Jugend einen Adventstern, in verschiedenen Farben gebastelt.
Der Stern wurde auf einer 2 Meter langen Stange befestigt, in der Mitte wurde ein Wachslicht angezündet, am Stern
wurde eine Schnur angebracht, wenn man daran zog rollte der Stern hin und her. Am ersten Wochenende im Advent
versammelten sich jung und alt, um den Stern durch das Dorf zu tragen. Alle schlossen sich dem vorausgehenden
Sternträger an, der den Stern durch die Hauptstraße und die angrenzenden Wege trug. Dieser Sternmarsch wurde an den
folgenden Adventwochenenden wiederholt.
Am ersten Weihnachtfeiertag wurde um 4:00 Uhr morgens ein Frühgottesdienst gehalten. Zuerst hat der Pfarrer eine
Andacht gehalten, dann haben die Kinder ein Krippenspiel aufgeführt und die Gemeinde hat schöne Weihnachtslieder
gesungen. Der Gastwirt Trzaska hat uns den Saal zur Verfügung gestellt. Wir hatten eine Posaunen- u. eine
Gitarrengruppe. Unter der Leitung von Herrn Willi Doormann spielten: Gottlieb Brosch, Fritz Ollech,
Gustav Rattay(Sopran), Wilhelm Pilath, Gustav Brosch(Alt), Fritz Both(Tenor) und Fritz Brosch(Bass).
In der Gitarrengruppe wirkten mit: Martha Ollech, Hedwig Ollech, Martha Lekzik, Martha Michalick und Auguste Lekzick.
Willy Doormann hat sie auf der Geige begleitet.
Kurz vor Ausbruch des 2. Weltkrieges
Bei der Aufstellung des Grenzschutzes(Regiment Buchholz), hat er als Hauptfeldwebel die
Gruppenführerkurse überwacht und selbst die fähigsten Männer dafür vorgeschlagen. Das Ausbildungspersonal hat das
Jäger-Battalion gestellt. Wir kamen zuerst ins Stadion(Waldheim), wurden da eingekleidet und dann ging es gleich
kasernenmäßig zu, theoretisch und praktisch. Jeder musste vor die Front treten und nachweisen ob er im Stande ist,
Befehle zu erteilen. Abends wurden Filme vorgeführt die uns zeigen sollten wie eine Gruppe sich im Gelände entfalten
muss. Die Exerziervorschriften hatten sich, im Verhältnis zu Kaiser Wilhelms Zeiten, etwas geändert. Damals bestand
eine Gruppe aus 8 Mann und einem Unteroffizier, jetzt aus 10 Schützen, 3 für das leichte Maschinengewehr und einem
Unteroffizier(13 Mann). Nach der Schulung folgte eine Abschlussprüfung, danach ein gemütliches Beisammensein. Aus
Rohmanen haben folgende Männer die Prüfung bestanden: Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy, Gustav Rattay und
Gustav Deptolla. Unsere Uniformen waren alle zu klein und es gab viel zu lachen bei der Anprobe.
Die erste Übung habe ich mit Emil Rosowski, in Lenzinen gemacht. Der Gutsbesitzer Marzinzick hat seine Scheune als
Unterkunft zur Verfügung gestellt. Er war im Range eines Hauptfeldwebels. In seinem haus war die Schreibstube
untergebracht, die er selbst verwaltete. Ein Lastauto hatte Uniformen aus der Kaserne in Ortelsburg geholt, jeder
musste eine Uniform anlegen und dann wurde solange getauscht bis alle eine passende gefunden hatten. An den Namen des
Kompanieführers kann ich mich nicht mehr erinnern. 1935 wurden wir zu einer Übung in die Dragonerkaserne nach Lyk
einberufen. Die Gruppenführer, Zugführer, und Kompanieführer die schon Frontberührung im dem Ersten Weltkrieg hatten,
mussten eine Woche früher anreisen. Die Übungen waren auf 6 Wochen angelegt. Die meisten der einberufenen waren noch
nie mit dem Wehrdienst in Berührung gekommen. Jeder Gruppenführer bekam 13 Mann zugeteilt.
Unser Zugführer war Leutnant Neumann, Kompanieführer Oberleutnant Rutschko, Battalions-Kommandeur Major Gröning
(Regiment Buchholz). Hier ging es wieder Kasernenmäßig voran. Das Bataillon wurde hier vereidigt. Jeden zweiten
Sonntag durften unsere Frauen uns besuchen. Ein Jahr später wurden wir wieder zu einer Übung einberufen, auf den
Truppenübungsplatz nach Arys. Jeder Gruppenführer hatte den Auftrag die Gruppe zu entfalten, und auf bewegliche
Figuren zu schießen. Diese Übung musste später mit scharfer Munition wiederholt werden. Jedes Maschinengewehr bekam
50 Schuss, jeder Schütze 20 Schuss zugeteilt. Nach dem Abschießen wurden die Treffer gezählt und dem Kommandierenden
Bericht erstattet. In einiger Entfernung spaziert ein Storch umher, der gar nicht bemerkt hatte dass geschossen wurde,
was bei den Kameraden ein großes Gelächter hervorrief.
Nach der Übung wurde uns gesagt das jeder Gruppenführer eine arische Abstammung nachweisen sollte. Ich konnte in den
Rheinsweiner Kirchenbüchern meine Vorfahren aus Gellen, bis zum Jahr 1732 zurück, nachweisen und wurde zum
Unteroffizier befördert. Aus unserem Dorf wurden auch, Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy und Gustav Deptolla
befördert. Zwischendurch mussten wir schon mal in die Radfahrer-Kaserne nach Ortelsburg, Gewehre empfangen und im
Gelände üben. Am 31 Juli 1939 wurde mir von einem Soldaten ein Schreiben übereicht, das mich aufforderte, am 1. August
um 6:00 Uhr, bei der 3. Kompanie, des 2. Infanterieregiments zu erscheinen.
Um 5:30 hat mich meine Schwester in die Kaserne gebracht. Auf der Schreibstube erklärte mir der Hauptfeldwebel,
dass mir ab sofort der Dienstgrad eines Sanitäters zugewiesen wird, ich mich in der Kammer einzukleiden hätte und mir
in der Handwerkerstube die entsprechenden Schulterklappen annähen lassen sollte. Die aktiven Sanitäter wurden den
Feldlazaretten zugewiesen und wir kamen an ihre Stelle. Unser Bataillon wurde nach Schodmak zum Bunker bauen und
Stacheldraht verlegen eingeteilt. Wir zogen in Begleitung einer Musikkapelle bis zur Kreuzung am Krankenhaus, dann
weiter zu unserem Bestimmungsort, gefolgt von einer Gulaschkanone die in den nächsten Tagen für unsere Verpflegung
sorgen sollte.
Am 14 August haben wir die Jägerkaserne, begleitet von einer Musikkapelle endgültig verlassen und zogen zuerst durch
Ortelsburg, dann über Lehmanen ins Feldmanöver, hinter Rohmanen. Dort entfaltete sich das Bataillon im Gelände, die
Verwundetensammelstelle wurde auf dem Hof des Bauern Friedrich Neumann eingerichtet. Gegen Abend wurde zu Sammeln
geblasen und Biwak bezogen, wobei unsere 3.Kompanie, in einem kleinen Wallt, in der Nähe von Otto Nickels Gehöft
Stellung bezogen hatte. Die 2. und 4. Kompanie hatte sich in der Nähe vom Abbau Pallasch niedergelassen. Die Frau
Nickel hat am Abend ein Mädel in Dorf geschickt um meiner Frau Bescheid zu sagen, wo wir uns zurzeit befinden. Meine
Frau ist dann noch gekommen um sich von mir zu verabschieden, weil wir am nächsten Morgen um 3:00 Uhr Zelte abbrechen
und um 4:00 Uhr in Richtung Kaspersguth marschieren sollten.
Wir sind dann über Achodden, Seelonken, Lehmanen, Ortelsburg, bis nach Grammen und Schützendorf marschiert, wo wir an
einem See Biwak bezogen haben. Es wurde immer gesagt, wir kommen zum Tannenberg-Denkmal bei Hohenstein, wo ein Reichs
Kriegervereinsfest stattfinden sollte. Es wurden auch schon Vorkommandos aufgestellt, doch dann kamen wir nach Orlau
und Lahna-Mühle, da wo die Alle entspringt haben wir 2 Tage biwakiert. Unser Kompanieführer hat uns nach Waplitz auf
den Soldatenfriedhof des Ersten Weltkrieges geführt und uns erklärt wie das Jägerbataillon sich 1914 hier entfaltet
hat und aufgerieben wurde. Dann mussten wir in der Nähe von Gut Koslau über einen Fluss und bezogen in einem Waldstück,
vorbereitete Stellungen in der Nähe der polnischen Grenze. Herr und Frau Thalmann haben uns jeden Tag, bis zur Grenze,
mit Brötchen und Getränken versorgt. Es wurde scharfe Munition ausgegeben, weil wir am nächsten Morgen um 4:00 Uhr die
polnische Grenze überschreiten sollten.
Am nächsten Morgen um 10 Minuten vor 4:00 Uhr kam der Befehl; scharfe Munition abgeben, alles zurück in ein 6 Kilometer
entferntes Dorf, wo wir auch einquartiert wurden. Das alles geschah’ eine Woche vor dem 1. September 1939. Es wurde
gesagt dass der Führer dem polnischen Präsidenten Rid-Szmigly, ein Ultimatum gestellt hat und es wahrscheinlich nicht
zum Krieg mit Polen kommt. Genau nach 5 Tagen kehrten wir wieder in die gleichen Stellungen zurück, es wurde wieder
scharfe Munition ausgegeben und am nächsten Morgen um 4:00 Uhr überschritten wir die polnische Grenze.
“Der 2. Weltkrieg.”
Der erste Einsatz in Polen
Wir kamen zuerst in ein Dorf in dem sich nur alte Menschen befanden. Auf unsere Frage wo denn die Bewohner wären sagte
man uns dass alle geflohen sind, weil erzählt wurde, die Deutschen würden alle Polen misshandeln und verstümmeln. Ich
habe ihnen daraufhin gesagt dass uns, unter Androhung von Strafe verboten wurde, einem Zivilisten etwas anzutun. Das
Vieh, die Schweine und Hunde des Dorfes liefen frei herum und die Soldaten fingen an auf die Hunde zu schießen, bis
gesagt wurde es seien Meldehunde im Dienste der Deutschen Wehrmacht und dieser Unfug der eigenen Truppe schaden würde,
weil etwaige Querschläger eigene Kameraden verletzen könnten. Wir gingen weiter auf polnischer Seite entlang der Grenze,
bis wir am Nachmittag die ersten Vorposten der Festung Mlawa erreichten, da befanden wir uns plötzlich im Feuerhagel
polnischer Festungsflack.
Am nächsten Morgen hatte ich schon 3 Verwundete und wusste nicht wo sich eine Verwundeten Sammelstelle befindet. Ich
suchte den Bataillonsgefechtstand auf der sich auf einer Anhöhe befand. Ich habe unseren Oberstabsarzt gefragt wo denn
die Verwundetensammelstelle wäre. Er rief beim Tross an, wo er die Auskunft erhielt, das sich vor dem Dorf ein Bunker
befindet in dem man die Verwundeten sammeln sollte, die dann von Sanitätsautos abgeholt würden, weil das Dorf unter
Artilleriebeschuss stand. Am Sonnabend haben unsere Flieger die Bunkerstellungen bombardiert, konnten aber, trotz guter
Treffer nicht viel ausrichten, die Bunker wurden nur etwas angekratzt.
Der Beschuss unserer vordersten Linien ging mit unverminderter Heftigkeit weiter. Am Sonntag verkündete eine große
Staubwolke die Ankunft unserer Panzer, doch sie kamen nur bis zur Panzersperre und mussten wieder abdrehen ohne den
Polen einen schaden zuzufügen. Ein Panzer bekam einen Volltreffer, der Fahrer konnte noch umkehren. Er blutete am Kopf
und der Schütze war so eingeklemmt, das wir ihn nur mit einem Seil unter den Armen, durch die Luke nach oben ziehen
konnten. Ob er seine Verwundung überlebt hat ist mir nicht bekannt, denn in der Nacht wurden Panzergeschütze nach
vorne in Stellung gebracht, die direkt in die Schießscharten der Bunker geschossen und so die Verteidiger vertrieben
haben. Daraufhin sind wir weiter vorgerückt. Auf einer Wiese war ein tiefer Graben ausgehoben und mit Ästen getarnt,
da war ein Panzer hinein gefahren, so dass nur das Hinterteil herausragte und er sich nicht aus eigner Kraft befreien
konnte. In der Luft waren Flieger die Brandbomben abwarfen, ich habe mich auf den Boden geworfen weil ich dachte die
würden explodieren, aber sie zischten nur, so das Stoppeln und Graß rings herum in Brand gerieten.
Bei den Kampfhandlungen gab es mehrere Verwundete, denen ich gerade Verbände anlegen wollte, als unser Hauptmann zur
Trillerpfeife griff um mir klar zu machen, dass ich ihm folgen sollte. Die Polen fingen an zu schreien, ich sollte
sie ins Lazarett bringen denn hier im Wald würde sie niemand finden. Ich setzte mich aufs Fahrrad und folgte unserem
Kompanieführer, der mir sagte ich soll immer bei der kämpfenden Truppe bleiben, denn hinter der Front sind die
Sanitätsabteilungen, die werden die Verwundeten schon versorgen. Der Vormarsch dauerte bis in die späte Nacht. Auf
einem Gehöft, das nach allen Seiten durch Feldwachen abgesichert wurde, machten wir endlich Rast. Wir haben
Getreidegarben auf dem Hof ausgebreitet und uns zur Ruhe gelegt, als plötzlich um Mitternacht Leuchtraketen den Himmel
erhellten und Maschinengewehrfeuer uns aus dem Schlaf schreckte. Ein par polnische Soldaten hatten das Feuer eröffnet,
aber sich kurz darauf ergeben.
Die Narew-Überquerung
Als es hell wurde ging der Vormarsch weiter. Es wurde uns untersagt Tagebuch zu führen, darum
weiß ich nicht wie die Orte hießen, durch die wir marschiert sind. Als wir durch ein sumpfiges Gelände vor drangen
stand auf einer Anhöhe am Horizont, die polnische Artillerie, die uns sofort unter Beschuss nahm. Unser Hauptmann war
der Meinung dass wir schon in der Nähe des Flusses Narew sein müssten, als aus den Sträuchern ein mit Schlauchboten
beladenes Lastauto auftauchte. Wir wurden aufgefordert mit je 6 Mann ein Schlauchboot zu nehmen, an einem Aggregat
der daneben stand mit Luft zu füllen und zu Wasser zu lassen. In einer Stunde war das ganze Bataillon über die Narew,
wo der Vormarsch fortgesetzt wurde. In einem Dorf überraschte uns die polnische Kavallerie und fing sofort mit
Maschinengewehren zu schießen an. Da kam der Befehl: Alles wieder zurück. Es ging noch schneller als auf der Hinfahrt.
Wir sind erst einige Kilometer am Fluss entlang gegangen und haben dann zum zweiten Mal rüber gesetzt.
Die Gehöfte im Dorf standen alle in Brand. Auf einem waren viele Bienestöcke. 2 Kameraden wollten den Stöcken Waben
entnehmen, doch die Bienen durch das Feuer aufgeschreckt, überfielen sie sofort und stachen derart zu das sie nicht
mehr wieder zu erkennen waren. Ich habe die Einstichstellen mit Salmiak betupft, mehr konnte ich nicht tun. Wir mussten
auf unserem Vormarsch durch einen Wald der in Flammen stand, so dass man kaum atmen konnte. Es ging weiter in Richtung
Minsk und Warschau, wo schon die Sowjetische Armee durchgegangen war, die Pferde und Vieh von einem Gut mitgenommen
hatten. In einem Wald stießen wir unverhofft auf ein Kloster, in dem wir einige Gefangene machten. Dann trafen wir auf
eine gute Straße die nach Grochow ging.
Als wir dort einmarschierten wurden wir aus den oberen Stockwerken beschossen, so dass wir, um uns zu schützen, nur an
den Hauswänden entlang gehen konnten. Wir haben jedes Haus nach Feinden durchsucht. Vor einem Haus stand ein Hund der
niemanden reinlassen wollte, solange bis ihn eine Kugel traf. Die polnische Artillerie feuerte von Warschau aus, um
unseren Vormarsch zu stoppen. Wir hatten uns gerade eingegraben als plötzlich deutsche Flieger am Himmel erschienen,
die unsere Stellungen mit Bomben bewarfen und dabei viel Unheil anrichteten. Wir haben sofort Fliegertücher
ausgebreitet und Leuchtraketen abgeschossen. Da ich in dem Graben, den ich kurz zuvor ausgehoben hatte, sofort in
Deckung gegangen bin ist mir zum Glück nichts passiert. Unter den anderen Kameraden gab es viele Verwundete, so dass
ich nicht wusste wem ich zuerst helfen sollte.
Der Oberstabsarzt hat mich sofort tatkräftig unterstützt, so das bald alle Verwundeten versorgt waren, außer einem,
dem ein Bombensplitter den Arm abgerissen hat. Ich habe im 3 große Verbandspäckchen auf die Wunde gelegt, doch die
Blutung ließ sich trotzdem nicht stoppen, so dass er eine Stunde später auf der Krankensammelstelle verstarb. Wir
haben danach in einem Tomatenfeld einen Graben ausgehoben und eine neue Abwehrstellung bezogen. Die Gruppe Schwarz
bekam den Auftrag nach etwaigen versprengten polnischen Verbänden Ausschau zu halten, als sie unerwartet aus einer
Häuserreihe mit Maschinengewehrsalven überschüttet wurden. Der Gruppenführer und noch ein Soldat wurden dabei tödlich
verwundet. Danach wurde noch ein weiter Stoßtrupp, unter der Führung von Leutnant Briskorn, der sich dazu freiwillig
gemeldet hatte, hinaus geschickt um den Gruppenführer und den anderen Toten zu bergen.
Bei diesem Unternehmen, das erfolglos ausging, weil die Toten schon verscharrt waren, durchschlug eine Kugel den
Stahlhelm von Leutnant Briskorn, der auch sofort tot war. Alle Toten wurden später, an der Kirchenmauer in Grochow, in
Särgen beigesetzt: Hauptmann Schönwald sagte, das sie nach dem Kriege auf den Heldenfriedhof nach Ortelsburg überführt
werden. Drei Tage lagen wir bei Grochow in Stellungen, waren dem polnischen Maschinengewehrfeuer sowie den Bomben
deutscher Flugzeuge ausgesetzt. In der Nacht musste ich zu einem Verwundeten in die vorderste Linie und habe den
Rückweg nicht mehr finden können, als plötzlich Gewehrfeuer aufflammte habe ich in den Ruinen Schutz gesucht. Erst im
Morgengrauen konnte ich mich wieder orientieren und zu meinem Unterstand zurückfinden.
Warschau wurde tagelang bombardiert und stand auch unter Artilleriebeschuss. Aus dunklen Rauchwolken kamen oft ganze
Bündel von Papier angeflogen. Die Verwundeten kamen oft auf Krücken zu unserem Unterstand, ich habe sie dann zur
Krankensammelstelle hingeführt. Wir haben auch polnische Zivilpersonen betreut, die während der Kampfhandlungen
verwundet wurden. Als einmal 2 Jungen vorbeiliefen hat einer ihnen nachgerufen sie sollten seiner Frau Bescheid sagen,
er wäre auf der Krankensammelstelle an der Kirche. Als wir dort ankamen war seine Frau, mit einem Kind auf dem Arm,
schon da.
Nach der Kapitulation von Warschau, gingen wir über Sokolow zum Bug und haben dort Quartier bezogen. Der Russe hatte
sich bereits hinter den Fluss zurückgezogen, hatte alles Vieh und Pferde mitgenommen. Dort erreichte mich ein Telegramm
von zu Hause, dass meine Tochter gestorben ist. Es sprach sich auch herum dass verschiedene Heimaturlaub bekommen haben,
ich durfte auch für 14 Tage heim. Wir fuhren mit Lastautos nach Allenstein in die neue Reiterkaserne, zum
Ersatzbatallion, da haben wir unsere Gewehre und Munition abgeben, dann durften wir, jeder in seinen Heimatort
weiterfahren.
Als wir unsere Quartiere am Bug verlassen haben war sehr viel Schnee gefallen. Hier in Ortelsburg fanden wir die
gleiche Wetterlage vor, aber nach 3 Tagen war alles wieder weggetaut und wir konnten die Kartoffelernte, die durch den
frühen Wintereinbruch gestoppt wurde, zu Ende bringen. Ein Tag bevor ich zu Hause angekommen bin wurde die Tochter
beerdigt. Nach 14 Tagen mussten wir uns in Allenstein melden, Gewehre empfangen und wieder zurück zur Division an den
Bug 150 Kilometer hinter Warschau. Die elfte Division, zu der wir auch gehörten sollte in den Westen Deutschlands
verlegt werden und war schon unterwegs zur Verladestation Skiernewice 50 Kilometer vor Warschau.
Mein Dienst als Sanitätsunteroffizier
Unser Bataillon kam in das Städtchen Burscheid, im Kreis Opladen, wo wir in Privatquartieren
untergebracht wurden. Nach 3 Monaten, im Januar 1940, wurden wir nach Solingen verlegt, wo wir bis zum
Frankreichfeldzug stationiert waren. Wir mussten an Feldübungen teilnehmen, wie andere die in Kasernen untergebracht
waren. Während dieser Zeit musste jeder seine Zähne in Ordnung bringen lassen. Jeden Tag fuhren 20 Mann in die
Cäzilienstraße nach Köln, zur Zahnklinik. Im Rheinland wurde unsere Division neu aufgestellt. Ausfälle durch den
Polenfeldzug wurden durch neue Soldaten ergänzt. Ich kam nun zum Ersatzbatallion, war der Älteste in der ganzen
Kompanie. Als der Frankreichfeldzug losging wurde unser Ersatzbatallion mit den noch vorhandenen Verwundeten, in die
neue Reiterkaserne, nach Allenstein verlegt.
Meine Frau hat, mit Unterstützung der Bauernschaft, einen Antrag gestellt, daraufhin wurde ich zur Frühjahrsbestellung,
beurlaubt und später bis auf weiteres vom Militärdienst freigestellt. Als der Russlandfeldzug losging wurde ich von der
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg, für 14 Tage einberufen. Ich war seit 1922, Mitglied der freiwilligen
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg und habe jedes Jahr an Übungen teilgenommen. Jede Bereitschaft musste etliche Leute
stellen. Von Rohmanen wurden Emil Rosowski, Johann Dembek, und ich, zur Krankensammelstelle Wirballen, in Litauen,
abkommandiert. Dorthin kamen Lazarettzüge aus Russland mit der Breitspurbahn. Die Verwundeten wurden frisch verbunden
und auf Waggon mit Normalspur verladen und nach Deutschland gebracht.
Als die 14 Tage vergangen waren wollten wir wieder nach Haus zurück, doch man wollte uns nicht entlassen. Stattdessen
wurden wir dem Wehrkreisamt Königsberg zugeteilt, neu eingekleidet und zur Aushilfe ins Lazarett nach Gumbinnen
abkommandiert. Mehr als ein Jahr war ich in den Urlauber-Baracken, habe dort Krankenstube betreut. Später, bis zum
Dezember 1944, war ich im Reserve-Lazarett 4, in Königsberg tätig. Dort habe ich auch die Luftangriffe der Engländer,
vom 25 bis 26. August 1944 miterlebt.
Wir sollten gerade einen Lazarettzug in Rotenstein entladen, als plötzlich die Sirenen ertönten - Fliegeralarm. Im
gleichen Moment waren die ersten Flugzeuge auch schon da, zuerst warfen sie „Tannenbäume” und danach Foßforkanister ab.
Die Omnibusse standen schon zur Abfahrt bereit als es losging. Wir haben die Verwundeten schnell in den
Luftschutzkeller getragen, haben die Betten von den Fenstern weggerückt damit die Verwundeten nicht von den
Glasssplittern verletzt wurden. Im Kasernenhof brannten die Fosforkanister lichterloh. Unsere Unterkunft, die sich in
einer Baracke befand ist völlig abgebrannt, mit dem Wenigen was wir unser Eigen nannten. Am nächsten Tag wurden wir neu
eingekleidet und am 29. bis 30. kamen die englischen Bomber wieder, sie setzten genau da ihr Zerstörungswerk fort wo
sie vor 3 Tagen aufgehört hatten.
Anfang Dezember 1944 musste ich mich nach Stablack melden und musste dann zur Sanitätsabteilung 1, nach Gernau, das
liegt zwischen Lodz und Warschau. Vormittags hatten wir Felddienstübungen und nachmittags theoretischen Unterricht.
Jeden Tag wurden Gruppen zusammengestellt und zu anderen Einheiten abkommandiert. Ich kam zu einer Panzerabteilung, wo
wir an einem Morgen plötzlich auf dem Kasernenhof antreten mussten und zu unserer Überraschung mit der Nachricht
konfrontiert wurden, dass der Russe an mehreren Frontabschnitten durchgebrochen war. Wir bekamen sofort einen
Marschbefehl in Richtung Lodz, wo das Stadtbild noch intakt war, selbst die Straßenbahnen fuhren noch. In der Nacht
haben russische Flugzeuge die Stadt bombardiert. Die Kaserne in der wir untergebracht waren hatte keine
Luftschutzkeller, aber zum Glück blieben wir von Bombentreffern verschont. Am nächsten morgen bot sich uns ein Bild der
Verwüstung. Die entgleisten Straßenbahnwagen, sowie andere Fahrzeuge blockierten die Straßen. Die Älteren unter uns
bekamen Fahrscheine für einen Transportzug, der bereit hinter Lodz abfahrbereit, unter Dampf stehen sollte. Als
russische Panzer in den Straßen auftauchten, verbrannte die Schreibstube unsere Wehrpässe und andere wichtige
Dokumente. Wir liefen zu der Station auf der unser Transportzug bereitstehen sollte, aber da war kein Zug mehr zu sehen
und wir setzten unseren Rückzug zu Fuß fort.
Der Rückzug und Zusammenbruch der Ostfront
In Dobroschin, einer Stadt in Polen, wurde gerade ein Lazarettzug verladen, doch wir kamen nicht
mehr zum Einsatz, weil die russische Infanterie uns schon auf den Fersen war. Es ging weiter über den Fluss Bober,
Sagan, bis nach Glogau an der Oder. Dort wurden wir der 29. motorisierten Sanitätskompanie zugeteilt. Im
Garnisonslazarett wurden noch Operationen durchgeführt. Unsere Division hatte ihr eigenes Feldlazarett, so dass wir den
Befehl zu Weiterfahrt erhielten und noch unbeschadet die Oderbrücke passieren konnten, denn Glogau wurde zur Festung
erklärt. Wir haben 2 Pferdewagen organisiert und mit Verbänden, sowie medizinischen Instrumenten beladen. So kamen wir
bis nach Lübbenau im Spreewald, wo wir in einem Schloss, in zuvor ein Museum war, unser Lazarett untergebracht haben.
Weil die Amerikaner Cottbus bombardiert hatten, wurden die Verwundeten zu uns nach Lübbenau gebracht. Hier haben wir
Tag und Nacht gearbeitet, um die vielen Verwundeten, aus den schweren Kämpfen bei Grünberg und Sagan zu versorgen. Die
Soldaten von der Abwehrfront kamen schon mit abgestorbenen Armen oder Beinen bei uns an, weil in vorderster Linie keine
Frontlazarette mehr vorhanden waren; es mussten viele Amputationen durchgeführt werden. Als für unsere Pferde kein Heu
mehr vorhanden war, schickte mich unser Hauptfeldwebel, zu einem Bauern in den Spreewald, mit dem Auftrag, Futter zu
besorgen. Mit noch zwei Mann fuhren mit zwei Kähnen, zuerst den Hauptstrom entlang und dann in einen Nebenarm; da haben
wir die Boote beladen und brachten das Heu nach Lübbenau.
Als wir uns bei unser Einheit zurück melden wollten, war alles schon marschbereit. Ich bin schnell in einen Bus
eingestiegen der sofort losfuhr, weil russische Verbände schon in sichtweite waren. Russische Flugzeuge kreisten über
den Dächern und nahmen, mit ihren Bordwaffen jeden unter Beschuss, der sich irgendwo blicken ließ. Wir konnten nur
durch den Wald, oder in der Nacht vorwärts kommen, denn wenn ein Auto auf der Landstraße fuhr, war alsbald ein Flugzeug
hinter ihm her und schoss es in Brand. Als wir nach Tagen am Ufer der Elbe ankamen, war bereits eine Ponton-Brücke
erstellt worden, welche die zerstörte Brücke ersetzen sollte.
Durch die vielen Fahrzeuge waren in den Sand tiefe Spuren gefahren, so dass andere Fahrzeuge unsere Busse ins
Schlepptau nehmen mussten, weil wir mit eigener Kraft nicht mehr weiterkamen. Beiderseits der Trasse standen
Flüchtlingswagen, in der der Hoffnung die Brücke passieren zu können, doch SS-Polizei verhinderte das die Gespanne den
militärischen Rückzug zum Stillstand brachten. Es gelang uns die Elbe zu überqueren, um in einem Waldstück Schutz vor
feindlichen Fliegern zu suchen.
Als wir unsere Busse und Autos gut getarnt hatten, hat unser Bataillonschef die anwesenden Parteigrößen zu sich
gerufen und ihnen erklärt das wir eine Einheit des Roten Kreuzes sind und nach internationalem Recht keine Waffen
besitzen dürfen. Nach langer, erregter Diskussion wurde beschlossen einen Graben auszuheben und alles im Sand zu
verscharren. Als wir dann weiter, durch die Dörfer fuhren, sahen wir schon viele weiße Bettlaken, als Zeichen der
Kapitulation, aus den Fenstern hängen. Es wurde uns erzählt dass der Bürgermeister von der SS erschossen wurde, weil
er die Bevölkerung zu diesem Schritt ermutigt hatte. Jetzt waren hinter uns die Russen und vor uns schon die Amerikaner.
Amerikanische Panzer fuhren umher und schossen wild durch die Gegend, ohne ein Ziel anzuvisieren. Niemand wollte sich
dem Russen ergeben, doch der Weg der zu den Amerikanern führte, war durch abgesägte Bäume blockiert. Wir sind schnell
in das nächste Dorf gegangen, haben uns Sägen und Äxte besorgt, die Bäume durchgesägt und in den Straßengraben
geworfen.
“ Nach dem Ende des 2. Weltkrieges.”
In amerikanische Kriegsgefangenschaft
Dann fuhren wir unter internationaler Flagge an eine Mulde Brücke, vor der zwei amerikanische Soldaten, mit Zigarren,
zur Hälfte im Mund, standen. Sie rauchten und kauten gleichzeitig. Wir mussten auf einen freien Platz fahren, alle
aussteigen und rechts wieder antreten. Wäschebeutel und Tornister mussten wir abstellen; danach wurden wir nach Waffen
durchsucht, Wertsachen, Uhren und Messer wurden uns gleich abgenommen. Als wir anschließend an unserem Gepäck
vorbeigingen durfte niemand was mitnehmen. Als ich gebückt, nach meinem Wäschebeutel greifen wollte, in dem sich noch
3 Konservendosen und ein Brot befanden, bekam ich einen Fußtritt ins Gesicht, so dass mir ein Zahn ausgeschlagen wurde.
Wir wurden dann in einem Garten zusammen getrieben und gefragt ob jemand bei der SS gedient hat. Nachdem wir in Reihe
und Glied angetreten waren, mussten wir den Oberkörper freimachen und die Arme anheben. Es wurde nach SS-Zeichen
gesucht, die gewöhnlich unter dem Oberarm eintätowiert waren. Nachdem wir Grimma bei Leipzig, wo wir in amerikanische
Gefangenschaft geraten waren, verlassen hatten, mussten wir durch ganz Thüringen bis Hersfeld, an der Grenze zu Hessen,
marschieren. In Hersfeld wurden wir auf große Lastautos verladen, die von farbigen Soldaten gefahren wurden. Man hat
uns mit Stöcken hinauf getrieben, solange bis das Auto so voll war das man kaum stehen konnte. Die Soldaten fuhren, für
diese Straßenverhältnisse, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Wenn die Straße eine scharfe Kurve hatte, flogen
wir alle übereinander und mussten erst mit viel Kraftanstrengung auf die Beine kommen um diese Fahrt zu überstehen.
Da die Straßenränder in dieser Gegend mit Obstbäumen bepflanzt sind und deren Äste sehr niedrig hängen, hätten die
uns die Köpfe abgerissen, wenn wir uns nicht ständig geduckt hätten. Unsere Fahrt endete in Bad Kreuznach, in der Pfalz,
wo wir in ein Lager, in dem sich später 130.000 Mann und 6 Generäle befanden, eingepfercht wurden. Die Unterkunft der
Generäle befand sich unter einem Zelt, alle anderen mussten die Zeit unter freiem Himmel zubringen. Die Offiziere, die
Unteroffiziere, die Mannschaften; wurden in getrennten Camps untergebracht. Die Mannschaften wurden auch zur Arbeit
abkommandiert und konnten bei dieser Gelegenheit, Brot, Brötchen oder Zigarettenstummel organisieren, wogegen die
Offiziere und Unteroffiziere ihr Camp überhaupt nicht verlassen durften.
Die ersten Tage gab es kein Wasser und kein Brot, so dass die Kameraden vor Erschöpfung umfielen. Später standen wir
manchmal den ganzen Tag nach Wasser an, das von den, uns bewachenden Negern mit großen Wassertanks angefahren wurde. Am
dritten Tag bekamen wir mittags und abends etwas zu Essen; Brot bekamen wir erst nach zwei Wochen, nach dem aus der
Umgebung herbeigeholte Handwerker, Backöfen gebaut hatten. In den verschiedenen Gemeinden, die in den uns umgebenden
Weinbergen lagen, mussten sich alle Männer beim Bürgermeister melden. Als sie dann erschienen waren, wurden sie auf
bereitstehende Lastautos getrieben und zu uns ins Lager gebracht. Sie waren ohne Kopfbedeckung und ohne wärmere
Bekleidung angekommen, weil ihnen gesagt wurde, dass ihr Aufenthalt im Lager nur von kurzer Dauer sein würde. Man hat
uns, falls noch vorhanden, Decken und Mäntel abgenommen, mit der Begründung, sie würden für Kranke und Verwundete
gebraucht. Jeden Tag starben mehr als 200 Mann, die wir sofort in ein Zelt tragen mussten. In der Nacht wurden die
Toten dann mit unbekanntem Ziel, weggefahren.
Viele haben ihren Verstand verloren uns irrten im ganzen Camp ziellos umher. Als Latrinen wurden Gräben ausgehoben, in
die verschiedene Kameraden, bei der Verrichtung ihrer Notdurft, vor Schwäche hineingefallen sind und nicht mehr wieder
heraus kamen. Aus den Pfählen die, die jungen Obstbäume stützten, haben wir Krankentragen gebaut um unsere Kameraden,
bei Bedarf, zur Krankensammelstelle zu tragen. Es war in diesem Frühjahr auch sehr kalt, doch unsere Erdlöcher, die wir
zum Schutz vor Kälte und Wind, nur mit leeren Konservendosen ausgehoben hatten, durften nicht tiefer als 20 Zentimeter
sein. Nach jedem Regenguss mussten wir das Wasser ausschöpfen. Nach einem Gewitter, standen wir wiedermal, total
durchnässt in unserem Camp, als unerwartet am Horizont die Sonne hervortrat. Einer unserer Kameraden hatte noch eine
Trompete gerettet und fing, von dem Anblick völlig überwältigt, zu spielen an: "Es geht alles vorüber, es geht alles
vorbei, nach jedem Dezember, folgt wieder ein Mai". Daraufhin hob sich die Stimmung der tiefbetrübten Kriegsgefangenen,
so das Heimatlieder durch das ganze Camp erklangen, obwohl wir in den nassen Kleider herumgehen mussten, bis sie am
Körper trocken wurden.
In Rohmanen wurden auch rote Ziegeln gebrannt. Viele Häuser wurden, mit Ziegeln erbaut, die nur wenige 100 Meter von
der Baustelle entfernt hergestellt wurden. Der Lehn wurde auf den Feldern in der näheren Umgebung entnommen, dann von
Ochsen solange getreten, bis er so geschmeidig war, das er sich in Formen einstreichen ließ. Wenn die Ziegel in der
Form trocken war, wurde sie entnommen und in einem Brennofen gestapelt. Um einen Ofen richtig anzufeuern, brauchte man
12 Raummeter Holz, das im Zeitraum von ein par Tagen verheizt wurde. Der Fischer Karl Glitza hatte schon eine
Knetmaschine, die von einem Pferd angetrieben wurde, das mit verbundenen Augen, den ganzen Tag in die Runde ging.
Im Dorf waren auch vier Kalköfen, in denen so genannte Kalksteine, die sich an gewissen Stellen, im Erdboden befanden,
gebrannt wurden. Nach dem Brennen wurden die Steine mit Wasser abgelöscht und die daraus entstandne Masse diente, nach
dem Beimischen einer gewissen Menge Sand, dann als Bindemittel beim Häuserbau. Das Gerichtsgebäude und das
Lehrerseminar in Ortelsburg wurden mit Kalk, aus dem Rohmaner Brennöfen erbaut. Auch zum Bau einer Eisenbahnbrücke, auf
der, der Zug, den Sawitzfluß, von Ortelsburg nach Allenstein überquerte, hat mein Großvater, mit einem Ochsengespann,
Kalk gefahren.
Hinter der Scheune, beim Bauern Johann Dembek hat man Tonerde gefördert, aus der man mit Hilfe einer Formerscheibe,
die von einem Arbeiter mit Muskelkraft(Fußbetrieb) angetrieben wurde, schöne Krüge, Schalen und Vasen geformt hat.
Die Töpferware wurde, nachdem sie trocken genug war, auch in einem Ofen gebrannt, anschließend mit einer Lasur
überzogen und wieder gebrannt. Es wurden auch Kacheln zum Bau von Kachelöfen hergestellt, die mit verschiedenen
Ornamenten versehen, die Wohnstuben unserer Vorfahren schmückten. So haben unsere Großväter ihr Leben gemeistert und
nach und nach, unsere Dörfer aus der Rückständigkeit in die Neuzeit geführt.
Hinter der Scheune, beim Bauern Johann Dembek hat man Tonerde gefördert, aus der man mit Hilfe einer Formerscheibe, die von einem Arbeiter mit Muskelkraft(Fußbetrieb) angetrieben wurde, schöne Krüge, Schalen und Vasen geformt hat. Die Töpferware wurde, nachdem sie trocken genug war, auch in einem Ofen gebrannt, anschließend mit einer Lasur überzogen und wieder gebrannt. Es wurden auch Kacheln zum Bau von Kachelöfen hergestellt, die mit verschiedenen Ornamenten versehen, die Wohnstuben unserer Vorfahren schmückten. So haben unsere Großväter ihr Leben gemeistert und nach und nach, unsere Dörfer aus der Rückständigkeit in die Neuzeit geführt.

Als der Lehrer Alfred Dorka, ein Frontkämpfer des Ersten Weltkrieges und ein Sportsmann, als
zweite Lehrkraft an der Rohmaner Schule angestellt wurde, hat er die Sitten und Gebräuche aus früherer Zeit wieder zum
Leben erweckt. Zuerst hat er die Jugend zusammen gerufen, einen Jugendverein und einen Fußballclub, gegründet. Zum
Vorsitzenden des Fußballclubs wurde Johann Gloddek berufen, der ihn auch geleitet hat. Bauer Wilhelm Spittka, der am
Rohmaner See wohnte, stellte Land für einen Sportplatz unentgeltlich zur Verfügung. Lehrer Alfred Dorka hat am
Rohmaner See eine Badestelle ausgesucht und ein Sprungbrett bauen lassen. An jedem Sonnabend im Sommer, bevor die
Sonne unterging, versammelte sich die gestammte Jugend des Dorfes an der Badestelle am See. Es wurde gebadet,
Heimatlieder gesungen, gespielt, im Fackelschein eines großen Biwakfeuers, bis in die späte Nacht hinein. Der Fischer
Karl Glitza hat uns Kähne zur Verfügung gestellt, mit denen wir auf den See hinausgepaddelt sind, dabei hatten wir viel
Spaß, was wiederum den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft gefördert hat. Ich habe mit meiner Mandoline den Gesang von
Volks- und Heimatliedern begleitet.
Der Rohmaner See liegt in einem Tal, dessen Hänge zu beiden Seiten mit Kiefern und Tannen bewaldet sind. Wenn man
gesungen oder Musiziert hat, hallte es von den Hängen zurück. Die Ufer waren mit Kalmus und Schilf bewachsen, was für
die Fischaufzucht von Vorteil war. Wenn man an einem sonnigen, windstillen Tag, am Seeufer spazieren ging, traf man
oft auf Flachstellen, an denen sich die Fischbrut im Sonnenlicht wärmte, wie ein Mückenschwarm. Im See befanden sich
folgende Fische: Karpfen, Hechte, Schleie, Barsche Plötze, Rotaugen, Aale und Krebse. Am Sonntagmorgen brachten viele
Rohmaner ihre Pferde zum See um sie zu baden.
Es wurden dort, unter der Aufsicht von Lehrer Dorka, auch viele Jugendfeste mit Theatervorführungen veranstaltet, zu
denen er selbst die Vorlagen organisiert hat. Der am See wohnende Bauer Johann Nadrowski, hat uns ein Scheunentor, als
Tanzboden zur Verfügung gestellt. Der Zimmermann Wilhelm Wittek hat uns eine Windmühle gebaut, die am auf dem Boden
liegenden Scheunentor aufgestellt wurde, dazu kamen Noch Tannen und Fichten, die das Ganze wie ein Bühnenbild
erscheinen ließen. Es wunden viele Bühnenstücke aufgeführt, unter anderen >Alte Weiber werden jung gemahlen<. Dazu bot
die Windmühle die entsprechende Kulisse.
Nach der Vorführung wurde der Boden aufgeräumt, um dann als Tanzdiele zur Verfügung zu stehen. Der Gastwirt Trzaska
hatte Tische und Bänke aufgestellt, Speisen und Getränke angeboten, so dass sich die die Veranstaltung bis in die
späte Nacht hinein zog. Es waren auch Leute aus Ortelsburg und anderen Nachbardörfern dabei. Im Winter hat Lehrer
Dorka eine Kreisrodelbahn eingerichtet, die von Zeit zu Zeit mit Wasser besprengt wurde, um die Gleitfähigkeit zu
verbessern. Von einer Anhöhe ging hinunter bis auf den halben See, was für alle ein großes Vergnügen war. Es kamen
Lehrer mit Schulklassen aus der näheren Umgebung um hier zu Rodeln.
Als Herr Lehrer Jobski als Hauptlehrer nach Rohmanen kam hat er mit dem Bürgermeister und der Gemeindeverwaltung
beschlossen, in der Nähe des Dorfes, auf einem zur Schule gehörenden Grundstück, einen Sportplatz anzulegen. Dafür
wurde gleich hinter den Gärten, 6 Morgen Ackerland abgetrennt, und nach Feierabend hat Lehrer Dorka mit den
Jugendlichen eingeebnet und gleich nebenan einen Graben für Schützenstand und Kugelfang ausgehoben. Am Sonntagvormittag
wurde Fußball gespielt und um 15:00 Uhr war Kleinkalieberschießen angesagt. Es musste auch ein kleiner Beitrag erhoben
werden, um Munition kaufen zu können. Eine Büchse konnten wir aus beim Kleinkalieberverein in Ortelsburg ausleihen.
Nach Hitlers Machtergreifung
Als Adolf Hitler an die Macht kam wurde die SA gegründet. Der Bürgermeister Michael Kownatzki
wurde zum Gruppenführer ernannt und folgende Männer haben sich freiwillig gemeldet: Wilhelm Matzey, Johann Gloddek,
Gustav Nadrowski, August Buttler, Karl Baran, Emil Nickel, Wilhelm Jaschinski, Emil Bork, Ernst Rattay und Gustav Bach.
Bei Versammlungen war die SA in Uniform angetreten um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Wer versucht hat Unruhe zu
stiften, egal aus welchem Grunde, wurde aufgefordert den Saal zu verlassen, andernfalls wurde er mit Gewalt entfernt.
Herr Lehrer Jobski wurde zum politischen Leiter ernannt, seine Frau hat die NS-Frauenschaft gegründet, Lehrer Dorka
die HJ, und so bekam die Dorfgemeinschaft, nach und nach ein anderes Gesicht. Der Sportplatz und der Schützenstand
wurden jetzt mehr als früher in den Mittelpunkt gestellt. Nach der Feldarbeit hat der Bürgermeister Fuhrwerke bestellt
und den Sportplatz noch besser herrichten lassen.
Der Bauer Wilhelm Both wurde zum Ortsbauernführer ernannt, mit der Aufgabe alles Land für den Anbau von Getreide und
Futtermittel bereitzustellen, oder wenn das nicht möglich war mit Wald aufzuforsten. Durch den Einsatz von Kunstdüngern
sollten größere Erträge aus dem Boden geholt werden, um den Viehbestand zu vergrößern und mehr Milch und Butter zu
produzieren. Deutschland sollte im Stande sein sich selbst zu selbst zu ernähren, ohne auf Importe angewiesen zu sein.
Frau Jobski hat, innerhalb der der NS-Frauenschaft, mit Hilfe von Fachkräften aus Ortelsburg, Lehrgänge veranstaltet,
auf denen man Backen und Nähen lernte. Auf den Bauernhöfen befand sich auch immer mehr Rassegeflügel, das eine erhöhte
Produktion von Eiern und Geflügelfleisch sicherstellen sollte.
Die Rohmaner Bauern hatten, außer in der Landwirtschaft, noch andere Verdienstmöglichkeiten in der Kreisstadt. In
Ortelsburg wurden vier Sägewerke betrieben, die mit Langholz aus dem Walde versorgt werden mussten. Wir haben eine
Kiefer von über 8 Festmeter angefahren, der wir zuerst 6 Meter Spitze abschneiden mussten, um diese Last überhaupt
auf den Wagen zu bekommen. Sechs Pferde musste angespannt werden um den Wagen zur befestigten Straße zu bringen.
Fichten und Tannen wuchsen bis zu einer Länge von 30 Metern. Auch beim Transport von Ziegel, von der Ziegelei zum
Bahnhof, konnte man gutes Geld verdienen.
Im Jahr 1934 wurde Rohmanen an das überregionale Stromnetz angeschlossen und schaffte auf diese Weise den Sprung von
der Petroleumlampe zur Glühbirne. Neben dem Grundstück von Karl Pietzonka wurde ein Transformatorhäuschen errichtet,
in dem der ankommende Strom von einer Hochspannung auf eine Verbrauchsspannung transformiert wurde. Es gab schon eine
Überlandleitung, die aus Richtung Ortelsburg kommend, quer über die Felder, in Richtung Neu Keykuth weiter ging.
Durch eine Zwischenspanne wurde der Transformator, mit der Hauptleitung auf Kownatzkis Feld verbunden.
Ein Stromanschluss konnte die Arbeit im Haus und Hof auf vielfältige Weise erleichtern, doch nur die besser gestellten
Bauern, sowie noch manche Pensionäre, die ein festes Einkommen hatten, konnten sich dass leisten. Weil nur wenige an
der Elektrifizierung teilnahmen, war ein Stromanschluss mit hohen Kosten verbunden. Nur Gustav Pietzonka, Gasthof
Trzaska, Friedrich Nickel, die Schule und Wilhelm Both, wurden in der ersten Phase erfasst.
Im Jahr 1952 wurde von den polnischen Behörden die zweite Stufe der Elektrifizierung eingeleitet, in der alle im Dorf
stehen Gebäude erfasst wurden. Am Anfang wurden nur Leitungen für Lichtstrom gelegt und auch nur 3 Lichtstellen pro
Haushalt bewilligt. Doch im nachfolgenden Zeitraum wurden dann, wenn Material vorhanden war, weitere Lichtpunkte
angelegt. 1952, am zweiten Wochenende im Advent, wurden dann die Leitungen geschaltet und alle waren von der
plötzlichen Helligkeit sehr begeistert. Wenn man Glühbirnen auswechseln wollte musste man am Anfang weite Wege
zurücklegen, um welche zu bekommen. In den 60ger Jahren wurden dann immer mehr Starkstromleitungen gelegt, weil die
Bauern elektrische Geräte kaufen konnten. Ende der 60ger wurden auch die Abbauten an das Stromnetz angeschlossen.
Das Urnengrab auf unserem Feld
Auf unserem Feld, in Richtung Seelonken, bin ich oft beim pflügen gegen Steine gestoßen, manchmal
rissen sogar die Stränge am Pferdegeschirr. Eines Tages nahm ich einen Spaten, Brechstange und einen langen Baum, um
der Sache auf den Grund zu gehen. Als ich eine Menge Sand ausgehoben hatte stieß ich auf eine steile, aus Steinen
errichtete Wand, die ich auch mit dem Baum nicht aus der Fassung bringen konnte. Ich habe den ganzen Vormittag gegraben,
konnte jedoch nicht unter die Steine kommen. Einige Tage später hatten wir in der Schule eine Bauernversammlung, da
habe ich Herrn Biella und Herrn Lehrer Dorka von meinem Fund berichtet. Am nächsten Morgen kam der Lehrer Dorka mit der
ganzen Schulklasse, mit Spaten und Sieben ausgerüstet auf unser Feld und fingen an die ausgehobene Erde zu sieben.
Lehrer Dorka benachrichtigte daraufhin den Leiter des Ortelsburger Heimatmuseums, der am nächsten Morgen vorbei kam um
sich die Fundstelle genau anzusehen. Er beauftragte ihn 4 Mann zu besorgen, um die Steine ringsum frei zu schaufeln.
Zwischen den Steinen durften wir die Erde nur mit Esslöffeln ausheben. Als es plötzlich zu regnen anfing hat Lehrer
Dorka die Brauerei Daum, in Ortelsburg angerufen, die uns über der Fundstelle ein Zelt errichtet haben, damit wir
ungestört weiterarbeiten konnten. Wir fanden 8 flache und 8 hohe Urnen zu beiden Seiten am Körper. Die Urnen wurden in
Gipsbinden eingewickelt und ins Heimatmuseum nach Ortelsburg gebracht, wo sie durch einen Fachmann, der extra aus einem
Königsberger Museum angereist war. Nach Reinigung der Urnen hat er festgestellt, das die Grabstätte etwa 2000 Jahre vor
Christi Geburt angelegt wurde und ein Doppelgrab war, in dem ein Toter liegend und einer in Hochstellung beigesetzt
wurde.
Die Nachricht von der Fundstelle verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Es erschienen viele Schaulustige, ganze
Schulklassen aus der Umgebung, mit Autos und zu Fuß. Durch die vielen Menschen wurden die bestellten Ackerflächen auf
unserem Feld sehr in Mitleidenschaft gezogen, eine Entschädigung haben wir nicht erhalten. Das Grab wurde vor dem
Heimatmuseum in Ortelsburg wieder so aufgebaut wie man es auf unserem Feld vorgefunden hat. Für den Transport der
Steine wurde ich entlohnt. Die Urnen hat das Königsberger Museum an sich genommen und wollte sie nicht wieder hergeben,
weil die solch einen Fund noch nicht in ihrer Sammlung hatten.
Sonnenwendfeuer
Am 24 Juni fand eine Sonnenwendfeier statt. Ein Brauch der an die alten Germanen erinnern sollte.
Der Lehrer Dorka hat den Bürgermeister beauftragt 2 Fuhrwerke in den Wald zu schicken, die Holz und alten Reisig holen
und auf dem großen Schulberg abladen sollten. Das Straßenbauamt hat uns Teertonnen zur Verfügung gestellt. Die ganze
Dorfgemeinschaft wurde eingeladen, am Abend, nach der Feldarbeit, an der Sonnenwendfeier teilzunehmen. Lehrer Dorka
hielt zuerst eine Ansprache, in der er anschaulich erklärte wie unsere Vorfahren in grauer Vorzeit gefeiert haben.
Nach dem offiziellen Teil wurden das Holz und die Teertonnen angezündet, es wurden Heimatlieder gesungen, wie: Wild
flutet der See, drauf schaukelt der Schiffer den schwankenden Kahn, Schaum wälzt er wie Schnee, von grausiger Mitte
zum Ufer heran, wild fluten die Wellen auf Vaterlands See, wie schön, oh trag mich auf Spiegel zu Hügel, Masovias See.
Masovia Land, mein Heimatland, Masovia es lebe mein Vaterland.
Lehrer Alfred Dorka und sein Wirken für Rohmanen.

Friedrich Biella hatte auf seinem Feld einen Granitstein mit einer geraden Seite, den haben wir
mit viel Schweiß an den Dorfteich transportiert und auf einer Erhöhung abgelegt. Der Stein sollte zum Denkmahl für die
Gefallenen des Ersten Weltkrieges umgestaltet werden. Da zu Wenige daran ein Interesse zeigten, wurde diese Idee fallen
gelassen und der Stein irgendwann ins Wasser gerollt. Der Lehrer Dorka war viele Jahre in Rohmanen tätig, dort hat er
später seine ehemalige Schülerin, Lotte Biella geheiratet. Er hat sich sehr für die Entwicklung des Dorfes interessiert,
war bei jeder Gemeindeversammlung anwesend und hat auf Schwachstellen hingewiesen die den Fortschritt behinderten.
Gemeinsam mit den Schülern hat er den Ehrenfriedhof für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges gepflegt, an der
Wegegablung nach Eichtal und zu Ehren des Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg eine Eiche gepflanzt.
Zum Advent hat Lehrer Dorka mit der Jugend einen Adventstern, in verschiedenen Farben gebastelt.
Der Stern wurde auf einer 2 Meter langen Stange befestigt, in der Mitte wurde ein Wachslicht angezündet, am Stern
wurde eine Schnur angebracht, wenn man daran zog rollte der Stern hin und her. Am ersten Wochenende im Advent
versammelten sich jung und alt, um den Stern durch das Dorf zu tragen. Alle schlossen sich dem vorausgehenden
Sternträger an, der den Stern durch die Hauptstraße und die angrenzenden Wege trug. Dieser Sternmarsch wurde an den
folgenden Adventwochenenden wiederholt.
Am ersten Weihnachtfeiertag wurde um 4:00 Uhr morgens ein Frühgottesdienst gehalten. Zuerst hat der Pfarrer eine
Andacht gehalten, dann haben die Kinder ein Krippenspiel aufgeführt und die Gemeinde hat schöne Weihnachtslieder
gesungen. Der Gastwirt Trzaska hat uns den Saal zur Verfügung gestellt. Wir hatten eine Posaunen- u. eine
Gitarrengruppe. Unter der Leitung von Herrn Willi Doormann spielten: Gottlieb Brosch, Fritz Ollech,
Gustav Rattay(Sopran), Wilhelm Pilath, Gustav Brosch(Alt), Fritz Both(Tenor) und Fritz Brosch(Bass).
In der Gitarrengruppe wirkten mit: Martha Ollech, Hedwig Ollech, Martha Lekzik, Martha Michalick und Auguste Lekzick.
Willy Doormann hat sie auf der Geige begleitet.
Kurz vor Ausbruch des 2. Weltkrieges
Bei der Aufstellung des Grenzschutzes(Regiment Buchholz), hat er als Hauptfeldwebel die
Gruppenführerkurse überwacht und selbst die fähigsten Männer dafür vorgeschlagen. Das Ausbildungspersonal hat das
Jäger-Battalion gestellt. Wir kamen zuerst ins Stadion(Waldheim), wurden da eingekleidet und dann ging es gleich
kasernenmäßig zu, theoretisch und praktisch. Jeder musste vor die Front treten und nachweisen ob er im Stande ist,
Befehle zu erteilen. Abends wurden Filme vorgeführt die uns zeigen sollten wie eine Gruppe sich im Gelände entfalten
muss. Die Exerziervorschriften hatten sich, im Verhältnis zu Kaiser Wilhelms Zeiten, etwas geändert. Damals bestand
eine Gruppe aus 8 Mann und einem Unteroffizier, jetzt aus 10 Schützen, 3 für das leichte Maschinengewehr und einem
Unteroffizier(13 Mann). Nach der Schulung folgte eine Abschlussprüfung, danach ein gemütliches Beisammensein. Aus
Rohmanen haben folgende Männer die Prüfung bestanden: Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy, Gustav Rattay und
Gustav Deptolla. Unsere Uniformen waren alle zu klein und es gab viel zu lachen bei der Anprobe.
Die erste Übung habe ich mit Emil Rosowski, in Lenzinen gemacht. Der Gutsbesitzer Marzinzick hat seine Scheune als
Unterkunft zur Verfügung gestellt. Er war im Range eines Hauptfeldwebels. In seinem haus war die Schreibstube
untergebracht, die er selbst verwaltete. Ein Lastauto hatte Uniformen aus der Kaserne in Ortelsburg geholt, jeder
musste eine Uniform anlegen und dann wurde solange getauscht bis alle eine passende gefunden hatten. An den Namen des
Kompanieführers kann ich mich nicht mehr erinnern. 1935 wurden wir zu einer Übung in die Dragonerkaserne nach Lyk
einberufen. Die Gruppenführer, Zugführer, und Kompanieführer die schon Frontberührung im dem Ersten Weltkrieg hatten,
mussten eine Woche früher anreisen. Die Übungen waren auf 6 Wochen angelegt. Die meisten der einberufenen waren noch
nie mit dem Wehrdienst in Berührung gekommen. Jeder Gruppenführer bekam 13 Mann zugeteilt.
Unser Zugführer war Leutnant Neumann, Kompanieführer Oberleutnant Rutschko, Battalions-Kommandeur Major Gröning
(Regiment Buchholz). Hier ging es wieder Kasernenmäßig voran. Das Bataillon wurde hier vereidigt. Jeden zweiten
Sonntag durften unsere Frauen uns besuchen. Ein Jahr später wurden wir wieder zu einer Übung einberufen, auf den
Truppenübungsplatz nach Arys. Jeder Gruppenführer hatte den Auftrag die Gruppe zu entfalten, und auf bewegliche
Figuren zu schießen. Diese Übung musste später mit scharfer Munition wiederholt werden. Jedes Maschinengewehr bekam
50 Schuss, jeder Schütze 20 Schuss zugeteilt. Nach dem Abschießen wurden die Treffer gezählt und dem Kommandierenden
Bericht erstattet. In einiger Entfernung spaziert ein Storch umher, der gar nicht bemerkt hatte dass geschossen wurde,
was bei den Kameraden ein großes Gelächter hervorrief.
Nach der Übung wurde uns gesagt das jeder Gruppenführer eine arische Abstammung nachweisen sollte. Ich konnte in den
Rheinsweiner Kirchenbüchern meine Vorfahren aus Gellen, bis zum Jahr 1732 zurück, nachweisen und wurde zum
Unteroffizier befördert. Aus unserem Dorf wurden auch, Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy und Gustav Deptolla
befördert. Zwischendurch mussten wir schon mal in die Radfahrer-Kaserne nach Ortelsburg, Gewehre empfangen und im
Gelände üben. Am 31 Juli 1939 wurde mir von einem Soldaten ein Schreiben übereicht, das mich aufforderte, am 1. August
um 6:00 Uhr, bei der 3. Kompanie, des 2. Infanterieregiments zu erscheinen.
Um 5:30 hat mich meine Schwester in die Kaserne gebracht. Auf der Schreibstube erklärte mir der Hauptfeldwebel,
dass mir ab sofort der Dienstgrad eines Sanitäters zugewiesen wird, ich mich in der Kammer einzukleiden hätte und mir
in der Handwerkerstube die entsprechenden Schulterklappen annähen lassen sollte. Die aktiven Sanitäter wurden den
Feldlazaretten zugewiesen und wir kamen an ihre Stelle. Unser Bataillon wurde nach Schodmak zum Bunker bauen und
Stacheldraht verlegen eingeteilt. Wir zogen in Begleitung einer Musikkapelle bis zur Kreuzung am Krankenhaus, dann
weiter zu unserem Bestimmungsort, gefolgt von einer Gulaschkanone die in den nächsten Tagen für unsere Verpflegung
sorgen sollte.
Am 14 August haben wir die Jägerkaserne, begleitet von einer Musikkapelle endgültig verlassen und zogen zuerst durch
Ortelsburg, dann über Lehmanen ins Feldmanöver, hinter Rohmanen. Dort entfaltete sich das Bataillon im Gelände, die
Verwundetensammelstelle wurde auf dem Hof des Bauern Friedrich Neumann eingerichtet. Gegen Abend wurde zu Sammeln
geblasen und Biwak bezogen, wobei unsere 3.Kompanie, in einem kleinen Wallt, in der Nähe von Otto Nickels Gehöft
Stellung bezogen hatte. Die 2. und 4. Kompanie hatte sich in der Nähe vom Abbau Pallasch niedergelassen. Die Frau
Nickel hat am Abend ein Mädel in Dorf geschickt um meiner Frau Bescheid zu sagen, wo wir uns zurzeit befinden. Meine
Frau ist dann noch gekommen um sich von mir zu verabschieden, weil wir am nächsten Morgen um 3:00 Uhr Zelte abbrechen
und um 4:00 Uhr in Richtung Kaspersguth marschieren sollten.
Wir sind dann über Achodden, Seelonken, Lehmanen, Ortelsburg, bis nach Grammen und Schützendorf marschiert, wo wir an
einem See Biwak bezogen haben. Es wurde immer gesagt, wir kommen zum Tannenberg-Denkmal bei Hohenstein, wo ein Reichs
Kriegervereinsfest stattfinden sollte. Es wurden auch schon Vorkommandos aufgestellt, doch dann kamen wir nach Orlau
und Lahna-Mühle, da wo die Alle entspringt haben wir 2 Tage biwakiert. Unser Kompanieführer hat uns nach Waplitz auf
den Soldatenfriedhof des Ersten Weltkrieges geführt und uns erklärt wie das Jägerbataillon sich 1914 hier entfaltet
hat und aufgerieben wurde. Dann mussten wir in der Nähe von Gut Koslau über einen Fluss und bezogen in einem Waldstück,
vorbereitete Stellungen in der Nähe der polnischen Grenze. Herr und Frau Thalmann haben uns jeden Tag, bis zur Grenze,
mit Brötchen und Getränken versorgt. Es wurde scharfe Munition ausgegeben, weil wir am nächsten Morgen um 4:00 Uhr die
polnische Grenze überschreiten sollten.
Am nächsten Morgen um 10 Minuten vor 4:00 Uhr kam der Befehl; scharfe Munition abgeben, alles zurück in ein 6 Kilometer
entferntes Dorf, wo wir auch einquartiert wurden. Das alles geschah’ eine Woche vor dem 1. September 1939. Es wurde
gesagt dass der Führer dem polnischen Präsidenten Rid-Szmigly, ein Ultimatum gestellt hat und es wahrscheinlich nicht
zum Krieg mit Polen kommt. Genau nach 5 Tagen kehrten wir wieder in die gleichen Stellungen zurück, es wurde wieder
scharfe Munition ausgegeben und am nächsten Morgen um 4:00 Uhr überschritten wir die polnische Grenze.
“Der 2. Weltkrieg.”
Der erste Einsatz in Polen
Wir kamen zuerst in ein Dorf in dem sich nur alte Menschen befanden. Auf unsere Frage wo denn die Bewohner wären sagte
man uns dass alle geflohen sind, weil erzählt wurde, die Deutschen würden alle Polen misshandeln und verstümmeln. Ich
habe ihnen daraufhin gesagt dass uns, unter Androhung von Strafe verboten wurde, einem Zivilisten etwas anzutun. Das
Vieh, die Schweine und Hunde des Dorfes liefen frei herum und die Soldaten fingen an auf die Hunde zu schießen, bis
gesagt wurde es seien Meldehunde im Dienste der Deutschen Wehrmacht und dieser Unfug der eigenen Truppe schaden würde,
weil etwaige Querschläger eigene Kameraden verletzen könnten. Wir gingen weiter auf polnischer Seite entlang der Grenze,
bis wir am Nachmittag die ersten Vorposten der Festung Mlawa erreichten, da befanden wir uns plötzlich im Feuerhagel
polnischer Festungsflack.
Am nächsten Morgen hatte ich schon 3 Verwundete und wusste nicht wo sich eine Verwundeten Sammelstelle befindet. Ich
suchte den Bataillonsgefechtstand auf der sich auf einer Anhöhe befand. Ich habe unseren Oberstabsarzt gefragt wo denn
die Verwundetensammelstelle wäre. Er rief beim Tross an, wo er die Auskunft erhielt, das sich vor dem Dorf ein Bunker
befindet in dem man die Verwundeten sammeln sollte, die dann von Sanitätsautos abgeholt würden, weil das Dorf unter
Artilleriebeschuss stand. Am Sonnabend haben unsere Flieger die Bunkerstellungen bombardiert, konnten aber, trotz guter
Treffer nicht viel ausrichten, die Bunker wurden nur etwas angekratzt.
Der Beschuss unserer vordersten Linien ging mit unverminderter Heftigkeit weiter. Am Sonntag verkündete eine große
Staubwolke die Ankunft unserer Panzer, doch sie kamen nur bis zur Panzersperre und mussten wieder abdrehen ohne den
Polen einen schaden zuzufügen. Ein Panzer bekam einen Volltreffer, der Fahrer konnte noch umkehren. Er blutete am Kopf
und der Schütze war so eingeklemmt, das wir ihn nur mit einem Seil unter den Armen, durch die Luke nach oben ziehen
konnten. Ob er seine Verwundung überlebt hat ist mir nicht bekannt, denn in der Nacht wurden Panzergeschütze nach
vorne in Stellung gebracht, die direkt in die Schießscharten der Bunker geschossen und so die Verteidiger vertrieben
haben. Daraufhin sind wir weiter vorgerückt. Auf einer Wiese war ein tiefer Graben ausgehoben und mit Ästen getarnt,
da war ein Panzer hinein gefahren, so dass nur das Hinterteil herausragte und er sich nicht aus eigner Kraft befreien
konnte. In der Luft waren Flieger die Brandbomben abwarfen, ich habe mich auf den Boden geworfen weil ich dachte die
würden explodieren, aber sie zischten nur, so das Stoppeln und Graß rings herum in Brand gerieten.
Bei den Kampfhandlungen gab es mehrere Verwundete, denen ich gerade Verbände anlegen wollte, als unser Hauptmann zur
Trillerpfeife griff um mir klar zu machen, dass ich ihm folgen sollte. Die Polen fingen an zu schreien, ich sollte
sie ins Lazarett bringen denn hier im Wald würde sie niemand finden. Ich setzte mich aufs Fahrrad und folgte unserem
Kompanieführer, der mir sagte ich soll immer bei der kämpfenden Truppe bleiben, denn hinter der Front sind die
Sanitätsabteilungen, die werden die Verwundeten schon versorgen. Der Vormarsch dauerte bis in die späte Nacht. Auf
einem Gehöft, das nach allen Seiten durch Feldwachen abgesichert wurde, machten wir endlich Rast. Wir haben
Getreidegarben auf dem Hof ausgebreitet und uns zur Ruhe gelegt, als plötzlich um Mitternacht Leuchtraketen den Himmel
erhellten und Maschinengewehrfeuer uns aus dem Schlaf schreckte. Ein par polnische Soldaten hatten das Feuer eröffnet,
aber sich kurz darauf ergeben.
Die Narew-Überquerung
Als es hell wurde ging der Vormarsch weiter. Es wurde uns untersagt Tagebuch zu führen, darum
weiß ich nicht wie die Orte hießen, durch die wir marschiert sind. Als wir durch ein sumpfiges Gelände vor drangen
stand auf einer Anhöhe am Horizont, die polnische Artillerie, die uns sofort unter Beschuss nahm. Unser Hauptmann war
der Meinung dass wir schon in der Nähe des Flusses Narew sein müssten, als aus den Sträuchern ein mit Schlauchboten
beladenes Lastauto auftauchte. Wir wurden aufgefordert mit je 6 Mann ein Schlauchboot zu nehmen, an einem Aggregat
der daneben stand mit Luft zu füllen und zu Wasser zu lassen. In einer Stunde war das ganze Bataillon über die Narew,
wo der Vormarsch fortgesetzt wurde. In einem Dorf überraschte uns die polnische Kavallerie und fing sofort mit
Maschinengewehren zu schießen an. Da kam der Befehl: Alles wieder zurück. Es ging noch schneller als auf der Hinfahrt.
Wir sind erst einige Kilometer am Fluss entlang gegangen und haben dann zum zweiten Mal rüber gesetzt.
Die Gehöfte im Dorf standen alle in Brand. Auf einem waren viele Bienestöcke. 2 Kameraden wollten den Stöcken Waben
entnehmen, doch die Bienen durch das Feuer aufgeschreckt, überfielen sie sofort und stachen derart zu das sie nicht
mehr wieder zu erkennen waren. Ich habe die Einstichstellen mit Salmiak betupft, mehr konnte ich nicht tun. Wir mussten
auf unserem Vormarsch durch einen Wald der in Flammen stand, so dass man kaum atmen konnte. Es ging weiter in Richtung
Minsk und Warschau, wo schon die Sowjetische Armee durchgegangen war, die Pferde und Vieh von einem Gut mitgenommen
hatten. In einem Wald stießen wir unverhofft auf ein Kloster, in dem wir einige Gefangene machten. Dann trafen wir auf
eine gute Straße die nach Grochow ging.
Als wir dort einmarschierten wurden wir aus den oberen Stockwerken beschossen, so dass wir, um uns zu schützen, nur an
den Hauswänden entlang gehen konnten. Wir haben jedes Haus nach Feinden durchsucht. Vor einem Haus stand ein Hund der
niemanden reinlassen wollte, solange bis ihn eine Kugel traf. Die polnische Artillerie feuerte von Warschau aus, um
unseren Vormarsch zu stoppen. Wir hatten uns gerade eingegraben als plötzlich deutsche Flieger am Himmel erschienen,
die unsere Stellungen mit Bomben bewarfen und dabei viel Unheil anrichteten. Wir haben sofort Fliegertücher
ausgebreitet und Leuchtraketen abgeschossen. Da ich in dem Graben, den ich kurz zuvor ausgehoben hatte, sofort in
Deckung gegangen bin ist mir zum Glück nichts passiert. Unter den anderen Kameraden gab es viele Verwundete, so dass
ich nicht wusste wem ich zuerst helfen sollte.
Der Oberstabsarzt hat mich sofort tatkräftig unterstützt, so das bald alle Verwundeten versorgt waren, außer einem,
dem ein Bombensplitter den Arm abgerissen hat. Ich habe im 3 große Verbandspäckchen auf die Wunde gelegt, doch die
Blutung ließ sich trotzdem nicht stoppen, so dass er eine Stunde später auf der Krankensammelstelle verstarb. Wir
haben danach in einem Tomatenfeld einen Graben ausgehoben und eine neue Abwehrstellung bezogen. Die Gruppe Schwarz
bekam den Auftrag nach etwaigen versprengten polnischen Verbänden Ausschau zu halten, als sie unerwartet aus einer
Häuserreihe mit Maschinengewehrsalven überschüttet wurden. Der Gruppenführer und noch ein Soldat wurden dabei tödlich
verwundet. Danach wurde noch ein weiter Stoßtrupp, unter der Führung von Leutnant Briskorn, der sich dazu freiwillig
gemeldet hatte, hinaus geschickt um den Gruppenführer und den anderen Toten zu bergen.
Bei diesem Unternehmen, das erfolglos ausging, weil die Toten schon verscharrt waren, durchschlug eine Kugel den
Stahlhelm von Leutnant Briskorn, der auch sofort tot war. Alle Toten wurden später, an der Kirchenmauer in Grochow, in
Särgen beigesetzt: Hauptmann Schönwald sagte, das sie nach dem Kriege auf den Heldenfriedhof nach Ortelsburg überführt
werden. Drei Tage lagen wir bei Grochow in Stellungen, waren dem polnischen Maschinengewehrfeuer sowie den Bomben
deutscher Flugzeuge ausgesetzt. In der Nacht musste ich zu einem Verwundeten in die vorderste Linie und habe den
Rückweg nicht mehr finden können, als plötzlich Gewehrfeuer aufflammte habe ich in den Ruinen Schutz gesucht. Erst im
Morgengrauen konnte ich mich wieder orientieren und zu meinem Unterstand zurückfinden.
Warschau wurde tagelang bombardiert und stand auch unter Artilleriebeschuss. Aus dunklen Rauchwolken kamen oft ganze
Bündel von Papier angeflogen. Die Verwundeten kamen oft auf Krücken zu unserem Unterstand, ich habe sie dann zur
Krankensammelstelle hingeführt. Wir haben auch polnische Zivilpersonen betreut, die während der Kampfhandlungen
verwundet wurden. Als einmal 2 Jungen vorbeiliefen hat einer ihnen nachgerufen sie sollten seiner Frau Bescheid sagen,
er wäre auf der Krankensammelstelle an der Kirche. Als wir dort ankamen war seine Frau, mit einem Kind auf dem Arm,
schon da.
Nach der Kapitulation von Warschau, gingen wir über Sokolow zum Bug und haben dort Quartier bezogen. Der Russe hatte
sich bereits hinter den Fluss zurückgezogen, hatte alles Vieh und Pferde mitgenommen. Dort erreichte mich ein Telegramm
von zu Hause, dass meine Tochter gestorben ist. Es sprach sich auch herum dass verschiedene Heimaturlaub bekommen haben,
ich durfte auch für 14 Tage heim. Wir fuhren mit Lastautos nach Allenstein in die neue Reiterkaserne, zum
Ersatzbatallion, da haben wir unsere Gewehre und Munition abgeben, dann durften wir, jeder in seinen Heimatort
weiterfahren.
Als wir unsere Quartiere am Bug verlassen haben war sehr viel Schnee gefallen. Hier in Ortelsburg fanden wir die
gleiche Wetterlage vor, aber nach 3 Tagen war alles wieder weggetaut und wir konnten die Kartoffelernte, die durch den
frühen Wintereinbruch gestoppt wurde, zu Ende bringen. Ein Tag bevor ich zu Hause angekommen bin wurde die Tochter
beerdigt. Nach 14 Tagen mussten wir uns in Allenstein melden, Gewehre empfangen und wieder zurück zur Division an den
Bug 150 Kilometer hinter Warschau. Die elfte Division, zu der wir auch gehörten sollte in den Westen Deutschlands
verlegt werden und war schon unterwegs zur Verladestation Skiernewice 50 Kilometer vor Warschau.
Mein Dienst als Sanitätsunteroffizier
Unser Bataillon kam in das Städtchen Burscheid, im Kreis Opladen, wo wir in Privatquartieren
untergebracht wurden. Nach 3 Monaten, im Januar 1940, wurden wir nach Solingen verlegt, wo wir bis zum
Frankreichfeldzug stationiert waren. Wir mussten an Feldübungen teilnehmen, wie andere die in Kasernen untergebracht
waren. Während dieser Zeit musste jeder seine Zähne in Ordnung bringen lassen. Jeden Tag fuhren 20 Mann in die
Cäzilienstraße nach Köln, zur Zahnklinik. Im Rheinland wurde unsere Division neu aufgestellt. Ausfälle durch den
Polenfeldzug wurden durch neue Soldaten ergänzt. Ich kam nun zum Ersatzbatallion, war der Älteste in der ganzen
Kompanie. Als der Frankreichfeldzug losging wurde unser Ersatzbatallion mit den noch vorhandenen Verwundeten, in die
neue Reiterkaserne, nach Allenstein verlegt.
Meine Frau hat, mit Unterstützung der Bauernschaft, einen Antrag gestellt, daraufhin wurde ich zur Frühjahrsbestellung,
beurlaubt und später bis auf weiteres vom Militärdienst freigestellt. Als der Russlandfeldzug losging wurde ich von der
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg, für 14 Tage einberufen. Ich war seit 1922, Mitglied der freiwilligen
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg und habe jedes Jahr an Übungen teilgenommen. Jede Bereitschaft musste etliche Leute
stellen. Von Rohmanen wurden Emil Rosowski, Johann Dembek, und ich, zur Krankensammelstelle Wirballen, in Litauen,
abkommandiert. Dorthin kamen Lazarettzüge aus Russland mit der Breitspurbahn. Die Verwundeten wurden frisch verbunden
und auf Waggon mit Normalspur verladen und nach Deutschland gebracht.
Als die 14 Tage vergangen waren wollten wir wieder nach Haus zurück, doch man wollte uns nicht entlassen. Stattdessen
wurden wir dem Wehrkreisamt Königsberg zugeteilt, neu eingekleidet und zur Aushilfe ins Lazarett nach Gumbinnen
abkommandiert. Mehr als ein Jahr war ich in den Urlauber-Baracken, habe dort Krankenstube betreut. Später, bis zum
Dezember 1944, war ich im Reserve-Lazarett 4, in Königsberg tätig. Dort habe ich auch die Luftangriffe der Engländer,
vom 25 bis 26. August 1944 miterlebt.
Wir sollten gerade einen Lazarettzug in Rotenstein entladen, als plötzlich die Sirenen ertönten - Fliegeralarm. Im
gleichen Moment waren die ersten Flugzeuge auch schon da, zuerst warfen sie „Tannenbäume” und danach Foßforkanister ab.
Die Omnibusse standen schon zur Abfahrt bereit als es losging. Wir haben die Verwundeten schnell in den
Luftschutzkeller getragen, haben die Betten von den Fenstern weggerückt damit die Verwundeten nicht von den
Glasssplittern verletzt wurden. Im Kasernenhof brannten die Fosforkanister lichterloh. Unsere Unterkunft, die sich in
einer Baracke befand ist völlig abgebrannt, mit dem Wenigen was wir unser Eigen nannten. Am nächsten Tag wurden wir neu
eingekleidet und am 29. bis 30. kamen die englischen Bomber wieder, sie setzten genau da ihr Zerstörungswerk fort wo
sie vor 3 Tagen aufgehört hatten.
Anfang Dezember 1944 musste ich mich nach Stablack melden und musste dann zur Sanitätsabteilung 1, nach Gernau, das
liegt zwischen Lodz und Warschau. Vormittags hatten wir Felddienstübungen und nachmittags theoretischen Unterricht.
Jeden Tag wurden Gruppen zusammengestellt und zu anderen Einheiten abkommandiert. Ich kam zu einer Panzerabteilung, wo
wir an einem Morgen plötzlich auf dem Kasernenhof antreten mussten und zu unserer Überraschung mit der Nachricht
konfrontiert wurden, dass der Russe an mehreren Frontabschnitten durchgebrochen war. Wir bekamen sofort einen
Marschbefehl in Richtung Lodz, wo das Stadtbild noch intakt war, selbst die Straßenbahnen fuhren noch. In der Nacht
haben russische Flugzeuge die Stadt bombardiert. Die Kaserne in der wir untergebracht waren hatte keine
Luftschutzkeller, aber zum Glück blieben wir von Bombentreffern verschont. Am nächsten morgen bot sich uns ein Bild der
Verwüstung. Die entgleisten Straßenbahnwagen, sowie andere Fahrzeuge blockierten die Straßen. Die Älteren unter uns
bekamen Fahrscheine für einen Transportzug, der bereit hinter Lodz abfahrbereit, unter Dampf stehen sollte. Als
russische Panzer in den Straßen auftauchten, verbrannte die Schreibstube unsere Wehrpässe und andere wichtige
Dokumente. Wir liefen zu der Station auf der unser Transportzug bereitstehen sollte, aber da war kein Zug mehr zu sehen
und wir setzten unseren Rückzug zu Fuß fort.
Der Rückzug und Zusammenbruch der Ostfront
In Dobroschin, einer Stadt in Polen, wurde gerade ein Lazarettzug verladen, doch wir kamen nicht
mehr zum Einsatz, weil die russische Infanterie uns schon auf den Fersen war. Es ging weiter über den Fluss Bober,
Sagan, bis nach Glogau an der Oder. Dort wurden wir der 29. motorisierten Sanitätskompanie zugeteilt. Im
Garnisonslazarett wurden noch Operationen durchgeführt. Unsere Division hatte ihr eigenes Feldlazarett, so dass wir den
Befehl zu Weiterfahrt erhielten und noch unbeschadet die Oderbrücke passieren konnten, denn Glogau wurde zur Festung
erklärt. Wir haben 2 Pferdewagen organisiert und mit Verbänden, sowie medizinischen Instrumenten beladen. So kamen wir
bis nach Lübbenau im Spreewald, wo wir in einem Schloss, in zuvor ein Museum war, unser Lazarett untergebracht haben.
Weil die Amerikaner Cottbus bombardiert hatten, wurden die Verwundeten zu uns nach Lübbenau gebracht. Hier haben wir
Tag und Nacht gearbeitet, um die vielen Verwundeten, aus den schweren Kämpfen bei Grünberg und Sagan zu versorgen. Die
Soldaten von der Abwehrfront kamen schon mit abgestorbenen Armen oder Beinen bei uns an, weil in vorderster Linie keine
Frontlazarette mehr vorhanden waren; es mussten viele Amputationen durchgeführt werden. Als für unsere Pferde kein Heu
mehr vorhanden war, schickte mich unser Hauptfeldwebel, zu einem Bauern in den Spreewald, mit dem Auftrag, Futter zu
besorgen. Mit noch zwei Mann fuhren mit zwei Kähnen, zuerst den Hauptstrom entlang und dann in einen Nebenarm; da haben
wir die Boote beladen und brachten das Heu nach Lübbenau.
Als wir uns bei unser Einheit zurück melden wollten, war alles schon marschbereit. Ich bin schnell in einen Bus
eingestiegen der sofort losfuhr, weil russische Verbände schon in sichtweite waren. Russische Flugzeuge kreisten über
den Dächern und nahmen, mit ihren Bordwaffen jeden unter Beschuss, der sich irgendwo blicken ließ. Wir konnten nur
durch den Wald, oder in der Nacht vorwärts kommen, denn wenn ein Auto auf der Landstraße fuhr, war alsbald ein Flugzeug
hinter ihm her und schoss es in Brand. Als wir nach Tagen am Ufer der Elbe ankamen, war bereits eine Ponton-Brücke
erstellt worden, welche die zerstörte Brücke ersetzen sollte.
Durch die vielen Fahrzeuge waren in den Sand tiefe Spuren gefahren, so dass andere Fahrzeuge unsere Busse ins
Schlepptau nehmen mussten, weil wir mit eigener Kraft nicht mehr weiterkamen. Beiderseits der Trasse standen
Flüchtlingswagen, in der der Hoffnung die Brücke passieren zu können, doch SS-Polizei verhinderte das die Gespanne den
militärischen Rückzug zum Stillstand brachten. Es gelang uns die Elbe zu überqueren, um in einem Waldstück Schutz vor
feindlichen Fliegern zu suchen.
Als wir unsere Busse und Autos gut getarnt hatten, hat unser Bataillonschef die anwesenden Parteigrößen zu sich
gerufen und ihnen erklärt das wir eine Einheit des Roten Kreuzes sind und nach internationalem Recht keine Waffen
besitzen dürfen. Nach langer, erregter Diskussion wurde beschlossen einen Graben auszuheben und alles im Sand zu
verscharren. Als wir dann weiter, durch die Dörfer fuhren, sahen wir schon viele weiße Bettlaken, als Zeichen der
Kapitulation, aus den Fenstern hängen. Es wurde uns erzählt dass der Bürgermeister von der SS erschossen wurde, weil
er die Bevölkerung zu diesem Schritt ermutigt hatte. Jetzt waren hinter uns die Russen und vor uns schon die Amerikaner.
Amerikanische Panzer fuhren umher und schossen wild durch die Gegend, ohne ein Ziel anzuvisieren. Niemand wollte sich
dem Russen ergeben, doch der Weg der zu den Amerikanern führte, war durch abgesägte Bäume blockiert. Wir sind schnell
in das nächste Dorf gegangen, haben uns Sägen und Äxte besorgt, die Bäume durchgesägt und in den Straßengraben
geworfen.
“ Nach dem Ende des 2. Weltkrieges.”
In amerikanische Kriegsgefangenschaft
Dann fuhren wir unter internationaler Flagge an eine Mulde Brücke, vor der zwei amerikanische Soldaten, mit Zigarren,
zur Hälfte im Mund, standen. Sie rauchten und kauten gleichzeitig. Wir mussten auf einen freien Platz fahren, alle
aussteigen und rechts wieder antreten. Wäschebeutel und Tornister mussten wir abstellen; danach wurden wir nach Waffen
durchsucht, Wertsachen, Uhren und Messer wurden uns gleich abgenommen. Als wir anschließend an unserem Gepäck
vorbeigingen durfte niemand was mitnehmen. Als ich gebückt, nach meinem Wäschebeutel greifen wollte, in dem sich noch
3 Konservendosen und ein Brot befanden, bekam ich einen Fußtritt ins Gesicht, so dass mir ein Zahn ausgeschlagen wurde.
Wir wurden dann in einem Garten zusammen getrieben und gefragt ob jemand bei der SS gedient hat. Nachdem wir in Reihe
und Glied angetreten waren, mussten wir den Oberkörper freimachen und die Arme anheben. Es wurde nach SS-Zeichen
gesucht, die gewöhnlich unter dem Oberarm eintätowiert waren. Nachdem wir Grimma bei Leipzig, wo wir in amerikanische
Gefangenschaft geraten waren, verlassen hatten, mussten wir durch ganz Thüringen bis Hersfeld, an der Grenze zu Hessen,
marschieren. In Hersfeld wurden wir auf große Lastautos verladen, die von farbigen Soldaten gefahren wurden. Man hat
uns mit Stöcken hinauf getrieben, solange bis das Auto so voll war das man kaum stehen konnte. Die Soldaten fuhren, für
diese Straßenverhältnisse, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Wenn die Straße eine scharfe Kurve hatte, flogen
wir alle übereinander und mussten erst mit viel Kraftanstrengung auf die Beine kommen um diese Fahrt zu überstehen.
Da die Straßenränder in dieser Gegend mit Obstbäumen bepflanzt sind und deren Äste sehr niedrig hängen, hätten die
uns die Köpfe abgerissen, wenn wir uns nicht ständig geduckt hätten. Unsere Fahrt endete in Bad Kreuznach, in der Pfalz,
wo wir in ein Lager, in dem sich später 130.000 Mann und 6 Generäle befanden, eingepfercht wurden. Die Unterkunft der
Generäle befand sich unter einem Zelt, alle anderen mussten die Zeit unter freiem Himmel zubringen. Die Offiziere, die
Unteroffiziere, die Mannschaften; wurden in getrennten Camps untergebracht. Die Mannschaften wurden auch zur Arbeit
abkommandiert und konnten bei dieser Gelegenheit, Brot, Brötchen oder Zigarettenstummel organisieren, wogegen die
Offiziere und Unteroffiziere ihr Camp überhaupt nicht verlassen durften.
Die ersten Tage gab es kein Wasser und kein Brot, so dass die Kameraden vor Erschöpfung umfielen. Später standen wir
manchmal den ganzen Tag nach Wasser an, das von den, uns bewachenden Negern mit großen Wassertanks angefahren wurde. Am
dritten Tag bekamen wir mittags und abends etwas zu Essen; Brot bekamen wir erst nach zwei Wochen, nach dem aus der
Umgebung herbeigeholte Handwerker, Backöfen gebaut hatten. In den verschiedenen Gemeinden, die in den uns umgebenden
Weinbergen lagen, mussten sich alle Männer beim Bürgermeister melden. Als sie dann erschienen waren, wurden sie auf
bereitstehende Lastautos getrieben und zu uns ins Lager gebracht. Sie waren ohne Kopfbedeckung und ohne wärmere
Bekleidung angekommen, weil ihnen gesagt wurde, dass ihr Aufenthalt im Lager nur von kurzer Dauer sein würde. Man hat
uns, falls noch vorhanden, Decken und Mäntel abgenommen, mit der Begründung, sie würden für Kranke und Verwundete
gebraucht. Jeden Tag starben mehr als 200 Mann, die wir sofort in ein Zelt tragen mussten. In der Nacht wurden die
Toten dann mit unbekanntem Ziel, weggefahren.
Viele haben ihren Verstand verloren uns irrten im ganzen Camp ziellos umher. Als Latrinen wurden Gräben ausgehoben, in
die verschiedene Kameraden, bei der Verrichtung ihrer Notdurft, vor Schwäche hineingefallen sind und nicht mehr wieder
heraus kamen. Aus den Pfählen die, die jungen Obstbäume stützten, haben wir Krankentragen gebaut um unsere Kameraden,
bei Bedarf, zur Krankensammelstelle zu tragen. Es war in diesem Frühjahr auch sehr kalt, doch unsere Erdlöcher, die wir
zum Schutz vor Kälte und Wind, nur mit leeren Konservendosen ausgehoben hatten, durften nicht tiefer als 20 Zentimeter
sein. Nach jedem Regenguss mussten wir das Wasser ausschöpfen. Nach einem Gewitter, standen wir wiedermal, total
durchnässt in unserem Camp, als unerwartet am Horizont die Sonne hervortrat. Einer unserer Kameraden hatte noch eine
Trompete gerettet und fing, von dem Anblick völlig überwältigt, zu spielen an: "Es geht alles vorüber, es geht alles
vorbei, nach jedem Dezember, folgt wieder ein Mai". Daraufhin hob sich die Stimmung der tiefbetrübten Kriegsgefangenen,
so das Heimatlieder durch das ganze Camp erklangen, obwohl wir in den nassen Kleider herumgehen mussten, bis sie am
Körper trocken wurden.
Es wurden dort, unter der Aufsicht von Lehrer Dorka, auch viele Jugendfeste mit Theatervorführungen veranstaltet, zu
denen er selbst die Vorlagen organisiert hat. Der am See wohnende Bauer Johann Nadrowski, hat uns ein Scheunentor, als
Tanzboden zur Verfügung gestellt. Der Zimmermann Wilhelm Wittek hat uns eine Windmühle gebaut, die am auf dem Boden
liegenden Scheunentor aufgestellt wurde, dazu kamen Noch Tannen und Fichten, die das Ganze wie ein Bühnenbild
erscheinen ließen. Es wunden viele Bühnenstücke aufgeführt, unter anderen >Alte Weiber werden jung gemahlen<. Dazu bot
die Windmühle die entsprechende Kulisse.
Nach der Vorführung wurde der Boden aufgeräumt, um dann als Tanzdiele zur Verfügung zu stehen. Der Gastwirt Trzaska
hatte Tische und Bänke aufgestellt, Speisen und Getränke angeboten, so dass sich die die Veranstaltung bis in die
späte Nacht hinein zog. Es waren auch Leute aus Ortelsburg und anderen Nachbardörfern dabei. Im Winter hat Lehrer
Dorka eine Kreisrodelbahn eingerichtet, die von Zeit zu Zeit mit Wasser besprengt wurde, um die Gleitfähigkeit zu
verbessern. Von einer Anhöhe ging hinunter bis auf den halben See, was für alle ein großes Vergnügen war. Es kamen
Lehrer mit Schulklassen aus der näheren Umgebung um hier zu Rodeln.
Als Herr Lehrer Jobski als Hauptlehrer nach Rohmanen kam hat er mit dem Bürgermeister und der Gemeindeverwaltung
beschlossen, in der Nähe des Dorfes, auf einem zur Schule gehörenden Grundstück, einen Sportplatz anzulegen. Dafür
wurde gleich hinter den Gärten, 6 Morgen Ackerland abgetrennt, und nach Feierabend hat Lehrer Dorka mit den
Jugendlichen eingeebnet und gleich nebenan einen Graben für Schützenstand und Kugelfang ausgehoben. Am Sonntagvormittag
wurde Fußball gespielt und um 15:00 Uhr war Kleinkalieberschießen angesagt. Es musste auch ein kleiner Beitrag erhoben
werden, um Munition kaufen zu können. Eine Büchse konnten wir aus beim Kleinkalieberverein in Ortelsburg ausleihen.
Als Herr Lehrer Jobski als Hauptlehrer nach Rohmanen kam hat er mit dem Bürgermeister und der Gemeindeverwaltung beschlossen, in der Nähe des Dorfes, auf einem zur Schule gehörenden Grundstück, einen Sportplatz anzulegen. Dafür wurde gleich hinter den Gärten, 6 Morgen Ackerland abgetrennt, und nach Feierabend hat Lehrer Dorka mit den Jugendlichen eingeebnet und gleich nebenan einen Graben für Schützenstand und Kugelfang ausgehoben. Am Sonntagvormittag wurde Fußball gespielt und um 15:00 Uhr war Kleinkalieberschießen angesagt. Es musste auch ein kleiner Beitrag erhoben werden, um Munition kaufen zu können. Eine Büchse konnten wir aus beim Kleinkalieberverein in Ortelsburg ausleihen.
Als Adolf Hitler an die Macht kam wurde die SA gegründet. Der Bürgermeister Michael Kownatzki
wurde zum Gruppenführer ernannt und folgende Männer haben sich freiwillig gemeldet: Wilhelm Matzey, Johann Gloddek,
Gustav Nadrowski, August Buttler, Karl Baran, Emil Nickel, Wilhelm Jaschinski, Emil Bork, Ernst Rattay und Gustav Bach.
Bei Versammlungen war die SA in Uniform angetreten um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Wer versucht hat Unruhe zu
stiften, egal aus welchem Grunde, wurde aufgefordert den Saal zu verlassen, andernfalls wurde er mit Gewalt entfernt.
Herr Lehrer Jobski wurde zum politischen Leiter ernannt, seine Frau hat die NS-Frauenschaft gegründet, Lehrer Dorka
die HJ, und so bekam die Dorfgemeinschaft, nach und nach ein anderes Gesicht. Der Sportplatz und der Schützenstand
wurden jetzt mehr als früher in den Mittelpunkt gestellt. Nach der Feldarbeit hat der Bürgermeister Fuhrwerke bestellt
und den Sportplatz noch besser herrichten lassen.
Der Bauer Wilhelm Both wurde zum Ortsbauernführer ernannt, mit der Aufgabe alles Land für den Anbau von Getreide und
Futtermittel bereitzustellen, oder wenn das nicht möglich war mit Wald aufzuforsten. Durch den Einsatz von Kunstdüngern
sollten größere Erträge aus dem Boden geholt werden, um den Viehbestand zu vergrößern und mehr Milch und Butter zu
produzieren. Deutschland sollte im Stande sein sich selbst zu selbst zu ernähren, ohne auf Importe angewiesen zu sein.
Frau Jobski hat, innerhalb der der NS-Frauenschaft, mit Hilfe von Fachkräften aus Ortelsburg, Lehrgänge veranstaltet,
auf denen man Backen und Nähen lernte. Auf den Bauernhöfen befand sich auch immer mehr Rassegeflügel, das eine erhöhte
Produktion von Eiern und Geflügelfleisch sicherstellen sollte.
Die Rohmaner Bauern hatten, außer in der Landwirtschaft, noch andere Verdienstmöglichkeiten in der Kreisstadt. In
Ortelsburg wurden vier Sägewerke betrieben, die mit Langholz aus dem Walde versorgt werden mussten. Wir haben eine
Kiefer von über 8 Festmeter angefahren, der wir zuerst 6 Meter Spitze abschneiden mussten, um diese Last überhaupt
auf den Wagen zu bekommen. Sechs Pferde musste angespannt werden um den Wagen zur befestigten Straße zu bringen.
Fichten und Tannen wuchsen bis zu einer Länge von 30 Metern. Auch beim Transport von Ziegel, von der Ziegelei zum
Bahnhof, konnte man gutes Geld verdienen.
Im Jahr 1934 wurde Rohmanen an das überregionale Stromnetz angeschlossen und schaffte auf diese Weise den Sprung von
der Petroleumlampe zur Glühbirne. Neben dem Grundstück von Karl Pietzonka wurde ein Transformatorhäuschen errichtet,
in dem der ankommende Strom von einer Hochspannung auf eine Verbrauchsspannung transformiert wurde. Es gab schon eine
Überlandleitung, die aus Richtung Ortelsburg kommend, quer über die Felder, in Richtung Neu Keykuth weiter ging.
Durch eine Zwischenspanne wurde der Transformator, mit der Hauptleitung auf Kownatzkis Feld verbunden.
Ein Stromanschluss konnte die Arbeit im Haus und Hof auf vielfältige Weise erleichtern, doch nur die besser gestellten
Bauern, sowie noch manche Pensionäre, die ein festes Einkommen hatten, konnten sich dass leisten. Weil nur wenige an
der Elektrifizierung teilnahmen, war ein Stromanschluss mit hohen Kosten verbunden. Nur Gustav Pietzonka, Gasthof
Trzaska, Friedrich Nickel, die Schule und Wilhelm Both, wurden in der ersten Phase erfasst.
Im Jahr 1952 wurde von den polnischen Behörden die zweite Stufe der Elektrifizierung eingeleitet, in der alle im Dorf
stehen Gebäude erfasst wurden. Am Anfang wurden nur Leitungen für Lichtstrom gelegt und auch nur 3 Lichtstellen pro
Haushalt bewilligt. Doch im nachfolgenden Zeitraum wurden dann, wenn Material vorhanden war, weitere Lichtpunkte
angelegt. 1952, am zweiten Wochenende im Advent, wurden dann die Leitungen geschaltet und alle waren von der
plötzlichen Helligkeit sehr begeistert. Wenn man Glühbirnen auswechseln wollte musste man am Anfang weite Wege
zurücklegen, um welche zu bekommen. In den 60ger Jahren wurden dann immer mehr Starkstromleitungen gelegt, weil die
Bauern elektrische Geräte kaufen konnten. Ende der 60ger wurden auch die Abbauten an das Stromnetz angeschlossen.
Das Urnengrab auf unserem Feld
Auf unserem Feld, in Richtung Seelonken, bin ich oft beim pflügen gegen Steine gestoßen, manchmal
rissen sogar die Stränge am Pferdegeschirr. Eines Tages nahm ich einen Spaten, Brechstange und einen langen Baum, um
der Sache auf den Grund zu gehen. Als ich eine Menge Sand ausgehoben hatte stieß ich auf eine steile, aus Steinen
errichtete Wand, die ich auch mit dem Baum nicht aus der Fassung bringen konnte. Ich habe den ganzen Vormittag gegraben,
konnte jedoch nicht unter die Steine kommen. Einige Tage später hatten wir in der Schule eine Bauernversammlung, da
habe ich Herrn Biella und Herrn Lehrer Dorka von meinem Fund berichtet. Am nächsten Morgen kam der Lehrer Dorka mit der
ganzen Schulklasse, mit Spaten und Sieben ausgerüstet auf unser Feld und fingen an die ausgehobene Erde zu sieben.
Lehrer Dorka benachrichtigte daraufhin den Leiter des Ortelsburger Heimatmuseums, der am nächsten Morgen vorbei kam um
sich die Fundstelle genau anzusehen. Er beauftragte ihn 4 Mann zu besorgen, um die Steine ringsum frei zu schaufeln.
Zwischen den Steinen durften wir die Erde nur mit Esslöffeln ausheben. Als es plötzlich zu regnen anfing hat Lehrer
Dorka die Brauerei Daum, in Ortelsburg angerufen, die uns über der Fundstelle ein Zelt errichtet haben, damit wir
ungestört weiterarbeiten konnten. Wir fanden 8 flache und 8 hohe Urnen zu beiden Seiten am Körper. Die Urnen wurden in
Gipsbinden eingewickelt und ins Heimatmuseum nach Ortelsburg gebracht, wo sie durch einen Fachmann, der extra aus einem
Königsberger Museum angereist war. Nach Reinigung der Urnen hat er festgestellt, das die Grabstätte etwa 2000 Jahre vor
Christi Geburt angelegt wurde und ein Doppelgrab war, in dem ein Toter liegend und einer in Hochstellung beigesetzt
wurde.
Die Nachricht von der Fundstelle verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Es erschienen viele Schaulustige, ganze
Schulklassen aus der Umgebung, mit Autos und zu Fuß. Durch die vielen Menschen wurden die bestellten Ackerflächen auf
unserem Feld sehr in Mitleidenschaft gezogen, eine Entschädigung haben wir nicht erhalten. Das Grab wurde vor dem
Heimatmuseum in Ortelsburg wieder so aufgebaut wie man es auf unserem Feld vorgefunden hat. Für den Transport der
Steine wurde ich entlohnt. Die Urnen hat das Königsberger Museum an sich genommen und wollte sie nicht wieder hergeben,
weil die solch einen Fund noch nicht in ihrer Sammlung hatten.
Sonnenwendfeuer
Am 24 Juni fand eine Sonnenwendfeier statt. Ein Brauch der an die alten Germanen erinnern sollte.
Der Lehrer Dorka hat den Bürgermeister beauftragt 2 Fuhrwerke in den Wald zu schicken, die Holz und alten Reisig holen
und auf dem großen Schulberg abladen sollten. Das Straßenbauamt hat uns Teertonnen zur Verfügung gestellt. Die ganze
Dorfgemeinschaft wurde eingeladen, am Abend, nach der Feldarbeit, an der Sonnenwendfeier teilzunehmen. Lehrer Dorka
hielt zuerst eine Ansprache, in der er anschaulich erklärte wie unsere Vorfahren in grauer Vorzeit gefeiert haben.
Nach dem offiziellen Teil wurden das Holz und die Teertonnen angezündet, es wurden Heimatlieder gesungen, wie: Wild
flutet der See, drauf schaukelt der Schiffer den schwankenden Kahn, Schaum wälzt er wie Schnee, von grausiger Mitte
zum Ufer heran, wild fluten die Wellen auf Vaterlands See, wie schön, oh trag mich auf Spiegel zu Hügel, Masovias See.
Masovia Land, mein Heimatland, Masovia es lebe mein Vaterland.
Lehrer Alfred Dorka und sein Wirken für Rohmanen.

Friedrich Biella hatte auf seinem Feld einen Granitstein mit einer geraden Seite, den haben wir
mit viel Schweiß an den Dorfteich transportiert und auf einer Erhöhung abgelegt. Der Stein sollte zum Denkmahl für die
Gefallenen des Ersten Weltkrieges umgestaltet werden. Da zu Wenige daran ein Interesse zeigten, wurde diese Idee fallen
gelassen und der Stein irgendwann ins Wasser gerollt. Der Lehrer Dorka war viele Jahre in Rohmanen tätig, dort hat er
später seine ehemalige Schülerin, Lotte Biella geheiratet. Er hat sich sehr für die Entwicklung des Dorfes interessiert,
war bei jeder Gemeindeversammlung anwesend und hat auf Schwachstellen hingewiesen die den Fortschritt behinderten.
Gemeinsam mit den Schülern hat er den Ehrenfriedhof für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges gepflegt, an der
Wegegablung nach Eichtal und zu Ehren des Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg eine Eiche gepflanzt.
Zum Advent hat Lehrer Dorka mit der Jugend einen Adventstern, in verschiedenen Farben gebastelt.
Der Stern wurde auf einer 2 Meter langen Stange befestigt, in der Mitte wurde ein Wachslicht angezündet, am Stern
wurde eine Schnur angebracht, wenn man daran zog rollte der Stern hin und her. Am ersten Wochenende im Advent
versammelten sich jung und alt, um den Stern durch das Dorf zu tragen. Alle schlossen sich dem vorausgehenden
Sternträger an, der den Stern durch die Hauptstraße und die angrenzenden Wege trug. Dieser Sternmarsch wurde an den
folgenden Adventwochenenden wiederholt.
Am ersten Weihnachtfeiertag wurde um 4:00 Uhr morgens ein Frühgottesdienst gehalten. Zuerst hat der Pfarrer eine
Andacht gehalten, dann haben die Kinder ein Krippenspiel aufgeführt und die Gemeinde hat schöne Weihnachtslieder
gesungen. Der Gastwirt Trzaska hat uns den Saal zur Verfügung gestellt. Wir hatten eine Posaunen- u. eine
Gitarrengruppe. Unter der Leitung von Herrn Willi Doormann spielten: Gottlieb Brosch, Fritz Ollech,
Gustav Rattay(Sopran), Wilhelm Pilath, Gustav Brosch(Alt), Fritz Both(Tenor) und Fritz Brosch(Bass).
In der Gitarrengruppe wirkten mit: Martha Ollech, Hedwig Ollech, Martha Lekzik, Martha Michalick und Auguste Lekzick.
Willy Doormann hat sie auf der Geige begleitet.
Kurz vor Ausbruch des 2. Weltkrieges
Bei der Aufstellung des Grenzschutzes(Regiment Buchholz), hat er als Hauptfeldwebel die
Gruppenführerkurse überwacht und selbst die fähigsten Männer dafür vorgeschlagen. Das Ausbildungspersonal hat das
Jäger-Battalion gestellt. Wir kamen zuerst ins Stadion(Waldheim), wurden da eingekleidet und dann ging es gleich
kasernenmäßig zu, theoretisch und praktisch. Jeder musste vor die Front treten und nachweisen ob er im Stande ist,
Befehle zu erteilen. Abends wurden Filme vorgeführt die uns zeigen sollten wie eine Gruppe sich im Gelände entfalten
muss. Die Exerziervorschriften hatten sich, im Verhältnis zu Kaiser Wilhelms Zeiten, etwas geändert. Damals bestand
eine Gruppe aus 8 Mann und einem Unteroffizier, jetzt aus 10 Schützen, 3 für das leichte Maschinengewehr und einem
Unteroffizier(13 Mann). Nach der Schulung folgte eine Abschlussprüfung, danach ein gemütliches Beisammensein. Aus
Rohmanen haben folgende Männer die Prüfung bestanden: Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy, Gustav Rattay und
Gustav Deptolla. Unsere Uniformen waren alle zu klein und es gab viel zu lachen bei der Anprobe.
Die erste Übung habe ich mit Emil Rosowski, in Lenzinen gemacht. Der Gutsbesitzer Marzinzick hat seine Scheune als
Unterkunft zur Verfügung gestellt. Er war im Range eines Hauptfeldwebels. In seinem haus war die Schreibstube
untergebracht, die er selbst verwaltete. Ein Lastauto hatte Uniformen aus der Kaserne in Ortelsburg geholt, jeder
musste eine Uniform anlegen und dann wurde solange getauscht bis alle eine passende gefunden hatten. An den Namen des
Kompanieführers kann ich mich nicht mehr erinnern. 1935 wurden wir zu einer Übung in die Dragonerkaserne nach Lyk
einberufen. Die Gruppenführer, Zugführer, und Kompanieführer die schon Frontberührung im dem Ersten Weltkrieg hatten,
mussten eine Woche früher anreisen. Die Übungen waren auf 6 Wochen angelegt. Die meisten der einberufenen waren noch
nie mit dem Wehrdienst in Berührung gekommen. Jeder Gruppenführer bekam 13 Mann zugeteilt.
Unser Zugführer war Leutnant Neumann, Kompanieführer Oberleutnant Rutschko, Battalions-Kommandeur Major Gröning
(Regiment Buchholz). Hier ging es wieder Kasernenmäßig voran. Das Bataillon wurde hier vereidigt. Jeden zweiten
Sonntag durften unsere Frauen uns besuchen. Ein Jahr später wurden wir wieder zu einer Übung einberufen, auf den
Truppenübungsplatz nach Arys. Jeder Gruppenführer hatte den Auftrag die Gruppe zu entfalten, und auf bewegliche
Figuren zu schießen. Diese Übung musste später mit scharfer Munition wiederholt werden. Jedes Maschinengewehr bekam
50 Schuss, jeder Schütze 20 Schuss zugeteilt. Nach dem Abschießen wurden die Treffer gezählt und dem Kommandierenden
Bericht erstattet. In einiger Entfernung spaziert ein Storch umher, der gar nicht bemerkt hatte dass geschossen wurde,
was bei den Kameraden ein großes Gelächter hervorrief.
Nach der Übung wurde uns gesagt das jeder Gruppenführer eine arische Abstammung nachweisen sollte. Ich konnte in den
Rheinsweiner Kirchenbüchern meine Vorfahren aus Gellen, bis zum Jahr 1732 zurück, nachweisen und wurde zum
Unteroffizier befördert. Aus unserem Dorf wurden auch, Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy und Gustav Deptolla
befördert. Zwischendurch mussten wir schon mal in die Radfahrer-Kaserne nach Ortelsburg, Gewehre empfangen und im
Gelände üben. Am 31 Juli 1939 wurde mir von einem Soldaten ein Schreiben übereicht, das mich aufforderte, am 1. August
um 6:00 Uhr, bei der 3. Kompanie, des 2. Infanterieregiments zu erscheinen.
Um 5:30 hat mich meine Schwester in die Kaserne gebracht. Auf der Schreibstube erklärte mir der Hauptfeldwebel,
dass mir ab sofort der Dienstgrad eines Sanitäters zugewiesen wird, ich mich in der Kammer einzukleiden hätte und mir
in der Handwerkerstube die entsprechenden Schulterklappen annähen lassen sollte. Die aktiven Sanitäter wurden den
Feldlazaretten zugewiesen und wir kamen an ihre Stelle. Unser Bataillon wurde nach Schodmak zum Bunker bauen und
Stacheldraht verlegen eingeteilt. Wir zogen in Begleitung einer Musikkapelle bis zur Kreuzung am Krankenhaus, dann
weiter zu unserem Bestimmungsort, gefolgt von einer Gulaschkanone die in den nächsten Tagen für unsere Verpflegung
sorgen sollte.
Am 14 August haben wir die Jägerkaserne, begleitet von einer Musikkapelle endgültig verlassen und zogen zuerst durch
Ortelsburg, dann über Lehmanen ins Feldmanöver, hinter Rohmanen. Dort entfaltete sich das Bataillon im Gelände, die
Verwundetensammelstelle wurde auf dem Hof des Bauern Friedrich Neumann eingerichtet. Gegen Abend wurde zu Sammeln
geblasen und Biwak bezogen, wobei unsere 3.Kompanie, in einem kleinen Wallt, in der Nähe von Otto Nickels Gehöft
Stellung bezogen hatte. Die 2. und 4. Kompanie hatte sich in der Nähe vom Abbau Pallasch niedergelassen. Die Frau
Nickel hat am Abend ein Mädel in Dorf geschickt um meiner Frau Bescheid zu sagen, wo wir uns zurzeit befinden. Meine
Frau ist dann noch gekommen um sich von mir zu verabschieden, weil wir am nächsten Morgen um 3:00 Uhr Zelte abbrechen
und um 4:00 Uhr in Richtung Kaspersguth marschieren sollten.
Wir sind dann über Achodden, Seelonken, Lehmanen, Ortelsburg, bis nach Grammen und Schützendorf marschiert, wo wir an
einem See Biwak bezogen haben. Es wurde immer gesagt, wir kommen zum Tannenberg-Denkmal bei Hohenstein, wo ein Reichs
Kriegervereinsfest stattfinden sollte. Es wurden auch schon Vorkommandos aufgestellt, doch dann kamen wir nach Orlau
und Lahna-Mühle, da wo die Alle entspringt haben wir 2 Tage biwakiert. Unser Kompanieführer hat uns nach Waplitz auf
den Soldatenfriedhof des Ersten Weltkrieges geführt und uns erklärt wie das Jägerbataillon sich 1914 hier entfaltet
hat und aufgerieben wurde. Dann mussten wir in der Nähe von Gut Koslau über einen Fluss und bezogen in einem Waldstück,
vorbereitete Stellungen in der Nähe der polnischen Grenze. Herr und Frau Thalmann haben uns jeden Tag, bis zur Grenze,
mit Brötchen und Getränken versorgt. Es wurde scharfe Munition ausgegeben, weil wir am nächsten Morgen um 4:00 Uhr die
polnische Grenze überschreiten sollten.
Am nächsten Morgen um 10 Minuten vor 4:00 Uhr kam der Befehl; scharfe Munition abgeben, alles zurück in ein 6 Kilometer
entferntes Dorf, wo wir auch einquartiert wurden. Das alles geschah’ eine Woche vor dem 1. September 1939. Es wurde
gesagt dass der Führer dem polnischen Präsidenten Rid-Szmigly, ein Ultimatum gestellt hat und es wahrscheinlich nicht
zum Krieg mit Polen kommt. Genau nach 5 Tagen kehrten wir wieder in die gleichen Stellungen zurück, es wurde wieder
scharfe Munition ausgegeben und am nächsten Morgen um 4:00 Uhr überschritten wir die polnische Grenze.
“Der 2. Weltkrieg.”
Der erste Einsatz in Polen
Wir kamen zuerst in ein Dorf in dem sich nur alte Menschen befanden. Auf unsere Frage wo denn die Bewohner wären sagte
man uns dass alle geflohen sind, weil erzählt wurde, die Deutschen würden alle Polen misshandeln und verstümmeln. Ich
habe ihnen daraufhin gesagt dass uns, unter Androhung von Strafe verboten wurde, einem Zivilisten etwas anzutun. Das
Vieh, die Schweine und Hunde des Dorfes liefen frei herum und die Soldaten fingen an auf die Hunde zu schießen, bis
gesagt wurde es seien Meldehunde im Dienste der Deutschen Wehrmacht und dieser Unfug der eigenen Truppe schaden würde,
weil etwaige Querschläger eigene Kameraden verletzen könnten. Wir gingen weiter auf polnischer Seite entlang der Grenze,
bis wir am Nachmittag die ersten Vorposten der Festung Mlawa erreichten, da befanden wir uns plötzlich im Feuerhagel
polnischer Festungsflack.
Am nächsten Morgen hatte ich schon 3 Verwundete und wusste nicht wo sich eine Verwundeten Sammelstelle befindet. Ich
suchte den Bataillonsgefechtstand auf der sich auf einer Anhöhe befand. Ich habe unseren Oberstabsarzt gefragt wo denn
die Verwundetensammelstelle wäre. Er rief beim Tross an, wo er die Auskunft erhielt, das sich vor dem Dorf ein Bunker
befindet in dem man die Verwundeten sammeln sollte, die dann von Sanitätsautos abgeholt würden, weil das Dorf unter
Artilleriebeschuss stand. Am Sonnabend haben unsere Flieger die Bunkerstellungen bombardiert, konnten aber, trotz guter
Treffer nicht viel ausrichten, die Bunker wurden nur etwas angekratzt.
Der Beschuss unserer vordersten Linien ging mit unverminderter Heftigkeit weiter. Am Sonntag verkündete eine große
Staubwolke die Ankunft unserer Panzer, doch sie kamen nur bis zur Panzersperre und mussten wieder abdrehen ohne den
Polen einen schaden zuzufügen. Ein Panzer bekam einen Volltreffer, der Fahrer konnte noch umkehren. Er blutete am Kopf
und der Schütze war so eingeklemmt, das wir ihn nur mit einem Seil unter den Armen, durch die Luke nach oben ziehen
konnten. Ob er seine Verwundung überlebt hat ist mir nicht bekannt, denn in der Nacht wurden Panzergeschütze nach
vorne in Stellung gebracht, die direkt in die Schießscharten der Bunker geschossen und so die Verteidiger vertrieben
haben. Daraufhin sind wir weiter vorgerückt. Auf einer Wiese war ein tiefer Graben ausgehoben und mit Ästen getarnt,
da war ein Panzer hinein gefahren, so dass nur das Hinterteil herausragte und er sich nicht aus eigner Kraft befreien
konnte. In der Luft waren Flieger die Brandbomben abwarfen, ich habe mich auf den Boden geworfen weil ich dachte die
würden explodieren, aber sie zischten nur, so das Stoppeln und Graß rings herum in Brand gerieten.
Bei den Kampfhandlungen gab es mehrere Verwundete, denen ich gerade Verbände anlegen wollte, als unser Hauptmann zur
Trillerpfeife griff um mir klar zu machen, dass ich ihm folgen sollte. Die Polen fingen an zu schreien, ich sollte
sie ins Lazarett bringen denn hier im Wald würde sie niemand finden. Ich setzte mich aufs Fahrrad und folgte unserem
Kompanieführer, der mir sagte ich soll immer bei der kämpfenden Truppe bleiben, denn hinter der Front sind die
Sanitätsabteilungen, die werden die Verwundeten schon versorgen. Der Vormarsch dauerte bis in die späte Nacht. Auf
einem Gehöft, das nach allen Seiten durch Feldwachen abgesichert wurde, machten wir endlich Rast. Wir haben
Getreidegarben auf dem Hof ausgebreitet und uns zur Ruhe gelegt, als plötzlich um Mitternacht Leuchtraketen den Himmel
erhellten und Maschinengewehrfeuer uns aus dem Schlaf schreckte. Ein par polnische Soldaten hatten das Feuer eröffnet,
aber sich kurz darauf ergeben.
Die Narew-Überquerung
Als es hell wurde ging der Vormarsch weiter. Es wurde uns untersagt Tagebuch zu führen, darum
weiß ich nicht wie die Orte hießen, durch die wir marschiert sind. Als wir durch ein sumpfiges Gelände vor drangen
stand auf einer Anhöhe am Horizont, die polnische Artillerie, die uns sofort unter Beschuss nahm. Unser Hauptmann war
der Meinung dass wir schon in der Nähe des Flusses Narew sein müssten, als aus den Sträuchern ein mit Schlauchboten
beladenes Lastauto auftauchte. Wir wurden aufgefordert mit je 6 Mann ein Schlauchboot zu nehmen, an einem Aggregat
der daneben stand mit Luft zu füllen und zu Wasser zu lassen. In einer Stunde war das ganze Bataillon über die Narew,
wo der Vormarsch fortgesetzt wurde. In einem Dorf überraschte uns die polnische Kavallerie und fing sofort mit
Maschinengewehren zu schießen an. Da kam der Befehl: Alles wieder zurück. Es ging noch schneller als auf der Hinfahrt.
Wir sind erst einige Kilometer am Fluss entlang gegangen und haben dann zum zweiten Mal rüber gesetzt.
Die Gehöfte im Dorf standen alle in Brand. Auf einem waren viele Bienestöcke. 2 Kameraden wollten den Stöcken Waben
entnehmen, doch die Bienen durch das Feuer aufgeschreckt, überfielen sie sofort und stachen derart zu das sie nicht
mehr wieder zu erkennen waren. Ich habe die Einstichstellen mit Salmiak betupft, mehr konnte ich nicht tun. Wir mussten
auf unserem Vormarsch durch einen Wald der in Flammen stand, so dass man kaum atmen konnte. Es ging weiter in Richtung
Minsk und Warschau, wo schon die Sowjetische Armee durchgegangen war, die Pferde und Vieh von einem Gut mitgenommen
hatten. In einem Wald stießen wir unverhofft auf ein Kloster, in dem wir einige Gefangene machten. Dann trafen wir auf
eine gute Straße die nach Grochow ging.
Als wir dort einmarschierten wurden wir aus den oberen Stockwerken beschossen, so dass wir, um uns zu schützen, nur an
den Hauswänden entlang gehen konnten. Wir haben jedes Haus nach Feinden durchsucht. Vor einem Haus stand ein Hund der
niemanden reinlassen wollte, solange bis ihn eine Kugel traf. Die polnische Artillerie feuerte von Warschau aus, um
unseren Vormarsch zu stoppen. Wir hatten uns gerade eingegraben als plötzlich deutsche Flieger am Himmel erschienen,
die unsere Stellungen mit Bomben bewarfen und dabei viel Unheil anrichteten. Wir haben sofort Fliegertücher
ausgebreitet und Leuchtraketen abgeschossen. Da ich in dem Graben, den ich kurz zuvor ausgehoben hatte, sofort in
Deckung gegangen bin ist mir zum Glück nichts passiert. Unter den anderen Kameraden gab es viele Verwundete, so dass
ich nicht wusste wem ich zuerst helfen sollte.
Der Oberstabsarzt hat mich sofort tatkräftig unterstützt, so das bald alle Verwundeten versorgt waren, außer einem,
dem ein Bombensplitter den Arm abgerissen hat. Ich habe im 3 große Verbandspäckchen auf die Wunde gelegt, doch die
Blutung ließ sich trotzdem nicht stoppen, so dass er eine Stunde später auf der Krankensammelstelle verstarb. Wir
haben danach in einem Tomatenfeld einen Graben ausgehoben und eine neue Abwehrstellung bezogen. Die Gruppe Schwarz
bekam den Auftrag nach etwaigen versprengten polnischen Verbänden Ausschau zu halten, als sie unerwartet aus einer
Häuserreihe mit Maschinengewehrsalven überschüttet wurden. Der Gruppenführer und noch ein Soldat wurden dabei tödlich
verwundet. Danach wurde noch ein weiter Stoßtrupp, unter der Führung von Leutnant Briskorn, der sich dazu freiwillig
gemeldet hatte, hinaus geschickt um den Gruppenführer und den anderen Toten zu bergen.
Bei diesem Unternehmen, das erfolglos ausging, weil die Toten schon verscharrt waren, durchschlug eine Kugel den
Stahlhelm von Leutnant Briskorn, der auch sofort tot war. Alle Toten wurden später, an der Kirchenmauer in Grochow, in
Särgen beigesetzt: Hauptmann Schönwald sagte, das sie nach dem Kriege auf den Heldenfriedhof nach Ortelsburg überführt
werden. Drei Tage lagen wir bei Grochow in Stellungen, waren dem polnischen Maschinengewehrfeuer sowie den Bomben
deutscher Flugzeuge ausgesetzt. In der Nacht musste ich zu einem Verwundeten in die vorderste Linie und habe den
Rückweg nicht mehr finden können, als plötzlich Gewehrfeuer aufflammte habe ich in den Ruinen Schutz gesucht. Erst im
Morgengrauen konnte ich mich wieder orientieren und zu meinem Unterstand zurückfinden.
Warschau wurde tagelang bombardiert und stand auch unter Artilleriebeschuss. Aus dunklen Rauchwolken kamen oft ganze
Bündel von Papier angeflogen. Die Verwundeten kamen oft auf Krücken zu unserem Unterstand, ich habe sie dann zur
Krankensammelstelle hingeführt. Wir haben auch polnische Zivilpersonen betreut, die während der Kampfhandlungen
verwundet wurden. Als einmal 2 Jungen vorbeiliefen hat einer ihnen nachgerufen sie sollten seiner Frau Bescheid sagen,
er wäre auf der Krankensammelstelle an der Kirche. Als wir dort ankamen war seine Frau, mit einem Kind auf dem Arm,
schon da.
Nach der Kapitulation von Warschau, gingen wir über Sokolow zum Bug und haben dort Quartier bezogen. Der Russe hatte
sich bereits hinter den Fluss zurückgezogen, hatte alles Vieh und Pferde mitgenommen. Dort erreichte mich ein Telegramm
von zu Hause, dass meine Tochter gestorben ist. Es sprach sich auch herum dass verschiedene Heimaturlaub bekommen haben,
ich durfte auch für 14 Tage heim. Wir fuhren mit Lastautos nach Allenstein in die neue Reiterkaserne, zum
Ersatzbatallion, da haben wir unsere Gewehre und Munition abgeben, dann durften wir, jeder in seinen Heimatort
weiterfahren.
Als wir unsere Quartiere am Bug verlassen haben war sehr viel Schnee gefallen. Hier in Ortelsburg fanden wir die
gleiche Wetterlage vor, aber nach 3 Tagen war alles wieder weggetaut und wir konnten die Kartoffelernte, die durch den
frühen Wintereinbruch gestoppt wurde, zu Ende bringen. Ein Tag bevor ich zu Hause angekommen bin wurde die Tochter
beerdigt. Nach 14 Tagen mussten wir uns in Allenstein melden, Gewehre empfangen und wieder zurück zur Division an den
Bug 150 Kilometer hinter Warschau. Die elfte Division, zu der wir auch gehörten sollte in den Westen Deutschlands
verlegt werden und war schon unterwegs zur Verladestation Skiernewice 50 Kilometer vor Warschau.
Mein Dienst als Sanitätsunteroffizier
Unser Bataillon kam in das Städtchen Burscheid, im Kreis Opladen, wo wir in Privatquartieren
untergebracht wurden. Nach 3 Monaten, im Januar 1940, wurden wir nach Solingen verlegt, wo wir bis zum
Frankreichfeldzug stationiert waren. Wir mussten an Feldübungen teilnehmen, wie andere die in Kasernen untergebracht
waren. Während dieser Zeit musste jeder seine Zähne in Ordnung bringen lassen. Jeden Tag fuhren 20 Mann in die
Cäzilienstraße nach Köln, zur Zahnklinik. Im Rheinland wurde unsere Division neu aufgestellt. Ausfälle durch den
Polenfeldzug wurden durch neue Soldaten ergänzt. Ich kam nun zum Ersatzbatallion, war der Älteste in der ganzen
Kompanie. Als der Frankreichfeldzug losging wurde unser Ersatzbatallion mit den noch vorhandenen Verwundeten, in die
neue Reiterkaserne, nach Allenstein verlegt.
Meine Frau hat, mit Unterstützung der Bauernschaft, einen Antrag gestellt, daraufhin wurde ich zur Frühjahrsbestellung,
beurlaubt und später bis auf weiteres vom Militärdienst freigestellt. Als der Russlandfeldzug losging wurde ich von der
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg, für 14 Tage einberufen. Ich war seit 1922, Mitglied der freiwilligen
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg und habe jedes Jahr an Übungen teilgenommen. Jede Bereitschaft musste etliche Leute
stellen. Von Rohmanen wurden Emil Rosowski, Johann Dembek, und ich, zur Krankensammelstelle Wirballen, in Litauen,
abkommandiert. Dorthin kamen Lazarettzüge aus Russland mit der Breitspurbahn. Die Verwundeten wurden frisch verbunden
und auf Waggon mit Normalspur verladen und nach Deutschland gebracht.
Als die 14 Tage vergangen waren wollten wir wieder nach Haus zurück, doch man wollte uns nicht entlassen. Stattdessen
wurden wir dem Wehrkreisamt Königsberg zugeteilt, neu eingekleidet und zur Aushilfe ins Lazarett nach Gumbinnen
abkommandiert. Mehr als ein Jahr war ich in den Urlauber-Baracken, habe dort Krankenstube betreut. Später, bis zum
Dezember 1944, war ich im Reserve-Lazarett 4, in Königsberg tätig. Dort habe ich auch die Luftangriffe der Engländer,
vom 25 bis 26. August 1944 miterlebt.
Wir sollten gerade einen Lazarettzug in Rotenstein entladen, als plötzlich die Sirenen ertönten - Fliegeralarm. Im
gleichen Moment waren die ersten Flugzeuge auch schon da, zuerst warfen sie „Tannenbäume” und danach Foßforkanister ab.
Die Omnibusse standen schon zur Abfahrt bereit als es losging. Wir haben die Verwundeten schnell in den
Luftschutzkeller getragen, haben die Betten von den Fenstern weggerückt damit die Verwundeten nicht von den
Glasssplittern verletzt wurden. Im Kasernenhof brannten die Fosforkanister lichterloh. Unsere Unterkunft, die sich in
einer Baracke befand ist völlig abgebrannt, mit dem Wenigen was wir unser Eigen nannten. Am nächsten Tag wurden wir neu
eingekleidet und am 29. bis 30. kamen die englischen Bomber wieder, sie setzten genau da ihr Zerstörungswerk fort wo
sie vor 3 Tagen aufgehört hatten.
Anfang Dezember 1944 musste ich mich nach Stablack melden und musste dann zur Sanitätsabteilung 1, nach Gernau, das
liegt zwischen Lodz und Warschau. Vormittags hatten wir Felddienstübungen und nachmittags theoretischen Unterricht.
Jeden Tag wurden Gruppen zusammengestellt und zu anderen Einheiten abkommandiert. Ich kam zu einer Panzerabteilung, wo
wir an einem Morgen plötzlich auf dem Kasernenhof antreten mussten und zu unserer Überraschung mit der Nachricht
konfrontiert wurden, dass der Russe an mehreren Frontabschnitten durchgebrochen war. Wir bekamen sofort einen
Marschbefehl in Richtung Lodz, wo das Stadtbild noch intakt war, selbst die Straßenbahnen fuhren noch. In der Nacht
haben russische Flugzeuge die Stadt bombardiert. Die Kaserne in der wir untergebracht waren hatte keine
Luftschutzkeller, aber zum Glück blieben wir von Bombentreffern verschont. Am nächsten morgen bot sich uns ein Bild der
Verwüstung. Die entgleisten Straßenbahnwagen, sowie andere Fahrzeuge blockierten die Straßen. Die Älteren unter uns
bekamen Fahrscheine für einen Transportzug, der bereit hinter Lodz abfahrbereit, unter Dampf stehen sollte. Als
russische Panzer in den Straßen auftauchten, verbrannte die Schreibstube unsere Wehrpässe und andere wichtige
Dokumente. Wir liefen zu der Station auf der unser Transportzug bereitstehen sollte, aber da war kein Zug mehr zu sehen
und wir setzten unseren Rückzug zu Fuß fort.
Der Rückzug und Zusammenbruch der Ostfront
In Dobroschin, einer Stadt in Polen, wurde gerade ein Lazarettzug verladen, doch wir kamen nicht
mehr zum Einsatz, weil die russische Infanterie uns schon auf den Fersen war. Es ging weiter über den Fluss Bober,
Sagan, bis nach Glogau an der Oder. Dort wurden wir der 29. motorisierten Sanitätskompanie zugeteilt. Im
Garnisonslazarett wurden noch Operationen durchgeführt. Unsere Division hatte ihr eigenes Feldlazarett, so dass wir den
Befehl zu Weiterfahrt erhielten und noch unbeschadet die Oderbrücke passieren konnten, denn Glogau wurde zur Festung
erklärt. Wir haben 2 Pferdewagen organisiert und mit Verbänden, sowie medizinischen Instrumenten beladen. So kamen wir
bis nach Lübbenau im Spreewald, wo wir in einem Schloss, in zuvor ein Museum war, unser Lazarett untergebracht haben.
Weil die Amerikaner Cottbus bombardiert hatten, wurden die Verwundeten zu uns nach Lübbenau gebracht. Hier haben wir
Tag und Nacht gearbeitet, um die vielen Verwundeten, aus den schweren Kämpfen bei Grünberg und Sagan zu versorgen. Die
Soldaten von der Abwehrfront kamen schon mit abgestorbenen Armen oder Beinen bei uns an, weil in vorderster Linie keine
Frontlazarette mehr vorhanden waren; es mussten viele Amputationen durchgeführt werden. Als für unsere Pferde kein Heu
mehr vorhanden war, schickte mich unser Hauptfeldwebel, zu einem Bauern in den Spreewald, mit dem Auftrag, Futter zu
besorgen. Mit noch zwei Mann fuhren mit zwei Kähnen, zuerst den Hauptstrom entlang und dann in einen Nebenarm; da haben
wir die Boote beladen und brachten das Heu nach Lübbenau.
Als wir uns bei unser Einheit zurück melden wollten, war alles schon marschbereit. Ich bin schnell in einen Bus
eingestiegen der sofort losfuhr, weil russische Verbände schon in sichtweite waren. Russische Flugzeuge kreisten über
den Dächern und nahmen, mit ihren Bordwaffen jeden unter Beschuss, der sich irgendwo blicken ließ. Wir konnten nur
durch den Wald, oder in der Nacht vorwärts kommen, denn wenn ein Auto auf der Landstraße fuhr, war alsbald ein Flugzeug
hinter ihm her und schoss es in Brand. Als wir nach Tagen am Ufer der Elbe ankamen, war bereits eine Ponton-Brücke
erstellt worden, welche die zerstörte Brücke ersetzen sollte.
Durch die vielen Fahrzeuge waren in den Sand tiefe Spuren gefahren, so dass andere Fahrzeuge unsere Busse ins
Schlepptau nehmen mussten, weil wir mit eigener Kraft nicht mehr weiterkamen. Beiderseits der Trasse standen
Flüchtlingswagen, in der der Hoffnung die Brücke passieren zu können, doch SS-Polizei verhinderte das die Gespanne den
militärischen Rückzug zum Stillstand brachten. Es gelang uns die Elbe zu überqueren, um in einem Waldstück Schutz vor
feindlichen Fliegern zu suchen.
Als wir unsere Busse und Autos gut getarnt hatten, hat unser Bataillonschef die anwesenden Parteigrößen zu sich
gerufen und ihnen erklärt das wir eine Einheit des Roten Kreuzes sind und nach internationalem Recht keine Waffen
besitzen dürfen. Nach langer, erregter Diskussion wurde beschlossen einen Graben auszuheben und alles im Sand zu
verscharren. Als wir dann weiter, durch die Dörfer fuhren, sahen wir schon viele weiße Bettlaken, als Zeichen der
Kapitulation, aus den Fenstern hängen. Es wurde uns erzählt dass der Bürgermeister von der SS erschossen wurde, weil
er die Bevölkerung zu diesem Schritt ermutigt hatte. Jetzt waren hinter uns die Russen und vor uns schon die Amerikaner.
Amerikanische Panzer fuhren umher und schossen wild durch die Gegend, ohne ein Ziel anzuvisieren. Niemand wollte sich
dem Russen ergeben, doch der Weg der zu den Amerikanern führte, war durch abgesägte Bäume blockiert. Wir sind schnell
in das nächste Dorf gegangen, haben uns Sägen und Äxte besorgt, die Bäume durchgesägt und in den Straßengraben
geworfen.
“ Nach dem Ende des 2. Weltkrieges.”
In amerikanische Kriegsgefangenschaft
Dann fuhren wir unter internationaler Flagge an eine Mulde Brücke, vor der zwei amerikanische Soldaten, mit Zigarren,
zur Hälfte im Mund, standen. Sie rauchten und kauten gleichzeitig. Wir mussten auf einen freien Platz fahren, alle
aussteigen und rechts wieder antreten. Wäschebeutel und Tornister mussten wir abstellen; danach wurden wir nach Waffen
durchsucht, Wertsachen, Uhren und Messer wurden uns gleich abgenommen. Als wir anschließend an unserem Gepäck
vorbeigingen durfte niemand was mitnehmen. Als ich gebückt, nach meinem Wäschebeutel greifen wollte, in dem sich noch
3 Konservendosen und ein Brot befanden, bekam ich einen Fußtritt ins Gesicht, so dass mir ein Zahn ausgeschlagen wurde.
Wir wurden dann in einem Garten zusammen getrieben und gefragt ob jemand bei der SS gedient hat. Nachdem wir in Reihe
und Glied angetreten waren, mussten wir den Oberkörper freimachen und die Arme anheben. Es wurde nach SS-Zeichen
gesucht, die gewöhnlich unter dem Oberarm eintätowiert waren. Nachdem wir Grimma bei Leipzig, wo wir in amerikanische
Gefangenschaft geraten waren, verlassen hatten, mussten wir durch ganz Thüringen bis Hersfeld, an der Grenze zu Hessen,
marschieren. In Hersfeld wurden wir auf große Lastautos verladen, die von farbigen Soldaten gefahren wurden. Man hat
uns mit Stöcken hinauf getrieben, solange bis das Auto so voll war das man kaum stehen konnte. Die Soldaten fuhren, für
diese Straßenverhältnisse, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Wenn die Straße eine scharfe Kurve hatte, flogen
wir alle übereinander und mussten erst mit viel Kraftanstrengung auf die Beine kommen um diese Fahrt zu überstehen.
Da die Straßenränder in dieser Gegend mit Obstbäumen bepflanzt sind und deren Äste sehr niedrig hängen, hätten die
uns die Köpfe abgerissen, wenn wir uns nicht ständig geduckt hätten. Unsere Fahrt endete in Bad Kreuznach, in der Pfalz,
wo wir in ein Lager, in dem sich später 130.000 Mann und 6 Generäle befanden, eingepfercht wurden. Die Unterkunft der
Generäle befand sich unter einem Zelt, alle anderen mussten die Zeit unter freiem Himmel zubringen. Die Offiziere, die
Unteroffiziere, die Mannschaften; wurden in getrennten Camps untergebracht. Die Mannschaften wurden auch zur Arbeit
abkommandiert und konnten bei dieser Gelegenheit, Brot, Brötchen oder Zigarettenstummel organisieren, wogegen die
Offiziere und Unteroffiziere ihr Camp überhaupt nicht verlassen durften.
Die ersten Tage gab es kein Wasser und kein Brot, so dass die Kameraden vor Erschöpfung umfielen. Später standen wir
manchmal den ganzen Tag nach Wasser an, das von den, uns bewachenden Negern mit großen Wassertanks angefahren wurde. Am
dritten Tag bekamen wir mittags und abends etwas zu Essen; Brot bekamen wir erst nach zwei Wochen, nach dem aus der
Umgebung herbeigeholte Handwerker, Backöfen gebaut hatten. In den verschiedenen Gemeinden, die in den uns umgebenden
Weinbergen lagen, mussten sich alle Männer beim Bürgermeister melden. Als sie dann erschienen waren, wurden sie auf
bereitstehende Lastautos getrieben und zu uns ins Lager gebracht. Sie waren ohne Kopfbedeckung und ohne wärmere
Bekleidung angekommen, weil ihnen gesagt wurde, dass ihr Aufenthalt im Lager nur von kurzer Dauer sein würde. Man hat
uns, falls noch vorhanden, Decken und Mäntel abgenommen, mit der Begründung, sie würden für Kranke und Verwundete
gebraucht. Jeden Tag starben mehr als 200 Mann, die wir sofort in ein Zelt tragen mussten. In der Nacht wurden die
Toten dann mit unbekanntem Ziel, weggefahren.
Viele haben ihren Verstand verloren uns irrten im ganzen Camp ziellos umher. Als Latrinen wurden Gräben ausgehoben, in
die verschiedene Kameraden, bei der Verrichtung ihrer Notdurft, vor Schwäche hineingefallen sind und nicht mehr wieder
heraus kamen. Aus den Pfählen die, die jungen Obstbäume stützten, haben wir Krankentragen gebaut um unsere Kameraden,
bei Bedarf, zur Krankensammelstelle zu tragen. Es war in diesem Frühjahr auch sehr kalt, doch unsere Erdlöcher, die wir
zum Schutz vor Kälte und Wind, nur mit leeren Konservendosen ausgehoben hatten, durften nicht tiefer als 20 Zentimeter
sein. Nach jedem Regenguss mussten wir das Wasser ausschöpfen. Nach einem Gewitter, standen wir wiedermal, total
durchnässt in unserem Camp, als unerwartet am Horizont die Sonne hervortrat. Einer unserer Kameraden hatte noch eine
Trompete gerettet und fing, von dem Anblick völlig überwältigt, zu spielen an: "Es geht alles vorüber, es geht alles
vorbei, nach jedem Dezember, folgt wieder ein Mai". Daraufhin hob sich die Stimmung der tiefbetrübten Kriegsgefangenen,
so das Heimatlieder durch das ganze Camp erklangen, obwohl wir in den nassen Kleider herumgehen mussten, bis sie am
Körper trocken wurden.
Die Rohmaner Bauern hatten, außer in der Landwirtschaft, noch andere Verdienstmöglichkeiten in der Kreisstadt. In
Ortelsburg wurden vier Sägewerke betrieben, die mit Langholz aus dem Walde versorgt werden mussten. Wir haben eine
Kiefer von über 8 Festmeter angefahren, der wir zuerst 6 Meter Spitze abschneiden mussten, um diese Last überhaupt
auf den Wagen zu bekommen. Sechs Pferde musste angespannt werden um den Wagen zur befestigten Straße zu bringen.
Fichten und Tannen wuchsen bis zu einer Länge von 30 Metern. Auch beim Transport von Ziegel, von der Ziegelei zum
Bahnhof, konnte man gutes Geld verdienen.
Im Jahr 1934 wurde Rohmanen an das überregionale Stromnetz angeschlossen und schaffte auf diese Weise den Sprung von
der Petroleumlampe zur Glühbirne. Neben dem Grundstück von Karl Pietzonka wurde ein Transformatorhäuschen errichtet,
in dem der ankommende Strom von einer Hochspannung auf eine Verbrauchsspannung transformiert wurde. Es gab schon eine
Überlandleitung, die aus Richtung Ortelsburg kommend, quer über die Felder, in Richtung Neu Keykuth weiter ging.
Durch eine Zwischenspanne wurde der Transformator, mit der Hauptleitung auf Kownatzkis Feld verbunden.
Ein Stromanschluss konnte die Arbeit im Haus und Hof auf vielfältige Weise erleichtern, doch nur die besser gestellten
Bauern, sowie noch manche Pensionäre, die ein festes Einkommen hatten, konnten sich dass leisten. Weil nur wenige an
der Elektrifizierung teilnahmen, war ein Stromanschluss mit hohen Kosten verbunden. Nur Gustav Pietzonka, Gasthof
Trzaska, Friedrich Nickel, die Schule und Wilhelm Both, wurden in der ersten Phase erfasst.
Im Jahr 1952 wurde von den polnischen Behörden die zweite Stufe der Elektrifizierung eingeleitet, in der alle im Dorf
stehen Gebäude erfasst wurden. Am Anfang wurden nur Leitungen für Lichtstrom gelegt und auch nur 3 Lichtstellen pro
Haushalt bewilligt. Doch im nachfolgenden Zeitraum wurden dann, wenn Material vorhanden war, weitere Lichtpunkte
angelegt. 1952, am zweiten Wochenende im Advent, wurden dann die Leitungen geschaltet und alle waren von der
plötzlichen Helligkeit sehr begeistert. Wenn man Glühbirnen auswechseln wollte musste man am Anfang weite Wege
zurücklegen, um welche zu bekommen. In den 60ger Jahren wurden dann immer mehr Starkstromleitungen gelegt, weil die
Bauern elektrische Geräte kaufen konnten. Ende der 60ger wurden auch die Abbauten an das Stromnetz angeschlossen.
Ein Stromanschluss konnte die Arbeit im Haus und Hof auf vielfältige Weise erleichtern, doch nur die besser gestellten
Bauern, sowie noch manche Pensionäre, die ein festes Einkommen hatten, konnten sich dass leisten. Weil nur wenige an
der Elektrifizierung teilnahmen, war ein Stromanschluss mit hohen Kosten verbunden. Nur Gustav Pietzonka, Gasthof
Trzaska, Friedrich Nickel, die Schule und Wilhelm Both, wurden in der ersten Phase erfasst.
Im Jahr 1952 wurde von den polnischen Behörden die zweite Stufe der Elektrifizierung eingeleitet, in der alle im Dorf
stehen Gebäude erfasst wurden. Am Anfang wurden nur Leitungen für Lichtstrom gelegt und auch nur 3 Lichtstellen pro
Haushalt bewilligt. Doch im nachfolgenden Zeitraum wurden dann, wenn Material vorhanden war, weitere Lichtpunkte
angelegt. 1952, am zweiten Wochenende im Advent, wurden dann die Leitungen geschaltet und alle waren von der
plötzlichen Helligkeit sehr begeistert. Wenn man Glühbirnen auswechseln wollte musste man am Anfang weite Wege
zurücklegen, um welche zu bekommen. In den 60ger Jahren wurden dann immer mehr Starkstromleitungen gelegt, weil die
Bauern elektrische Geräte kaufen konnten. Ende der 60ger wurden auch die Abbauten an das Stromnetz angeschlossen.
Auf unserem Feld, in Richtung Seelonken, bin ich oft beim pflügen gegen Steine gestoßen, manchmal
rissen sogar die Stränge am Pferdegeschirr. Eines Tages nahm ich einen Spaten, Brechstange und einen langen Baum, um
der Sache auf den Grund zu gehen. Als ich eine Menge Sand ausgehoben hatte stieß ich auf eine steile, aus Steinen
errichtete Wand, die ich auch mit dem Baum nicht aus der Fassung bringen konnte. Ich habe den ganzen Vormittag gegraben,
konnte jedoch nicht unter die Steine kommen. Einige Tage später hatten wir in der Schule eine Bauernversammlung, da
habe ich Herrn Biella und Herrn Lehrer Dorka von meinem Fund berichtet. Am nächsten Morgen kam der Lehrer Dorka mit der
ganzen Schulklasse, mit Spaten und Sieben ausgerüstet auf unser Feld und fingen an die ausgehobene Erde zu sieben.
Lehrer Dorka benachrichtigte daraufhin den Leiter des Ortelsburger Heimatmuseums, der am nächsten Morgen vorbei kam um
sich die Fundstelle genau anzusehen. Er beauftragte ihn 4 Mann zu besorgen, um die Steine ringsum frei zu schaufeln.
Zwischen den Steinen durften wir die Erde nur mit Esslöffeln ausheben. Als es plötzlich zu regnen anfing hat Lehrer
Dorka die Brauerei Daum, in Ortelsburg angerufen, die uns über der Fundstelle ein Zelt errichtet haben, damit wir
ungestört weiterarbeiten konnten. Wir fanden 8 flache und 8 hohe Urnen zu beiden Seiten am Körper. Die Urnen wurden in
Gipsbinden eingewickelt und ins Heimatmuseum nach Ortelsburg gebracht, wo sie durch einen Fachmann, der extra aus einem
Königsberger Museum angereist war. Nach Reinigung der Urnen hat er festgestellt, das die Grabstätte etwa 2000 Jahre vor
Christi Geburt angelegt wurde und ein Doppelgrab war, in dem ein Toter liegend und einer in Hochstellung beigesetzt
wurde.
Die Nachricht von der Fundstelle verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Es erschienen viele Schaulustige, ganze
Schulklassen aus der Umgebung, mit Autos und zu Fuß. Durch die vielen Menschen wurden die bestellten Ackerflächen auf
unserem Feld sehr in Mitleidenschaft gezogen, eine Entschädigung haben wir nicht erhalten. Das Grab wurde vor dem
Heimatmuseum in Ortelsburg wieder so aufgebaut wie man es auf unserem Feld vorgefunden hat. Für den Transport der
Steine wurde ich entlohnt. Die Urnen hat das Königsberger Museum an sich genommen und wollte sie nicht wieder hergeben,
weil die solch einen Fund noch nicht in ihrer Sammlung hatten.
Sonnenwendfeuer
Am 24 Juni fand eine Sonnenwendfeier statt. Ein Brauch der an die alten Germanen erinnern sollte.
Der Lehrer Dorka hat den Bürgermeister beauftragt 2 Fuhrwerke in den Wald zu schicken, die Holz und alten Reisig holen
und auf dem großen Schulberg abladen sollten. Das Straßenbauamt hat uns Teertonnen zur Verfügung gestellt. Die ganze
Dorfgemeinschaft wurde eingeladen, am Abend, nach der Feldarbeit, an der Sonnenwendfeier teilzunehmen. Lehrer Dorka
hielt zuerst eine Ansprache, in der er anschaulich erklärte wie unsere Vorfahren in grauer Vorzeit gefeiert haben.
Nach dem offiziellen Teil wurden das Holz und die Teertonnen angezündet, es wurden Heimatlieder gesungen, wie: Wild
flutet der See, drauf schaukelt der Schiffer den schwankenden Kahn, Schaum wälzt er wie Schnee, von grausiger Mitte
zum Ufer heran, wild fluten die Wellen auf Vaterlands See, wie schön, oh trag mich auf Spiegel zu Hügel, Masovias See.
Masovia Land, mein Heimatland, Masovia es lebe mein Vaterland.
Lehrer Alfred Dorka und sein Wirken für Rohmanen.

Friedrich Biella hatte auf seinem Feld einen Granitstein mit einer geraden Seite, den haben wir
mit viel Schweiß an den Dorfteich transportiert und auf einer Erhöhung abgelegt. Der Stein sollte zum Denkmahl für die
Gefallenen des Ersten Weltkrieges umgestaltet werden. Da zu Wenige daran ein Interesse zeigten, wurde diese Idee fallen
gelassen und der Stein irgendwann ins Wasser gerollt. Der Lehrer Dorka war viele Jahre in Rohmanen tätig, dort hat er
später seine ehemalige Schülerin, Lotte Biella geheiratet. Er hat sich sehr für die Entwicklung des Dorfes interessiert,
war bei jeder Gemeindeversammlung anwesend und hat auf Schwachstellen hingewiesen die den Fortschritt behinderten.
Gemeinsam mit den Schülern hat er den Ehrenfriedhof für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges gepflegt, an der
Wegegablung nach Eichtal und zu Ehren des Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg eine Eiche gepflanzt.
Zum Advent hat Lehrer Dorka mit der Jugend einen Adventstern, in verschiedenen Farben gebastelt.
Der Stern wurde auf einer 2 Meter langen Stange befestigt, in der Mitte wurde ein Wachslicht angezündet, am Stern
wurde eine Schnur angebracht, wenn man daran zog rollte der Stern hin und her. Am ersten Wochenende im Advent
versammelten sich jung und alt, um den Stern durch das Dorf zu tragen. Alle schlossen sich dem vorausgehenden
Sternträger an, der den Stern durch die Hauptstraße und die angrenzenden Wege trug. Dieser Sternmarsch wurde an den
folgenden Adventwochenenden wiederholt.
Am ersten Weihnachtfeiertag wurde um 4:00 Uhr morgens ein Frühgottesdienst gehalten. Zuerst hat der Pfarrer eine
Andacht gehalten, dann haben die Kinder ein Krippenspiel aufgeführt und die Gemeinde hat schöne Weihnachtslieder
gesungen. Der Gastwirt Trzaska hat uns den Saal zur Verfügung gestellt. Wir hatten eine Posaunen- u. eine
Gitarrengruppe. Unter der Leitung von Herrn Willi Doormann spielten: Gottlieb Brosch, Fritz Ollech,
Gustav Rattay(Sopran), Wilhelm Pilath, Gustav Brosch(Alt), Fritz Both(Tenor) und Fritz Brosch(Bass).
In der Gitarrengruppe wirkten mit: Martha Ollech, Hedwig Ollech, Martha Lekzik, Martha Michalick und Auguste Lekzick.
Willy Doormann hat sie auf der Geige begleitet.
Kurz vor Ausbruch des 2. Weltkrieges
Bei der Aufstellung des Grenzschutzes(Regiment Buchholz), hat er als Hauptfeldwebel die
Gruppenführerkurse überwacht und selbst die fähigsten Männer dafür vorgeschlagen. Das Ausbildungspersonal hat das
Jäger-Battalion gestellt. Wir kamen zuerst ins Stadion(Waldheim), wurden da eingekleidet und dann ging es gleich
kasernenmäßig zu, theoretisch und praktisch. Jeder musste vor die Front treten und nachweisen ob er im Stande ist,
Befehle zu erteilen. Abends wurden Filme vorgeführt die uns zeigen sollten wie eine Gruppe sich im Gelände entfalten
muss. Die Exerziervorschriften hatten sich, im Verhältnis zu Kaiser Wilhelms Zeiten, etwas geändert. Damals bestand
eine Gruppe aus 8 Mann und einem Unteroffizier, jetzt aus 10 Schützen, 3 für das leichte Maschinengewehr und einem
Unteroffizier(13 Mann). Nach der Schulung folgte eine Abschlussprüfung, danach ein gemütliches Beisammensein. Aus
Rohmanen haben folgende Männer die Prüfung bestanden: Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy, Gustav Rattay und
Gustav Deptolla. Unsere Uniformen waren alle zu klein und es gab viel zu lachen bei der Anprobe.
Die erste Übung habe ich mit Emil Rosowski, in Lenzinen gemacht. Der Gutsbesitzer Marzinzick hat seine Scheune als
Unterkunft zur Verfügung gestellt. Er war im Range eines Hauptfeldwebels. In seinem haus war die Schreibstube
untergebracht, die er selbst verwaltete. Ein Lastauto hatte Uniformen aus der Kaserne in Ortelsburg geholt, jeder
musste eine Uniform anlegen und dann wurde solange getauscht bis alle eine passende gefunden hatten. An den Namen des
Kompanieführers kann ich mich nicht mehr erinnern. 1935 wurden wir zu einer Übung in die Dragonerkaserne nach Lyk
einberufen. Die Gruppenführer, Zugführer, und Kompanieführer die schon Frontberührung im dem Ersten Weltkrieg hatten,
mussten eine Woche früher anreisen. Die Übungen waren auf 6 Wochen angelegt. Die meisten der einberufenen waren noch
nie mit dem Wehrdienst in Berührung gekommen. Jeder Gruppenführer bekam 13 Mann zugeteilt.
Unser Zugführer war Leutnant Neumann, Kompanieführer Oberleutnant Rutschko, Battalions-Kommandeur Major Gröning
(Regiment Buchholz). Hier ging es wieder Kasernenmäßig voran. Das Bataillon wurde hier vereidigt. Jeden zweiten
Sonntag durften unsere Frauen uns besuchen. Ein Jahr später wurden wir wieder zu einer Übung einberufen, auf den
Truppenübungsplatz nach Arys. Jeder Gruppenführer hatte den Auftrag die Gruppe zu entfalten, und auf bewegliche
Figuren zu schießen. Diese Übung musste später mit scharfer Munition wiederholt werden. Jedes Maschinengewehr bekam
50 Schuss, jeder Schütze 20 Schuss zugeteilt. Nach dem Abschießen wurden die Treffer gezählt und dem Kommandierenden
Bericht erstattet. In einiger Entfernung spaziert ein Storch umher, der gar nicht bemerkt hatte dass geschossen wurde,
was bei den Kameraden ein großes Gelächter hervorrief.
Nach der Übung wurde uns gesagt das jeder Gruppenführer eine arische Abstammung nachweisen sollte. Ich konnte in den
Rheinsweiner Kirchenbüchern meine Vorfahren aus Gellen, bis zum Jahr 1732 zurück, nachweisen und wurde zum
Unteroffizier befördert. Aus unserem Dorf wurden auch, Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy und Gustav Deptolla
befördert. Zwischendurch mussten wir schon mal in die Radfahrer-Kaserne nach Ortelsburg, Gewehre empfangen und im
Gelände üben. Am 31 Juli 1939 wurde mir von einem Soldaten ein Schreiben übereicht, das mich aufforderte, am 1. August
um 6:00 Uhr, bei der 3. Kompanie, des 2. Infanterieregiments zu erscheinen.
Um 5:30 hat mich meine Schwester in die Kaserne gebracht. Auf der Schreibstube erklärte mir der Hauptfeldwebel,
dass mir ab sofort der Dienstgrad eines Sanitäters zugewiesen wird, ich mich in der Kammer einzukleiden hätte und mir
in der Handwerkerstube die entsprechenden Schulterklappen annähen lassen sollte. Die aktiven Sanitäter wurden den
Feldlazaretten zugewiesen und wir kamen an ihre Stelle. Unser Bataillon wurde nach Schodmak zum Bunker bauen und
Stacheldraht verlegen eingeteilt. Wir zogen in Begleitung einer Musikkapelle bis zur Kreuzung am Krankenhaus, dann
weiter zu unserem Bestimmungsort, gefolgt von einer Gulaschkanone die in den nächsten Tagen für unsere Verpflegung
sorgen sollte.
Am 14 August haben wir die Jägerkaserne, begleitet von einer Musikkapelle endgültig verlassen und zogen zuerst durch
Ortelsburg, dann über Lehmanen ins Feldmanöver, hinter Rohmanen. Dort entfaltete sich das Bataillon im Gelände, die
Verwundetensammelstelle wurde auf dem Hof des Bauern Friedrich Neumann eingerichtet. Gegen Abend wurde zu Sammeln
geblasen und Biwak bezogen, wobei unsere 3.Kompanie, in einem kleinen Wallt, in der Nähe von Otto Nickels Gehöft
Stellung bezogen hatte. Die 2. und 4. Kompanie hatte sich in der Nähe vom Abbau Pallasch niedergelassen. Die Frau
Nickel hat am Abend ein Mädel in Dorf geschickt um meiner Frau Bescheid zu sagen, wo wir uns zurzeit befinden. Meine
Frau ist dann noch gekommen um sich von mir zu verabschieden, weil wir am nächsten Morgen um 3:00 Uhr Zelte abbrechen
und um 4:00 Uhr in Richtung Kaspersguth marschieren sollten.
Wir sind dann über Achodden, Seelonken, Lehmanen, Ortelsburg, bis nach Grammen und Schützendorf marschiert, wo wir an
einem See Biwak bezogen haben. Es wurde immer gesagt, wir kommen zum Tannenberg-Denkmal bei Hohenstein, wo ein Reichs
Kriegervereinsfest stattfinden sollte. Es wurden auch schon Vorkommandos aufgestellt, doch dann kamen wir nach Orlau
und Lahna-Mühle, da wo die Alle entspringt haben wir 2 Tage biwakiert. Unser Kompanieführer hat uns nach Waplitz auf
den Soldatenfriedhof des Ersten Weltkrieges geführt und uns erklärt wie das Jägerbataillon sich 1914 hier entfaltet
hat und aufgerieben wurde. Dann mussten wir in der Nähe von Gut Koslau über einen Fluss und bezogen in einem Waldstück,
vorbereitete Stellungen in der Nähe der polnischen Grenze. Herr und Frau Thalmann haben uns jeden Tag, bis zur Grenze,
mit Brötchen und Getränken versorgt. Es wurde scharfe Munition ausgegeben, weil wir am nächsten Morgen um 4:00 Uhr die
polnische Grenze überschreiten sollten.
Am nächsten Morgen um 10 Minuten vor 4:00 Uhr kam der Befehl; scharfe Munition abgeben, alles zurück in ein 6 Kilometer
entferntes Dorf, wo wir auch einquartiert wurden. Das alles geschah’ eine Woche vor dem 1. September 1939. Es wurde
gesagt dass der Führer dem polnischen Präsidenten Rid-Szmigly, ein Ultimatum gestellt hat und es wahrscheinlich nicht
zum Krieg mit Polen kommt. Genau nach 5 Tagen kehrten wir wieder in die gleichen Stellungen zurück, es wurde wieder
scharfe Munition ausgegeben und am nächsten Morgen um 4:00 Uhr überschritten wir die polnische Grenze.
“Der 2. Weltkrieg.”
Der erste Einsatz in Polen
Wir kamen zuerst in ein Dorf in dem sich nur alte Menschen befanden. Auf unsere Frage wo denn die Bewohner wären sagte
man uns dass alle geflohen sind, weil erzählt wurde, die Deutschen würden alle Polen misshandeln und verstümmeln. Ich
habe ihnen daraufhin gesagt dass uns, unter Androhung von Strafe verboten wurde, einem Zivilisten etwas anzutun. Das
Vieh, die Schweine und Hunde des Dorfes liefen frei herum und die Soldaten fingen an auf die Hunde zu schießen, bis
gesagt wurde es seien Meldehunde im Dienste der Deutschen Wehrmacht und dieser Unfug der eigenen Truppe schaden würde,
weil etwaige Querschläger eigene Kameraden verletzen könnten. Wir gingen weiter auf polnischer Seite entlang der Grenze,
bis wir am Nachmittag die ersten Vorposten der Festung Mlawa erreichten, da befanden wir uns plötzlich im Feuerhagel
polnischer Festungsflack.
Am nächsten Morgen hatte ich schon 3 Verwundete und wusste nicht wo sich eine Verwundeten Sammelstelle befindet. Ich
suchte den Bataillonsgefechtstand auf der sich auf einer Anhöhe befand. Ich habe unseren Oberstabsarzt gefragt wo denn
die Verwundetensammelstelle wäre. Er rief beim Tross an, wo er die Auskunft erhielt, das sich vor dem Dorf ein Bunker
befindet in dem man die Verwundeten sammeln sollte, die dann von Sanitätsautos abgeholt würden, weil das Dorf unter
Artilleriebeschuss stand. Am Sonnabend haben unsere Flieger die Bunkerstellungen bombardiert, konnten aber, trotz guter
Treffer nicht viel ausrichten, die Bunker wurden nur etwas angekratzt.
Der Beschuss unserer vordersten Linien ging mit unverminderter Heftigkeit weiter. Am Sonntag verkündete eine große
Staubwolke die Ankunft unserer Panzer, doch sie kamen nur bis zur Panzersperre und mussten wieder abdrehen ohne den
Polen einen schaden zuzufügen. Ein Panzer bekam einen Volltreffer, der Fahrer konnte noch umkehren. Er blutete am Kopf
und der Schütze war so eingeklemmt, das wir ihn nur mit einem Seil unter den Armen, durch die Luke nach oben ziehen
konnten. Ob er seine Verwundung überlebt hat ist mir nicht bekannt, denn in der Nacht wurden Panzergeschütze nach
vorne in Stellung gebracht, die direkt in die Schießscharten der Bunker geschossen und so die Verteidiger vertrieben
haben. Daraufhin sind wir weiter vorgerückt. Auf einer Wiese war ein tiefer Graben ausgehoben und mit Ästen getarnt,
da war ein Panzer hinein gefahren, so dass nur das Hinterteil herausragte und er sich nicht aus eigner Kraft befreien
konnte. In der Luft waren Flieger die Brandbomben abwarfen, ich habe mich auf den Boden geworfen weil ich dachte die
würden explodieren, aber sie zischten nur, so das Stoppeln und Graß rings herum in Brand gerieten.
Bei den Kampfhandlungen gab es mehrere Verwundete, denen ich gerade Verbände anlegen wollte, als unser Hauptmann zur
Trillerpfeife griff um mir klar zu machen, dass ich ihm folgen sollte. Die Polen fingen an zu schreien, ich sollte
sie ins Lazarett bringen denn hier im Wald würde sie niemand finden. Ich setzte mich aufs Fahrrad und folgte unserem
Kompanieführer, der mir sagte ich soll immer bei der kämpfenden Truppe bleiben, denn hinter der Front sind die
Sanitätsabteilungen, die werden die Verwundeten schon versorgen. Der Vormarsch dauerte bis in die späte Nacht. Auf
einem Gehöft, das nach allen Seiten durch Feldwachen abgesichert wurde, machten wir endlich Rast. Wir haben
Getreidegarben auf dem Hof ausgebreitet und uns zur Ruhe gelegt, als plötzlich um Mitternacht Leuchtraketen den Himmel
erhellten und Maschinengewehrfeuer uns aus dem Schlaf schreckte. Ein par polnische Soldaten hatten das Feuer eröffnet,
aber sich kurz darauf ergeben.
Die Narew-Überquerung
Als es hell wurde ging der Vormarsch weiter. Es wurde uns untersagt Tagebuch zu führen, darum
weiß ich nicht wie die Orte hießen, durch die wir marschiert sind. Als wir durch ein sumpfiges Gelände vor drangen
stand auf einer Anhöhe am Horizont, die polnische Artillerie, die uns sofort unter Beschuss nahm. Unser Hauptmann war
der Meinung dass wir schon in der Nähe des Flusses Narew sein müssten, als aus den Sträuchern ein mit Schlauchboten
beladenes Lastauto auftauchte. Wir wurden aufgefordert mit je 6 Mann ein Schlauchboot zu nehmen, an einem Aggregat
der daneben stand mit Luft zu füllen und zu Wasser zu lassen. In einer Stunde war das ganze Bataillon über die Narew,
wo der Vormarsch fortgesetzt wurde. In einem Dorf überraschte uns die polnische Kavallerie und fing sofort mit
Maschinengewehren zu schießen an. Da kam der Befehl: Alles wieder zurück. Es ging noch schneller als auf der Hinfahrt.
Wir sind erst einige Kilometer am Fluss entlang gegangen und haben dann zum zweiten Mal rüber gesetzt.
Die Gehöfte im Dorf standen alle in Brand. Auf einem waren viele Bienestöcke. 2 Kameraden wollten den Stöcken Waben
entnehmen, doch die Bienen durch das Feuer aufgeschreckt, überfielen sie sofort und stachen derart zu das sie nicht
mehr wieder zu erkennen waren. Ich habe die Einstichstellen mit Salmiak betupft, mehr konnte ich nicht tun. Wir mussten
auf unserem Vormarsch durch einen Wald der in Flammen stand, so dass man kaum atmen konnte. Es ging weiter in Richtung
Minsk und Warschau, wo schon die Sowjetische Armee durchgegangen war, die Pferde und Vieh von einem Gut mitgenommen
hatten. In einem Wald stießen wir unverhofft auf ein Kloster, in dem wir einige Gefangene machten. Dann trafen wir auf
eine gute Straße die nach Grochow ging.
Als wir dort einmarschierten wurden wir aus den oberen Stockwerken beschossen, so dass wir, um uns zu schützen, nur an
den Hauswänden entlang gehen konnten. Wir haben jedes Haus nach Feinden durchsucht. Vor einem Haus stand ein Hund der
niemanden reinlassen wollte, solange bis ihn eine Kugel traf. Die polnische Artillerie feuerte von Warschau aus, um
unseren Vormarsch zu stoppen. Wir hatten uns gerade eingegraben als plötzlich deutsche Flieger am Himmel erschienen,
die unsere Stellungen mit Bomben bewarfen und dabei viel Unheil anrichteten. Wir haben sofort Fliegertücher
ausgebreitet und Leuchtraketen abgeschossen. Da ich in dem Graben, den ich kurz zuvor ausgehoben hatte, sofort in
Deckung gegangen bin ist mir zum Glück nichts passiert. Unter den anderen Kameraden gab es viele Verwundete, so dass
ich nicht wusste wem ich zuerst helfen sollte.
Der Oberstabsarzt hat mich sofort tatkräftig unterstützt, so das bald alle Verwundeten versorgt waren, außer einem,
dem ein Bombensplitter den Arm abgerissen hat. Ich habe im 3 große Verbandspäckchen auf die Wunde gelegt, doch die
Blutung ließ sich trotzdem nicht stoppen, so dass er eine Stunde später auf der Krankensammelstelle verstarb. Wir
haben danach in einem Tomatenfeld einen Graben ausgehoben und eine neue Abwehrstellung bezogen. Die Gruppe Schwarz
bekam den Auftrag nach etwaigen versprengten polnischen Verbänden Ausschau zu halten, als sie unerwartet aus einer
Häuserreihe mit Maschinengewehrsalven überschüttet wurden. Der Gruppenführer und noch ein Soldat wurden dabei tödlich
verwundet. Danach wurde noch ein weiter Stoßtrupp, unter der Führung von Leutnant Briskorn, der sich dazu freiwillig
gemeldet hatte, hinaus geschickt um den Gruppenführer und den anderen Toten zu bergen.
Bei diesem Unternehmen, das erfolglos ausging, weil die Toten schon verscharrt waren, durchschlug eine Kugel den
Stahlhelm von Leutnant Briskorn, der auch sofort tot war. Alle Toten wurden später, an der Kirchenmauer in Grochow, in
Särgen beigesetzt: Hauptmann Schönwald sagte, das sie nach dem Kriege auf den Heldenfriedhof nach Ortelsburg überführt
werden. Drei Tage lagen wir bei Grochow in Stellungen, waren dem polnischen Maschinengewehrfeuer sowie den Bomben
deutscher Flugzeuge ausgesetzt. In der Nacht musste ich zu einem Verwundeten in die vorderste Linie und habe den
Rückweg nicht mehr finden können, als plötzlich Gewehrfeuer aufflammte habe ich in den Ruinen Schutz gesucht. Erst im
Morgengrauen konnte ich mich wieder orientieren und zu meinem Unterstand zurückfinden.
Warschau wurde tagelang bombardiert und stand auch unter Artilleriebeschuss. Aus dunklen Rauchwolken kamen oft ganze
Bündel von Papier angeflogen. Die Verwundeten kamen oft auf Krücken zu unserem Unterstand, ich habe sie dann zur
Krankensammelstelle hingeführt. Wir haben auch polnische Zivilpersonen betreut, die während der Kampfhandlungen
verwundet wurden. Als einmal 2 Jungen vorbeiliefen hat einer ihnen nachgerufen sie sollten seiner Frau Bescheid sagen,
er wäre auf der Krankensammelstelle an der Kirche. Als wir dort ankamen war seine Frau, mit einem Kind auf dem Arm,
schon da.
Nach der Kapitulation von Warschau, gingen wir über Sokolow zum Bug und haben dort Quartier bezogen. Der Russe hatte
sich bereits hinter den Fluss zurückgezogen, hatte alles Vieh und Pferde mitgenommen. Dort erreichte mich ein Telegramm
von zu Hause, dass meine Tochter gestorben ist. Es sprach sich auch herum dass verschiedene Heimaturlaub bekommen haben,
ich durfte auch für 14 Tage heim. Wir fuhren mit Lastautos nach Allenstein in die neue Reiterkaserne, zum
Ersatzbatallion, da haben wir unsere Gewehre und Munition abgeben, dann durften wir, jeder in seinen Heimatort
weiterfahren.
Als wir unsere Quartiere am Bug verlassen haben war sehr viel Schnee gefallen. Hier in Ortelsburg fanden wir die
gleiche Wetterlage vor, aber nach 3 Tagen war alles wieder weggetaut und wir konnten die Kartoffelernte, die durch den
frühen Wintereinbruch gestoppt wurde, zu Ende bringen. Ein Tag bevor ich zu Hause angekommen bin wurde die Tochter
beerdigt. Nach 14 Tagen mussten wir uns in Allenstein melden, Gewehre empfangen und wieder zurück zur Division an den
Bug 150 Kilometer hinter Warschau. Die elfte Division, zu der wir auch gehörten sollte in den Westen Deutschlands
verlegt werden und war schon unterwegs zur Verladestation Skiernewice 50 Kilometer vor Warschau.
Mein Dienst als Sanitätsunteroffizier
Unser Bataillon kam in das Städtchen Burscheid, im Kreis Opladen, wo wir in Privatquartieren
untergebracht wurden. Nach 3 Monaten, im Januar 1940, wurden wir nach Solingen verlegt, wo wir bis zum
Frankreichfeldzug stationiert waren. Wir mussten an Feldübungen teilnehmen, wie andere die in Kasernen untergebracht
waren. Während dieser Zeit musste jeder seine Zähne in Ordnung bringen lassen. Jeden Tag fuhren 20 Mann in die
Cäzilienstraße nach Köln, zur Zahnklinik. Im Rheinland wurde unsere Division neu aufgestellt. Ausfälle durch den
Polenfeldzug wurden durch neue Soldaten ergänzt. Ich kam nun zum Ersatzbatallion, war der Älteste in der ganzen
Kompanie. Als der Frankreichfeldzug losging wurde unser Ersatzbatallion mit den noch vorhandenen Verwundeten, in die
neue Reiterkaserne, nach Allenstein verlegt.
Meine Frau hat, mit Unterstützung der Bauernschaft, einen Antrag gestellt, daraufhin wurde ich zur Frühjahrsbestellung,
beurlaubt und später bis auf weiteres vom Militärdienst freigestellt. Als der Russlandfeldzug losging wurde ich von der
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg, für 14 Tage einberufen. Ich war seit 1922, Mitglied der freiwilligen
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg und habe jedes Jahr an Übungen teilgenommen. Jede Bereitschaft musste etliche Leute
stellen. Von Rohmanen wurden Emil Rosowski, Johann Dembek, und ich, zur Krankensammelstelle Wirballen, in Litauen,
abkommandiert. Dorthin kamen Lazarettzüge aus Russland mit der Breitspurbahn. Die Verwundeten wurden frisch verbunden
und auf Waggon mit Normalspur verladen und nach Deutschland gebracht.
Als die 14 Tage vergangen waren wollten wir wieder nach Haus zurück, doch man wollte uns nicht entlassen. Stattdessen
wurden wir dem Wehrkreisamt Königsberg zugeteilt, neu eingekleidet und zur Aushilfe ins Lazarett nach Gumbinnen
abkommandiert. Mehr als ein Jahr war ich in den Urlauber-Baracken, habe dort Krankenstube betreut. Später, bis zum
Dezember 1944, war ich im Reserve-Lazarett 4, in Königsberg tätig. Dort habe ich auch die Luftangriffe der Engländer,
vom 25 bis 26. August 1944 miterlebt.
Wir sollten gerade einen Lazarettzug in Rotenstein entladen, als plötzlich die Sirenen ertönten - Fliegeralarm. Im
gleichen Moment waren die ersten Flugzeuge auch schon da, zuerst warfen sie „Tannenbäume” und danach Foßforkanister ab.
Die Omnibusse standen schon zur Abfahrt bereit als es losging. Wir haben die Verwundeten schnell in den
Luftschutzkeller getragen, haben die Betten von den Fenstern weggerückt damit die Verwundeten nicht von den
Glasssplittern verletzt wurden. Im Kasernenhof brannten die Fosforkanister lichterloh. Unsere Unterkunft, die sich in
einer Baracke befand ist völlig abgebrannt, mit dem Wenigen was wir unser Eigen nannten. Am nächsten Tag wurden wir neu
eingekleidet und am 29. bis 30. kamen die englischen Bomber wieder, sie setzten genau da ihr Zerstörungswerk fort wo
sie vor 3 Tagen aufgehört hatten.
Anfang Dezember 1944 musste ich mich nach Stablack melden und musste dann zur Sanitätsabteilung 1, nach Gernau, das
liegt zwischen Lodz und Warschau. Vormittags hatten wir Felddienstübungen und nachmittags theoretischen Unterricht.
Jeden Tag wurden Gruppen zusammengestellt und zu anderen Einheiten abkommandiert. Ich kam zu einer Panzerabteilung, wo
wir an einem Morgen plötzlich auf dem Kasernenhof antreten mussten und zu unserer Überraschung mit der Nachricht
konfrontiert wurden, dass der Russe an mehreren Frontabschnitten durchgebrochen war. Wir bekamen sofort einen
Marschbefehl in Richtung Lodz, wo das Stadtbild noch intakt war, selbst die Straßenbahnen fuhren noch. In der Nacht
haben russische Flugzeuge die Stadt bombardiert. Die Kaserne in der wir untergebracht waren hatte keine
Luftschutzkeller, aber zum Glück blieben wir von Bombentreffern verschont. Am nächsten morgen bot sich uns ein Bild der
Verwüstung. Die entgleisten Straßenbahnwagen, sowie andere Fahrzeuge blockierten die Straßen. Die Älteren unter uns
bekamen Fahrscheine für einen Transportzug, der bereit hinter Lodz abfahrbereit, unter Dampf stehen sollte. Als
russische Panzer in den Straßen auftauchten, verbrannte die Schreibstube unsere Wehrpässe und andere wichtige
Dokumente. Wir liefen zu der Station auf der unser Transportzug bereitstehen sollte, aber da war kein Zug mehr zu sehen
und wir setzten unseren Rückzug zu Fuß fort.
Der Rückzug und Zusammenbruch der Ostfront
In Dobroschin, einer Stadt in Polen, wurde gerade ein Lazarettzug verladen, doch wir kamen nicht
mehr zum Einsatz, weil die russische Infanterie uns schon auf den Fersen war. Es ging weiter über den Fluss Bober,
Sagan, bis nach Glogau an der Oder. Dort wurden wir der 29. motorisierten Sanitätskompanie zugeteilt. Im
Garnisonslazarett wurden noch Operationen durchgeführt. Unsere Division hatte ihr eigenes Feldlazarett, so dass wir den
Befehl zu Weiterfahrt erhielten und noch unbeschadet die Oderbrücke passieren konnten, denn Glogau wurde zur Festung
erklärt. Wir haben 2 Pferdewagen organisiert und mit Verbänden, sowie medizinischen Instrumenten beladen. So kamen wir
bis nach Lübbenau im Spreewald, wo wir in einem Schloss, in zuvor ein Museum war, unser Lazarett untergebracht haben.
Weil die Amerikaner Cottbus bombardiert hatten, wurden die Verwundeten zu uns nach Lübbenau gebracht. Hier haben wir
Tag und Nacht gearbeitet, um die vielen Verwundeten, aus den schweren Kämpfen bei Grünberg und Sagan zu versorgen. Die
Soldaten von der Abwehrfront kamen schon mit abgestorbenen Armen oder Beinen bei uns an, weil in vorderster Linie keine
Frontlazarette mehr vorhanden waren; es mussten viele Amputationen durchgeführt werden. Als für unsere Pferde kein Heu
mehr vorhanden war, schickte mich unser Hauptfeldwebel, zu einem Bauern in den Spreewald, mit dem Auftrag, Futter zu
besorgen. Mit noch zwei Mann fuhren mit zwei Kähnen, zuerst den Hauptstrom entlang und dann in einen Nebenarm; da haben
wir die Boote beladen und brachten das Heu nach Lübbenau.
Als wir uns bei unser Einheit zurück melden wollten, war alles schon marschbereit. Ich bin schnell in einen Bus
eingestiegen der sofort losfuhr, weil russische Verbände schon in sichtweite waren. Russische Flugzeuge kreisten über
den Dächern und nahmen, mit ihren Bordwaffen jeden unter Beschuss, der sich irgendwo blicken ließ. Wir konnten nur
durch den Wald, oder in der Nacht vorwärts kommen, denn wenn ein Auto auf der Landstraße fuhr, war alsbald ein Flugzeug
hinter ihm her und schoss es in Brand. Als wir nach Tagen am Ufer der Elbe ankamen, war bereits eine Ponton-Brücke
erstellt worden, welche die zerstörte Brücke ersetzen sollte.
Durch die vielen Fahrzeuge waren in den Sand tiefe Spuren gefahren, so dass andere Fahrzeuge unsere Busse ins
Schlepptau nehmen mussten, weil wir mit eigener Kraft nicht mehr weiterkamen. Beiderseits der Trasse standen
Flüchtlingswagen, in der der Hoffnung die Brücke passieren zu können, doch SS-Polizei verhinderte das die Gespanne den
militärischen Rückzug zum Stillstand brachten. Es gelang uns die Elbe zu überqueren, um in einem Waldstück Schutz vor
feindlichen Fliegern zu suchen.
Als wir unsere Busse und Autos gut getarnt hatten, hat unser Bataillonschef die anwesenden Parteigrößen zu sich
gerufen und ihnen erklärt das wir eine Einheit des Roten Kreuzes sind und nach internationalem Recht keine Waffen
besitzen dürfen. Nach langer, erregter Diskussion wurde beschlossen einen Graben auszuheben und alles im Sand zu
verscharren. Als wir dann weiter, durch die Dörfer fuhren, sahen wir schon viele weiße Bettlaken, als Zeichen der
Kapitulation, aus den Fenstern hängen. Es wurde uns erzählt dass der Bürgermeister von der SS erschossen wurde, weil
er die Bevölkerung zu diesem Schritt ermutigt hatte. Jetzt waren hinter uns die Russen und vor uns schon die Amerikaner.
Amerikanische Panzer fuhren umher und schossen wild durch die Gegend, ohne ein Ziel anzuvisieren. Niemand wollte sich
dem Russen ergeben, doch der Weg der zu den Amerikanern führte, war durch abgesägte Bäume blockiert. Wir sind schnell
in das nächste Dorf gegangen, haben uns Sägen und Äxte besorgt, die Bäume durchgesägt und in den Straßengraben
geworfen.
“ Nach dem Ende des 2. Weltkrieges.”
In amerikanische Kriegsgefangenschaft
Dann fuhren wir unter internationaler Flagge an eine Mulde Brücke, vor der zwei amerikanische Soldaten, mit Zigarren,
zur Hälfte im Mund, standen. Sie rauchten und kauten gleichzeitig. Wir mussten auf einen freien Platz fahren, alle
aussteigen und rechts wieder antreten. Wäschebeutel und Tornister mussten wir abstellen; danach wurden wir nach Waffen
durchsucht, Wertsachen, Uhren und Messer wurden uns gleich abgenommen. Als wir anschließend an unserem Gepäck
vorbeigingen durfte niemand was mitnehmen. Als ich gebückt, nach meinem Wäschebeutel greifen wollte, in dem sich noch
3 Konservendosen und ein Brot befanden, bekam ich einen Fußtritt ins Gesicht, so dass mir ein Zahn ausgeschlagen wurde.
Wir wurden dann in einem Garten zusammen getrieben und gefragt ob jemand bei der SS gedient hat. Nachdem wir in Reihe
und Glied angetreten waren, mussten wir den Oberkörper freimachen und die Arme anheben. Es wurde nach SS-Zeichen
gesucht, die gewöhnlich unter dem Oberarm eintätowiert waren. Nachdem wir Grimma bei Leipzig, wo wir in amerikanische
Gefangenschaft geraten waren, verlassen hatten, mussten wir durch ganz Thüringen bis Hersfeld, an der Grenze zu Hessen,
marschieren. In Hersfeld wurden wir auf große Lastautos verladen, die von farbigen Soldaten gefahren wurden. Man hat
uns mit Stöcken hinauf getrieben, solange bis das Auto so voll war das man kaum stehen konnte. Die Soldaten fuhren, für
diese Straßenverhältnisse, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Wenn die Straße eine scharfe Kurve hatte, flogen
wir alle übereinander und mussten erst mit viel Kraftanstrengung auf die Beine kommen um diese Fahrt zu überstehen.
Da die Straßenränder in dieser Gegend mit Obstbäumen bepflanzt sind und deren Äste sehr niedrig hängen, hätten die
uns die Köpfe abgerissen, wenn wir uns nicht ständig geduckt hätten. Unsere Fahrt endete in Bad Kreuznach, in der Pfalz,
wo wir in ein Lager, in dem sich später 130.000 Mann und 6 Generäle befanden, eingepfercht wurden. Die Unterkunft der
Generäle befand sich unter einem Zelt, alle anderen mussten die Zeit unter freiem Himmel zubringen. Die Offiziere, die
Unteroffiziere, die Mannschaften; wurden in getrennten Camps untergebracht. Die Mannschaften wurden auch zur Arbeit
abkommandiert und konnten bei dieser Gelegenheit, Brot, Brötchen oder Zigarettenstummel organisieren, wogegen die
Offiziere und Unteroffiziere ihr Camp überhaupt nicht verlassen durften.
Die ersten Tage gab es kein Wasser und kein Brot, so dass die Kameraden vor Erschöpfung umfielen. Später standen wir
manchmal den ganzen Tag nach Wasser an, das von den, uns bewachenden Negern mit großen Wassertanks angefahren wurde. Am
dritten Tag bekamen wir mittags und abends etwas zu Essen; Brot bekamen wir erst nach zwei Wochen, nach dem aus der
Umgebung herbeigeholte Handwerker, Backöfen gebaut hatten. In den verschiedenen Gemeinden, die in den uns umgebenden
Weinbergen lagen, mussten sich alle Männer beim Bürgermeister melden. Als sie dann erschienen waren, wurden sie auf
bereitstehende Lastautos getrieben und zu uns ins Lager gebracht. Sie waren ohne Kopfbedeckung und ohne wärmere
Bekleidung angekommen, weil ihnen gesagt wurde, dass ihr Aufenthalt im Lager nur von kurzer Dauer sein würde. Man hat
uns, falls noch vorhanden, Decken und Mäntel abgenommen, mit der Begründung, sie würden für Kranke und Verwundete
gebraucht. Jeden Tag starben mehr als 200 Mann, die wir sofort in ein Zelt tragen mussten. In der Nacht wurden die
Toten dann mit unbekanntem Ziel, weggefahren.
Viele haben ihren Verstand verloren uns irrten im ganzen Camp ziellos umher. Als Latrinen wurden Gräben ausgehoben, in
die verschiedene Kameraden, bei der Verrichtung ihrer Notdurft, vor Schwäche hineingefallen sind und nicht mehr wieder
heraus kamen. Aus den Pfählen die, die jungen Obstbäume stützten, haben wir Krankentragen gebaut um unsere Kameraden,
bei Bedarf, zur Krankensammelstelle zu tragen. Es war in diesem Frühjahr auch sehr kalt, doch unsere Erdlöcher, die wir
zum Schutz vor Kälte und Wind, nur mit leeren Konservendosen ausgehoben hatten, durften nicht tiefer als 20 Zentimeter
sein. Nach jedem Regenguss mussten wir das Wasser ausschöpfen. Nach einem Gewitter, standen wir wiedermal, total
durchnässt in unserem Camp, als unerwartet am Horizont die Sonne hervortrat. Einer unserer Kameraden hatte noch eine
Trompete gerettet und fing, von dem Anblick völlig überwältigt, zu spielen an: "Es geht alles vorüber, es geht alles
vorbei, nach jedem Dezember, folgt wieder ein Mai". Daraufhin hob sich die Stimmung der tiefbetrübten Kriegsgefangenen,
so das Heimatlieder durch das ganze Camp erklangen, obwohl wir in den nassen Kleider herumgehen mussten, bis sie am
Körper trocken wurden.
Die Nachricht von der Fundstelle verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Es erschienen viele Schaulustige, ganze Schulklassen aus der Umgebung, mit Autos und zu Fuß. Durch die vielen Menschen wurden die bestellten Ackerflächen auf unserem Feld sehr in Mitleidenschaft gezogen, eine Entschädigung haben wir nicht erhalten. Das Grab wurde vor dem Heimatmuseum in Ortelsburg wieder so aufgebaut wie man es auf unserem Feld vorgefunden hat. Für den Transport der Steine wurde ich entlohnt. Die Urnen hat das Königsberger Museum an sich genommen und wollte sie nicht wieder hergeben, weil die solch einen Fund noch nicht in ihrer Sammlung hatten.
Am 24 Juni fand eine Sonnenwendfeier statt. Ein Brauch der an die alten Germanen erinnern sollte.
Der Lehrer Dorka hat den Bürgermeister beauftragt 2 Fuhrwerke in den Wald zu schicken, die Holz und alten Reisig holen
und auf dem großen Schulberg abladen sollten. Das Straßenbauamt hat uns Teertonnen zur Verfügung gestellt. Die ganze
Dorfgemeinschaft wurde eingeladen, am Abend, nach der Feldarbeit, an der Sonnenwendfeier teilzunehmen. Lehrer Dorka
hielt zuerst eine Ansprache, in der er anschaulich erklärte wie unsere Vorfahren in grauer Vorzeit gefeiert haben.
Nach dem offiziellen Teil wurden das Holz und die Teertonnen angezündet, es wurden Heimatlieder gesungen, wie: Wild
flutet der See, drauf schaukelt der Schiffer den schwankenden Kahn, Schaum wälzt er wie Schnee, von grausiger Mitte
zum Ufer heran, wild fluten die Wellen auf Vaterlands See, wie schön, oh trag mich auf Spiegel zu Hügel, Masovias See.
Masovia Land, mein Heimatland, Masovia es lebe mein Vaterland.
Lehrer Alfred Dorka und sein Wirken für Rohmanen.

Friedrich Biella hatte auf seinem Feld einen Granitstein mit einer geraden Seite, den haben wir
mit viel Schweiß an den Dorfteich transportiert und auf einer Erhöhung abgelegt. Der Stein sollte zum Denkmahl für die
Gefallenen des Ersten Weltkrieges umgestaltet werden. Da zu Wenige daran ein Interesse zeigten, wurde diese Idee fallen
gelassen und der Stein irgendwann ins Wasser gerollt. Der Lehrer Dorka war viele Jahre in Rohmanen tätig, dort hat er
später seine ehemalige Schülerin, Lotte Biella geheiratet. Er hat sich sehr für die Entwicklung des Dorfes interessiert,
war bei jeder Gemeindeversammlung anwesend und hat auf Schwachstellen hingewiesen die den Fortschritt behinderten.
Gemeinsam mit den Schülern hat er den Ehrenfriedhof für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges gepflegt, an der
Wegegablung nach Eichtal und zu Ehren des Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg eine Eiche gepflanzt.
Zum Advent hat Lehrer Dorka mit der Jugend einen Adventstern, in verschiedenen Farben gebastelt.
Der Stern wurde auf einer 2 Meter langen Stange befestigt, in der Mitte wurde ein Wachslicht angezündet, am Stern
wurde eine Schnur angebracht, wenn man daran zog rollte der Stern hin und her. Am ersten Wochenende im Advent
versammelten sich jung und alt, um den Stern durch das Dorf zu tragen. Alle schlossen sich dem vorausgehenden
Sternträger an, der den Stern durch die Hauptstraße und die angrenzenden Wege trug. Dieser Sternmarsch wurde an den
folgenden Adventwochenenden wiederholt.
Am ersten Weihnachtfeiertag wurde um 4:00 Uhr morgens ein Frühgottesdienst gehalten. Zuerst hat der Pfarrer eine
Andacht gehalten, dann haben die Kinder ein Krippenspiel aufgeführt und die Gemeinde hat schöne Weihnachtslieder
gesungen. Der Gastwirt Trzaska hat uns den Saal zur Verfügung gestellt. Wir hatten eine Posaunen- u. eine
Gitarrengruppe. Unter der Leitung von Herrn Willi Doormann spielten: Gottlieb Brosch, Fritz Ollech,
Gustav Rattay(Sopran), Wilhelm Pilath, Gustav Brosch(Alt), Fritz Both(Tenor) und Fritz Brosch(Bass).
In der Gitarrengruppe wirkten mit: Martha Ollech, Hedwig Ollech, Martha Lekzik, Martha Michalick und Auguste Lekzick.
Willy Doormann hat sie auf der Geige begleitet.
Kurz vor Ausbruch des 2. Weltkrieges
Bei der Aufstellung des Grenzschutzes(Regiment Buchholz), hat er als Hauptfeldwebel die
Gruppenführerkurse überwacht und selbst die fähigsten Männer dafür vorgeschlagen. Das Ausbildungspersonal hat das
Jäger-Battalion gestellt. Wir kamen zuerst ins Stadion(Waldheim), wurden da eingekleidet und dann ging es gleich
kasernenmäßig zu, theoretisch und praktisch. Jeder musste vor die Front treten und nachweisen ob er im Stande ist,
Befehle zu erteilen. Abends wurden Filme vorgeführt die uns zeigen sollten wie eine Gruppe sich im Gelände entfalten
muss. Die Exerziervorschriften hatten sich, im Verhältnis zu Kaiser Wilhelms Zeiten, etwas geändert. Damals bestand
eine Gruppe aus 8 Mann und einem Unteroffizier, jetzt aus 10 Schützen, 3 für das leichte Maschinengewehr und einem
Unteroffizier(13 Mann). Nach der Schulung folgte eine Abschlussprüfung, danach ein gemütliches Beisammensein. Aus
Rohmanen haben folgende Männer die Prüfung bestanden: Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy, Gustav Rattay und
Gustav Deptolla. Unsere Uniformen waren alle zu klein und es gab viel zu lachen bei der Anprobe.
Die erste Übung habe ich mit Emil Rosowski, in Lenzinen gemacht. Der Gutsbesitzer Marzinzick hat seine Scheune als
Unterkunft zur Verfügung gestellt. Er war im Range eines Hauptfeldwebels. In seinem haus war die Schreibstube
untergebracht, die er selbst verwaltete. Ein Lastauto hatte Uniformen aus der Kaserne in Ortelsburg geholt, jeder
musste eine Uniform anlegen und dann wurde solange getauscht bis alle eine passende gefunden hatten. An den Namen des
Kompanieführers kann ich mich nicht mehr erinnern. 1935 wurden wir zu einer Übung in die Dragonerkaserne nach Lyk
einberufen. Die Gruppenführer, Zugführer, und Kompanieführer die schon Frontberührung im dem Ersten Weltkrieg hatten,
mussten eine Woche früher anreisen. Die Übungen waren auf 6 Wochen angelegt. Die meisten der einberufenen waren noch
nie mit dem Wehrdienst in Berührung gekommen. Jeder Gruppenführer bekam 13 Mann zugeteilt.
Unser Zugführer war Leutnant Neumann, Kompanieführer Oberleutnant Rutschko, Battalions-Kommandeur Major Gröning
(Regiment Buchholz). Hier ging es wieder Kasernenmäßig voran. Das Bataillon wurde hier vereidigt. Jeden zweiten
Sonntag durften unsere Frauen uns besuchen. Ein Jahr später wurden wir wieder zu einer Übung einberufen, auf den
Truppenübungsplatz nach Arys. Jeder Gruppenführer hatte den Auftrag die Gruppe zu entfalten, und auf bewegliche
Figuren zu schießen. Diese Übung musste später mit scharfer Munition wiederholt werden. Jedes Maschinengewehr bekam
50 Schuss, jeder Schütze 20 Schuss zugeteilt. Nach dem Abschießen wurden die Treffer gezählt und dem Kommandierenden
Bericht erstattet. In einiger Entfernung spaziert ein Storch umher, der gar nicht bemerkt hatte dass geschossen wurde,
was bei den Kameraden ein großes Gelächter hervorrief.
Nach der Übung wurde uns gesagt das jeder Gruppenführer eine arische Abstammung nachweisen sollte. Ich konnte in den
Rheinsweiner Kirchenbüchern meine Vorfahren aus Gellen, bis zum Jahr 1732 zurück, nachweisen und wurde zum
Unteroffizier befördert. Aus unserem Dorf wurden auch, Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy und Gustav Deptolla
befördert. Zwischendurch mussten wir schon mal in die Radfahrer-Kaserne nach Ortelsburg, Gewehre empfangen und im
Gelände üben. Am 31 Juli 1939 wurde mir von einem Soldaten ein Schreiben übereicht, das mich aufforderte, am 1. August
um 6:00 Uhr, bei der 3. Kompanie, des 2. Infanterieregiments zu erscheinen.
Um 5:30 hat mich meine Schwester in die Kaserne gebracht. Auf der Schreibstube erklärte mir der Hauptfeldwebel,
dass mir ab sofort der Dienstgrad eines Sanitäters zugewiesen wird, ich mich in der Kammer einzukleiden hätte und mir
in der Handwerkerstube die entsprechenden Schulterklappen annähen lassen sollte. Die aktiven Sanitäter wurden den
Feldlazaretten zugewiesen und wir kamen an ihre Stelle. Unser Bataillon wurde nach Schodmak zum Bunker bauen und
Stacheldraht verlegen eingeteilt. Wir zogen in Begleitung einer Musikkapelle bis zur Kreuzung am Krankenhaus, dann
weiter zu unserem Bestimmungsort, gefolgt von einer Gulaschkanone die in den nächsten Tagen für unsere Verpflegung
sorgen sollte.
Am 14 August haben wir die Jägerkaserne, begleitet von einer Musikkapelle endgültig verlassen und zogen zuerst durch
Ortelsburg, dann über Lehmanen ins Feldmanöver, hinter Rohmanen. Dort entfaltete sich das Bataillon im Gelände, die
Verwundetensammelstelle wurde auf dem Hof des Bauern Friedrich Neumann eingerichtet. Gegen Abend wurde zu Sammeln
geblasen und Biwak bezogen, wobei unsere 3.Kompanie, in einem kleinen Wallt, in der Nähe von Otto Nickels Gehöft
Stellung bezogen hatte. Die 2. und 4. Kompanie hatte sich in der Nähe vom Abbau Pallasch niedergelassen. Die Frau
Nickel hat am Abend ein Mädel in Dorf geschickt um meiner Frau Bescheid zu sagen, wo wir uns zurzeit befinden. Meine
Frau ist dann noch gekommen um sich von mir zu verabschieden, weil wir am nächsten Morgen um 3:00 Uhr Zelte abbrechen
und um 4:00 Uhr in Richtung Kaspersguth marschieren sollten.
Wir sind dann über Achodden, Seelonken, Lehmanen, Ortelsburg, bis nach Grammen und Schützendorf marschiert, wo wir an
einem See Biwak bezogen haben. Es wurde immer gesagt, wir kommen zum Tannenberg-Denkmal bei Hohenstein, wo ein Reichs
Kriegervereinsfest stattfinden sollte. Es wurden auch schon Vorkommandos aufgestellt, doch dann kamen wir nach Orlau
und Lahna-Mühle, da wo die Alle entspringt haben wir 2 Tage biwakiert. Unser Kompanieführer hat uns nach Waplitz auf
den Soldatenfriedhof des Ersten Weltkrieges geführt und uns erklärt wie das Jägerbataillon sich 1914 hier entfaltet
hat und aufgerieben wurde. Dann mussten wir in der Nähe von Gut Koslau über einen Fluss und bezogen in einem Waldstück,
vorbereitete Stellungen in der Nähe der polnischen Grenze. Herr und Frau Thalmann haben uns jeden Tag, bis zur Grenze,
mit Brötchen und Getränken versorgt. Es wurde scharfe Munition ausgegeben, weil wir am nächsten Morgen um 4:00 Uhr die
polnische Grenze überschreiten sollten.
Am nächsten Morgen um 10 Minuten vor 4:00 Uhr kam der Befehl; scharfe Munition abgeben, alles zurück in ein 6 Kilometer
entferntes Dorf, wo wir auch einquartiert wurden. Das alles geschah’ eine Woche vor dem 1. September 1939. Es wurde
gesagt dass der Führer dem polnischen Präsidenten Rid-Szmigly, ein Ultimatum gestellt hat und es wahrscheinlich nicht
zum Krieg mit Polen kommt. Genau nach 5 Tagen kehrten wir wieder in die gleichen Stellungen zurück, es wurde wieder
scharfe Munition ausgegeben und am nächsten Morgen um 4:00 Uhr überschritten wir die polnische Grenze.
“Der 2. Weltkrieg.”
Der erste Einsatz in Polen
Wir kamen zuerst in ein Dorf in dem sich nur alte Menschen befanden. Auf unsere Frage wo denn die Bewohner wären sagte
man uns dass alle geflohen sind, weil erzählt wurde, die Deutschen würden alle Polen misshandeln und verstümmeln. Ich
habe ihnen daraufhin gesagt dass uns, unter Androhung von Strafe verboten wurde, einem Zivilisten etwas anzutun. Das
Vieh, die Schweine und Hunde des Dorfes liefen frei herum und die Soldaten fingen an auf die Hunde zu schießen, bis
gesagt wurde es seien Meldehunde im Dienste der Deutschen Wehrmacht und dieser Unfug der eigenen Truppe schaden würde,
weil etwaige Querschläger eigene Kameraden verletzen könnten. Wir gingen weiter auf polnischer Seite entlang der Grenze,
bis wir am Nachmittag die ersten Vorposten der Festung Mlawa erreichten, da befanden wir uns plötzlich im Feuerhagel
polnischer Festungsflack.
Am nächsten Morgen hatte ich schon 3 Verwundete und wusste nicht wo sich eine Verwundeten Sammelstelle befindet. Ich
suchte den Bataillonsgefechtstand auf der sich auf einer Anhöhe befand. Ich habe unseren Oberstabsarzt gefragt wo denn
die Verwundetensammelstelle wäre. Er rief beim Tross an, wo er die Auskunft erhielt, das sich vor dem Dorf ein Bunker
befindet in dem man die Verwundeten sammeln sollte, die dann von Sanitätsautos abgeholt würden, weil das Dorf unter
Artilleriebeschuss stand. Am Sonnabend haben unsere Flieger die Bunkerstellungen bombardiert, konnten aber, trotz guter
Treffer nicht viel ausrichten, die Bunker wurden nur etwas angekratzt.
Der Beschuss unserer vordersten Linien ging mit unverminderter Heftigkeit weiter. Am Sonntag verkündete eine große
Staubwolke die Ankunft unserer Panzer, doch sie kamen nur bis zur Panzersperre und mussten wieder abdrehen ohne den
Polen einen schaden zuzufügen. Ein Panzer bekam einen Volltreffer, der Fahrer konnte noch umkehren. Er blutete am Kopf
und der Schütze war so eingeklemmt, das wir ihn nur mit einem Seil unter den Armen, durch die Luke nach oben ziehen
konnten. Ob er seine Verwundung überlebt hat ist mir nicht bekannt, denn in der Nacht wurden Panzergeschütze nach
vorne in Stellung gebracht, die direkt in die Schießscharten der Bunker geschossen und so die Verteidiger vertrieben
haben. Daraufhin sind wir weiter vorgerückt. Auf einer Wiese war ein tiefer Graben ausgehoben und mit Ästen getarnt,
da war ein Panzer hinein gefahren, so dass nur das Hinterteil herausragte und er sich nicht aus eigner Kraft befreien
konnte. In der Luft waren Flieger die Brandbomben abwarfen, ich habe mich auf den Boden geworfen weil ich dachte die
würden explodieren, aber sie zischten nur, so das Stoppeln und Graß rings herum in Brand gerieten.
Bei den Kampfhandlungen gab es mehrere Verwundete, denen ich gerade Verbände anlegen wollte, als unser Hauptmann zur
Trillerpfeife griff um mir klar zu machen, dass ich ihm folgen sollte. Die Polen fingen an zu schreien, ich sollte
sie ins Lazarett bringen denn hier im Wald würde sie niemand finden. Ich setzte mich aufs Fahrrad und folgte unserem
Kompanieführer, der mir sagte ich soll immer bei der kämpfenden Truppe bleiben, denn hinter der Front sind die
Sanitätsabteilungen, die werden die Verwundeten schon versorgen. Der Vormarsch dauerte bis in die späte Nacht. Auf
einem Gehöft, das nach allen Seiten durch Feldwachen abgesichert wurde, machten wir endlich Rast. Wir haben
Getreidegarben auf dem Hof ausgebreitet und uns zur Ruhe gelegt, als plötzlich um Mitternacht Leuchtraketen den Himmel
erhellten und Maschinengewehrfeuer uns aus dem Schlaf schreckte. Ein par polnische Soldaten hatten das Feuer eröffnet,
aber sich kurz darauf ergeben.
Die Narew-Überquerung
Als es hell wurde ging der Vormarsch weiter. Es wurde uns untersagt Tagebuch zu führen, darum
weiß ich nicht wie die Orte hießen, durch die wir marschiert sind. Als wir durch ein sumpfiges Gelände vor drangen
stand auf einer Anhöhe am Horizont, die polnische Artillerie, die uns sofort unter Beschuss nahm. Unser Hauptmann war
der Meinung dass wir schon in der Nähe des Flusses Narew sein müssten, als aus den Sträuchern ein mit Schlauchboten
beladenes Lastauto auftauchte. Wir wurden aufgefordert mit je 6 Mann ein Schlauchboot zu nehmen, an einem Aggregat
der daneben stand mit Luft zu füllen und zu Wasser zu lassen. In einer Stunde war das ganze Bataillon über die Narew,
wo der Vormarsch fortgesetzt wurde. In einem Dorf überraschte uns die polnische Kavallerie und fing sofort mit
Maschinengewehren zu schießen an. Da kam der Befehl: Alles wieder zurück. Es ging noch schneller als auf der Hinfahrt.
Wir sind erst einige Kilometer am Fluss entlang gegangen und haben dann zum zweiten Mal rüber gesetzt.
Die Gehöfte im Dorf standen alle in Brand. Auf einem waren viele Bienestöcke. 2 Kameraden wollten den Stöcken Waben
entnehmen, doch die Bienen durch das Feuer aufgeschreckt, überfielen sie sofort und stachen derart zu das sie nicht
mehr wieder zu erkennen waren. Ich habe die Einstichstellen mit Salmiak betupft, mehr konnte ich nicht tun. Wir mussten
auf unserem Vormarsch durch einen Wald der in Flammen stand, so dass man kaum atmen konnte. Es ging weiter in Richtung
Minsk und Warschau, wo schon die Sowjetische Armee durchgegangen war, die Pferde und Vieh von einem Gut mitgenommen
hatten. In einem Wald stießen wir unverhofft auf ein Kloster, in dem wir einige Gefangene machten. Dann trafen wir auf
eine gute Straße die nach Grochow ging.
Als wir dort einmarschierten wurden wir aus den oberen Stockwerken beschossen, so dass wir, um uns zu schützen, nur an
den Hauswänden entlang gehen konnten. Wir haben jedes Haus nach Feinden durchsucht. Vor einem Haus stand ein Hund der
niemanden reinlassen wollte, solange bis ihn eine Kugel traf. Die polnische Artillerie feuerte von Warschau aus, um
unseren Vormarsch zu stoppen. Wir hatten uns gerade eingegraben als plötzlich deutsche Flieger am Himmel erschienen,
die unsere Stellungen mit Bomben bewarfen und dabei viel Unheil anrichteten. Wir haben sofort Fliegertücher
ausgebreitet und Leuchtraketen abgeschossen. Da ich in dem Graben, den ich kurz zuvor ausgehoben hatte, sofort in
Deckung gegangen bin ist mir zum Glück nichts passiert. Unter den anderen Kameraden gab es viele Verwundete, so dass
ich nicht wusste wem ich zuerst helfen sollte.
Der Oberstabsarzt hat mich sofort tatkräftig unterstützt, so das bald alle Verwundeten versorgt waren, außer einem,
dem ein Bombensplitter den Arm abgerissen hat. Ich habe im 3 große Verbandspäckchen auf die Wunde gelegt, doch die
Blutung ließ sich trotzdem nicht stoppen, so dass er eine Stunde später auf der Krankensammelstelle verstarb. Wir
haben danach in einem Tomatenfeld einen Graben ausgehoben und eine neue Abwehrstellung bezogen. Die Gruppe Schwarz
bekam den Auftrag nach etwaigen versprengten polnischen Verbänden Ausschau zu halten, als sie unerwartet aus einer
Häuserreihe mit Maschinengewehrsalven überschüttet wurden. Der Gruppenführer und noch ein Soldat wurden dabei tödlich
verwundet. Danach wurde noch ein weiter Stoßtrupp, unter der Führung von Leutnant Briskorn, der sich dazu freiwillig
gemeldet hatte, hinaus geschickt um den Gruppenführer und den anderen Toten zu bergen.
Bei diesem Unternehmen, das erfolglos ausging, weil die Toten schon verscharrt waren, durchschlug eine Kugel den
Stahlhelm von Leutnant Briskorn, der auch sofort tot war. Alle Toten wurden später, an der Kirchenmauer in Grochow, in
Särgen beigesetzt: Hauptmann Schönwald sagte, das sie nach dem Kriege auf den Heldenfriedhof nach Ortelsburg überführt
werden. Drei Tage lagen wir bei Grochow in Stellungen, waren dem polnischen Maschinengewehrfeuer sowie den Bomben
deutscher Flugzeuge ausgesetzt. In der Nacht musste ich zu einem Verwundeten in die vorderste Linie und habe den
Rückweg nicht mehr finden können, als plötzlich Gewehrfeuer aufflammte habe ich in den Ruinen Schutz gesucht. Erst im
Morgengrauen konnte ich mich wieder orientieren und zu meinem Unterstand zurückfinden.
Warschau wurde tagelang bombardiert und stand auch unter Artilleriebeschuss. Aus dunklen Rauchwolken kamen oft ganze
Bündel von Papier angeflogen. Die Verwundeten kamen oft auf Krücken zu unserem Unterstand, ich habe sie dann zur
Krankensammelstelle hingeführt. Wir haben auch polnische Zivilpersonen betreut, die während der Kampfhandlungen
verwundet wurden. Als einmal 2 Jungen vorbeiliefen hat einer ihnen nachgerufen sie sollten seiner Frau Bescheid sagen,
er wäre auf der Krankensammelstelle an der Kirche. Als wir dort ankamen war seine Frau, mit einem Kind auf dem Arm,
schon da.
Nach der Kapitulation von Warschau, gingen wir über Sokolow zum Bug und haben dort Quartier bezogen. Der Russe hatte
sich bereits hinter den Fluss zurückgezogen, hatte alles Vieh und Pferde mitgenommen. Dort erreichte mich ein Telegramm
von zu Hause, dass meine Tochter gestorben ist. Es sprach sich auch herum dass verschiedene Heimaturlaub bekommen haben,
ich durfte auch für 14 Tage heim. Wir fuhren mit Lastautos nach Allenstein in die neue Reiterkaserne, zum
Ersatzbatallion, da haben wir unsere Gewehre und Munition abgeben, dann durften wir, jeder in seinen Heimatort
weiterfahren.
Als wir unsere Quartiere am Bug verlassen haben war sehr viel Schnee gefallen. Hier in Ortelsburg fanden wir die
gleiche Wetterlage vor, aber nach 3 Tagen war alles wieder weggetaut und wir konnten die Kartoffelernte, die durch den
frühen Wintereinbruch gestoppt wurde, zu Ende bringen. Ein Tag bevor ich zu Hause angekommen bin wurde die Tochter
beerdigt. Nach 14 Tagen mussten wir uns in Allenstein melden, Gewehre empfangen und wieder zurück zur Division an den
Bug 150 Kilometer hinter Warschau. Die elfte Division, zu der wir auch gehörten sollte in den Westen Deutschlands
verlegt werden und war schon unterwegs zur Verladestation Skiernewice 50 Kilometer vor Warschau.
Mein Dienst als Sanitätsunteroffizier
Unser Bataillon kam in das Städtchen Burscheid, im Kreis Opladen, wo wir in Privatquartieren
untergebracht wurden. Nach 3 Monaten, im Januar 1940, wurden wir nach Solingen verlegt, wo wir bis zum
Frankreichfeldzug stationiert waren. Wir mussten an Feldübungen teilnehmen, wie andere die in Kasernen untergebracht
waren. Während dieser Zeit musste jeder seine Zähne in Ordnung bringen lassen. Jeden Tag fuhren 20 Mann in die
Cäzilienstraße nach Köln, zur Zahnklinik. Im Rheinland wurde unsere Division neu aufgestellt. Ausfälle durch den
Polenfeldzug wurden durch neue Soldaten ergänzt. Ich kam nun zum Ersatzbatallion, war der Älteste in der ganzen
Kompanie. Als der Frankreichfeldzug losging wurde unser Ersatzbatallion mit den noch vorhandenen Verwundeten, in die
neue Reiterkaserne, nach Allenstein verlegt.
Meine Frau hat, mit Unterstützung der Bauernschaft, einen Antrag gestellt, daraufhin wurde ich zur Frühjahrsbestellung,
beurlaubt und später bis auf weiteres vom Militärdienst freigestellt. Als der Russlandfeldzug losging wurde ich von der
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg, für 14 Tage einberufen. Ich war seit 1922, Mitglied der freiwilligen
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg und habe jedes Jahr an Übungen teilgenommen. Jede Bereitschaft musste etliche Leute
stellen. Von Rohmanen wurden Emil Rosowski, Johann Dembek, und ich, zur Krankensammelstelle Wirballen, in Litauen,
abkommandiert. Dorthin kamen Lazarettzüge aus Russland mit der Breitspurbahn. Die Verwundeten wurden frisch verbunden
und auf Waggon mit Normalspur verladen und nach Deutschland gebracht.
Als die 14 Tage vergangen waren wollten wir wieder nach Haus zurück, doch man wollte uns nicht entlassen. Stattdessen
wurden wir dem Wehrkreisamt Königsberg zugeteilt, neu eingekleidet und zur Aushilfe ins Lazarett nach Gumbinnen
abkommandiert. Mehr als ein Jahr war ich in den Urlauber-Baracken, habe dort Krankenstube betreut. Später, bis zum
Dezember 1944, war ich im Reserve-Lazarett 4, in Königsberg tätig. Dort habe ich auch die Luftangriffe der Engländer,
vom 25 bis 26. August 1944 miterlebt.
Wir sollten gerade einen Lazarettzug in Rotenstein entladen, als plötzlich die Sirenen ertönten - Fliegeralarm. Im
gleichen Moment waren die ersten Flugzeuge auch schon da, zuerst warfen sie „Tannenbäume” und danach Foßforkanister ab.
Die Omnibusse standen schon zur Abfahrt bereit als es losging. Wir haben die Verwundeten schnell in den
Luftschutzkeller getragen, haben die Betten von den Fenstern weggerückt damit die Verwundeten nicht von den
Glasssplittern verletzt wurden. Im Kasernenhof brannten die Fosforkanister lichterloh. Unsere Unterkunft, die sich in
einer Baracke befand ist völlig abgebrannt, mit dem Wenigen was wir unser Eigen nannten. Am nächsten Tag wurden wir neu
eingekleidet und am 29. bis 30. kamen die englischen Bomber wieder, sie setzten genau da ihr Zerstörungswerk fort wo
sie vor 3 Tagen aufgehört hatten.
Anfang Dezember 1944 musste ich mich nach Stablack melden und musste dann zur Sanitätsabteilung 1, nach Gernau, das
liegt zwischen Lodz und Warschau. Vormittags hatten wir Felddienstübungen und nachmittags theoretischen Unterricht.
Jeden Tag wurden Gruppen zusammengestellt und zu anderen Einheiten abkommandiert. Ich kam zu einer Panzerabteilung, wo
wir an einem Morgen plötzlich auf dem Kasernenhof antreten mussten und zu unserer Überraschung mit der Nachricht
konfrontiert wurden, dass der Russe an mehreren Frontabschnitten durchgebrochen war. Wir bekamen sofort einen
Marschbefehl in Richtung Lodz, wo das Stadtbild noch intakt war, selbst die Straßenbahnen fuhren noch. In der Nacht
haben russische Flugzeuge die Stadt bombardiert. Die Kaserne in der wir untergebracht waren hatte keine
Luftschutzkeller, aber zum Glück blieben wir von Bombentreffern verschont. Am nächsten morgen bot sich uns ein Bild der
Verwüstung. Die entgleisten Straßenbahnwagen, sowie andere Fahrzeuge blockierten die Straßen. Die Älteren unter uns
bekamen Fahrscheine für einen Transportzug, der bereit hinter Lodz abfahrbereit, unter Dampf stehen sollte. Als
russische Panzer in den Straßen auftauchten, verbrannte die Schreibstube unsere Wehrpässe und andere wichtige
Dokumente. Wir liefen zu der Station auf der unser Transportzug bereitstehen sollte, aber da war kein Zug mehr zu sehen
und wir setzten unseren Rückzug zu Fuß fort.
Der Rückzug und Zusammenbruch der Ostfront
In Dobroschin, einer Stadt in Polen, wurde gerade ein Lazarettzug verladen, doch wir kamen nicht
mehr zum Einsatz, weil die russische Infanterie uns schon auf den Fersen war. Es ging weiter über den Fluss Bober,
Sagan, bis nach Glogau an der Oder. Dort wurden wir der 29. motorisierten Sanitätskompanie zugeteilt. Im
Garnisonslazarett wurden noch Operationen durchgeführt. Unsere Division hatte ihr eigenes Feldlazarett, so dass wir den
Befehl zu Weiterfahrt erhielten und noch unbeschadet die Oderbrücke passieren konnten, denn Glogau wurde zur Festung
erklärt. Wir haben 2 Pferdewagen organisiert und mit Verbänden, sowie medizinischen Instrumenten beladen. So kamen wir
bis nach Lübbenau im Spreewald, wo wir in einem Schloss, in zuvor ein Museum war, unser Lazarett untergebracht haben.
Weil die Amerikaner Cottbus bombardiert hatten, wurden die Verwundeten zu uns nach Lübbenau gebracht. Hier haben wir
Tag und Nacht gearbeitet, um die vielen Verwundeten, aus den schweren Kämpfen bei Grünberg und Sagan zu versorgen. Die
Soldaten von der Abwehrfront kamen schon mit abgestorbenen Armen oder Beinen bei uns an, weil in vorderster Linie keine
Frontlazarette mehr vorhanden waren; es mussten viele Amputationen durchgeführt werden. Als für unsere Pferde kein Heu
mehr vorhanden war, schickte mich unser Hauptfeldwebel, zu einem Bauern in den Spreewald, mit dem Auftrag, Futter zu
besorgen. Mit noch zwei Mann fuhren mit zwei Kähnen, zuerst den Hauptstrom entlang und dann in einen Nebenarm; da haben
wir die Boote beladen und brachten das Heu nach Lübbenau.
Als wir uns bei unser Einheit zurück melden wollten, war alles schon marschbereit. Ich bin schnell in einen Bus
eingestiegen der sofort losfuhr, weil russische Verbände schon in sichtweite waren. Russische Flugzeuge kreisten über
den Dächern und nahmen, mit ihren Bordwaffen jeden unter Beschuss, der sich irgendwo blicken ließ. Wir konnten nur
durch den Wald, oder in der Nacht vorwärts kommen, denn wenn ein Auto auf der Landstraße fuhr, war alsbald ein Flugzeug
hinter ihm her und schoss es in Brand. Als wir nach Tagen am Ufer der Elbe ankamen, war bereits eine Ponton-Brücke
erstellt worden, welche die zerstörte Brücke ersetzen sollte.
Durch die vielen Fahrzeuge waren in den Sand tiefe Spuren gefahren, so dass andere Fahrzeuge unsere Busse ins
Schlepptau nehmen mussten, weil wir mit eigener Kraft nicht mehr weiterkamen. Beiderseits der Trasse standen
Flüchtlingswagen, in der der Hoffnung die Brücke passieren zu können, doch SS-Polizei verhinderte das die Gespanne den
militärischen Rückzug zum Stillstand brachten. Es gelang uns die Elbe zu überqueren, um in einem Waldstück Schutz vor
feindlichen Fliegern zu suchen.
Als wir unsere Busse und Autos gut getarnt hatten, hat unser Bataillonschef die anwesenden Parteigrößen zu sich
gerufen und ihnen erklärt das wir eine Einheit des Roten Kreuzes sind und nach internationalem Recht keine Waffen
besitzen dürfen. Nach langer, erregter Diskussion wurde beschlossen einen Graben auszuheben und alles im Sand zu
verscharren. Als wir dann weiter, durch die Dörfer fuhren, sahen wir schon viele weiße Bettlaken, als Zeichen der
Kapitulation, aus den Fenstern hängen. Es wurde uns erzählt dass der Bürgermeister von der SS erschossen wurde, weil
er die Bevölkerung zu diesem Schritt ermutigt hatte. Jetzt waren hinter uns die Russen und vor uns schon die Amerikaner.
Amerikanische Panzer fuhren umher und schossen wild durch die Gegend, ohne ein Ziel anzuvisieren. Niemand wollte sich
dem Russen ergeben, doch der Weg der zu den Amerikanern führte, war durch abgesägte Bäume blockiert. Wir sind schnell
in das nächste Dorf gegangen, haben uns Sägen und Äxte besorgt, die Bäume durchgesägt und in den Straßengraben
geworfen.
“ Nach dem Ende des 2. Weltkrieges.”
In amerikanische Kriegsgefangenschaft
Dann fuhren wir unter internationaler Flagge an eine Mulde Brücke, vor der zwei amerikanische Soldaten, mit Zigarren,
zur Hälfte im Mund, standen. Sie rauchten und kauten gleichzeitig. Wir mussten auf einen freien Platz fahren, alle
aussteigen und rechts wieder antreten. Wäschebeutel und Tornister mussten wir abstellen; danach wurden wir nach Waffen
durchsucht, Wertsachen, Uhren und Messer wurden uns gleich abgenommen. Als wir anschließend an unserem Gepäck
vorbeigingen durfte niemand was mitnehmen. Als ich gebückt, nach meinem Wäschebeutel greifen wollte, in dem sich noch
3 Konservendosen und ein Brot befanden, bekam ich einen Fußtritt ins Gesicht, so dass mir ein Zahn ausgeschlagen wurde.
Wir wurden dann in einem Garten zusammen getrieben und gefragt ob jemand bei der SS gedient hat. Nachdem wir in Reihe
und Glied angetreten waren, mussten wir den Oberkörper freimachen und die Arme anheben. Es wurde nach SS-Zeichen
gesucht, die gewöhnlich unter dem Oberarm eintätowiert waren. Nachdem wir Grimma bei Leipzig, wo wir in amerikanische
Gefangenschaft geraten waren, verlassen hatten, mussten wir durch ganz Thüringen bis Hersfeld, an der Grenze zu Hessen,
marschieren. In Hersfeld wurden wir auf große Lastautos verladen, die von farbigen Soldaten gefahren wurden. Man hat
uns mit Stöcken hinauf getrieben, solange bis das Auto so voll war das man kaum stehen konnte. Die Soldaten fuhren, für
diese Straßenverhältnisse, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Wenn die Straße eine scharfe Kurve hatte, flogen
wir alle übereinander und mussten erst mit viel Kraftanstrengung auf die Beine kommen um diese Fahrt zu überstehen.
Da die Straßenränder in dieser Gegend mit Obstbäumen bepflanzt sind und deren Äste sehr niedrig hängen, hätten die
uns die Köpfe abgerissen, wenn wir uns nicht ständig geduckt hätten. Unsere Fahrt endete in Bad Kreuznach, in der Pfalz,
wo wir in ein Lager, in dem sich später 130.000 Mann und 6 Generäle befanden, eingepfercht wurden. Die Unterkunft der
Generäle befand sich unter einem Zelt, alle anderen mussten die Zeit unter freiem Himmel zubringen. Die Offiziere, die
Unteroffiziere, die Mannschaften; wurden in getrennten Camps untergebracht. Die Mannschaften wurden auch zur Arbeit
abkommandiert und konnten bei dieser Gelegenheit, Brot, Brötchen oder Zigarettenstummel organisieren, wogegen die
Offiziere und Unteroffiziere ihr Camp überhaupt nicht verlassen durften.
Die ersten Tage gab es kein Wasser und kein Brot, so dass die Kameraden vor Erschöpfung umfielen. Später standen wir
manchmal den ganzen Tag nach Wasser an, das von den, uns bewachenden Negern mit großen Wassertanks angefahren wurde. Am
dritten Tag bekamen wir mittags und abends etwas zu Essen; Brot bekamen wir erst nach zwei Wochen, nach dem aus der
Umgebung herbeigeholte Handwerker, Backöfen gebaut hatten. In den verschiedenen Gemeinden, die in den uns umgebenden
Weinbergen lagen, mussten sich alle Männer beim Bürgermeister melden. Als sie dann erschienen waren, wurden sie auf
bereitstehende Lastautos getrieben und zu uns ins Lager gebracht. Sie waren ohne Kopfbedeckung und ohne wärmere
Bekleidung angekommen, weil ihnen gesagt wurde, dass ihr Aufenthalt im Lager nur von kurzer Dauer sein würde. Man hat
uns, falls noch vorhanden, Decken und Mäntel abgenommen, mit der Begründung, sie würden für Kranke und Verwundete
gebraucht. Jeden Tag starben mehr als 200 Mann, die wir sofort in ein Zelt tragen mussten. In der Nacht wurden die
Toten dann mit unbekanntem Ziel, weggefahren.
Viele haben ihren Verstand verloren uns irrten im ganzen Camp ziellos umher. Als Latrinen wurden Gräben ausgehoben, in
die verschiedene Kameraden, bei der Verrichtung ihrer Notdurft, vor Schwäche hineingefallen sind und nicht mehr wieder
heraus kamen. Aus den Pfählen die, die jungen Obstbäume stützten, haben wir Krankentragen gebaut um unsere Kameraden,
bei Bedarf, zur Krankensammelstelle zu tragen. Es war in diesem Frühjahr auch sehr kalt, doch unsere Erdlöcher, die wir
zum Schutz vor Kälte und Wind, nur mit leeren Konservendosen ausgehoben hatten, durften nicht tiefer als 20 Zentimeter
sein. Nach jedem Regenguss mussten wir das Wasser ausschöpfen. Nach einem Gewitter, standen wir wiedermal, total
durchnässt in unserem Camp, als unerwartet am Horizont die Sonne hervortrat. Einer unserer Kameraden hatte noch eine
Trompete gerettet und fing, von dem Anblick völlig überwältigt, zu spielen an: "Es geht alles vorüber, es geht alles
vorbei, nach jedem Dezember, folgt wieder ein Mai". Daraufhin hob sich die Stimmung der tiefbetrübten Kriegsgefangenen,
so das Heimatlieder durch das ganze Camp erklangen, obwohl wir in den nassen Kleider herumgehen mussten, bis sie am
Körper trocken wurden.

Friedrich Biella hatte auf seinem Feld einen Granitstein mit einer geraden Seite, den haben wir
mit viel Schweiß an den Dorfteich transportiert und auf einer Erhöhung abgelegt. Der Stein sollte zum Denkmahl für die
Gefallenen des Ersten Weltkrieges umgestaltet werden. Da zu Wenige daran ein Interesse zeigten, wurde diese Idee fallen
gelassen und der Stein irgendwann ins Wasser gerollt. Der Lehrer Dorka war viele Jahre in Rohmanen tätig, dort hat er
später seine ehemalige Schülerin, Lotte Biella geheiratet. Er hat sich sehr für die Entwicklung des Dorfes interessiert,
war bei jeder Gemeindeversammlung anwesend und hat auf Schwachstellen hingewiesen die den Fortschritt behinderten.
Gemeinsam mit den Schülern hat er den Ehrenfriedhof für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges gepflegt, an der
Wegegablung nach Eichtal und zu Ehren des Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg eine Eiche gepflanzt.
Zum Advent hat Lehrer Dorka mit der Jugend einen Adventstern, in verschiedenen Farben gebastelt.
Der Stern wurde auf einer 2 Meter langen Stange befestigt, in der Mitte wurde ein Wachslicht angezündet, am Stern
wurde eine Schnur angebracht, wenn man daran zog rollte der Stern hin und her. Am ersten Wochenende im Advent
versammelten sich jung und alt, um den Stern durch das Dorf zu tragen. Alle schlossen sich dem vorausgehenden
Sternträger an, der den Stern durch die Hauptstraße und die angrenzenden Wege trug. Dieser Sternmarsch wurde an den
folgenden Adventwochenenden wiederholt.
Am ersten Weihnachtfeiertag wurde um 4:00 Uhr morgens ein Frühgottesdienst gehalten. Zuerst hat der Pfarrer eine
Andacht gehalten, dann haben die Kinder ein Krippenspiel aufgeführt und die Gemeinde hat schöne Weihnachtslieder
gesungen. Der Gastwirt Trzaska hat uns den Saal zur Verfügung gestellt. Wir hatten eine Posaunen- u. eine
Gitarrengruppe. Unter der Leitung von Herrn Willi Doormann spielten: Gottlieb Brosch, Fritz Ollech,
Gustav Rattay(Sopran), Wilhelm Pilath, Gustav Brosch(Alt), Fritz Both(Tenor) und Fritz Brosch(Bass).
In der Gitarrengruppe wirkten mit: Martha Ollech, Hedwig Ollech, Martha Lekzik, Martha Michalick und Auguste Lekzick.
Willy Doormann hat sie auf der Geige begleitet.
Kurz vor Ausbruch des 2. Weltkrieges
Bei der Aufstellung des Grenzschutzes(Regiment Buchholz), hat er als Hauptfeldwebel die
Gruppenführerkurse überwacht und selbst die fähigsten Männer dafür vorgeschlagen. Das Ausbildungspersonal hat das
Jäger-Battalion gestellt. Wir kamen zuerst ins Stadion(Waldheim), wurden da eingekleidet und dann ging es gleich
kasernenmäßig zu, theoretisch und praktisch. Jeder musste vor die Front treten und nachweisen ob er im Stande ist,
Befehle zu erteilen. Abends wurden Filme vorgeführt die uns zeigen sollten wie eine Gruppe sich im Gelände entfalten
muss. Die Exerziervorschriften hatten sich, im Verhältnis zu Kaiser Wilhelms Zeiten, etwas geändert. Damals bestand
eine Gruppe aus 8 Mann und einem Unteroffizier, jetzt aus 10 Schützen, 3 für das leichte Maschinengewehr und einem
Unteroffizier(13 Mann). Nach der Schulung folgte eine Abschlussprüfung, danach ein gemütliches Beisammensein. Aus
Rohmanen haben folgende Männer die Prüfung bestanden: Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy, Gustav Rattay und
Gustav Deptolla. Unsere Uniformen waren alle zu klein und es gab viel zu lachen bei der Anprobe.
Die erste Übung habe ich mit Emil Rosowski, in Lenzinen gemacht. Der Gutsbesitzer Marzinzick hat seine Scheune als
Unterkunft zur Verfügung gestellt. Er war im Range eines Hauptfeldwebels. In seinem haus war die Schreibstube
untergebracht, die er selbst verwaltete. Ein Lastauto hatte Uniformen aus der Kaserne in Ortelsburg geholt, jeder
musste eine Uniform anlegen und dann wurde solange getauscht bis alle eine passende gefunden hatten. An den Namen des
Kompanieführers kann ich mich nicht mehr erinnern. 1935 wurden wir zu einer Übung in die Dragonerkaserne nach Lyk
einberufen. Die Gruppenführer, Zugführer, und Kompanieführer die schon Frontberührung im dem Ersten Weltkrieg hatten,
mussten eine Woche früher anreisen. Die Übungen waren auf 6 Wochen angelegt. Die meisten der einberufenen waren noch
nie mit dem Wehrdienst in Berührung gekommen. Jeder Gruppenführer bekam 13 Mann zugeteilt.
Unser Zugführer war Leutnant Neumann, Kompanieführer Oberleutnant Rutschko, Battalions-Kommandeur Major Gröning
(Regiment Buchholz). Hier ging es wieder Kasernenmäßig voran. Das Bataillon wurde hier vereidigt. Jeden zweiten
Sonntag durften unsere Frauen uns besuchen. Ein Jahr später wurden wir wieder zu einer Übung einberufen, auf den
Truppenübungsplatz nach Arys. Jeder Gruppenführer hatte den Auftrag die Gruppe zu entfalten, und auf bewegliche
Figuren zu schießen. Diese Übung musste später mit scharfer Munition wiederholt werden. Jedes Maschinengewehr bekam
50 Schuss, jeder Schütze 20 Schuss zugeteilt. Nach dem Abschießen wurden die Treffer gezählt und dem Kommandierenden
Bericht erstattet. In einiger Entfernung spaziert ein Storch umher, der gar nicht bemerkt hatte dass geschossen wurde,
was bei den Kameraden ein großes Gelächter hervorrief.
Nach der Übung wurde uns gesagt das jeder Gruppenführer eine arische Abstammung nachweisen sollte. Ich konnte in den
Rheinsweiner Kirchenbüchern meine Vorfahren aus Gellen, bis zum Jahr 1732 zurück, nachweisen und wurde zum
Unteroffizier befördert. Aus unserem Dorf wurden auch, Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy und Gustav Deptolla
befördert. Zwischendurch mussten wir schon mal in die Radfahrer-Kaserne nach Ortelsburg, Gewehre empfangen und im
Gelände üben. Am 31 Juli 1939 wurde mir von einem Soldaten ein Schreiben übereicht, das mich aufforderte, am 1. August
um 6:00 Uhr, bei der 3. Kompanie, des 2. Infanterieregiments zu erscheinen.
Um 5:30 hat mich meine Schwester in die Kaserne gebracht. Auf der Schreibstube erklärte mir der Hauptfeldwebel,
dass mir ab sofort der Dienstgrad eines Sanitäters zugewiesen wird, ich mich in der Kammer einzukleiden hätte und mir
in der Handwerkerstube die entsprechenden Schulterklappen annähen lassen sollte. Die aktiven Sanitäter wurden den
Feldlazaretten zugewiesen und wir kamen an ihre Stelle. Unser Bataillon wurde nach Schodmak zum Bunker bauen und
Stacheldraht verlegen eingeteilt. Wir zogen in Begleitung einer Musikkapelle bis zur Kreuzung am Krankenhaus, dann
weiter zu unserem Bestimmungsort, gefolgt von einer Gulaschkanone die in den nächsten Tagen für unsere Verpflegung
sorgen sollte.
Am 14 August haben wir die Jägerkaserne, begleitet von einer Musikkapelle endgültig verlassen und zogen zuerst durch
Ortelsburg, dann über Lehmanen ins Feldmanöver, hinter Rohmanen. Dort entfaltete sich das Bataillon im Gelände, die
Verwundetensammelstelle wurde auf dem Hof des Bauern Friedrich Neumann eingerichtet. Gegen Abend wurde zu Sammeln
geblasen und Biwak bezogen, wobei unsere 3.Kompanie, in einem kleinen Wallt, in der Nähe von Otto Nickels Gehöft
Stellung bezogen hatte. Die 2. und 4. Kompanie hatte sich in der Nähe vom Abbau Pallasch niedergelassen. Die Frau
Nickel hat am Abend ein Mädel in Dorf geschickt um meiner Frau Bescheid zu sagen, wo wir uns zurzeit befinden. Meine
Frau ist dann noch gekommen um sich von mir zu verabschieden, weil wir am nächsten Morgen um 3:00 Uhr Zelte abbrechen
und um 4:00 Uhr in Richtung Kaspersguth marschieren sollten.
Wir sind dann über Achodden, Seelonken, Lehmanen, Ortelsburg, bis nach Grammen und Schützendorf marschiert, wo wir an
einem See Biwak bezogen haben. Es wurde immer gesagt, wir kommen zum Tannenberg-Denkmal bei Hohenstein, wo ein Reichs
Kriegervereinsfest stattfinden sollte. Es wurden auch schon Vorkommandos aufgestellt, doch dann kamen wir nach Orlau
und Lahna-Mühle, da wo die Alle entspringt haben wir 2 Tage biwakiert. Unser Kompanieführer hat uns nach Waplitz auf
den Soldatenfriedhof des Ersten Weltkrieges geführt und uns erklärt wie das Jägerbataillon sich 1914 hier entfaltet
hat und aufgerieben wurde. Dann mussten wir in der Nähe von Gut Koslau über einen Fluss und bezogen in einem Waldstück,
vorbereitete Stellungen in der Nähe der polnischen Grenze. Herr und Frau Thalmann haben uns jeden Tag, bis zur Grenze,
mit Brötchen und Getränken versorgt. Es wurde scharfe Munition ausgegeben, weil wir am nächsten Morgen um 4:00 Uhr die
polnische Grenze überschreiten sollten.
Am nächsten Morgen um 10 Minuten vor 4:00 Uhr kam der Befehl; scharfe Munition abgeben, alles zurück in ein 6 Kilometer
entferntes Dorf, wo wir auch einquartiert wurden. Das alles geschah’ eine Woche vor dem 1. September 1939. Es wurde
gesagt dass der Führer dem polnischen Präsidenten Rid-Szmigly, ein Ultimatum gestellt hat und es wahrscheinlich nicht
zum Krieg mit Polen kommt. Genau nach 5 Tagen kehrten wir wieder in die gleichen Stellungen zurück, es wurde wieder
scharfe Munition ausgegeben und am nächsten Morgen um 4:00 Uhr überschritten wir die polnische Grenze.
“Der 2. Weltkrieg.”
Der erste Einsatz in Polen
Wir kamen zuerst in ein Dorf in dem sich nur alte Menschen befanden. Auf unsere Frage wo denn die Bewohner wären sagte
man uns dass alle geflohen sind, weil erzählt wurde, die Deutschen würden alle Polen misshandeln und verstümmeln. Ich
habe ihnen daraufhin gesagt dass uns, unter Androhung von Strafe verboten wurde, einem Zivilisten etwas anzutun. Das
Vieh, die Schweine und Hunde des Dorfes liefen frei herum und die Soldaten fingen an auf die Hunde zu schießen, bis
gesagt wurde es seien Meldehunde im Dienste der Deutschen Wehrmacht und dieser Unfug der eigenen Truppe schaden würde,
weil etwaige Querschläger eigene Kameraden verletzen könnten. Wir gingen weiter auf polnischer Seite entlang der Grenze,
bis wir am Nachmittag die ersten Vorposten der Festung Mlawa erreichten, da befanden wir uns plötzlich im Feuerhagel
polnischer Festungsflack.
Am nächsten Morgen hatte ich schon 3 Verwundete und wusste nicht wo sich eine Verwundeten Sammelstelle befindet. Ich
suchte den Bataillonsgefechtstand auf der sich auf einer Anhöhe befand. Ich habe unseren Oberstabsarzt gefragt wo denn
die Verwundetensammelstelle wäre. Er rief beim Tross an, wo er die Auskunft erhielt, das sich vor dem Dorf ein Bunker
befindet in dem man die Verwundeten sammeln sollte, die dann von Sanitätsautos abgeholt würden, weil das Dorf unter
Artilleriebeschuss stand. Am Sonnabend haben unsere Flieger die Bunkerstellungen bombardiert, konnten aber, trotz guter
Treffer nicht viel ausrichten, die Bunker wurden nur etwas angekratzt.
Der Beschuss unserer vordersten Linien ging mit unverminderter Heftigkeit weiter. Am Sonntag verkündete eine große
Staubwolke die Ankunft unserer Panzer, doch sie kamen nur bis zur Panzersperre und mussten wieder abdrehen ohne den
Polen einen schaden zuzufügen. Ein Panzer bekam einen Volltreffer, der Fahrer konnte noch umkehren. Er blutete am Kopf
und der Schütze war so eingeklemmt, das wir ihn nur mit einem Seil unter den Armen, durch die Luke nach oben ziehen
konnten. Ob er seine Verwundung überlebt hat ist mir nicht bekannt, denn in der Nacht wurden Panzergeschütze nach
vorne in Stellung gebracht, die direkt in die Schießscharten der Bunker geschossen und so die Verteidiger vertrieben
haben. Daraufhin sind wir weiter vorgerückt. Auf einer Wiese war ein tiefer Graben ausgehoben und mit Ästen getarnt,
da war ein Panzer hinein gefahren, so dass nur das Hinterteil herausragte und er sich nicht aus eigner Kraft befreien
konnte. In der Luft waren Flieger die Brandbomben abwarfen, ich habe mich auf den Boden geworfen weil ich dachte die
würden explodieren, aber sie zischten nur, so das Stoppeln und Graß rings herum in Brand gerieten.
Bei den Kampfhandlungen gab es mehrere Verwundete, denen ich gerade Verbände anlegen wollte, als unser Hauptmann zur
Trillerpfeife griff um mir klar zu machen, dass ich ihm folgen sollte. Die Polen fingen an zu schreien, ich sollte
sie ins Lazarett bringen denn hier im Wald würde sie niemand finden. Ich setzte mich aufs Fahrrad und folgte unserem
Kompanieführer, der mir sagte ich soll immer bei der kämpfenden Truppe bleiben, denn hinter der Front sind die
Sanitätsabteilungen, die werden die Verwundeten schon versorgen. Der Vormarsch dauerte bis in die späte Nacht. Auf
einem Gehöft, das nach allen Seiten durch Feldwachen abgesichert wurde, machten wir endlich Rast. Wir haben
Getreidegarben auf dem Hof ausgebreitet und uns zur Ruhe gelegt, als plötzlich um Mitternacht Leuchtraketen den Himmel
erhellten und Maschinengewehrfeuer uns aus dem Schlaf schreckte. Ein par polnische Soldaten hatten das Feuer eröffnet,
aber sich kurz darauf ergeben.
Die Narew-Überquerung
Als es hell wurde ging der Vormarsch weiter. Es wurde uns untersagt Tagebuch zu führen, darum
weiß ich nicht wie die Orte hießen, durch die wir marschiert sind. Als wir durch ein sumpfiges Gelände vor drangen
stand auf einer Anhöhe am Horizont, die polnische Artillerie, die uns sofort unter Beschuss nahm. Unser Hauptmann war
der Meinung dass wir schon in der Nähe des Flusses Narew sein müssten, als aus den Sträuchern ein mit Schlauchboten
beladenes Lastauto auftauchte. Wir wurden aufgefordert mit je 6 Mann ein Schlauchboot zu nehmen, an einem Aggregat
der daneben stand mit Luft zu füllen und zu Wasser zu lassen. In einer Stunde war das ganze Bataillon über die Narew,
wo der Vormarsch fortgesetzt wurde. In einem Dorf überraschte uns die polnische Kavallerie und fing sofort mit
Maschinengewehren zu schießen an. Da kam der Befehl: Alles wieder zurück. Es ging noch schneller als auf der Hinfahrt.
Wir sind erst einige Kilometer am Fluss entlang gegangen und haben dann zum zweiten Mal rüber gesetzt.
Die Gehöfte im Dorf standen alle in Brand. Auf einem waren viele Bienestöcke. 2 Kameraden wollten den Stöcken Waben
entnehmen, doch die Bienen durch das Feuer aufgeschreckt, überfielen sie sofort und stachen derart zu das sie nicht
mehr wieder zu erkennen waren. Ich habe die Einstichstellen mit Salmiak betupft, mehr konnte ich nicht tun. Wir mussten
auf unserem Vormarsch durch einen Wald der in Flammen stand, so dass man kaum atmen konnte. Es ging weiter in Richtung
Minsk und Warschau, wo schon die Sowjetische Armee durchgegangen war, die Pferde und Vieh von einem Gut mitgenommen
hatten. In einem Wald stießen wir unverhofft auf ein Kloster, in dem wir einige Gefangene machten. Dann trafen wir auf
eine gute Straße die nach Grochow ging.
Als wir dort einmarschierten wurden wir aus den oberen Stockwerken beschossen, so dass wir, um uns zu schützen, nur an
den Hauswänden entlang gehen konnten. Wir haben jedes Haus nach Feinden durchsucht. Vor einem Haus stand ein Hund der
niemanden reinlassen wollte, solange bis ihn eine Kugel traf. Die polnische Artillerie feuerte von Warschau aus, um
unseren Vormarsch zu stoppen. Wir hatten uns gerade eingegraben als plötzlich deutsche Flieger am Himmel erschienen,
die unsere Stellungen mit Bomben bewarfen und dabei viel Unheil anrichteten. Wir haben sofort Fliegertücher
ausgebreitet und Leuchtraketen abgeschossen. Da ich in dem Graben, den ich kurz zuvor ausgehoben hatte, sofort in
Deckung gegangen bin ist mir zum Glück nichts passiert. Unter den anderen Kameraden gab es viele Verwundete, so dass
ich nicht wusste wem ich zuerst helfen sollte.
Der Oberstabsarzt hat mich sofort tatkräftig unterstützt, so das bald alle Verwundeten versorgt waren, außer einem,
dem ein Bombensplitter den Arm abgerissen hat. Ich habe im 3 große Verbandspäckchen auf die Wunde gelegt, doch die
Blutung ließ sich trotzdem nicht stoppen, so dass er eine Stunde später auf der Krankensammelstelle verstarb. Wir
haben danach in einem Tomatenfeld einen Graben ausgehoben und eine neue Abwehrstellung bezogen. Die Gruppe Schwarz
bekam den Auftrag nach etwaigen versprengten polnischen Verbänden Ausschau zu halten, als sie unerwartet aus einer
Häuserreihe mit Maschinengewehrsalven überschüttet wurden. Der Gruppenführer und noch ein Soldat wurden dabei tödlich
verwundet. Danach wurde noch ein weiter Stoßtrupp, unter der Führung von Leutnant Briskorn, der sich dazu freiwillig
gemeldet hatte, hinaus geschickt um den Gruppenführer und den anderen Toten zu bergen.
Bei diesem Unternehmen, das erfolglos ausging, weil die Toten schon verscharrt waren, durchschlug eine Kugel den
Stahlhelm von Leutnant Briskorn, der auch sofort tot war. Alle Toten wurden später, an der Kirchenmauer in Grochow, in
Särgen beigesetzt: Hauptmann Schönwald sagte, das sie nach dem Kriege auf den Heldenfriedhof nach Ortelsburg überführt
werden. Drei Tage lagen wir bei Grochow in Stellungen, waren dem polnischen Maschinengewehrfeuer sowie den Bomben
deutscher Flugzeuge ausgesetzt. In der Nacht musste ich zu einem Verwundeten in die vorderste Linie und habe den
Rückweg nicht mehr finden können, als plötzlich Gewehrfeuer aufflammte habe ich in den Ruinen Schutz gesucht. Erst im
Morgengrauen konnte ich mich wieder orientieren und zu meinem Unterstand zurückfinden.
Warschau wurde tagelang bombardiert und stand auch unter Artilleriebeschuss. Aus dunklen Rauchwolken kamen oft ganze
Bündel von Papier angeflogen. Die Verwundeten kamen oft auf Krücken zu unserem Unterstand, ich habe sie dann zur
Krankensammelstelle hingeführt. Wir haben auch polnische Zivilpersonen betreut, die während der Kampfhandlungen
verwundet wurden. Als einmal 2 Jungen vorbeiliefen hat einer ihnen nachgerufen sie sollten seiner Frau Bescheid sagen,
er wäre auf der Krankensammelstelle an der Kirche. Als wir dort ankamen war seine Frau, mit einem Kind auf dem Arm,
schon da.
Nach der Kapitulation von Warschau, gingen wir über Sokolow zum Bug und haben dort Quartier bezogen. Der Russe hatte
sich bereits hinter den Fluss zurückgezogen, hatte alles Vieh und Pferde mitgenommen. Dort erreichte mich ein Telegramm
von zu Hause, dass meine Tochter gestorben ist. Es sprach sich auch herum dass verschiedene Heimaturlaub bekommen haben,
ich durfte auch für 14 Tage heim. Wir fuhren mit Lastautos nach Allenstein in die neue Reiterkaserne, zum
Ersatzbatallion, da haben wir unsere Gewehre und Munition abgeben, dann durften wir, jeder in seinen Heimatort
weiterfahren.
Als wir unsere Quartiere am Bug verlassen haben war sehr viel Schnee gefallen. Hier in Ortelsburg fanden wir die
gleiche Wetterlage vor, aber nach 3 Tagen war alles wieder weggetaut und wir konnten die Kartoffelernte, die durch den
frühen Wintereinbruch gestoppt wurde, zu Ende bringen. Ein Tag bevor ich zu Hause angekommen bin wurde die Tochter
beerdigt. Nach 14 Tagen mussten wir uns in Allenstein melden, Gewehre empfangen und wieder zurück zur Division an den
Bug 150 Kilometer hinter Warschau. Die elfte Division, zu der wir auch gehörten sollte in den Westen Deutschlands
verlegt werden und war schon unterwegs zur Verladestation Skiernewice 50 Kilometer vor Warschau.
Mein Dienst als Sanitätsunteroffizier
Unser Bataillon kam in das Städtchen Burscheid, im Kreis Opladen, wo wir in Privatquartieren
untergebracht wurden. Nach 3 Monaten, im Januar 1940, wurden wir nach Solingen verlegt, wo wir bis zum
Frankreichfeldzug stationiert waren. Wir mussten an Feldübungen teilnehmen, wie andere die in Kasernen untergebracht
waren. Während dieser Zeit musste jeder seine Zähne in Ordnung bringen lassen. Jeden Tag fuhren 20 Mann in die
Cäzilienstraße nach Köln, zur Zahnklinik. Im Rheinland wurde unsere Division neu aufgestellt. Ausfälle durch den
Polenfeldzug wurden durch neue Soldaten ergänzt. Ich kam nun zum Ersatzbatallion, war der Älteste in der ganzen
Kompanie. Als der Frankreichfeldzug losging wurde unser Ersatzbatallion mit den noch vorhandenen Verwundeten, in die
neue Reiterkaserne, nach Allenstein verlegt.
Meine Frau hat, mit Unterstützung der Bauernschaft, einen Antrag gestellt, daraufhin wurde ich zur Frühjahrsbestellung,
beurlaubt und später bis auf weiteres vom Militärdienst freigestellt. Als der Russlandfeldzug losging wurde ich von der
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg, für 14 Tage einberufen. Ich war seit 1922, Mitglied der freiwilligen
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg und habe jedes Jahr an Übungen teilgenommen. Jede Bereitschaft musste etliche Leute
stellen. Von Rohmanen wurden Emil Rosowski, Johann Dembek, und ich, zur Krankensammelstelle Wirballen, in Litauen,
abkommandiert. Dorthin kamen Lazarettzüge aus Russland mit der Breitspurbahn. Die Verwundeten wurden frisch verbunden
und auf Waggon mit Normalspur verladen und nach Deutschland gebracht.
Als die 14 Tage vergangen waren wollten wir wieder nach Haus zurück, doch man wollte uns nicht entlassen. Stattdessen
wurden wir dem Wehrkreisamt Königsberg zugeteilt, neu eingekleidet und zur Aushilfe ins Lazarett nach Gumbinnen
abkommandiert. Mehr als ein Jahr war ich in den Urlauber-Baracken, habe dort Krankenstube betreut. Später, bis zum
Dezember 1944, war ich im Reserve-Lazarett 4, in Königsberg tätig. Dort habe ich auch die Luftangriffe der Engländer,
vom 25 bis 26. August 1944 miterlebt.
Wir sollten gerade einen Lazarettzug in Rotenstein entladen, als plötzlich die Sirenen ertönten - Fliegeralarm. Im
gleichen Moment waren die ersten Flugzeuge auch schon da, zuerst warfen sie „Tannenbäume” und danach Foßforkanister ab.
Die Omnibusse standen schon zur Abfahrt bereit als es losging. Wir haben die Verwundeten schnell in den
Luftschutzkeller getragen, haben die Betten von den Fenstern weggerückt damit die Verwundeten nicht von den
Glasssplittern verletzt wurden. Im Kasernenhof brannten die Fosforkanister lichterloh. Unsere Unterkunft, die sich in
einer Baracke befand ist völlig abgebrannt, mit dem Wenigen was wir unser Eigen nannten. Am nächsten Tag wurden wir neu
eingekleidet und am 29. bis 30. kamen die englischen Bomber wieder, sie setzten genau da ihr Zerstörungswerk fort wo
sie vor 3 Tagen aufgehört hatten.
Anfang Dezember 1944 musste ich mich nach Stablack melden und musste dann zur Sanitätsabteilung 1, nach Gernau, das
liegt zwischen Lodz und Warschau. Vormittags hatten wir Felddienstübungen und nachmittags theoretischen Unterricht.
Jeden Tag wurden Gruppen zusammengestellt und zu anderen Einheiten abkommandiert. Ich kam zu einer Panzerabteilung, wo
wir an einem Morgen plötzlich auf dem Kasernenhof antreten mussten und zu unserer Überraschung mit der Nachricht
konfrontiert wurden, dass der Russe an mehreren Frontabschnitten durchgebrochen war. Wir bekamen sofort einen
Marschbefehl in Richtung Lodz, wo das Stadtbild noch intakt war, selbst die Straßenbahnen fuhren noch. In der Nacht
haben russische Flugzeuge die Stadt bombardiert. Die Kaserne in der wir untergebracht waren hatte keine
Luftschutzkeller, aber zum Glück blieben wir von Bombentreffern verschont. Am nächsten morgen bot sich uns ein Bild der
Verwüstung. Die entgleisten Straßenbahnwagen, sowie andere Fahrzeuge blockierten die Straßen. Die Älteren unter uns
bekamen Fahrscheine für einen Transportzug, der bereit hinter Lodz abfahrbereit, unter Dampf stehen sollte. Als
russische Panzer in den Straßen auftauchten, verbrannte die Schreibstube unsere Wehrpässe und andere wichtige
Dokumente. Wir liefen zu der Station auf der unser Transportzug bereitstehen sollte, aber da war kein Zug mehr zu sehen
und wir setzten unseren Rückzug zu Fuß fort.
Der Rückzug und Zusammenbruch der Ostfront
In Dobroschin, einer Stadt in Polen, wurde gerade ein Lazarettzug verladen, doch wir kamen nicht
mehr zum Einsatz, weil die russische Infanterie uns schon auf den Fersen war. Es ging weiter über den Fluss Bober,
Sagan, bis nach Glogau an der Oder. Dort wurden wir der 29. motorisierten Sanitätskompanie zugeteilt. Im
Garnisonslazarett wurden noch Operationen durchgeführt. Unsere Division hatte ihr eigenes Feldlazarett, so dass wir den
Befehl zu Weiterfahrt erhielten und noch unbeschadet die Oderbrücke passieren konnten, denn Glogau wurde zur Festung
erklärt. Wir haben 2 Pferdewagen organisiert und mit Verbänden, sowie medizinischen Instrumenten beladen. So kamen wir
bis nach Lübbenau im Spreewald, wo wir in einem Schloss, in zuvor ein Museum war, unser Lazarett untergebracht haben.
Weil die Amerikaner Cottbus bombardiert hatten, wurden die Verwundeten zu uns nach Lübbenau gebracht. Hier haben wir
Tag und Nacht gearbeitet, um die vielen Verwundeten, aus den schweren Kämpfen bei Grünberg und Sagan zu versorgen. Die
Soldaten von der Abwehrfront kamen schon mit abgestorbenen Armen oder Beinen bei uns an, weil in vorderster Linie keine
Frontlazarette mehr vorhanden waren; es mussten viele Amputationen durchgeführt werden. Als für unsere Pferde kein Heu
mehr vorhanden war, schickte mich unser Hauptfeldwebel, zu einem Bauern in den Spreewald, mit dem Auftrag, Futter zu
besorgen. Mit noch zwei Mann fuhren mit zwei Kähnen, zuerst den Hauptstrom entlang und dann in einen Nebenarm; da haben
wir die Boote beladen und brachten das Heu nach Lübbenau.
Als wir uns bei unser Einheit zurück melden wollten, war alles schon marschbereit. Ich bin schnell in einen Bus
eingestiegen der sofort losfuhr, weil russische Verbände schon in sichtweite waren. Russische Flugzeuge kreisten über
den Dächern und nahmen, mit ihren Bordwaffen jeden unter Beschuss, der sich irgendwo blicken ließ. Wir konnten nur
durch den Wald, oder in der Nacht vorwärts kommen, denn wenn ein Auto auf der Landstraße fuhr, war alsbald ein Flugzeug
hinter ihm her und schoss es in Brand. Als wir nach Tagen am Ufer der Elbe ankamen, war bereits eine Ponton-Brücke
erstellt worden, welche die zerstörte Brücke ersetzen sollte.
Durch die vielen Fahrzeuge waren in den Sand tiefe Spuren gefahren, so dass andere Fahrzeuge unsere Busse ins
Schlepptau nehmen mussten, weil wir mit eigener Kraft nicht mehr weiterkamen. Beiderseits der Trasse standen
Flüchtlingswagen, in der der Hoffnung die Brücke passieren zu können, doch SS-Polizei verhinderte das die Gespanne den
militärischen Rückzug zum Stillstand brachten. Es gelang uns die Elbe zu überqueren, um in einem Waldstück Schutz vor
feindlichen Fliegern zu suchen.
Als wir unsere Busse und Autos gut getarnt hatten, hat unser Bataillonschef die anwesenden Parteigrößen zu sich
gerufen und ihnen erklärt das wir eine Einheit des Roten Kreuzes sind und nach internationalem Recht keine Waffen
besitzen dürfen. Nach langer, erregter Diskussion wurde beschlossen einen Graben auszuheben und alles im Sand zu
verscharren. Als wir dann weiter, durch die Dörfer fuhren, sahen wir schon viele weiße Bettlaken, als Zeichen der
Kapitulation, aus den Fenstern hängen. Es wurde uns erzählt dass der Bürgermeister von der SS erschossen wurde, weil
er die Bevölkerung zu diesem Schritt ermutigt hatte. Jetzt waren hinter uns die Russen und vor uns schon die Amerikaner.
Amerikanische Panzer fuhren umher und schossen wild durch die Gegend, ohne ein Ziel anzuvisieren. Niemand wollte sich
dem Russen ergeben, doch der Weg der zu den Amerikanern führte, war durch abgesägte Bäume blockiert. Wir sind schnell
in das nächste Dorf gegangen, haben uns Sägen und Äxte besorgt, die Bäume durchgesägt und in den Straßengraben
geworfen.
“ Nach dem Ende des 2. Weltkrieges.”
In amerikanische Kriegsgefangenschaft
Dann fuhren wir unter internationaler Flagge an eine Mulde Brücke, vor der zwei amerikanische Soldaten, mit Zigarren,
zur Hälfte im Mund, standen. Sie rauchten und kauten gleichzeitig. Wir mussten auf einen freien Platz fahren, alle
aussteigen und rechts wieder antreten. Wäschebeutel und Tornister mussten wir abstellen; danach wurden wir nach Waffen
durchsucht, Wertsachen, Uhren und Messer wurden uns gleich abgenommen. Als wir anschließend an unserem Gepäck
vorbeigingen durfte niemand was mitnehmen. Als ich gebückt, nach meinem Wäschebeutel greifen wollte, in dem sich noch
3 Konservendosen und ein Brot befanden, bekam ich einen Fußtritt ins Gesicht, so dass mir ein Zahn ausgeschlagen wurde.
Wir wurden dann in einem Garten zusammen getrieben und gefragt ob jemand bei der SS gedient hat. Nachdem wir in Reihe
und Glied angetreten waren, mussten wir den Oberkörper freimachen und die Arme anheben. Es wurde nach SS-Zeichen
gesucht, die gewöhnlich unter dem Oberarm eintätowiert waren. Nachdem wir Grimma bei Leipzig, wo wir in amerikanische
Gefangenschaft geraten waren, verlassen hatten, mussten wir durch ganz Thüringen bis Hersfeld, an der Grenze zu Hessen,
marschieren. In Hersfeld wurden wir auf große Lastautos verladen, die von farbigen Soldaten gefahren wurden. Man hat
uns mit Stöcken hinauf getrieben, solange bis das Auto so voll war das man kaum stehen konnte. Die Soldaten fuhren, für
diese Straßenverhältnisse, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Wenn die Straße eine scharfe Kurve hatte, flogen
wir alle übereinander und mussten erst mit viel Kraftanstrengung auf die Beine kommen um diese Fahrt zu überstehen.
Da die Straßenränder in dieser Gegend mit Obstbäumen bepflanzt sind und deren Äste sehr niedrig hängen, hätten die
uns die Köpfe abgerissen, wenn wir uns nicht ständig geduckt hätten. Unsere Fahrt endete in Bad Kreuznach, in der Pfalz,
wo wir in ein Lager, in dem sich später 130.000 Mann und 6 Generäle befanden, eingepfercht wurden. Die Unterkunft der
Generäle befand sich unter einem Zelt, alle anderen mussten die Zeit unter freiem Himmel zubringen. Die Offiziere, die
Unteroffiziere, die Mannschaften; wurden in getrennten Camps untergebracht. Die Mannschaften wurden auch zur Arbeit
abkommandiert und konnten bei dieser Gelegenheit, Brot, Brötchen oder Zigarettenstummel organisieren, wogegen die
Offiziere und Unteroffiziere ihr Camp überhaupt nicht verlassen durften.
Die ersten Tage gab es kein Wasser und kein Brot, so dass die Kameraden vor Erschöpfung umfielen. Später standen wir
manchmal den ganzen Tag nach Wasser an, das von den, uns bewachenden Negern mit großen Wassertanks angefahren wurde. Am
dritten Tag bekamen wir mittags und abends etwas zu Essen; Brot bekamen wir erst nach zwei Wochen, nach dem aus der
Umgebung herbeigeholte Handwerker, Backöfen gebaut hatten. In den verschiedenen Gemeinden, die in den uns umgebenden
Weinbergen lagen, mussten sich alle Männer beim Bürgermeister melden. Als sie dann erschienen waren, wurden sie auf
bereitstehende Lastautos getrieben und zu uns ins Lager gebracht. Sie waren ohne Kopfbedeckung und ohne wärmere
Bekleidung angekommen, weil ihnen gesagt wurde, dass ihr Aufenthalt im Lager nur von kurzer Dauer sein würde. Man hat
uns, falls noch vorhanden, Decken und Mäntel abgenommen, mit der Begründung, sie würden für Kranke und Verwundete
gebraucht. Jeden Tag starben mehr als 200 Mann, die wir sofort in ein Zelt tragen mussten. In der Nacht wurden die
Toten dann mit unbekanntem Ziel, weggefahren.
Viele haben ihren Verstand verloren uns irrten im ganzen Camp ziellos umher. Als Latrinen wurden Gräben ausgehoben, in
die verschiedene Kameraden, bei der Verrichtung ihrer Notdurft, vor Schwäche hineingefallen sind und nicht mehr wieder
heraus kamen. Aus den Pfählen die, die jungen Obstbäume stützten, haben wir Krankentragen gebaut um unsere Kameraden,
bei Bedarf, zur Krankensammelstelle zu tragen. Es war in diesem Frühjahr auch sehr kalt, doch unsere Erdlöcher, die wir
zum Schutz vor Kälte und Wind, nur mit leeren Konservendosen ausgehoben hatten, durften nicht tiefer als 20 Zentimeter
sein. Nach jedem Regenguss mussten wir das Wasser ausschöpfen. Nach einem Gewitter, standen wir wiedermal, total
durchnässt in unserem Camp, als unerwartet am Horizont die Sonne hervortrat. Einer unserer Kameraden hatte noch eine
Trompete gerettet und fing, von dem Anblick völlig überwältigt, zu spielen an: "Es geht alles vorüber, es geht alles
vorbei, nach jedem Dezember, folgt wieder ein Mai". Daraufhin hob sich die Stimmung der tiefbetrübten Kriegsgefangenen,
so das Heimatlieder durch das ganze Camp erklangen, obwohl wir in den nassen Kleider herumgehen mussten, bis sie am
Körper trocken wurden.
Am ersten Weihnachtfeiertag wurde um 4:00 Uhr morgens ein Frühgottesdienst gehalten. Zuerst hat der Pfarrer eine Andacht gehalten, dann haben die Kinder ein Krippenspiel aufgeführt und die Gemeinde hat schöne Weihnachtslieder gesungen. Der Gastwirt Trzaska hat uns den Saal zur Verfügung gestellt. Wir hatten eine Posaunen- u. eine Gitarrengruppe. Unter der Leitung von Herrn Willi Doormann spielten: Gottlieb Brosch, Fritz Ollech, Gustav Rattay(Sopran), Wilhelm Pilath, Gustav Brosch(Alt), Fritz Both(Tenor) und Fritz Brosch(Bass). In der Gitarrengruppe wirkten mit: Martha Ollech, Hedwig Ollech, Martha Lekzik, Martha Michalick und Auguste Lekzick. Willy Doormann hat sie auf der Geige begleitet.
Bei der Aufstellung des Grenzschutzes(Regiment Buchholz), hat er als Hauptfeldwebel die
Gruppenführerkurse überwacht und selbst die fähigsten Männer dafür vorgeschlagen. Das Ausbildungspersonal hat das
Jäger-Battalion gestellt. Wir kamen zuerst ins Stadion(Waldheim), wurden da eingekleidet und dann ging es gleich
kasernenmäßig zu, theoretisch und praktisch. Jeder musste vor die Front treten und nachweisen ob er im Stande ist,
Befehle zu erteilen. Abends wurden Filme vorgeführt die uns zeigen sollten wie eine Gruppe sich im Gelände entfalten
muss. Die Exerziervorschriften hatten sich, im Verhältnis zu Kaiser Wilhelms Zeiten, etwas geändert. Damals bestand
eine Gruppe aus 8 Mann und einem Unteroffizier, jetzt aus 10 Schützen, 3 für das leichte Maschinengewehr und einem
Unteroffizier(13 Mann). Nach der Schulung folgte eine Abschlussprüfung, danach ein gemütliches Beisammensein. Aus
Rohmanen haben folgende Männer die Prüfung bestanden: Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy, Gustav Rattay und
Gustav Deptolla. Unsere Uniformen waren alle zu klein und es gab viel zu lachen bei der Anprobe.
Die erste Übung habe ich mit Emil Rosowski, in Lenzinen gemacht. Der Gutsbesitzer Marzinzick hat seine Scheune als
Unterkunft zur Verfügung gestellt. Er war im Range eines Hauptfeldwebels. In seinem haus war die Schreibstube
untergebracht, die er selbst verwaltete. Ein Lastauto hatte Uniformen aus der Kaserne in Ortelsburg geholt, jeder
musste eine Uniform anlegen und dann wurde solange getauscht bis alle eine passende gefunden hatten. An den Namen des
Kompanieführers kann ich mich nicht mehr erinnern. 1935 wurden wir zu einer Übung in die Dragonerkaserne nach Lyk
einberufen. Die Gruppenführer, Zugführer, und Kompanieführer die schon Frontberührung im dem Ersten Weltkrieg hatten,
mussten eine Woche früher anreisen. Die Übungen waren auf 6 Wochen angelegt. Die meisten der einberufenen waren noch
nie mit dem Wehrdienst in Berührung gekommen. Jeder Gruppenführer bekam 13 Mann zugeteilt.
Unser Zugführer war Leutnant Neumann, Kompanieführer Oberleutnant Rutschko, Battalions-Kommandeur Major Gröning
(Regiment Buchholz). Hier ging es wieder Kasernenmäßig voran. Das Bataillon wurde hier vereidigt. Jeden zweiten
Sonntag durften unsere Frauen uns besuchen. Ein Jahr später wurden wir wieder zu einer Übung einberufen, auf den
Truppenübungsplatz nach Arys. Jeder Gruppenführer hatte den Auftrag die Gruppe zu entfalten, und auf bewegliche
Figuren zu schießen. Diese Übung musste später mit scharfer Munition wiederholt werden. Jedes Maschinengewehr bekam
50 Schuss, jeder Schütze 20 Schuss zugeteilt. Nach dem Abschießen wurden die Treffer gezählt und dem Kommandierenden
Bericht erstattet. In einiger Entfernung spaziert ein Storch umher, der gar nicht bemerkt hatte dass geschossen wurde,
was bei den Kameraden ein großes Gelächter hervorrief.
Nach der Übung wurde uns gesagt das jeder Gruppenführer eine arische Abstammung nachweisen sollte. Ich konnte in den
Rheinsweiner Kirchenbüchern meine Vorfahren aus Gellen, bis zum Jahr 1732 zurück, nachweisen und wurde zum
Unteroffizier befördert. Aus unserem Dorf wurden auch, Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy und Gustav Deptolla
befördert. Zwischendurch mussten wir schon mal in die Radfahrer-Kaserne nach Ortelsburg, Gewehre empfangen und im
Gelände üben. Am 31 Juli 1939 wurde mir von einem Soldaten ein Schreiben übereicht, das mich aufforderte, am 1. August
um 6:00 Uhr, bei der 3. Kompanie, des 2. Infanterieregiments zu erscheinen.
Um 5:30 hat mich meine Schwester in die Kaserne gebracht. Auf der Schreibstube erklärte mir der Hauptfeldwebel,
dass mir ab sofort der Dienstgrad eines Sanitäters zugewiesen wird, ich mich in der Kammer einzukleiden hätte und mir
in der Handwerkerstube die entsprechenden Schulterklappen annähen lassen sollte. Die aktiven Sanitäter wurden den
Feldlazaretten zugewiesen und wir kamen an ihre Stelle. Unser Bataillon wurde nach Schodmak zum Bunker bauen und
Stacheldraht verlegen eingeteilt. Wir zogen in Begleitung einer Musikkapelle bis zur Kreuzung am Krankenhaus, dann
weiter zu unserem Bestimmungsort, gefolgt von einer Gulaschkanone die in den nächsten Tagen für unsere Verpflegung
sorgen sollte.
Am 14 August haben wir die Jägerkaserne, begleitet von einer Musikkapelle endgültig verlassen und zogen zuerst durch
Ortelsburg, dann über Lehmanen ins Feldmanöver, hinter Rohmanen. Dort entfaltete sich das Bataillon im Gelände, die
Verwundetensammelstelle wurde auf dem Hof des Bauern Friedrich Neumann eingerichtet. Gegen Abend wurde zu Sammeln
geblasen und Biwak bezogen, wobei unsere 3.Kompanie, in einem kleinen Wallt, in der Nähe von Otto Nickels Gehöft
Stellung bezogen hatte. Die 2. und 4. Kompanie hatte sich in der Nähe vom Abbau Pallasch niedergelassen. Die Frau
Nickel hat am Abend ein Mädel in Dorf geschickt um meiner Frau Bescheid zu sagen, wo wir uns zurzeit befinden. Meine
Frau ist dann noch gekommen um sich von mir zu verabschieden, weil wir am nächsten Morgen um 3:00 Uhr Zelte abbrechen
und um 4:00 Uhr in Richtung Kaspersguth marschieren sollten.
Wir sind dann über Achodden, Seelonken, Lehmanen, Ortelsburg, bis nach Grammen und Schützendorf marschiert, wo wir an
einem See Biwak bezogen haben. Es wurde immer gesagt, wir kommen zum Tannenberg-Denkmal bei Hohenstein, wo ein Reichs
Kriegervereinsfest stattfinden sollte. Es wurden auch schon Vorkommandos aufgestellt, doch dann kamen wir nach Orlau
und Lahna-Mühle, da wo die Alle entspringt haben wir 2 Tage biwakiert. Unser Kompanieführer hat uns nach Waplitz auf
den Soldatenfriedhof des Ersten Weltkrieges geführt und uns erklärt wie das Jägerbataillon sich 1914 hier entfaltet
hat und aufgerieben wurde. Dann mussten wir in der Nähe von Gut Koslau über einen Fluss und bezogen in einem Waldstück,
vorbereitete Stellungen in der Nähe der polnischen Grenze. Herr und Frau Thalmann haben uns jeden Tag, bis zur Grenze,
mit Brötchen und Getränken versorgt. Es wurde scharfe Munition ausgegeben, weil wir am nächsten Morgen um 4:00 Uhr die
polnische Grenze überschreiten sollten.
Am nächsten Morgen um 10 Minuten vor 4:00 Uhr kam der Befehl; scharfe Munition abgeben, alles zurück in ein 6 Kilometer
entferntes Dorf, wo wir auch einquartiert wurden. Das alles geschah’ eine Woche vor dem 1. September 1939. Es wurde
gesagt dass der Führer dem polnischen Präsidenten Rid-Szmigly, ein Ultimatum gestellt hat und es wahrscheinlich nicht
zum Krieg mit Polen kommt. Genau nach 5 Tagen kehrten wir wieder in die gleichen Stellungen zurück, es wurde wieder
scharfe Munition ausgegeben und am nächsten Morgen um 4:00 Uhr überschritten wir die polnische Grenze.
“Der 2. Weltkrieg.”
Der erste Einsatz in Polen
Wir kamen zuerst in ein Dorf in dem sich nur alte Menschen befanden. Auf unsere Frage wo denn die Bewohner wären sagte
man uns dass alle geflohen sind, weil erzählt wurde, die Deutschen würden alle Polen misshandeln und verstümmeln. Ich
habe ihnen daraufhin gesagt dass uns, unter Androhung von Strafe verboten wurde, einem Zivilisten etwas anzutun. Das
Vieh, die Schweine und Hunde des Dorfes liefen frei herum und die Soldaten fingen an auf die Hunde zu schießen, bis
gesagt wurde es seien Meldehunde im Dienste der Deutschen Wehrmacht und dieser Unfug der eigenen Truppe schaden würde,
weil etwaige Querschläger eigene Kameraden verletzen könnten. Wir gingen weiter auf polnischer Seite entlang der Grenze,
bis wir am Nachmittag die ersten Vorposten der Festung Mlawa erreichten, da befanden wir uns plötzlich im Feuerhagel
polnischer Festungsflack.
Am nächsten Morgen hatte ich schon 3 Verwundete und wusste nicht wo sich eine Verwundeten Sammelstelle befindet. Ich
suchte den Bataillonsgefechtstand auf der sich auf einer Anhöhe befand. Ich habe unseren Oberstabsarzt gefragt wo denn
die Verwundetensammelstelle wäre. Er rief beim Tross an, wo er die Auskunft erhielt, das sich vor dem Dorf ein Bunker
befindet in dem man die Verwundeten sammeln sollte, die dann von Sanitätsautos abgeholt würden, weil das Dorf unter
Artilleriebeschuss stand. Am Sonnabend haben unsere Flieger die Bunkerstellungen bombardiert, konnten aber, trotz guter
Treffer nicht viel ausrichten, die Bunker wurden nur etwas angekratzt.
Der Beschuss unserer vordersten Linien ging mit unverminderter Heftigkeit weiter. Am Sonntag verkündete eine große
Staubwolke die Ankunft unserer Panzer, doch sie kamen nur bis zur Panzersperre und mussten wieder abdrehen ohne den
Polen einen schaden zuzufügen. Ein Panzer bekam einen Volltreffer, der Fahrer konnte noch umkehren. Er blutete am Kopf
und der Schütze war so eingeklemmt, das wir ihn nur mit einem Seil unter den Armen, durch die Luke nach oben ziehen
konnten. Ob er seine Verwundung überlebt hat ist mir nicht bekannt, denn in der Nacht wurden Panzergeschütze nach
vorne in Stellung gebracht, die direkt in die Schießscharten der Bunker geschossen und so die Verteidiger vertrieben
haben. Daraufhin sind wir weiter vorgerückt. Auf einer Wiese war ein tiefer Graben ausgehoben und mit Ästen getarnt,
da war ein Panzer hinein gefahren, so dass nur das Hinterteil herausragte und er sich nicht aus eigner Kraft befreien
konnte. In der Luft waren Flieger die Brandbomben abwarfen, ich habe mich auf den Boden geworfen weil ich dachte die
würden explodieren, aber sie zischten nur, so das Stoppeln und Graß rings herum in Brand gerieten.
Bei den Kampfhandlungen gab es mehrere Verwundete, denen ich gerade Verbände anlegen wollte, als unser Hauptmann zur
Trillerpfeife griff um mir klar zu machen, dass ich ihm folgen sollte. Die Polen fingen an zu schreien, ich sollte
sie ins Lazarett bringen denn hier im Wald würde sie niemand finden. Ich setzte mich aufs Fahrrad und folgte unserem
Kompanieführer, der mir sagte ich soll immer bei der kämpfenden Truppe bleiben, denn hinter der Front sind die
Sanitätsabteilungen, die werden die Verwundeten schon versorgen. Der Vormarsch dauerte bis in die späte Nacht. Auf
einem Gehöft, das nach allen Seiten durch Feldwachen abgesichert wurde, machten wir endlich Rast. Wir haben
Getreidegarben auf dem Hof ausgebreitet und uns zur Ruhe gelegt, als plötzlich um Mitternacht Leuchtraketen den Himmel
erhellten und Maschinengewehrfeuer uns aus dem Schlaf schreckte. Ein par polnische Soldaten hatten das Feuer eröffnet,
aber sich kurz darauf ergeben.
Die Narew-Überquerung
Als es hell wurde ging der Vormarsch weiter. Es wurde uns untersagt Tagebuch zu führen, darum
weiß ich nicht wie die Orte hießen, durch die wir marschiert sind. Als wir durch ein sumpfiges Gelände vor drangen
stand auf einer Anhöhe am Horizont, die polnische Artillerie, die uns sofort unter Beschuss nahm. Unser Hauptmann war
der Meinung dass wir schon in der Nähe des Flusses Narew sein müssten, als aus den Sträuchern ein mit Schlauchboten
beladenes Lastauto auftauchte. Wir wurden aufgefordert mit je 6 Mann ein Schlauchboot zu nehmen, an einem Aggregat
der daneben stand mit Luft zu füllen und zu Wasser zu lassen. In einer Stunde war das ganze Bataillon über die Narew,
wo der Vormarsch fortgesetzt wurde. In einem Dorf überraschte uns die polnische Kavallerie und fing sofort mit
Maschinengewehren zu schießen an. Da kam der Befehl: Alles wieder zurück. Es ging noch schneller als auf der Hinfahrt.
Wir sind erst einige Kilometer am Fluss entlang gegangen und haben dann zum zweiten Mal rüber gesetzt.
Die Gehöfte im Dorf standen alle in Brand. Auf einem waren viele Bienestöcke. 2 Kameraden wollten den Stöcken Waben
entnehmen, doch die Bienen durch das Feuer aufgeschreckt, überfielen sie sofort und stachen derart zu das sie nicht
mehr wieder zu erkennen waren. Ich habe die Einstichstellen mit Salmiak betupft, mehr konnte ich nicht tun. Wir mussten
auf unserem Vormarsch durch einen Wald der in Flammen stand, so dass man kaum atmen konnte. Es ging weiter in Richtung
Minsk und Warschau, wo schon die Sowjetische Armee durchgegangen war, die Pferde und Vieh von einem Gut mitgenommen
hatten. In einem Wald stießen wir unverhofft auf ein Kloster, in dem wir einige Gefangene machten. Dann trafen wir auf
eine gute Straße die nach Grochow ging.
Als wir dort einmarschierten wurden wir aus den oberen Stockwerken beschossen, so dass wir, um uns zu schützen, nur an
den Hauswänden entlang gehen konnten. Wir haben jedes Haus nach Feinden durchsucht. Vor einem Haus stand ein Hund der
niemanden reinlassen wollte, solange bis ihn eine Kugel traf. Die polnische Artillerie feuerte von Warschau aus, um
unseren Vormarsch zu stoppen. Wir hatten uns gerade eingegraben als plötzlich deutsche Flieger am Himmel erschienen,
die unsere Stellungen mit Bomben bewarfen und dabei viel Unheil anrichteten. Wir haben sofort Fliegertücher
ausgebreitet und Leuchtraketen abgeschossen. Da ich in dem Graben, den ich kurz zuvor ausgehoben hatte, sofort in
Deckung gegangen bin ist mir zum Glück nichts passiert. Unter den anderen Kameraden gab es viele Verwundete, so dass
ich nicht wusste wem ich zuerst helfen sollte.
Der Oberstabsarzt hat mich sofort tatkräftig unterstützt, so das bald alle Verwundeten versorgt waren, außer einem,
dem ein Bombensplitter den Arm abgerissen hat. Ich habe im 3 große Verbandspäckchen auf die Wunde gelegt, doch die
Blutung ließ sich trotzdem nicht stoppen, so dass er eine Stunde später auf der Krankensammelstelle verstarb. Wir
haben danach in einem Tomatenfeld einen Graben ausgehoben und eine neue Abwehrstellung bezogen. Die Gruppe Schwarz
bekam den Auftrag nach etwaigen versprengten polnischen Verbänden Ausschau zu halten, als sie unerwartet aus einer
Häuserreihe mit Maschinengewehrsalven überschüttet wurden. Der Gruppenführer und noch ein Soldat wurden dabei tödlich
verwundet. Danach wurde noch ein weiter Stoßtrupp, unter der Führung von Leutnant Briskorn, der sich dazu freiwillig
gemeldet hatte, hinaus geschickt um den Gruppenführer und den anderen Toten zu bergen.
Bei diesem Unternehmen, das erfolglos ausging, weil die Toten schon verscharrt waren, durchschlug eine Kugel den
Stahlhelm von Leutnant Briskorn, der auch sofort tot war. Alle Toten wurden später, an der Kirchenmauer in Grochow, in
Särgen beigesetzt: Hauptmann Schönwald sagte, das sie nach dem Kriege auf den Heldenfriedhof nach Ortelsburg überführt
werden. Drei Tage lagen wir bei Grochow in Stellungen, waren dem polnischen Maschinengewehrfeuer sowie den Bomben
deutscher Flugzeuge ausgesetzt. In der Nacht musste ich zu einem Verwundeten in die vorderste Linie und habe den
Rückweg nicht mehr finden können, als plötzlich Gewehrfeuer aufflammte habe ich in den Ruinen Schutz gesucht. Erst im
Morgengrauen konnte ich mich wieder orientieren und zu meinem Unterstand zurückfinden.
Warschau wurde tagelang bombardiert und stand auch unter Artilleriebeschuss. Aus dunklen Rauchwolken kamen oft ganze
Bündel von Papier angeflogen. Die Verwundeten kamen oft auf Krücken zu unserem Unterstand, ich habe sie dann zur
Krankensammelstelle hingeführt. Wir haben auch polnische Zivilpersonen betreut, die während der Kampfhandlungen
verwundet wurden. Als einmal 2 Jungen vorbeiliefen hat einer ihnen nachgerufen sie sollten seiner Frau Bescheid sagen,
er wäre auf der Krankensammelstelle an der Kirche. Als wir dort ankamen war seine Frau, mit einem Kind auf dem Arm,
schon da.
Nach der Kapitulation von Warschau, gingen wir über Sokolow zum Bug und haben dort Quartier bezogen. Der Russe hatte
sich bereits hinter den Fluss zurückgezogen, hatte alles Vieh und Pferde mitgenommen. Dort erreichte mich ein Telegramm
von zu Hause, dass meine Tochter gestorben ist. Es sprach sich auch herum dass verschiedene Heimaturlaub bekommen haben,
ich durfte auch für 14 Tage heim. Wir fuhren mit Lastautos nach Allenstein in die neue Reiterkaserne, zum
Ersatzbatallion, da haben wir unsere Gewehre und Munition abgeben, dann durften wir, jeder in seinen Heimatort
weiterfahren.
Als wir unsere Quartiere am Bug verlassen haben war sehr viel Schnee gefallen. Hier in Ortelsburg fanden wir die
gleiche Wetterlage vor, aber nach 3 Tagen war alles wieder weggetaut und wir konnten die Kartoffelernte, die durch den
frühen Wintereinbruch gestoppt wurde, zu Ende bringen. Ein Tag bevor ich zu Hause angekommen bin wurde die Tochter
beerdigt. Nach 14 Tagen mussten wir uns in Allenstein melden, Gewehre empfangen und wieder zurück zur Division an den
Bug 150 Kilometer hinter Warschau. Die elfte Division, zu der wir auch gehörten sollte in den Westen Deutschlands
verlegt werden und war schon unterwegs zur Verladestation Skiernewice 50 Kilometer vor Warschau.
Mein Dienst als Sanitätsunteroffizier
Unser Bataillon kam in das Städtchen Burscheid, im Kreis Opladen, wo wir in Privatquartieren
untergebracht wurden. Nach 3 Monaten, im Januar 1940, wurden wir nach Solingen verlegt, wo wir bis zum
Frankreichfeldzug stationiert waren. Wir mussten an Feldübungen teilnehmen, wie andere die in Kasernen untergebracht
waren. Während dieser Zeit musste jeder seine Zähne in Ordnung bringen lassen. Jeden Tag fuhren 20 Mann in die
Cäzilienstraße nach Köln, zur Zahnklinik. Im Rheinland wurde unsere Division neu aufgestellt. Ausfälle durch den
Polenfeldzug wurden durch neue Soldaten ergänzt. Ich kam nun zum Ersatzbatallion, war der Älteste in der ganzen
Kompanie. Als der Frankreichfeldzug losging wurde unser Ersatzbatallion mit den noch vorhandenen Verwundeten, in die
neue Reiterkaserne, nach Allenstein verlegt.
Meine Frau hat, mit Unterstützung der Bauernschaft, einen Antrag gestellt, daraufhin wurde ich zur Frühjahrsbestellung,
beurlaubt und später bis auf weiteres vom Militärdienst freigestellt. Als der Russlandfeldzug losging wurde ich von der
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg, für 14 Tage einberufen. Ich war seit 1922, Mitglied der freiwilligen
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg und habe jedes Jahr an Übungen teilgenommen. Jede Bereitschaft musste etliche Leute
stellen. Von Rohmanen wurden Emil Rosowski, Johann Dembek, und ich, zur Krankensammelstelle Wirballen, in Litauen,
abkommandiert. Dorthin kamen Lazarettzüge aus Russland mit der Breitspurbahn. Die Verwundeten wurden frisch verbunden
und auf Waggon mit Normalspur verladen und nach Deutschland gebracht.
Als die 14 Tage vergangen waren wollten wir wieder nach Haus zurück, doch man wollte uns nicht entlassen. Stattdessen
wurden wir dem Wehrkreisamt Königsberg zugeteilt, neu eingekleidet und zur Aushilfe ins Lazarett nach Gumbinnen
abkommandiert. Mehr als ein Jahr war ich in den Urlauber-Baracken, habe dort Krankenstube betreut. Später, bis zum
Dezember 1944, war ich im Reserve-Lazarett 4, in Königsberg tätig. Dort habe ich auch die Luftangriffe der Engländer,
vom 25 bis 26. August 1944 miterlebt.
Wir sollten gerade einen Lazarettzug in Rotenstein entladen, als plötzlich die Sirenen ertönten - Fliegeralarm. Im
gleichen Moment waren die ersten Flugzeuge auch schon da, zuerst warfen sie „Tannenbäume” und danach Foßforkanister ab.
Die Omnibusse standen schon zur Abfahrt bereit als es losging. Wir haben die Verwundeten schnell in den
Luftschutzkeller getragen, haben die Betten von den Fenstern weggerückt damit die Verwundeten nicht von den
Glasssplittern verletzt wurden. Im Kasernenhof brannten die Fosforkanister lichterloh. Unsere Unterkunft, die sich in
einer Baracke befand ist völlig abgebrannt, mit dem Wenigen was wir unser Eigen nannten. Am nächsten Tag wurden wir neu
eingekleidet und am 29. bis 30. kamen die englischen Bomber wieder, sie setzten genau da ihr Zerstörungswerk fort wo
sie vor 3 Tagen aufgehört hatten.
Anfang Dezember 1944 musste ich mich nach Stablack melden und musste dann zur Sanitätsabteilung 1, nach Gernau, das
liegt zwischen Lodz und Warschau. Vormittags hatten wir Felddienstübungen und nachmittags theoretischen Unterricht.
Jeden Tag wurden Gruppen zusammengestellt und zu anderen Einheiten abkommandiert. Ich kam zu einer Panzerabteilung, wo
wir an einem Morgen plötzlich auf dem Kasernenhof antreten mussten und zu unserer Überraschung mit der Nachricht
konfrontiert wurden, dass der Russe an mehreren Frontabschnitten durchgebrochen war. Wir bekamen sofort einen
Marschbefehl in Richtung Lodz, wo das Stadtbild noch intakt war, selbst die Straßenbahnen fuhren noch. In der Nacht
haben russische Flugzeuge die Stadt bombardiert. Die Kaserne in der wir untergebracht waren hatte keine
Luftschutzkeller, aber zum Glück blieben wir von Bombentreffern verschont. Am nächsten morgen bot sich uns ein Bild der
Verwüstung. Die entgleisten Straßenbahnwagen, sowie andere Fahrzeuge blockierten die Straßen. Die Älteren unter uns
bekamen Fahrscheine für einen Transportzug, der bereit hinter Lodz abfahrbereit, unter Dampf stehen sollte. Als
russische Panzer in den Straßen auftauchten, verbrannte die Schreibstube unsere Wehrpässe und andere wichtige
Dokumente. Wir liefen zu der Station auf der unser Transportzug bereitstehen sollte, aber da war kein Zug mehr zu sehen
und wir setzten unseren Rückzug zu Fuß fort.
Der Rückzug und Zusammenbruch der Ostfront
In Dobroschin, einer Stadt in Polen, wurde gerade ein Lazarettzug verladen, doch wir kamen nicht
mehr zum Einsatz, weil die russische Infanterie uns schon auf den Fersen war. Es ging weiter über den Fluss Bober,
Sagan, bis nach Glogau an der Oder. Dort wurden wir der 29. motorisierten Sanitätskompanie zugeteilt. Im
Garnisonslazarett wurden noch Operationen durchgeführt. Unsere Division hatte ihr eigenes Feldlazarett, so dass wir den
Befehl zu Weiterfahrt erhielten und noch unbeschadet die Oderbrücke passieren konnten, denn Glogau wurde zur Festung
erklärt. Wir haben 2 Pferdewagen organisiert und mit Verbänden, sowie medizinischen Instrumenten beladen. So kamen wir
bis nach Lübbenau im Spreewald, wo wir in einem Schloss, in zuvor ein Museum war, unser Lazarett untergebracht haben.
Weil die Amerikaner Cottbus bombardiert hatten, wurden die Verwundeten zu uns nach Lübbenau gebracht. Hier haben wir
Tag und Nacht gearbeitet, um die vielen Verwundeten, aus den schweren Kämpfen bei Grünberg und Sagan zu versorgen. Die
Soldaten von der Abwehrfront kamen schon mit abgestorbenen Armen oder Beinen bei uns an, weil in vorderster Linie keine
Frontlazarette mehr vorhanden waren; es mussten viele Amputationen durchgeführt werden. Als für unsere Pferde kein Heu
mehr vorhanden war, schickte mich unser Hauptfeldwebel, zu einem Bauern in den Spreewald, mit dem Auftrag, Futter zu
besorgen. Mit noch zwei Mann fuhren mit zwei Kähnen, zuerst den Hauptstrom entlang und dann in einen Nebenarm; da haben
wir die Boote beladen und brachten das Heu nach Lübbenau.
Als wir uns bei unser Einheit zurück melden wollten, war alles schon marschbereit. Ich bin schnell in einen Bus
eingestiegen der sofort losfuhr, weil russische Verbände schon in sichtweite waren. Russische Flugzeuge kreisten über
den Dächern und nahmen, mit ihren Bordwaffen jeden unter Beschuss, der sich irgendwo blicken ließ. Wir konnten nur
durch den Wald, oder in der Nacht vorwärts kommen, denn wenn ein Auto auf der Landstraße fuhr, war alsbald ein Flugzeug
hinter ihm her und schoss es in Brand. Als wir nach Tagen am Ufer der Elbe ankamen, war bereits eine Ponton-Brücke
erstellt worden, welche die zerstörte Brücke ersetzen sollte.
Durch die vielen Fahrzeuge waren in den Sand tiefe Spuren gefahren, so dass andere Fahrzeuge unsere Busse ins
Schlepptau nehmen mussten, weil wir mit eigener Kraft nicht mehr weiterkamen. Beiderseits der Trasse standen
Flüchtlingswagen, in der der Hoffnung die Brücke passieren zu können, doch SS-Polizei verhinderte das die Gespanne den
militärischen Rückzug zum Stillstand brachten. Es gelang uns die Elbe zu überqueren, um in einem Waldstück Schutz vor
feindlichen Fliegern zu suchen.
Als wir unsere Busse und Autos gut getarnt hatten, hat unser Bataillonschef die anwesenden Parteigrößen zu sich
gerufen und ihnen erklärt das wir eine Einheit des Roten Kreuzes sind und nach internationalem Recht keine Waffen
besitzen dürfen. Nach langer, erregter Diskussion wurde beschlossen einen Graben auszuheben und alles im Sand zu
verscharren. Als wir dann weiter, durch die Dörfer fuhren, sahen wir schon viele weiße Bettlaken, als Zeichen der
Kapitulation, aus den Fenstern hängen. Es wurde uns erzählt dass der Bürgermeister von der SS erschossen wurde, weil
er die Bevölkerung zu diesem Schritt ermutigt hatte. Jetzt waren hinter uns die Russen und vor uns schon die Amerikaner.
Amerikanische Panzer fuhren umher und schossen wild durch die Gegend, ohne ein Ziel anzuvisieren. Niemand wollte sich
dem Russen ergeben, doch der Weg der zu den Amerikanern führte, war durch abgesägte Bäume blockiert. Wir sind schnell
in das nächste Dorf gegangen, haben uns Sägen und Äxte besorgt, die Bäume durchgesägt und in den Straßengraben
geworfen.
“ Nach dem Ende des 2. Weltkrieges.”
In amerikanische Kriegsgefangenschaft
Dann fuhren wir unter internationaler Flagge an eine Mulde Brücke, vor der zwei amerikanische Soldaten, mit Zigarren,
zur Hälfte im Mund, standen. Sie rauchten und kauten gleichzeitig. Wir mussten auf einen freien Platz fahren, alle
aussteigen und rechts wieder antreten. Wäschebeutel und Tornister mussten wir abstellen; danach wurden wir nach Waffen
durchsucht, Wertsachen, Uhren und Messer wurden uns gleich abgenommen. Als wir anschließend an unserem Gepäck
vorbeigingen durfte niemand was mitnehmen. Als ich gebückt, nach meinem Wäschebeutel greifen wollte, in dem sich noch
3 Konservendosen und ein Brot befanden, bekam ich einen Fußtritt ins Gesicht, so dass mir ein Zahn ausgeschlagen wurde.
Wir wurden dann in einem Garten zusammen getrieben und gefragt ob jemand bei der SS gedient hat. Nachdem wir in Reihe
und Glied angetreten waren, mussten wir den Oberkörper freimachen und die Arme anheben. Es wurde nach SS-Zeichen
gesucht, die gewöhnlich unter dem Oberarm eintätowiert waren. Nachdem wir Grimma bei Leipzig, wo wir in amerikanische
Gefangenschaft geraten waren, verlassen hatten, mussten wir durch ganz Thüringen bis Hersfeld, an der Grenze zu Hessen,
marschieren. In Hersfeld wurden wir auf große Lastautos verladen, die von farbigen Soldaten gefahren wurden. Man hat
uns mit Stöcken hinauf getrieben, solange bis das Auto so voll war das man kaum stehen konnte. Die Soldaten fuhren, für
diese Straßenverhältnisse, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Wenn die Straße eine scharfe Kurve hatte, flogen
wir alle übereinander und mussten erst mit viel Kraftanstrengung auf die Beine kommen um diese Fahrt zu überstehen.
Da die Straßenränder in dieser Gegend mit Obstbäumen bepflanzt sind und deren Äste sehr niedrig hängen, hätten die
uns die Köpfe abgerissen, wenn wir uns nicht ständig geduckt hätten. Unsere Fahrt endete in Bad Kreuznach, in der Pfalz,
wo wir in ein Lager, in dem sich später 130.000 Mann und 6 Generäle befanden, eingepfercht wurden. Die Unterkunft der
Generäle befand sich unter einem Zelt, alle anderen mussten die Zeit unter freiem Himmel zubringen. Die Offiziere, die
Unteroffiziere, die Mannschaften; wurden in getrennten Camps untergebracht. Die Mannschaften wurden auch zur Arbeit
abkommandiert und konnten bei dieser Gelegenheit, Brot, Brötchen oder Zigarettenstummel organisieren, wogegen die
Offiziere und Unteroffiziere ihr Camp überhaupt nicht verlassen durften.
Die ersten Tage gab es kein Wasser und kein Brot, so dass die Kameraden vor Erschöpfung umfielen. Später standen wir
manchmal den ganzen Tag nach Wasser an, das von den, uns bewachenden Negern mit großen Wassertanks angefahren wurde. Am
dritten Tag bekamen wir mittags und abends etwas zu Essen; Brot bekamen wir erst nach zwei Wochen, nach dem aus der
Umgebung herbeigeholte Handwerker, Backöfen gebaut hatten. In den verschiedenen Gemeinden, die in den uns umgebenden
Weinbergen lagen, mussten sich alle Männer beim Bürgermeister melden. Als sie dann erschienen waren, wurden sie auf
bereitstehende Lastautos getrieben und zu uns ins Lager gebracht. Sie waren ohne Kopfbedeckung und ohne wärmere
Bekleidung angekommen, weil ihnen gesagt wurde, dass ihr Aufenthalt im Lager nur von kurzer Dauer sein würde. Man hat
uns, falls noch vorhanden, Decken und Mäntel abgenommen, mit der Begründung, sie würden für Kranke und Verwundete
gebraucht. Jeden Tag starben mehr als 200 Mann, die wir sofort in ein Zelt tragen mussten. In der Nacht wurden die
Toten dann mit unbekanntem Ziel, weggefahren.
Viele haben ihren Verstand verloren uns irrten im ganzen Camp ziellos umher. Als Latrinen wurden Gräben ausgehoben, in
die verschiedene Kameraden, bei der Verrichtung ihrer Notdurft, vor Schwäche hineingefallen sind und nicht mehr wieder
heraus kamen. Aus den Pfählen die, die jungen Obstbäume stützten, haben wir Krankentragen gebaut um unsere Kameraden,
bei Bedarf, zur Krankensammelstelle zu tragen. Es war in diesem Frühjahr auch sehr kalt, doch unsere Erdlöcher, die wir
zum Schutz vor Kälte und Wind, nur mit leeren Konservendosen ausgehoben hatten, durften nicht tiefer als 20 Zentimeter
sein. Nach jedem Regenguss mussten wir das Wasser ausschöpfen. Nach einem Gewitter, standen wir wiedermal, total
durchnässt in unserem Camp, als unerwartet am Horizont die Sonne hervortrat. Einer unserer Kameraden hatte noch eine
Trompete gerettet und fing, von dem Anblick völlig überwältigt, zu spielen an: "Es geht alles vorüber, es geht alles
vorbei, nach jedem Dezember, folgt wieder ein Mai". Daraufhin hob sich die Stimmung der tiefbetrübten Kriegsgefangenen,
so das Heimatlieder durch das ganze Camp erklangen, obwohl wir in den nassen Kleider herumgehen mussten, bis sie am
Körper trocken wurden.
Unser Zugführer war Leutnant Neumann, Kompanieführer Oberleutnant Rutschko, Battalions-Kommandeur Major Gröning
(Regiment Buchholz). Hier ging es wieder Kasernenmäßig voran. Das Bataillon wurde hier vereidigt. Jeden zweiten
Sonntag durften unsere Frauen uns besuchen. Ein Jahr später wurden wir wieder zu einer Übung einberufen, auf den
Truppenübungsplatz nach Arys. Jeder Gruppenführer hatte den Auftrag die Gruppe zu entfalten, und auf bewegliche
Figuren zu schießen. Diese Übung musste später mit scharfer Munition wiederholt werden. Jedes Maschinengewehr bekam
50 Schuss, jeder Schütze 20 Schuss zugeteilt. Nach dem Abschießen wurden die Treffer gezählt und dem Kommandierenden
Bericht erstattet. In einiger Entfernung spaziert ein Storch umher, der gar nicht bemerkt hatte dass geschossen wurde,
was bei den Kameraden ein großes Gelächter hervorrief.
Nach der Übung wurde uns gesagt das jeder Gruppenführer eine arische Abstammung nachweisen sollte. Ich konnte in den
Rheinsweiner Kirchenbüchern meine Vorfahren aus Gellen, bis zum Jahr 1732 zurück, nachweisen und wurde zum
Unteroffizier befördert. Aus unserem Dorf wurden auch, Karl Pelkowski, Wilhelm Pilath, Fritz Kiy und Gustav Deptolla
befördert. Zwischendurch mussten wir schon mal in die Radfahrer-Kaserne nach Ortelsburg, Gewehre empfangen und im
Gelände üben. Am 31 Juli 1939 wurde mir von einem Soldaten ein Schreiben übereicht, das mich aufforderte, am 1. August
um 6:00 Uhr, bei der 3. Kompanie, des 2. Infanterieregiments zu erscheinen.
Um 5:30 hat mich meine Schwester in die Kaserne gebracht. Auf der Schreibstube erklärte mir der Hauptfeldwebel,
dass mir ab sofort der Dienstgrad eines Sanitäters zugewiesen wird, ich mich in der Kammer einzukleiden hätte und mir
in der Handwerkerstube die entsprechenden Schulterklappen annähen lassen sollte. Die aktiven Sanitäter wurden den
Feldlazaretten zugewiesen und wir kamen an ihre Stelle. Unser Bataillon wurde nach Schodmak zum Bunker bauen und
Stacheldraht verlegen eingeteilt. Wir zogen in Begleitung einer Musikkapelle bis zur Kreuzung am Krankenhaus, dann
weiter zu unserem Bestimmungsort, gefolgt von einer Gulaschkanone die in den nächsten Tagen für unsere Verpflegung
sorgen sollte.
Am 14 August haben wir die Jägerkaserne, begleitet von einer Musikkapelle endgültig verlassen und zogen zuerst durch
Ortelsburg, dann über Lehmanen ins Feldmanöver, hinter Rohmanen. Dort entfaltete sich das Bataillon im Gelände, die
Verwundetensammelstelle wurde auf dem Hof des Bauern Friedrich Neumann eingerichtet. Gegen Abend wurde zu Sammeln
geblasen und Biwak bezogen, wobei unsere 3.Kompanie, in einem kleinen Wallt, in der Nähe von Otto Nickels Gehöft
Stellung bezogen hatte. Die 2. und 4. Kompanie hatte sich in der Nähe vom Abbau Pallasch niedergelassen. Die Frau
Nickel hat am Abend ein Mädel in Dorf geschickt um meiner Frau Bescheid zu sagen, wo wir uns zurzeit befinden. Meine
Frau ist dann noch gekommen um sich von mir zu verabschieden, weil wir am nächsten Morgen um 3:00 Uhr Zelte abbrechen
und um 4:00 Uhr in Richtung Kaspersguth marschieren sollten.
Wir sind dann über Achodden, Seelonken, Lehmanen, Ortelsburg, bis nach Grammen und Schützendorf marschiert, wo wir an
einem See Biwak bezogen haben. Es wurde immer gesagt, wir kommen zum Tannenberg-Denkmal bei Hohenstein, wo ein Reichs
Kriegervereinsfest stattfinden sollte. Es wurden auch schon Vorkommandos aufgestellt, doch dann kamen wir nach Orlau
und Lahna-Mühle, da wo die Alle entspringt haben wir 2 Tage biwakiert. Unser Kompanieführer hat uns nach Waplitz auf
den Soldatenfriedhof des Ersten Weltkrieges geführt und uns erklärt wie das Jägerbataillon sich 1914 hier entfaltet
hat und aufgerieben wurde. Dann mussten wir in der Nähe von Gut Koslau über einen Fluss und bezogen in einem Waldstück,
vorbereitete Stellungen in der Nähe der polnischen Grenze. Herr und Frau Thalmann haben uns jeden Tag, bis zur Grenze,
mit Brötchen und Getränken versorgt. Es wurde scharfe Munition ausgegeben, weil wir am nächsten Morgen um 4:00 Uhr die
polnische Grenze überschreiten sollten.
Am nächsten Morgen um 10 Minuten vor 4:00 Uhr kam der Befehl; scharfe Munition abgeben, alles zurück in ein 6 Kilometer
entferntes Dorf, wo wir auch einquartiert wurden. Das alles geschah’ eine Woche vor dem 1. September 1939. Es wurde
gesagt dass der Führer dem polnischen Präsidenten Rid-Szmigly, ein Ultimatum gestellt hat und es wahrscheinlich nicht
zum Krieg mit Polen kommt. Genau nach 5 Tagen kehrten wir wieder in die gleichen Stellungen zurück, es wurde wieder
scharfe Munition ausgegeben und am nächsten Morgen um 4:00 Uhr überschritten wir die polnische Grenze.
Um 5:30 hat mich meine Schwester in die Kaserne gebracht. Auf der Schreibstube erklärte mir der Hauptfeldwebel,
dass mir ab sofort der Dienstgrad eines Sanitäters zugewiesen wird, ich mich in der Kammer einzukleiden hätte und mir
in der Handwerkerstube die entsprechenden Schulterklappen annähen lassen sollte. Die aktiven Sanitäter wurden den
Feldlazaretten zugewiesen und wir kamen an ihre Stelle. Unser Bataillon wurde nach Schodmak zum Bunker bauen und
Stacheldraht verlegen eingeteilt. Wir zogen in Begleitung einer Musikkapelle bis zur Kreuzung am Krankenhaus, dann
weiter zu unserem Bestimmungsort, gefolgt von einer Gulaschkanone die in den nächsten Tagen für unsere Verpflegung
sorgen sollte.
Am 14 August haben wir die Jägerkaserne, begleitet von einer Musikkapelle endgültig verlassen und zogen zuerst durch
Ortelsburg, dann über Lehmanen ins Feldmanöver, hinter Rohmanen. Dort entfaltete sich das Bataillon im Gelände, die
Verwundetensammelstelle wurde auf dem Hof des Bauern Friedrich Neumann eingerichtet. Gegen Abend wurde zu Sammeln
geblasen und Biwak bezogen, wobei unsere 3.Kompanie, in einem kleinen Wallt, in der Nähe von Otto Nickels Gehöft
Stellung bezogen hatte. Die 2. und 4. Kompanie hatte sich in der Nähe vom Abbau Pallasch niedergelassen. Die Frau
Nickel hat am Abend ein Mädel in Dorf geschickt um meiner Frau Bescheid zu sagen, wo wir uns zurzeit befinden. Meine
Frau ist dann noch gekommen um sich von mir zu verabschieden, weil wir am nächsten Morgen um 3:00 Uhr Zelte abbrechen
und um 4:00 Uhr in Richtung Kaspersguth marschieren sollten.
Wir sind dann über Achodden, Seelonken, Lehmanen, Ortelsburg, bis nach Grammen und Schützendorf marschiert, wo wir an
einem See Biwak bezogen haben. Es wurde immer gesagt, wir kommen zum Tannenberg-Denkmal bei Hohenstein, wo ein Reichs
Kriegervereinsfest stattfinden sollte. Es wurden auch schon Vorkommandos aufgestellt, doch dann kamen wir nach Orlau
und Lahna-Mühle, da wo die Alle entspringt haben wir 2 Tage biwakiert. Unser Kompanieführer hat uns nach Waplitz auf
den Soldatenfriedhof des Ersten Weltkrieges geführt und uns erklärt wie das Jägerbataillon sich 1914 hier entfaltet
hat und aufgerieben wurde. Dann mussten wir in der Nähe von Gut Koslau über einen Fluss und bezogen in einem Waldstück,
vorbereitete Stellungen in der Nähe der polnischen Grenze. Herr und Frau Thalmann haben uns jeden Tag, bis zur Grenze,
mit Brötchen und Getränken versorgt. Es wurde scharfe Munition ausgegeben, weil wir am nächsten Morgen um 4:00 Uhr die
polnische Grenze überschreiten sollten.
Am nächsten Morgen um 10 Minuten vor 4:00 Uhr kam der Befehl; scharfe Munition abgeben, alles zurück in ein 6 Kilometer
entferntes Dorf, wo wir auch einquartiert wurden. Das alles geschah’ eine Woche vor dem 1. September 1939. Es wurde
gesagt dass der Führer dem polnischen Präsidenten Rid-Szmigly, ein Ultimatum gestellt hat und es wahrscheinlich nicht
zum Krieg mit Polen kommt. Genau nach 5 Tagen kehrten wir wieder in die gleichen Stellungen zurück, es wurde wieder
scharfe Munition ausgegeben und am nächsten Morgen um 4:00 Uhr überschritten wir die polnische Grenze.
Wir sind dann über Achodden, Seelonken, Lehmanen, Ortelsburg, bis nach Grammen und Schützendorf marschiert, wo wir an
einem See Biwak bezogen haben. Es wurde immer gesagt, wir kommen zum Tannenberg-Denkmal bei Hohenstein, wo ein Reichs
Kriegervereinsfest stattfinden sollte. Es wurden auch schon Vorkommandos aufgestellt, doch dann kamen wir nach Orlau
und Lahna-Mühle, da wo die Alle entspringt haben wir 2 Tage biwakiert. Unser Kompanieführer hat uns nach Waplitz auf
den Soldatenfriedhof des Ersten Weltkrieges geführt und uns erklärt wie das Jägerbataillon sich 1914 hier entfaltet
hat und aufgerieben wurde. Dann mussten wir in der Nähe von Gut Koslau über einen Fluss und bezogen in einem Waldstück,
vorbereitete Stellungen in der Nähe der polnischen Grenze. Herr und Frau Thalmann haben uns jeden Tag, bis zur Grenze,
mit Brötchen und Getränken versorgt. Es wurde scharfe Munition ausgegeben, weil wir am nächsten Morgen um 4:00 Uhr die
polnische Grenze überschreiten sollten.
Am nächsten Morgen um 10 Minuten vor 4:00 Uhr kam der Befehl; scharfe Munition abgeben, alles zurück in ein 6 Kilometer
entferntes Dorf, wo wir auch einquartiert wurden. Das alles geschah’ eine Woche vor dem 1. September 1939. Es wurde
gesagt dass der Führer dem polnischen Präsidenten Rid-Szmigly, ein Ultimatum gestellt hat und es wahrscheinlich nicht
zum Krieg mit Polen kommt. Genau nach 5 Tagen kehrten wir wieder in die gleichen Stellungen zurück, es wurde wieder
scharfe Munition ausgegeben und am nächsten Morgen um 4:00 Uhr überschritten wir die polnische Grenze.
Der erste Einsatz in Polen
Wir kamen zuerst in ein Dorf in dem sich nur alte Menschen befanden. Auf unsere Frage wo denn die Bewohner wären sagte
man uns dass alle geflohen sind, weil erzählt wurde, die Deutschen würden alle Polen misshandeln und verstümmeln. Ich
habe ihnen daraufhin gesagt dass uns, unter Androhung von Strafe verboten wurde, einem Zivilisten etwas anzutun. Das
Vieh, die Schweine und Hunde des Dorfes liefen frei herum und die Soldaten fingen an auf die Hunde zu schießen, bis
gesagt wurde es seien Meldehunde im Dienste der Deutschen Wehrmacht und dieser Unfug der eigenen Truppe schaden würde,
weil etwaige Querschläger eigene Kameraden verletzen könnten. Wir gingen weiter auf polnischer Seite entlang der Grenze,
bis wir am Nachmittag die ersten Vorposten der Festung Mlawa erreichten, da befanden wir uns plötzlich im Feuerhagel
polnischer Festungsflack.
Am nächsten Morgen hatte ich schon 3 Verwundete und wusste nicht wo sich eine Verwundeten Sammelstelle befindet. Ich
suchte den Bataillonsgefechtstand auf der sich auf einer Anhöhe befand. Ich habe unseren Oberstabsarzt gefragt wo denn
die Verwundetensammelstelle wäre. Er rief beim Tross an, wo er die Auskunft erhielt, das sich vor dem Dorf ein Bunker
befindet in dem man die Verwundeten sammeln sollte, die dann von Sanitätsautos abgeholt würden, weil das Dorf unter
Artilleriebeschuss stand. Am Sonnabend haben unsere Flieger die Bunkerstellungen bombardiert, konnten aber, trotz guter
Treffer nicht viel ausrichten, die Bunker wurden nur etwas angekratzt.
Der Beschuss unserer vordersten Linien ging mit unverminderter Heftigkeit weiter. Am Sonntag verkündete eine große
Staubwolke die Ankunft unserer Panzer, doch sie kamen nur bis zur Panzersperre und mussten wieder abdrehen ohne den
Polen einen schaden zuzufügen. Ein Panzer bekam einen Volltreffer, der Fahrer konnte noch umkehren. Er blutete am Kopf
und der Schütze war so eingeklemmt, das wir ihn nur mit einem Seil unter den Armen, durch die Luke nach oben ziehen
konnten. Ob er seine Verwundung überlebt hat ist mir nicht bekannt, denn in der Nacht wurden Panzergeschütze nach
vorne in Stellung gebracht, die direkt in die Schießscharten der Bunker geschossen und so die Verteidiger vertrieben
haben. Daraufhin sind wir weiter vorgerückt. Auf einer Wiese war ein tiefer Graben ausgehoben und mit Ästen getarnt,
da war ein Panzer hinein gefahren, so dass nur das Hinterteil herausragte und er sich nicht aus eigner Kraft befreien
konnte. In der Luft waren Flieger die Brandbomben abwarfen, ich habe mich auf den Boden geworfen weil ich dachte die
würden explodieren, aber sie zischten nur, so das Stoppeln und Graß rings herum in Brand gerieten.
Bei den Kampfhandlungen gab es mehrere Verwundete, denen ich gerade Verbände anlegen wollte, als unser Hauptmann zur
Trillerpfeife griff um mir klar zu machen, dass ich ihm folgen sollte. Die Polen fingen an zu schreien, ich sollte
sie ins Lazarett bringen denn hier im Wald würde sie niemand finden. Ich setzte mich aufs Fahrrad und folgte unserem
Kompanieführer, der mir sagte ich soll immer bei der kämpfenden Truppe bleiben, denn hinter der Front sind die
Sanitätsabteilungen, die werden die Verwundeten schon versorgen. Der Vormarsch dauerte bis in die späte Nacht. Auf
einem Gehöft, das nach allen Seiten durch Feldwachen abgesichert wurde, machten wir endlich Rast. Wir haben
Getreidegarben auf dem Hof ausgebreitet und uns zur Ruhe gelegt, als plötzlich um Mitternacht Leuchtraketen den Himmel
erhellten und Maschinengewehrfeuer uns aus dem Schlaf schreckte. Ein par polnische Soldaten hatten das Feuer eröffnet,
aber sich kurz darauf ergeben.
Die Narew-Überquerung
Als es hell wurde ging der Vormarsch weiter. Es wurde uns untersagt Tagebuch zu führen, darum
weiß ich nicht wie die Orte hießen, durch die wir marschiert sind. Als wir durch ein sumpfiges Gelände vor drangen
stand auf einer Anhöhe am Horizont, die polnische Artillerie, die uns sofort unter Beschuss nahm. Unser Hauptmann war
der Meinung dass wir schon in der Nähe des Flusses Narew sein müssten, als aus den Sträuchern ein mit Schlauchboten
beladenes Lastauto auftauchte. Wir wurden aufgefordert mit je 6 Mann ein Schlauchboot zu nehmen, an einem Aggregat
der daneben stand mit Luft zu füllen und zu Wasser zu lassen. In einer Stunde war das ganze Bataillon über die Narew,
wo der Vormarsch fortgesetzt wurde. In einem Dorf überraschte uns die polnische Kavallerie und fing sofort mit
Maschinengewehren zu schießen an. Da kam der Befehl: Alles wieder zurück. Es ging noch schneller als auf der Hinfahrt.
Wir sind erst einige Kilometer am Fluss entlang gegangen und haben dann zum zweiten Mal rüber gesetzt.
Die Gehöfte im Dorf standen alle in Brand. Auf einem waren viele Bienestöcke. 2 Kameraden wollten den Stöcken Waben
entnehmen, doch die Bienen durch das Feuer aufgeschreckt, überfielen sie sofort und stachen derart zu das sie nicht
mehr wieder zu erkennen waren. Ich habe die Einstichstellen mit Salmiak betupft, mehr konnte ich nicht tun. Wir mussten
auf unserem Vormarsch durch einen Wald der in Flammen stand, so dass man kaum atmen konnte. Es ging weiter in Richtung
Minsk und Warschau, wo schon die Sowjetische Armee durchgegangen war, die Pferde und Vieh von einem Gut mitgenommen
hatten. In einem Wald stießen wir unverhofft auf ein Kloster, in dem wir einige Gefangene machten. Dann trafen wir auf
eine gute Straße die nach Grochow ging.
Als wir dort einmarschierten wurden wir aus den oberen Stockwerken beschossen, so dass wir, um uns zu schützen, nur an
den Hauswänden entlang gehen konnten. Wir haben jedes Haus nach Feinden durchsucht. Vor einem Haus stand ein Hund der
niemanden reinlassen wollte, solange bis ihn eine Kugel traf. Die polnische Artillerie feuerte von Warschau aus, um
unseren Vormarsch zu stoppen. Wir hatten uns gerade eingegraben als plötzlich deutsche Flieger am Himmel erschienen,
die unsere Stellungen mit Bomben bewarfen und dabei viel Unheil anrichteten. Wir haben sofort Fliegertücher
ausgebreitet und Leuchtraketen abgeschossen. Da ich in dem Graben, den ich kurz zuvor ausgehoben hatte, sofort in
Deckung gegangen bin ist mir zum Glück nichts passiert. Unter den anderen Kameraden gab es viele Verwundete, so dass
ich nicht wusste wem ich zuerst helfen sollte.
Der Oberstabsarzt hat mich sofort tatkräftig unterstützt, so das bald alle Verwundeten versorgt waren, außer einem,
dem ein Bombensplitter den Arm abgerissen hat. Ich habe im 3 große Verbandspäckchen auf die Wunde gelegt, doch die
Blutung ließ sich trotzdem nicht stoppen, so dass er eine Stunde später auf der Krankensammelstelle verstarb. Wir
haben danach in einem Tomatenfeld einen Graben ausgehoben und eine neue Abwehrstellung bezogen. Die Gruppe Schwarz
bekam den Auftrag nach etwaigen versprengten polnischen Verbänden Ausschau zu halten, als sie unerwartet aus einer
Häuserreihe mit Maschinengewehrsalven überschüttet wurden. Der Gruppenführer und noch ein Soldat wurden dabei tödlich
verwundet. Danach wurde noch ein weiter Stoßtrupp, unter der Führung von Leutnant Briskorn, der sich dazu freiwillig
gemeldet hatte, hinaus geschickt um den Gruppenführer und den anderen Toten zu bergen.
Bei diesem Unternehmen, das erfolglos ausging, weil die Toten schon verscharrt waren, durchschlug eine Kugel den
Stahlhelm von Leutnant Briskorn, der auch sofort tot war. Alle Toten wurden später, an der Kirchenmauer in Grochow, in
Särgen beigesetzt: Hauptmann Schönwald sagte, das sie nach dem Kriege auf den Heldenfriedhof nach Ortelsburg überführt
werden. Drei Tage lagen wir bei Grochow in Stellungen, waren dem polnischen Maschinengewehrfeuer sowie den Bomben
deutscher Flugzeuge ausgesetzt. In der Nacht musste ich zu einem Verwundeten in die vorderste Linie und habe den
Rückweg nicht mehr finden können, als plötzlich Gewehrfeuer aufflammte habe ich in den Ruinen Schutz gesucht. Erst im
Morgengrauen konnte ich mich wieder orientieren und zu meinem Unterstand zurückfinden.
Warschau wurde tagelang bombardiert und stand auch unter Artilleriebeschuss. Aus dunklen Rauchwolken kamen oft ganze
Bündel von Papier angeflogen. Die Verwundeten kamen oft auf Krücken zu unserem Unterstand, ich habe sie dann zur
Krankensammelstelle hingeführt. Wir haben auch polnische Zivilpersonen betreut, die während der Kampfhandlungen
verwundet wurden. Als einmal 2 Jungen vorbeiliefen hat einer ihnen nachgerufen sie sollten seiner Frau Bescheid sagen,
er wäre auf der Krankensammelstelle an der Kirche. Als wir dort ankamen war seine Frau, mit einem Kind auf dem Arm,
schon da.
Nach der Kapitulation von Warschau, gingen wir über Sokolow zum Bug und haben dort Quartier bezogen. Der Russe hatte
sich bereits hinter den Fluss zurückgezogen, hatte alles Vieh und Pferde mitgenommen. Dort erreichte mich ein Telegramm
von zu Hause, dass meine Tochter gestorben ist. Es sprach sich auch herum dass verschiedene Heimaturlaub bekommen haben,
ich durfte auch für 14 Tage heim. Wir fuhren mit Lastautos nach Allenstein in die neue Reiterkaserne, zum
Ersatzbatallion, da haben wir unsere Gewehre und Munition abgeben, dann durften wir, jeder in seinen Heimatort
weiterfahren.
Als wir unsere Quartiere am Bug verlassen haben war sehr viel Schnee gefallen. Hier in Ortelsburg fanden wir die
gleiche Wetterlage vor, aber nach 3 Tagen war alles wieder weggetaut und wir konnten die Kartoffelernte, die durch den
frühen Wintereinbruch gestoppt wurde, zu Ende bringen. Ein Tag bevor ich zu Hause angekommen bin wurde die Tochter
beerdigt. Nach 14 Tagen mussten wir uns in Allenstein melden, Gewehre empfangen und wieder zurück zur Division an den
Bug 150 Kilometer hinter Warschau. Die elfte Division, zu der wir auch gehörten sollte in den Westen Deutschlands
verlegt werden und war schon unterwegs zur Verladestation Skiernewice 50 Kilometer vor Warschau.
Mein Dienst als Sanitätsunteroffizier
Unser Bataillon kam in das Städtchen Burscheid, im Kreis Opladen, wo wir in Privatquartieren
untergebracht wurden. Nach 3 Monaten, im Januar 1940, wurden wir nach Solingen verlegt, wo wir bis zum
Frankreichfeldzug stationiert waren. Wir mussten an Feldübungen teilnehmen, wie andere die in Kasernen untergebracht
waren. Während dieser Zeit musste jeder seine Zähne in Ordnung bringen lassen. Jeden Tag fuhren 20 Mann in die
Cäzilienstraße nach Köln, zur Zahnklinik. Im Rheinland wurde unsere Division neu aufgestellt. Ausfälle durch den
Polenfeldzug wurden durch neue Soldaten ergänzt. Ich kam nun zum Ersatzbatallion, war der Älteste in der ganzen
Kompanie. Als der Frankreichfeldzug losging wurde unser Ersatzbatallion mit den noch vorhandenen Verwundeten, in die
neue Reiterkaserne, nach Allenstein verlegt.
Meine Frau hat, mit Unterstützung der Bauernschaft, einen Antrag gestellt, daraufhin wurde ich zur Frühjahrsbestellung,
beurlaubt und später bis auf weiteres vom Militärdienst freigestellt. Als der Russlandfeldzug losging wurde ich von der
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg, für 14 Tage einberufen. Ich war seit 1922, Mitglied der freiwilligen
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg und habe jedes Jahr an Übungen teilgenommen. Jede Bereitschaft musste etliche Leute
stellen. Von Rohmanen wurden Emil Rosowski, Johann Dembek, und ich, zur Krankensammelstelle Wirballen, in Litauen,
abkommandiert. Dorthin kamen Lazarettzüge aus Russland mit der Breitspurbahn. Die Verwundeten wurden frisch verbunden
und auf Waggon mit Normalspur verladen und nach Deutschland gebracht.
Als die 14 Tage vergangen waren wollten wir wieder nach Haus zurück, doch man wollte uns nicht entlassen. Stattdessen
wurden wir dem Wehrkreisamt Königsberg zugeteilt, neu eingekleidet und zur Aushilfe ins Lazarett nach Gumbinnen
abkommandiert. Mehr als ein Jahr war ich in den Urlauber-Baracken, habe dort Krankenstube betreut. Später, bis zum
Dezember 1944, war ich im Reserve-Lazarett 4, in Königsberg tätig. Dort habe ich auch die Luftangriffe der Engländer,
vom 25 bis 26. August 1944 miterlebt.
Wir sollten gerade einen Lazarettzug in Rotenstein entladen, als plötzlich die Sirenen ertönten - Fliegeralarm. Im
gleichen Moment waren die ersten Flugzeuge auch schon da, zuerst warfen sie „Tannenbäume” und danach Foßforkanister ab.
Die Omnibusse standen schon zur Abfahrt bereit als es losging. Wir haben die Verwundeten schnell in den
Luftschutzkeller getragen, haben die Betten von den Fenstern weggerückt damit die Verwundeten nicht von den
Glasssplittern verletzt wurden. Im Kasernenhof brannten die Fosforkanister lichterloh. Unsere Unterkunft, die sich in
einer Baracke befand ist völlig abgebrannt, mit dem Wenigen was wir unser Eigen nannten. Am nächsten Tag wurden wir neu
eingekleidet und am 29. bis 30. kamen die englischen Bomber wieder, sie setzten genau da ihr Zerstörungswerk fort wo
sie vor 3 Tagen aufgehört hatten.
Anfang Dezember 1944 musste ich mich nach Stablack melden und musste dann zur Sanitätsabteilung 1, nach Gernau, das
liegt zwischen Lodz und Warschau. Vormittags hatten wir Felddienstübungen und nachmittags theoretischen Unterricht.
Jeden Tag wurden Gruppen zusammengestellt und zu anderen Einheiten abkommandiert. Ich kam zu einer Panzerabteilung, wo
wir an einem Morgen plötzlich auf dem Kasernenhof antreten mussten und zu unserer Überraschung mit der Nachricht
konfrontiert wurden, dass der Russe an mehreren Frontabschnitten durchgebrochen war. Wir bekamen sofort einen
Marschbefehl in Richtung Lodz, wo das Stadtbild noch intakt war, selbst die Straßenbahnen fuhren noch. In der Nacht
haben russische Flugzeuge die Stadt bombardiert. Die Kaserne in der wir untergebracht waren hatte keine
Luftschutzkeller, aber zum Glück blieben wir von Bombentreffern verschont. Am nächsten morgen bot sich uns ein Bild der
Verwüstung. Die entgleisten Straßenbahnwagen, sowie andere Fahrzeuge blockierten die Straßen. Die Älteren unter uns
bekamen Fahrscheine für einen Transportzug, der bereit hinter Lodz abfahrbereit, unter Dampf stehen sollte. Als
russische Panzer in den Straßen auftauchten, verbrannte die Schreibstube unsere Wehrpässe und andere wichtige
Dokumente. Wir liefen zu der Station auf der unser Transportzug bereitstehen sollte, aber da war kein Zug mehr zu sehen
und wir setzten unseren Rückzug zu Fuß fort.
Der Rückzug und Zusammenbruch der Ostfront
In Dobroschin, einer Stadt in Polen, wurde gerade ein Lazarettzug verladen, doch wir kamen nicht
mehr zum Einsatz, weil die russische Infanterie uns schon auf den Fersen war. Es ging weiter über den Fluss Bober,
Sagan, bis nach Glogau an der Oder. Dort wurden wir der 29. motorisierten Sanitätskompanie zugeteilt. Im
Garnisonslazarett wurden noch Operationen durchgeführt. Unsere Division hatte ihr eigenes Feldlazarett, so dass wir den
Befehl zu Weiterfahrt erhielten und noch unbeschadet die Oderbrücke passieren konnten, denn Glogau wurde zur Festung
erklärt. Wir haben 2 Pferdewagen organisiert und mit Verbänden, sowie medizinischen Instrumenten beladen. So kamen wir
bis nach Lübbenau im Spreewald, wo wir in einem Schloss, in zuvor ein Museum war, unser Lazarett untergebracht haben.
Weil die Amerikaner Cottbus bombardiert hatten, wurden die Verwundeten zu uns nach Lübbenau gebracht. Hier haben wir
Tag und Nacht gearbeitet, um die vielen Verwundeten, aus den schweren Kämpfen bei Grünberg und Sagan zu versorgen. Die
Soldaten von der Abwehrfront kamen schon mit abgestorbenen Armen oder Beinen bei uns an, weil in vorderster Linie keine
Frontlazarette mehr vorhanden waren; es mussten viele Amputationen durchgeführt werden. Als für unsere Pferde kein Heu
mehr vorhanden war, schickte mich unser Hauptfeldwebel, zu einem Bauern in den Spreewald, mit dem Auftrag, Futter zu
besorgen. Mit noch zwei Mann fuhren mit zwei Kähnen, zuerst den Hauptstrom entlang und dann in einen Nebenarm; da haben
wir die Boote beladen und brachten das Heu nach Lübbenau.
Als wir uns bei unser Einheit zurück melden wollten, war alles schon marschbereit. Ich bin schnell in einen Bus
eingestiegen der sofort losfuhr, weil russische Verbände schon in sichtweite waren. Russische Flugzeuge kreisten über
den Dächern und nahmen, mit ihren Bordwaffen jeden unter Beschuss, der sich irgendwo blicken ließ. Wir konnten nur
durch den Wald, oder in der Nacht vorwärts kommen, denn wenn ein Auto auf der Landstraße fuhr, war alsbald ein Flugzeug
hinter ihm her und schoss es in Brand. Als wir nach Tagen am Ufer der Elbe ankamen, war bereits eine Ponton-Brücke
erstellt worden, welche die zerstörte Brücke ersetzen sollte.
Durch die vielen Fahrzeuge waren in den Sand tiefe Spuren gefahren, so dass andere Fahrzeuge unsere Busse ins
Schlepptau nehmen mussten, weil wir mit eigener Kraft nicht mehr weiterkamen. Beiderseits der Trasse standen
Flüchtlingswagen, in der der Hoffnung die Brücke passieren zu können, doch SS-Polizei verhinderte das die Gespanne den
militärischen Rückzug zum Stillstand brachten. Es gelang uns die Elbe zu überqueren, um in einem Waldstück Schutz vor
feindlichen Fliegern zu suchen.
Als wir unsere Busse und Autos gut getarnt hatten, hat unser Bataillonschef die anwesenden Parteigrößen zu sich
gerufen und ihnen erklärt das wir eine Einheit des Roten Kreuzes sind und nach internationalem Recht keine Waffen
besitzen dürfen. Nach langer, erregter Diskussion wurde beschlossen einen Graben auszuheben und alles im Sand zu
verscharren. Als wir dann weiter, durch die Dörfer fuhren, sahen wir schon viele weiße Bettlaken, als Zeichen der
Kapitulation, aus den Fenstern hängen. Es wurde uns erzählt dass der Bürgermeister von der SS erschossen wurde, weil
er die Bevölkerung zu diesem Schritt ermutigt hatte. Jetzt waren hinter uns die Russen und vor uns schon die Amerikaner.
Amerikanische Panzer fuhren umher und schossen wild durch die Gegend, ohne ein Ziel anzuvisieren. Niemand wollte sich
dem Russen ergeben, doch der Weg der zu den Amerikanern führte, war durch abgesägte Bäume blockiert. Wir sind schnell
in das nächste Dorf gegangen, haben uns Sägen und Äxte besorgt, die Bäume durchgesägt und in den Straßengraben
geworfen.
“ Nach dem Ende des 2. Weltkrieges.”
In amerikanische Kriegsgefangenschaft
Dann fuhren wir unter internationaler Flagge an eine Mulde Brücke, vor der zwei amerikanische Soldaten, mit Zigarren,
zur Hälfte im Mund, standen. Sie rauchten und kauten gleichzeitig. Wir mussten auf einen freien Platz fahren, alle
aussteigen und rechts wieder antreten. Wäschebeutel und Tornister mussten wir abstellen; danach wurden wir nach Waffen
durchsucht, Wertsachen, Uhren und Messer wurden uns gleich abgenommen. Als wir anschließend an unserem Gepäck
vorbeigingen durfte niemand was mitnehmen. Als ich gebückt, nach meinem Wäschebeutel greifen wollte, in dem sich noch
3 Konservendosen und ein Brot befanden, bekam ich einen Fußtritt ins Gesicht, so dass mir ein Zahn ausgeschlagen wurde.
Wir wurden dann in einem Garten zusammen getrieben und gefragt ob jemand bei der SS gedient hat. Nachdem wir in Reihe
und Glied angetreten waren, mussten wir den Oberkörper freimachen und die Arme anheben. Es wurde nach SS-Zeichen
gesucht, die gewöhnlich unter dem Oberarm eintätowiert waren. Nachdem wir Grimma bei Leipzig, wo wir in amerikanische
Gefangenschaft geraten waren, verlassen hatten, mussten wir durch ganz Thüringen bis Hersfeld, an der Grenze zu Hessen,
marschieren. In Hersfeld wurden wir auf große Lastautos verladen, die von farbigen Soldaten gefahren wurden. Man hat
uns mit Stöcken hinauf getrieben, solange bis das Auto so voll war das man kaum stehen konnte. Die Soldaten fuhren, für
diese Straßenverhältnisse, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Wenn die Straße eine scharfe Kurve hatte, flogen
wir alle übereinander und mussten erst mit viel Kraftanstrengung auf die Beine kommen um diese Fahrt zu überstehen.
Da die Straßenränder in dieser Gegend mit Obstbäumen bepflanzt sind und deren Äste sehr niedrig hängen, hätten die
uns die Köpfe abgerissen, wenn wir uns nicht ständig geduckt hätten. Unsere Fahrt endete in Bad Kreuznach, in der Pfalz,
wo wir in ein Lager, in dem sich später 130.000 Mann und 6 Generäle befanden, eingepfercht wurden. Die Unterkunft der
Generäle befand sich unter einem Zelt, alle anderen mussten die Zeit unter freiem Himmel zubringen. Die Offiziere, die
Unteroffiziere, die Mannschaften; wurden in getrennten Camps untergebracht. Die Mannschaften wurden auch zur Arbeit
abkommandiert und konnten bei dieser Gelegenheit, Brot, Brötchen oder Zigarettenstummel organisieren, wogegen die
Offiziere und Unteroffiziere ihr Camp überhaupt nicht verlassen durften.
Die ersten Tage gab es kein Wasser und kein Brot, so dass die Kameraden vor Erschöpfung umfielen. Später standen wir
manchmal den ganzen Tag nach Wasser an, das von den, uns bewachenden Negern mit großen Wassertanks angefahren wurde. Am
dritten Tag bekamen wir mittags und abends etwas zu Essen; Brot bekamen wir erst nach zwei Wochen, nach dem aus der
Umgebung herbeigeholte Handwerker, Backöfen gebaut hatten. In den verschiedenen Gemeinden, die in den uns umgebenden
Weinbergen lagen, mussten sich alle Männer beim Bürgermeister melden. Als sie dann erschienen waren, wurden sie auf
bereitstehende Lastautos getrieben und zu uns ins Lager gebracht. Sie waren ohne Kopfbedeckung und ohne wärmere
Bekleidung angekommen, weil ihnen gesagt wurde, dass ihr Aufenthalt im Lager nur von kurzer Dauer sein würde. Man hat
uns, falls noch vorhanden, Decken und Mäntel abgenommen, mit der Begründung, sie würden für Kranke und Verwundete
gebraucht. Jeden Tag starben mehr als 200 Mann, die wir sofort in ein Zelt tragen mussten. In der Nacht wurden die
Toten dann mit unbekanntem Ziel, weggefahren.
Viele haben ihren Verstand verloren uns irrten im ganzen Camp ziellos umher. Als Latrinen wurden Gräben ausgehoben, in
die verschiedene Kameraden, bei der Verrichtung ihrer Notdurft, vor Schwäche hineingefallen sind und nicht mehr wieder
heraus kamen. Aus den Pfählen die, die jungen Obstbäume stützten, haben wir Krankentragen gebaut um unsere Kameraden,
bei Bedarf, zur Krankensammelstelle zu tragen. Es war in diesem Frühjahr auch sehr kalt, doch unsere Erdlöcher, die wir
zum Schutz vor Kälte und Wind, nur mit leeren Konservendosen ausgehoben hatten, durften nicht tiefer als 20 Zentimeter
sein. Nach jedem Regenguss mussten wir das Wasser ausschöpfen. Nach einem Gewitter, standen wir wiedermal, total
durchnässt in unserem Camp, als unerwartet am Horizont die Sonne hervortrat. Einer unserer Kameraden hatte noch eine
Trompete gerettet und fing, von dem Anblick völlig überwältigt, zu spielen an: "Es geht alles vorüber, es geht alles
vorbei, nach jedem Dezember, folgt wieder ein Mai". Daraufhin hob sich die Stimmung der tiefbetrübten Kriegsgefangenen,
so das Heimatlieder durch das ganze Camp erklangen, obwohl wir in den nassen Kleider herumgehen mussten, bis sie am
Körper trocken wurden.
Am nächsten Morgen hatte ich schon 3 Verwundete und wusste nicht wo sich eine Verwundeten Sammelstelle befindet. Ich
suchte den Bataillonsgefechtstand auf der sich auf einer Anhöhe befand. Ich habe unseren Oberstabsarzt gefragt wo denn
die Verwundetensammelstelle wäre. Er rief beim Tross an, wo er die Auskunft erhielt, das sich vor dem Dorf ein Bunker
befindet in dem man die Verwundeten sammeln sollte, die dann von Sanitätsautos abgeholt würden, weil das Dorf unter
Artilleriebeschuss stand. Am Sonnabend haben unsere Flieger die Bunkerstellungen bombardiert, konnten aber, trotz guter
Treffer nicht viel ausrichten, die Bunker wurden nur etwas angekratzt.
Der Beschuss unserer vordersten Linien ging mit unverminderter Heftigkeit weiter. Am Sonntag verkündete eine große
Staubwolke die Ankunft unserer Panzer, doch sie kamen nur bis zur Panzersperre und mussten wieder abdrehen ohne den
Polen einen schaden zuzufügen. Ein Panzer bekam einen Volltreffer, der Fahrer konnte noch umkehren. Er blutete am Kopf
und der Schütze war so eingeklemmt, das wir ihn nur mit einem Seil unter den Armen, durch die Luke nach oben ziehen
konnten. Ob er seine Verwundung überlebt hat ist mir nicht bekannt, denn in der Nacht wurden Panzergeschütze nach
vorne in Stellung gebracht, die direkt in die Schießscharten der Bunker geschossen und so die Verteidiger vertrieben
haben. Daraufhin sind wir weiter vorgerückt. Auf einer Wiese war ein tiefer Graben ausgehoben und mit Ästen getarnt,
da war ein Panzer hinein gefahren, so dass nur das Hinterteil herausragte und er sich nicht aus eigner Kraft befreien
konnte. In der Luft waren Flieger die Brandbomben abwarfen, ich habe mich auf den Boden geworfen weil ich dachte die
würden explodieren, aber sie zischten nur, so das Stoppeln und Graß rings herum in Brand gerieten.
Bei den Kampfhandlungen gab es mehrere Verwundete, denen ich gerade Verbände anlegen wollte, als unser Hauptmann zur
Trillerpfeife griff um mir klar zu machen, dass ich ihm folgen sollte. Die Polen fingen an zu schreien, ich sollte
sie ins Lazarett bringen denn hier im Wald würde sie niemand finden. Ich setzte mich aufs Fahrrad und folgte unserem
Kompanieführer, der mir sagte ich soll immer bei der kämpfenden Truppe bleiben, denn hinter der Front sind die
Sanitätsabteilungen, die werden die Verwundeten schon versorgen. Der Vormarsch dauerte bis in die späte Nacht. Auf
einem Gehöft, das nach allen Seiten durch Feldwachen abgesichert wurde, machten wir endlich Rast. Wir haben
Getreidegarben auf dem Hof ausgebreitet und uns zur Ruhe gelegt, als plötzlich um Mitternacht Leuchtraketen den Himmel
erhellten und Maschinengewehrfeuer uns aus dem Schlaf schreckte. Ein par polnische Soldaten hatten das Feuer eröffnet,
aber sich kurz darauf ergeben.
Die Narew-Überquerung
Als es hell wurde ging der Vormarsch weiter. Es wurde uns untersagt Tagebuch zu führen, darum
weiß ich nicht wie die Orte hießen, durch die wir marschiert sind. Als wir durch ein sumpfiges Gelände vor drangen
stand auf einer Anhöhe am Horizont, die polnische Artillerie, die uns sofort unter Beschuss nahm. Unser Hauptmann war
der Meinung dass wir schon in der Nähe des Flusses Narew sein müssten, als aus den Sträuchern ein mit Schlauchboten
beladenes Lastauto auftauchte. Wir wurden aufgefordert mit je 6 Mann ein Schlauchboot zu nehmen, an einem Aggregat
der daneben stand mit Luft zu füllen und zu Wasser zu lassen. In einer Stunde war das ganze Bataillon über die Narew,
wo der Vormarsch fortgesetzt wurde. In einem Dorf überraschte uns die polnische Kavallerie und fing sofort mit
Maschinengewehren zu schießen an. Da kam der Befehl: Alles wieder zurück. Es ging noch schneller als auf der Hinfahrt.
Wir sind erst einige Kilometer am Fluss entlang gegangen und haben dann zum zweiten Mal rüber gesetzt.
Die Gehöfte im Dorf standen alle in Brand. Auf einem waren viele Bienestöcke. 2 Kameraden wollten den Stöcken Waben
entnehmen, doch die Bienen durch das Feuer aufgeschreckt, überfielen sie sofort und stachen derart zu das sie nicht
mehr wieder zu erkennen waren. Ich habe die Einstichstellen mit Salmiak betupft, mehr konnte ich nicht tun. Wir mussten
auf unserem Vormarsch durch einen Wald der in Flammen stand, so dass man kaum atmen konnte. Es ging weiter in Richtung
Minsk und Warschau, wo schon die Sowjetische Armee durchgegangen war, die Pferde und Vieh von einem Gut mitgenommen
hatten. In einem Wald stießen wir unverhofft auf ein Kloster, in dem wir einige Gefangene machten. Dann trafen wir auf
eine gute Straße die nach Grochow ging.
Als wir dort einmarschierten wurden wir aus den oberen Stockwerken beschossen, so dass wir, um uns zu schützen, nur an
den Hauswänden entlang gehen konnten. Wir haben jedes Haus nach Feinden durchsucht. Vor einem Haus stand ein Hund der
niemanden reinlassen wollte, solange bis ihn eine Kugel traf. Die polnische Artillerie feuerte von Warschau aus, um
unseren Vormarsch zu stoppen. Wir hatten uns gerade eingegraben als plötzlich deutsche Flieger am Himmel erschienen,
die unsere Stellungen mit Bomben bewarfen und dabei viel Unheil anrichteten. Wir haben sofort Fliegertücher
ausgebreitet und Leuchtraketen abgeschossen. Da ich in dem Graben, den ich kurz zuvor ausgehoben hatte, sofort in
Deckung gegangen bin ist mir zum Glück nichts passiert. Unter den anderen Kameraden gab es viele Verwundete, so dass
ich nicht wusste wem ich zuerst helfen sollte.
Der Oberstabsarzt hat mich sofort tatkräftig unterstützt, so das bald alle Verwundeten versorgt waren, außer einem,
dem ein Bombensplitter den Arm abgerissen hat. Ich habe im 3 große Verbandspäckchen auf die Wunde gelegt, doch die
Blutung ließ sich trotzdem nicht stoppen, so dass er eine Stunde später auf der Krankensammelstelle verstarb. Wir
haben danach in einem Tomatenfeld einen Graben ausgehoben und eine neue Abwehrstellung bezogen. Die Gruppe Schwarz
bekam den Auftrag nach etwaigen versprengten polnischen Verbänden Ausschau zu halten, als sie unerwartet aus einer
Häuserreihe mit Maschinengewehrsalven überschüttet wurden. Der Gruppenführer und noch ein Soldat wurden dabei tödlich
verwundet. Danach wurde noch ein weiter Stoßtrupp, unter der Führung von Leutnant Briskorn, der sich dazu freiwillig
gemeldet hatte, hinaus geschickt um den Gruppenführer und den anderen Toten zu bergen.
Bei diesem Unternehmen, das erfolglos ausging, weil die Toten schon verscharrt waren, durchschlug eine Kugel den
Stahlhelm von Leutnant Briskorn, der auch sofort tot war. Alle Toten wurden später, an der Kirchenmauer in Grochow, in
Särgen beigesetzt: Hauptmann Schönwald sagte, das sie nach dem Kriege auf den Heldenfriedhof nach Ortelsburg überführt
werden. Drei Tage lagen wir bei Grochow in Stellungen, waren dem polnischen Maschinengewehrfeuer sowie den Bomben
deutscher Flugzeuge ausgesetzt. In der Nacht musste ich zu einem Verwundeten in die vorderste Linie und habe den
Rückweg nicht mehr finden können, als plötzlich Gewehrfeuer aufflammte habe ich in den Ruinen Schutz gesucht. Erst im
Morgengrauen konnte ich mich wieder orientieren und zu meinem Unterstand zurückfinden.
Warschau wurde tagelang bombardiert und stand auch unter Artilleriebeschuss. Aus dunklen Rauchwolken kamen oft ganze
Bündel von Papier angeflogen. Die Verwundeten kamen oft auf Krücken zu unserem Unterstand, ich habe sie dann zur
Krankensammelstelle hingeführt. Wir haben auch polnische Zivilpersonen betreut, die während der Kampfhandlungen
verwundet wurden. Als einmal 2 Jungen vorbeiliefen hat einer ihnen nachgerufen sie sollten seiner Frau Bescheid sagen,
er wäre auf der Krankensammelstelle an der Kirche. Als wir dort ankamen war seine Frau, mit einem Kind auf dem Arm,
schon da.
Nach der Kapitulation von Warschau, gingen wir über Sokolow zum Bug und haben dort Quartier bezogen. Der Russe hatte
sich bereits hinter den Fluss zurückgezogen, hatte alles Vieh und Pferde mitgenommen. Dort erreichte mich ein Telegramm
von zu Hause, dass meine Tochter gestorben ist. Es sprach sich auch herum dass verschiedene Heimaturlaub bekommen haben,
ich durfte auch für 14 Tage heim. Wir fuhren mit Lastautos nach Allenstein in die neue Reiterkaserne, zum
Ersatzbatallion, da haben wir unsere Gewehre und Munition abgeben, dann durften wir, jeder in seinen Heimatort
weiterfahren.
Als wir unsere Quartiere am Bug verlassen haben war sehr viel Schnee gefallen. Hier in Ortelsburg fanden wir die
gleiche Wetterlage vor, aber nach 3 Tagen war alles wieder weggetaut und wir konnten die Kartoffelernte, die durch den
frühen Wintereinbruch gestoppt wurde, zu Ende bringen. Ein Tag bevor ich zu Hause angekommen bin wurde die Tochter
beerdigt. Nach 14 Tagen mussten wir uns in Allenstein melden, Gewehre empfangen und wieder zurück zur Division an den
Bug 150 Kilometer hinter Warschau. Die elfte Division, zu der wir auch gehörten sollte in den Westen Deutschlands
verlegt werden und war schon unterwegs zur Verladestation Skiernewice 50 Kilometer vor Warschau.
Mein Dienst als Sanitätsunteroffizier
Unser Bataillon kam in das Städtchen Burscheid, im Kreis Opladen, wo wir in Privatquartieren
untergebracht wurden. Nach 3 Monaten, im Januar 1940, wurden wir nach Solingen verlegt, wo wir bis zum
Frankreichfeldzug stationiert waren. Wir mussten an Feldübungen teilnehmen, wie andere die in Kasernen untergebracht
waren. Während dieser Zeit musste jeder seine Zähne in Ordnung bringen lassen. Jeden Tag fuhren 20 Mann in die
Cäzilienstraße nach Köln, zur Zahnklinik. Im Rheinland wurde unsere Division neu aufgestellt. Ausfälle durch den
Polenfeldzug wurden durch neue Soldaten ergänzt. Ich kam nun zum Ersatzbatallion, war der Älteste in der ganzen
Kompanie. Als der Frankreichfeldzug losging wurde unser Ersatzbatallion mit den noch vorhandenen Verwundeten, in die
neue Reiterkaserne, nach Allenstein verlegt.
Meine Frau hat, mit Unterstützung der Bauernschaft, einen Antrag gestellt, daraufhin wurde ich zur Frühjahrsbestellung,
beurlaubt und später bis auf weiteres vom Militärdienst freigestellt. Als der Russlandfeldzug losging wurde ich von der
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg, für 14 Tage einberufen. Ich war seit 1922, Mitglied der freiwilligen
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg und habe jedes Jahr an Übungen teilgenommen. Jede Bereitschaft musste etliche Leute
stellen. Von Rohmanen wurden Emil Rosowski, Johann Dembek, und ich, zur Krankensammelstelle Wirballen, in Litauen,
abkommandiert. Dorthin kamen Lazarettzüge aus Russland mit der Breitspurbahn. Die Verwundeten wurden frisch verbunden
und auf Waggon mit Normalspur verladen und nach Deutschland gebracht.
Als die 14 Tage vergangen waren wollten wir wieder nach Haus zurück, doch man wollte uns nicht entlassen. Stattdessen
wurden wir dem Wehrkreisamt Königsberg zugeteilt, neu eingekleidet und zur Aushilfe ins Lazarett nach Gumbinnen
abkommandiert. Mehr als ein Jahr war ich in den Urlauber-Baracken, habe dort Krankenstube betreut. Später, bis zum
Dezember 1944, war ich im Reserve-Lazarett 4, in Königsberg tätig. Dort habe ich auch die Luftangriffe der Engländer,
vom 25 bis 26. August 1944 miterlebt.
Wir sollten gerade einen Lazarettzug in Rotenstein entladen, als plötzlich die Sirenen ertönten - Fliegeralarm. Im
gleichen Moment waren die ersten Flugzeuge auch schon da, zuerst warfen sie „Tannenbäume” und danach Foßforkanister ab.
Die Omnibusse standen schon zur Abfahrt bereit als es losging. Wir haben die Verwundeten schnell in den
Luftschutzkeller getragen, haben die Betten von den Fenstern weggerückt damit die Verwundeten nicht von den
Glasssplittern verletzt wurden. Im Kasernenhof brannten die Fosforkanister lichterloh. Unsere Unterkunft, die sich in
einer Baracke befand ist völlig abgebrannt, mit dem Wenigen was wir unser Eigen nannten. Am nächsten Tag wurden wir neu
eingekleidet und am 29. bis 30. kamen die englischen Bomber wieder, sie setzten genau da ihr Zerstörungswerk fort wo
sie vor 3 Tagen aufgehört hatten.
Anfang Dezember 1944 musste ich mich nach Stablack melden und musste dann zur Sanitätsabteilung 1, nach Gernau, das
liegt zwischen Lodz und Warschau. Vormittags hatten wir Felddienstübungen und nachmittags theoretischen Unterricht.
Jeden Tag wurden Gruppen zusammengestellt und zu anderen Einheiten abkommandiert. Ich kam zu einer Panzerabteilung, wo
wir an einem Morgen plötzlich auf dem Kasernenhof antreten mussten und zu unserer Überraschung mit der Nachricht
konfrontiert wurden, dass der Russe an mehreren Frontabschnitten durchgebrochen war. Wir bekamen sofort einen
Marschbefehl in Richtung Lodz, wo das Stadtbild noch intakt war, selbst die Straßenbahnen fuhren noch. In der Nacht
haben russische Flugzeuge die Stadt bombardiert. Die Kaserne in der wir untergebracht waren hatte keine
Luftschutzkeller, aber zum Glück blieben wir von Bombentreffern verschont. Am nächsten morgen bot sich uns ein Bild der
Verwüstung. Die entgleisten Straßenbahnwagen, sowie andere Fahrzeuge blockierten die Straßen. Die Älteren unter uns
bekamen Fahrscheine für einen Transportzug, der bereit hinter Lodz abfahrbereit, unter Dampf stehen sollte. Als
russische Panzer in den Straßen auftauchten, verbrannte die Schreibstube unsere Wehrpässe und andere wichtige
Dokumente. Wir liefen zu der Station auf der unser Transportzug bereitstehen sollte, aber da war kein Zug mehr zu sehen
und wir setzten unseren Rückzug zu Fuß fort.
Der Rückzug und Zusammenbruch der Ostfront
In Dobroschin, einer Stadt in Polen, wurde gerade ein Lazarettzug verladen, doch wir kamen nicht
mehr zum Einsatz, weil die russische Infanterie uns schon auf den Fersen war. Es ging weiter über den Fluss Bober,
Sagan, bis nach Glogau an der Oder. Dort wurden wir der 29. motorisierten Sanitätskompanie zugeteilt. Im
Garnisonslazarett wurden noch Operationen durchgeführt. Unsere Division hatte ihr eigenes Feldlazarett, so dass wir den
Befehl zu Weiterfahrt erhielten und noch unbeschadet die Oderbrücke passieren konnten, denn Glogau wurde zur Festung
erklärt. Wir haben 2 Pferdewagen organisiert und mit Verbänden, sowie medizinischen Instrumenten beladen. So kamen wir
bis nach Lübbenau im Spreewald, wo wir in einem Schloss, in zuvor ein Museum war, unser Lazarett untergebracht haben.
Weil die Amerikaner Cottbus bombardiert hatten, wurden die Verwundeten zu uns nach Lübbenau gebracht. Hier haben wir
Tag und Nacht gearbeitet, um die vielen Verwundeten, aus den schweren Kämpfen bei Grünberg und Sagan zu versorgen. Die
Soldaten von der Abwehrfront kamen schon mit abgestorbenen Armen oder Beinen bei uns an, weil in vorderster Linie keine
Frontlazarette mehr vorhanden waren; es mussten viele Amputationen durchgeführt werden. Als für unsere Pferde kein Heu
mehr vorhanden war, schickte mich unser Hauptfeldwebel, zu einem Bauern in den Spreewald, mit dem Auftrag, Futter zu
besorgen. Mit noch zwei Mann fuhren mit zwei Kähnen, zuerst den Hauptstrom entlang und dann in einen Nebenarm; da haben
wir die Boote beladen und brachten das Heu nach Lübbenau.
Als wir uns bei unser Einheit zurück melden wollten, war alles schon marschbereit. Ich bin schnell in einen Bus
eingestiegen der sofort losfuhr, weil russische Verbände schon in sichtweite waren. Russische Flugzeuge kreisten über
den Dächern und nahmen, mit ihren Bordwaffen jeden unter Beschuss, der sich irgendwo blicken ließ. Wir konnten nur
durch den Wald, oder in der Nacht vorwärts kommen, denn wenn ein Auto auf der Landstraße fuhr, war alsbald ein Flugzeug
hinter ihm her und schoss es in Brand. Als wir nach Tagen am Ufer der Elbe ankamen, war bereits eine Ponton-Brücke
erstellt worden, welche die zerstörte Brücke ersetzen sollte.
Durch die vielen Fahrzeuge waren in den Sand tiefe Spuren gefahren, so dass andere Fahrzeuge unsere Busse ins
Schlepptau nehmen mussten, weil wir mit eigener Kraft nicht mehr weiterkamen. Beiderseits der Trasse standen
Flüchtlingswagen, in der der Hoffnung die Brücke passieren zu können, doch SS-Polizei verhinderte das die Gespanne den
militärischen Rückzug zum Stillstand brachten. Es gelang uns die Elbe zu überqueren, um in einem Waldstück Schutz vor
feindlichen Fliegern zu suchen.
Als wir unsere Busse und Autos gut getarnt hatten, hat unser Bataillonschef die anwesenden Parteigrößen zu sich
gerufen und ihnen erklärt das wir eine Einheit des Roten Kreuzes sind und nach internationalem Recht keine Waffen
besitzen dürfen. Nach langer, erregter Diskussion wurde beschlossen einen Graben auszuheben und alles im Sand zu
verscharren. Als wir dann weiter, durch die Dörfer fuhren, sahen wir schon viele weiße Bettlaken, als Zeichen der
Kapitulation, aus den Fenstern hängen. Es wurde uns erzählt dass der Bürgermeister von der SS erschossen wurde, weil
er die Bevölkerung zu diesem Schritt ermutigt hatte. Jetzt waren hinter uns die Russen und vor uns schon die Amerikaner.
Amerikanische Panzer fuhren umher und schossen wild durch die Gegend, ohne ein Ziel anzuvisieren. Niemand wollte sich
dem Russen ergeben, doch der Weg der zu den Amerikanern führte, war durch abgesägte Bäume blockiert. Wir sind schnell
in das nächste Dorf gegangen, haben uns Sägen und Äxte besorgt, die Bäume durchgesägt und in den Straßengraben
geworfen.
“ Nach dem Ende des 2. Weltkrieges.”
In amerikanische Kriegsgefangenschaft
Dann fuhren wir unter internationaler Flagge an eine Mulde Brücke, vor der zwei amerikanische Soldaten, mit Zigarren,
zur Hälfte im Mund, standen. Sie rauchten und kauten gleichzeitig. Wir mussten auf einen freien Platz fahren, alle
aussteigen und rechts wieder antreten. Wäschebeutel und Tornister mussten wir abstellen; danach wurden wir nach Waffen
durchsucht, Wertsachen, Uhren und Messer wurden uns gleich abgenommen. Als wir anschließend an unserem Gepäck
vorbeigingen durfte niemand was mitnehmen. Als ich gebückt, nach meinem Wäschebeutel greifen wollte, in dem sich noch
3 Konservendosen und ein Brot befanden, bekam ich einen Fußtritt ins Gesicht, so dass mir ein Zahn ausgeschlagen wurde.
Wir wurden dann in einem Garten zusammen getrieben und gefragt ob jemand bei der SS gedient hat. Nachdem wir in Reihe
und Glied angetreten waren, mussten wir den Oberkörper freimachen und die Arme anheben. Es wurde nach SS-Zeichen
gesucht, die gewöhnlich unter dem Oberarm eintätowiert waren. Nachdem wir Grimma bei Leipzig, wo wir in amerikanische
Gefangenschaft geraten waren, verlassen hatten, mussten wir durch ganz Thüringen bis Hersfeld, an der Grenze zu Hessen,
marschieren. In Hersfeld wurden wir auf große Lastautos verladen, die von farbigen Soldaten gefahren wurden. Man hat
uns mit Stöcken hinauf getrieben, solange bis das Auto so voll war das man kaum stehen konnte. Die Soldaten fuhren, für
diese Straßenverhältnisse, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Wenn die Straße eine scharfe Kurve hatte, flogen
wir alle übereinander und mussten erst mit viel Kraftanstrengung auf die Beine kommen um diese Fahrt zu überstehen.
Da die Straßenränder in dieser Gegend mit Obstbäumen bepflanzt sind und deren Äste sehr niedrig hängen, hätten die
uns die Köpfe abgerissen, wenn wir uns nicht ständig geduckt hätten. Unsere Fahrt endete in Bad Kreuznach, in der Pfalz,
wo wir in ein Lager, in dem sich später 130.000 Mann und 6 Generäle befanden, eingepfercht wurden. Die Unterkunft der
Generäle befand sich unter einem Zelt, alle anderen mussten die Zeit unter freiem Himmel zubringen. Die Offiziere, die
Unteroffiziere, die Mannschaften; wurden in getrennten Camps untergebracht. Die Mannschaften wurden auch zur Arbeit
abkommandiert und konnten bei dieser Gelegenheit, Brot, Brötchen oder Zigarettenstummel organisieren, wogegen die
Offiziere und Unteroffiziere ihr Camp überhaupt nicht verlassen durften.
Die ersten Tage gab es kein Wasser und kein Brot, so dass die Kameraden vor Erschöpfung umfielen. Später standen wir
manchmal den ganzen Tag nach Wasser an, das von den, uns bewachenden Negern mit großen Wassertanks angefahren wurde. Am
dritten Tag bekamen wir mittags und abends etwas zu Essen; Brot bekamen wir erst nach zwei Wochen, nach dem aus der
Umgebung herbeigeholte Handwerker, Backöfen gebaut hatten. In den verschiedenen Gemeinden, die in den uns umgebenden
Weinbergen lagen, mussten sich alle Männer beim Bürgermeister melden. Als sie dann erschienen waren, wurden sie auf
bereitstehende Lastautos getrieben und zu uns ins Lager gebracht. Sie waren ohne Kopfbedeckung und ohne wärmere
Bekleidung angekommen, weil ihnen gesagt wurde, dass ihr Aufenthalt im Lager nur von kurzer Dauer sein würde. Man hat
uns, falls noch vorhanden, Decken und Mäntel abgenommen, mit der Begründung, sie würden für Kranke und Verwundete
gebraucht. Jeden Tag starben mehr als 200 Mann, die wir sofort in ein Zelt tragen mussten. In der Nacht wurden die
Toten dann mit unbekanntem Ziel, weggefahren.
Viele haben ihren Verstand verloren uns irrten im ganzen Camp ziellos umher. Als Latrinen wurden Gräben ausgehoben, in
die verschiedene Kameraden, bei der Verrichtung ihrer Notdurft, vor Schwäche hineingefallen sind und nicht mehr wieder
heraus kamen. Aus den Pfählen die, die jungen Obstbäume stützten, haben wir Krankentragen gebaut um unsere Kameraden,
bei Bedarf, zur Krankensammelstelle zu tragen. Es war in diesem Frühjahr auch sehr kalt, doch unsere Erdlöcher, die wir
zum Schutz vor Kälte und Wind, nur mit leeren Konservendosen ausgehoben hatten, durften nicht tiefer als 20 Zentimeter
sein. Nach jedem Regenguss mussten wir das Wasser ausschöpfen. Nach einem Gewitter, standen wir wiedermal, total
durchnässt in unserem Camp, als unerwartet am Horizont die Sonne hervortrat. Einer unserer Kameraden hatte noch eine
Trompete gerettet und fing, von dem Anblick völlig überwältigt, zu spielen an: "Es geht alles vorüber, es geht alles
vorbei, nach jedem Dezember, folgt wieder ein Mai". Daraufhin hob sich die Stimmung der tiefbetrübten Kriegsgefangenen,
so das Heimatlieder durch das ganze Camp erklangen, obwohl wir in den nassen Kleider herumgehen mussten, bis sie am
Körper trocken wurden.
Bei den Kampfhandlungen gab es mehrere Verwundete, denen ich gerade Verbände anlegen wollte, als unser Hauptmann zur
Trillerpfeife griff um mir klar zu machen, dass ich ihm folgen sollte. Die Polen fingen an zu schreien, ich sollte
sie ins Lazarett bringen denn hier im Wald würde sie niemand finden. Ich setzte mich aufs Fahrrad und folgte unserem
Kompanieführer, der mir sagte ich soll immer bei der kämpfenden Truppe bleiben, denn hinter der Front sind die
Sanitätsabteilungen, die werden die Verwundeten schon versorgen. Der Vormarsch dauerte bis in die späte Nacht. Auf
einem Gehöft, das nach allen Seiten durch Feldwachen abgesichert wurde, machten wir endlich Rast. Wir haben
Getreidegarben auf dem Hof ausgebreitet und uns zur Ruhe gelegt, als plötzlich um Mitternacht Leuchtraketen den Himmel
erhellten und Maschinengewehrfeuer uns aus dem Schlaf schreckte. Ein par polnische Soldaten hatten das Feuer eröffnet,
aber sich kurz darauf ergeben.
Die Narew-Überquerung
Als es hell wurde ging der Vormarsch weiter. Es wurde uns untersagt Tagebuch zu führen, darum
weiß ich nicht wie die Orte hießen, durch die wir marschiert sind. Als wir durch ein sumpfiges Gelände vor drangen
stand auf einer Anhöhe am Horizont, die polnische Artillerie, die uns sofort unter Beschuss nahm. Unser Hauptmann war
der Meinung dass wir schon in der Nähe des Flusses Narew sein müssten, als aus den Sträuchern ein mit Schlauchboten
beladenes Lastauto auftauchte. Wir wurden aufgefordert mit je 6 Mann ein Schlauchboot zu nehmen, an einem Aggregat
der daneben stand mit Luft zu füllen und zu Wasser zu lassen. In einer Stunde war das ganze Bataillon über die Narew,
wo der Vormarsch fortgesetzt wurde. In einem Dorf überraschte uns die polnische Kavallerie und fing sofort mit
Maschinengewehren zu schießen an. Da kam der Befehl: Alles wieder zurück. Es ging noch schneller als auf der Hinfahrt.
Wir sind erst einige Kilometer am Fluss entlang gegangen und haben dann zum zweiten Mal rüber gesetzt.
Die Gehöfte im Dorf standen alle in Brand. Auf einem waren viele Bienestöcke. 2 Kameraden wollten den Stöcken Waben
entnehmen, doch die Bienen durch das Feuer aufgeschreckt, überfielen sie sofort und stachen derart zu das sie nicht
mehr wieder zu erkennen waren. Ich habe die Einstichstellen mit Salmiak betupft, mehr konnte ich nicht tun. Wir mussten
auf unserem Vormarsch durch einen Wald der in Flammen stand, so dass man kaum atmen konnte. Es ging weiter in Richtung
Minsk und Warschau, wo schon die Sowjetische Armee durchgegangen war, die Pferde und Vieh von einem Gut mitgenommen
hatten. In einem Wald stießen wir unverhofft auf ein Kloster, in dem wir einige Gefangene machten. Dann trafen wir auf
eine gute Straße die nach Grochow ging.
Als wir dort einmarschierten wurden wir aus den oberen Stockwerken beschossen, so dass wir, um uns zu schützen, nur an
den Hauswänden entlang gehen konnten. Wir haben jedes Haus nach Feinden durchsucht. Vor einem Haus stand ein Hund der
niemanden reinlassen wollte, solange bis ihn eine Kugel traf. Die polnische Artillerie feuerte von Warschau aus, um
unseren Vormarsch zu stoppen. Wir hatten uns gerade eingegraben als plötzlich deutsche Flieger am Himmel erschienen,
die unsere Stellungen mit Bomben bewarfen und dabei viel Unheil anrichteten. Wir haben sofort Fliegertücher
ausgebreitet und Leuchtraketen abgeschossen. Da ich in dem Graben, den ich kurz zuvor ausgehoben hatte, sofort in
Deckung gegangen bin ist mir zum Glück nichts passiert. Unter den anderen Kameraden gab es viele Verwundete, so dass
ich nicht wusste wem ich zuerst helfen sollte.
Der Oberstabsarzt hat mich sofort tatkräftig unterstützt, so das bald alle Verwundeten versorgt waren, außer einem,
dem ein Bombensplitter den Arm abgerissen hat. Ich habe im 3 große Verbandspäckchen auf die Wunde gelegt, doch die
Blutung ließ sich trotzdem nicht stoppen, so dass er eine Stunde später auf der Krankensammelstelle verstarb. Wir
haben danach in einem Tomatenfeld einen Graben ausgehoben und eine neue Abwehrstellung bezogen. Die Gruppe Schwarz
bekam den Auftrag nach etwaigen versprengten polnischen Verbänden Ausschau zu halten, als sie unerwartet aus einer
Häuserreihe mit Maschinengewehrsalven überschüttet wurden. Der Gruppenführer und noch ein Soldat wurden dabei tödlich
verwundet. Danach wurde noch ein weiter Stoßtrupp, unter der Führung von Leutnant Briskorn, der sich dazu freiwillig
gemeldet hatte, hinaus geschickt um den Gruppenführer und den anderen Toten zu bergen.
Bei diesem Unternehmen, das erfolglos ausging, weil die Toten schon verscharrt waren, durchschlug eine Kugel den
Stahlhelm von Leutnant Briskorn, der auch sofort tot war. Alle Toten wurden später, an der Kirchenmauer in Grochow, in
Särgen beigesetzt: Hauptmann Schönwald sagte, das sie nach dem Kriege auf den Heldenfriedhof nach Ortelsburg überführt
werden. Drei Tage lagen wir bei Grochow in Stellungen, waren dem polnischen Maschinengewehrfeuer sowie den Bomben
deutscher Flugzeuge ausgesetzt. In der Nacht musste ich zu einem Verwundeten in die vorderste Linie und habe den
Rückweg nicht mehr finden können, als plötzlich Gewehrfeuer aufflammte habe ich in den Ruinen Schutz gesucht. Erst im
Morgengrauen konnte ich mich wieder orientieren und zu meinem Unterstand zurückfinden.
Warschau wurde tagelang bombardiert und stand auch unter Artilleriebeschuss. Aus dunklen Rauchwolken kamen oft ganze
Bündel von Papier angeflogen. Die Verwundeten kamen oft auf Krücken zu unserem Unterstand, ich habe sie dann zur
Krankensammelstelle hingeführt. Wir haben auch polnische Zivilpersonen betreut, die während der Kampfhandlungen
verwundet wurden. Als einmal 2 Jungen vorbeiliefen hat einer ihnen nachgerufen sie sollten seiner Frau Bescheid sagen,
er wäre auf der Krankensammelstelle an der Kirche. Als wir dort ankamen war seine Frau, mit einem Kind auf dem Arm,
schon da.
Nach der Kapitulation von Warschau, gingen wir über Sokolow zum Bug und haben dort Quartier bezogen. Der Russe hatte
sich bereits hinter den Fluss zurückgezogen, hatte alles Vieh und Pferde mitgenommen. Dort erreichte mich ein Telegramm
von zu Hause, dass meine Tochter gestorben ist. Es sprach sich auch herum dass verschiedene Heimaturlaub bekommen haben,
ich durfte auch für 14 Tage heim. Wir fuhren mit Lastautos nach Allenstein in die neue Reiterkaserne, zum
Ersatzbatallion, da haben wir unsere Gewehre und Munition abgeben, dann durften wir, jeder in seinen Heimatort
weiterfahren.
Als wir unsere Quartiere am Bug verlassen haben war sehr viel Schnee gefallen. Hier in Ortelsburg fanden wir die
gleiche Wetterlage vor, aber nach 3 Tagen war alles wieder weggetaut und wir konnten die Kartoffelernte, die durch den
frühen Wintereinbruch gestoppt wurde, zu Ende bringen. Ein Tag bevor ich zu Hause angekommen bin wurde die Tochter
beerdigt. Nach 14 Tagen mussten wir uns in Allenstein melden, Gewehre empfangen und wieder zurück zur Division an den
Bug 150 Kilometer hinter Warschau. Die elfte Division, zu der wir auch gehörten sollte in den Westen Deutschlands
verlegt werden und war schon unterwegs zur Verladestation Skiernewice 50 Kilometer vor Warschau.
Mein Dienst als Sanitätsunteroffizier
Unser Bataillon kam in das Städtchen Burscheid, im Kreis Opladen, wo wir in Privatquartieren
untergebracht wurden. Nach 3 Monaten, im Januar 1940, wurden wir nach Solingen verlegt, wo wir bis zum
Frankreichfeldzug stationiert waren. Wir mussten an Feldübungen teilnehmen, wie andere die in Kasernen untergebracht
waren. Während dieser Zeit musste jeder seine Zähne in Ordnung bringen lassen. Jeden Tag fuhren 20 Mann in die
Cäzilienstraße nach Köln, zur Zahnklinik. Im Rheinland wurde unsere Division neu aufgestellt. Ausfälle durch den
Polenfeldzug wurden durch neue Soldaten ergänzt. Ich kam nun zum Ersatzbatallion, war der Älteste in der ganzen
Kompanie. Als der Frankreichfeldzug losging wurde unser Ersatzbatallion mit den noch vorhandenen Verwundeten, in die
neue Reiterkaserne, nach Allenstein verlegt.
Meine Frau hat, mit Unterstützung der Bauernschaft, einen Antrag gestellt, daraufhin wurde ich zur Frühjahrsbestellung,
beurlaubt und später bis auf weiteres vom Militärdienst freigestellt. Als der Russlandfeldzug losging wurde ich von der
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg, für 14 Tage einberufen. Ich war seit 1922, Mitglied der freiwilligen
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg und habe jedes Jahr an Übungen teilgenommen. Jede Bereitschaft musste etliche Leute
stellen. Von Rohmanen wurden Emil Rosowski, Johann Dembek, und ich, zur Krankensammelstelle Wirballen, in Litauen,
abkommandiert. Dorthin kamen Lazarettzüge aus Russland mit der Breitspurbahn. Die Verwundeten wurden frisch verbunden
und auf Waggon mit Normalspur verladen und nach Deutschland gebracht.
Als die 14 Tage vergangen waren wollten wir wieder nach Haus zurück, doch man wollte uns nicht entlassen. Stattdessen
wurden wir dem Wehrkreisamt Königsberg zugeteilt, neu eingekleidet und zur Aushilfe ins Lazarett nach Gumbinnen
abkommandiert. Mehr als ein Jahr war ich in den Urlauber-Baracken, habe dort Krankenstube betreut. Später, bis zum
Dezember 1944, war ich im Reserve-Lazarett 4, in Königsberg tätig. Dort habe ich auch die Luftangriffe der Engländer,
vom 25 bis 26. August 1944 miterlebt.
Wir sollten gerade einen Lazarettzug in Rotenstein entladen, als plötzlich die Sirenen ertönten - Fliegeralarm. Im
gleichen Moment waren die ersten Flugzeuge auch schon da, zuerst warfen sie „Tannenbäume” und danach Foßforkanister ab.
Die Omnibusse standen schon zur Abfahrt bereit als es losging. Wir haben die Verwundeten schnell in den
Luftschutzkeller getragen, haben die Betten von den Fenstern weggerückt damit die Verwundeten nicht von den
Glasssplittern verletzt wurden. Im Kasernenhof brannten die Fosforkanister lichterloh. Unsere Unterkunft, die sich in
einer Baracke befand ist völlig abgebrannt, mit dem Wenigen was wir unser Eigen nannten. Am nächsten Tag wurden wir neu
eingekleidet und am 29. bis 30. kamen die englischen Bomber wieder, sie setzten genau da ihr Zerstörungswerk fort wo
sie vor 3 Tagen aufgehört hatten.
Anfang Dezember 1944 musste ich mich nach Stablack melden und musste dann zur Sanitätsabteilung 1, nach Gernau, das
liegt zwischen Lodz und Warschau. Vormittags hatten wir Felddienstübungen und nachmittags theoretischen Unterricht.
Jeden Tag wurden Gruppen zusammengestellt und zu anderen Einheiten abkommandiert. Ich kam zu einer Panzerabteilung, wo
wir an einem Morgen plötzlich auf dem Kasernenhof antreten mussten und zu unserer Überraschung mit der Nachricht
konfrontiert wurden, dass der Russe an mehreren Frontabschnitten durchgebrochen war. Wir bekamen sofort einen
Marschbefehl in Richtung Lodz, wo das Stadtbild noch intakt war, selbst die Straßenbahnen fuhren noch. In der Nacht
haben russische Flugzeuge die Stadt bombardiert. Die Kaserne in der wir untergebracht waren hatte keine
Luftschutzkeller, aber zum Glück blieben wir von Bombentreffern verschont. Am nächsten morgen bot sich uns ein Bild der
Verwüstung. Die entgleisten Straßenbahnwagen, sowie andere Fahrzeuge blockierten die Straßen. Die Älteren unter uns
bekamen Fahrscheine für einen Transportzug, der bereit hinter Lodz abfahrbereit, unter Dampf stehen sollte. Als
russische Panzer in den Straßen auftauchten, verbrannte die Schreibstube unsere Wehrpässe und andere wichtige
Dokumente. Wir liefen zu der Station auf der unser Transportzug bereitstehen sollte, aber da war kein Zug mehr zu sehen
und wir setzten unseren Rückzug zu Fuß fort.
Der Rückzug und Zusammenbruch der Ostfront
In Dobroschin, einer Stadt in Polen, wurde gerade ein Lazarettzug verladen, doch wir kamen nicht
mehr zum Einsatz, weil die russische Infanterie uns schon auf den Fersen war. Es ging weiter über den Fluss Bober,
Sagan, bis nach Glogau an der Oder. Dort wurden wir der 29. motorisierten Sanitätskompanie zugeteilt. Im
Garnisonslazarett wurden noch Operationen durchgeführt. Unsere Division hatte ihr eigenes Feldlazarett, so dass wir den
Befehl zu Weiterfahrt erhielten und noch unbeschadet die Oderbrücke passieren konnten, denn Glogau wurde zur Festung
erklärt. Wir haben 2 Pferdewagen organisiert und mit Verbänden, sowie medizinischen Instrumenten beladen. So kamen wir
bis nach Lübbenau im Spreewald, wo wir in einem Schloss, in zuvor ein Museum war, unser Lazarett untergebracht haben.
Weil die Amerikaner Cottbus bombardiert hatten, wurden die Verwundeten zu uns nach Lübbenau gebracht. Hier haben wir
Tag und Nacht gearbeitet, um die vielen Verwundeten, aus den schweren Kämpfen bei Grünberg und Sagan zu versorgen. Die
Soldaten von der Abwehrfront kamen schon mit abgestorbenen Armen oder Beinen bei uns an, weil in vorderster Linie keine
Frontlazarette mehr vorhanden waren; es mussten viele Amputationen durchgeführt werden. Als für unsere Pferde kein Heu
mehr vorhanden war, schickte mich unser Hauptfeldwebel, zu einem Bauern in den Spreewald, mit dem Auftrag, Futter zu
besorgen. Mit noch zwei Mann fuhren mit zwei Kähnen, zuerst den Hauptstrom entlang und dann in einen Nebenarm; da haben
wir die Boote beladen und brachten das Heu nach Lübbenau.
Als wir uns bei unser Einheit zurück melden wollten, war alles schon marschbereit. Ich bin schnell in einen Bus
eingestiegen der sofort losfuhr, weil russische Verbände schon in sichtweite waren. Russische Flugzeuge kreisten über
den Dächern und nahmen, mit ihren Bordwaffen jeden unter Beschuss, der sich irgendwo blicken ließ. Wir konnten nur
durch den Wald, oder in der Nacht vorwärts kommen, denn wenn ein Auto auf der Landstraße fuhr, war alsbald ein Flugzeug
hinter ihm her und schoss es in Brand. Als wir nach Tagen am Ufer der Elbe ankamen, war bereits eine Ponton-Brücke
erstellt worden, welche die zerstörte Brücke ersetzen sollte.
Durch die vielen Fahrzeuge waren in den Sand tiefe Spuren gefahren, so dass andere Fahrzeuge unsere Busse ins
Schlepptau nehmen mussten, weil wir mit eigener Kraft nicht mehr weiterkamen. Beiderseits der Trasse standen
Flüchtlingswagen, in der der Hoffnung die Brücke passieren zu können, doch SS-Polizei verhinderte das die Gespanne den
militärischen Rückzug zum Stillstand brachten. Es gelang uns die Elbe zu überqueren, um in einem Waldstück Schutz vor
feindlichen Fliegern zu suchen.
Als wir unsere Busse und Autos gut getarnt hatten, hat unser Bataillonschef die anwesenden Parteigrößen zu sich
gerufen und ihnen erklärt das wir eine Einheit des Roten Kreuzes sind und nach internationalem Recht keine Waffen
besitzen dürfen. Nach langer, erregter Diskussion wurde beschlossen einen Graben auszuheben und alles im Sand zu
verscharren. Als wir dann weiter, durch die Dörfer fuhren, sahen wir schon viele weiße Bettlaken, als Zeichen der
Kapitulation, aus den Fenstern hängen. Es wurde uns erzählt dass der Bürgermeister von der SS erschossen wurde, weil
er die Bevölkerung zu diesem Schritt ermutigt hatte. Jetzt waren hinter uns die Russen und vor uns schon die Amerikaner.
Amerikanische Panzer fuhren umher und schossen wild durch die Gegend, ohne ein Ziel anzuvisieren. Niemand wollte sich
dem Russen ergeben, doch der Weg der zu den Amerikanern führte, war durch abgesägte Bäume blockiert. Wir sind schnell
in das nächste Dorf gegangen, haben uns Sägen und Äxte besorgt, die Bäume durchgesägt und in den Straßengraben
geworfen.
“ Nach dem Ende des 2. Weltkrieges.”
In amerikanische Kriegsgefangenschaft
Dann fuhren wir unter internationaler Flagge an eine Mulde Brücke, vor der zwei amerikanische Soldaten, mit Zigarren,
zur Hälfte im Mund, standen. Sie rauchten und kauten gleichzeitig. Wir mussten auf einen freien Platz fahren, alle
aussteigen und rechts wieder antreten. Wäschebeutel und Tornister mussten wir abstellen; danach wurden wir nach Waffen
durchsucht, Wertsachen, Uhren und Messer wurden uns gleich abgenommen. Als wir anschließend an unserem Gepäck
vorbeigingen durfte niemand was mitnehmen. Als ich gebückt, nach meinem Wäschebeutel greifen wollte, in dem sich noch
3 Konservendosen und ein Brot befanden, bekam ich einen Fußtritt ins Gesicht, so dass mir ein Zahn ausgeschlagen wurde.
Wir wurden dann in einem Garten zusammen getrieben und gefragt ob jemand bei der SS gedient hat. Nachdem wir in Reihe
und Glied angetreten waren, mussten wir den Oberkörper freimachen und die Arme anheben. Es wurde nach SS-Zeichen
gesucht, die gewöhnlich unter dem Oberarm eintätowiert waren. Nachdem wir Grimma bei Leipzig, wo wir in amerikanische
Gefangenschaft geraten waren, verlassen hatten, mussten wir durch ganz Thüringen bis Hersfeld, an der Grenze zu Hessen,
marschieren. In Hersfeld wurden wir auf große Lastautos verladen, die von farbigen Soldaten gefahren wurden. Man hat
uns mit Stöcken hinauf getrieben, solange bis das Auto so voll war das man kaum stehen konnte. Die Soldaten fuhren, für
diese Straßenverhältnisse, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Wenn die Straße eine scharfe Kurve hatte, flogen
wir alle übereinander und mussten erst mit viel Kraftanstrengung auf die Beine kommen um diese Fahrt zu überstehen.
Da die Straßenränder in dieser Gegend mit Obstbäumen bepflanzt sind und deren Äste sehr niedrig hängen, hätten die
uns die Köpfe abgerissen, wenn wir uns nicht ständig geduckt hätten. Unsere Fahrt endete in Bad Kreuznach, in der Pfalz,
wo wir in ein Lager, in dem sich später 130.000 Mann und 6 Generäle befanden, eingepfercht wurden. Die Unterkunft der
Generäle befand sich unter einem Zelt, alle anderen mussten die Zeit unter freiem Himmel zubringen. Die Offiziere, die
Unteroffiziere, die Mannschaften; wurden in getrennten Camps untergebracht. Die Mannschaften wurden auch zur Arbeit
abkommandiert und konnten bei dieser Gelegenheit, Brot, Brötchen oder Zigarettenstummel organisieren, wogegen die
Offiziere und Unteroffiziere ihr Camp überhaupt nicht verlassen durften.
Die ersten Tage gab es kein Wasser und kein Brot, so dass die Kameraden vor Erschöpfung umfielen. Später standen wir
manchmal den ganzen Tag nach Wasser an, das von den, uns bewachenden Negern mit großen Wassertanks angefahren wurde. Am
dritten Tag bekamen wir mittags und abends etwas zu Essen; Brot bekamen wir erst nach zwei Wochen, nach dem aus der
Umgebung herbeigeholte Handwerker, Backöfen gebaut hatten. In den verschiedenen Gemeinden, die in den uns umgebenden
Weinbergen lagen, mussten sich alle Männer beim Bürgermeister melden. Als sie dann erschienen waren, wurden sie auf
bereitstehende Lastautos getrieben und zu uns ins Lager gebracht. Sie waren ohne Kopfbedeckung und ohne wärmere
Bekleidung angekommen, weil ihnen gesagt wurde, dass ihr Aufenthalt im Lager nur von kurzer Dauer sein würde. Man hat
uns, falls noch vorhanden, Decken und Mäntel abgenommen, mit der Begründung, sie würden für Kranke und Verwundete
gebraucht. Jeden Tag starben mehr als 200 Mann, die wir sofort in ein Zelt tragen mussten. In der Nacht wurden die
Toten dann mit unbekanntem Ziel, weggefahren.
Viele haben ihren Verstand verloren uns irrten im ganzen Camp ziellos umher. Als Latrinen wurden Gräben ausgehoben, in
die verschiedene Kameraden, bei der Verrichtung ihrer Notdurft, vor Schwäche hineingefallen sind und nicht mehr wieder
heraus kamen. Aus den Pfählen die, die jungen Obstbäume stützten, haben wir Krankentragen gebaut um unsere Kameraden,
bei Bedarf, zur Krankensammelstelle zu tragen. Es war in diesem Frühjahr auch sehr kalt, doch unsere Erdlöcher, die wir
zum Schutz vor Kälte und Wind, nur mit leeren Konservendosen ausgehoben hatten, durften nicht tiefer als 20 Zentimeter
sein. Nach jedem Regenguss mussten wir das Wasser ausschöpfen. Nach einem Gewitter, standen wir wiedermal, total
durchnässt in unserem Camp, als unerwartet am Horizont die Sonne hervortrat. Einer unserer Kameraden hatte noch eine
Trompete gerettet und fing, von dem Anblick völlig überwältigt, zu spielen an: "Es geht alles vorüber, es geht alles
vorbei, nach jedem Dezember, folgt wieder ein Mai". Daraufhin hob sich die Stimmung der tiefbetrübten Kriegsgefangenen,
so das Heimatlieder durch das ganze Camp erklangen, obwohl wir in den nassen Kleider herumgehen mussten, bis sie am
Körper trocken wurden.
Als es hell wurde ging der Vormarsch weiter. Es wurde uns untersagt Tagebuch zu führen, darum
weiß ich nicht wie die Orte hießen, durch die wir marschiert sind. Als wir durch ein sumpfiges Gelände vor drangen
stand auf einer Anhöhe am Horizont, die polnische Artillerie, die uns sofort unter Beschuss nahm. Unser Hauptmann war
der Meinung dass wir schon in der Nähe des Flusses Narew sein müssten, als aus den Sträuchern ein mit Schlauchboten
beladenes Lastauto auftauchte. Wir wurden aufgefordert mit je 6 Mann ein Schlauchboot zu nehmen, an einem Aggregat
der daneben stand mit Luft zu füllen und zu Wasser zu lassen. In einer Stunde war das ganze Bataillon über die Narew,
wo der Vormarsch fortgesetzt wurde. In einem Dorf überraschte uns die polnische Kavallerie und fing sofort mit
Maschinengewehren zu schießen an. Da kam der Befehl: Alles wieder zurück. Es ging noch schneller als auf der Hinfahrt.
Wir sind erst einige Kilometer am Fluss entlang gegangen und haben dann zum zweiten Mal rüber gesetzt.
Die Gehöfte im Dorf standen alle in Brand. Auf einem waren viele Bienestöcke. 2 Kameraden wollten den Stöcken Waben
entnehmen, doch die Bienen durch das Feuer aufgeschreckt, überfielen sie sofort und stachen derart zu das sie nicht
mehr wieder zu erkennen waren. Ich habe die Einstichstellen mit Salmiak betupft, mehr konnte ich nicht tun. Wir mussten
auf unserem Vormarsch durch einen Wald der in Flammen stand, so dass man kaum atmen konnte. Es ging weiter in Richtung
Minsk und Warschau, wo schon die Sowjetische Armee durchgegangen war, die Pferde und Vieh von einem Gut mitgenommen
hatten. In einem Wald stießen wir unverhofft auf ein Kloster, in dem wir einige Gefangene machten. Dann trafen wir auf
eine gute Straße die nach Grochow ging.
Als wir dort einmarschierten wurden wir aus den oberen Stockwerken beschossen, so dass wir, um uns zu schützen, nur an
den Hauswänden entlang gehen konnten. Wir haben jedes Haus nach Feinden durchsucht. Vor einem Haus stand ein Hund der
niemanden reinlassen wollte, solange bis ihn eine Kugel traf. Die polnische Artillerie feuerte von Warschau aus, um
unseren Vormarsch zu stoppen. Wir hatten uns gerade eingegraben als plötzlich deutsche Flieger am Himmel erschienen,
die unsere Stellungen mit Bomben bewarfen und dabei viel Unheil anrichteten. Wir haben sofort Fliegertücher
ausgebreitet und Leuchtraketen abgeschossen. Da ich in dem Graben, den ich kurz zuvor ausgehoben hatte, sofort in
Deckung gegangen bin ist mir zum Glück nichts passiert. Unter den anderen Kameraden gab es viele Verwundete, so dass
ich nicht wusste wem ich zuerst helfen sollte.
Der Oberstabsarzt hat mich sofort tatkräftig unterstützt, so das bald alle Verwundeten versorgt waren, außer einem,
dem ein Bombensplitter den Arm abgerissen hat. Ich habe im 3 große Verbandspäckchen auf die Wunde gelegt, doch die
Blutung ließ sich trotzdem nicht stoppen, so dass er eine Stunde später auf der Krankensammelstelle verstarb. Wir
haben danach in einem Tomatenfeld einen Graben ausgehoben und eine neue Abwehrstellung bezogen. Die Gruppe Schwarz
bekam den Auftrag nach etwaigen versprengten polnischen Verbänden Ausschau zu halten, als sie unerwartet aus einer
Häuserreihe mit Maschinengewehrsalven überschüttet wurden. Der Gruppenführer und noch ein Soldat wurden dabei tödlich
verwundet. Danach wurde noch ein weiter Stoßtrupp, unter der Führung von Leutnant Briskorn, der sich dazu freiwillig
gemeldet hatte, hinaus geschickt um den Gruppenführer und den anderen Toten zu bergen.
Bei diesem Unternehmen, das erfolglos ausging, weil die Toten schon verscharrt waren, durchschlug eine Kugel den
Stahlhelm von Leutnant Briskorn, der auch sofort tot war. Alle Toten wurden später, an der Kirchenmauer in Grochow, in
Särgen beigesetzt: Hauptmann Schönwald sagte, das sie nach dem Kriege auf den Heldenfriedhof nach Ortelsburg überführt
werden. Drei Tage lagen wir bei Grochow in Stellungen, waren dem polnischen Maschinengewehrfeuer sowie den Bomben
deutscher Flugzeuge ausgesetzt. In der Nacht musste ich zu einem Verwundeten in die vorderste Linie und habe den
Rückweg nicht mehr finden können, als plötzlich Gewehrfeuer aufflammte habe ich in den Ruinen Schutz gesucht. Erst im
Morgengrauen konnte ich mich wieder orientieren und zu meinem Unterstand zurückfinden.
Warschau wurde tagelang bombardiert und stand auch unter Artilleriebeschuss. Aus dunklen Rauchwolken kamen oft ganze
Bündel von Papier angeflogen. Die Verwundeten kamen oft auf Krücken zu unserem Unterstand, ich habe sie dann zur
Krankensammelstelle hingeführt. Wir haben auch polnische Zivilpersonen betreut, die während der Kampfhandlungen
verwundet wurden. Als einmal 2 Jungen vorbeiliefen hat einer ihnen nachgerufen sie sollten seiner Frau Bescheid sagen,
er wäre auf der Krankensammelstelle an der Kirche. Als wir dort ankamen war seine Frau, mit einem Kind auf dem Arm,
schon da.
Nach der Kapitulation von Warschau, gingen wir über Sokolow zum Bug und haben dort Quartier bezogen. Der Russe hatte
sich bereits hinter den Fluss zurückgezogen, hatte alles Vieh und Pferde mitgenommen. Dort erreichte mich ein Telegramm
von zu Hause, dass meine Tochter gestorben ist. Es sprach sich auch herum dass verschiedene Heimaturlaub bekommen haben,
ich durfte auch für 14 Tage heim. Wir fuhren mit Lastautos nach Allenstein in die neue Reiterkaserne, zum
Ersatzbatallion, da haben wir unsere Gewehre und Munition abgeben, dann durften wir, jeder in seinen Heimatort
weiterfahren.
Als wir unsere Quartiere am Bug verlassen haben war sehr viel Schnee gefallen. Hier in Ortelsburg fanden wir die
gleiche Wetterlage vor, aber nach 3 Tagen war alles wieder weggetaut und wir konnten die Kartoffelernte, die durch den
frühen Wintereinbruch gestoppt wurde, zu Ende bringen. Ein Tag bevor ich zu Hause angekommen bin wurde die Tochter
beerdigt. Nach 14 Tagen mussten wir uns in Allenstein melden, Gewehre empfangen und wieder zurück zur Division an den
Bug 150 Kilometer hinter Warschau. Die elfte Division, zu der wir auch gehörten sollte in den Westen Deutschlands
verlegt werden und war schon unterwegs zur Verladestation Skiernewice 50 Kilometer vor Warschau.
Mein Dienst als Sanitätsunteroffizier
Unser Bataillon kam in das Städtchen Burscheid, im Kreis Opladen, wo wir in Privatquartieren
untergebracht wurden. Nach 3 Monaten, im Januar 1940, wurden wir nach Solingen verlegt, wo wir bis zum
Frankreichfeldzug stationiert waren. Wir mussten an Feldübungen teilnehmen, wie andere die in Kasernen untergebracht
waren. Während dieser Zeit musste jeder seine Zähne in Ordnung bringen lassen. Jeden Tag fuhren 20 Mann in die
Cäzilienstraße nach Köln, zur Zahnklinik. Im Rheinland wurde unsere Division neu aufgestellt. Ausfälle durch den
Polenfeldzug wurden durch neue Soldaten ergänzt. Ich kam nun zum Ersatzbatallion, war der Älteste in der ganzen
Kompanie. Als der Frankreichfeldzug losging wurde unser Ersatzbatallion mit den noch vorhandenen Verwundeten, in die
neue Reiterkaserne, nach Allenstein verlegt.
Meine Frau hat, mit Unterstützung der Bauernschaft, einen Antrag gestellt, daraufhin wurde ich zur Frühjahrsbestellung,
beurlaubt und später bis auf weiteres vom Militärdienst freigestellt. Als der Russlandfeldzug losging wurde ich von der
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg, für 14 Tage einberufen. Ich war seit 1922, Mitglied der freiwilligen
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg und habe jedes Jahr an Übungen teilgenommen. Jede Bereitschaft musste etliche Leute
stellen. Von Rohmanen wurden Emil Rosowski, Johann Dembek, und ich, zur Krankensammelstelle Wirballen, in Litauen,
abkommandiert. Dorthin kamen Lazarettzüge aus Russland mit der Breitspurbahn. Die Verwundeten wurden frisch verbunden
und auf Waggon mit Normalspur verladen und nach Deutschland gebracht.
Als die 14 Tage vergangen waren wollten wir wieder nach Haus zurück, doch man wollte uns nicht entlassen. Stattdessen
wurden wir dem Wehrkreisamt Königsberg zugeteilt, neu eingekleidet und zur Aushilfe ins Lazarett nach Gumbinnen
abkommandiert. Mehr als ein Jahr war ich in den Urlauber-Baracken, habe dort Krankenstube betreut. Später, bis zum
Dezember 1944, war ich im Reserve-Lazarett 4, in Königsberg tätig. Dort habe ich auch die Luftangriffe der Engländer,
vom 25 bis 26. August 1944 miterlebt.
Wir sollten gerade einen Lazarettzug in Rotenstein entladen, als plötzlich die Sirenen ertönten - Fliegeralarm. Im
gleichen Moment waren die ersten Flugzeuge auch schon da, zuerst warfen sie „Tannenbäume” und danach Foßforkanister ab.
Die Omnibusse standen schon zur Abfahrt bereit als es losging. Wir haben die Verwundeten schnell in den
Luftschutzkeller getragen, haben die Betten von den Fenstern weggerückt damit die Verwundeten nicht von den
Glasssplittern verletzt wurden. Im Kasernenhof brannten die Fosforkanister lichterloh. Unsere Unterkunft, die sich in
einer Baracke befand ist völlig abgebrannt, mit dem Wenigen was wir unser Eigen nannten. Am nächsten Tag wurden wir neu
eingekleidet und am 29. bis 30. kamen die englischen Bomber wieder, sie setzten genau da ihr Zerstörungswerk fort wo
sie vor 3 Tagen aufgehört hatten.
Anfang Dezember 1944 musste ich mich nach Stablack melden und musste dann zur Sanitätsabteilung 1, nach Gernau, das
liegt zwischen Lodz und Warschau. Vormittags hatten wir Felddienstübungen und nachmittags theoretischen Unterricht.
Jeden Tag wurden Gruppen zusammengestellt und zu anderen Einheiten abkommandiert. Ich kam zu einer Panzerabteilung, wo
wir an einem Morgen plötzlich auf dem Kasernenhof antreten mussten und zu unserer Überraschung mit der Nachricht
konfrontiert wurden, dass der Russe an mehreren Frontabschnitten durchgebrochen war. Wir bekamen sofort einen
Marschbefehl in Richtung Lodz, wo das Stadtbild noch intakt war, selbst die Straßenbahnen fuhren noch. In der Nacht
haben russische Flugzeuge die Stadt bombardiert. Die Kaserne in der wir untergebracht waren hatte keine
Luftschutzkeller, aber zum Glück blieben wir von Bombentreffern verschont. Am nächsten morgen bot sich uns ein Bild der
Verwüstung. Die entgleisten Straßenbahnwagen, sowie andere Fahrzeuge blockierten die Straßen. Die Älteren unter uns
bekamen Fahrscheine für einen Transportzug, der bereit hinter Lodz abfahrbereit, unter Dampf stehen sollte. Als
russische Panzer in den Straßen auftauchten, verbrannte die Schreibstube unsere Wehrpässe und andere wichtige
Dokumente. Wir liefen zu der Station auf der unser Transportzug bereitstehen sollte, aber da war kein Zug mehr zu sehen
und wir setzten unseren Rückzug zu Fuß fort.
Der Rückzug und Zusammenbruch der Ostfront
In Dobroschin, einer Stadt in Polen, wurde gerade ein Lazarettzug verladen, doch wir kamen nicht
mehr zum Einsatz, weil die russische Infanterie uns schon auf den Fersen war. Es ging weiter über den Fluss Bober,
Sagan, bis nach Glogau an der Oder. Dort wurden wir der 29. motorisierten Sanitätskompanie zugeteilt. Im
Garnisonslazarett wurden noch Operationen durchgeführt. Unsere Division hatte ihr eigenes Feldlazarett, so dass wir den
Befehl zu Weiterfahrt erhielten und noch unbeschadet die Oderbrücke passieren konnten, denn Glogau wurde zur Festung
erklärt. Wir haben 2 Pferdewagen organisiert und mit Verbänden, sowie medizinischen Instrumenten beladen. So kamen wir
bis nach Lübbenau im Spreewald, wo wir in einem Schloss, in zuvor ein Museum war, unser Lazarett untergebracht haben.
Weil die Amerikaner Cottbus bombardiert hatten, wurden die Verwundeten zu uns nach Lübbenau gebracht. Hier haben wir
Tag und Nacht gearbeitet, um die vielen Verwundeten, aus den schweren Kämpfen bei Grünberg und Sagan zu versorgen. Die
Soldaten von der Abwehrfront kamen schon mit abgestorbenen Armen oder Beinen bei uns an, weil in vorderster Linie keine
Frontlazarette mehr vorhanden waren; es mussten viele Amputationen durchgeführt werden. Als für unsere Pferde kein Heu
mehr vorhanden war, schickte mich unser Hauptfeldwebel, zu einem Bauern in den Spreewald, mit dem Auftrag, Futter zu
besorgen. Mit noch zwei Mann fuhren mit zwei Kähnen, zuerst den Hauptstrom entlang und dann in einen Nebenarm; da haben
wir die Boote beladen und brachten das Heu nach Lübbenau.
Als wir uns bei unser Einheit zurück melden wollten, war alles schon marschbereit. Ich bin schnell in einen Bus
eingestiegen der sofort losfuhr, weil russische Verbände schon in sichtweite waren. Russische Flugzeuge kreisten über
den Dächern und nahmen, mit ihren Bordwaffen jeden unter Beschuss, der sich irgendwo blicken ließ. Wir konnten nur
durch den Wald, oder in der Nacht vorwärts kommen, denn wenn ein Auto auf der Landstraße fuhr, war alsbald ein Flugzeug
hinter ihm her und schoss es in Brand. Als wir nach Tagen am Ufer der Elbe ankamen, war bereits eine Ponton-Brücke
erstellt worden, welche die zerstörte Brücke ersetzen sollte.
Durch die vielen Fahrzeuge waren in den Sand tiefe Spuren gefahren, so dass andere Fahrzeuge unsere Busse ins
Schlepptau nehmen mussten, weil wir mit eigener Kraft nicht mehr weiterkamen. Beiderseits der Trasse standen
Flüchtlingswagen, in der der Hoffnung die Brücke passieren zu können, doch SS-Polizei verhinderte das die Gespanne den
militärischen Rückzug zum Stillstand brachten. Es gelang uns die Elbe zu überqueren, um in einem Waldstück Schutz vor
feindlichen Fliegern zu suchen.
Als wir unsere Busse und Autos gut getarnt hatten, hat unser Bataillonschef die anwesenden Parteigrößen zu sich
gerufen und ihnen erklärt das wir eine Einheit des Roten Kreuzes sind und nach internationalem Recht keine Waffen
besitzen dürfen. Nach langer, erregter Diskussion wurde beschlossen einen Graben auszuheben und alles im Sand zu
verscharren. Als wir dann weiter, durch die Dörfer fuhren, sahen wir schon viele weiße Bettlaken, als Zeichen der
Kapitulation, aus den Fenstern hängen. Es wurde uns erzählt dass der Bürgermeister von der SS erschossen wurde, weil
er die Bevölkerung zu diesem Schritt ermutigt hatte. Jetzt waren hinter uns die Russen und vor uns schon die Amerikaner.
Amerikanische Panzer fuhren umher und schossen wild durch die Gegend, ohne ein Ziel anzuvisieren. Niemand wollte sich
dem Russen ergeben, doch der Weg der zu den Amerikanern führte, war durch abgesägte Bäume blockiert. Wir sind schnell
in das nächste Dorf gegangen, haben uns Sägen und Äxte besorgt, die Bäume durchgesägt und in den Straßengraben
geworfen.
“ Nach dem Ende des 2. Weltkrieges.”
In amerikanische Kriegsgefangenschaft
Dann fuhren wir unter internationaler Flagge an eine Mulde Brücke, vor der zwei amerikanische Soldaten, mit Zigarren,
zur Hälfte im Mund, standen. Sie rauchten und kauten gleichzeitig. Wir mussten auf einen freien Platz fahren, alle
aussteigen und rechts wieder antreten. Wäschebeutel und Tornister mussten wir abstellen; danach wurden wir nach Waffen
durchsucht, Wertsachen, Uhren und Messer wurden uns gleich abgenommen. Als wir anschließend an unserem Gepäck
vorbeigingen durfte niemand was mitnehmen. Als ich gebückt, nach meinem Wäschebeutel greifen wollte, in dem sich noch
3 Konservendosen und ein Brot befanden, bekam ich einen Fußtritt ins Gesicht, so dass mir ein Zahn ausgeschlagen wurde.
Wir wurden dann in einem Garten zusammen getrieben und gefragt ob jemand bei der SS gedient hat. Nachdem wir in Reihe
und Glied angetreten waren, mussten wir den Oberkörper freimachen und die Arme anheben. Es wurde nach SS-Zeichen
gesucht, die gewöhnlich unter dem Oberarm eintätowiert waren. Nachdem wir Grimma bei Leipzig, wo wir in amerikanische
Gefangenschaft geraten waren, verlassen hatten, mussten wir durch ganz Thüringen bis Hersfeld, an der Grenze zu Hessen,
marschieren. In Hersfeld wurden wir auf große Lastautos verladen, die von farbigen Soldaten gefahren wurden. Man hat
uns mit Stöcken hinauf getrieben, solange bis das Auto so voll war das man kaum stehen konnte. Die Soldaten fuhren, für
diese Straßenverhältnisse, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Wenn die Straße eine scharfe Kurve hatte, flogen
wir alle übereinander und mussten erst mit viel Kraftanstrengung auf die Beine kommen um diese Fahrt zu überstehen.
Da die Straßenränder in dieser Gegend mit Obstbäumen bepflanzt sind und deren Äste sehr niedrig hängen, hätten die
uns die Köpfe abgerissen, wenn wir uns nicht ständig geduckt hätten. Unsere Fahrt endete in Bad Kreuznach, in der Pfalz,
wo wir in ein Lager, in dem sich später 130.000 Mann und 6 Generäle befanden, eingepfercht wurden. Die Unterkunft der
Generäle befand sich unter einem Zelt, alle anderen mussten die Zeit unter freiem Himmel zubringen. Die Offiziere, die
Unteroffiziere, die Mannschaften; wurden in getrennten Camps untergebracht. Die Mannschaften wurden auch zur Arbeit
abkommandiert und konnten bei dieser Gelegenheit, Brot, Brötchen oder Zigarettenstummel organisieren, wogegen die
Offiziere und Unteroffiziere ihr Camp überhaupt nicht verlassen durften.
Die ersten Tage gab es kein Wasser und kein Brot, so dass die Kameraden vor Erschöpfung umfielen. Später standen wir
manchmal den ganzen Tag nach Wasser an, das von den, uns bewachenden Negern mit großen Wassertanks angefahren wurde. Am
dritten Tag bekamen wir mittags und abends etwas zu Essen; Brot bekamen wir erst nach zwei Wochen, nach dem aus der
Umgebung herbeigeholte Handwerker, Backöfen gebaut hatten. In den verschiedenen Gemeinden, die in den uns umgebenden
Weinbergen lagen, mussten sich alle Männer beim Bürgermeister melden. Als sie dann erschienen waren, wurden sie auf
bereitstehende Lastautos getrieben und zu uns ins Lager gebracht. Sie waren ohne Kopfbedeckung und ohne wärmere
Bekleidung angekommen, weil ihnen gesagt wurde, dass ihr Aufenthalt im Lager nur von kurzer Dauer sein würde. Man hat
uns, falls noch vorhanden, Decken und Mäntel abgenommen, mit der Begründung, sie würden für Kranke und Verwundete
gebraucht. Jeden Tag starben mehr als 200 Mann, die wir sofort in ein Zelt tragen mussten. In der Nacht wurden die
Toten dann mit unbekanntem Ziel, weggefahren.
Viele haben ihren Verstand verloren uns irrten im ganzen Camp ziellos umher. Als Latrinen wurden Gräben ausgehoben, in
die verschiedene Kameraden, bei der Verrichtung ihrer Notdurft, vor Schwäche hineingefallen sind und nicht mehr wieder
heraus kamen. Aus den Pfählen die, die jungen Obstbäume stützten, haben wir Krankentragen gebaut um unsere Kameraden,
bei Bedarf, zur Krankensammelstelle zu tragen. Es war in diesem Frühjahr auch sehr kalt, doch unsere Erdlöcher, die wir
zum Schutz vor Kälte und Wind, nur mit leeren Konservendosen ausgehoben hatten, durften nicht tiefer als 20 Zentimeter
sein. Nach jedem Regenguss mussten wir das Wasser ausschöpfen. Nach einem Gewitter, standen wir wiedermal, total
durchnässt in unserem Camp, als unerwartet am Horizont die Sonne hervortrat. Einer unserer Kameraden hatte noch eine
Trompete gerettet und fing, von dem Anblick völlig überwältigt, zu spielen an: "Es geht alles vorüber, es geht alles
vorbei, nach jedem Dezember, folgt wieder ein Mai". Daraufhin hob sich die Stimmung der tiefbetrübten Kriegsgefangenen,
so das Heimatlieder durch das ganze Camp erklangen, obwohl wir in den nassen Kleider herumgehen mussten, bis sie am
Körper trocken wurden.
Als wir dort einmarschierten wurden wir aus den oberen Stockwerken beschossen, so dass wir, um uns zu schützen, nur an
den Hauswänden entlang gehen konnten. Wir haben jedes Haus nach Feinden durchsucht. Vor einem Haus stand ein Hund der
niemanden reinlassen wollte, solange bis ihn eine Kugel traf. Die polnische Artillerie feuerte von Warschau aus, um
unseren Vormarsch zu stoppen. Wir hatten uns gerade eingegraben als plötzlich deutsche Flieger am Himmel erschienen,
die unsere Stellungen mit Bomben bewarfen und dabei viel Unheil anrichteten. Wir haben sofort Fliegertücher
ausgebreitet und Leuchtraketen abgeschossen. Da ich in dem Graben, den ich kurz zuvor ausgehoben hatte, sofort in
Deckung gegangen bin ist mir zum Glück nichts passiert. Unter den anderen Kameraden gab es viele Verwundete, so dass
ich nicht wusste wem ich zuerst helfen sollte.
Der Oberstabsarzt hat mich sofort tatkräftig unterstützt, so das bald alle Verwundeten versorgt waren, außer einem,
dem ein Bombensplitter den Arm abgerissen hat. Ich habe im 3 große Verbandspäckchen auf die Wunde gelegt, doch die
Blutung ließ sich trotzdem nicht stoppen, so dass er eine Stunde später auf der Krankensammelstelle verstarb. Wir
haben danach in einem Tomatenfeld einen Graben ausgehoben und eine neue Abwehrstellung bezogen. Die Gruppe Schwarz
bekam den Auftrag nach etwaigen versprengten polnischen Verbänden Ausschau zu halten, als sie unerwartet aus einer
Häuserreihe mit Maschinengewehrsalven überschüttet wurden. Der Gruppenführer und noch ein Soldat wurden dabei tödlich
verwundet. Danach wurde noch ein weiter Stoßtrupp, unter der Führung von Leutnant Briskorn, der sich dazu freiwillig
gemeldet hatte, hinaus geschickt um den Gruppenführer und den anderen Toten zu bergen.
Bei diesem Unternehmen, das erfolglos ausging, weil die Toten schon verscharrt waren, durchschlug eine Kugel den
Stahlhelm von Leutnant Briskorn, der auch sofort tot war. Alle Toten wurden später, an der Kirchenmauer in Grochow, in
Särgen beigesetzt: Hauptmann Schönwald sagte, das sie nach dem Kriege auf den Heldenfriedhof nach Ortelsburg überführt
werden. Drei Tage lagen wir bei Grochow in Stellungen, waren dem polnischen Maschinengewehrfeuer sowie den Bomben
deutscher Flugzeuge ausgesetzt. In der Nacht musste ich zu einem Verwundeten in die vorderste Linie und habe den
Rückweg nicht mehr finden können, als plötzlich Gewehrfeuer aufflammte habe ich in den Ruinen Schutz gesucht. Erst im
Morgengrauen konnte ich mich wieder orientieren und zu meinem Unterstand zurückfinden.
Warschau wurde tagelang bombardiert und stand auch unter Artilleriebeschuss. Aus dunklen Rauchwolken kamen oft ganze
Bündel von Papier angeflogen. Die Verwundeten kamen oft auf Krücken zu unserem Unterstand, ich habe sie dann zur
Krankensammelstelle hingeführt. Wir haben auch polnische Zivilpersonen betreut, die während der Kampfhandlungen
verwundet wurden. Als einmal 2 Jungen vorbeiliefen hat einer ihnen nachgerufen sie sollten seiner Frau Bescheid sagen,
er wäre auf der Krankensammelstelle an der Kirche. Als wir dort ankamen war seine Frau, mit einem Kind auf dem Arm,
schon da.
Nach der Kapitulation von Warschau, gingen wir über Sokolow zum Bug und haben dort Quartier bezogen. Der Russe hatte
sich bereits hinter den Fluss zurückgezogen, hatte alles Vieh und Pferde mitgenommen. Dort erreichte mich ein Telegramm
von zu Hause, dass meine Tochter gestorben ist. Es sprach sich auch herum dass verschiedene Heimaturlaub bekommen haben,
ich durfte auch für 14 Tage heim. Wir fuhren mit Lastautos nach Allenstein in die neue Reiterkaserne, zum
Ersatzbatallion, da haben wir unsere Gewehre und Munition abgeben, dann durften wir, jeder in seinen Heimatort
weiterfahren.
Als wir unsere Quartiere am Bug verlassen haben war sehr viel Schnee gefallen. Hier in Ortelsburg fanden wir die
gleiche Wetterlage vor, aber nach 3 Tagen war alles wieder weggetaut und wir konnten die Kartoffelernte, die durch den
frühen Wintereinbruch gestoppt wurde, zu Ende bringen. Ein Tag bevor ich zu Hause angekommen bin wurde die Tochter
beerdigt. Nach 14 Tagen mussten wir uns in Allenstein melden, Gewehre empfangen und wieder zurück zur Division an den
Bug 150 Kilometer hinter Warschau. Die elfte Division, zu der wir auch gehörten sollte in den Westen Deutschlands
verlegt werden und war schon unterwegs zur Verladestation Skiernewice 50 Kilometer vor Warschau.
Bei diesem Unternehmen, das erfolglos ausging, weil die Toten schon verscharrt waren, durchschlug eine Kugel den
Stahlhelm von Leutnant Briskorn, der auch sofort tot war. Alle Toten wurden später, an der Kirchenmauer in Grochow, in
Särgen beigesetzt: Hauptmann Schönwald sagte, das sie nach dem Kriege auf den Heldenfriedhof nach Ortelsburg überführt
werden. Drei Tage lagen wir bei Grochow in Stellungen, waren dem polnischen Maschinengewehrfeuer sowie den Bomben
deutscher Flugzeuge ausgesetzt. In der Nacht musste ich zu einem Verwundeten in die vorderste Linie und habe den
Rückweg nicht mehr finden können, als plötzlich Gewehrfeuer aufflammte habe ich in den Ruinen Schutz gesucht. Erst im
Morgengrauen konnte ich mich wieder orientieren und zu meinem Unterstand zurückfinden.
Warschau wurde tagelang bombardiert und stand auch unter Artilleriebeschuss. Aus dunklen Rauchwolken kamen oft ganze
Bündel von Papier angeflogen. Die Verwundeten kamen oft auf Krücken zu unserem Unterstand, ich habe sie dann zur
Krankensammelstelle hingeführt. Wir haben auch polnische Zivilpersonen betreut, die während der Kampfhandlungen
verwundet wurden. Als einmal 2 Jungen vorbeiliefen hat einer ihnen nachgerufen sie sollten seiner Frau Bescheid sagen,
er wäre auf der Krankensammelstelle an der Kirche. Als wir dort ankamen war seine Frau, mit einem Kind auf dem Arm,
schon da.
Nach der Kapitulation von Warschau, gingen wir über Sokolow zum Bug und haben dort Quartier bezogen. Der Russe hatte
sich bereits hinter den Fluss zurückgezogen, hatte alles Vieh und Pferde mitgenommen. Dort erreichte mich ein Telegramm
von zu Hause, dass meine Tochter gestorben ist. Es sprach sich auch herum dass verschiedene Heimaturlaub bekommen haben,
ich durfte auch für 14 Tage heim. Wir fuhren mit Lastautos nach Allenstein in die neue Reiterkaserne, zum
Ersatzbatallion, da haben wir unsere Gewehre und Munition abgeben, dann durften wir, jeder in seinen Heimatort
weiterfahren.
Als wir unsere Quartiere am Bug verlassen haben war sehr viel Schnee gefallen. Hier in Ortelsburg fanden wir die
gleiche Wetterlage vor, aber nach 3 Tagen war alles wieder weggetaut und wir konnten die Kartoffelernte, die durch den
frühen Wintereinbruch gestoppt wurde, zu Ende bringen. Ein Tag bevor ich zu Hause angekommen bin wurde die Tochter
beerdigt. Nach 14 Tagen mussten wir uns in Allenstein melden, Gewehre empfangen und wieder zurück zur Division an den
Bug 150 Kilometer hinter Warschau. Die elfte Division, zu der wir auch gehörten sollte in den Westen Deutschlands
verlegt werden und war schon unterwegs zur Verladestation Skiernewice 50 Kilometer vor Warschau.
Nach der Kapitulation von Warschau, gingen wir über Sokolow zum Bug und haben dort Quartier bezogen. Der Russe hatte
sich bereits hinter den Fluss zurückgezogen, hatte alles Vieh und Pferde mitgenommen. Dort erreichte mich ein Telegramm
von zu Hause, dass meine Tochter gestorben ist. Es sprach sich auch herum dass verschiedene Heimaturlaub bekommen haben,
ich durfte auch für 14 Tage heim. Wir fuhren mit Lastautos nach Allenstein in die neue Reiterkaserne, zum
Ersatzbatallion, da haben wir unsere Gewehre und Munition abgeben, dann durften wir, jeder in seinen Heimatort
weiterfahren.
Als wir unsere Quartiere am Bug verlassen haben war sehr viel Schnee gefallen. Hier in Ortelsburg fanden wir die
gleiche Wetterlage vor, aber nach 3 Tagen war alles wieder weggetaut und wir konnten die Kartoffelernte, die durch den
frühen Wintereinbruch gestoppt wurde, zu Ende bringen. Ein Tag bevor ich zu Hause angekommen bin wurde die Tochter
beerdigt. Nach 14 Tagen mussten wir uns in Allenstein melden, Gewehre empfangen und wieder zurück zur Division an den
Bug 150 Kilometer hinter Warschau. Die elfte Division, zu der wir auch gehörten sollte in den Westen Deutschlands
verlegt werden und war schon unterwegs zur Verladestation Skiernewice 50 Kilometer vor Warschau.
Unser Bataillon kam in das Städtchen Burscheid, im Kreis Opladen, wo wir in Privatquartieren
untergebracht wurden. Nach 3 Monaten, im Januar 1940, wurden wir nach Solingen verlegt, wo wir bis zum
Frankreichfeldzug stationiert waren. Wir mussten an Feldübungen teilnehmen, wie andere die in Kasernen untergebracht
waren. Während dieser Zeit musste jeder seine Zähne in Ordnung bringen lassen. Jeden Tag fuhren 20 Mann in die
Cäzilienstraße nach Köln, zur Zahnklinik. Im Rheinland wurde unsere Division neu aufgestellt. Ausfälle durch den
Polenfeldzug wurden durch neue Soldaten ergänzt. Ich kam nun zum Ersatzbatallion, war der Älteste in der ganzen
Kompanie. Als der Frankreichfeldzug losging wurde unser Ersatzbatallion mit den noch vorhandenen Verwundeten, in die
neue Reiterkaserne, nach Allenstein verlegt.
Meine Frau hat, mit Unterstützung der Bauernschaft, einen Antrag gestellt, daraufhin wurde ich zur Frühjahrsbestellung,
beurlaubt und später bis auf weiteres vom Militärdienst freigestellt. Als der Russlandfeldzug losging wurde ich von der
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg, für 14 Tage einberufen. Ich war seit 1922, Mitglied der freiwilligen
Sanitätsbereitschaft Ortelsburg und habe jedes Jahr an Übungen teilgenommen. Jede Bereitschaft musste etliche Leute
stellen. Von Rohmanen wurden Emil Rosowski, Johann Dembek, und ich, zur Krankensammelstelle Wirballen, in Litauen,
abkommandiert. Dorthin kamen Lazarettzüge aus Russland mit der Breitspurbahn. Die Verwundeten wurden frisch verbunden
und auf Waggon mit Normalspur verladen und nach Deutschland gebracht.
Als die 14 Tage vergangen waren wollten wir wieder nach Haus zurück, doch man wollte uns nicht entlassen. Stattdessen
wurden wir dem Wehrkreisamt Königsberg zugeteilt, neu eingekleidet und zur Aushilfe ins Lazarett nach Gumbinnen
abkommandiert. Mehr als ein Jahr war ich in den Urlauber-Baracken, habe dort Krankenstube betreut. Später, bis zum
Dezember 1944, war ich im Reserve-Lazarett 4, in Königsberg tätig. Dort habe ich auch die Luftangriffe der Engländer,
vom 25 bis 26. August 1944 miterlebt.
Wir sollten gerade einen Lazarettzug in Rotenstein entladen, als plötzlich die Sirenen ertönten - Fliegeralarm. Im
gleichen Moment waren die ersten Flugzeuge auch schon da, zuerst warfen sie „Tannenbäume” und danach Foßforkanister ab.
Die Omnibusse standen schon zur Abfahrt bereit als es losging. Wir haben die Verwundeten schnell in den
Luftschutzkeller getragen, haben die Betten von den Fenstern weggerückt damit die Verwundeten nicht von den
Glasssplittern verletzt wurden. Im Kasernenhof brannten die Fosforkanister lichterloh. Unsere Unterkunft, die sich in
einer Baracke befand ist völlig abgebrannt, mit dem Wenigen was wir unser Eigen nannten. Am nächsten Tag wurden wir neu
eingekleidet und am 29. bis 30. kamen die englischen Bomber wieder, sie setzten genau da ihr Zerstörungswerk fort wo
sie vor 3 Tagen aufgehört hatten.
Anfang Dezember 1944 musste ich mich nach Stablack melden und musste dann zur Sanitätsabteilung 1, nach Gernau, das
liegt zwischen Lodz und Warschau. Vormittags hatten wir Felddienstübungen und nachmittags theoretischen Unterricht.
Jeden Tag wurden Gruppen zusammengestellt und zu anderen Einheiten abkommandiert. Ich kam zu einer Panzerabteilung, wo
wir an einem Morgen plötzlich auf dem Kasernenhof antreten mussten und zu unserer Überraschung mit der Nachricht
konfrontiert wurden, dass der Russe an mehreren Frontabschnitten durchgebrochen war. Wir bekamen sofort einen
Marschbefehl in Richtung Lodz, wo das Stadtbild noch intakt war, selbst die Straßenbahnen fuhren noch. In der Nacht
haben russische Flugzeuge die Stadt bombardiert. Die Kaserne in der wir untergebracht waren hatte keine
Luftschutzkeller, aber zum Glück blieben wir von Bombentreffern verschont. Am nächsten morgen bot sich uns ein Bild der
Verwüstung. Die entgleisten Straßenbahnwagen, sowie andere Fahrzeuge blockierten die Straßen. Die Älteren unter uns
bekamen Fahrscheine für einen Transportzug, der bereit hinter Lodz abfahrbereit, unter Dampf stehen sollte. Als
russische Panzer in den Straßen auftauchten, verbrannte die Schreibstube unsere Wehrpässe und andere wichtige
Dokumente. Wir liefen zu der Station auf der unser Transportzug bereitstehen sollte, aber da war kein Zug mehr zu sehen
und wir setzten unseren Rückzug zu Fuß fort.
Der Rückzug und Zusammenbruch der Ostfront
In Dobroschin, einer Stadt in Polen, wurde gerade ein Lazarettzug verladen, doch wir kamen nicht
mehr zum Einsatz, weil die russische Infanterie uns schon auf den Fersen war. Es ging weiter über den Fluss Bober,
Sagan, bis nach Glogau an der Oder. Dort wurden wir der 29. motorisierten Sanitätskompanie zugeteilt. Im
Garnisonslazarett wurden noch Operationen durchgeführt. Unsere Division hatte ihr eigenes Feldlazarett, so dass wir den
Befehl zu Weiterfahrt erhielten und noch unbeschadet die Oderbrücke passieren konnten, denn Glogau wurde zur Festung
erklärt. Wir haben 2 Pferdewagen organisiert und mit Verbänden, sowie medizinischen Instrumenten beladen. So kamen wir
bis nach Lübbenau im Spreewald, wo wir in einem Schloss, in zuvor ein Museum war, unser Lazarett untergebracht haben.
Weil die Amerikaner Cottbus bombardiert hatten, wurden die Verwundeten zu uns nach Lübbenau gebracht. Hier haben wir
Tag und Nacht gearbeitet, um die vielen Verwundeten, aus den schweren Kämpfen bei Grünberg und Sagan zu versorgen. Die
Soldaten von der Abwehrfront kamen schon mit abgestorbenen Armen oder Beinen bei uns an, weil in vorderster Linie keine
Frontlazarette mehr vorhanden waren; es mussten viele Amputationen durchgeführt werden. Als für unsere Pferde kein Heu
mehr vorhanden war, schickte mich unser Hauptfeldwebel, zu einem Bauern in den Spreewald, mit dem Auftrag, Futter zu
besorgen. Mit noch zwei Mann fuhren mit zwei Kähnen, zuerst den Hauptstrom entlang und dann in einen Nebenarm; da haben
wir die Boote beladen und brachten das Heu nach Lübbenau.
Als wir uns bei unser Einheit zurück melden wollten, war alles schon marschbereit. Ich bin schnell in einen Bus
eingestiegen der sofort losfuhr, weil russische Verbände schon in sichtweite waren. Russische Flugzeuge kreisten über
den Dächern und nahmen, mit ihren Bordwaffen jeden unter Beschuss, der sich irgendwo blicken ließ. Wir konnten nur
durch den Wald, oder in der Nacht vorwärts kommen, denn wenn ein Auto auf der Landstraße fuhr, war alsbald ein Flugzeug
hinter ihm her und schoss es in Brand. Als wir nach Tagen am Ufer der Elbe ankamen, war bereits eine Ponton-Brücke
erstellt worden, welche die zerstörte Brücke ersetzen sollte.
Durch die vielen Fahrzeuge waren in den Sand tiefe Spuren gefahren, so dass andere Fahrzeuge unsere Busse ins
Schlepptau nehmen mussten, weil wir mit eigener Kraft nicht mehr weiterkamen. Beiderseits der Trasse standen
Flüchtlingswagen, in der der Hoffnung die Brücke passieren zu können, doch SS-Polizei verhinderte das die Gespanne den
militärischen Rückzug zum Stillstand brachten. Es gelang uns die Elbe zu überqueren, um in einem Waldstück Schutz vor
feindlichen Fliegern zu suchen.
Als wir unsere Busse und Autos gut getarnt hatten, hat unser Bataillonschef die anwesenden Parteigrößen zu sich
gerufen und ihnen erklärt das wir eine Einheit des Roten Kreuzes sind und nach internationalem Recht keine Waffen
besitzen dürfen. Nach langer, erregter Diskussion wurde beschlossen einen Graben auszuheben und alles im Sand zu
verscharren. Als wir dann weiter, durch die Dörfer fuhren, sahen wir schon viele weiße Bettlaken, als Zeichen der
Kapitulation, aus den Fenstern hängen. Es wurde uns erzählt dass der Bürgermeister von der SS erschossen wurde, weil
er die Bevölkerung zu diesem Schritt ermutigt hatte. Jetzt waren hinter uns die Russen und vor uns schon die Amerikaner.
Amerikanische Panzer fuhren umher und schossen wild durch die Gegend, ohne ein Ziel anzuvisieren. Niemand wollte sich
dem Russen ergeben, doch der Weg der zu den Amerikanern führte, war durch abgesägte Bäume blockiert. Wir sind schnell
in das nächste Dorf gegangen, haben uns Sägen und Äxte besorgt, die Bäume durchgesägt und in den Straßengraben
geworfen.
“ Nach dem Ende des 2. Weltkrieges.”
In amerikanische Kriegsgefangenschaft
Dann fuhren wir unter internationaler Flagge an eine Mulde Brücke, vor der zwei amerikanische Soldaten, mit Zigarren,
zur Hälfte im Mund, standen. Sie rauchten und kauten gleichzeitig. Wir mussten auf einen freien Platz fahren, alle
aussteigen und rechts wieder antreten. Wäschebeutel und Tornister mussten wir abstellen; danach wurden wir nach Waffen
durchsucht, Wertsachen, Uhren und Messer wurden uns gleich abgenommen. Als wir anschließend an unserem Gepäck
vorbeigingen durfte niemand was mitnehmen. Als ich gebückt, nach meinem Wäschebeutel greifen wollte, in dem sich noch
3 Konservendosen und ein Brot befanden, bekam ich einen Fußtritt ins Gesicht, so dass mir ein Zahn ausgeschlagen wurde.
Wir wurden dann in einem Garten zusammen getrieben und gefragt ob jemand bei der SS gedient hat. Nachdem wir in Reihe
und Glied angetreten waren, mussten wir den Oberkörper freimachen und die Arme anheben. Es wurde nach SS-Zeichen
gesucht, die gewöhnlich unter dem Oberarm eintätowiert waren. Nachdem wir Grimma bei Leipzig, wo wir in amerikanische
Gefangenschaft geraten waren, verlassen hatten, mussten wir durch ganz Thüringen bis Hersfeld, an der Grenze zu Hessen,
marschieren. In Hersfeld wurden wir auf große Lastautos verladen, die von farbigen Soldaten gefahren wurden. Man hat
uns mit Stöcken hinauf getrieben, solange bis das Auto so voll war das man kaum stehen konnte. Die Soldaten fuhren, für
diese Straßenverhältnisse, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Wenn die Straße eine scharfe Kurve hatte, flogen
wir alle übereinander und mussten erst mit viel Kraftanstrengung auf die Beine kommen um diese Fahrt zu überstehen.
Da die Straßenränder in dieser Gegend mit Obstbäumen bepflanzt sind und deren Äste sehr niedrig hängen, hätten die
uns die Köpfe abgerissen, wenn wir uns nicht ständig geduckt hätten. Unsere Fahrt endete in Bad Kreuznach, in der Pfalz,
wo wir in ein Lager, in dem sich später 130.000 Mann und 6 Generäle befanden, eingepfercht wurden. Die Unterkunft der
Generäle befand sich unter einem Zelt, alle anderen mussten die Zeit unter freiem Himmel zubringen. Die Offiziere, die
Unteroffiziere, die Mannschaften; wurden in getrennten Camps untergebracht. Die Mannschaften wurden auch zur Arbeit
abkommandiert und konnten bei dieser Gelegenheit, Brot, Brötchen oder Zigarettenstummel organisieren, wogegen die
Offiziere und Unteroffiziere ihr Camp überhaupt nicht verlassen durften.
Die ersten Tage gab es kein Wasser und kein Brot, so dass die Kameraden vor Erschöpfung umfielen. Später standen wir
manchmal den ganzen Tag nach Wasser an, das von den, uns bewachenden Negern mit großen Wassertanks angefahren wurde. Am
dritten Tag bekamen wir mittags und abends etwas zu Essen; Brot bekamen wir erst nach zwei Wochen, nach dem aus der
Umgebung herbeigeholte Handwerker, Backöfen gebaut hatten. In den verschiedenen Gemeinden, die in den uns umgebenden
Weinbergen lagen, mussten sich alle Männer beim Bürgermeister melden. Als sie dann erschienen waren, wurden sie auf
bereitstehende Lastautos getrieben und zu uns ins Lager gebracht. Sie waren ohne Kopfbedeckung und ohne wärmere
Bekleidung angekommen, weil ihnen gesagt wurde, dass ihr Aufenthalt im Lager nur von kurzer Dauer sein würde. Man hat
uns, falls noch vorhanden, Decken und Mäntel abgenommen, mit der Begründung, sie würden für Kranke und Verwundete
gebraucht. Jeden Tag starben mehr als 200 Mann, die wir sofort in ein Zelt tragen mussten. In der Nacht wurden die
Toten dann mit unbekanntem Ziel, weggefahren.
Viele haben ihren Verstand verloren uns irrten im ganzen Camp ziellos umher. Als Latrinen wurden Gräben ausgehoben, in
die verschiedene Kameraden, bei der Verrichtung ihrer Notdurft, vor Schwäche hineingefallen sind und nicht mehr wieder
heraus kamen. Aus den Pfählen die, die jungen Obstbäume stützten, haben wir Krankentragen gebaut um unsere Kameraden,
bei Bedarf, zur Krankensammelstelle zu tragen. Es war in diesem Frühjahr auch sehr kalt, doch unsere Erdlöcher, die wir
zum Schutz vor Kälte und Wind, nur mit leeren Konservendosen ausgehoben hatten, durften nicht tiefer als 20 Zentimeter
sein. Nach jedem Regenguss mussten wir das Wasser ausschöpfen. Nach einem Gewitter, standen wir wiedermal, total
durchnässt in unserem Camp, als unerwartet am Horizont die Sonne hervortrat. Einer unserer Kameraden hatte noch eine
Trompete gerettet und fing, von dem Anblick völlig überwältigt, zu spielen an: "Es geht alles vorüber, es geht alles
vorbei, nach jedem Dezember, folgt wieder ein Mai". Daraufhin hob sich die Stimmung der tiefbetrübten Kriegsgefangenen,
so das Heimatlieder durch das ganze Camp erklangen, obwohl wir in den nassen Kleider herumgehen mussten, bis sie am
Körper trocken wurden.
Als die 14 Tage vergangen waren wollten wir wieder nach Haus zurück, doch man wollte uns nicht entlassen. Stattdessen
wurden wir dem Wehrkreisamt Königsberg zugeteilt, neu eingekleidet und zur Aushilfe ins Lazarett nach Gumbinnen
abkommandiert. Mehr als ein Jahr war ich in den Urlauber-Baracken, habe dort Krankenstube betreut. Später, bis zum
Dezember 1944, war ich im Reserve-Lazarett 4, in Königsberg tätig. Dort habe ich auch die Luftangriffe der Engländer,
vom 25 bis 26. August 1944 miterlebt.
Wir sollten gerade einen Lazarettzug in Rotenstein entladen, als plötzlich die Sirenen ertönten - Fliegeralarm. Im
gleichen Moment waren die ersten Flugzeuge auch schon da, zuerst warfen sie „Tannenbäume” und danach Foßforkanister ab.
Die Omnibusse standen schon zur Abfahrt bereit als es losging. Wir haben die Verwundeten schnell in den
Luftschutzkeller getragen, haben die Betten von den Fenstern weggerückt damit die Verwundeten nicht von den
Glasssplittern verletzt wurden. Im Kasernenhof brannten die Fosforkanister lichterloh. Unsere Unterkunft, die sich in
einer Baracke befand ist völlig abgebrannt, mit dem Wenigen was wir unser Eigen nannten. Am nächsten Tag wurden wir neu
eingekleidet und am 29. bis 30. kamen die englischen Bomber wieder, sie setzten genau da ihr Zerstörungswerk fort wo
sie vor 3 Tagen aufgehört hatten.
Anfang Dezember 1944 musste ich mich nach Stablack melden und musste dann zur Sanitätsabteilung 1, nach Gernau, das
liegt zwischen Lodz und Warschau. Vormittags hatten wir Felddienstübungen und nachmittags theoretischen Unterricht.
Jeden Tag wurden Gruppen zusammengestellt und zu anderen Einheiten abkommandiert. Ich kam zu einer Panzerabteilung, wo
wir an einem Morgen plötzlich auf dem Kasernenhof antreten mussten und zu unserer Überraschung mit der Nachricht
konfrontiert wurden, dass der Russe an mehreren Frontabschnitten durchgebrochen war. Wir bekamen sofort einen
Marschbefehl in Richtung Lodz, wo das Stadtbild noch intakt war, selbst die Straßenbahnen fuhren noch. In der Nacht
haben russische Flugzeuge die Stadt bombardiert. Die Kaserne in der wir untergebracht waren hatte keine
Luftschutzkeller, aber zum Glück blieben wir von Bombentreffern verschont. Am nächsten morgen bot sich uns ein Bild der
Verwüstung. Die entgleisten Straßenbahnwagen, sowie andere Fahrzeuge blockierten die Straßen. Die Älteren unter uns
bekamen Fahrscheine für einen Transportzug, der bereit hinter Lodz abfahrbereit, unter Dampf stehen sollte. Als
russische Panzer in den Straßen auftauchten, verbrannte die Schreibstube unsere Wehrpässe und andere wichtige
Dokumente. Wir liefen zu der Station auf der unser Transportzug bereitstehen sollte, aber da war kein Zug mehr zu sehen
und wir setzten unseren Rückzug zu Fuß fort.
Anfang Dezember 1944 musste ich mich nach Stablack melden und musste dann zur Sanitätsabteilung 1, nach Gernau, das liegt zwischen Lodz und Warschau. Vormittags hatten wir Felddienstübungen und nachmittags theoretischen Unterricht. Jeden Tag wurden Gruppen zusammengestellt und zu anderen Einheiten abkommandiert. Ich kam zu einer Panzerabteilung, wo wir an einem Morgen plötzlich auf dem Kasernenhof antreten mussten und zu unserer Überraschung mit der Nachricht konfrontiert wurden, dass der Russe an mehreren Frontabschnitten durchgebrochen war. Wir bekamen sofort einen Marschbefehl in Richtung Lodz, wo das Stadtbild noch intakt war, selbst die Straßenbahnen fuhren noch. In der Nacht haben russische Flugzeuge die Stadt bombardiert. Die Kaserne in der wir untergebracht waren hatte keine Luftschutzkeller, aber zum Glück blieben wir von Bombentreffern verschont. Am nächsten morgen bot sich uns ein Bild der Verwüstung. Die entgleisten Straßenbahnwagen, sowie andere Fahrzeuge blockierten die Straßen. Die Älteren unter uns bekamen Fahrscheine für einen Transportzug, der bereit hinter Lodz abfahrbereit, unter Dampf stehen sollte. Als russische Panzer in den Straßen auftauchten, verbrannte die Schreibstube unsere Wehrpässe und andere wichtige Dokumente. Wir liefen zu der Station auf der unser Transportzug bereitstehen sollte, aber da war kein Zug mehr zu sehen und wir setzten unseren Rückzug zu Fuß fort.
In Dobroschin, einer Stadt in Polen, wurde gerade ein Lazarettzug verladen, doch wir kamen nicht
mehr zum Einsatz, weil die russische Infanterie uns schon auf den Fersen war. Es ging weiter über den Fluss Bober,
Sagan, bis nach Glogau an der Oder. Dort wurden wir der 29. motorisierten Sanitätskompanie zugeteilt. Im
Garnisonslazarett wurden noch Operationen durchgeführt. Unsere Division hatte ihr eigenes Feldlazarett, so dass wir den
Befehl zu Weiterfahrt erhielten und noch unbeschadet die Oderbrücke passieren konnten, denn Glogau wurde zur Festung
erklärt. Wir haben 2 Pferdewagen organisiert und mit Verbänden, sowie medizinischen Instrumenten beladen. So kamen wir
bis nach Lübbenau im Spreewald, wo wir in einem Schloss, in zuvor ein Museum war, unser Lazarett untergebracht haben.
Weil die Amerikaner Cottbus bombardiert hatten, wurden die Verwundeten zu uns nach Lübbenau gebracht. Hier haben wir
Tag und Nacht gearbeitet, um die vielen Verwundeten, aus den schweren Kämpfen bei Grünberg und Sagan zu versorgen. Die
Soldaten von der Abwehrfront kamen schon mit abgestorbenen Armen oder Beinen bei uns an, weil in vorderster Linie keine
Frontlazarette mehr vorhanden waren; es mussten viele Amputationen durchgeführt werden. Als für unsere Pferde kein Heu
mehr vorhanden war, schickte mich unser Hauptfeldwebel, zu einem Bauern in den Spreewald, mit dem Auftrag, Futter zu
besorgen. Mit noch zwei Mann fuhren mit zwei Kähnen, zuerst den Hauptstrom entlang und dann in einen Nebenarm; da haben
wir die Boote beladen und brachten das Heu nach Lübbenau.
Als wir uns bei unser Einheit zurück melden wollten, war alles schon marschbereit. Ich bin schnell in einen Bus
eingestiegen der sofort losfuhr, weil russische Verbände schon in sichtweite waren. Russische Flugzeuge kreisten über
den Dächern und nahmen, mit ihren Bordwaffen jeden unter Beschuss, der sich irgendwo blicken ließ. Wir konnten nur
durch den Wald, oder in der Nacht vorwärts kommen, denn wenn ein Auto auf der Landstraße fuhr, war alsbald ein Flugzeug
hinter ihm her und schoss es in Brand. Als wir nach Tagen am Ufer der Elbe ankamen, war bereits eine Ponton-Brücke
erstellt worden, welche die zerstörte Brücke ersetzen sollte.
Durch die vielen Fahrzeuge waren in den Sand tiefe Spuren gefahren, so dass andere Fahrzeuge unsere Busse ins
Schlepptau nehmen mussten, weil wir mit eigener Kraft nicht mehr weiterkamen. Beiderseits der Trasse standen
Flüchtlingswagen, in der der Hoffnung die Brücke passieren zu können, doch SS-Polizei verhinderte das die Gespanne den
militärischen Rückzug zum Stillstand brachten. Es gelang uns die Elbe zu überqueren, um in einem Waldstück Schutz vor
feindlichen Fliegern zu suchen.
Als wir unsere Busse und Autos gut getarnt hatten, hat unser Bataillonschef die anwesenden Parteigrößen zu sich
gerufen und ihnen erklärt das wir eine Einheit des Roten Kreuzes sind und nach internationalem Recht keine Waffen
besitzen dürfen. Nach langer, erregter Diskussion wurde beschlossen einen Graben auszuheben und alles im Sand zu
verscharren. Als wir dann weiter, durch die Dörfer fuhren, sahen wir schon viele weiße Bettlaken, als Zeichen der
Kapitulation, aus den Fenstern hängen. Es wurde uns erzählt dass der Bürgermeister von der SS erschossen wurde, weil
er die Bevölkerung zu diesem Schritt ermutigt hatte. Jetzt waren hinter uns die Russen und vor uns schon die Amerikaner.
Amerikanische Panzer fuhren umher und schossen wild durch die Gegend, ohne ein Ziel anzuvisieren. Niemand wollte sich
dem Russen ergeben, doch der Weg der zu den Amerikanern führte, war durch abgesägte Bäume blockiert. Wir sind schnell
in das nächste Dorf gegangen, haben uns Sägen und Äxte besorgt, die Bäume durchgesägt und in den Straßengraben
geworfen.
“ Nach dem Ende des 2. Weltkrieges.”
In amerikanische Kriegsgefangenschaft
Dann fuhren wir unter internationaler Flagge an eine Mulde Brücke, vor der zwei amerikanische Soldaten, mit Zigarren,
zur Hälfte im Mund, standen. Sie rauchten und kauten gleichzeitig. Wir mussten auf einen freien Platz fahren, alle
aussteigen und rechts wieder antreten. Wäschebeutel und Tornister mussten wir abstellen; danach wurden wir nach Waffen
durchsucht, Wertsachen, Uhren und Messer wurden uns gleich abgenommen. Als wir anschließend an unserem Gepäck
vorbeigingen durfte niemand was mitnehmen. Als ich gebückt, nach meinem Wäschebeutel greifen wollte, in dem sich noch
3 Konservendosen und ein Brot befanden, bekam ich einen Fußtritt ins Gesicht, so dass mir ein Zahn ausgeschlagen wurde.
Wir wurden dann in einem Garten zusammen getrieben und gefragt ob jemand bei der SS gedient hat. Nachdem wir in Reihe
und Glied angetreten waren, mussten wir den Oberkörper freimachen und die Arme anheben. Es wurde nach SS-Zeichen
gesucht, die gewöhnlich unter dem Oberarm eintätowiert waren. Nachdem wir Grimma bei Leipzig, wo wir in amerikanische
Gefangenschaft geraten waren, verlassen hatten, mussten wir durch ganz Thüringen bis Hersfeld, an der Grenze zu Hessen,
marschieren. In Hersfeld wurden wir auf große Lastautos verladen, die von farbigen Soldaten gefahren wurden. Man hat
uns mit Stöcken hinauf getrieben, solange bis das Auto so voll war das man kaum stehen konnte. Die Soldaten fuhren, für
diese Straßenverhältnisse, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Wenn die Straße eine scharfe Kurve hatte, flogen
wir alle übereinander und mussten erst mit viel Kraftanstrengung auf die Beine kommen um diese Fahrt zu überstehen.
Da die Straßenränder in dieser Gegend mit Obstbäumen bepflanzt sind und deren Äste sehr niedrig hängen, hätten die
uns die Köpfe abgerissen, wenn wir uns nicht ständig geduckt hätten. Unsere Fahrt endete in Bad Kreuznach, in der Pfalz,
wo wir in ein Lager, in dem sich später 130.000 Mann und 6 Generäle befanden, eingepfercht wurden. Die Unterkunft der
Generäle befand sich unter einem Zelt, alle anderen mussten die Zeit unter freiem Himmel zubringen. Die Offiziere, die
Unteroffiziere, die Mannschaften; wurden in getrennten Camps untergebracht. Die Mannschaften wurden auch zur Arbeit
abkommandiert und konnten bei dieser Gelegenheit, Brot, Brötchen oder Zigarettenstummel organisieren, wogegen die
Offiziere und Unteroffiziere ihr Camp überhaupt nicht verlassen durften.
Die ersten Tage gab es kein Wasser und kein Brot, so dass die Kameraden vor Erschöpfung umfielen. Später standen wir
manchmal den ganzen Tag nach Wasser an, das von den, uns bewachenden Negern mit großen Wassertanks angefahren wurde. Am
dritten Tag bekamen wir mittags und abends etwas zu Essen; Brot bekamen wir erst nach zwei Wochen, nach dem aus der
Umgebung herbeigeholte Handwerker, Backöfen gebaut hatten. In den verschiedenen Gemeinden, die in den uns umgebenden
Weinbergen lagen, mussten sich alle Männer beim Bürgermeister melden. Als sie dann erschienen waren, wurden sie auf
bereitstehende Lastautos getrieben und zu uns ins Lager gebracht. Sie waren ohne Kopfbedeckung und ohne wärmere
Bekleidung angekommen, weil ihnen gesagt wurde, dass ihr Aufenthalt im Lager nur von kurzer Dauer sein würde. Man hat
uns, falls noch vorhanden, Decken und Mäntel abgenommen, mit der Begründung, sie würden für Kranke und Verwundete
gebraucht. Jeden Tag starben mehr als 200 Mann, die wir sofort in ein Zelt tragen mussten. In der Nacht wurden die
Toten dann mit unbekanntem Ziel, weggefahren.
Viele haben ihren Verstand verloren uns irrten im ganzen Camp ziellos umher. Als Latrinen wurden Gräben ausgehoben, in
die verschiedene Kameraden, bei der Verrichtung ihrer Notdurft, vor Schwäche hineingefallen sind und nicht mehr wieder
heraus kamen. Aus den Pfählen die, die jungen Obstbäume stützten, haben wir Krankentragen gebaut um unsere Kameraden,
bei Bedarf, zur Krankensammelstelle zu tragen. Es war in diesem Frühjahr auch sehr kalt, doch unsere Erdlöcher, die wir
zum Schutz vor Kälte und Wind, nur mit leeren Konservendosen ausgehoben hatten, durften nicht tiefer als 20 Zentimeter
sein. Nach jedem Regenguss mussten wir das Wasser ausschöpfen. Nach einem Gewitter, standen wir wiedermal, total
durchnässt in unserem Camp, als unerwartet am Horizont die Sonne hervortrat. Einer unserer Kameraden hatte noch eine
Trompete gerettet und fing, von dem Anblick völlig überwältigt, zu spielen an: "Es geht alles vorüber, es geht alles
vorbei, nach jedem Dezember, folgt wieder ein Mai". Daraufhin hob sich die Stimmung der tiefbetrübten Kriegsgefangenen,
so das Heimatlieder durch das ganze Camp erklangen, obwohl wir in den nassen Kleider herumgehen mussten, bis sie am
Körper trocken wurden.
Als wir uns bei unser Einheit zurück melden wollten, war alles schon marschbereit. Ich bin schnell in einen Bus
eingestiegen der sofort losfuhr, weil russische Verbände schon in sichtweite waren. Russische Flugzeuge kreisten über
den Dächern und nahmen, mit ihren Bordwaffen jeden unter Beschuss, der sich irgendwo blicken ließ. Wir konnten nur
durch den Wald, oder in der Nacht vorwärts kommen, denn wenn ein Auto auf der Landstraße fuhr, war alsbald ein Flugzeug
hinter ihm her und schoss es in Brand. Als wir nach Tagen am Ufer der Elbe ankamen, war bereits eine Ponton-Brücke
erstellt worden, welche die zerstörte Brücke ersetzen sollte.
Durch die vielen Fahrzeuge waren in den Sand tiefe Spuren gefahren, so dass andere Fahrzeuge unsere Busse ins
Schlepptau nehmen mussten, weil wir mit eigener Kraft nicht mehr weiterkamen. Beiderseits der Trasse standen
Flüchtlingswagen, in der der Hoffnung die Brücke passieren zu können, doch SS-Polizei verhinderte das die Gespanne den
militärischen Rückzug zum Stillstand brachten. Es gelang uns die Elbe zu überqueren, um in einem Waldstück Schutz vor
feindlichen Fliegern zu suchen.
Als wir unsere Busse und Autos gut getarnt hatten, hat unser Bataillonschef die anwesenden Parteigrößen zu sich
gerufen und ihnen erklärt das wir eine Einheit des Roten Kreuzes sind und nach internationalem Recht keine Waffen
besitzen dürfen. Nach langer, erregter Diskussion wurde beschlossen einen Graben auszuheben und alles im Sand zu
verscharren. Als wir dann weiter, durch die Dörfer fuhren, sahen wir schon viele weiße Bettlaken, als Zeichen der
Kapitulation, aus den Fenstern hängen. Es wurde uns erzählt dass der Bürgermeister von der SS erschossen wurde, weil
er die Bevölkerung zu diesem Schritt ermutigt hatte. Jetzt waren hinter uns die Russen und vor uns schon die Amerikaner.
Amerikanische Panzer fuhren umher und schossen wild durch die Gegend, ohne ein Ziel anzuvisieren. Niemand wollte sich
dem Russen ergeben, doch der Weg der zu den Amerikanern führte, war durch abgesägte Bäume blockiert. Wir sind schnell
in das nächste Dorf gegangen, haben uns Sägen und Äxte besorgt, die Bäume durchgesägt und in den Straßengraben
geworfen.
Als wir unsere Busse und Autos gut getarnt hatten, hat unser Bataillonschef die anwesenden Parteigrößen zu sich gerufen und ihnen erklärt das wir eine Einheit des Roten Kreuzes sind und nach internationalem Recht keine Waffen besitzen dürfen. Nach langer, erregter Diskussion wurde beschlossen einen Graben auszuheben und alles im Sand zu verscharren. Als wir dann weiter, durch die Dörfer fuhren, sahen wir schon viele weiße Bettlaken, als Zeichen der Kapitulation, aus den Fenstern hängen. Es wurde uns erzählt dass der Bürgermeister von der SS erschossen wurde, weil er die Bevölkerung zu diesem Schritt ermutigt hatte. Jetzt waren hinter uns die Russen und vor uns schon die Amerikaner. Amerikanische Panzer fuhren umher und schossen wild durch die Gegend, ohne ein Ziel anzuvisieren. Niemand wollte sich dem Russen ergeben, doch der Weg der zu den Amerikanern führte, war durch abgesägte Bäume blockiert. Wir sind schnell in das nächste Dorf gegangen, haben uns Sägen und Äxte besorgt, die Bäume durchgesägt und in den Straßengraben geworfen.
In amerikanische Kriegsgefangenschaft
Dann fuhren wir unter internationaler Flagge an eine Mulde Brücke, vor der zwei amerikanische Soldaten, mit Zigarren,
zur Hälfte im Mund, standen. Sie rauchten und kauten gleichzeitig. Wir mussten auf einen freien Platz fahren, alle
aussteigen und rechts wieder antreten. Wäschebeutel und Tornister mussten wir abstellen; danach wurden wir nach Waffen
durchsucht, Wertsachen, Uhren und Messer wurden uns gleich abgenommen. Als wir anschließend an unserem Gepäck
vorbeigingen durfte niemand was mitnehmen. Als ich gebückt, nach meinem Wäschebeutel greifen wollte, in dem sich noch
3 Konservendosen und ein Brot befanden, bekam ich einen Fußtritt ins Gesicht, so dass mir ein Zahn ausgeschlagen wurde.
Wir wurden dann in einem Garten zusammen getrieben und gefragt ob jemand bei der SS gedient hat. Nachdem wir in Reihe
und Glied angetreten waren, mussten wir den Oberkörper freimachen und die Arme anheben. Es wurde nach SS-Zeichen
gesucht, die gewöhnlich unter dem Oberarm eintätowiert waren. Nachdem wir Grimma bei Leipzig, wo wir in amerikanische
Gefangenschaft geraten waren, verlassen hatten, mussten wir durch ganz Thüringen bis Hersfeld, an der Grenze zu Hessen,
marschieren. In Hersfeld wurden wir auf große Lastautos verladen, die von farbigen Soldaten gefahren wurden. Man hat
uns mit Stöcken hinauf getrieben, solange bis das Auto so voll war das man kaum stehen konnte. Die Soldaten fuhren, für
diese Straßenverhältnisse, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Wenn die Straße eine scharfe Kurve hatte, flogen
wir alle übereinander und mussten erst mit viel Kraftanstrengung auf die Beine kommen um diese Fahrt zu überstehen.
Da die Straßenränder in dieser Gegend mit Obstbäumen bepflanzt sind und deren Äste sehr niedrig hängen, hätten die
uns die Köpfe abgerissen, wenn wir uns nicht ständig geduckt hätten. Unsere Fahrt endete in Bad Kreuznach, in der Pfalz,
wo wir in ein Lager, in dem sich später 130.000 Mann und 6 Generäle befanden, eingepfercht wurden. Die Unterkunft der
Generäle befand sich unter einem Zelt, alle anderen mussten die Zeit unter freiem Himmel zubringen. Die Offiziere, die
Unteroffiziere, die Mannschaften; wurden in getrennten Camps untergebracht. Die Mannschaften wurden auch zur Arbeit
abkommandiert und konnten bei dieser Gelegenheit, Brot, Brötchen oder Zigarettenstummel organisieren, wogegen die
Offiziere und Unteroffiziere ihr Camp überhaupt nicht verlassen durften.
Die ersten Tage gab es kein Wasser und kein Brot, so dass die Kameraden vor Erschöpfung umfielen. Später standen wir
manchmal den ganzen Tag nach Wasser an, das von den, uns bewachenden Negern mit großen Wassertanks angefahren wurde. Am
dritten Tag bekamen wir mittags und abends etwas zu Essen; Brot bekamen wir erst nach zwei Wochen, nach dem aus der
Umgebung herbeigeholte Handwerker, Backöfen gebaut hatten. In den verschiedenen Gemeinden, die in den uns umgebenden
Weinbergen lagen, mussten sich alle Männer beim Bürgermeister melden. Als sie dann erschienen waren, wurden sie auf
bereitstehende Lastautos getrieben und zu uns ins Lager gebracht. Sie waren ohne Kopfbedeckung und ohne wärmere
Bekleidung angekommen, weil ihnen gesagt wurde, dass ihr Aufenthalt im Lager nur von kurzer Dauer sein würde. Man hat
uns, falls noch vorhanden, Decken und Mäntel abgenommen, mit der Begründung, sie würden für Kranke und Verwundete
gebraucht. Jeden Tag starben mehr als 200 Mann, die wir sofort in ein Zelt tragen mussten. In der Nacht wurden die
Toten dann mit unbekanntem Ziel, weggefahren.
Viele haben ihren Verstand verloren uns irrten im ganzen Camp ziellos umher. Als Latrinen wurden Gräben ausgehoben, in
die verschiedene Kameraden, bei der Verrichtung ihrer Notdurft, vor Schwäche hineingefallen sind und nicht mehr wieder
heraus kamen. Aus den Pfählen die, die jungen Obstbäume stützten, haben wir Krankentragen gebaut um unsere Kameraden,
bei Bedarf, zur Krankensammelstelle zu tragen. Es war in diesem Frühjahr auch sehr kalt, doch unsere Erdlöcher, die wir
zum Schutz vor Kälte und Wind, nur mit leeren Konservendosen ausgehoben hatten, durften nicht tiefer als 20 Zentimeter
sein. Nach jedem Regenguss mussten wir das Wasser ausschöpfen. Nach einem Gewitter, standen wir wiedermal, total
durchnässt in unserem Camp, als unerwartet am Horizont die Sonne hervortrat. Einer unserer Kameraden hatte noch eine
Trompete gerettet und fing, von dem Anblick völlig überwältigt, zu spielen an: "Es geht alles vorüber, es geht alles
vorbei, nach jedem Dezember, folgt wieder ein Mai". Daraufhin hob sich die Stimmung der tiefbetrübten Kriegsgefangenen,
so das Heimatlieder durch das ganze Camp erklangen, obwohl wir in den nassen Kleider herumgehen mussten, bis sie am
Körper trocken wurden.
Wir wurden dann in einem Garten zusammen getrieben und gefragt ob jemand bei der SS gedient hat. Nachdem wir in Reihe
und Glied angetreten waren, mussten wir den Oberkörper freimachen und die Arme anheben. Es wurde nach SS-Zeichen
gesucht, die gewöhnlich unter dem Oberarm eintätowiert waren. Nachdem wir Grimma bei Leipzig, wo wir in amerikanische
Gefangenschaft geraten waren, verlassen hatten, mussten wir durch ganz Thüringen bis Hersfeld, an der Grenze zu Hessen,
marschieren. In Hersfeld wurden wir auf große Lastautos verladen, die von farbigen Soldaten gefahren wurden. Man hat
uns mit Stöcken hinauf getrieben, solange bis das Auto so voll war das man kaum stehen konnte. Die Soldaten fuhren, für
diese Straßenverhältnisse, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Wenn die Straße eine scharfe Kurve hatte, flogen
wir alle übereinander und mussten erst mit viel Kraftanstrengung auf die Beine kommen um diese Fahrt zu überstehen.
Da die Straßenränder in dieser Gegend mit Obstbäumen bepflanzt sind und deren Äste sehr niedrig hängen, hätten die
uns die Köpfe abgerissen, wenn wir uns nicht ständig geduckt hätten. Unsere Fahrt endete in Bad Kreuznach, in der Pfalz,
wo wir in ein Lager, in dem sich später 130.000 Mann und 6 Generäle befanden, eingepfercht wurden. Die Unterkunft der
Generäle befand sich unter einem Zelt, alle anderen mussten die Zeit unter freiem Himmel zubringen. Die Offiziere, die
Unteroffiziere, die Mannschaften; wurden in getrennten Camps untergebracht. Die Mannschaften wurden auch zur Arbeit
abkommandiert und konnten bei dieser Gelegenheit, Brot, Brötchen oder Zigarettenstummel organisieren, wogegen die
Offiziere und Unteroffiziere ihr Camp überhaupt nicht verlassen durften.
Die ersten Tage gab es kein Wasser und kein Brot, so dass die Kameraden vor Erschöpfung umfielen. Später standen wir
manchmal den ganzen Tag nach Wasser an, das von den, uns bewachenden Negern mit großen Wassertanks angefahren wurde. Am
dritten Tag bekamen wir mittags und abends etwas zu Essen; Brot bekamen wir erst nach zwei Wochen, nach dem aus der
Umgebung herbeigeholte Handwerker, Backöfen gebaut hatten. In den verschiedenen Gemeinden, die in den uns umgebenden
Weinbergen lagen, mussten sich alle Männer beim Bürgermeister melden. Als sie dann erschienen waren, wurden sie auf
bereitstehende Lastautos getrieben und zu uns ins Lager gebracht. Sie waren ohne Kopfbedeckung und ohne wärmere
Bekleidung angekommen, weil ihnen gesagt wurde, dass ihr Aufenthalt im Lager nur von kurzer Dauer sein würde. Man hat
uns, falls noch vorhanden, Decken und Mäntel abgenommen, mit der Begründung, sie würden für Kranke und Verwundete
gebraucht. Jeden Tag starben mehr als 200 Mann, die wir sofort in ein Zelt tragen mussten. In der Nacht wurden die
Toten dann mit unbekanntem Ziel, weggefahren.
Viele haben ihren Verstand verloren uns irrten im ganzen Camp ziellos umher. Als Latrinen wurden Gräben ausgehoben, in
die verschiedene Kameraden, bei der Verrichtung ihrer Notdurft, vor Schwäche hineingefallen sind und nicht mehr wieder
heraus kamen. Aus den Pfählen die, die jungen Obstbäume stützten, haben wir Krankentragen gebaut um unsere Kameraden,
bei Bedarf, zur Krankensammelstelle zu tragen. Es war in diesem Frühjahr auch sehr kalt, doch unsere Erdlöcher, die wir
zum Schutz vor Kälte und Wind, nur mit leeren Konservendosen ausgehoben hatten, durften nicht tiefer als 20 Zentimeter
sein. Nach jedem Regenguss mussten wir das Wasser ausschöpfen. Nach einem Gewitter, standen wir wiedermal, total
durchnässt in unserem Camp, als unerwartet am Horizont die Sonne hervortrat. Einer unserer Kameraden hatte noch eine
Trompete gerettet und fing, von dem Anblick völlig überwältigt, zu spielen an: "Es geht alles vorüber, es geht alles
vorbei, nach jedem Dezember, folgt wieder ein Mai". Daraufhin hob sich die Stimmung der tiefbetrübten Kriegsgefangenen,
so das Heimatlieder durch das ganze Camp erklangen, obwohl wir in den nassen Kleider herumgehen mussten, bis sie am
Körper trocken wurden.
Die ersten Tage gab es kein Wasser und kein Brot, so dass die Kameraden vor Erschöpfung umfielen. Später standen wir
manchmal den ganzen Tag nach Wasser an, das von den, uns bewachenden Negern mit großen Wassertanks angefahren wurde. Am
dritten Tag bekamen wir mittags und abends etwas zu Essen; Brot bekamen wir erst nach zwei Wochen, nach dem aus der
Umgebung herbeigeholte Handwerker, Backöfen gebaut hatten. In den verschiedenen Gemeinden, die in den uns umgebenden
Weinbergen lagen, mussten sich alle Männer beim Bürgermeister melden. Als sie dann erschienen waren, wurden sie auf
bereitstehende Lastautos getrieben und zu uns ins Lager gebracht. Sie waren ohne Kopfbedeckung und ohne wärmere
Bekleidung angekommen, weil ihnen gesagt wurde, dass ihr Aufenthalt im Lager nur von kurzer Dauer sein würde. Man hat
uns, falls noch vorhanden, Decken und Mäntel abgenommen, mit der Begründung, sie würden für Kranke und Verwundete
gebraucht. Jeden Tag starben mehr als 200 Mann, die wir sofort in ein Zelt tragen mussten. In der Nacht wurden die
Toten dann mit unbekanntem Ziel, weggefahren.
Viele haben ihren Verstand verloren uns irrten im ganzen Camp ziellos umher. Als Latrinen wurden Gräben ausgehoben, in
die verschiedene Kameraden, bei der Verrichtung ihrer Notdurft, vor Schwäche hineingefallen sind und nicht mehr wieder
heraus kamen. Aus den Pfählen die, die jungen Obstbäume stützten, haben wir Krankentragen gebaut um unsere Kameraden,
bei Bedarf, zur Krankensammelstelle zu tragen. Es war in diesem Frühjahr auch sehr kalt, doch unsere Erdlöcher, die wir
zum Schutz vor Kälte und Wind, nur mit leeren Konservendosen ausgehoben hatten, durften nicht tiefer als 20 Zentimeter
sein. Nach jedem Regenguss mussten wir das Wasser ausschöpfen. Nach einem Gewitter, standen wir wiedermal, total
durchnässt in unserem Camp, als unerwartet am Horizont die Sonne hervortrat. Einer unserer Kameraden hatte noch eine
Trompete gerettet und fing, von dem Anblick völlig überwältigt, zu spielen an: "Es geht alles vorüber, es geht alles
vorbei, nach jedem Dezember, folgt wieder ein Mai". Daraufhin hob sich die Stimmung der tiefbetrübten Kriegsgefangenen,
so das Heimatlieder durch das ganze Camp erklangen, obwohl wir in den nassen Kleider herumgehen mussten, bis sie am
Körper trocken wurden.
Nach etwa einem Monat, haben uns die Amerikaner, den Franzosen, zum Arbeitseinsatz, ausgeliefert.
Etwa 4 Kilometer von Bad Kreuznach entfernt, stand auf freier Strecke, ein Zug mit offenen Kohlenloren, auf den wir
verladen wurden. In jeden Waggon, wurde pro Person eine Tafel Schokolade und ein Päcken Zwieback rein geworfen, doch
viele Kameraden fanden nur leere Päckchen vor, weil die schon zuvor von der französischen Wachmannschaft geplündert
wurden. Wir haben uns darüber beschwert, doch die haben uns nur ausgelacht. Nachdem wir zunächst bei Mainz über den
Rhein fuhren, endete unsere Fahrt bei Paris in einem großen Zeltlager. Dort wurden wir auf andere Züge verladen, die uns
nach Südfrankreich, in ein Barackenlager, bei Mazarei, brachten.
Auf einer Zwischenstation hat man uns unter einer Pumpe, die Lokomotiven mit Wasser versorgt, abgestellt, den Kran
aufgedreht und uns anschließend ausgelacht, die Kinder Haben uns mit Steinen beworfen. Ein Wachmann kam in unseren
Waggon gekommen, hat unser Gepäck durchsucht, wenn er Tabak oder Zigaretten gefunden hat, nahm er sie mit. Die Kameraden
waren darüber so empört, dass sie vorhatten, ihn nachts unter den Waggon zu werfen. Wir haben sie gebeten dass zu
unterlassen, weil man uns in diesem Falle, alle erschießen würde.
Als wir ins Lager kamen wurden wir zuerst gezählt, dann mussten wir unser Gepäck stehen lassen und beiseite treten.
Wenn man bei der Nachkontrolle noch was in den Taschen fand, wurde das auch entwendet, selbst Esslöffel. Wir wurden
dann in drei Baracken, ohne Toiletten, eingeschlossen. Die Kameraden haben ihre Bedürfnisse in Kochgeschirre erledigt
und durch ein kleines Fenster, das sich fast unter der Decke befand, hinausgeworfen. Andere Fenster ließen sich nicht
öffnen, weil sie mit Stacheldraht zu geflochten waren. Als die Kameraden die Kochgeschirre auskippten, haben die
Wachposten geschossen und die Fenster zertrümmert. Sie waren der Meinung dass wir ausbrechen wollten. Es herrschte eine
große Hitze, in den überfüllten Baracken sind wir fast erstickt. Am nächsten Tag haben wir uns über fehlende Toilettem
beschwert, da haben sie Heringsfässer durch die Hälfte geschnitten und an der Ausgangstür hingestellt. Um bei den
überfüllten Räumen dort hinzukommen, musste man über die Köpfe der Anderen steigen. Viele hatten Fieber und Durchfall
und mussten in die Krankenstube eingeliefert werden, wo sie kurz darauf verstarben.
Besonders Raucher litten sehr an der Unterernährung, bekamen Wasser in den Beinen und waren die Ersten die verstarben.
Nach der Registrierung wurden wir auf andere Baracken verteilt. Die Zivilbevölkerung kam in die Räume und begann uns
auszuplündern. Wer noch gute Schuhe besaß musste sie ausziehen und bekam dafür die kaputten des Plünderers. Eine Woche
lang mussten wir diesen Zustand ertragen, erst als die Kameraden sich beschwerten, wurde am Eingang eine Tafel am
Eingang angebracht, dass die Zivilbevölkerung das Lager nicht betreten darf. Bis auf einige, wenige Ausnahmen wurde
diese Anweisung befolgt.
Als wir im Lager ankamen, war der französische Lagerkommandant, ein ehemaliger Kriegsgefangener, der bei einem Bauern
in Deutschland gearbeitet hatte. Dieser Bauer war jetzt als Kriegsgefangener in seinem Lager. Als er ihn erkannte, hat
er ihn gleich zum Küchendienst eingeteilt und mit dem nächsten Krankentransport nach Hause fahren lassen. Zu Mittag
bekamen wir nur gekochte Haferkörner, da schwamm alles oben, später war man dann auf Gerste umgestiegen. Als viele
daran gestorben waren, weil sie diese „Rohkost”, die nur ein Kuhmagen verträgt, nicht gegessen haben, hat man die
Körner durch eine Schrotmühle laufen lassen. Dann hat man uns Steckrüben gekocht; wir bekamen 250 Gramm Weißbrot,
etwas Quark und ein viertel Liter Magermilch. Später, als wir schon arbeiten mussten, hat man in unserem Essen einen
Kuhkopf mitgekocht, das hat dann bedeutend besser geschmeckt.
Bevor wir morgens zur Arbeit gingen, mussten wir zu Flaggenparade und abends, nach der Rückkehr, haben wir die Flagge
wieder eingeholt. Wir haben einen Kanal gereinigt, dessen Sohle 2 Meter dick mit Schlamm bedeckt war. Zuerst wurde das
Wasser abgelassen, dann haben wir, einer dem andern, den Schlamm mit der Schippe hoch gereicht. Der Letzte hat den
Schlamm, der so zäh war, dass er nicht von der Schippe wollte, oben am Rande abgelegt. Manchmal waren 10 Mann nötig um
den Höhenunterschied zu überwinden. Das Wachpersonal schoss über unsere Köpfe hinweg und rief: „schnell arbeiten”. Bei
der großen Hitze war das ein Ding der Unmöglichkeit, zumal es nichts zu Trinken gab. Auf dem Heimweg haben wir im Walde
Heilkräuter gesammelt, die man in der Küche getrocknet und als Tee zubereitet hat, den wir am nächsten tag zur Arbeit
mitnahmen, um unseren Durst zu stillen.
Unser Aufseher hatte einen Stock, an dem sich noch kurz abgeschnittene Äste befanden. Wer seiner Meinung nach, nicht
ordentlich gearbeitet hat, bekam gleich Schläge auf den Rücken. Die weißen Aufseher wurden irgendwann durch Neger
ersetzt, die uns bedeutend besser behandelt haben. Wenn irgendetwas schief ging, haben sie nichts gesagt, nur gelacht.
In den übrig gebliebenen Wassertümpeln hatten sich noch einige Aale versteckt, die wir zu fangen versuchten, was uns
auch manchmal gelang. Wir mussten ihnen das Genick brechen, damit sie uns nicht entwischen konnten. Wenn die Franzosen
bemerkten das wir Aale hatten, wurden sie uns abgenommen. Gelang es uns aber, sie ins Lager zu bringen, dann haben wir
uns eine köstliche Malzeit zubereitet.
Um sicherzustellen dass niemand geflüchtet ist, wurden wir, wenn wir abends ins Lager zurückkamen, zuerst gezählt.
Diese Zählung wurde mehrmals wiederholt, weil die Wachmannschaften sich immer wieder verzählt haben. Als einer von uns
hin ging, ihnen sagte dass alle da sind, wollten sie es nicht glauben und haben uns vor dem stehen lassen, bis es ihnen
irgendwann einfiel. uns doch das Tor zuöffnen. Einmal, als wir von der Arbeit zurückgekehrt waren, standen wir bis 23
Uhr neben der Flagge, weil uns niemand das Tor geöffnet hat. Als wir dann doch irgendwie ins Lager kamen haben wir
festgestellt, dass das ganze Wachpersonal betrunken war und niemand im Stande uns das Tor zu öffnen.
Eines Tages waren wir wieder abends zur Parole angetreten, als ein älterer Herr mit seinem Hund, am Stacheldraht
entlang, spazieren ging. Weil der Hund, unterm Stacheldraht hindurch, zu uns kam, hat ihn einer geschnappt, ihm das
Genick gebrochen und unter seiner Jacke versteckt. Der Franzose hat nach seinem Hund gerufen und gepfiffen, aber alles
vergebens, der Hund war nicht aufzufinden. Die Kameraden haben ihm gleich das Fell über die Ohren gezogen, das Fleisch
gekocht und das Fell in die Latrine geworfen. Das Fleisch wurde umgehend verspeist.
Als wir am nächsten Tag von der Arbeit zurückkehrten, war im Lager der Teufel los. Wir mussten sofort antreten und
wurden gefragt, wo der Hund geblieben ist, der Gestern Abend, mit seinem Herrchen, am Zaun entlang spazieren ging. Als
sich niemand dazu bekannte, mussten wir weiterhin stehen bleiben, während die Wachmannschaften von Baracke zu Baracke
gingen und alles durchsuchten. In einer Latrine hat man dann das Fell gefunden, was uns ein furchtbares „Donnerwetter”
einbrachte und in den nächsten Tagen, nach der Arbeit, unter dem Kommando eines Oberfeldwebels, eine Stunde
nachexerzieren.
In Südfrankreich regnet es den ganzen Sommer nicht; die Bauern haben da keine Scheunen und das Getreide wir nur in
Schobern aufgestellt und dann umgehend gedroschen. Vom Oktober bis Dezember regnete es fasst jeden Tag in Strömen.
Gesät wird nur im Frühjahr und im Herbst, weil im Sommer alles vertrocknet. Es wird viel Wein angebaut und die
Steckrübe wächst den ganzen Winter. Neben den Weinreben wurde aus Schieferplatten ein Zaun aufgestellt, um dem Wein
einen optimalen Standort zu sichern. Die Bauernwagen hatten nur zwei Räder und waren nur mit einem Pferd bespannt, das
die ganze Balance des Wagens zu halten hatte. Trotzdem haben sie soviel aufgeladen wie wir auf einen Leiterwagen. Viele
Kameraden wurden den Bauern zur Arbeit ausgeliehen. Wenn ein Bauer einen Arbeiter gebraucht hat und es wurde gefragt,
wer sich in der Landwirtschaft auskennt, da haben sich alle gemeldet. Der Bauer konnte sich dann aussuchen, wen er
mitnehmen wollte.
Wenn wir durch die Stadt zur Arbeit gingen, haben verschiedene Leute Fallobst in die Abfalleimer gelegt. Wenn das von
den Kameraden bemerkt wurde, schwenkten viele aus der Reihe, um sich etwas mit zunehmen, was von den Wachmannschaften
nicht gern gesehen wurde. Viele Kriegsgefangene hatten keine Schuhe mehr, sie haben die Füße nur mit Lumpen bewickelt.
Eines Tages kamen Kameraden aus Norwegen, die nach Deutschland entlassen werden sollten. Mann hat sie jedoch ins Lager
gesteckt und zur Arbeit eingeteilt. In Norwegen hatten sie Kleider und Stoffe eingekauft, hatten volle Seesäcke und
sogar Karren auf 2 Rädern, weil sie ja in die Heimat entlassen werden sollten. Als wir morgens zur Arbeit rausgeführt
wurden standen sie schon vor dem Lager. Wir haben ihnen zugerufen, dass sie uns etwas abgeben sollen, weil ihnen ja
sowieso alles abgenommen wird, aber sie haben uns nur ausgelacht. Als sie ins Lager Kamen mussten sie ihr Gepäck
ablegen, wurden dann wo anders hingeführt und haben es danach nie wieder gesehen.
Durch die vielen Läuse, Flöhe und Wanzen die wie im Lager hatten, kam es bei verschieden Kameraden, an den
Einstichstellen, zu eiternden Entzündungen. Um dem vorzubeugen hat man uns mit einem Pulver, das in Frankreich
hergestellt wurde, aber bei den Parasiten keine Wirkung zeigte, eingesprüht. Erst bei der Anwendung eines Mittels
amerikanischer Herkunft, war alles über Nacht verschwunden.
Der Sonntag war arbeitsfrei. Dann kam ein katholischer, französischer Pfarrer, eskortiert von 3 Mann, mit
aufgepflanztem Seitengewehr ins Lager und hat Gottesdienst gehalten. Einen evangelischen Pfarrer gab es nicht, nur
einen Baptisten Prediger. Der wurde würdevoll eingekleidet, bekam ein großes Kreuz und hat jeden Sonntag in einer
extra dafür hergerichteten Baracke Gottesdienst gehalten. Wer Theologie studiert hatte und sich meldete, wurde zu
einem Seminar geschickt und konnte sein Studium fortsetzen. Glasbläser durften das Lager auch verlassen und ihrem
erlernten Beruf wieder arbeiten.
Wer sich freiwillig, für 5 Jahre, zum Dienst in der Fremdenlegion verpflichtet hat, das waren etliche unter uns, wurde
neu eingekleidet, bekam gutes Essen und Rauchwaren soviel er wollte. Nach einem Jahr wurden, nach und nach, die
Kranken und Körperbehinderten in die Sowjetische Besatzungszone entlassen. Eine Entlassung von Kriegsgefangenen, die
in den Westzonen oder jenseits von Oder und Neise zu Hause waren, war nicht vorgesehen. Die Österreicher wurden alle,
unabhängig von ihrem Gesundheitszustand entlassen.
Ich habe Briefe nach Hause geschrieben, aber die kamen nur bis Allenstein und wurden wieder zurück geschickt. Als eine
Kommission des Roten Kreuzes aus der Schweiz unser Lager besichtigt hat, haben wir uns beschwert, das wir als
Sanitätsdienstgrade, zur Arbeit gehen müssen. Daraufhin erging ein Befehl: Wer einen vom Roten Kreuz, ausgestellten
Ausweis besitzt, gehört einem internationalen Verband an und braucht nicht zu Arbeit gehen. Aus unserem Lager hatten
sich 20 Mann gemeldet, die daraufhin Freigang, in Begleitung von zwei französischen Wachsoldaten erhielten. Als wir
gefragt wurden wo wir hin wollen, entschlossen wir uns, einen Soldatenfriedhof, auf dem unsere verstorbenen Kameraden
beerdigt waren, zu besuchen.
Da der Untergrund in dieser Gegend aus Felsen bestand, wurden die Gräben, in denen die Toten in selbst gezimmerten
Kisten nebeneinander gestellt wurden, mit Hilfe von Dynamit ausgehoben. Ein Leichenwagen, mit einem Pferd bespannt,
das mit einer schwarzen Decke abgedeckt war, wurde von einem Kutscher in angemessener Kleidung, gefahren. Der Wagen
konnte gleichzeitig 4 Kisten transportieren. Wenn wir von der Arbeit kommend, dem Leichenwagen begegneten, wurde
gehalten und mit einer Schweigeminute der Toten gedacht, bis der Wagen vorbei war. Die Zivilbevölkerung verharrte auch
im Schweigen, mit abgenommener Kopfbedeckung.
Ein Kamerad, der in Krottorf, Kreis Oschersleben, bei Magdeburg, zuhause war, sagte bei seiner Entlassung zu mir:
Sollte ich das Glück haben, meine Entlassungspapiere zu erhalten ohne eine Bleibe vorzuweisen, dann soll ich Krottorf
als Heimatadresse angeben. Auf der Krankenstube habe ich angegeben, dass sich noch ein Schrapnellsplitter, aus dem
Ersten Weltkrieg, in meiner Kreuzbeingegend befindet, er zwar verkapselt ist, aber immer noch Beschwerden verursacht.
Daraufhin wurde ich zur Entlassung vornotiert. Als bekannt wurde das ein Rückkehrertransport in die sowjetische
Besatzungszone zusammengestellt wird, habe ich mich sofort gemeldet und wurde für ein Entlassungslager in Angoleme
vorgesehen. War das eine Freude, als uns mitgeteilt wurde, wann der Rücktransport stattfindet.
In unserem Lager waren noch 2 Kameraden aus dem Kreis Ortelsburg: Ein Gustav Lumma aus Leynau und ein Alfred Moritz
aus Groß Schöndamerau. Sie mussten noch zurückbleiben und haben mir den Auftrag erteil, die Angehörigen in der Heimat
zu grüßen und ihnen die Anschrift mitzuteilen. Als wir im Entlassungslager ankamen, fragte man uns nach unserer
Heimatanschrift. Dann wurden die Entlassungspapiere angefertigt. Es wurde uns auch ein Barscheck, für die in Frankreich
geleistete Arbeit ausgehändigt, den wir bei jeder Kasse in Deutschland einlösen könnten. Ich habe ihn bis zum heutigen
Tage nicht einlösen können, obwohl ich irgendwann in der Zeitung gelesen habe, das Verrechnungschecks die den aus
französischer Kriegsgefangenschaft Entlassenen, ausgehändigt wurden, einzulösen sind.
Wir kamen zuerst nach Saar Elbe, dann in die Nähe der Zonengrenze zu Thüringen. Hier mussten wir 2 Tage warten, weil
aus der sowjetischen Besatzungszone keine Eisenbahnwagen bereitgestellt wurden. Angesichts dessen, das der Russe beim
letzten Transport die aus Frankreich kommenden Wagen kassiert und nicht mehr herausgeben wollte, bestand der Franzose
jetzt darauf, seine Wagen sofort wieder mitzunehmen. Als der sehnsüchtig erwartete Zug endlich eintraf, durften wir
umsteigen und kamen, immer noch hinter Stacheldraht, nach Erfurt. Von dort weiter ins Quarantänelager nach Prätsch an
der Elbe.
Unter Androhung von Strafe war es verboten das Lager zu verlassen, doch der Hunger zwang uns dazu, in den umliegenden
Dörfern um Lebensmittel zu betteln. Man drohte uns damit, dass Zuwiderhandlungen, mit einer 14-tägigen Verlängerung der
Quarantäne geahndet werden. Der Roggen war schon reif und wir haben, auf den umliegenden Feldern, die Ähren abgerissen,
das Korn, zwischen 2 Steinen zu Mehl zerrieben, um daraus eine Suppe zu kochen, denn von dem was unsere Lagerküche uns
bieten konnte, war es nicht möglich zu überleben. Als der Eigentümer bemerkte wer seine Roggenähren entwendet hat, kam
er ins Lager, gerade zu dem Zeitpunkt als wir mit dem Mahlen beschäftigt waren. Der Lagerkommandant, bei dem er sich
beschwerte, drohte uns zu bestrafen, wenn wir unsere „Rauzüge” nicht unmittelbar einstellen würden. Wir sagten ihm er
solle uns heimfahren lassen, da wir doch lange genug hinter Stacheldraht gesessen hätten.
Endlich wieder in Freiheit
14 Tage nach unserer Ankunft wurden uns Entlassungspapiere ausgehändigt, sowie auch Fahrscheine
zum den, von uns angegeben Heimatorten. So kam ich nach Krottof, Kreis Oschersleben, zu meinem ehemaligen
Kriegskameraden, bei dem ich einen Tag geblieben bin. Er hatte mir schon eine Stelle bei einem Bauern besorgt, der 70
Jahre alt und kinderlos war. Zum Hof, den er mit seiner Ehefrau bewirtschaftet hat, gehörten 36 Morgen Land, 2 Ochsen
und 3 Kühe. Das Ackerland bestand aus 17 Parzellen und sicherte mir einen Arbeitsplatz.
Jetzt, da ich ein Dach überm Kopf und genug zu essen hatte, fing ich an nach dem Verbleib meiner Familie zu forschen.
Bei meinem letzten Heimaturlaub hatte ich mit meiner Frau verabredet; falls wir uns in den Kriegswirren verlieren
sollten, unsere Kontaktadresse, die meiner Quartiersleute in Burscheid, Kreis Opladen, sein sollte. Ich habe zuerst
nach Rohmanen geschrieben, aber leider keine Antwort erhalten. Dann habe ich nach Burscheid geschrieben, und siehe, -
bei denen lag schon eine Anfrage meiner Frau vor, die nach mir gefragt, und ihre jetzige Anschrift hinterlassen hatte.
Ich habe dem Bauern erzählt dass meine Frau sich zurzeit, auf einem Gut, in Alt Steinhorst, im Kreis Rostock, befindet.
Er war sofort bereit uns ein Zimmer zur Verfügung zu stellen, wenn ich meine Frau nach Krottorf rüberholen wollte. Das
habe ich Ihr mitgeteilt und sie war sofort bereit ihren Wohnsitz nach Krottorf zu verlegen, denn sie wohnte dort in
einem kleinen Stübchen unterm Dach.
Im Herbst, als die Feldarbeit so ziemlich erledigt war, bin ich nach Alt Steinhorst gefahren, um meine Frau und meinen
Sohn Kurt, sowie meinen Sohn Manfred, den ich noch nicht kannte, weil er erst nach der Flucht, am 31. Januar, in Groß
Lüssewitz, geboren wurde, nach Krottorf zu holen. Meine Frau hatte schon Holz für den Winter besorgt und vom Gut, auf
dem sie im Sommer gearbeitet hatte, Mehl und Kartoffeln bekommen. Wir haben das Mehl und andere Habseligkeiten in
Kisten verpackt. Das Holz haben wir einem Bauern gegeben, der uns und unser Gepäck, mit seinem Pferdewagen, zum 14
Kilometer entfernten Bahnhof, nach Ribnitz gebracht hat. Wir sind auch gut in Krottorf angekommen, aber als wir am
nächsten Tag, unsere Kisten vom Bahnhof abholen wollten, haben wir zwar die Kisten vorgefunden, doch der gesamte Inhalt
wurde während der Bahnfahrt entwendet. Die Bahnstation in Krottorf hat die Vorkommnisse zur Kenntnis genommen und
protokolliert, aber unsere Sachen haben wir nie wieder gesehen und mussten wieder bei Null anfangen.
Im Winter musste ich auf der Genossenschaft, unentgeltlich, für die Russen Weizen einsacken. Ich hatte versucht eine
Arbeit als Zimmermann zu bekommen, doch auf dem Arbeitsamt wurde mir gesagt, ich bin Ladwirt und muss auf der
Landwirtschaft arbeiten. Da in den ersten Nachkriegsjahren, auch in der sowjetisch besetzten Zone Arbeitsplätze knapp
waren, mussten auch solche, die einen anderen Beruf erlernt hatten, jede zumutbare Arbeit annehmen. Aus der Heimat
erhielt ich einen Brief, von meiner dort noch lebenden Mutter. Sie schrieb das sie mich noch einmal sehen wollte und
ich sollte doch wieder zurück kommen; Unser Hof wäre nicht von Polen besetzt und sie wäre ganz alleine, weil der Vater
nach dem Durchzug der Front von den Russen erschlagen wurde. Daraufhin habe ich dem polnischen Konsulat in Magdeburg
mitgeteilt, dass ich in Rohmanen eine Landwirtschaft besitze, und um eine Einreisegenehmigung gebeten.
Nach 2 Monaten erhielt ich eine Postkarte, mit der Mitteilung, ich sollte mich persönlich beim Konsulat vorstellen.
Nach Aufnahme meiner Personalien, wurde mir gesagt, das ich benachrichtigt werde wenn mein Antrag genehmigt wird. Ende
Juli 1947 erhielten wir die Einreisegenehmigung nach Ostpreußen, das jetzt unter polnischer Verwaltung stand. Wir
mussten zuerst zum polnischen Konsulat in Berlin-Lichterfelde, wo wir umgeben von einer Trümmerlandschaft, gewartet
haben, bis alle Untersuchungen und Formalitäten erledigt waren.
“ Wieder zurück in Ostpreußen.”
Der schwere Wiederaufbau nach dem Kriege
Dann fuhren wir über Frankfurt/Oder, Posen, Thorn, Allenstein, nach Ortelsburg, wo wir am 2. August 1947 ankamen. Mit
einem zweirädrigen Karren, den ich mir von einem noch in Ortelsburg lebenden Bekanten ausgeliehen hatte und meinem
Sohn Manfred im Kinderwagen fuhren wir nach Rohmanen. Meine Mutter war inzwischen verstorben und auf dem Hof war nur
meine, inzwischen aus Russischer Gefangenschaft wiedergekehrte Schwester, Frieda Pelkowski.

Es war alles ausgeplündert; kein Vieh, keine Maschinen und der ganze Hof mit kniehohem Graß überwachsen. Nur schmale
Trampelpfade, vom Haus zum Holzschuppen und zum Klo, durchkreuzten das satte Grün. Ich habe das Gras auf dem Hof mit
einer Sense, die ich noch gefunden habe, abgemäht, damit der Hof nicht so verwahrlost aussah. Am nächsten Tag habe ich
mich bei der Polizei in Ortelsburg angemeldet, wo ich auch ein Startgeld von 100 Zloty erhielt und Gepäckstücke, die
ich in Krottorf aufgegeben, am Bahnhof abgeholt. Es hat mich sehr gewundert das, das Gepäck überhaupt angekommen ist.
Da man von der Landwirtschaft nicht Leben konnte, habe ich mich in den nächsten Tagen, bei der jetzt polnischen Bahn,
um Arbeit beworben und wurde auch angenommen. Wenn wir unseren Monatslohn bekamen, saß immer einer am Tisch, der von
uns 100 Zloty für den Wiederaufbau von Warschau verlangte. Wenn ich dran war, riefen die Anderen, ich hätte Warschau
zerstört und müsste deshalb 200 Zloty abgeben. Nach 3 Jahren kam eine Verfügung, die besagte, dass wer länger als 1
Jahr bei der Bahn beschäftigt ist, angestellt werden muss. Um diese Bestimmung zu umgehen hat man mich entlassen und
eine Woche später wieder eingestellt.
Als ich vor Ablauf des nächsten Jahres, aus dem gleichen Grunde wieder entlassen wurde, habe ich mich bei der
Stadtverwaltung in Ortelsburg(jetzt Szczytno)beworben, wo ich zuerst im Gaswerk als Heizer und später auf Baustellen
als Zimmermann gearbeitet habe. Wir haben durch den Krieg beschädigte Häuser repariert, in den ehemals touristischen
Zentren einige Ausbesserungen an den Einrichtungen durchgeführt, eine Ziegelei wieder in Betrieb gesetzt und andere
anfallende Arbeiten verrichtet. Im Dach des Rathausturmes war während der Kämpfe eine Granate eingeschlagen, die, die
Dachlatten und die Verschalung zerstört hatte. Da wir, unter schwersten Bedingungen, den Schaden repariert haben,
wurde uns eine Höhenzulage versprochen, die wir aber nicht bekommen haben.
Aus Verärgerung darüber habe ich bei der Stadtverwaltung gekündigt und bei einer Wiederaufbaufirma unter der Leitung
von Bauingenieur Laskowski wieder angefangen, wo ich bis 1954, als Zimmermann beschäftigt war. Ab da habe ich mich
nur um meinen Hof gekümmert, der wegen meiner Arbeitsstellen, gezwungenermaßen, sehr vernachlässigt wurde. Als wir
1947 zurückkamen, brachten wir unseren Sohn Manfred noch im Kinderwagen. Den hat meine Frau zum Markt gebracht,
verkauft, und dafür eine Ziege erworben, die dank guter Pflege, uns täglich mit 4 Liter Milch versorgte. Das war der
erste Baustein zum Wiederaufbau, unserer durch den Krieg zerstörten, und danach ausgeplünderten Landwirtschaft.
Während meiner Arbeit bei der Bahn haben wir uns eine Kuh gekauft, die nach einem halben Jahr, wegen nicht bezahlter
Grundsteuer, vom Gerichtsvollzieher gepfändet wurde. Man hat uns die Kuh weggenommen und bei einem Arbeiter, der in
der Ernst-Mey-Straße in Ortelsburg wohnte und sie wegen nicht vorhandener Futtermittel, nur mit Kartoffelkraut
gefüttert hat, untergestellt. Als ich bei der Bahn meinen Monatslohn bekommen habe, bin ich zur Gmina gegangen, habe
eine Rate angezahlt und durfte dann die Kuh wieder mit nach Hause nehmen. Durch die schlechte Ernährung war die Kuh
stark abgemagert und lieferte nur die Hälfte der ursprünglichen Milchleistung.
Später habe ich ein Pferd auf Abzahlung bekommen, das 140.000 alte Zloty gekostet hat. Die Stute war schwach und unser
Feld sehr hügelig, so dass man nur bergab pflügen konnte, was sehr beschwerlich war, bergauf ging es immer im Leerlauf.
Später habe ich die schweren Böden mit dem Traktor umpflügen, und in den letzten Jahren auch mit dem Binder mähen
lassen. Von der Stute habe ich 2 schöne Fohlen gezogen; ein davon habe ich bei der Ausreise in die Bundesrepublik
mitgebracht und bei der Viehverwertungs-Genossenschaft in Göttingen verkauft. In den ersten Nachkriegsjahren als noch
wenig Land bestellt wurde, breiteten sich auf den nicht beackerten Flächen, Wildkräuter aus. Disteln und andere
Schnellwachsende, erreichten manchmal eine Höhe von 2 Meter, besonders auf den schweren Böden.
Es hat viel Schweiß gekostet ehe man den Acker soweit hatte, das er auch befriedigende Erträge abwarf. Die
Währungsreform von 1950, hat unser weiniges Geld das wir schon gespart hatten, wieder vernichtet. Ich hatte 2 Pferde,
1 Fohlen, 2 Kühe und Schweine, als ich wieder aufgefordert wurde nicht bezahlte Grundsteuern nachzuzahlen. Als ich
nicht bezahlen konnte, hat der Vollziehungsbeamte, ein Fohlen, eine Kuh und ein Schwein gepfändet. Es gelang mir jedoch
nach längeren Verhandlungen, ohne größere Verluste, alles zu regeln. Später kam eine Verfügung, die besagte; wenn
jemand auf seinem Hof nur eine Kuh und ein Pferd hatte, durften sie nicht gepfändet werden. Einige haben ihr Inventar
dieser Verfügung angepasst und dadurch die Zahlung von Grundsteuer umgangen.

Wer seine Steuern pünktlich bezahlt und sein Kontingent an landwirtschaftlichen Produkten fristgerecht abgeliefert hat,
der konnte seine, darüber hinaus erwirtschafteten Produkte zu marktgerechten Preisen verkaufen. Für eine hochtragende
Sterke, mindestens 400 kg schwer, die auf ein staatliches Gut verkauft wurde, konnte man bis zu 12000 Zloty bekommen.
Unsere Böden waren kalkarm, doch durch den Einsatz von Kalk und Kunstdünger konnte man den Ertrag erheblich steigern.
Kalk und Kunstdünger konnte man bei der Genossenschaft(GS) bestellen, der dann auch direkt auf den Hof geliefert wurde.
Kalk wurde geliefert und gleich auf dem Feld ausgestreut. In den 1960ger Jahren waren alle Ackerflächen der Rohmaner
Felder bestellt.
Die nach dem Krieg zurückgebliebenen deutschen Bauernfamilien, aber auch die Polen, die während des Krieges beim Bauern
in Deutschland gearbeitet haben, versuchten mit teils bescheidenen, oder auch zusammen gesuchten, landwirtschaftlichen
Geräten, die bäuerlichen Betriebe aufrecht zu erhalten. Nach den schweren Anfängen in den ersten Nachkriegsjahren
erzielten sie schließlich einen beachtlichen Erfolg, der sich in wogenden Kornfeldern, sowie in grünen Wiesen auf
denen gut genährtes Vieh weidete, widerspiegelte.
Ein schwerer Einschnitt in meinem Leben.
Am 11. Mai 1956 verstarb nach langer schwerer Krankheit, meine liebe Ehefrau Marta Rattay,
geborene Brosch. Ein Jahr zuvor war schon mein Schwiegervater Gottlib Brosch verstorben. Die schweren Bedingungen
unter denen wir nach Kriegende leben mussten, haben ihrer bereits angegriffenen Gesundheit sehr zugesetzt. Sie
verstarb mit 44 Jahren und hinterließ in unserer Familie eine große Lücke, die nicht mehr zu Überbrücken war. Wir
haben sie unter großer Anteilnahme der noch verbliebenen deutschen Bevölkerung zu Grabe getragen und auf dem Rohmaner
Friedhof beigesetzt. Die Arbeit die sie sonst verrichtet hatte fiel jetzt auf mich und meine Söhne zurück. Meine
Schwester Frieda Pelkowski half auch wo sie nur konnte. Wir waren auf die Unterstützung durch Nachbarn und Freunde
angewiesen, die uns immer wenn es nötig war, tatkräftig unterstützt haben. Im laufe der Zeit haben wir wieder zum
Alltag zurück gefunden, haben sie noch etliche Jahre auf dem Friedhof besuchen können, bis wir, bedingt durch unsere
Ausreise uns endgültig von ihr trennen mussten.
Der endgültige Abschied von Ostpreußen
Ab 1956 begannen, durch die Vermittlung des Deutschen Roten Kreuzes, die ersten Ausreisen in die
Bundesrepublik Deutschland. Zuerst waren es Kinder die zu ihren Eltern ausreisen durften, Familien deren Väter aus der
Kriegsgefangenschaft in den Westen Deutschlands entlassen wurden und andere durch den Krieg getrennte
Familienangehörige. Ab 1960 erhöhte sich die Zahl der Ausreisewilligen aus dem polnisch besetzten Ostpreußen. Es setzte
sich die Überzeugung durch, dass unsere Angestammte Heimat, uns für die Zukunft keine Perspektive mehr bieten konnte.
Meistens wurden die Anträge, die wir an die Passabteilung in Allenstein stellen mussten, um einen Ausreisepass zu
bekommen, negativ beschieden. Nach mehrmaligen Versuchen gelang es dann doch, diese begehrte Ausreiseberechtigung in
Empfang zu nehmen. Die Enttäuschung der Zurückgebliebenen war groß, wenn wieder mal Verwandte oder Nachbarn, den Weg
in Richtung Bahnhof einschlugen.
Um einen Reisepass zu beantragen, musste man zuerst eine Einladung von Verwandten aus der Bundesrepublik vorlegen, in
der, diese sich verpflichten mussten, für Unterkunft und Verpflegung der Eingeladenen zu sorgen. Diese Einladung
musste durch ein Amt in der Bundesrepublik beglaubigt werden. Außerdem mussten die Kosten für die Bahnfahrt, ab
polnischer Grenze, bis zum Zielort, beim polnischen Reisebüro ORBIS, in Warschau, in DM eingezahlt werden.
Unseren ersten Ausreiseantrag haben wir 1964, bei der Kommandantur der polnischen Miliz in Allenstein eingereicht, der
nach einer gewissen Zeitspanne, ohne eine uns verständliche Begründung zu nennen, abgelehnt wurde. Gegen diese
Ablehnung wurde ein Widerspruch zugelassen, den wir sofort einreichten. Nach einer weiteren Zeitspanne erhielten wir
wieder eine Ablehnung, gegen die kein Widerspruch mehr zulässig war. Wer seine Ausreiseabsicht nicht aufgeben wollte,
musste einen neuen Antrag stellen. Es gab Familien die schon 10 Mal einen Ausreiseantrag gestellt hatten und immer
wieder abgewiesen wurden. Da meine Söhne, nicht die Absicht hatten in Rohmanen zu bleiben und ich nach 2 Weltkriegen,
an denen ich teilgenommen, die schwere Arbeit auf der Landwirtschaft, nicht aus eigener Kraft schaffen würde, haben wir
1966 wieder einen Antrag gestellt, der prompt abgelehnt wurde. Der Widerspruch auf diese Ablehnung wurde auch negativ
beantwortet, so dass wir 1968 wieder einen Antrag eingereicht haben.
Weil das Passamt in Allenstein lange nichts von sich hören ließ, hegten wir schon die Hoffnung das es jetzt klappen
würde und waren sehr enttäuscht als wieder eine Absage kam. In der Zwischenzeit sind viele Nachbarn und Bekannte aus
Rohmanen, sowie aus der näheren Umgebung, ausgereist und das Häuflein der noch verbliebenen Deutschen, wurde immer
kleiner. Die Motivation, die uns in früheren Jahren, über so manche schwierige Lage hinweg geholfen hat, ist einer
hoffnungslosen Resignation gewichen. Man war davon überzeugt, dass unser Leben, in unser Angestammten Heimat, keine
Zukunftsperspektive mehr haben konnte und wenn wir keine Ausreisegenehmigung bekommen, wir eines Tages die letzten
Deutschen in der ganzen Umgebung sein werden.
Die Ausreise-Heimat ade
Wir hatten die Hoffnung schon aufgegeben, als am 30. April 1969, der Briefträger unseren Hof
betrat und mir einen Brief überreichte, in dem uns das Passamt in Allenstein mitteilte, dass unsere Ausreise in die
Bundesrepublik Deutschland, genehmigt worden ist. Wir müssten, nach Aushändigung der Reisepapiere, den Geltungsbereich
der Volksrepublik Polen, innerhalb von 3 Monaten verlassen. Wir waren zuerst geschockt, über den Hinweis, das wir
unsere Heimat in 3 Monaten verlassen müssen, aber dann stellte sich die Zukunftsperspektive wieder ein und wir gingen,
wie von einem schweren Ballast befreit und gut gelaunt unser weiteren Tätigkeit nach.
Als der Briefträger unseren Hof betrat, waren ich und mein Sohn Kurt gerade dabei eine Fuhre Mist zu laden. Wir hatten
den Wagen gerade halb geladen und haben nach der frohen Kunde nicht mehr weiter gemacht, sondern die Pferde vorgespannt
und den Mist aufs Feld gefahren, damit wir den Wagen für alle Fälle frei hatten. Das war die letzte Tätigkeit für
unsere Landwirtschaft in Ostpreußen.
Die Nachricht von unserer Ausreise verbreitete sich, ohne dass wir darüber gesprochen haben, wie ein Lauffeuer.
Alsbald kamen Leute aus dem Dorf, die sich für das Vieh und für diverse Landwirtschaftliche Geräte interessierten.
Etliche wollten bestimmte Sachen sofort kaufen, andere haben nur zurücklegen lassen und wollten später kommen und
bezahlen, haben es aber dann doch nicht genommen.

Wenn man eine Landwirtschaft hatte, konnte man 2 Pferde, 2 Rinder, 3 Schweine, 5 Schafe und 10 Hühner, in einem
geschlossenen Viehwaggon, in die Bundesrepublik mitnehmen. Jeden Tag war man unterwegs, von einer Behörde zur Andern.
Die Aushändigung der Reisepapiere erfolgte nur nach Vorlage bestimmter Bescheinigungen: Es mussten alle Steuern bezahlt
sein, das Kontingent landwirtschaftlicher Erzeugnisse musste abgeliefert sein, je eine Bescheinigung vom Katasteramt
und vom Notar musste vorgelegt werden, das man dem polnischen Staat das Grundstück abgetreten hat. Die Gebühren für
die notarielle Beglaubigung mussten wir selbst bezahlen. Wenn man alle Bescheinigungen beisammen hatte, bekam man bei
der Kreisverwaltung eine Gesamtbescheinigung. Mit dieser Bescheinigung konnte man nach Allenstein, zur
Polizeikommandantur fahren, wo man nach dem schriftlichen Verzicht auf die polnische Staatsangehörigkeit, einen
Reisepass ausgehändigt bekam, der den Inhaber zum Grenzübertritt berechtigte, aber nicht zur Wiedereinreise.
Wir haben 2 Pferde, eine Sterke, einen Ochsen, 5 Schafe, 2 Schweine und 10 Hühner mitgenommen. Über die Schutzimpfung
der Rinder musste man eine, vom Kreistierarzt beglaubigte Bescheinigung vorweisen. Ich habe 5 Schafsböcke gekauft, die
ich in der Zwischenzeit, hinter der Scheune, zum Weiden angekettet hatte. Einer von denen hat sich losgerissen und
seinen Nachbarn getötet. Das Fleisch konnten wir noch verkaufen, mussten aber dafür einen anderen Schafsbock kaufen.
Innerhalb von 3 Monaten mussten wir alles regeln und zwei Tage vor der Abfahrt einen Eisenbahnwagen, bei der
Eisenbahndirektion in Allenstein bestellen. Reservierungen bei den polnischen Behörden waren meist immer mit
Schmiergeld verbunden, weil man sonst nie sicher sein konnte dass diese Vereinbarungen auch eingehalten werden. Schon
2 Wochen vor unserer Abfahrt, gab es in Ortelsburg keine alkoholischen Getränke zu kaufen. Meine Söhne mussten mit dem
Motorrad die umliegenden Dörfer abfahren, damit wir für die Reise einen Vorrat anlegen konnten; denn Wodka war zu der
Zeit, in Polen, wie eine zweite Währung.
Am 25. Juli haben wir zusammen, mit meinem Neffen Siegfried Brosch, unseren sonstigen Hausrat, der in Kisten verpackt
war, in einen Eisenbahnwagen, auf dem Allensteiner Bahnhof verladen. Alles musste zuerst durch den Zoll, wo die
Federbetten gewogen wurden und über das erlaubte hinausgehende Kissen, verzollt werden mussten. Dasselbe galt auch für
Fleisch und Räucherwaren.
Am 26. Juli, unserem Verladetag, kam der Eisenbahnwagen aus Allenstein, erst um 11 Uhr auf dem Ortelsburger Bahnhof an.
Die Rinder hatten wir zu Fuß, zum Bahnhof gebracht; Schweine, Schafe und Hühner auf dem Pferdewagen. Im Eisenbahnwagen
mussten, mit Hilfe von Brettern und Bohlen, Boxen für die verschiedenen Tiere erstellt werden. Jedes Pferd und jedes
Rind in eine Bucht. Die Schafe zwischen die Pferde, die Schweine zwischen die Rinder und die Hühner in einem Käfig,
unter der Decke über den Rindern. Die Hühner hatten unterwegs Eier gelegt, somit hatten wir jeden Tag frische
Verpflegung. Bei der Fahrt im Viehwagen, begleitete mich mein Sohn Manfred. Als die Lokomotive nahte, um den Wagen
abzuholen, wurden noch schnell die restlichen Sachen hinein geworfen und so mache Abschiedsträne rollte dann die Wange
hinab.
Unsere Nachbarn, Deutsche und Polen, halfen uns beim Verladen des lebendigen Inventars. Jetzt erinnerte ich mich
plötzlich, an die oft auch schönen, Ereignisse der letzten 22 Jahre. Einer Zeit, in der das Zusammenleben von
Deutschen und Polen, von Jahr zu Jahr, besser wurde. Man half sich beim einbringen der Getreideernte, beim Dreschen
des Getreides, bei der Kartoffelernte und bei anderen Arbeiten, wo viele Menschen zupacken mussten. Es war eine
Dorfgemeinschaft, in schweren Zeiten geboren; jeder half jedem wenn Hilfe nötig war. Es wurde mir plötzlich bewusst,
das jetzt ein Lebensabschnitt zu Ende ging, zu dem ich nicht mehr zurückkehren konnte. Unsere Existenzgrundlage war
jetzt ein Eisenbahnwagen auf einem Schienenstrang, dessen Ende irgendwo in weiter Ferne lag. Obwohl, von langer Hand
vorbereitet, war dieser Moment voller Wehmut.
Doch als der Zug sich plötzlich, in Bewegung setzte, war ich sofort wieder in der Gegenwart. Menschen, mit denen man
Jahrzehnte lang, in gutem Einvernehmen zusammen gelebt hat, blieben plötzlich am Bahnsteig zurück und die Entfernung
zwischen ihnen und mir vergrößerte sich mit jeder Sekunde, bis sie letztendlich aus meinem Blickfeld verschwanden.
Es war ein heißer Julitag, als wir unsere Reise gen Westen antraten. Für die Schweine, die besonders unter der Hitze
zu leiden hatten, haben wir 10 Flaschen Essig mitgenommen und sie von Zeit zu Zeit besprenkelt, damit sie besser atmen
konnten. Für die anderen Tiere war reichlich Heu und Hafer vorhanden. Eine großes Fas und zwei Milchkannen waren mit
Wasser gefüllt, die wir auf den an der Strecke liegenden Bahnstationen, bei Bedarf wieder nachgefüllt haben.
Da der Kreistierarzt nicht in seinem Büro war, konnten wir die Impfbescheinigung für das Vieh, nicht rechtzeitig
herbeischaffen. Der Zug setzte sich in Bewegung und die Bescheinigung war immer noch nicht da. Als die Bescheinigung
dann eingetroffen, wir aber schon unterwegs waren, ist mein Sohn Kurt mit dem Motorrad hinterher gefahren und hat uns
in Passenheim, wo der Zug noch andere Wagen angehängt bekam, die Impfbescheinigung übergeben. Wir waren sehr froh das
er es noch geschafft hat, denn in solch einer Situation fühlt man sich sicherer wenn man alle Bescheinigungen bei sich
hat. Auf der Rückfahrt, mit dem Motorrad hatte er noch eine Panne, musste das Motorrad stehen lassen und per Anhalter
nach Hause fahren. Am nächsten Tag kam er mit Siegfried Deptolla, der das Motorrad wieder flott machte und brachte es
wieder nach Rohmanen zurück.
Die Fahrt mit dem Viehwagen, gen Westen
Von Ortelsburg bis Allenstein(45 km) hat unser Zug 4 Stunden gebraucht, weil auf jedem Bahnhof
gehalten wurde, um neue Wagen anzuhängen. Nachdem wir in Allenstein angekommen waren, kam ein Rangierer und fragte
nach unserem Ziel. Als wir ihm mitteilten, das wir in die Bundesrepublik Deutschland wollen, sagte er nur: „In 10
Minuten fährt ein Zug los. Wenn ich von euch 500 Zloty und einen Liter Wodka bekomme, werde euch sofort anhängen,
andernfalls kommt ihr auf ein Nebengleis und müsst dann auf den nächsten Zug warten. Es blieb uns nichts anderes übrig
als seiner Forderung nachzukommen, denn über derartige Erpressungen hat man bereits von Anderen, die vor uns ausgereist
sind, gehört. Wir wurden auch sofort angehängt und fuhren dann die ganze Nacht, an Osterode, und Thorn vorbei bis
Gnesen. Dort wurde wieder rangiert.
Von einer Anhöhe wurden die einzelnen Wagen auf verschiedene Gleise verteilt und zu neuen Zügen zusammengestellt. Der
Aufprall der ungebremsten Wagen erzeugte eine derartige Erschütterung, dass manche Bretter an den Boxen geborsten waren.
Von Gnesen ging es dann in einem Zuge durch bis zur Grenzstation Reppen(Rzepin). Dort mussten wir zum Zollamt, wo
unsere Ausfuhrpapiere durch die Zollbeamten, und durch einen Tierarzt geprüft wurden. Bis Reppen(Rzepin) haben wir für
den Eisenbahnwagen 900 Zloty bezahlt; hier mussten wir noch einmal 650 Zloty bezahlen. Bei der Wagenkontrolle erklärte
uns ein Bahnbeamter das unser Wagen, sich nicht für den internationalen Transport eignet und wir deshalb den Inhalt in
einen Anderen umladen müssen, der irgendwann, auf dem Nebengleis bereitgestellt wird. Nach langer Verhandlung, sowie
einer Zulage von 500 Zloty und einem Liter Wodka haben wir ihn davon überzeugt, das der Wagen sich doch für die
Weiterfahrt eignet.
In der Nacht war Schichtwechsel, der unseren Wagen wieder abgehängt hat, weil er angeblich von der Reichsbahn der DDR,
wegen technischer Mängel nicht weiterbefördert würde. Wir mussten unsere Verhandlung vom Vorabend wiederholen, die mit
der Zusage endete, dass wir am frühen Morgen, über die Grenze auf DDR Gebiet, gebracht werden. Um 5 Uhr morgens kam
eine Lokomotive, die uns den letzten Abschnitt bis über die Grenze bringen sollte. Als der Zug hat noch einmal anhielt,
kamen polnische Grenzbeamte und Soldaten in den Wagen. Sie durchsuchten ihn und fragten, ob wir noch polnisches Geld
oder einen Grundbuchauszug bei uns hätten. Wir zeigten ihnen 800 Zloty, die sie uns, nach Ausstellung einer Quittung
über 500 Zloty, abnahmen. Die Grundbuchauszüge habe ich, im Stroh versteckt, dem Ochsen vor die Füße gelegt. Falls
jemand da suchen sollte, hätte ich gesagt, das das Tier bösartig veranlagt ist, und ich für seine Sicherheit nicht
garantieren könnte, deshalb sollte er vorsichtig sein.
Als die Grenzkontrolle den Zug verlassen hatte, setzte sich die Lokomotive wieder in Bewegung und überquerte nach
kurzer Zeit die Oderbrücke. Auf einer eingezäunten Fläche, jenseits der Grenze, hat man uns abgestellt hat und die
Lokomotive fuhr zurück auf polnisches Gebiet. Vor und hinter uns waren die Tore verschlossen. Auf den Wachtürmen,
links und Rechts von uns, standen Posten mit einem Gewehr im Anschlag. Vier Grenzbeamte der DDR, jeder mit einer
Leiter in der Hand, sowie ein Schäferhund, kamen zu unserem Wagen. Sie öffneten die Schiebetüre, stellten die Leiter
davor und ließen den Hund in den Wagen springen, der nur etwas herum schnupperte und wieder heraussprang. 2 Beamte
haben dann anschließend, die Papiere kontrolliert und das Inventar gezählt.
Nach einiger Zeit wurden wir an einen Güterzug der Reichsbahn angehängt und fuhren von Frankfurt an der Oder, vorbei
an Berlin, Ellingen und Nordhausen, über die Grenze zur Bundesrepublik bis Herzberg. Hier hat ein Zollbeamter der
Bundesrepublik, die Formalitäten erledigt und ein Tierarzt die Pferde, Rinder und Schweine gründlich untersucht. Ich
musste ihnen die Mäuler aufhalten und die Füße hochheben. Danach hat uns die Lokomotive zu einer Wasserzapfstelle
gebracht, wo wir die Tiere tränken und unsere Behälter mit Wasser auffüllen konnten. Anschließen fuhren wir über
Northeim nach Göttingen, zur Viehverwertungsgenossenschaft, die zuvor von unserer Ankunft in Kenntnis gesetzt wurde.
Der Ochse, die Sterke und die Schweine wurden, in Göttingen zum Schlachthof gebracht; die Pferde kamen nach Hannover
und die Schafsböcke nach Kassel. Wir waren mit dem Viehtransport 5 Tage unterwegs; hatten so manche Klippe umschifft
und Schwierigkeiten gemeistert, die im normalen Leben nicht vorkommen.
Wir wurden mit einem PKW, ins Durchgangslager Friedland bei Göttingen gefahren, wo mein Sohn Kurt, meine Schwester
Frieda Pelkowski und Siegfried Brosch mit Familie, die am 30 Juli, um 14 Uhr, von Warschau mit dem Zug abgefahren, und
hier am 31. Juli in den Morgenstunden eingetroffen sind, schon auf uns gewartet haben. In Friedland hat man uns mit
Familie Siegfried Brosch in einem Raum untergebracht, wir wurden registriert und erhielten 20 DM Überbrückungsgeld,
pro Person. Da wir erst am Freitag in Friedland eingetroffen sind, mussten wir hier über das Wochenende bleiben,
obwohl die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der Regel nur 3 bis 4 Tage beträgt.
Um einen Antrag für die Ausreise stellen zu können, brauchten wir eine Einladung von in der Bundesrepublik lebenden
Verwandten. Diese Einladung hat uns mein Bruder, Ernst Rattay, aus Ingelheim am Rhein zugeschickt. Ingelheim liegt im
Bundesland Rheinland-Pfalz. Das Geld für die Bahnfahrt, hat uns, Frieda Schellin, geb. Nickel, aus Duisburg, die
Tochter unseres Nachbarn, überwiesen. In Friedland wurden wir registriert. Im Registrierschein, war als unser
nächster Aufenthaltsort in der Bundesrepublik, das Durchgangslager Osthofen bei Worms, das alle Aussiedler für
Rheinland-Pfalz aufnehmen musste, eingetragen. Die Eintragung erfolgte deshalb, weil der Ort aus dem uns unsere
Einladung zugeschickt wurde, sich auch in Rheinland-Pfalz befand.
Da ich nach dem Polenfeldzug, als Soldat, ein Jahr im Kreis Opladen, im Rheinland gewesen bin, wäre ich sehr gerne in
diese Gegend gezogen, denn die Erinnerung an die schönen Tage die ich dort verlebt habe war in mir immer noch wach.
Ich versuchte die Eintragung in unseren Regiestierscheinen ändern zu lassen, was nach einigen, vielleicht auch
berechtigten Einwänden, am 4. August, vom Beauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen, genehmigt wurde. Anstelle von
Rheinlad-Pfalz stand da jetzt Nordrhein-Westfalen und am 7. August, fuhren wir, noch mit anderen Aussiedlern, ins
Durchgangslager Unna-Massen, am östlichen Rande des Ruhrgebietes gelegen. Hier wurden wir in einem Zimmer untergebracht
und konnten unser Essen in einer Gemeinschaftsküche zubereiten.
Am 8. August wurden wir in Unna-Massen, als Bürger der Bundesrepublik Deutschland registriert, erhielten
Einhundert DM Begrüßungsgeld, den Vertriebenen Ausweis -A -und 4 Wochen später den Bundespersonalausweis. In
Unna-Massen haben wir mehr als 4 Monate verbracht, weil mein Sohn Kurt, wegen fehlender Berufsausbildung, in Unna, an
einem Grundlehrgang für Metallarbeiter teilgenommen hat, der vom Arbeitsamt finanziert wurde. Am 11 Dezember 1969 sind
wir endlich an unserem vorläufigen Wohnsitz, im Durchgangswohnheim, an der Elisabethstraße 13, in Velbert angekommen.
Ab dem 5. Januar 1970 konnten meine Söhne, in der Zahnradfabrik Reining, in Velbert ihrer geregelten Arbeit nachgehen.
Von Bau- und Sparverein in Velbert wurde uns am 20. Juni 1970, unsere erste Wohnung zugewiesen.
Velbert im Februar 1972
gezeichnet: Gustav Rattay
Als wir ins Lager kamen wurden wir zuerst gezählt, dann mussten wir unser Gepäck stehen lassen und beiseite treten.
Wenn man bei der Nachkontrolle noch was in den Taschen fand, wurde das auch entwendet, selbst Esslöffel. Wir wurden
dann in drei Baracken, ohne Toiletten, eingeschlossen. Die Kameraden haben ihre Bedürfnisse in Kochgeschirre erledigt
und durch ein kleines Fenster, das sich fast unter der Decke befand, hinausgeworfen. Andere Fenster ließen sich nicht
öffnen, weil sie mit Stacheldraht zu geflochten waren. Als die Kameraden die Kochgeschirre auskippten, haben die
Wachposten geschossen und die Fenster zertrümmert. Sie waren der Meinung dass wir ausbrechen wollten. Es herrschte eine
große Hitze, in den überfüllten Baracken sind wir fast erstickt. Am nächsten Tag haben wir uns über fehlende Toilettem
beschwert, da haben sie Heringsfässer durch die Hälfte geschnitten und an der Ausgangstür hingestellt. Um bei den
überfüllten Räumen dort hinzukommen, musste man über die Köpfe der Anderen steigen. Viele hatten Fieber und Durchfall
und mussten in die Krankenstube eingeliefert werden, wo sie kurz darauf verstarben.
Besonders Raucher litten sehr an der Unterernährung, bekamen Wasser in den Beinen und waren die Ersten die verstarben.
Nach der Registrierung wurden wir auf andere Baracken verteilt. Die Zivilbevölkerung kam in die Räume und begann uns
auszuplündern. Wer noch gute Schuhe besaß musste sie ausziehen und bekam dafür die kaputten des Plünderers. Eine Woche
lang mussten wir diesen Zustand ertragen, erst als die Kameraden sich beschwerten, wurde am Eingang eine Tafel am
Eingang angebracht, dass die Zivilbevölkerung das Lager nicht betreten darf. Bis auf einige, wenige Ausnahmen wurde
diese Anweisung befolgt.
Als wir im Lager ankamen, war der französische Lagerkommandant, ein ehemaliger Kriegsgefangener, der bei einem Bauern
in Deutschland gearbeitet hatte. Dieser Bauer war jetzt als Kriegsgefangener in seinem Lager. Als er ihn erkannte, hat
er ihn gleich zum Küchendienst eingeteilt und mit dem nächsten Krankentransport nach Hause fahren lassen. Zu Mittag
bekamen wir nur gekochte Haferkörner, da schwamm alles oben, später war man dann auf Gerste umgestiegen. Als viele
daran gestorben waren, weil sie diese „Rohkost”, die nur ein Kuhmagen verträgt, nicht gegessen haben, hat man die
Körner durch eine Schrotmühle laufen lassen. Dann hat man uns Steckrüben gekocht; wir bekamen 250 Gramm Weißbrot,
etwas Quark und ein viertel Liter Magermilch. Später, als wir schon arbeiten mussten, hat man in unserem Essen einen
Kuhkopf mitgekocht, das hat dann bedeutend besser geschmeckt.
Bevor wir morgens zur Arbeit gingen, mussten wir zu Flaggenparade und abends, nach der Rückkehr, haben wir die Flagge
wieder eingeholt. Wir haben einen Kanal gereinigt, dessen Sohle 2 Meter dick mit Schlamm bedeckt war. Zuerst wurde das
Wasser abgelassen, dann haben wir, einer dem andern, den Schlamm mit der Schippe hoch gereicht. Der Letzte hat den
Schlamm, der so zäh war, dass er nicht von der Schippe wollte, oben am Rande abgelegt. Manchmal waren 10 Mann nötig um
den Höhenunterschied zu überwinden. Das Wachpersonal schoss über unsere Köpfe hinweg und rief: „schnell arbeiten”. Bei
der großen Hitze war das ein Ding der Unmöglichkeit, zumal es nichts zu Trinken gab. Auf dem Heimweg haben wir im Walde
Heilkräuter gesammelt, die man in der Küche getrocknet und als Tee zubereitet hat, den wir am nächsten tag zur Arbeit
mitnahmen, um unseren Durst zu stillen.
Unser Aufseher hatte einen Stock, an dem sich noch kurz abgeschnittene Äste befanden. Wer seiner Meinung nach, nicht
ordentlich gearbeitet hat, bekam gleich Schläge auf den Rücken. Die weißen Aufseher wurden irgendwann durch Neger
ersetzt, die uns bedeutend besser behandelt haben. Wenn irgendetwas schief ging, haben sie nichts gesagt, nur gelacht.
In den übrig gebliebenen Wassertümpeln hatten sich noch einige Aale versteckt, die wir zu fangen versuchten, was uns
auch manchmal gelang. Wir mussten ihnen das Genick brechen, damit sie uns nicht entwischen konnten. Wenn die Franzosen
bemerkten das wir Aale hatten, wurden sie uns abgenommen. Gelang es uns aber, sie ins Lager zu bringen, dann haben wir
uns eine köstliche Malzeit zubereitet.
Um sicherzustellen dass niemand geflüchtet ist, wurden wir, wenn wir abends ins Lager zurückkamen, zuerst gezählt.
Diese Zählung wurde mehrmals wiederholt, weil die Wachmannschaften sich immer wieder verzählt haben. Als einer von uns
hin ging, ihnen sagte dass alle da sind, wollten sie es nicht glauben und haben uns vor dem stehen lassen, bis es ihnen
irgendwann einfiel. uns doch das Tor zuöffnen. Einmal, als wir von der Arbeit zurückgekehrt waren, standen wir bis 23
Uhr neben der Flagge, weil uns niemand das Tor geöffnet hat. Als wir dann doch irgendwie ins Lager kamen haben wir
festgestellt, dass das ganze Wachpersonal betrunken war und niemand im Stande uns das Tor zu öffnen.
Eines Tages waren wir wieder abends zur Parole angetreten, als ein älterer Herr mit seinem Hund, am Stacheldraht
entlang, spazieren ging. Weil der Hund, unterm Stacheldraht hindurch, zu uns kam, hat ihn einer geschnappt, ihm das
Genick gebrochen und unter seiner Jacke versteckt. Der Franzose hat nach seinem Hund gerufen und gepfiffen, aber alles
vergebens, der Hund war nicht aufzufinden. Die Kameraden haben ihm gleich das Fell über die Ohren gezogen, das Fleisch
gekocht und das Fell in die Latrine geworfen. Das Fleisch wurde umgehend verspeist.
Als wir am nächsten Tag von der Arbeit zurückkehrten, war im Lager der Teufel los. Wir mussten sofort antreten und
wurden gefragt, wo der Hund geblieben ist, der Gestern Abend, mit seinem Herrchen, am Zaun entlang spazieren ging. Als
sich niemand dazu bekannte, mussten wir weiterhin stehen bleiben, während die Wachmannschaften von Baracke zu Baracke
gingen und alles durchsuchten. In einer Latrine hat man dann das Fell gefunden, was uns ein furchtbares „Donnerwetter”
einbrachte und in den nächsten Tagen, nach der Arbeit, unter dem Kommando eines Oberfeldwebels, eine Stunde
nachexerzieren.
In Südfrankreich regnet es den ganzen Sommer nicht; die Bauern haben da keine Scheunen und das Getreide wir nur in
Schobern aufgestellt und dann umgehend gedroschen. Vom Oktober bis Dezember regnete es fasst jeden Tag in Strömen.
Gesät wird nur im Frühjahr und im Herbst, weil im Sommer alles vertrocknet. Es wird viel Wein angebaut und die
Steckrübe wächst den ganzen Winter. Neben den Weinreben wurde aus Schieferplatten ein Zaun aufgestellt, um dem Wein
einen optimalen Standort zu sichern. Die Bauernwagen hatten nur zwei Räder und waren nur mit einem Pferd bespannt, das
die ganze Balance des Wagens zu halten hatte. Trotzdem haben sie soviel aufgeladen wie wir auf einen Leiterwagen. Viele
Kameraden wurden den Bauern zur Arbeit ausgeliehen. Wenn ein Bauer einen Arbeiter gebraucht hat und es wurde gefragt,
wer sich in der Landwirtschaft auskennt, da haben sich alle gemeldet. Der Bauer konnte sich dann aussuchen, wen er
mitnehmen wollte.
Wenn wir durch die Stadt zur Arbeit gingen, haben verschiedene Leute Fallobst in die Abfalleimer gelegt. Wenn das von
den Kameraden bemerkt wurde, schwenkten viele aus der Reihe, um sich etwas mit zunehmen, was von den Wachmannschaften
nicht gern gesehen wurde. Viele Kriegsgefangene hatten keine Schuhe mehr, sie haben die Füße nur mit Lumpen bewickelt.
Eines Tages kamen Kameraden aus Norwegen, die nach Deutschland entlassen werden sollten. Mann hat sie jedoch ins Lager
gesteckt und zur Arbeit eingeteilt. In Norwegen hatten sie Kleider und Stoffe eingekauft, hatten volle Seesäcke und
sogar Karren auf 2 Rädern, weil sie ja in die Heimat entlassen werden sollten. Als wir morgens zur Arbeit rausgeführt
wurden standen sie schon vor dem Lager. Wir haben ihnen zugerufen, dass sie uns etwas abgeben sollen, weil ihnen ja
sowieso alles abgenommen wird, aber sie haben uns nur ausgelacht. Als sie ins Lager Kamen mussten sie ihr Gepäck
ablegen, wurden dann wo anders hingeführt und haben es danach nie wieder gesehen.
Durch die vielen Läuse, Flöhe und Wanzen die wie im Lager hatten, kam es bei verschieden Kameraden, an den
Einstichstellen, zu eiternden Entzündungen. Um dem vorzubeugen hat man uns mit einem Pulver, das in Frankreich
hergestellt wurde, aber bei den Parasiten keine Wirkung zeigte, eingesprüht. Erst bei der Anwendung eines Mittels
amerikanischer Herkunft, war alles über Nacht verschwunden.
Der Sonntag war arbeitsfrei. Dann kam ein katholischer, französischer Pfarrer, eskortiert von 3 Mann, mit
aufgepflanztem Seitengewehr ins Lager und hat Gottesdienst gehalten. Einen evangelischen Pfarrer gab es nicht, nur
einen Baptisten Prediger. Der wurde würdevoll eingekleidet, bekam ein großes Kreuz und hat jeden Sonntag in einer
extra dafür hergerichteten Baracke Gottesdienst gehalten. Wer Theologie studiert hatte und sich meldete, wurde zu
einem Seminar geschickt und konnte sein Studium fortsetzen. Glasbläser durften das Lager auch verlassen und ihrem
erlernten Beruf wieder arbeiten.
Wer sich freiwillig, für 5 Jahre, zum Dienst in der Fremdenlegion verpflichtet hat, das waren etliche unter uns, wurde
neu eingekleidet, bekam gutes Essen und Rauchwaren soviel er wollte. Nach einem Jahr wurden, nach und nach, die
Kranken und Körperbehinderten in die Sowjetische Besatzungszone entlassen. Eine Entlassung von Kriegsgefangenen, die
in den Westzonen oder jenseits von Oder und Neise zu Hause waren, war nicht vorgesehen. Die Österreicher wurden alle,
unabhängig von ihrem Gesundheitszustand entlassen.
Ich habe Briefe nach Hause geschrieben, aber die kamen nur bis Allenstein und wurden wieder zurück geschickt. Als eine
Kommission des Roten Kreuzes aus der Schweiz unser Lager besichtigt hat, haben wir uns beschwert, das wir als
Sanitätsdienstgrade, zur Arbeit gehen müssen. Daraufhin erging ein Befehl: Wer einen vom Roten Kreuz, ausgestellten
Ausweis besitzt, gehört einem internationalen Verband an und braucht nicht zu Arbeit gehen. Aus unserem Lager hatten
sich 20 Mann gemeldet, die daraufhin Freigang, in Begleitung von zwei französischen Wachsoldaten erhielten. Als wir
gefragt wurden wo wir hin wollen, entschlossen wir uns, einen Soldatenfriedhof, auf dem unsere verstorbenen Kameraden
beerdigt waren, zu besuchen.
Da der Untergrund in dieser Gegend aus Felsen bestand, wurden die Gräben, in denen die Toten in selbst gezimmerten
Kisten nebeneinander gestellt wurden, mit Hilfe von Dynamit ausgehoben. Ein Leichenwagen, mit einem Pferd bespannt,
das mit einer schwarzen Decke abgedeckt war, wurde von einem Kutscher in angemessener Kleidung, gefahren. Der Wagen
konnte gleichzeitig 4 Kisten transportieren. Wenn wir von der Arbeit kommend, dem Leichenwagen begegneten, wurde
gehalten und mit einer Schweigeminute der Toten gedacht, bis der Wagen vorbei war. Die Zivilbevölkerung verharrte auch
im Schweigen, mit abgenommener Kopfbedeckung.
Ein Kamerad, der in Krottorf, Kreis Oschersleben, bei Magdeburg, zuhause war, sagte bei seiner Entlassung zu mir:
Sollte ich das Glück haben, meine Entlassungspapiere zu erhalten ohne eine Bleibe vorzuweisen, dann soll ich Krottorf
als Heimatadresse angeben. Auf der Krankenstube habe ich angegeben, dass sich noch ein Schrapnellsplitter, aus dem
Ersten Weltkrieg, in meiner Kreuzbeingegend befindet, er zwar verkapselt ist, aber immer noch Beschwerden verursacht.
Daraufhin wurde ich zur Entlassung vornotiert. Als bekannt wurde das ein Rückkehrertransport in die sowjetische
Besatzungszone zusammengestellt wird, habe ich mich sofort gemeldet und wurde für ein Entlassungslager in Angoleme
vorgesehen. War das eine Freude, als uns mitgeteilt wurde, wann der Rücktransport stattfindet.
In unserem Lager waren noch 2 Kameraden aus dem Kreis Ortelsburg: Ein Gustav Lumma aus Leynau und ein Alfred Moritz
aus Groß Schöndamerau. Sie mussten noch zurückbleiben und haben mir den Auftrag erteil, die Angehörigen in der Heimat
zu grüßen und ihnen die Anschrift mitzuteilen. Als wir im Entlassungslager ankamen, fragte man uns nach unserer
Heimatanschrift. Dann wurden die Entlassungspapiere angefertigt. Es wurde uns auch ein Barscheck, für die in Frankreich
geleistete Arbeit ausgehändigt, den wir bei jeder Kasse in Deutschland einlösen könnten. Ich habe ihn bis zum heutigen
Tage nicht einlösen können, obwohl ich irgendwann in der Zeitung gelesen habe, das Verrechnungschecks die den aus
französischer Kriegsgefangenschaft Entlassenen, ausgehändigt wurden, einzulösen sind.
Wir kamen zuerst nach Saar Elbe, dann in die Nähe der Zonengrenze zu Thüringen. Hier mussten wir 2 Tage warten, weil
aus der sowjetischen Besatzungszone keine Eisenbahnwagen bereitgestellt wurden. Angesichts dessen, das der Russe beim
letzten Transport die aus Frankreich kommenden Wagen kassiert und nicht mehr herausgeben wollte, bestand der Franzose
jetzt darauf, seine Wagen sofort wieder mitzunehmen. Als der sehnsüchtig erwartete Zug endlich eintraf, durften wir
umsteigen und kamen, immer noch hinter Stacheldraht, nach Erfurt. Von dort weiter ins Quarantänelager nach Prätsch an
der Elbe.
Unter Androhung von Strafe war es verboten das Lager zu verlassen, doch der Hunger zwang uns dazu, in den umliegenden
Dörfern um Lebensmittel zu betteln. Man drohte uns damit, dass Zuwiderhandlungen, mit einer 14-tägigen Verlängerung der
Quarantäne geahndet werden. Der Roggen war schon reif und wir haben, auf den umliegenden Feldern, die Ähren abgerissen,
das Korn, zwischen 2 Steinen zu Mehl zerrieben, um daraus eine Suppe zu kochen, denn von dem was unsere Lagerküche uns
bieten konnte, war es nicht möglich zu überleben. Als der Eigentümer bemerkte wer seine Roggenähren entwendet hat, kam
er ins Lager, gerade zu dem Zeitpunkt als wir mit dem Mahlen beschäftigt waren. Der Lagerkommandant, bei dem er sich
beschwerte, drohte uns zu bestrafen, wenn wir unsere „Rauzüge” nicht unmittelbar einstellen würden. Wir sagten ihm er
solle uns heimfahren lassen, da wir doch lange genug hinter Stacheldraht gesessen hätten.
Endlich wieder in Freiheit
14 Tage nach unserer Ankunft wurden uns Entlassungspapiere ausgehändigt, sowie auch Fahrscheine
zum den, von uns angegeben Heimatorten. So kam ich nach Krottof, Kreis Oschersleben, zu meinem ehemaligen
Kriegskameraden, bei dem ich einen Tag geblieben bin. Er hatte mir schon eine Stelle bei einem Bauern besorgt, der 70
Jahre alt und kinderlos war. Zum Hof, den er mit seiner Ehefrau bewirtschaftet hat, gehörten 36 Morgen Land, 2 Ochsen
und 3 Kühe. Das Ackerland bestand aus 17 Parzellen und sicherte mir einen Arbeitsplatz.
Jetzt, da ich ein Dach überm Kopf und genug zu essen hatte, fing ich an nach dem Verbleib meiner Familie zu forschen.
Bei meinem letzten Heimaturlaub hatte ich mit meiner Frau verabredet; falls wir uns in den Kriegswirren verlieren
sollten, unsere Kontaktadresse, die meiner Quartiersleute in Burscheid, Kreis Opladen, sein sollte. Ich habe zuerst
nach Rohmanen geschrieben, aber leider keine Antwort erhalten. Dann habe ich nach Burscheid geschrieben, und siehe, -
bei denen lag schon eine Anfrage meiner Frau vor, die nach mir gefragt, und ihre jetzige Anschrift hinterlassen hatte.
Ich habe dem Bauern erzählt dass meine Frau sich zurzeit, auf einem Gut, in Alt Steinhorst, im Kreis Rostock, befindet.
Er war sofort bereit uns ein Zimmer zur Verfügung zu stellen, wenn ich meine Frau nach Krottorf rüberholen wollte. Das
habe ich Ihr mitgeteilt und sie war sofort bereit ihren Wohnsitz nach Krottorf zu verlegen, denn sie wohnte dort in
einem kleinen Stübchen unterm Dach.
Im Herbst, als die Feldarbeit so ziemlich erledigt war, bin ich nach Alt Steinhorst gefahren, um meine Frau und meinen
Sohn Kurt, sowie meinen Sohn Manfred, den ich noch nicht kannte, weil er erst nach der Flucht, am 31. Januar, in Groß
Lüssewitz, geboren wurde, nach Krottorf zu holen. Meine Frau hatte schon Holz für den Winter besorgt und vom Gut, auf
dem sie im Sommer gearbeitet hatte, Mehl und Kartoffeln bekommen. Wir haben das Mehl und andere Habseligkeiten in
Kisten verpackt. Das Holz haben wir einem Bauern gegeben, der uns und unser Gepäck, mit seinem Pferdewagen, zum 14
Kilometer entfernten Bahnhof, nach Ribnitz gebracht hat. Wir sind auch gut in Krottorf angekommen, aber als wir am
nächsten Tag, unsere Kisten vom Bahnhof abholen wollten, haben wir zwar die Kisten vorgefunden, doch der gesamte Inhalt
wurde während der Bahnfahrt entwendet. Die Bahnstation in Krottorf hat die Vorkommnisse zur Kenntnis genommen und
protokolliert, aber unsere Sachen haben wir nie wieder gesehen und mussten wieder bei Null anfangen.
Im Winter musste ich auf der Genossenschaft, unentgeltlich, für die Russen Weizen einsacken. Ich hatte versucht eine
Arbeit als Zimmermann zu bekommen, doch auf dem Arbeitsamt wurde mir gesagt, ich bin Ladwirt und muss auf der
Landwirtschaft arbeiten. Da in den ersten Nachkriegsjahren, auch in der sowjetisch besetzten Zone Arbeitsplätze knapp
waren, mussten auch solche, die einen anderen Beruf erlernt hatten, jede zumutbare Arbeit annehmen. Aus der Heimat
erhielt ich einen Brief, von meiner dort noch lebenden Mutter. Sie schrieb das sie mich noch einmal sehen wollte und
ich sollte doch wieder zurück kommen; Unser Hof wäre nicht von Polen besetzt und sie wäre ganz alleine, weil der Vater
nach dem Durchzug der Front von den Russen erschlagen wurde. Daraufhin habe ich dem polnischen Konsulat in Magdeburg
mitgeteilt, dass ich in Rohmanen eine Landwirtschaft besitze, und um eine Einreisegenehmigung gebeten.
Nach 2 Monaten erhielt ich eine Postkarte, mit der Mitteilung, ich sollte mich persönlich beim Konsulat vorstellen.
Nach Aufnahme meiner Personalien, wurde mir gesagt, das ich benachrichtigt werde wenn mein Antrag genehmigt wird. Ende
Juli 1947 erhielten wir die Einreisegenehmigung nach Ostpreußen, das jetzt unter polnischer Verwaltung stand. Wir
mussten zuerst zum polnischen Konsulat in Berlin-Lichterfelde, wo wir umgeben von einer Trümmerlandschaft, gewartet
haben, bis alle Untersuchungen und Formalitäten erledigt waren.
“ Wieder zurück in Ostpreußen.”
Der schwere Wiederaufbau nach dem Kriege
Dann fuhren wir über Frankfurt/Oder, Posen, Thorn, Allenstein, nach Ortelsburg, wo wir am 2. August 1947 ankamen. Mit
einem zweirädrigen Karren, den ich mir von einem noch in Ortelsburg lebenden Bekanten ausgeliehen hatte und meinem
Sohn Manfred im Kinderwagen fuhren wir nach Rohmanen. Meine Mutter war inzwischen verstorben und auf dem Hof war nur
meine, inzwischen aus Russischer Gefangenschaft wiedergekehrte Schwester, Frieda Pelkowski.

Es war alles ausgeplündert; kein Vieh, keine Maschinen und der ganze Hof mit kniehohem Graß überwachsen. Nur schmale
Trampelpfade, vom Haus zum Holzschuppen und zum Klo, durchkreuzten das satte Grün. Ich habe das Gras auf dem Hof mit
einer Sense, die ich noch gefunden habe, abgemäht, damit der Hof nicht so verwahrlost aussah. Am nächsten Tag habe ich
mich bei der Polizei in Ortelsburg angemeldet, wo ich auch ein Startgeld von 100 Zloty erhielt und Gepäckstücke, die
ich in Krottorf aufgegeben, am Bahnhof abgeholt. Es hat mich sehr gewundert das, das Gepäck überhaupt angekommen ist.
Da man von der Landwirtschaft nicht Leben konnte, habe ich mich in den nächsten Tagen, bei der jetzt polnischen Bahn,
um Arbeit beworben und wurde auch angenommen. Wenn wir unseren Monatslohn bekamen, saß immer einer am Tisch, der von
uns 100 Zloty für den Wiederaufbau von Warschau verlangte. Wenn ich dran war, riefen die Anderen, ich hätte Warschau
zerstört und müsste deshalb 200 Zloty abgeben. Nach 3 Jahren kam eine Verfügung, die besagte, dass wer länger als 1
Jahr bei der Bahn beschäftigt ist, angestellt werden muss. Um diese Bestimmung zu umgehen hat man mich entlassen und
eine Woche später wieder eingestellt.
Als ich vor Ablauf des nächsten Jahres, aus dem gleichen Grunde wieder entlassen wurde, habe ich mich bei der
Stadtverwaltung in Ortelsburg(jetzt Szczytno)beworben, wo ich zuerst im Gaswerk als Heizer und später auf Baustellen
als Zimmermann gearbeitet habe. Wir haben durch den Krieg beschädigte Häuser repariert, in den ehemals touristischen
Zentren einige Ausbesserungen an den Einrichtungen durchgeführt, eine Ziegelei wieder in Betrieb gesetzt und andere
anfallende Arbeiten verrichtet. Im Dach des Rathausturmes war während der Kämpfe eine Granate eingeschlagen, die, die
Dachlatten und die Verschalung zerstört hatte. Da wir, unter schwersten Bedingungen, den Schaden repariert haben,
wurde uns eine Höhenzulage versprochen, die wir aber nicht bekommen haben.
Aus Verärgerung darüber habe ich bei der Stadtverwaltung gekündigt und bei einer Wiederaufbaufirma unter der Leitung
von Bauingenieur Laskowski wieder angefangen, wo ich bis 1954, als Zimmermann beschäftigt war. Ab da habe ich mich
nur um meinen Hof gekümmert, der wegen meiner Arbeitsstellen, gezwungenermaßen, sehr vernachlässigt wurde. Als wir
1947 zurückkamen, brachten wir unseren Sohn Manfred noch im Kinderwagen. Den hat meine Frau zum Markt gebracht,
verkauft, und dafür eine Ziege erworben, die dank guter Pflege, uns täglich mit 4 Liter Milch versorgte. Das war der
erste Baustein zum Wiederaufbau, unserer durch den Krieg zerstörten, und danach ausgeplünderten Landwirtschaft.
Während meiner Arbeit bei der Bahn haben wir uns eine Kuh gekauft, die nach einem halben Jahr, wegen nicht bezahlter
Grundsteuer, vom Gerichtsvollzieher gepfändet wurde. Man hat uns die Kuh weggenommen und bei einem Arbeiter, der in
der Ernst-Mey-Straße in Ortelsburg wohnte und sie wegen nicht vorhandener Futtermittel, nur mit Kartoffelkraut
gefüttert hat, untergestellt. Als ich bei der Bahn meinen Monatslohn bekommen habe, bin ich zur Gmina gegangen, habe
eine Rate angezahlt und durfte dann die Kuh wieder mit nach Hause nehmen. Durch die schlechte Ernährung war die Kuh
stark abgemagert und lieferte nur die Hälfte der ursprünglichen Milchleistung.
Später habe ich ein Pferd auf Abzahlung bekommen, das 140.000 alte Zloty gekostet hat. Die Stute war schwach und unser
Feld sehr hügelig, so dass man nur bergab pflügen konnte, was sehr beschwerlich war, bergauf ging es immer im Leerlauf.
Später habe ich die schweren Böden mit dem Traktor umpflügen, und in den letzten Jahren auch mit dem Binder mähen
lassen. Von der Stute habe ich 2 schöne Fohlen gezogen; ein davon habe ich bei der Ausreise in die Bundesrepublik
mitgebracht und bei der Viehverwertungs-Genossenschaft in Göttingen verkauft. In den ersten Nachkriegsjahren als noch
wenig Land bestellt wurde, breiteten sich auf den nicht beackerten Flächen, Wildkräuter aus. Disteln und andere
Schnellwachsende, erreichten manchmal eine Höhe von 2 Meter, besonders auf den schweren Böden.
Es hat viel Schweiß gekostet ehe man den Acker soweit hatte, das er auch befriedigende Erträge abwarf. Die
Währungsreform von 1950, hat unser weiniges Geld das wir schon gespart hatten, wieder vernichtet. Ich hatte 2 Pferde,
1 Fohlen, 2 Kühe und Schweine, als ich wieder aufgefordert wurde nicht bezahlte Grundsteuern nachzuzahlen. Als ich
nicht bezahlen konnte, hat der Vollziehungsbeamte, ein Fohlen, eine Kuh und ein Schwein gepfändet. Es gelang mir jedoch
nach längeren Verhandlungen, ohne größere Verluste, alles zu regeln. Später kam eine Verfügung, die besagte; wenn
jemand auf seinem Hof nur eine Kuh und ein Pferd hatte, durften sie nicht gepfändet werden. Einige haben ihr Inventar
dieser Verfügung angepasst und dadurch die Zahlung von Grundsteuer umgangen.

Wer seine Steuern pünktlich bezahlt und sein Kontingent an landwirtschaftlichen Produkten fristgerecht abgeliefert hat,
der konnte seine, darüber hinaus erwirtschafteten Produkte zu marktgerechten Preisen verkaufen. Für eine hochtragende
Sterke, mindestens 400 kg schwer, die auf ein staatliches Gut verkauft wurde, konnte man bis zu 12000 Zloty bekommen.
Unsere Böden waren kalkarm, doch durch den Einsatz von Kalk und Kunstdünger konnte man den Ertrag erheblich steigern.
Kalk und Kunstdünger konnte man bei der Genossenschaft(GS) bestellen, der dann auch direkt auf den Hof geliefert wurde.
Kalk wurde geliefert und gleich auf dem Feld ausgestreut. In den 1960ger Jahren waren alle Ackerflächen der Rohmaner
Felder bestellt.
Die nach dem Krieg zurückgebliebenen deutschen Bauernfamilien, aber auch die Polen, die während des Krieges beim Bauern
in Deutschland gearbeitet haben, versuchten mit teils bescheidenen, oder auch zusammen gesuchten, landwirtschaftlichen
Geräten, die bäuerlichen Betriebe aufrecht zu erhalten. Nach den schweren Anfängen in den ersten Nachkriegsjahren
erzielten sie schließlich einen beachtlichen Erfolg, der sich in wogenden Kornfeldern, sowie in grünen Wiesen auf
denen gut genährtes Vieh weidete, widerspiegelte.
Als wir im Lager ankamen, war der französische Lagerkommandant, ein ehemaliger Kriegsgefangener, der bei einem Bauern
in Deutschland gearbeitet hatte. Dieser Bauer war jetzt als Kriegsgefangener in seinem Lager. Als er ihn erkannte, hat
er ihn gleich zum Küchendienst eingeteilt und mit dem nächsten Krankentransport nach Hause fahren lassen. Zu Mittag
bekamen wir nur gekochte Haferkörner, da schwamm alles oben, später war man dann auf Gerste umgestiegen. Als viele
daran gestorben waren, weil sie diese „Rohkost”, die nur ein Kuhmagen verträgt, nicht gegessen haben, hat man die
Körner durch eine Schrotmühle laufen lassen. Dann hat man uns Steckrüben gekocht; wir bekamen 250 Gramm Weißbrot,
etwas Quark und ein viertel Liter Magermilch. Später, als wir schon arbeiten mussten, hat man in unserem Essen einen
Kuhkopf mitgekocht, das hat dann bedeutend besser geschmeckt.
Bevor wir morgens zur Arbeit gingen, mussten wir zu Flaggenparade und abends, nach der Rückkehr, haben wir die Flagge
wieder eingeholt. Wir haben einen Kanal gereinigt, dessen Sohle 2 Meter dick mit Schlamm bedeckt war. Zuerst wurde das
Wasser abgelassen, dann haben wir, einer dem andern, den Schlamm mit der Schippe hoch gereicht. Der Letzte hat den
Schlamm, der so zäh war, dass er nicht von der Schippe wollte, oben am Rande abgelegt. Manchmal waren 10 Mann nötig um
den Höhenunterschied zu überwinden. Das Wachpersonal schoss über unsere Köpfe hinweg und rief: „schnell arbeiten”. Bei
der großen Hitze war das ein Ding der Unmöglichkeit, zumal es nichts zu Trinken gab. Auf dem Heimweg haben wir im Walde
Heilkräuter gesammelt, die man in der Küche getrocknet und als Tee zubereitet hat, den wir am nächsten tag zur Arbeit
mitnahmen, um unseren Durst zu stillen.
Unser Aufseher hatte einen Stock, an dem sich noch kurz abgeschnittene Äste befanden. Wer seiner Meinung nach, nicht
ordentlich gearbeitet hat, bekam gleich Schläge auf den Rücken. Die weißen Aufseher wurden irgendwann durch Neger
ersetzt, die uns bedeutend besser behandelt haben. Wenn irgendetwas schief ging, haben sie nichts gesagt, nur gelacht.
In den übrig gebliebenen Wassertümpeln hatten sich noch einige Aale versteckt, die wir zu fangen versuchten, was uns
auch manchmal gelang. Wir mussten ihnen das Genick brechen, damit sie uns nicht entwischen konnten. Wenn die Franzosen
bemerkten das wir Aale hatten, wurden sie uns abgenommen. Gelang es uns aber, sie ins Lager zu bringen, dann haben wir
uns eine köstliche Malzeit zubereitet.
Um sicherzustellen dass niemand geflüchtet ist, wurden wir, wenn wir abends ins Lager zurückkamen, zuerst gezählt.
Diese Zählung wurde mehrmals wiederholt, weil die Wachmannschaften sich immer wieder verzählt haben. Als einer von uns
hin ging, ihnen sagte dass alle da sind, wollten sie es nicht glauben und haben uns vor dem stehen lassen, bis es ihnen
irgendwann einfiel. uns doch das Tor zuöffnen. Einmal, als wir von der Arbeit zurückgekehrt waren, standen wir bis 23
Uhr neben der Flagge, weil uns niemand das Tor geöffnet hat. Als wir dann doch irgendwie ins Lager kamen haben wir
festgestellt, dass das ganze Wachpersonal betrunken war und niemand im Stande uns das Tor zu öffnen.
Eines Tages waren wir wieder abends zur Parole angetreten, als ein älterer Herr mit seinem Hund, am Stacheldraht
entlang, spazieren ging. Weil der Hund, unterm Stacheldraht hindurch, zu uns kam, hat ihn einer geschnappt, ihm das
Genick gebrochen und unter seiner Jacke versteckt. Der Franzose hat nach seinem Hund gerufen und gepfiffen, aber alles
vergebens, der Hund war nicht aufzufinden. Die Kameraden haben ihm gleich das Fell über die Ohren gezogen, das Fleisch
gekocht und das Fell in die Latrine geworfen. Das Fleisch wurde umgehend verspeist.
Als wir am nächsten Tag von der Arbeit zurückkehrten, war im Lager der Teufel los. Wir mussten sofort antreten und
wurden gefragt, wo der Hund geblieben ist, der Gestern Abend, mit seinem Herrchen, am Zaun entlang spazieren ging. Als
sich niemand dazu bekannte, mussten wir weiterhin stehen bleiben, während die Wachmannschaften von Baracke zu Baracke
gingen und alles durchsuchten. In einer Latrine hat man dann das Fell gefunden, was uns ein furchtbares „Donnerwetter”
einbrachte und in den nächsten Tagen, nach der Arbeit, unter dem Kommando eines Oberfeldwebels, eine Stunde
nachexerzieren.
In Südfrankreich regnet es den ganzen Sommer nicht; die Bauern haben da keine Scheunen und das Getreide wir nur in
Schobern aufgestellt und dann umgehend gedroschen. Vom Oktober bis Dezember regnete es fasst jeden Tag in Strömen.
Gesät wird nur im Frühjahr und im Herbst, weil im Sommer alles vertrocknet. Es wird viel Wein angebaut und die
Steckrübe wächst den ganzen Winter. Neben den Weinreben wurde aus Schieferplatten ein Zaun aufgestellt, um dem Wein
einen optimalen Standort zu sichern. Die Bauernwagen hatten nur zwei Räder und waren nur mit einem Pferd bespannt, das
die ganze Balance des Wagens zu halten hatte. Trotzdem haben sie soviel aufgeladen wie wir auf einen Leiterwagen. Viele
Kameraden wurden den Bauern zur Arbeit ausgeliehen. Wenn ein Bauer einen Arbeiter gebraucht hat und es wurde gefragt,
wer sich in der Landwirtschaft auskennt, da haben sich alle gemeldet. Der Bauer konnte sich dann aussuchen, wen er
mitnehmen wollte.
Wenn wir durch die Stadt zur Arbeit gingen, haben verschiedene Leute Fallobst in die Abfalleimer gelegt. Wenn das von
den Kameraden bemerkt wurde, schwenkten viele aus der Reihe, um sich etwas mit zunehmen, was von den Wachmannschaften
nicht gern gesehen wurde. Viele Kriegsgefangene hatten keine Schuhe mehr, sie haben die Füße nur mit Lumpen bewickelt.
Eines Tages kamen Kameraden aus Norwegen, die nach Deutschland entlassen werden sollten. Mann hat sie jedoch ins Lager
gesteckt und zur Arbeit eingeteilt. In Norwegen hatten sie Kleider und Stoffe eingekauft, hatten volle Seesäcke und
sogar Karren auf 2 Rädern, weil sie ja in die Heimat entlassen werden sollten. Als wir morgens zur Arbeit rausgeführt
wurden standen sie schon vor dem Lager. Wir haben ihnen zugerufen, dass sie uns etwas abgeben sollen, weil ihnen ja
sowieso alles abgenommen wird, aber sie haben uns nur ausgelacht. Als sie ins Lager Kamen mussten sie ihr Gepäck
ablegen, wurden dann wo anders hingeführt und haben es danach nie wieder gesehen.
Durch die vielen Läuse, Flöhe und Wanzen die wie im Lager hatten, kam es bei verschieden Kameraden, an den
Einstichstellen, zu eiternden Entzündungen. Um dem vorzubeugen hat man uns mit einem Pulver, das in Frankreich
hergestellt wurde, aber bei den Parasiten keine Wirkung zeigte, eingesprüht. Erst bei der Anwendung eines Mittels
amerikanischer Herkunft, war alles über Nacht verschwunden.
Der Sonntag war arbeitsfrei. Dann kam ein katholischer, französischer Pfarrer, eskortiert von 3 Mann, mit
aufgepflanztem Seitengewehr ins Lager und hat Gottesdienst gehalten. Einen evangelischen Pfarrer gab es nicht, nur
einen Baptisten Prediger. Der wurde würdevoll eingekleidet, bekam ein großes Kreuz und hat jeden Sonntag in einer
extra dafür hergerichteten Baracke Gottesdienst gehalten. Wer Theologie studiert hatte und sich meldete, wurde zu
einem Seminar geschickt und konnte sein Studium fortsetzen. Glasbläser durften das Lager auch verlassen und ihrem
erlernten Beruf wieder arbeiten.
Wer sich freiwillig, für 5 Jahre, zum Dienst in der Fremdenlegion verpflichtet hat, das waren etliche unter uns, wurde
neu eingekleidet, bekam gutes Essen und Rauchwaren soviel er wollte. Nach einem Jahr wurden, nach und nach, die
Kranken und Körperbehinderten in die Sowjetische Besatzungszone entlassen. Eine Entlassung von Kriegsgefangenen, die
in den Westzonen oder jenseits von Oder und Neise zu Hause waren, war nicht vorgesehen. Die Österreicher wurden alle,
unabhängig von ihrem Gesundheitszustand entlassen.
Ich habe Briefe nach Hause geschrieben, aber die kamen nur bis Allenstein und wurden wieder zurück geschickt. Als eine
Kommission des Roten Kreuzes aus der Schweiz unser Lager besichtigt hat, haben wir uns beschwert, das wir als
Sanitätsdienstgrade, zur Arbeit gehen müssen. Daraufhin erging ein Befehl: Wer einen vom Roten Kreuz, ausgestellten
Ausweis besitzt, gehört einem internationalen Verband an und braucht nicht zu Arbeit gehen. Aus unserem Lager hatten
sich 20 Mann gemeldet, die daraufhin Freigang, in Begleitung von zwei französischen Wachsoldaten erhielten. Als wir
gefragt wurden wo wir hin wollen, entschlossen wir uns, einen Soldatenfriedhof, auf dem unsere verstorbenen Kameraden
beerdigt waren, zu besuchen.
Da der Untergrund in dieser Gegend aus Felsen bestand, wurden die Gräben, in denen die Toten in selbst gezimmerten
Kisten nebeneinander gestellt wurden, mit Hilfe von Dynamit ausgehoben. Ein Leichenwagen, mit einem Pferd bespannt,
das mit einer schwarzen Decke abgedeckt war, wurde von einem Kutscher in angemessener Kleidung, gefahren. Der Wagen
konnte gleichzeitig 4 Kisten transportieren. Wenn wir von der Arbeit kommend, dem Leichenwagen begegneten, wurde
gehalten und mit einer Schweigeminute der Toten gedacht, bis der Wagen vorbei war. Die Zivilbevölkerung verharrte auch
im Schweigen, mit abgenommener Kopfbedeckung.
Ein Kamerad, der in Krottorf, Kreis Oschersleben, bei Magdeburg, zuhause war, sagte bei seiner Entlassung zu mir:
Sollte ich das Glück haben, meine Entlassungspapiere zu erhalten ohne eine Bleibe vorzuweisen, dann soll ich Krottorf
als Heimatadresse angeben. Auf der Krankenstube habe ich angegeben, dass sich noch ein Schrapnellsplitter, aus dem
Ersten Weltkrieg, in meiner Kreuzbeingegend befindet, er zwar verkapselt ist, aber immer noch Beschwerden verursacht.
Daraufhin wurde ich zur Entlassung vornotiert. Als bekannt wurde das ein Rückkehrertransport in die sowjetische
Besatzungszone zusammengestellt wird, habe ich mich sofort gemeldet und wurde für ein Entlassungslager in Angoleme
vorgesehen. War das eine Freude, als uns mitgeteilt wurde, wann der Rücktransport stattfindet.
In unserem Lager waren noch 2 Kameraden aus dem Kreis Ortelsburg: Ein Gustav Lumma aus Leynau und ein Alfred Moritz
aus Groß Schöndamerau. Sie mussten noch zurückbleiben und haben mir den Auftrag erteil, die Angehörigen in der Heimat
zu grüßen und ihnen die Anschrift mitzuteilen. Als wir im Entlassungslager ankamen, fragte man uns nach unserer
Heimatanschrift. Dann wurden die Entlassungspapiere angefertigt. Es wurde uns auch ein Barscheck, für die in Frankreich
geleistete Arbeit ausgehändigt, den wir bei jeder Kasse in Deutschland einlösen könnten. Ich habe ihn bis zum heutigen
Tage nicht einlösen können, obwohl ich irgendwann in der Zeitung gelesen habe, das Verrechnungschecks die den aus
französischer Kriegsgefangenschaft Entlassenen, ausgehändigt wurden, einzulösen sind.
Wir kamen zuerst nach Saar Elbe, dann in die Nähe der Zonengrenze zu Thüringen. Hier mussten wir 2 Tage warten, weil
aus der sowjetischen Besatzungszone keine Eisenbahnwagen bereitgestellt wurden. Angesichts dessen, das der Russe beim
letzten Transport die aus Frankreich kommenden Wagen kassiert und nicht mehr herausgeben wollte, bestand der Franzose
jetzt darauf, seine Wagen sofort wieder mitzunehmen. Als der sehnsüchtig erwartete Zug endlich eintraf, durften wir
umsteigen und kamen, immer noch hinter Stacheldraht, nach Erfurt. Von dort weiter ins Quarantänelager nach Prätsch an
der Elbe.
Unter Androhung von Strafe war es verboten das Lager zu verlassen, doch der Hunger zwang uns dazu, in den umliegenden
Dörfern um Lebensmittel zu betteln. Man drohte uns damit, dass Zuwiderhandlungen, mit einer 14-tägigen Verlängerung der
Quarantäne geahndet werden. Der Roggen war schon reif und wir haben, auf den umliegenden Feldern, die Ähren abgerissen,
das Korn, zwischen 2 Steinen zu Mehl zerrieben, um daraus eine Suppe zu kochen, denn von dem was unsere Lagerküche uns
bieten konnte, war es nicht möglich zu überleben. Als der Eigentümer bemerkte wer seine Roggenähren entwendet hat, kam
er ins Lager, gerade zu dem Zeitpunkt als wir mit dem Mahlen beschäftigt waren. Der Lagerkommandant, bei dem er sich
beschwerte, drohte uns zu bestrafen, wenn wir unsere „Rauzüge” nicht unmittelbar einstellen würden. Wir sagten ihm er
solle uns heimfahren lassen, da wir doch lange genug hinter Stacheldraht gesessen hätten.
Endlich wieder in Freiheit
14 Tage nach unserer Ankunft wurden uns Entlassungspapiere ausgehändigt, sowie auch Fahrscheine
zum den, von uns angegeben Heimatorten. So kam ich nach Krottof, Kreis Oschersleben, zu meinem ehemaligen
Kriegskameraden, bei dem ich einen Tag geblieben bin. Er hatte mir schon eine Stelle bei einem Bauern besorgt, der 70
Jahre alt und kinderlos war. Zum Hof, den er mit seiner Ehefrau bewirtschaftet hat, gehörten 36 Morgen Land, 2 Ochsen
und 3 Kühe. Das Ackerland bestand aus 17 Parzellen und sicherte mir einen Arbeitsplatz.
Jetzt, da ich ein Dach überm Kopf und genug zu essen hatte, fing ich an nach dem Verbleib meiner Familie zu forschen.
Bei meinem letzten Heimaturlaub hatte ich mit meiner Frau verabredet; falls wir uns in den Kriegswirren verlieren
sollten, unsere Kontaktadresse, die meiner Quartiersleute in Burscheid, Kreis Opladen, sein sollte. Ich habe zuerst
nach Rohmanen geschrieben, aber leider keine Antwort erhalten. Dann habe ich nach Burscheid geschrieben, und siehe, -
bei denen lag schon eine Anfrage meiner Frau vor, die nach mir gefragt, und ihre jetzige Anschrift hinterlassen hatte.
Ich habe dem Bauern erzählt dass meine Frau sich zurzeit, auf einem Gut, in Alt Steinhorst, im Kreis Rostock, befindet.
Er war sofort bereit uns ein Zimmer zur Verfügung zu stellen, wenn ich meine Frau nach Krottorf rüberholen wollte. Das
habe ich Ihr mitgeteilt und sie war sofort bereit ihren Wohnsitz nach Krottorf zu verlegen, denn sie wohnte dort in
einem kleinen Stübchen unterm Dach.
Im Herbst, als die Feldarbeit so ziemlich erledigt war, bin ich nach Alt Steinhorst gefahren, um meine Frau und meinen
Sohn Kurt, sowie meinen Sohn Manfred, den ich noch nicht kannte, weil er erst nach der Flucht, am 31. Januar, in Groß
Lüssewitz, geboren wurde, nach Krottorf zu holen. Meine Frau hatte schon Holz für den Winter besorgt und vom Gut, auf
dem sie im Sommer gearbeitet hatte, Mehl und Kartoffeln bekommen. Wir haben das Mehl und andere Habseligkeiten in
Kisten verpackt. Das Holz haben wir einem Bauern gegeben, der uns und unser Gepäck, mit seinem Pferdewagen, zum 14
Kilometer entfernten Bahnhof, nach Ribnitz gebracht hat. Wir sind auch gut in Krottorf angekommen, aber als wir am
nächsten Tag, unsere Kisten vom Bahnhof abholen wollten, haben wir zwar die Kisten vorgefunden, doch der gesamte Inhalt
wurde während der Bahnfahrt entwendet. Die Bahnstation in Krottorf hat die Vorkommnisse zur Kenntnis genommen und
protokolliert, aber unsere Sachen haben wir nie wieder gesehen und mussten wieder bei Null anfangen.
Im Winter musste ich auf der Genossenschaft, unentgeltlich, für die Russen Weizen einsacken. Ich hatte versucht eine
Arbeit als Zimmermann zu bekommen, doch auf dem Arbeitsamt wurde mir gesagt, ich bin Ladwirt und muss auf der
Landwirtschaft arbeiten. Da in den ersten Nachkriegsjahren, auch in der sowjetisch besetzten Zone Arbeitsplätze knapp
waren, mussten auch solche, die einen anderen Beruf erlernt hatten, jede zumutbare Arbeit annehmen. Aus der Heimat
erhielt ich einen Brief, von meiner dort noch lebenden Mutter. Sie schrieb das sie mich noch einmal sehen wollte und
ich sollte doch wieder zurück kommen; Unser Hof wäre nicht von Polen besetzt und sie wäre ganz alleine, weil der Vater
nach dem Durchzug der Front von den Russen erschlagen wurde. Daraufhin habe ich dem polnischen Konsulat in Magdeburg
mitgeteilt, dass ich in Rohmanen eine Landwirtschaft besitze, und um eine Einreisegenehmigung gebeten.
Nach 2 Monaten erhielt ich eine Postkarte, mit der Mitteilung, ich sollte mich persönlich beim Konsulat vorstellen.
Nach Aufnahme meiner Personalien, wurde mir gesagt, das ich benachrichtigt werde wenn mein Antrag genehmigt wird. Ende
Juli 1947 erhielten wir die Einreisegenehmigung nach Ostpreußen, das jetzt unter polnischer Verwaltung stand. Wir
mussten zuerst zum polnischen Konsulat in Berlin-Lichterfelde, wo wir umgeben von einer Trümmerlandschaft, gewartet
haben, bis alle Untersuchungen und Formalitäten erledigt waren.
“ Wieder zurück in Ostpreußen.”
Der schwere Wiederaufbau nach dem Kriege
Dann fuhren wir über Frankfurt/Oder, Posen, Thorn, Allenstein, nach Ortelsburg, wo wir am 2. August 1947 ankamen. Mit
einem zweirädrigen Karren, den ich mir von einem noch in Ortelsburg lebenden Bekanten ausgeliehen hatte und meinem
Sohn Manfred im Kinderwagen fuhren wir nach Rohmanen. Meine Mutter war inzwischen verstorben und auf dem Hof war nur
meine, inzwischen aus Russischer Gefangenschaft wiedergekehrte Schwester, Frieda Pelkowski.

Es war alles ausgeplündert; kein Vieh, keine Maschinen und der ganze Hof mit kniehohem Graß überwachsen. Nur schmale
Trampelpfade, vom Haus zum Holzschuppen und zum Klo, durchkreuzten das satte Grün. Ich habe das Gras auf dem Hof mit
einer Sense, die ich noch gefunden habe, abgemäht, damit der Hof nicht so verwahrlost aussah. Am nächsten Tag habe ich
mich bei der Polizei in Ortelsburg angemeldet, wo ich auch ein Startgeld von 100 Zloty erhielt und Gepäckstücke, die
ich in Krottorf aufgegeben, am Bahnhof abgeholt. Es hat mich sehr gewundert das, das Gepäck überhaupt angekommen ist.
Da man von der Landwirtschaft nicht Leben konnte, habe ich mich in den nächsten Tagen, bei der jetzt polnischen Bahn,
um Arbeit beworben und wurde auch angenommen. Wenn wir unseren Monatslohn bekamen, saß immer einer am Tisch, der von
uns 100 Zloty für den Wiederaufbau von Warschau verlangte. Wenn ich dran war, riefen die Anderen, ich hätte Warschau
zerstört und müsste deshalb 200 Zloty abgeben. Nach 3 Jahren kam eine Verfügung, die besagte, dass wer länger als 1
Jahr bei der Bahn beschäftigt ist, angestellt werden muss. Um diese Bestimmung zu umgehen hat man mich entlassen und
eine Woche später wieder eingestellt.
Als ich vor Ablauf des nächsten Jahres, aus dem gleichen Grunde wieder entlassen wurde, habe ich mich bei der
Stadtverwaltung in Ortelsburg(jetzt Szczytno)beworben, wo ich zuerst im Gaswerk als Heizer und später auf Baustellen
als Zimmermann gearbeitet habe. Wir haben durch den Krieg beschädigte Häuser repariert, in den ehemals touristischen
Zentren einige Ausbesserungen an den Einrichtungen durchgeführt, eine Ziegelei wieder in Betrieb gesetzt und andere
anfallende Arbeiten verrichtet. Im Dach des Rathausturmes war während der Kämpfe eine Granate eingeschlagen, die, die
Dachlatten und die Verschalung zerstört hatte. Da wir, unter schwersten Bedingungen, den Schaden repariert haben,
wurde uns eine Höhenzulage versprochen, die wir aber nicht bekommen haben.
Aus Verärgerung darüber habe ich bei der Stadtverwaltung gekündigt und bei einer Wiederaufbaufirma unter der Leitung
von Bauingenieur Laskowski wieder angefangen, wo ich bis 1954, als Zimmermann beschäftigt war. Ab da habe ich mich
nur um meinen Hof gekümmert, der wegen meiner Arbeitsstellen, gezwungenermaßen, sehr vernachlässigt wurde. Als wir
1947 zurückkamen, brachten wir unseren Sohn Manfred noch im Kinderwagen. Den hat meine Frau zum Markt gebracht,
verkauft, und dafür eine Ziege erworben, die dank guter Pflege, uns täglich mit 4 Liter Milch versorgte. Das war der
erste Baustein zum Wiederaufbau, unserer durch den Krieg zerstörten, und danach ausgeplünderten Landwirtschaft.
Während meiner Arbeit bei der Bahn haben wir uns eine Kuh gekauft, die nach einem halben Jahr, wegen nicht bezahlter
Grundsteuer, vom Gerichtsvollzieher gepfändet wurde. Man hat uns die Kuh weggenommen und bei einem Arbeiter, der in
der Ernst-Mey-Straße in Ortelsburg wohnte und sie wegen nicht vorhandener Futtermittel, nur mit Kartoffelkraut
gefüttert hat, untergestellt. Als ich bei der Bahn meinen Monatslohn bekommen habe, bin ich zur Gmina gegangen, habe
eine Rate angezahlt und durfte dann die Kuh wieder mit nach Hause nehmen. Durch die schlechte Ernährung war die Kuh
stark abgemagert und lieferte nur die Hälfte der ursprünglichen Milchleistung.
Später habe ich ein Pferd auf Abzahlung bekommen, das 140.000 alte Zloty gekostet hat. Die Stute war schwach und unser
Feld sehr hügelig, so dass man nur bergab pflügen konnte, was sehr beschwerlich war, bergauf ging es immer im Leerlauf.
Später habe ich die schweren Böden mit dem Traktor umpflügen, und in den letzten Jahren auch mit dem Binder mähen
lassen. Von der Stute habe ich 2 schöne Fohlen gezogen; ein davon habe ich bei der Ausreise in die Bundesrepublik
mitgebracht und bei der Viehverwertungs-Genossenschaft in Göttingen verkauft. In den ersten Nachkriegsjahren als noch
wenig Land bestellt wurde, breiteten sich auf den nicht beackerten Flächen, Wildkräuter aus. Disteln und andere
Schnellwachsende, erreichten manchmal eine Höhe von 2 Meter, besonders auf den schweren Böden.
Es hat viel Schweiß gekostet ehe man den Acker soweit hatte, das er auch befriedigende Erträge abwarf. Die
Währungsreform von 1950, hat unser weiniges Geld das wir schon gespart hatten, wieder vernichtet. Ich hatte 2 Pferde,
1 Fohlen, 2 Kühe und Schweine, als ich wieder aufgefordert wurde nicht bezahlte Grundsteuern nachzuzahlen. Als ich
nicht bezahlen konnte, hat der Vollziehungsbeamte, ein Fohlen, eine Kuh und ein Schwein gepfändet. Es gelang mir jedoch
nach längeren Verhandlungen, ohne größere Verluste, alles zu regeln. Später kam eine Verfügung, die besagte; wenn
jemand auf seinem Hof nur eine Kuh und ein Pferd hatte, durften sie nicht gepfändet werden. Einige haben ihr Inventar
dieser Verfügung angepasst und dadurch die Zahlung von Grundsteuer umgangen.

Wer seine Steuern pünktlich bezahlt und sein Kontingent an landwirtschaftlichen Produkten fristgerecht abgeliefert hat,
der konnte seine, darüber hinaus erwirtschafteten Produkte zu marktgerechten Preisen verkaufen. Für eine hochtragende
Sterke, mindestens 400 kg schwer, die auf ein staatliches Gut verkauft wurde, konnte man bis zu 12000 Zloty bekommen.
Unsere Böden waren kalkarm, doch durch den Einsatz von Kalk und Kunstdünger konnte man den Ertrag erheblich steigern.
Kalk und Kunstdünger konnte man bei der Genossenschaft(GS) bestellen, der dann auch direkt auf den Hof geliefert wurde.
Kalk wurde geliefert und gleich auf dem Feld ausgestreut. In den 1960ger Jahren waren alle Ackerflächen der Rohmaner
Felder bestellt.
Die nach dem Krieg zurückgebliebenen deutschen Bauernfamilien, aber auch die Polen, die während des Krieges beim Bauern
in Deutschland gearbeitet haben, versuchten mit teils bescheidenen, oder auch zusammen gesuchten, landwirtschaftlichen
Geräten, die bäuerlichen Betriebe aufrecht zu erhalten. Nach den schweren Anfängen in den ersten Nachkriegsjahren
erzielten sie schließlich einen beachtlichen Erfolg, der sich in wogenden Kornfeldern, sowie in grünen Wiesen auf
denen gut genährtes Vieh weidete, widerspiegelte.
Unser Aufseher hatte einen Stock, an dem sich noch kurz abgeschnittene Äste befanden. Wer seiner Meinung nach, nicht
ordentlich gearbeitet hat, bekam gleich Schläge auf den Rücken. Die weißen Aufseher wurden irgendwann durch Neger
ersetzt, die uns bedeutend besser behandelt haben. Wenn irgendetwas schief ging, haben sie nichts gesagt, nur gelacht.
In den übrig gebliebenen Wassertümpeln hatten sich noch einige Aale versteckt, die wir zu fangen versuchten, was uns
auch manchmal gelang. Wir mussten ihnen das Genick brechen, damit sie uns nicht entwischen konnten. Wenn die Franzosen
bemerkten das wir Aale hatten, wurden sie uns abgenommen. Gelang es uns aber, sie ins Lager zu bringen, dann haben wir
uns eine köstliche Malzeit zubereitet.
Um sicherzustellen dass niemand geflüchtet ist, wurden wir, wenn wir abends ins Lager zurückkamen, zuerst gezählt.
Diese Zählung wurde mehrmals wiederholt, weil die Wachmannschaften sich immer wieder verzählt haben. Als einer von uns
hin ging, ihnen sagte dass alle da sind, wollten sie es nicht glauben und haben uns vor dem stehen lassen, bis es ihnen
irgendwann einfiel. uns doch das Tor zuöffnen. Einmal, als wir von der Arbeit zurückgekehrt waren, standen wir bis 23
Uhr neben der Flagge, weil uns niemand das Tor geöffnet hat. Als wir dann doch irgendwie ins Lager kamen haben wir
festgestellt, dass das ganze Wachpersonal betrunken war und niemand im Stande uns das Tor zu öffnen.
Eines Tages waren wir wieder abends zur Parole angetreten, als ein älterer Herr mit seinem Hund, am Stacheldraht
entlang, spazieren ging. Weil der Hund, unterm Stacheldraht hindurch, zu uns kam, hat ihn einer geschnappt, ihm das
Genick gebrochen und unter seiner Jacke versteckt. Der Franzose hat nach seinem Hund gerufen und gepfiffen, aber alles
vergebens, der Hund war nicht aufzufinden. Die Kameraden haben ihm gleich das Fell über die Ohren gezogen, das Fleisch
gekocht und das Fell in die Latrine geworfen. Das Fleisch wurde umgehend verspeist.
Als wir am nächsten Tag von der Arbeit zurückkehrten, war im Lager der Teufel los. Wir mussten sofort antreten und
wurden gefragt, wo der Hund geblieben ist, der Gestern Abend, mit seinem Herrchen, am Zaun entlang spazieren ging. Als
sich niemand dazu bekannte, mussten wir weiterhin stehen bleiben, während die Wachmannschaften von Baracke zu Baracke
gingen und alles durchsuchten. In einer Latrine hat man dann das Fell gefunden, was uns ein furchtbares „Donnerwetter”
einbrachte und in den nächsten Tagen, nach der Arbeit, unter dem Kommando eines Oberfeldwebels, eine Stunde
nachexerzieren.
In Südfrankreich regnet es den ganzen Sommer nicht; die Bauern haben da keine Scheunen und das Getreide wir nur in
Schobern aufgestellt und dann umgehend gedroschen. Vom Oktober bis Dezember regnete es fasst jeden Tag in Strömen.
Gesät wird nur im Frühjahr und im Herbst, weil im Sommer alles vertrocknet. Es wird viel Wein angebaut und die
Steckrübe wächst den ganzen Winter. Neben den Weinreben wurde aus Schieferplatten ein Zaun aufgestellt, um dem Wein
einen optimalen Standort zu sichern. Die Bauernwagen hatten nur zwei Räder und waren nur mit einem Pferd bespannt, das
die ganze Balance des Wagens zu halten hatte. Trotzdem haben sie soviel aufgeladen wie wir auf einen Leiterwagen. Viele
Kameraden wurden den Bauern zur Arbeit ausgeliehen. Wenn ein Bauer einen Arbeiter gebraucht hat und es wurde gefragt,
wer sich in der Landwirtschaft auskennt, da haben sich alle gemeldet. Der Bauer konnte sich dann aussuchen, wen er
mitnehmen wollte.
Wenn wir durch die Stadt zur Arbeit gingen, haben verschiedene Leute Fallobst in die Abfalleimer gelegt. Wenn das von
den Kameraden bemerkt wurde, schwenkten viele aus der Reihe, um sich etwas mit zunehmen, was von den Wachmannschaften
nicht gern gesehen wurde. Viele Kriegsgefangene hatten keine Schuhe mehr, sie haben die Füße nur mit Lumpen bewickelt.
Eines Tages kamen Kameraden aus Norwegen, die nach Deutschland entlassen werden sollten. Mann hat sie jedoch ins Lager
gesteckt und zur Arbeit eingeteilt. In Norwegen hatten sie Kleider und Stoffe eingekauft, hatten volle Seesäcke und
sogar Karren auf 2 Rädern, weil sie ja in die Heimat entlassen werden sollten. Als wir morgens zur Arbeit rausgeführt
wurden standen sie schon vor dem Lager. Wir haben ihnen zugerufen, dass sie uns etwas abgeben sollen, weil ihnen ja
sowieso alles abgenommen wird, aber sie haben uns nur ausgelacht. Als sie ins Lager Kamen mussten sie ihr Gepäck
ablegen, wurden dann wo anders hingeführt und haben es danach nie wieder gesehen.
Durch die vielen Läuse, Flöhe und Wanzen die wie im Lager hatten, kam es bei verschieden Kameraden, an den
Einstichstellen, zu eiternden Entzündungen. Um dem vorzubeugen hat man uns mit einem Pulver, das in Frankreich
hergestellt wurde, aber bei den Parasiten keine Wirkung zeigte, eingesprüht. Erst bei der Anwendung eines Mittels
amerikanischer Herkunft, war alles über Nacht verschwunden.
Der Sonntag war arbeitsfrei. Dann kam ein katholischer, französischer Pfarrer, eskortiert von 3 Mann, mit
aufgepflanztem Seitengewehr ins Lager und hat Gottesdienst gehalten. Einen evangelischen Pfarrer gab es nicht, nur
einen Baptisten Prediger. Der wurde würdevoll eingekleidet, bekam ein großes Kreuz und hat jeden Sonntag in einer
extra dafür hergerichteten Baracke Gottesdienst gehalten. Wer Theologie studiert hatte und sich meldete, wurde zu
einem Seminar geschickt und konnte sein Studium fortsetzen. Glasbläser durften das Lager auch verlassen und ihrem
erlernten Beruf wieder arbeiten.
Wer sich freiwillig, für 5 Jahre, zum Dienst in der Fremdenlegion verpflichtet hat, das waren etliche unter uns, wurde
neu eingekleidet, bekam gutes Essen und Rauchwaren soviel er wollte. Nach einem Jahr wurden, nach und nach, die
Kranken und Körperbehinderten in die Sowjetische Besatzungszone entlassen. Eine Entlassung von Kriegsgefangenen, die
in den Westzonen oder jenseits von Oder und Neise zu Hause waren, war nicht vorgesehen. Die Österreicher wurden alle,
unabhängig von ihrem Gesundheitszustand entlassen.
Ich habe Briefe nach Hause geschrieben, aber die kamen nur bis Allenstein und wurden wieder zurück geschickt. Als eine
Kommission des Roten Kreuzes aus der Schweiz unser Lager besichtigt hat, haben wir uns beschwert, das wir als
Sanitätsdienstgrade, zur Arbeit gehen müssen. Daraufhin erging ein Befehl: Wer einen vom Roten Kreuz, ausgestellten
Ausweis besitzt, gehört einem internationalen Verband an und braucht nicht zu Arbeit gehen. Aus unserem Lager hatten
sich 20 Mann gemeldet, die daraufhin Freigang, in Begleitung von zwei französischen Wachsoldaten erhielten. Als wir
gefragt wurden wo wir hin wollen, entschlossen wir uns, einen Soldatenfriedhof, auf dem unsere verstorbenen Kameraden
beerdigt waren, zu besuchen.
Da der Untergrund in dieser Gegend aus Felsen bestand, wurden die Gräben, in denen die Toten in selbst gezimmerten
Kisten nebeneinander gestellt wurden, mit Hilfe von Dynamit ausgehoben. Ein Leichenwagen, mit einem Pferd bespannt,
das mit einer schwarzen Decke abgedeckt war, wurde von einem Kutscher in angemessener Kleidung, gefahren. Der Wagen
konnte gleichzeitig 4 Kisten transportieren. Wenn wir von der Arbeit kommend, dem Leichenwagen begegneten, wurde
gehalten und mit einer Schweigeminute der Toten gedacht, bis der Wagen vorbei war. Die Zivilbevölkerung verharrte auch
im Schweigen, mit abgenommener Kopfbedeckung.
Ein Kamerad, der in Krottorf, Kreis Oschersleben, bei Magdeburg, zuhause war, sagte bei seiner Entlassung zu mir:
Sollte ich das Glück haben, meine Entlassungspapiere zu erhalten ohne eine Bleibe vorzuweisen, dann soll ich Krottorf
als Heimatadresse angeben. Auf der Krankenstube habe ich angegeben, dass sich noch ein Schrapnellsplitter, aus dem
Ersten Weltkrieg, in meiner Kreuzbeingegend befindet, er zwar verkapselt ist, aber immer noch Beschwerden verursacht.
Daraufhin wurde ich zur Entlassung vornotiert. Als bekannt wurde das ein Rückkehrertransport in die sowjetische
Besatzungszone zusammengestellt wird, habe ich mich sofort gemeldet und wurde für ein Entlassungslager in Angoleme
vorgesehen. War das eine Freude, als uns mitgeteilt wurde, wann der Rücktransport stattfindet.
In unserem Lager waren noch 2 Kameraden aus dem Kreis Ortelsburg: Ein Gustav Lumma aus Leynau und ein Alfred Moritz
aus Groß Schöndamerau. Sie mussten noch zurückbleiben und haben mir den Auftrag erteil, die Angehörigen in der Heimat
zu grüßen und ihnen die Anschrift mitzuteilen. Als wir im Entlassungslager ankamen, fragte man uns nach unserer
Heimatanschrift. Dann wurden die Entlassungspapiere angefertigt. Es wurde uns auch ein Barscheck, für die in Frankreich
geleistete Arbeit ausgehändigt, den wir bei jeder Kasse in Deutschland einlösen könnten. Ich habe ihn bis zum heutigen
Tage nicht einlösen können, obwohl ich irgendwann in der Zeitung gelesen habe, das Verrechnungschecks die den aus
französischer Kriegsgefangenschaft Entlassenen, ausgehändigt wurden, einzulösen sind.
Wir kamen zuerst nach Saar Elbe, dann in die Nähe der Zonengrenze zu Thüringen. Hier mussten wir 2 Tage warten, weil
aus der sowjetischen Besatzungszone keine Eisenbahnwagen bereitgestellt wurden. Angesichts dessen, das der Russe beim
letzten Transport die aus Frankreich kommenden Wagen kassiert und nicht mehr herausgeben wollte, bestand der Franzose
jetzt darauf, seine Wagen sofort wieder mitzunehmen. Als der sehnsüchtig erwartete Zug endlich eintraf, durften wir
umsteigen und kamen, immer noch hinter Stacheldraht, nach Erfurt. Von dort weiter ins Quarantänelager nach Prätsch an
der Elbe.
Unter Androhung von Strafe war es verboten das Lager zu verlassen, doch der Hunger zwang uns dazu, in den umliegenden
Dörfern um Lebensmittel zu betteln. Man drohte uns damit, dass Zuwiderhandlungen, mit einer 14-tägigen Verlängerung der
Quarantäne geahndet werden. Der Roggen war schon reif und wir haben, auf den umliegenden Feldern, die Ähren abgerissen,
das Korn, zwischen 2 Steinen zu Mehl zerrieben, um daraus eine Suppe zu kochen, denn von dem was unsere Lagerküche uns
bieten konnte, war es nicht möglich zu überleben. Als der Eigentümer bemerkte wer seine Roggenähren entwendet hat, kam
er ins Lager, gerade zu dem Zeitpunkt als wir mit dem Mahlen beschäftigt waren. Der Lagerkommandant, bei dem er sich
beschwerte, drohte uns zu bestrafen, wenn wir unsere „Rauzüge” nicht unmittelbar einstellen würden. Wir sagten ihm er
solle uns heimfahren lassen, da wir doch lange genug hinter Stacheldraht gesessen hätten.
Endlich wieder in Freiheit
14 Tage nach unserer Ankunft wurden uns Entlassungspapiere ausgehändigt, sowie auch Fahrscheine
zum den, von uns angegeben Heimatorten. So kam ich nach Krottof, Kreis Oschersleben, zu meinem ehemaligen
Kriegskameraden, bei dem ich einen Tag geblieben bin. Er hatte mir schon eine Stelle bei einem Bauern besorgt, der 70
Jahre alt und kinderlos war. Zum Hof, den er mit seiner Ehefrau bewirtschaftet hat, gehörten 36 Morgen Land, 2 Ochsen
und 3 Kühe. Das Ackerland bestand aus 17 Parzellen und sicherte mir einen Arbeitsplatz.
Jetzt, da ich ein Dach überm Kopf und genug zu essen hatte, fing ich an nach dem Verbleib meiner Familie zu forschen.
Bei meinem letzten Heimaturlaub hatte ich mit meiner Frau verabredet; falls wir uns in den Kriegswirren verlieren
sollten, unsere Kontaktadresse, die meiner Quartiersleute in Burscheid, Kreis Opladen, sein sollte. Ich habe zuerst
nach Rohmanen geschrieben, aber leider keine Antwort erhalten. Dann habe ich nach Burscheid geschrieben, und siehe, -
bei denen lag schon eine Anfrage meiner Frau vor, die nach mir gefragt, und ihre jetzige Anschrift hinterlassen hatte.
Ich habe dem Bauern erzählt dass meine Frau sich zurzeit, auf einem Gut, in Alt Steinhorst, im Kreis Rostock, befindet.
Er war sofort bereit uns ein Zimmer zur Verfügung zu stellen, wenn ich meine Frau nach Krottorf rüberholen wollte. Das
habe ich Ihr mitgeteilt und sie war sofort bereit ihren Wohnsitz nach Krottorf zu verlegen, denn sie wohnte dort in
einem kleinen Stübchen unterm Dach.
Im Herbst, als die Feldarbeit so ziemlich erledigt war, bin ich nach Alt Steinhorst gefahren, um meine Frau und meinen
Sohn Kurt, sowie meinen Sohn Manfred, den ich noch nicht kannte, weil er erst nach der Flucht, am 31. Januar, in Groß
Lüssewitz, geboren wurde, nach Krottorf zu holen. Meine Frau hatte schon Holz für den Winter besorgt und vom Gut, auf
dem sie im Sommer gearbeitet hatte, Mehl und Kartoffeln bekommen. Wir haben das Mehl und andere Habseligkeiten in
Kisten verpackt. Das Holz haben wir einem Bauern gegeben, der uns und unser Gepäck, mit seinem Pferdewagen, zum 14
Kilometer entfernten Bahnhof, nach Ribnitz gebracht hat. Wir sind auch gut in Krottorf angekommen, aber als wir am
nächsten Tag, unsere Kisten vom Bahnhof abholen wollten, haben wir zwar die Kisten vorgefunden, doch der gesamte Inhalt
wurde während der Bahnfahrt entwendet. Die Bahnstation in Krottorf hat die Vorkommnisse zur Kenntnis genommen und
protokolliert, aber unsere Sachen haben wir nie wieder gesehen und mussten wieder bei Null anfangen.
Im Winter musste ich auf der Genossenschaft, unentgeltlich, für die Russen Weizen einsacken. Ich hatte versucht eine
Arbeit als Zimmermann zu bekommen, doch auf dem Arbeitsamt wurde mir gesagt, ich bin Ladwirt und muss auf der
Landwirtschaft arbeiten. Da in den ersten Nachkriegsjahren, auch in der sowjetisch besetzten Zone Arbeitsplätze knapp
waren, mussten auch solche, die einen anderen Beruf erlernt hatten, jede zumutbare Arbeit annehmen. Aus der Heimat
erhielt ich einen Brief, von meiner dort noch lebenden Mutter. Sie schrieb das sie mich noch einmal sehen wollte und
ich sollte doch wieder zurück kommen; Unser Hof wäre nicht von Polen besetzt und sie wäre ganz alleine, weil der Vater
nach dem Durchzug der Front von den Russen erschlagen wurde. Daraufhin habe ich dem polnischen Konsulat in Magdeburg
mitgeteilt, dass ich in Rohmanen eine Landwirtschaft besitze, und um eine Einreisegenehmigung gebeten.
Nach 2 Monaten erhielt ich eine Postkarte, mit der Mitteilung, ich sollte mich persönlich beim Konsulat vorstellen.
Nach Aufnahme meiner Personalien, wurde mir gesagt, das ich benachrichtigt werde wenn mein Antrag genehmigt wird. Ende
Juli 1947 erhielten wir die Einreisegenehmigung nach Ostpreußen, das jetzt unter polnischer Verwaltung stand. Wir
mussten zuerst zum polnischen Konsulat in Berlin-Lichterfelde, wo wir umgeben von einer Trümmerlandschaft, gewartet
haben, bis alle Untersuchungen und Formalitäten erledigt waren.
“ Wieder zurück in Ostpreußen.”
Der schwere Wiederaufbau nach dem Kriege
Dann fuhren wir über Frankfurt/Oder, Posen, Thorn, Allenstein, nach Ortelsburg, wo wir am 2. August 1947 ankamen. Mit
einem zweirädrigen Karren, den ich mir von einem noch in Ortelsburg lebenden Bekanten ausgeliehen hatte und meinem
Sohn Manfred im Kinderwagen fuhren wir nach Rohmanen. Meine Mutter war inzwischen verstorben und auf dem Hof war nur
meine, inzwischen aus Russischer Gefangenschaft wiedergekehrte Schwester, Frieda Pelkowski.

Es war alles ausgeplündert; kein Vieh, keine Maschinen und der ganze Hof mit kniehohem Graß überwachsen. Nur schmale
Trampelpfade, vom Haus zum Holzschuppen und zum Klo, durchkreuzten das satte Grün. Ich habe das Gras auf dem Hof mit
einer Sense, die ich noch gefunden habe, abgemäht, damit der Hof nicht so verwahrlost aussah. Am nächsten Tag habe ich
mich bei der Polizei in Ortelsburg angemeldet, wo ich auch ein Startgeld von 100 Zloty erhielt und Gepäckstücke, die
ich in Krottorf aufgegeben, am Bahnhof abgeholt. Es hat mich sehr gewundert das, das Gepäck überhaupt angekommen ist.
Da man von der Landwirtschaft nicht Leben konnte, habe ich mich in den nächsten Tagen, bei der jetzt polnischen Bahn,
um Arbeit beworben und wurde auch angenommen. Wenn wir unseren Monatslohn bekamen, saß immer einer am Tisch, der von
uns 100 Zloty für den Wiederaufbau von Warschau verlangte. Wenn ich dran war, riefen die Anderen, ich hätte Warschau
zerstört und müsste deshalb 200 Zloty abgeben. Nach 3 Jahren kam eine Verfügung, die besagte, dass wer länger als 1
Jahr bei der Bahn beschäftigt ist, angestellt werden muss. Um diese Bestimmung zu umgehen hat man mich entlassen und
eine Woche später wieder eingestellt.
Als ich vor Ablauf des nächsten Jahres, aus dem gleichen Grunde wieder entlassen wurde, habe ich mich bei der
Stadtverwaltung in Ortelsburg(jetzt Szczytno)beworben, wo ich zuerst im Gaswerk als Heizer und später auf Baustellen
als Zimmermann gearbeitet habe. Wir haben durch den Krieg beschädigte Häuser repariert, in den ehemals touristischen
Zentren einige Ausbesserungen an den Einrichtungen durchgeführt, eine Ziegelei wieder in Betrieb gesetzt und andere
anfallende Arbeiten verrichtet. Im Dach des Rathausturmes war während der Kämpfe eine Granate eingeschlagen, die, die
Dachlatten und die Verschalung zerstört hatte. Da wir, unter schwersten Bedingungen, den Schaden repariert haben,
wurde uns eine Höhenzulage versprochen, die wir aber nicht bekommen haben.
Aus Verärgerung darüber habe ich bei der Stadtverwaltung gekündigt und bei einer Wiederaufbaufirma unter der Leitung
von Bauingenieur Laskowski wieder angefangen, wo ich bis 1954, als Zimmermann beschäftigt war. Ab da habe ich mich
nur um meinen Hof gekümmert, der wegen meiner Arbeitsstellen, gezwungenermaßen, sehr vernachlässigt wurde. Als wir
1947 zurückkamen, brachten wir unseren Sohn Manfred noch im Kinderwagen. Den hat meine Frau zum Markt gebracht,
verkauft, und dafür eine Ziege erworben, die dank guter Pflege, uns täglich mit 4 Liter Milch versorgte. Das war der
erste Baustein zum Wiederaufbau, unserer durch den Krieg zerstörten, und danach ausgeplünderten Landwirtschaft.
Während meiner Arbeit bei der Bahn haben wir uns eine Kuh gekauft, die nach einem halben Jahr, wegen nicht bezahlter
Grundsteuer, vom Gerichtsvollzieher gepfändet wurde. Man hat uns die Kuh weggenommen und bei einem Arbeiter, der in
der Ernst-Mey-Straße in Ortelsburg wohnte und sie wegen nicht vorhandener Futtermittel, nur mit Kartoffelkraut
gefüttert hat, untergestellt. Als ich bei der Bahn meinen Monatslohn bekommen habe, bin ich zur Gmina gegangen, habe
eine Rate angezahlt und durfte dann die Kuh wieder mit nach Hause nehmen. Durch die schlechte Ernährung war die Kuh
stark abgemagert und lieferte nur die Hälfte der ursprünglichen Milchleistung.
Später habe ich ein Pferd auf Abzahlung bekommen, das 140.000 alte Zloty gekostet hat. Die Stute war schwach und unser
Feld sehr hügelig, so dass man nur bergab pflügen konnte, was sehr beschwerlich war, bergauf ging es immer im Leerlauf.
Später habe ich die schweren Böden mit dem Traktor umpflügen, und in den letzten Jahren auch mit dem Binder mähen
lassen. Von der Stute habe ich 2 schöne Fohlen gezogen; ein davon habe ich bei der Ausreise in die Bundesrepublik
mitgebracht und bei der Viehverwertungs-Genossenschaft in Göttingen verkauft. In den ersten Nachkriegsjahren als noch
wenig Land bestellt wurde, breiteten sich auf den nicht beackerten Flächen, Wildkräuter aus. Disteln und andere
Schnellwachsende, erreichten manchmal eine Höhe von 2 Meter, besonders auf den schweren Böden.
Es hat viel Schweiß gekostet ehe man den Acker soweit hatte, das er auch befriedigende Erträge abwarf. Die
Währungsreform von 1950, hat unser weiniges Geld das wir schon gespart hatten, wieder vernichtet. Ich hatte 2 Pferde,
1 Fohlen, 2 Kühe und Schweine, als ich wieder aufgefordert wurde nicht bezahlte Grundsteuern nachzuzahlen. Als ich
nicht bezahlen konnte, hat der Vollziehungsbeamte, ein Fohlen, eine Kuh und ein Schwein gepfändet. Es gelang mir jedoch
nach längeren Verhandlungen, ohne größere Verluste, alles zu regeln. Später kam eine Verfügung, die besagte; wenn
jemand auf seinem Hof nur eine Kuh und ein Pferd hatte, durften sie nicht gepfändet werden. Einige haben ihr Inventar
dieser Verfügung angepasst und dadurch die Zahlung von Grundsteuer umgangen.

Wer seine Steuern pünktlich bezahlt und sein Kontingent an landwirtschaftlichen Produkten fristgerecht abgeliefert hat,
der konnte seine, darüber hinaus erwirtschafteten Produkte zu marktgerechten Preisen verkaufen. Für eine hochtragende
Sterke, mindestens 400 kg schwer, die auf ein staatliches Gut verkauft wurde, konnte man bis zu 12000 Zloty bekommen.
Unsere Böden waren kalkarm, doch durch den Einsatz von Kalk und Kunstdünger konnte man den Ertrag erheblich steigern.
Kalk und Kunstdünger konnte man bei der Genossenschaft(GS) bestellen, der dann auch direkt auf den Hof geliefert wurde.
Kalk wurde geliefert und gleich auf dem Feld ausgestreut. In den 1960ger Jahren waren alle Ackerflächen der Rohmaner
Felder bestellt.
Die nach dem Krieg zurückgebliebenen deutschen Bauernfamilien, aber auch die Polen, die während des Krieges beim Bauern
in Deutschland gearbeitet haben, versuchten mit teils bescheidenen, oder auch zusammen gesuchten, landwirtschaftlichen
Geräten, die bäuerlichen Betriebe aufrecht zu erhalten. Nach den schweren Anfängen in den ersten Nachkriegsjahren
erzielten sie schließlich einen beachtlichen Erfolg, der sich in wogenden Kornfeldern, sowie in grünen Wiesen auf
denen gut genährtes Vieh weidete, widerspiegelte.
Eines Tages waren wir wieder abends zur Parole angetreten, als ein älterer Herr mit seinem Hund, am Stacheldraht
entlang, spazieren ging. Weil der Hund, unterm Stacheldraht hindurch, zu uns kam, hat ihn einer geschnappt, ihm das
Genick gebrochen und unter seiner Jacke versteckt. Der Franzose hat nach seinem Hund gerufen und gepfiffen, aber alles
vergebens, der Hund war nicht aufzufinden. Die Kameraden haben ihm gleich das Fell über die Ohren gezogen, das Fleisch
gekocht und das Fell in die Latrine geworfen. Das Fleisch wurde umgehend verspeist.
Als wir am nächsten Tag von der Arbeit zurückkehrten, war im Lager der Teufel los. Wir mussten sofort antreten und
wurden gefragt, wo der Hund geblieben ist, der Gestern Abend, mit seinem Herrchen, am Zaun entlang spazieren ging. Als
sich niemand dazu bekannte, mussten wir weiterhin stehen bleiben, während die Wachmannschaften von Baracke zu Baracke
gingen und alles durchsuchten. In einer Latrine hat man dann das Fell gefunden, was uns ein furchtbares „Donnerwetter”
einbrachte und in den nächsten Tagen, nach der Arbeit, unter dem Kommando eines Oberfeldwebels, eine Stunde
nachexerzieren.
In Südfrankreich regnet es den ganzen Sommer nicht; die Bauern haben da keine Scheunen und das Getreide wir nur in
Schobern aufgestellt und dann umgehend gedroschen. Vom Oktober bis Dezember regnete es fasst jeden Tag in Strömen.
Gesät wird nur im Frühjahr und im Herbst, weil im Sommer alles vertrocknet. Es wird viel Wein angebaut und die
Steckrübe wächst den ganzen Winter. Neben den Weinreben wurde aus Schieferplatten ein Zaun aufgestellt, um dem Wein
einen optimalen Standort zu sichern. Die Bauernwagen hatten nur zwei Räder und waren nur mit einem Pferd bespannt, das
die ganze Balance des Wagens zu halten hatte. Trotzdem haben sie soviel aufgeladen wie wir auf einen Leiterwagen. Viele
Kameraden wurden den Bauern zur Arbeit ausgeliehen. Wenn ein Bauer einen Arbeiter gebraucht hat und es wurde gefragt,
wer sich in der Landwirtschaft auskennt, da haben sich alle gemeldet. Der Bauer konnte sich dann aussuchen, wen er
mitnehmen wollte.
Wenn wir durch die Stadt zur Arbeit gingen, haben verschiedene Leute Fallobst in die Abfalleimer gelegt. Wenn das von
den Kameraden bemerkt wurde, schwenkten viele aus der Reihe, um sich etwas mit zunehmen, was von den Wachmannschaften
nicht gern gesehen wurde. Viele Kriegsgefangene hatten keine Schuhe mehr, sie haben die Füße nur mit Lumpen bewickelt.
Eines Tages kamen Kameraden aus Norwegen, die nach Deutschland entlassen werden sollten. Mann hat sie jedoch ins Lager
gesteckt und zur Arbeit eingeteilt. In Norwegen hatten sie Kleider und Stoffe eingekauft, hatten volle Seesäcke und
sogar Karren auf 2 Rädern, weil sie ja in die Heimat entlassen werden sollten. Als wir morgens zur Arbeit rausgeführt
wurden standen sie schon vor dem Lager. Wir haben ihnen zugerufen, dass sie uns etwas abgeben sollen, weil ihnen ja
sowieso alles abgenommen wird, aber sie haben uns nur ausgelacht. Als sie ins Lager Kamen mussten sie ihr Gepäck
ablegen, wurden dann wo anders hingeführt und haben es danach nie wieder gesehen.
Durch die vielen Läuse, Flöhe und Wanzen die wie im Lager hatten, kam es bei verschieden Kameraden, an den
Einstichstellen, zu eiternden Entzündungen. Um dem vorzubeugen hat man uns mit einem Pulver, das in Frankreich
hergestellt wurde, aber bei den Parasiten keine Wirkung zeigte, eingesprüht. Erst bei der Anwendung eines Mittels
amerikanischer Herkunft, war alles über Nacht verschwunden.
Der Sonntag war arbeitsfrei. Dann kam ein katholischer, französischer Pfarrer, eskortiert von 3 Mann, mit
aufgepflanztem Seitengewehr ins Lager und hat Gottesdienst gehalten. Einen evangelischen Pfarrer gab es nicht, nur
einen Baptisten Prediger. Der wurde würdevoll eingekleidet, bekam ein großes Kreuz und hat jeden Sonntag in einer
extra dafür hergerichteten Baracke Gottesdienst gehalten. Wer Theologie studiert hatte und sich meldete, wurde zu
einem Seminar geschickt und konnte sein Studium fortsetzen. Glasbläser durften das Lager auch verlassen und ihrem
erlernten Beruf wieder arbeiten.
Wer sich freiwillig, für 5 Jahre, zum Dienst in der Fremdenlegion verpflichtet hat, das waren etliche unter uns, wurde
neu eingekleidet, bekam gutes Essen und Rauchwaren soviel er wollte. Nach einem Jahr wurden, nach und nach, die
Kranken und Körperbehinderten in die Sowjetische Besatzungszone entlassen. Eine Entlassung von Kriegsgefangenen, die
in den Westzonen oder jenseits von Oder und Neise zu Hause waren, war nicht vorgesehen. Die Österreicher wurden alle,
unabhängig von ihrem Gesundheitszustand entlassen.
Ich habe Briefe nach Hause geschrieben, aber die kamen nur bis Allenstein und wurden wieder zurück geschickt. Als eine
Kommission des Roten Kreuzes aus der Schweiz unser Lager besichtigt hat, haben wir uns beschwert, das wir als
Sanitätsdienstgrade, zur Arbeit gehen müssen. Daraufhin erging ein Befehl: Wer einen vom Roten Kreuz, ausgestellten
Ausweis besitzt, gehört einem internationalen Verband an und braucht nicht zu Arbeit gehen. Aus unserem Lager hatten
sich 20 Mann gemeldet, die daraufhin Freigang, in Begleitung von zwei französischen Wachsoldaten erhielten. Als wir
gefragt wurden wo wir hin wollen, entschlossen wir uns, einen Soldatenfriedhof, auf dem unsere verstorbenen Kameraden
beerdigt waren, zu besuchen.
Da der Untergrund in dieser Gegend aus Felsen bestand, wurden die Gräben, in denen die Toten in selbst gezimmerten
Kisten nebeneinander gestellt wurden, mit Hilfe von Dynamit ausgehoben. Ein Leichenwagen, mit einem Pferd bespannt,
das mit einer schwarzen Decke abgedeckt war, wurde von einem Kutscher in angemessener Kleidung, gefahren. Der Wagen
konnte gleichzeitig 4 Kisten transportieren. Wenn wir von der Arbeit kommend, dem Leichenwagen begegneten, wurde
gehalten und mit einer Schweigeminute der Toten gedacht, bis der Wagen vorbei war. Die Zivilbevölkerung verharrte auch
im Schweigen, mit abgenommener Kopfbedeckung.
Ein Kamerad, der in Krottorf, Kreis Oschersleben, bei Magdeburg, zuhause war, sagte bei seiner Entlassung zu mir:
Sollte ich das Glück haben, meine Entlassungspapiere zu erhalten ohne eine Bleibe vorzuweisen, dann soll ich Krottorf
als Heimatadresse angeben. Auf der Krankenstube habe ich angegeben, dass sich noch ein Schrapnellsplitter, aus dem
Ersten Weltkrieg, in meiner Kreuzbeingegend befindet, er zwar verkapselt ist, aber immer noch Beschwerden verursacht.
Daraufhin wurde ich zur Entlassung vornotiert. Als bekannt wurde das ein Rückkehrertransport in die sowjetische
Besatzungszone zusammengestellt wird, habe ich mich sofort gemeldet und wurde für ein Entlassungslager in Angoleme
vorgesehen. War das eine Freude, als uns mitgeteilt wurde, wann der Rücktransport stattfindet.
In unserem Lager waren noch 2 Kameraden aus dem Kreis Ortelsburg: Ein Gustav Lumma aus Leynau und ein Alfred Moritz
aus Groß Schöndamerau. Sie mussten noch zurückbleiben und haben mir den Auftrag erteil, die Angehörigen in der Heimat
zu grüßen und ihnen die Anschrift mitzuteilen. Als wir im Entlassungslager ankamen, fragte man uns nach unserer
Heimatanschrift. Dann wurden die Entlassungspapiere angefertigt. Es wurde uns auch ein Barscheck, für die in Frankreich
geleistete Arbeit ausgehändigt, den wir bei jeder Kasse in Deutschland einlösen könnten. Ich habe ihn bis zum heutigen
Tage nicht einlösen können, obwohl ich irgendwann in der Zeitung gelesen habe, das Verrechnungschecks die den aus
französischer Kriegsgefangenschaft Entlassenen, ausgehändigt wurden, einzulösen sind.
Wir kamen zuerst nach Saar Elbe, dann in die Nähe der Zonengrenze zu Thüringen. Hier mussten wir 2 Tage warten, weil
aus der sowjetischen Besatzungszone keine Eisenbahnwagen bereitgestellt wurden. Angesichts dessen, das der Russe beim
letzten Transport die aus Frankreich kommenden Wagen kassiert und nicht mehr herausgeben wollte, bestand der Franzose
jetzt darauf, seine Wagen sofort wieder mitzunehmen. Als der sehnsüchtig erwartete Zug endlich eintraf, durften wir
umsteigen und kamen, immer noch hinter Stacheldraht, nach Erfurt. Von dort weiter ins Quarantänelager nach Prätsch an
der Elbe.
Unter Androhung von Strafe war es verboten das Lager zu verlassen, doch der Hunger zwang uns dazu, in den umliegenden
Dörfern um Lebensmittel zu betteln. Man drohte uns damit, dass Zuwiderhandlungen, mit einer 14-tägigen Verlängerung der
Quarantäne geahndet werden. Der Roggen war schon reif und wir haben, auf den umliegenden Feldern, die Ähren abgerissen,
das Korn, zwischen 2 Steinen zu Mehl zerrieben, um daraus eine Suppe zu kochen, denn von dem was unsere Lagerküche uns
bieten konnte, war es nicht möglich zu überleben. Als der Eigentümer bemerkte wer seine Roggenähren entwendet hat, kam
er ins Lager, gerade zu dem Zeitpunkt als wir mit dem Mahlen beschäftigt waren. Der Lagerkommandant, bei dem er sich
beschwerte, drohte uns zu bestrafen, wenn wir unsere „Rauzüge” nicht unmittelbar einstellen würden. Wir sagten ihm er
solle uns heimfahren lassen, da wir doch lange genug hinter Stacheldraht gesessen hätten.
Endlich wieder in Freiheit
14 Tage nach unserer Ankunft wurden uns Entlassungspapiere ausgehändigt, sowie auch Fahrscheine
zum den, von uns angegeben Heimatorten. So kam ich nach Krottof, Kreis Oschersleben, zu meinem ehemaligen
Kriegskameraden, bei dem ich einen Tag geblieben bin. Er hatte mir schon eine Stelle bei einem Bauern besorgt, der 70
Jahre alt und kinderlos war. Zum Hof, den er mit seiner Ehefrau bewirtschaftet hat, gehörten 36 Morgen Land, 2 Ochsen
und 3 Kühe. Das Ackerland bestand aus 17 Parzellen und sicherte mir einen Arbeitsplatz.
Jetzt, da ich ein Dach überm Kopf und genug zu essen hatte, fing ich an nach dem Verbleib meiner Familie zu forschen.
Bei meinem letzten Heimaturlaub hatte ich mit meiner Frau verabredet; falls wir uns in den Kriegswirren verlieren
sollten, unsere Kontaktadresse, die meiner Quartiersleute in Burscheid, Kreis Opladen, sein sollte. Ich habe zuerst
nach Rohmanen geschrieben, aber leider keine Antwort erhalten. Dann habe ich nach Burscheid geschrieben, und siehe, -
bei denen lag schon eine Anfrage meiner Frau vor, die nach mir gefragt, und ihre jetzige Anschrift hinterlassen hatte.
Ich habe dem Bauern erzählt dass meine Frau sich zurzeit, auf einem Gut, in Alt Steinhorst, im Kreis Rostock, befindet.
Er war sofort bereit uns ein Zimmer zur Verfügung zu stellen, wenn ich meine Frau nach Krottorf rüberholen wollte. Das
habe ich Ihr mitgeteilt und sie war sofort bereit ihren Wohnsitz nach Krottorf zu verlegen, denn sie wohnte dort in
einem kleinen Stübchen unterm Dach.
Im Herbst, als die Feldarbeit so ziemlich erledigt war, bin ich nach Alt Steinhorst gefahren, um meine Frau und meinen
Sohn Kurt, sowie meinen Sohn Manfred, den ich noch nicht kannte, weil er erst nach der Flucht, am 31. Januar, in Groß
Lüssewitz, geboren wurde, nach Krottorf zu holen. Meine Frau hatte schon Holz für den Winter besorgt und vom Gut, auf
dem sie im Sommer gearbeitet hatte, Mehl und Kartoffeln bekommen. Wir haben das Mehl und andere Habseligkeiten in
Kisten verpackt. Das Holz haben wir einem Bauern gegeben, der uns und unser Gepäck, mit seinem Pferdewagen, zum 14
Kilometer entfernten Bahnhof, nach Ribnitz gebracht hat. Wir sind auch gut in Krottorf angekommen, aber als wir am
nächsten Tag, unsere Kisten vom Bahnhof abholen wollten, haben wir zwar die Kisten vorgefunden, doch der gesamte Inhalt
wurde während der Bahnfahrt entwendet. Die Bahnstation in Krottorf hat die Vorkommnisse zur Kenntnis genommen und
protokolliert, aber unsere Sachen haben wir nie wieder gesehen und mussten wieder bei Null anfangen.
Im Winter musste ich auf der Genossenschaft, unentgeltlich, für die Russen Weizen einsacken. Ich hatte versucht eine
Arbeit als Zimmermann zu bekommen, doch auf dem Arbeitsamt wurde mir gesagt, ich bin Ladwirt und muss auf der
Landwirtschaft arbeiten. Da in den ersten Nachkriegsjahren, auch in der sowjetisch besetzten Zone Arbeitsplätze knapp
waren, mussten auch solche, die einen anderen Beruf erlernt hatten, jede zumutbare Arbeit annehmen. Aus der Heimat
erhielt ich einen Brief, von meiner dort noch lebenden Mutter. Sie schrieb das sie mich noch einmal sehen wollte und
ich sollte doch wieder zurück kommen; Unser Hof wäre nicht von Polen besetzt und sie wäre ganz alleine, weil der Vater
nach dem Durchzug der Front von den Russen erschlagen wurde. Daraufhin habe ich dem polnischen Konsulat in Magdeburg
mitgeteilt, dass ich in Rohmanen eine Landwirtschaft besitze, und um eine Einreisegenehmigung gebeten.
Nach 2 Monaten erhielt ich eine Postkarte, mit der Mitteilung, ich sollte mich persönlich beim Konsulat vorstellen.
Nach Aufnahme meiner Personalien, wurde mir gesagt, das ich benachrichtigt werde wenn mein Antrag genehmigt wird. Ende
Juli 1947 erhielten wir die Einreisegenehmigung nach Ostpreußen, das jetzt unter polnischer Verwaltung stand. Wir
mussten zuerst zum polnischen Konsulat in Berlin-Lichterfelde, wo wir umgeben von einer Trümmerlandschaft, gewartet
haben, bis alle Untersuchungen und Formalitäten erledigt waren.
“ Wieder zurück in Ostpreußen.”
Der schwere Wiederaufbau nach dem Kriege
Dann fuhren wir über Frankfurt/Oder, Posen, Thorn, Allenstein, nach Ortelsburg, wo wir am 2. August 1947 ankamen. Mit
einem zweirädrigen Karren, den ich mir von einem noch in Ortelsburg lebenden Bekanten ausgeliehen hatte und meinem
Sohn Manfred im Kinderwagen fuhren wir nach Rohmanen. Meine Mutter war inzwischen verstorben und auf dem Hof war nur
meine, inzwischen aus Russischer Gefangenschaft wiedergekehrte Schwester, Frieda Pelkowski.

Es war alles ausgeplündert; kein Vieh, keine Maschinen und der ganze Hof mit kniehohem Graß überwachsen. Nur schmale
Trampelpfade, vom Haus zum Holzschuppen und zum Klo, durchkreuzten das satte Grün. Ich habe das Gras auf dem Hof mit
einer Sense, die ich noch gefunden habe, abgemäht, damit der Hof nicht so verwahrlost aussah. Am nächsten Tag habe ich
mich bei der Polizei in Ortelsburg angemeldet, wo ich auch ein Startgeld von 100 Zloty erhielt und Gepäckstücke, die
ich in Krottorf aufgegeben, am Bahnhof abgeholt. Es hat mich sehr gewundert das, das Gepäck überhaupt angekommen ist.
Da man von der Landwirtschaft nicht Leben konnte, habe ich mich in den nächsten Tagen, bei der jetzt polnischen Bahn,
um Arbeit beworben und wurde auch angenommen. Wenn wir unseren Monatslohn bekamen, saß immer einer am Tisch, der von
uns 100 Zloty für den Wiederaufbau von Warschau verlangte. Wenn ich dran war, riefen die Anderen, ich hätte Warschau
zerstört und müsste deshalb 200 Zloty abgeben. Nach 3 Jahren kam eine Verfügung, die besagte, dass wer länger als 1
Jahr bei der Bahn beschäftigt ist, angestellt werden muss. Um diese Bestimmung zu umgehen hat man mich entlassen und
eine Woche später wieder eingestellt.
Als ich vor Ablauf des nächsten Jahres, aus dem gleichen Grunde wieder entlassen wurde, habe ich mich bei der
Stadtverwaltung in Ortelsburg(jetzt Szczytno)beworben, wo ich zuerst im Gaswerk als Heizer und später auf Baustellen
als Zimmermann gearbeitet habe. Wir haben durch den Krieg beschädigte Häuser repariert, in den ehemals touristischen
Zentren einige Ausbesserungen an den Einrichtungen durchgeführt, eine Ziegelei wieder in Betrieb gesetzt und andere
anfallende Arbeiten verrichtet. Im Dach des Rathausturmes war während der Kämpfe eine Granate eingeschlagen, die, die
Dachlatten und die Verschalung zerstört hatte. Da wir, unter schwersten Bedingungen, den Schaden repariert haben,
wurde uns eine Höhenzulage versprochen, die wir aber nicht bekommen haben.
Aus Verärgerung darüber habe ich bei der Stadtverwaltung gekündigt und bei einer Wiederaufbaufirma unter der Leitung
von Bauingenieur Laskowski wieder angefangen, wo ich bis 1954, als Zimmermann beschäftigt war. Ab da habe ich mich
nur um meinen Hof gekümmert, der wegen meiner Arbeitsstellen, gezwungenermaßen, sehr vernachlässigt wurde. Als wir
1947 zurückkamen, brachten wir unseren Sohn Manfred noch im Kinderwagen. Den hat meine Frau zum Markt gebracht,
verkauft, und dafür eine Ziege erworben, die dank guter Pflege, uns täglich mit 4 Liter Milch versorgte. Das war der
erste Baustein zum Wiederaufbau, unserer durch den Krieg zerstörten, und danach ausgeplünderten Landwirtschaft.
Während meiner Arbeit bei der Bahn haben wir uns eine Kuh gekauft, die nach einem halben Jahr, wegen nicht bezahlter
Grundsteuer, vom Gerichtsvollzieher gepfändet wurde. Man hat uns die Kuh weggenommen und bei einem Arbeiter, der in
der Ernst-Mey-Straße in Ortelsburg wohnte und sie wegen nicht vorhandener Futtermittel, nur mit Kartoffelkraut
gefüttert hat, untergestellt. Als ich bei der Bahn meinen Monatslohn bekommen habe, bin ich zur Gmina gegangen, habe
eine Rate angezahlt und durfte dann die Kuh wieder mit nach Hause nehmen. Durch die schlechte Ernährung war die Kuh
stark abgemagert und lieferte nur die Hälfte der ursprünglichen Milchleistung.
Später habe ich ein Pferd auf Abzahlung bekommen, das 140.000 alte Zloty gekostet hat. Die Stute war schwach und unser
Feld sehr hügelig, so dass man nur bergab pflügen konnte, was sehr beschwerlich war, bergauf ging es immer im Leerlauf.
Später habe ich die schweren Böden mit dem Traktor umpflügen, und in den letzten Jahren auch mit dem Binder mähen
lassen. Von der Stute habe ich 2 schöne Fohlen gezogen; ein davon habe ich bei der Ausreise in die Bundesrepublik
mitgebracht und bei der Viehverwertungs-Genossenschaft in Göttingen verkauft. In den ersten Nachkriegsjahren als noch
wenig Land bestellt wurde, breiteten sich auf den nicht beackerten Flächen, Wildkräuter aus. Disteln und andere
Schnellwachsende, erreichten manchmal eine Höhe von 2 Meter, besonders auf den schweren Böden.
Es hat viel Schweiß gekostet ehe man den Acker soweit hatte, das er auch befriedigende Erträge abwarf. Die
Währungsreform von 1950, hat unser weiniges Geld das wir schon gespart hatten, wieder vernichtet. Ich hatte 2 Pferde,
1 Fohlen, 2 Kühe und Schweine, als ich wieder aufgefordert wurde nicht bezahlte Grundsteuern nachzuzahlen. Als ich
nicht bezahlen konnte, hat der Vollziehungsbeamte, ein Fohlen, eine Kuh und ein Schwein gepfändet. Es gelang mir jedoch
nach längeren Verhandlungen, ohne größere Verluste, alles zu regeln. Später kam eine Verfügung, die besagte; wenn
jemand auf seinem Hof nur eine Kuh und ein Pferd hatte, durften sie nicht gepfändet werden. Einige haben ihr Inventar
dieser Verfügung angepasst und dadurch die Zahlung von Grundsteuer umgangen.

Wer seine Steuern pünktlich bezahlt und sein Kontingent an landwirtschaftlichen Produkten fristgerecht abgeliefert hat,
der konnte seine, darüber hinaus erwirtschafteten Produkte zu marktgerechten Preisen verkaufen. Für eine hochtragende
Sterke, mindestens 400 kg schwer, die auf ein staatliches Gut verkauft wurde, konnte man bis zu 12000 Zloty bekommen.
Unsere Böden waren kalkarm, doch durch den Einsatz von Kalk und Kunstdünger konnte man den Ertrag erheblich steigern.
Kalk und Kunstdünger konnte man bei der Genossenschaft(GS) bestellen, der dann auch direkt auf den Hof geliefert wurde.
Kalk wurde geliefert und gleich auf dem Feld ausgestreut. In den 1960ger Jahren waren alle Ackerflächen der Rohmaner
Felder bestellt.
Die nach dem Krieg zurückgebliebenen deutschen Bauernfamilien, aber auch die Polen, die während des Krieges beim Bauern
in Deutschland gearbeitet haben, versuchten mit teils bescheidenen, oder auch zusammen gesuchten, landwirtschaftlichen
Geräten, die bäuerlichen Betriebe aufrecht zu erhalten. Nach den schweren Anfängen in den ersten Nachkriegsjahren
erzielten sie schließlich einen beachtlichen Erfolg, der sich in wogenden Kornfeldern, sowie in grünen Wiesen auf
denen gut genährtes Vieh weidete, widerspiegelte.
In Südfrankreich regnet es den ganzen Sommer nicht; die Bauern haben da keine Scheunen und das Getreide wir nur in
Schobern aufgestellt und dann umgehend gedroschen. Vom Oktober bis Dezember regnete es fasst jeden Tag in Strömen.
Gesät wird nur im Frühjahr und im Herbst, weil im Sommer alles vertrocknet. Es wird viel Wein angebaut und die
Steckrübe wächst den ganzen Winter. Neben den Weinreben wurde aus Schieferplatten ein Zaun aufgestellt, um dem Wein
einen optimalen Standort zu sichern. Die Bauernwagen hatten nur zwei Räder und waren nur mit einem Pferd bespannt, das
die ganze Balance des Wagens zu halten hatte. Trotzdem haben sie soviel aufgeladen wie wir auf einen Leiterwagen. Viele
Kameraden wurden den Bauern zur Arbeit ausgeliehen. Wenn ein Bauer einen Arbeiter gebraucht hat und es wurde gefragt,
wer sich in der Landwirtschaft auskennt, da haben sich alle gemeldet. Der Bauer konnte sich dann aussuchen, wen er
mitnehmen wollte.
Wenn wir durch die Stadt zur Arbeit gingen, haben verschiedene Leute Fallobst in die Abfalleimer gelegt. Wenn das von
den Kameraden bemerkt wurde, schwenkten viele aus der Reihe, um sich etwas mit zunehmen, was von den Wachmannschaften
nicht gern gesehen wurde. Viele Kriegsgefangene hatten keine Schuhe mehr, sie haben die Füße nur mit Lumpen bewickelt.
Eines Tages kamen Kameraden aus Norwegen, die nach Deutschland entlassen werden sollten. Mann hat sie jedoch ins Lager
gesteckt und zur Arbeit eingeteilt. In Norwegen hatten sie Kleider und Stoffe eingekauft, hatten volle Seesäcke und
sogar Karren auf 2 Rädern, weil sie ja in die Heimat entlassen werden sollten. Als wir morgens zur Arbeit rausgeführt
wurden standen sie schon vor dem Lager. Wir haben ihnen zugerufen, dass sie uns etwas abgeben sollen, weil ihnen ja
sowieso alles abgenommen wird, aber sie haben uns nur ausgelacht. Als sie ins Lager Kamen mussten sie ihr Gepäck
ablegen, wurden dann wo anders hingeführt und haben es danach nie wieder gesehen.
Durch die vielen Läuse, Flöhe und Wanzen die wie im Lager hatten, kam es bei verschieden Kameraden, an den
Einstichstellen, zu eiternden Entzündungen. Um dem vorzubeugen hat man uns mit einem Pulver, das in Frankreich
hergestellt wurde, aber bei den Parasiten keine Wirkung zeigte, eingesprüht. Erst bei der Anwendung eines Mittels
amerikanischer Herkunft, war alles über Nacht verschwunden.
Der Sonntag war arbeitsfrei. Dann kam ein katholischer, französischer Pfarrer, eskortiert von 3 Mann, mit
aufgepflanztem Seitengewehr ins Lager und hat Gottesdienst gehalten. Einen evangelischen Pfarrer gab es nicht, nur
einen Baptisten Prediger. Der wurde würdevoll eingekleidet, bekam ein großes Kreuz und hat jeden Sonntag in einer
extra dafür hergerichteten Baracke Gottesdienst gehalten. Wer Theologie studiert hatte und sich meldete, wurde zu
einem Seminar geschickt und konnte sein Studium fortsetzen. Glasbläser durften das Lager auch verlassen und ihrem
erlernten Beruf wieder arbeiten.
Wer sich freiwillig, für 5 Jahre, zum Dienst in der Fremdenlegion verpflichtet hat, das waren etliche unter uns, wurde
neu eingekleidet, bekam gutes Essen und Rauchwaren soviel er wollte. Nach einem Jahr wurden, nach und nach, die
Kranken und Körperbehinderten in die Sowjetische Besatzungszone entlassen. Eine Entlassung von Kriegsgefangenen, die
in den Westzonen oder jenseits von Oder und Neise zu Hause waren, war nicht vorgesehen. Die Österreicher wurden alle,
unabhängig von ihrem Gesundheitszustand entlassen.
Ich habe Briefe nach Hause geschrieben, aber die kamen nur bis Allenstein und wurden wieder zurück geschickt. Als eine
Kommission des Roten Kreuzes aus der Schweiz unser Lager besichtigt hat, haben wir uns beschwert, das wir als
Sanitätsdienstgrade, zur Arbeit gehen müssen. Daraufhin erging ein Befehl: Wer einen vom Roten Kreuz, ausgestellten
Ausweis besitzt, gehört einem internationalen Verband an und braucht nicht zu Arbeit gehen. Aus unserem Lager hatten
sich 20 Mann gemeldet, die daraufhin Freigang, in Begleitung von zwei französischen Wachsoldaten erhielten. Als wir
gefragt wurden wo wir hin wollen, entschlossen wir uns, einen Soldatenfriedhof, auf dem unsere verstorbenen Kameraden
beerdigt waren, zu besuchen.
Da der Untergrund in dieser Gegend aus Felsen bestand, wurden die Gräben, in denen die Toten in selbst gezimmerten
Kisten nebeneinander gestellt wurden, mit Hilfe von Dynamit ausgehoben. Ein Leichenwagen, mit einem Pferd bespannt,
das mit einer schwarzen Decke abgedeckt war, wurde von einem Kutscher in angemessener Kleidung, gefahren. Der Wagen
konnte gleichzeitig 4 Kisten transportieren. Wenn wir von der Arbeit kommend, dem Leichenwagen begegneten, wurde
gehalten und mit einer Schweigeminute der Toten gedacht, bis der Wagen vorbei war. Die Zivilbevölkerung verharrte auch
im Schweigen, mit abgenommener Kopfbedeckung.
Ein Kamerad, der in Krottorf, Kreis Oschersleben, bei Magdeburg, zuhause war, sagte bei seiner Entlassung zu mir:
Sollte ich das Glück haben, meine Entlassungspapiere zu erhalten ohne eine Bleibe vorzuweisen, dann soll ich Krottorf
als Heimatadresse angeben. Auf der Krankenstube habe ich angegeben, dass sich noch ein Schrapnellsplitter, aus dem
Ersten Weltkrieg, in meiner Kreuzbeingegend befindet, er zwar verkapselt ist, aber immer noch Beschwerden verursacht.
Daraufhin wurde ich zur Entlassung vornotiert. Als bekannt wurde das ein Rückkehrertransport in die sowjetische
Besatzungszone zusammengestellt wird, habe ich mich sofort gemeldet und wurde für ein Entlassungslager in Angoleme
vorgesehen. War das eine Freude, als uns mitgeteilt wurde, wann der Rücktransport stattfindet.
In unserem Lager waren noch 2 Kameraden aus dem Kreis Ortelsburg: Ein Gustav Lumma aus Leynau und ein Alfred Moritz
aus Groß Schöndamerau. Sie mussten noch zurückbleiben und haben mir den Auftrag erteil, die Angehörigen in der Heimat
zu grüßen und ihnen die Anschrift mitzuteilen. Als wir im Entlassungslager ankamen, fragte man uns nach unserer
Heimatanschrift. Dann wurden die Entlassungspapiere angefertigt. Es wurde uns auch ein Barscheck, für die in Frankreich
geleistete Arbeit ausgehändigt, den wir bei jeder Kasse in Deutschland einlösen könnten. Ich habe ihn bis zum heutigen
Tage nicht einlösen können, obwohl ich irgendwann in der Zeitung gelesen habe, das Verrechnungschecks die den aus
französischer Kriegsgefangenschaft Entlassenen, ausgehändigt wurden, einzulösen sind.
Wir kamen zuerst nach Saar Elbe, dann in die Nähe der Zonengrenze zu Thüringen. Hier mussten wir 2 Tage warten, weil
aus der sowjetischen Besatzungszone keine Eisenbahnwagen bereitgestellt wurden. Angesichts dessen, das der Russe beim
letzten Transport die aus Frankreich kommenden Wagen kassiert und nicht mehr herausgeben wollte, bestand der Franzose
jetzt darauf, seine Wagen sofort wieder mitzunehmen. Als der sehnsüchtig erwartete Zug endlich eintraf, durften wir
umsteigen und kamen, immer noch hinter Stacheldraht, nach Erfurt. Von dort weiter ins Quarantänelager nach Prätsch an
der Elbe.
Unter Androhung von Strafe war es verboten das Lager zu verlassen, doch der Hunger zwang uns dazu, in den umliegenden
Dörfern um Lebensmittel zu betteln. Man drohte uns damit, dass Zuwiderhandlungen, mit einer 14-tägigen Verlängerung der
Quarantäne geahndet werden. Der Roggen war schon reif und wir haben, auf den umliegenden Feldern, die Ähren abgerissen,
das Korn, zwischen 2 Steinen zu Mehl zerrieben, um daraus eine Suppe zu kochen, denn von dem was unsere Lagerküche uns
bieten konnte, war es nicht möglich zu überleben. Als der Eigentümer bemerkte wer seine Roggenähren entwendet hat, kam
er ins Lager, gerade zu dem Zeitpunkt als wir mit dem Mahlen beschäftigt waren. Der Lagerkommandant, bei dem er sich
beschwerte, drohte uns zu bestrafen, wenn wir unsere „Rauzüge” nicht unmittelbar einstellen würden. Wir sagten ihm er
solle uns heimfahren lassen, da wir doch lange genug hinter Stacheldraht gesessen hätten.
Endlich wieder in Freiheit
14 Tage nach unserer Ankunft wurden uns Entlassungspapiere ausgehändigt, sowie auch Fahrscheine
zum den, von uns angegeben Heimatorten. So kam ich nach Krottof, Kreis Oschersleben, zu meinem ehemaligen
Kriegskameraden, bei dem ich einen Tag geblieben bin. Er hatte mir schon eine Stelle bei einem Bauern besorgt, der 70
Jahre alt und kinderlos war. Zum Hof, den er mit seiner Ehefrau bewirtschaftet hat, gehörten 36 Morgen Land, 2 Ochsen
und 3 Kühe. Das Ackerland bestand aus 17 Parzellen und sicherte mir einen Arbeitsplatz.
Jetzt, da ich ein Dach überm Kopf und genug zu essen hatte, fing ich an nach dem Verbleib meiner Familie zu forschen.
Bei meinem letzten Heimaturlaub hatte ich mit meiner Frau verabredet; falls wir uns in den Kriegswirren verlieren
sollten, unsere Kontaktadresse, die meiner Quartiersleute in Burscheid, Kreis Opladen, sein sollte. Ich habe zuerst
nach Rohmanen geschrieben, aber leider keine Antwort erhalten. Dann habe ich nach Burscheid geschrieben, und siehe, -
bei denen lag schon eine Anfrage meiner Frau vor, die nach mir gefragt, und ihre jetzige Anschrift hinterlassen hatte.
Ich habe dem Bauern erzählt dass meine Frau sich zurzeit, auf einem Gut, in Alt Steinhorst, im Kreis Rostock, befindet.
Er war sofort bereit uns ein Zimmer zur Verfügung zu stellen, wenn ich meine Frau nach Krottorf rüberholen wollte. Das
habe ich Ihr mitgeteilt und sie war sofort bereit ihren Wohnsitz nach Krottorf zu verlegen, denn sie wohnte dort in
einem kleinen Stübchen unterm Dach.
Im Herbst, als die Feldarbeit so ziemlich erledigt war, bin ich nach Alt Steinhorst gefahren, um meine Frau und meinen
Sohn Kurt, sowie meinen Sohn Manfred, den ich noch nicht kannte, weil er erst nach der Flucht, am 31. Januar, in Groß
Lüssewitz, geboren wurde, nach Krottorf zu holen. Meine Frau hatte schon Holz für den Winter besorgt und vom Gut, auf
dem sie im Sommer gearbeitet hatte, Mehl und Kartoffeln bekommen. Wir haben das Mehl und andere Habseligkeiten in
Kisten verpackt. Das Holz haben wir einem Bauern gegeben, der uns und unser Gepäck, mit seinem Pferdewagen, zum 14
Kilometer entfernten Bahnhof, nach Ribnitz gebracht hat. Wir sind auch gut in Krottorf angekommen, aber als wir am
nächsten Tag, unsere Kisten vom Bahnhof abholen wollten, haben wir zwar die Kisten vorgefunden, doch der gesamte Inhalt
wurde während der Bahnfahrt entwendet. Die Bahnstation in Krottorf hat die Vorkommnisse zur Kenntnis genommen und
protokolliert, aber unsere Sachen haben wir nie wieder gesehen und mussten wieder bei Null anfangen.
Im Winter musste ich auf der Genossenschaft, unentgeltlich, für die Russen Weizen einsacken. Ich hatte versucht eine
Arbeit als Zimmermann zu bekommen, doch auf dem Arbeitsamt wurde mir gesagt, ich bin Ladwirt und muss auf der
Landwirtschaft arbeiten. Da in den ersten Nachkriegsjahren, auch in der sowjetisch besetzten Zone Arbeitsplätze knapp
waren, mussten auch solche, die einen anderen Beruf erlernt hatten, jede zumutbare Arbeit annehmen. Aus der Heimat
erhielt ich einen Brief, von meiner dort noch lebenden Mutter. Sie schrieb das sie mich noch einmal sehen wollte und
ich sollte doch wieder zurück kommen; Unser Hof wäre nicht von Polen besetzt und sie wäre ganz alleine, weil der Vater
nach dem Durchzug der Front von den Russen erschlagen wurde. Daraufhin habe ich dem polnischen Konsulat in Magdeburg
mitgeteilt, dass ich in Rohmanen eine Landwirtschaft besitze, und um eine Einreisegenehmigung gebeten.
Nach 2 Monaten erhielt ich eine Postkarte, mit der Mitteilung, ich sollte mich persönlich beim Konsulat vorstellen.
Nach Aufnahme meiner Personalien, wurde mir gesagt, das ich benachrichtigt werde wenn mein Antrag genehmigt wird. Ende
Juli 1947 erhielten wir die Einreisegenehmigung nach Ostpreußen, das jetzt unter polnischer Verwaltung stand. Wir
mussten zuerst zum polnischen Konsulat in Berlin-Lichterfelde, wo wir umgeben von einer Trümmerlandschaft, gewartet
haben, bis alle Untersuchungen und Formalitäten erledigt waren.
“ Wieder zurück in Ostpreußen.”
Der schwere Wiederaufbau nach dem Kriege
Dann fuhren wir über Frankfurt/Oder, Posen, Thorn, Allenstein, nach Ortelsburg, wo wir am 2. August 1947 ankamen. Mit
einem zweirädrigen Karren, den ich mir von einem noch in Ortelsburg lebenden Bekanten ausgeliehen hatte und meinem
Sohn Manfred im Kinderwagen fuhren wir nach Rohmanen. Meine Mutter war inzwischen verstorben und auf dem Hof war nur
meine, inzwischen aus Russischer Gefangenschaft wiedergekehrte Schwester, Frieda Pelkowski.

Es war alles ausgeplündert; kein Vieh, keine Maschinen und der ganze Hof mit kniehohem Graß überwachsen. Nur schmale
Trampelpfade, vom Haus zum Holzschuppen und zum Klo, durchkreuzten das satte Grün. Ich habe das Gras auf dem Hof mit
einer Sense, die ich noch gefunden habe, abgemäht, damit der Hof nicht so verwahrlost aussah. Am nächsten Tag habe ich
mich bei der Polizei in Ortelsburg angemeldet, wo ich auch ein Startgeld von 100 Zloty erhielt und Gepäckstücke, die
ich in Krottorf aufgegeben, am Bahnhof abgeholt. Es hat mich sehr gewundert das, das Gepäck überhaupt angekommen ist.
Da man von der Landwirtschaft nicht Leben konnte, habe ich mich in den nächsten Tagen, bei der jetzt polnischen Bahn,
um Arbeit beworben und wurde auch angenommen. Wenn wir unseren Monatslohn bekamen, saß immer einer am Tisch, der von
uns 100 Zloty für den Wiederaufbau von Warschau verlangte. Wenn ich dran war, riefen die Anderen, ich hätte Warschau
zerstört und müsste deshalb 200 Zloty abgeben. Nach 3 Jahren kam eine Verfügung, die besagte, dass wer länger als 1
Jahr bei der Bahn beschäftigt ist, angestellt werden muss. Um diese Bestimmung zu umgehen hat man mich entlassen und
eine Woche später wieder eingestellt.
Als ich vor Ablauf des nächsten Jahres, aus dem gleichen Grunde wieder entlassen wurde, habe ich mich bei der
Stadtverwaltung in Ortelsburg(jetzt Szczytno)beworben, wo ich zuerst im Gaswerk als Heizer und später auf Baustellen
als Zimmermann gearbeitet habe. Wir haben durch den Krieg beschädigte Häuser repariert, in den ehemals touristischen
Zentren einige Ausbesserungen an den Einrichtungen durchgeführt, eine Ziegelei wieder in Betrieb gesetzt und andere
anfallende Arbeiten verrichtet. Im Dach des Rathausturmes war während der Kämpfe eine Granate eingeschlagen, die, die
Dachlatten und die Verschalung zerstört hatte. Da wir, unter schwersten Bedingungen, den Schaden repariert haben,
wurde uns eine Höhenzulage versprochen, die wir aber nicht bekommen haben.
Aus Verärgerung darüber habe ich bei der Stadtverwaltung gekündigt und bei einer Wiederaufbaufirma unter der Leitung
von Bauingenieur Laskowski wieder angefangen, wo ich bis 1954, als Zimmermann beschäftigt war. Ab da habe ich mich
nur um meinen Hof gekümmert, der wegen meiner Arbeitsstellen, gezwungenermaßen, sehr vernachlässigt wurde. Als wir
1947 zurückkamen, brachten wir unseren Sohn Manfred noch im Kinderwagen. Den hat meine Frau zum Markt gebracht,
verkauft, und dafür eine Ziege erworben, die dank guter Pflege, uns täglich mit 4 Liter Milch versorgte. Das war der
erste Baustein zum Wiederaufbau, unserer durch den Krieg zerstörten, und danach ausgeplünderten Landwirtschaft.
Während meiner Arbeit bei der Bahn haben wir uns eine Kuh gekauft, die nach einem halben Jahr, wegen nicht bezahlter
Grundsteuer, vom Gerichtsvollzieher gepfändet wurde. Man hat uns die Kuh weggenommen und bei einem Arbeiter, der in
der Ernst-Mey-Straße in Ortelsburg wohnte und sie wegen nicht vorhandener Futtermittel, nur mit Kartoffelkraut
gefüttert hat, untergestellt. Als ich bei der Bahn meinen Monatslohn bekommen habe, bin ich zur Gmina gegangen, habe
eine Rate angezahlt und durfte dann die Kuh wieder mit nach Hause nehmen. Durch die schlechte Ernährung war die Kuh
stark abgemagert und lieferte nur die Hälfte der ursprünglichen Milchleistung.
Später habe ich ein Pferd auf Abzahlung bekommen, das 140.000 alte Zloty gekostet hat. Die Stute war schwach und unser
Feld sehr hügelig, so dass man nur bergab pflügen konnte, was sehr beschwerlich war, bergauf ging es immer im Leerlauf.
Später habe ich die schweren Böden mit dem Traktor umpflügen, und in den letzten Jahren auch mit dem Binder mähen
lassen. Von der Stute habe ich 2 schöne Fohlen gezogen; ein davon habe ich bei der Ausreise in die Bundesrepublik
mitgebracht und bei der Viehverwertungs-Genossenschaft in Göttingen verkauft. In den ersten Nachkriegsjahren als noch
wenig Land bestellt wurde, breiteten sich auf den nicht beackerten Flächen, Wildkräuter aus. Disteln und andere
Schnellwachsende, erreichten manchmal eine Höhe von 2 Meter, besonders auf den schweren Böden.
Es hat viel Schweiß gekostet ehe man den Acker soweit hatte, das er auch befriedigende Erträge abwarf. Die
Währungsreform von 1950, hat unser weiniges Geld das wir schon gespart hatten, wieder vernichtet. Ich hatte 2 Pferde,
1 Fohlen, 2 Kühe und Schweine, als ich wieder aufgefordert wurde nicht bezahlte Grundsteuern nachzuzahlen. Als ich
nicht bezahlen konnte, hat der Vollziehungsbeamte, ein Fohlen, eine Kuh und ein Schwein gepfändet. Es gelang mir jedoch
nach längeren Verhandlungen, ohne größere Verluste, alles zu regeln. Später kam eine Verfügung, die besagte; wenn
jemand auf seinem Hof nur eine Kuh und ein Pferd hatte, durften sie nicht gepfändet werden. Einige haben ihr Inventar
dieser Verfügung angepasst und dadurch die Zahlung von Grundsteuer umgangen.

Wer seine Steuern pünktlich bezahlt und sein Kontingent an landwirtschaftlichen Produkten fristgerecht abgeliefert hat,
der konnte seine, darüber hinaus erwirtschafteten Produkte zu marktgerechten Preisen verkaufen. Für eine hochtragende
Sterke, mindestens 400 kg schwer, die auf ein staatliches Gut verkauft wurde, konnte man bis zu 12000 Zloty bekommen.
Unsere Böden waren kalkarm, doch durch den Einsatz von Kalk und Kunstdünger konnte man den Ertrag erheblich steigern.
Kalk und Kunstdünger konnte man bei der Genossenschaft(GS) bestellen, der dann auch direkt auf den Hof geliefert wurde.
Kalk wurde geliefert und gleich auf dem Feld ausgestreut. In den 1960ger Jahren waren alle Ackerflächen der Rohmaner
Felder bestellt.
Die nach dem Krieg zurückgebliebenen deutschen Bauernfamilien, aber auch die Polen, die während des Krieges beim Bauern
in Deutschland gearbeitet haben, versuchten mit teils bescheidenen, oder auch zusammen gesuchten, landwirtschaftlichen
Geräten, die bäuerlichen Betriebe aufrecht zu erhalten. Nach den schweren Anfängen in den ersten Nachkriegsjahren
erzielten sie schließlich einen beachtlichen Erfolg, der sich in wogenden Kornfeldern, sowie in grünen Wiesen auf
denen gut genährtes Vieh weidete, widerspiegelte.
Eines Tages kamen Kameraden aus Norwegen, die nach Deutschland entlassen werden sollten. Mann hat sie jedoch ins Lager
gesteckt und zur Arbeit eingeteilt. In Norwegen hatten sie Kleider und Stoffe eingekauft, hatten volle Seesäcke und
sogar Karren auf 2 Rädern, weil sie ja in die Heimat entlassen werden sollten. Als wir morgens zur Arbeit rausgeführt
wurden standen sie schon vor dem Lager. Wir haben ihnen zugerufen, dass sie uns etwas abgeben sollen, weil ihnen ja
sowieso alles abgenommen wird, aber sie haben uns nur ausgelacht. Als sie ins Lager Kamen mussten sie ihr Gepäck
ablegen, wurden dann wo anders hingeführt und haben es danach nie wieder gesehen.
Durch die vielen Läuse, Flöhe und Wanzen die wie im Lager hatten, kam es bei verschieden Kameraden, an den
Einstichstellen, zu eiternden Entzündungen. Um dem vorzubeugen hat man uns mit einem Pulver, das in Frankreich
hergestellt wurde, aber bei den Parasiten keine Wirkung zeigte, eingesprüht. Erst bei der Anwendung eines Mittels
amerikanischer Herkunft, war alles über Nacht verschwunden.
Der Sonntag war arbeitsfrei. Dann kam ein katholischer, französischer Pfarrer, eskortiert von 3 Mann, mit
aufgepflanztem Seitengewehr ins Lager und hat Gottesdienst gehalten. Einen evangelischen Pfarrer gab es nicht, nur
einen Baptisten Prediger. Der wurde würdevoll eingekleidet, bekam ein großes Kreuz und hat jeden Sonntag in einer
extra dafür hergerichteten Baracke Gottesdienst gehalten. Wer Theologie studiert hatte und sich meldete, wurde zu
einem Seminar geschickt und konnte sein Studium fortsetzen. Glasbläser durften das Lager auch verlassen und ihrem
erlernten Beruf wieder arbeiten.
Wer sich freiwillig, für 5 Jahre, zum Dienst in der Fremdenlegion verpflichtet hat, das waren etliche unter uns, wurde
neu eingekleidet, bekam gutes Essen und Rauchwaren soviel er wollte. Nach einem Jahr wurden, nach und nach, die
Kranken und Körperbehinderten in die Sowjetische Besatzungszone entlassen. Eine Entlassung von Kriegsgefangenen, die
in den Westzonen oder jenseits von Oder und Neise zu Hause waren, war nicht vorgesehen. Die Österreicher wurden alle,
unabhängig von ihrem Gesundheitszustand entlassen.
Ich habe Briefe nach Hause geschrieben, aber die kamen nur bis Allenstein und wurden wieder zurück geschickt. Als eine
Kommission des Roten Kreuzes aus der Schweiz unser Lager besichtigt hat, haben wir uns beschwert, das wir als
Sanitätsdienstgrade, zur Arbeit gehen müssen. Daraufhin erging ein Befehl: Wer einen vom Roten Kreuz, ausgestellten
Ausweis besitzt, gehört einem internationalen Verband an und braucht nicht zu Arbeit gehen. Aus unserem Lager hatten
sich 20 Mann gemeldet, die daraufhin Freigang, in Begleitung von zwei französischen Wachsoldaten erhielten. Als wir
gefragt wurden wo wir hin wollen, entschlossen wir uns, einen Soldatenfriedhof, auf dem unsere verstorbenen Kameraden
beerdigt waren, zu besuchen.
Da der Untergrund in dieser Gegend aus Felsen bestand, wurden die Gräben, in denen die Toten in selbst gezimmerten
Kisten nebeneinander gestellt wurden, mit Hilfe von Dynamit ausgehoben. Ein Leichenwagen, mit einem Pferd bespannt,
das mit einer schwarzen Decke abgedeckt war, wurde von einem Kutscher in angemessener Kleidung, gefahren. Der Wagen
konnte gleichzeitig 4 Kisten transportieren. Wenn wir von der Arbeit kommend, dem Leichenwagen begegneten, wurde
gehalten und mit einer Schweigeminute der Toten gedacht, bis der Wagen vorbei war. Die Zivilbevölkerung verharrte auch
im Schweigen, mit abgenommener Kopfbedeckung.
Ein Kamerad, der in Krottorf, Kreis Oschersleben, bei Magdeburg, zuhause war, sagte bei seiner Entlassung zu mir:
Sollte ich das Glück haben, meine Entlassungspapiere zu erhalten ohne eine Bleibe vorzuweisen, dann soll ich Krottorf
als Heimatadresse angeben. Auf der Krankenstube habe ich angegeben, dass sich noch ein Schrapnellsplitter, aus dem
Ersten Weltkrieg, in meiner Kreuzbeingegend befindet, er zwar verkapselt ist, aber immer noch Beschwerden verursacht.
Daraufhin wurde ich zur Entlassung vornotiert. Als bekannt wurde das ein Rückkehrertransport in die sowjetische
Besatzungszone zusammengestellt wird, habe ich mich sofort gemeldet und wurde für ein Entlassungslager in Angoleme
vorgesehen. War das eine Freude, als uns mitgeteilt wurde, wann der Rücktransport stattfindet.
In unserem Lager waren noch 2 Kameraden aus dem Kreis Ortelsburg: Ein Gustav Lumma aus Leynau und ein Alfred Moritz
aus Groß Schöndamerau. Sie mussten noch zurückbleiben und haben mir den Auftrag erteil, die Angehörigen in der Heimat
zu grüßen und ihnen die Anschrift mitzuteilen. Als wir im Entlassungslager ankamen, fragte man uns nach unserer
Heimatanschrift. Dann wurden die Entlassungspapiere angefertigt. Es wurde uns auch ein Barscheck, für die in Frankreich
geleistete Arbeit ausgehändigt, den wir bei jeder Kasse in Deutschland einlösen könnten. Ich habe ihn bis zum heutigen
Tage nicht einlösen können, obwohl ich irgendwann in der Zeitung gelesen habe, das Verrechnungschecks die den aus
französischer Kriegsgefangenschaft Entlassenen, ausgehändigt wurden, einzulösen sind.
Wir kamen zuerst nach Saar Elbe, dann in die Nähe der Zonengrenze zu Thüringen. Hier mussten wir 2 Tage warten, weil
aus der sowjetischen Besatzungszone keine Eisenbahnwagen bereitgestellt wurden. Angesichts dessen, das der Russe beim
letzten Transport die aus Frankreich kommenden Wagen kassiert und nicht mehr herausgeben wollte, bestand der Franzose
jetzt darauf, seine Wagen sofort wieder mitzunehmen. Als der sehnsüchtig erwartete Zug endlich eintraf, durften wir
umsteigen und kamen, immer noch hinter Stacheldraht, nach Erfurt. Von dort weiter ins Quarantänelager nach Prätsch an
der Elbe.
Unter Androhung von Strafe war es verboten das Lager zu verlassen, doch der Hunger zwang uns dazu, in den umliegenden
Dörfern um Lebensmittel zu betteln. Man drohte uns damit, dass Zuwiderhandlungen, mit einer 14-tägigen Verlängerung der
Quarantäne geahndet werden. Der Roggen war schon reif und wir haben, auf den umliegenden Feldern, die Ähren abgerissen,
das Korn, zwischen 2 Steinen zu Mehl zerrieben, um daraus eine Suppe zu kochen, denn von dem was unsere Lagerküche uns
bieten konnte, war es nicht möglich zu überleben. Als der Eigentümer bemerkte wer seine Roggenähren entwendet hat, kam
er ins Lager, gerade zu dem Zeitpunkt als wir mit dem Mahlen beschäftigt waren. Der Lagerkommandant, bei dem er sich
beschwerte, drohte uns zu bestrafen, wenn wir unsere „Rauzüge” nicht unmittelbar einstellen würden. Wir sagten ihm er
solle uns heimfahren lassen, da wir doch lange genug hinter Stacheldraht gesessen hätten.
Endlich wieder in Freiheit
14 Tage nach unserer Ankunft wurden uns Entlassungspapiere ausgehändigt, sowie auch Fahrscheine
zum den, von uns angegeben Heimatorten. So kam ich nach Krottof, Kreis Oschersleben, zu meinem ehemaligen
Kriegskameraden, bei dem ich einen Tag geblieben bin. Er hatte mir schon eine Stelle bei einem Bauern besorgt, der 70
Jahre alt und kinderlos war. Zum Hof, den er mit seiner Ehefrau bewirtschaftet hat, gehörten 36 Morgen Land, 2 Ochsen
und 3 Kühe. Das Ackerland bestand aus 17 Parzellen und sicherte mir einen Arbeitsplatz.
Jetzt, da ich ein Dach überm Kopf und genug zu essen hatte, fing ich an nach dem Verbleib meiner Familie zu forschen.
Bei meinem letzten Heimaturlaub hatte ich mit meiner Frau verabredet; falls wir uns in den Kriegswirren verlieren
sollten, unsere Kontaktadresse, die meiner Quartiersleute in Burscheid, Kreis Opladen, sein sollte. Ich habe zuerst
nach Rohmanen geschrieben, aber leider keine Antwort erhalten. Dann habe ich nach Burscheid geschrieben, und siehe, -
bei denen lag schon eine Anfrage meiner Frau vor, die nach mir gefragt, und ihre jetzige Anschrift hinterlassen hatte.
Ich habe dem Bauern erzählt dass meine Frau sich zurzeit, auf einem Gut, in Alt Steinhorst, im Kreis Rostock, befindet.
Er war sofort bereit uns ein Zimmer zur Verfügung zu stellen, wenn ich meine Frau nach Krottorf rüberholen wollte. Das
habe ich Ihr mitgeteilt und sie war sofort bereit ihren Wohnsitz nach Krottorf zu verlegen, denn sie wohnte dort in
einem kleinen Stübchen unterm Dach.
Im Herbst, als die Feldarbeit so ziemlich erledigt war, bin ich nach Alt Steinhorst gefahren, um meine Frau und meinen
Sohn Kurt, sowie meinen Sohn Manfred, den ich noch nicht kannte, weil er erst nach der Flucht, am 31. Januar, in Groß
Lüssewitz, geboren wurde, nach Krottorf zu holen. Meine Frau hatte schon Holz für den Winter besorgt und vom Gut, auf
dem sie im Sommer gearbeitet hatte, Mehl und Kartoffeln bekommen. Wir haben das Mehl und andere Habseligkeiten in
Kisten verpackt. Das Holz haben wir einem Bauern gegeben, der uns und unser Gepäck, mit seinem Pferdewagen, zum 14
Kilometer entfernten Bahnhof, nach Ribnitz gebracht hat. Wir sind auch gut in Krottorf angekommen, aber als wir am
nächsten Tag, unsere Kisten vom Bahnhof abholen wollten, haben wir zwar die Kisten vorgefunden, doch der gesamte Inhalt
wurde während der Bahnfahrt entwendet. Die Bahnstation in Krottorf hat die Vorkommnisse zur Kenntnis genommen und
protokolliert, aber unsere Sachen haben wir nie wieder gesehen und mussten wieder bei Null anfangen.
Im Winter musste ich auf der Genossenschaft, unentgeltlich, für die Russen Weizen einsacken. Ich hatte versucht eine
Arbeit als Zimmermann zu bekommen, doch auf dem Arbeitsamt wurde mir gesagt, ich bin Ladwirt und muss auf der
Landwirtschaft arbeiten. Da in den ersten Nachkriegsjahren, auch in der sowjetisch besetzten Zone Arbeitsplätze knapp
waren, mussten auch solche, die einen anderen Beruf erlernt hatten, jede zumutbare Arbeit annehmen. Aus der Heimat
erhielt ich einen Brief, von meiner dort noch lebenden Mutter. Sie schrieb das sie mich noch einmal sehen wollte und
ich sollte doch wieder zurück kommen; Unser Hof wäre nicht von Polen besetzt und sie wäre ganz alleine, weil der Vater
nach dem Durchzug der Front von den Russen erschlagen wurde. Daraufhin habe ich dem polnischen Konsulat in Magdeburg
mitgeteilt, dass ich in Rohmanen eine Landwirtschaft besitze, und um eine Einreisegenehmigung gebeten.
Nach 2 Monaten erhielt ich eine Postkarte, mit der Mitteilung, ich sollte mich persönlich beim Konsulat vorstellen.
Nach Aufnahme meiner Personalien, wurde mir gesagt, das ich benachrichtigt werde wenn mein Antrag genehmigt wird. Ende
Juli 1947 erhielten wir die Einreisegenehmigung nach Ostpreußen, das jetzt unter polnischer Verwaltung stand. Wir
mussten zuerst zum polnischen Konsulat in Berlin-Lichterfelde, wo wir umgeben von einer Trümmerlandschaft, gewartet
haben, bis alle Untersuchungen und Formalitäten erledigt waren.
“ Wieder zurück in Ostpreußen.”
Der schwere Wiederaufbau nach dem Kriege
Dann fuhren wir über Frankfurt/Oder, Posen, Thorn, Allenstein, nach Ortelsburg, wo wir am 2. August 1947 ankamen. Mit
einem zweirädrigen Karren, den ich mir von einem noch in Ortelsburg lebenden Bekanten ausgeliehen hatte und meinem
Sohn Manfred im Kinderwagen fuhren wir nach Rohmanen. Meine Mutter war inzwischen verstorben und auf dem Hof war nur
meine, inzwischen aus Russischer Gefangenschaft wiedergekehrte Schwester, Frieda Pelkowski.

Es war alles ausgeplündert; kein Vieh, keine Maschinen und der ganze Hof mit kniehohem Graß überwachsen. Nur schmale
Trampelpfade, vom Haus zum Holzschuppen und zum Klo, durchkreuzten das satte Grün. Ich habe das Gras auf dem Hof mit
einer Sense, die ich noch gefunden habe, abgemäht, damit der Hof nicht so verwahrlost aussah. Am nächsten Tag habe ich
mich bei der Polizei in Ortelsburg angemeldet, wo ich auch ein Startgeld von 100 Zloty erhielt und Gepäckstücke, die
ich in Krottorf aufgegeben, am Bahnhof abgeholt. Es hat mich sehr gewundert das, das Gepäck überhaupt angekommen ist.
Da man von der Landwirtschaft nicht Leben konnte, habe ich mich in den nächsten Tagen, bei der jetzt polnischen Bahn,
um Arbeit beworben und wurde auch angenommen. Wenn wir unseren Monatslohn bekamen, saß immer einer am Tisch, der von
uns 100 Zloty für den Wiederaufbau von Warschau verlangte. Wenn ich dran war, riefen die Anderen, ich hätte Warschau
zerstört und müsste deshalb 200 Zloty abgeben. Nach 3 Jahren kam eine Verfügung, die besagte, dass wer länger als 1
Jahr bei der Bahn beschäftigt ist, angestellt werden muss. Um diese Bestimmung zu umgehen hat man mich entlassen und
eine Woche später wieder eingestellt.
Als ich vor Ablauf des nächsten Jahres, aus dem gleichen Grunde wieder entlassen wurde, habe ich mich bei der
Stadtverwaltung in Ortelsburg(jetzt Szczytno)beworben, wo ich zuerst im Gaswerk als Heizer und später auf Baustellen
als Zimmermann gearbeitet habe. Wir haben durch den Krieg beschädigte Häuser repariert, in den ehemals touristischen
Zentren einige Ausbesserungen an den Einrichtungen durchgeführt, eine Ziegelei wieder in Betrieb gesetzt und andere
anfallende Arbeiten verrichtet. Im Dach des Rathausturmes war während der Kämpfe eine Granate eingeschlagen, die, die
Dachlatten und die Verschalung zerstört hatte. Da wir, unter schwersten Bedingungen, den Schaden repariert haben,
wurde uns eine Höhenzulage versprochen, die wir aber nicht bekommen haben.
Aus Verärgerung darüber habe ich bei der Stadtverwaltung gekündigt und bei einer Wiederaufbaufirma unter der Leitung
von Bauingenieur Laskowski wieder angefangen, wo ich bis 1954, als Zimmermann beschäftigt war. Ab da habe ich mich
nur um meinen Hof gekümmert, der wegen meiner Arbeitsstellen, gezwungenermaßen, sehr vernachlässigt wurde. Als wir
1947 zurückkamen, brachten wir unseren Sohn Manfred noch im Kinderwagen. Den hat meine Frau zum Markt gebracht,
verkauft, und dafür eine Ziege erworben, die dank guter Pflege, uns täglich mit 4 Liter Milch versorgte. Das war der
erste Baustein zum Wiederaufbau, unserer durch den Krieg zerstörten, und danach ausgeplünderten Landwirtschaft.
Während meiner Arbeit bei der Bahn haben wir uns eine Kuh gekauft, die nach einem halben Jahr, wegen nicht bezahlter
Grundsteuer, vom Gerichtsvollzieher gepfändet wurde. Man hat uns die Kuh weggenommen und bei einem Arbeiter, der in
der Ernst-Mey-Straße in Ortelsburg wohnte und sie wegen nicht vorhandener Futtermittel, nur mit Kartoffelkraut
gefüttert hat, untergestellt. Als ich bei der Bahn meinen Monatslohn bekommen habe, bin ich zur Gmina gegangen, habe
eine Rate angezahlt und durfte dann die Kuh wieder mit nach Hause nehmen. Durch die schlechte Ernährung war die Kuh
stark abgemagert und lieferte nur die Hälfte der ursprünglichen Milchleistung.
Später habe ich ein Pferd auf Abzahlung bekommen, das 140.000 alte Zloty gekostet hat. Die Stute war schwach und unser
Feld sehr hügelig, so dass man nur bergab pflügen konnte, was sehr beschwerlich war, bergauf ging es immer im Leerlauf.
Später habe ich die schweren Böden mit dem Traktor umpflügen, und in den letzten Jahren auch mit dem Binder mähen
lassen. Von der Stute habe ich 2 schöne Fohlen gezogen; ein davon habe ich bei der Ausreise in die Bundesrepublik
mitgebracht und bei der Viehverwertungs-Genossenschaft in Göttingen verkauft. In den ersten Nachkriegsjahren als noch
wenig Land bestellt wurde, breiteten sich auf den nicht beackerten Flächen, Wildkräuter aus. Disteln und andere
Schnellwachsende, erreichten manchmal eine Höhe von 2 Meter, besonders auf den schweren Böden.
Es hat viel Schweiß gekostet ehe man den Acker soweit hatte, das er auch befriedigende Erträge abwarf. Die
Währungsreform von 1950, hat unser weiniges Geld das wir schon gespart hatten, wieder vernichtet. Ich hatte 2 Pferde,
1 Fohlen, 2 Kühe und Schweine, als ich wieder aufgefordert wurde nicht bezahlte Grundsteuern nachzuzahlen. Als ich
nicht bezahlen konnte, hat der Vollziehungsbeamte, ein Fohlen, eine Kuh und ein Schwein gepfändet. Es gelang mir jedoch
nach längeren Verhandlungen, ohne größere Verluste, alles zu regeln. Später kam eine Verfügung, die besagte; wenn
jemand auf seinem Hof nur eine Kuh und ein Pferd hatte, durften sie nicht gepfändet werden. Einige haben ihr Inventar
dieser Verfügung angepasst und dadurch die Zahlung von Grundsteuer umgangen.

Wer seine Steuern pünktlich bezahlt und sein Kontingent an landwirtschaftlichen Produkten fristgerecht abgeliefert hat,
der konnte seine, darüber hinaus erwirtschafteten Produkte zu marktgerechten Preisen verkaufen. Für eine hochtragende
Sterke, mindestens 400 kg schwer, die auf ein staatliches Gut verkauft wurde, konnte man bis zu 12000 Zloty bekommen.
Unsere Böden waren kalkarm, doch durch den Einsatz von Kalk und Kunstdünger konnte man den Ertrag erheblich steigern.
Kalk und Kunstdünger konnte man bei der Genossenschaft(GS) bestellen, der dann auch direkt auf den Hof geliefert wurde.
Kalk wurde geliefert und gleich auf dem Feld ausgestreut. In den 1960ger Jahren waren alle Ackerflächen der Rohmaner
Felder bestellt.
Die nach dem Krieg zurückgebliebenen deutschen Bauernfamilien, aber auch die Polen, die während des Krieges beim Bauern
in Deutschland gearbeitet haben, versuchten mit teils bescheidenen, oder auch zusammen gesuchten, landwirtschaftlichen
Geräten, die bäuerlichen Betriebe aufrecht zu erhalten. Nach den schweren Anfängen in den ersten Nachkriegsjahren
erzielten sie schließlich einen beachtlichen Erfolg, der sich in wogenden Kornfeldern, sowie in grünen Wiesen auf
denen gut genährtes Vieh weidete, widerspiegelte.
Der Sonntag war arbeitsfrei. Dann kam ein katholischer, französischer Pfarrer, eskortiert von 3 Mann, mit
aufgepflanztem Seitengewehr ins Lager und hat Gottesdienst gehalten. Einen evangelischen Pfarrer gab es nicht, nur
einen Baptisten Prediger. Der wurde würdevoll eingekleidet, bekam ein großes Kreuz und hat jeden Sonntag in einer
extra dafür hergerichteten Baracke Gottesdienst gehalten. Wer Theologie studiert hatte und sich meldete, wurde zu
einem Seminar geschickt und konnte sein Studium fortsetzen. Glasbläser durften das Lager auch verlassen und ihrem
erlernten Beruf wieder arbeiten.
Wer sich freiwillig, für 5 Jahre, zum Dienst in der Fremdenlegion verpflichtet hat, das waren etliche unter uns, wurde
neu eingekleidet, bekam gutes Essen und Rauchwaren soviel er wollte. Nach einem Jahr wurden, nach und nach, die
Kranken und Körperbehinderten in die Sowjetische Besatzungszone entlassen. Eine Entlassung von Kriegsgefangenen, die
in den Westzonen oder jenseits von Oder und Neise zu Hause waren, war nicht vorgesehen. Die Österreicher wurden alle,
unabhängig von ihrem Gesundheitszustand entlassen.
Ich habe Briefe nach Hause geschrieben, aber die kamen nur bis Allenstein und wurden wieder zurück geschickt. Als eine
Kommission des Roten Kreuzes aus der Schweiz unser Lager besichtigt hat, haben wir uns beschwert, das wir als
Sanitätsdienstgrade, zur Arbeit gehen müssen. Daraufhin erging ein Befehl: Wer einen vom Roten Kreuz, ausgestellten
Ausweis besitzt, gehört einem internationalen Verband an und braucht nicht zu Arbeit gehen. Aus unserem Lager hatten
sich 20 Mann gemeldet, die daraufhin Freigang, in Begleitung von zwei französischen Wachsoldaten erhielten. Als wir
gefragt wurden wo wir hin wollen, entschlossen wir uns, einen Soldatenfriedhof, auf dem unsere verstorbenen Kameraden
beerdigt waren, zu besuchen.
Da der Untergrund in dieser Gegend aus Felsen bestand, wurden die Gräben, in denen die Toten in selbst gezimmerten
Kisten nebeneinander gestellt wurden, mit Hilfe von Dynamit ausgehoben. Ein Leichenwagen, mit einem Pferd bespannt,
das mit einer schwarzen Decke abgedeckt war, wurde von einem Kutscher in angemessener Kleidung, gefahren. Der Wagen
konnte gleichzeitig 4 Kisten transportieren. Wenn wir von der Arbeit kommend, dem Leichenwagen begegneten, wurde
gehalten und mit einer Schweigeminute der Toten gedacht, bis der Wagen vorbei war. Die Zivilbevölkerung verharrte auch
im Schweigen, mit abgenommener Kopfbedeckung.
Ein Kamerad, der in Krottorf, Kreis Oschersleben, bei Magdeburg, zuhause war, sagte bei seiner Entlassung zu mir:
Sollte ich das Glück haben, meine Entlassungspapiere zu erhalten ohne eine Bleibe vorzuweisen, dann soll ich Krottorf
als Heimatadresse angeben. Auf der Krankenstube habe ich angegeben, dass sich noch ein Schrapnellsplitter, aus dem
Ersten Weltkrieg, in meiner Kreuzbeingegend befindet, er zwar verkapselt ist, aber immer noch Beschwerden verursacht.
Daraufhin wurde ich zur Entlassung vornotiert. Als bekannt wurde das ein Rückkehrertransport in die sowjetische
Besatzungszone zusammengestellt wird, habe ich mich sofort gemeldet und wurde für ein Entlassungslager in Angoleme
vorgesehen. War das eine Freude, als uns mitgeteilt wurde, wann der Rücktransport stattfindet.
In unserem Lager waren noch 2 Kameraden aus dem Kreis Ortelsburg: Ein Gustav Lumma aus Leynau und ein Alfred Moritz
aus Groß Schöndamerau. Sie mussten noch zurückbleiben und haben mir den Auftrag erteil, die Angehörigen in der Heimat
zu grüßen und ihnen die Anschrift mitzuteilen. Als wir im Entlassungslager ankamen, fragte man uns nach unserer
Heimatanschrift. Dann wurden die Entlassungspapiere angefertigt. Es wurde uns auch ein Barscheck, für die in Frankreich
geleistete Arbeit ausgehändigt, den wir bei jeder Kasse in Deutschland einlösen könnten. Ich habe ihn bis zum heutigen
Tage nicht einlösen können, obwohl ich irgendwann in der Zeitung gelesen habe, das Verrechnungschecks die den aus
französischer Kriegsgefangenschaft Entlassenen, ausgehändigt wurden, einzulösen sind.
Wir kamen zuerst nach Saar Elbe, dann in die Nähe der Zonengrenze zu Thüringen. Hier mussten wir 2 Tage warten, weil
aus der sowjetischen Besatzungszone keine Eisenbahnwagen bereitgestellt wurden. Angesichts dessen, das der Russe beim
letzten Transport die aus Frankreich kommenden Wagen kassiert und nicht mehr herausgeben wollte, bestand der Franzose
jetzt darauf, seine Wagen sofort wieder mitzunehmen. Als der sehnsüchtig erwartete Zug endlich eintraf, durften wir
umsteigen und kamen, immer noch hinter Stacheldraht, nach Erfurt. Von dort weiter ins Quarantänelager nach Prätsch an
der Elbe.
Unter Androhung von Strafe war es verboten das Lager zu verlassen, doch der Hunger zwang uns dazu, in den umliegenden
Dörfern um Lebensmittel zu betteln. Man drohte uns damit, dass Zuwiderhandlungen, mit einer 14-tägigen Verlängerung der
Quarantäne geahndet werden. Der Roggen war schon reif und wir haben, auf den umliegenden Feldern, die Ähren abgerissen,
das Korn, zwischen 2 Steinen zu Mehl zerrieben, um daraus eine Suppe zu kochen, denn von dem was unsere Lagerküche uns
bieten konnte, war es nicht möglich zu überleben. Als der Eigentümer bemerkte wer seine Roggenähren entwendet hat, kam
er ins Lager, gerade zu dem Zeitpunkt als wir mit dem Mahlen beschäftigt waren. Der Lagerkommandant, bei dem er sich
beschwerte, drohte uns zu bestrafen, wenn wir unsere „Rauzüge” nicht unmittelbar einstellen würden. Wir sagten ihm er
solle uns heimfahren lassen, da wir doch lange genug hinter Stacheldraht gesessen hätten.
Endlich wieder in Freiheit
14 Tage nach unserer Ankunft wurden uns Entlassungspapiere ausgehändigt, sowie auch Fahrscheine
zum den, von uns angegeben Heimatorten. So kam ich nach Krottof, Kreis Oschersleben, zu meinem ehemaligen
Kriegskameraden, bei dem ich einen Tag geblieben bin. Er hatte mir schon eine Stelle bei einem Bauern besorgt, der 70
Jahre alt und kinderlos war. Zum Hof, den er mit seiner Ehefrau bewirtschaftet hat, gehörten 36 Morgen Land, 2 Ochsen
und 3 Kühe. Das Ackerland bestand aus 17 Parzellen und sicherte mir einen Arbeitsplatz.
Jetzt, da ich ein Dach überm Kopf und genug zu essen hatte, fing ich an nach dem Verbleib meiner Familie zu forschen.
Bei meinem letzten Heimaturlaub hatte ich mit meiner Frau verabredet; falls wir uns in den Kriegswirren verlieren
sollten, unsere Kontaktadresse, die meiner Quartiersleute in Burscheid, Kreis Opladen, sein sollte. Ich habe zuerst
nach Rohmanen geschrieben, aber leider keine Antwort erhalten. Dann habe ich nach Burscheid geschrieben, und siehe, -
bei denen lag schon eine Anfrage meiner Frau vor, die nach mir gefragt, und ihre jetzige Anschrift hinterlassen hatte.
Ich habe dem Bauern erzählt dass meine Frau sich zurzeit, auf einem Gut, in Alt Steinhorst, im Kreis Rostock, befindet.
Er war sofort bereit uns ein Zimmer zur Verfügung zu stellen, wenn ich meine Frau nach Krottorf rüberholen wollte. Das
habe ich Ihr mitgeteilt und sie war sofort bereit ihren Wohnsitz nach Krottorf zu verlegen, denn sie wohnte dort in
einem kleinen Stübchen unterm Dach.
Im Herbst, als die Feldarbeit so ziemlich erledigt war, bin ich nach Alt Steinhorst gefahren, um meine Frau und meinen
Sohn Kurt, sowie meinen Sohn Manfred, den ich noch nicht kannte, weil er erst nach der Flucht, am 31. Januar, in Groß
Lüssewitz, geboren wurde, nach Krottorf zu holen. Meine Frau hatte schon Holz für den Winter besorgt und vom Gut, auf
dem sie im Sommer gearbeitet hatte, Mehl und Kartoffeln bekommen. Wir haben das Mehl und andere Habseligkeiten in
Kisten verpackt. Das Holz haben wir einem Bauern gegeben, der uns und unser Gepäck, mit seinem Pferdewagen, zum 14
Kilometer entfernten Bahnhof, nach Ribnitz gebracht hat. Wir sind auch gut in Krottorf angekommen, aber als wir am
nächsten Tag, unsere Kisten vom Bahnhof abholen wollten, haben wir zwar die Kisten vorgefunden, doch der gesamte Inhalt
wurde während der Bahnfahrt entwendet. Die Bahnstation in Krottorf hat die Vorkommnisse zur Kenntnis genommen und
protokolliert, aber unsere Sachen haben wir nie wieder gesehen und mussten wieder bei Null anfangen.
Im Winter musste ich auf der Genossenschaft, unentgeltlich, für die Russen Weizen einsacken. Ich hatte versucht eine
Arbeit als Zimmermann zu bekommen, doch auf dem Arbeitsamt wurde mir gesagt, ich bin Ladwirt und muss auf der
Landwirtschaft arbeiten. Da in den ersten Nachkriegsjahren, auch in der sowjetisch besetzten Zone Arbeitsplätze knapp
waren, mussten auch solche, die einen anderen Beruf erlernt hatten, jede zumutbare Arbeit annehmen. Aus der Heimat
erhielt ich einen Brief, von meiner dort noch lebenden Mutter. Sie schrieb das sie mich noch einmal sehen wollte und
ich sollte doch wieder zurück kommen; Unser Hof wäre nicht von Polen besetzt und sie wäre ganz alleine, weil der Vater
nach dem Durchzug der Front von den Russen erschlagen wurde. Daraufhin habe ich dem polnischen Konsulat in Magdeburg
mitgeteilt, dass ich in Rohmanen eine Landwirtschaft besitze, und um eine Einreisegenehmigung gebeten.
Nach 2 Monaten erhielt ich eine Postkarte, mit der Mitteilung, ich sollte mich persönlich beim Konsulat vorstellen.
Nach Aufnahme meiner Personalien, wurde mir gesagt, das ich benachrichtigt werde wenn mein Antrag genehmigt wird. Ende
Juli 1947 erhielten wir die Einreisegenehmigung nach Ostpreußen, das jetzt unter polnischer Verwaltung stand. Wir
mussten zuerst zum polnischen Konsulat in Berlin-Lichterfelde, wo wir umgeben von einer Trümmerlandschaft, gewartet
haben, bis alle Untersuchungen und Formalitäten erledigt waren.
“ Wieder zurück in Ostpreußen.”
Der schwere Wiederaufbau nach dem Kriege
Dann fuhren wir über Frankfurt/Oder, Posen, Thorn, Allenstein, nach Ortelsburg, wo wir am 2. August 1947 ankamen. Mit
einem zweirädrigen Karren, den ich mir von einem noch in Ortelsburg lebenden Bekanten ausgeliehen hatte und meinem
Sohn Manfred im Kinderwagen fuhren wir nach Rohmanen. Meine Mutter war inzwischen verstorben und auf dem Hof war nur
meine, inzwischen aus Russischer Gefangenschaft wiedergekehrte Schwester, Frieda Pelkowski.

Es war alles ausgeplündert; kein Vieh, keine Maschinen und der ganze Hof mit kniehohem Graß überwachsen. Nur schmale
Trampelpfade, vom Haus zum Holzschuppen und zum Klo, durchkreuzten das satte Grün. Ich habe das Gras auf dem Hof mit
einer Sense, die ich noch gefunden habe, abgemäht, damit der Hof nicht so verwahrlost aussah. Am nächsten Tag habe ich
mich bei der Polizei in Ortelsburg angemeldet, wo ich auch ein Startgeld von 100 Zloty erhielt und Gepäckstücke, die
ich in Krottorf aufgegeben, am Bahnhof abgeholt. Es hat mich sehr gewundert das, das Gepäck überhaupt angekommen ist.
Da man von der Landwirtschaft nicht Leben konnte, habe ich mich in den nächsten Tagen, bei der jetzt polnischen Bahn,
um Arbeit beworben und wurde auch angenommen. Wenn wir unseren Monatslohn bekamen, saß immer einer am Tisch, der von
uns 100 Zloty für den Wiederaufbau von Warschau verlangte. Wenn ich dran war, riefen die Anderen, ich hätte Warschau
zerstört und müsste deshalb 200 Zloty abgeben. Nach 3 Jahren kam eine Verfügung, die besagte, dass wer länger als 1
Jahr bei der Bahn beschäftigt ist, angestellt werden muss. Um diese Bestimmung zu umgehen hat man mich entlassen und
eine Woche später wieder eingestellt.
Als ich vor Ablauf des nächsten Jahres, aus dem gleichen Grunde wieder entlassen wurde, habe ich mich bei der
Stadtverwaltung in Ortelsburg(jetzt Szczytno)beworben, wo ich zuerst im Gaswerk als Heizer und später auf Baustellen
als Zimmermann gearbeitet habe. Wir haben durch den Krieg beschädigte Häuser repariert, in den ehemals touristischen
Zentren einige Ausbesserungen an den Einrichtungen durchgeführt, eine Ziegelei wieder in Betrieb gesetzt und andere
anfallende Arbeiten verrichtet. Im Dach des Rathausturmes war während der Kämpfe eine Granate eingeschlagen, die, die
Dachlatten und die Verschalung zerstört hatte. Da wir, unter schwersten Bedingungen, den Schaden repariert haben,
wurde uns eine Höhenzulage versprochen, die wir aber nicht bekommen haben.
Aus Verärgerung darüber habe ich bei der Stadtverwaltung gekündigt und bei einer Wiederaufbaufirma unter der Leitung
von Bauingenieur Laskowski wieder angefangen, wo ich bis 1954, als Zimmermann beschäftigt war. Ab da habe ich mich
nur um meinen Hof gekümmert, der wegen meiner Arbeitsstellen, gezwungenermaßen, sehr vernachlässigt wurde. Als wir
1947 zurückkamen, brachten wir unseren Sohn Manfred noch im Kinderwagen. Den hat meine Frau zum Markt gebracht,
verkauft, und dafür eine Ziege erworben, die dank guter Pflege, uns täglich mit 4 Liter Milch versorgte. Das war der
erste Baustein zum Wiederaufbau, unserer durch den Krieg zerstörten, und danach ausgeplünderten Landwirtschaft.
Während meiner Arbeit bei der Bahn haben wir uns eine Kuh gekauft, die nach einem halben Jahr, wegen nicht bezahlter
Grundsteuer, vom Gerichtsvollzieher gepfändet wurde. Man hat uns die Kuh weggenommen und bei einem Arbeiter, der in
der Ernst-Mey-Straße in Ortelsburg wohnte und sie wegen nicht vorhandener Futtermittel, nur mit Kartoffelkraut
gefüttert hat, untergestellt. Als ich bei der Bahn meinen Monatslohn bekommen habe, bin ich zur Gmina gegangen, habe
eine Rate angezahlt und durfte dann die Kuh wieder mit nach Hause nehmen. Durch die schlechte Ernährung war die Kuh
stark abgemagert und lieferte nur die Hälfte der ursprünglichen Milchleistung.
Später habe ich ein Pferd auf Abzahlung bekommen, das 140.000 alte Zloty gekostet hat. Die Stute war schwach und unser
Feld sehr hügelig, so dass man nur bergab pflügen konnte, was sehr beschwerlich war, bergauf ging es immer im Leerlauf.
Später habe ich die schweren Böden mit dem Traktor umpflügen, und in den letzten Jahren auch mit dem Binder mähen
lassen. Von der Stute habe ich 2 schöne Fohlen gezogen; ein davon habe ich bei der Ausreise in die Bundesrepublik
mitgebracht und bei der Viehverwertungs-Genossenschaft in Göttingen verkauft. In den ersten Nachkriegsjahren als noch
wenig Land bestellt wurde, breiteten sich auf den nicht beackerten Flächen, Wildkräuter aus. Disteln und andere
Schnellwachsende, erreichten manchmal eine Höhe von 2 Meter, besonders auf den schweren Böden.
Es hat viel Schweiß gekostet ehe man den Acker soweit hatte, das er auch befriedigende Erträge abwarf. Die
Währungsreform von 1950, hat unser weiniges Geld das wir schon gespart hatten, wieder vernichtet. Ich hatte 2 Pferde,
1 Fohlen, 2 Kühe und Schweine, als ich wieder aufgefordert wurde nicht bezahlte Grundsteuern nachzuzahlen. Als ich
nicht bezahlen konnte, hat der Vollziehungsbeamte, ein Fohlen, eine Kuh und ein Schwein gepfändet. Es gelang mir jedoch
nach längeren Verhandlungen, ohne größere Verluste, alles zu regeln. Später kam eine Verfügung, die besagte; wenn
jemand auf seinem Hof nur eine Kuh und ein Pferd hatte, durften sie nicht gepfändet werden. Einige haben ihr Inventar
dieser Verfügung angepasst und dadurch die Zahlung von Grundsteuer umgangen.

Wer seine Steuern pünktlich bezahlt und sein Kontingent an landwirtschaftlichen Produkten fristgerecht abgeliefert hat,
der konnte seine, darüber hinaus erwirtschafteten Produkte zu marktgerechten Preisen verkaufen. Für eine hochtragende
Sterke, mindestens 400 kg schwer, die auf ein staatliches Gut verkauft wurde, konnte man bis zu 12000 Zloty bekommen.
Unsere Böden waren kalkarm, doch durch den Einsatz von Kalk und Kunstdünger konnte man den Ertrag erheblich steigern.
Kalk und Kunstdünger konnte man bei der Genossenschaft(GS) bestellen, der dann auch direkt auf den Hof geliefert wurde.
Kalk wurde geliefert und gleich auf dem Feld ausgestreut. In den 1960ger Jahren waren alle Ackerflächen der Rohmaner
Felder bestellt.
Die nach dem Krieg zurückgebliebenen deutschen Bauernfamilien, aber auch die Polen, die während des Krieges beim Bauern
in Deutschland gearbeitet haben, versuchten mit teils bescheidenen, oder auch zusammen gesuchten, landwirtschaftlichen
Geräten, die bäuerlichen Betriebe aufrecht zu erhalten. Nach den schweren Anfängen in den ersten Nachkriegsjahren
erzielten sie schließlich einen beachtlichen Erfolg, der sich in wogenden Kornfeldern, sowie in grünen Wiesen auf
denen gut genährtes Vieh weidete, widerspiegelte.
Ich habe Briefe nach Hause geschrieben, aber die kamen nur bis Allenstein und wurden wieder zurück geschickt. Als eine
Kommission des Roten Kreuzes aus der Schweiz unser Lager besichtigt hat, haben wir uns beschwert, das wir als
Sanitätsdienstgrade, zur Arbeit gehen müssen. Daraufhin erging ein Befehl: Wer einen vom Roten Kreuz, ausgestellten
Ausweis besitzt, gehört einem internationalen Verband an und braucht nicht zu Arbeit gehen. Aus unserem Lager hatten
sich 20 Mann gemeldet, die daraufhin Freigang, in Begleitung von zwei französischen Wachsoldaten erhielten. Als wir
gefragt wurden wo wir hin wollen, entschlossen wir uns, einen Soldatenfriedhof, auf dem unsere verstorbenen Kameraden
beerdigt waren, zu besuchen.
Da der Untergrund in dieser Gegend aus Felsen bestand, wurden die Gräben, in denen die Toten in selbst gezimmerten
Kisten nebeneinander gestellt wurden, mit Hilfe von Dynamit ausgehoben. Ein Leichenwagen, mit einem Pferd bespannt,
das mit einer schwarzen Decke abgedeckt war, wurde von einem Kutscher in angemessener Kleidung, gefahren. Der Wagen
konnte gleichzeitig 4 Kisten transportieren. Wenn wir von der Arbeit kommend, dem Leichenwagen begegneten, wurde
gehalten und mit einer Schweigeminute der Toten gedacht, bis der Wagen vorbei war. Die Zivilbevölkerung verharrte auch
im Schweigen, mit abgenommener Kopfbedeckung.
Ein Kamerad, der in Krottorf, Kreis Oschersleben, bei Magdeburg, zuhause war, sagte bei seiner Entlassung zu mir:
Sollte ich das Glück haben, meine Entlassungspapiere zu erhalten ohne eine Bleibe vorzuweisen, dann soll ich Krottorf
als Heimatadresse angeben. Auf der Krankenstube habe ich angegeben, dass sich noch ein Schrapnellsplitter, aus dem
Ersten Weltkrieg, in meiner Kreuzbeingegend befindet, er zwar verkapselt ist, aber immer noch Beschwerden verursacht.
Daraufhin wurde ich zur Entlassung vornotiert. Als bekannt wurde das ein Rückkehrertransport in die sowjetische
Besatzungszone zusammengestellt wird, habe ich mich sofort gemeldet und wurde für ein Entlassungslager in Angoleme
vorgesehen. War das eine Freude, als uns mitgeteilt wurde, wann der Rücktransport stattfindet.
In unserem Lager waren noch 2 Kameraden aus dem Kreis Ortelsburg: Ein Gustav Lumma aus Leynau und ein Alfred Moritz
aus Groß Schöndamerau. Sie mussten noch zurückbleiben und haben mir den Auftrag erteil, die Angehörigen in der Heimat
zu grüßen und ihnen die Anschrift mitzuteilen. Als wir im Entlassungslager ankamen, fragte man uns nach unserer
Heimatanschrift. Dann wurden die Entlassungspapiere angefertigt. Es wurde uns auch ein Barscheck, für die in Frankreich
geleistete Arbeit ausgehändigt, den wir bei jeder Kasse in Deutschland einlösen könnten. Ich habe ihn bis zum heutigen
Tage nicht einlösen können, obwohl ich irgendwann in der Zeitung gelesen habe, das Verrechnungschecks die den aus
französischer Kriegsgefangenschaft Entlassenen, ausgehändigt wurden, einzulösen sind.
Wir kamen zuerst nach Saar Elbe, dann in die Nähe der Zonengrenze zu Thüringen. Hier mussten wir 2 Tage warten, weil
aus der sowjetischen Besatzungszone keine Eisenbahnwagen bereitgestellt wurden. Angesichts dessen, das der Russe beim
letzten Transport die aus Frankreich kommenden Wagen kassiert und nicht mehr herausgeben wollte, bestand der Franzose
jetzt darauf, seine Wagen sofort wieder mitzunehmen. Als der sehnsüchtig erwartete Zug endlich eintraf, durften wir
umsteigen und kamen, immer noch hinter Stacheldraht, nach Erfurt. Von dort weiter ins Quarantänelager nach Prätsch an
der Elbe.
Unter Androhung von Strafe war es verboten das Lager zu verlassen, doch der Hunger zwang uns dazu, in den umliegenden
Dörfern um Lebensmittel zu betteln. Man drohte uns damit, dass Zuwiderhandlungen, mit einer 14-tägigen Verlängerung der
Quarantäne geahndet werden. Der Roggen war schon reif und wir haben, auf den umliegenden Feldern, die Ähren abgerissen,
das Korn, zwischen 2 Steinen zu Mehl zerrieben, um daraus eine Suppe zu kochen, denn von dem was unsere Lagerküche uns
bieten konnte, war es nicht möglich zu überleben. Als der Eigentümer bemerkte wer seine Roggenähren entwendet hat, kam
er ins Lager, gerade zu dem Zeitpunkt als wir mit dem Mahlen beschäftigt waren. Der Lagerkommandant, bei dem er sich
beschwerte, drohte uns zu bestrafen, wenn wir unsere „Rauzüge” nicht unmittelbar einstellen würden. Wir sagten ihm er
solle uns heimfahren lassen, da wir doch lange genug hinter Stacheldraht gesessen hätten.
Endlich wieder in Freiheit
14 Tage nach unserer Ankunft wurden uns Entlassungspapiere ausgehändigt, sowie auch Fahrscheine
zum den, von uns angegeben Heimatorten. So kam ich nach Krottof, Kreis Oschersleben, zu meinem ehemaligen
Kriegskameraden, bei dem ich einen Tag geblieben bin. Er hatte mir schon eine Stelle bei einem Bauern besorgt, der 70
Jahre alt und kinderlos war. Zum Hof, den er mit seiner Ehefrau bewirtschaftet hat, gehörten 36 Morgen Land, 2 Ochsen
und 3 Kühe. Das Ackerland bestand aus 17 Parzellen und sicherte mir einen Arbeitsplatz.
Jetzt, da ich ein Dach überm Kopf und genug zu essen hatte, fing ich an nach dem Verbleib meiner Familie zu forschen.
Bei meinem letzten Heimaturlaub hatte ich mit meiner Frau verabredet; falls wir uns in den Kriegswirren verlieren
sollten, unsere Kontaktadresse, die meiner Quartiersleute in Burscheid, Kreis Opladen, sein sollte. Ich habe zuerst
nach Rohmanen geschrieben, aber leider keine Antwort erhalten. Dann habe ich nach Burscheid geschrieben, und siehe, -
bei denen lag schon eine Anfrage meiner Frau vor, die nach mir gefragt, und ihre jetzige Anschrift hinterlassen hatte.
Ich habe dem Bauern erzählt dass meine Frau sich zurzeit, auf einem Gut, in Alt Steinhorst, im Kreis Rostock, befindet.
Er war sofort bereit uns ein Zimmer zur Verfügung zu stellen, wenn ich meine Frau nach Krottorf rüberholen wollte. Das
habe ich Ihr mitgeteilt und sie war sofort bereit ihren Wohnsitz nach Krottorf zu verlegen, denn sie wohnte dort in
einem kleinen Stübchen unterm Dach.
Im Herbst, als die Feldarbeit so ziemlich erledigt war, bin ich nach Alt Steinhorst gefahren, um meine Frau und meinen
Sohn Kurt, sowie meinen Sohn Manfred, den ich noch nicht kannte, weil er erst nach der Flucht, am 31. Januar, in Groß
Lüssewitz, geboren wurde, nach Krottorf zu holen. Meine Frau hatte schon Holz für den Winter besorgt und vom Gut, auf
dem sie im Sommer gearbeitet hatte, Mehl und Kartoffeln bekommen. Wir haben das Mehl und andere Habseligkeiten in
Kisten verpackt. Das Holz haben wir einem Bauern gegeben, der uns und unser Gepäck, mit seinem Pferdewagen, zum 14
Kilometer entfernten Bahnhof, nach Ribnitz gebracht hat. Wir sind auch gut in Krottorf angekommen, aber als wir am
nächsten Tag, unsere Kisten vom Bahnhof abholen wollten, haben wir zwar die Kisten vorgefunden, doch der gesamte Inhalt
wurde während der Bahnfahrt entwendet. Die Bahnstation in Krottorf hat die Vorkommnisse zur Kenntnis genommen und
protokolliert, aber unsere Sachen haben wir nie wieder gesehen und mussten wieder bei Null anfangen.
Im Winter musste ich auf der Genossenschaft, unentgeltlich, für die Russen Weizen einsacken. Ich hatte versucht eine
Arbeit als Zimmermann zu bekommen, doch auf dem Arbeitsamt wurde mir gesagt, ich bin Ladwirt und muss auf der
Landwirtschaft arbeiten. Da in den ersten Nachkriegsjahren, auch in der sowjetisch besetzten Zone Arbeitsplätze knapp
waren, mussten auch solche, die einen anderen Beruf erlernt hatten, jede zumutbare Arbeit annehmen. Aus der Heimat
erhielt ich einen Brief, von meiner dort noch lebenden Mutter. Sie schrieb das sie mich noch einmal sehen wollte und
ich sollte doch wieder zurück kommen; Unser Hof wäre nicht von Polen besetzt und sie wäre ganz alleine, weil der Vater
nach dem Durchzug der Front von den Russen erschlagen wurde. Daraufhin habe ich dem polnischen Konsulat in Magdeburg
mitgeteilt, dass ich in Rohmanen eine Landwirtschaft besitze, und um eine Einreisegenehmigung gebeten.
Nach 2 Monaten erhielt ich eine Postkarte, mit der Mitteilung, ich sollte mich persönlich beim Konsulat vorstellen.
Nach Aufnahme meiner Personalien, wurde mir gesagt, das ich benachrichtigt werde wenn mein Antrag genehmigt wird. Ende
Juli 1947 erhielten wir die Einreisegenehmigung nach Ostpreußen, das jetzt unter polnischer Verwaltung stand. Wir
mussten zuerst zum polnischen Konsulat in Berlin-Lichterfelde, wo wir umgeben von einer Trümmerlandschaft, gewartet
haben, bis alle Untersuchungen und Formalitäten erledigt waren.
“ Wieder zurück in Ostpreußen.”
Der schwere Wiederaufbau nach dem Kriege
Dann fuhren wir über Frankfurt/Oder, Posen, Thorn, Allenstein, nach Ortelsburg, wo wir am 2. August 1947 ankamen. Mit
einem zweirädrigen Karren, den ich mir von einem noch in Ortelsburg lebenden Bekanten ausgeliehen hatte und meinem
Sohn Manfred im Kinderwagen fuhren wir nach Rohmanen. Meine Mutter war inzwischen verstorben und auf dem Hof war nur
meine, inzwischen aus Russischer Gefangenschaft wiedergekehrte Schwester, Frieda Pelkowski.

Es war alles ausgeplündert; kein Vieh, keine Maschinen und der ganze Hof mit kniehohem Graß überwachsen. Nur schmale
Trampelpfade, vom Haus zum Holzschuppen und zum Klo, durchkreuzten das satte Grün. Ich habe das Gras auf dem Hof mit
einer Sense, die ich noch gefunden habe, abgemäht, damit der Hof nicht so verwahrlost aussah. Am nächsten Tag habe ich
mich bei der Polizei in Ortelsburg angemeldet, wo ich auch ein Startgeld von 100 Zloty erhielt und Gepäckstücke, die
ich in Krottorf aufgegeben, am Bahnhof abgeholt. Es hat mich sehr gewundert das, das Gepäck überhaupt angekommen ist.
Da man von der Landwirtschaft nicht Leben konnte, habe ich mich in den nächsten Tagen, bei der jetzt polnischen Bahn,
um Arbeit beworben und wurde auch angenommen. Wenn wir unseren Monatslohn bekamen, saß immer einer am Tisch, der von
uns 100 Zloty für den Wiederaufbau von Warschau verlangte. Wenn ich dran war, riefen die Anderen, ich hätte Warschau
zerstört und müsste deshalb 200 Zloty abgeben. Nach 3 Jahren kam eine Verfügung, die besagte, dass wer länger als 1
Jahr bei der Bahn beschäftigt ist, angestellt werden muss. Um diese Bestimmung zu umgehen hat man mich entlassen und
eine Woche später wieder eingestellt.
Als ich vor Ablauf des nächsten Jahres, aus dem gleichen Grunde wieder entlassen wurde, habe ich mich bei der
Stadtverwaltung in Ortelsburg(jetzt Szczytno)beworben, wo ich zuerst im Gaswerk als Heizer und später auf Baustellen
als Zimmermann gearbeitet habe. Wir haben durch den Krieg beschädigte Häuser repariert, in den ehemals touristischen
Zentren einige Ausbesserungen an den Einrichtungen durchgeführt, eine Ziegelei wieder in Betrieb gesetzt und andere
anfallende Arbeiten verrichtet. Im Dach des Rathausturmes war während der Kämpfe eine Granate eingeschlagen, die, die
Dachlatten und die Verschalung zerstört hatte. Da wir, unter schwersten Bedingungen, den Schaden repariert haben,
wurde uns eine Höhenzulage versprochen, die wir aber nicht bekommen haben.
Aus Verärgerung darüber habe ich bei der Stadtverwaltung gekündigt und bei einer Wiederaufbaufirma unter der Leitung
von Bauingenieur Laskowski wieder angefangen, wo ich bis 1954, als Zimmermann beschäftigt war. Ab da habe ich mich
nur um meinen Hof gekümmert, der wegen meiner Arbeitsstellen, gezwungenermaßen, sehr vernachlässigt wurde. Als wir
1947 zurückkamen, brachten wir unseren Sohn Manfred noch im Kinderwagen. Den hat meine Frau zum Markt gebracht,
verkauft, und dafür eine Ziege erworben, die dank guter Pflege, uns täglich mit 4 Liter Milch versorgte. Das war der
erste Baustein zum Wiederaufbau, unserer durch den Krieg zerstörten, und danach ausgeplünderten Landwirtschaft.
Während meiner Arbeit bei der Bahn haben wir uns eine Kuh gekauft, die nach einem halben Jahr, wegen nicht bezahlter
Grundsteuer, vom Gerichtsvollzieher gepfändet wurde. Man hat uns die Kuh weggenommen und bei einem Arbeiter, der in
der Ernst-Mey-Straße in Ortelsburg wohnte und sie wegen nicht vorhandener Futtermittel, nur mit Kartoffelkraut
gefüttert hat, untergestellt. Als ich bei der Bahn meinen Monatslohn bekommen habe, bin ich zur Gmina gegangen, habe
eine Rate angezahlt und durfte dann die Kuh wieder mit nach Hause nehmen. Durch die schlechte Ernährung war die Kuh
stark abgemagert und lieferte nur die Hälfte der ursprünglichen Milchleistung.
Später habe ich ein Pferd auf Abzahlung bekommen, das 140.000 alte Zloty gekostet hat. Die Stute war schwach und unser
Feld sehr hügelig, so dass man nur bergab pflügen konnte, was sehr beschwerlich war, bergauf ging es immer im Leerlauf.
Später habe ich die schweren Böden mit dem Traktor umpflügen, und in den letzten Jahren auch mit dem Binder mähen
lassen. Von der Stute habe ich 2 schöne Fohlen gezogen; ein davon habe ich bei der Ausreise in die Bundesrepublik
mitgebracht und bei der Viehverwertungs-Genossenschaft in Göttingen verkauft. In den ersten Nachkriegsjahren als noch
wenig Land bestellt wurde, breiteten sich auf den nicht beackerten Flächen, Wildkräuter aus. Disteln und andere
Schnellwachsende, erreichten manchmal eine Höhe von 2 Meter, besonders auf den schweren Böden.
Es hat viel Schweiß gekostet ehe man den Acker soweit hatte, das er auch befriedigende Erträge abwarf. Die
Währungsreform von 1950, hat unser weiniges Geld das wir schon gespart hatten, wieder vernichtet. Ich hatte 2 Pferde,
1 Fohlen, 2 Kühe und Schweine, als ich wieder aufgefordert wurde nicht bezahlte Grundsteuern nachzuzahlen. Als ich
nicht bezahlen konnte, hat der Vollziehungsbeamte, ein Fohlen, eine Kuh und ein Schwein gepfändet. Es gelang mir jedoch
nach längeren Verhandlungen, ohne größere Verluste, alles zu regeln. Später kam eine Verfügung, die besagte; wenn
jemand auf seinem Hof nur eine Kuh und ein Pferd hatte, durften sie nicht gepfändet werden. Einige haben ihr Inventar
dieser Verfügung angepasst und dadurch die Zahlung von Grundsteuer umgangen.

Wer seine Steuern pünktlich bezahlt und sein Kontingent an landwirtschaftlichen Produkten fristgerecht abgeliefert hat,
der konnte seine, darüber hinaus erwirtschafteten Produkte zu marktgerechten Preisen verkaufen. Für eine hochtragende
Sterke, mindestens 400 kg schwer, die auf ein staatliches Gut verkauft wurde, konnte man bis zu 12000 Zloty bekommen.
Unsere Böden waren kalkarm, doch durch den Einsatz von Kalk und Kunstdünger konnte man den Ertrag erheblich steigern.
Kalk und Kunstdünger konnte man bei der Genossenschaft(GS) bestellen, der dann auch direkt auf den Hof geliefert wurde.
Kalk wurde geliefert und gleich auf dem Feld ausgestreut. In den 1960ger Jahren waren alle Ackerflächen der Rohmaner
Felder bestellt.
Die nach dem Krieg zurückgebliebenen deutschen Bauernfamilien, aber auch die Polen, die während des Krieges beim Bauern
in Deutschland gearbeitet haben, versuchten mit teils bescheidenen, oder auch zusammen gesuchten, landwirtschaftlichen
Geräten, die bäuerlichen Betriebe aufrecht zu erhalten. Nach den schweren Anfängen in den ersten Nachkriegsjahren
erzielten sie schließlich einen beachtlichen Erfolg, der sich in wogenden Kornfeldern, sowie in grünen Wiesen auf
denen gut genährtes Vieh weidete, widerspiegelte.
Ein Kamerad, der in Krottorf, Kreis Oschersleben, bei Magdeburg, zuhause war, sagte bei seiner Entlassung zu mir:
Sollte ich das Glück haben, meine Entlassungspapiere zu erhalten ohne eine Bleibe vorzuweisen, dann soll ich Krottorf
als Heimatadresse angeben. Auf der Krankenstube habe ich angegeben, dass sich noch ein Schrapnellsplitter, aus dem
Ersten Weltkrieg, in meiner Kreuzbeingegend befindet, er zwar verkapselt ist, aber immer noch Beschwerden verursacht.
Daraufhin wurde ich zur Entlassung vornotiert. Als bekannt wurde das ein Rückkehrertransport in die sowjetische
Besatzungszone zusammengestellt wird, habe ich mich sofort gemeldet und wurde für ein Entlassungslager in Angoleme
vorgesehen. War das eine Freude, als uns mitgeteilt wurde, wann der Rücktransport stattfindet.
In unserem Lager waren noch 2 Kameraden aus dem Kreis Ortelsburg: Ein Gustav Lumma aus Leynau und ein Alfred Moritz
aus Groß Schöndamerau. Sie mussten noch zurückbleiben und haben mir den Auftrag erteil, die Angehörigen in der Heimat
zu grüßen und ihnen die Anschrift mitzuteilen. Als wir im Entlassungslager ankamen, fragte man uns nach unserer
Heimatanschrift. Dann wurden die Entlassungspapiere angefertigt. Es wurde uns auch ein Barscheck, für die in Frankreich
geleistete Arbeit ausgehändigt, den wir bei jeder Kasse in Deutschland einlösen könnten. Ich habe ihn bis zum heutigen
Tage nicht einlösen können, obwohl ich irgendwann in der Zeitung gelesen habe, das Verrechnungschecks die den aus
französischer Kriegsgefangenschaft Entlassenen, ausgehändigt wurden, einzulösen sind.
Wir kamen zuerst nach Saar Elbe, dann in die Nähe der Zonengrenze zu Thüringen. Hier mussten wir 2 Tage warten, weil
aus der sowjetischen Besatzungszone keine Eisenbahnwagen bereitgestellt wurden. Angesichts dessen, das der Russe beim
letzten Transport die aus Frankreich kommenden Wagen kassiert und nicht mehr herausgeben wollte, bestand der Franzose
jetzt darauf, seine Wagen sofort wieder mitzunehmen. Als der sehnsüchtig erwartete Zug endlich eintraf, durften wir
umsteigen und kamen, immer noch hinter Stacheldraht, nach Erfurt. Von dort weiter ins Quarantänelager nach Prätsch an
der Elbe.
Unter Androhung von Strafe war es verboten das Lager zu verlassen, doch der Hunger zwang uns dazu, in den umliegenden
Dörfern um Lebensmittel zu betteln. Man drohte uns damit, dass Zuwiderhandlungen, mit einer 14-tägigen Verlängerung der
Quarantäne geahndet werden. Der Roggen war schon reif und wir haben, auf den umliegenden Feldern, die Ähren abgerissen,
das Korn, zwischen 2 Steinen zu Mehl zerrieben, um daraus eine Suppe zu kochen, denn von dem was unsere Lagerküche uns
bieten konnte, war es nicht möglich zu überleben. Als der Eigentümer bemerkte wer seine Roggenähren entwendet hat, kam
er ins Lager, gerade zu dem Zeitpunkt als wir mit dem Mahlen beschäftigt waren. Der Lagerkommandant, bei dem er sich
beschwerte, drohte uns zu bestrafen, wenn wir unsere „Rauzüge” nicht unmittelbar einstellen würden. Wir sagten ihm er
solle uns heimfahren lassen, da wir doch lange genug hinter Stacheldraht gesessen hätten.
Endlich wieder in Freiheit
14 Tage nach unserer Ankunft wurden uns Entlassungspapiere ausgehändigt, sowie auch Fahrscheine
zum den, von uns angegeben Heimatorten. So kam ich nach Krottof, Kreis Oschersleben, zu meinem ehemaligen
Kriegskameraden, bei dem ich einen Tag geblieben bin. Er hatte mir schon eine Stelle bei einem Bauern besorgt, der 70
Jahre alt und kinderlos war. Zum Hof, den er mit seiner Ehefrau bewirtschaftet hat, gehörten 36 Morgen Land, 2 Ochsen
und 3 Kühe. Das Ackerland bestand aus 17 Parzellen und sicherte mir einen Arbeitsplatz.
Jetzt, da ich ein Dach überm Kopf und genug zu essen hatte, fing ich an nach dem Verbleib meiner Familie zu forschen.
Bei meinem letzten Heimaturlaub hatte ich mit meiner Frau verabredet; falls wir uns in den Kriegswirren verlieren
sollten, unsere Kontaktadresse, die meiner Quartiersleute in Burscheid, Kreis Opladen, sein sollte. Ich habe zuerst
nach Rohmanen geschrieben, aber leider keine Antwort erhalten. Dann habe ich nach Burscheid geschrieben, und siehe, -
bei denen lag schon eine Anfrage meiner Frau vor, die nach mir gefragt, und ihre jetzige Anschrift hinterlassen hatte.
Ich habe dem Bauern erzählt dass meine Frau sich zurzeit, auf einem Gut, in Alt Steinhorst, im Kreis Rostock, befindet.
Er war sofort bereit uns ein Zimmer zur Verfügung zu stellen, wenn ich meine Frau nach Krottorf rüberholen wollte. Das
habe ich Ihr mitgeteilt und sie war sofort bereit ihren Wohnsitz nach Krottorf zu verlegen, denn sie wohnte dort in
einem kleinen Stübchen unterm Dach.
Im Herbst, als die Feldarbeit so ziemlich erledigt war, bin ich nach Alt Steinhorst gefahren, um meine Frau und meinen
Sohn Kurt, sowie meinen Sohn Manfred, den ich noch nicht kannte, weil er erst nach der Flucht, am 31. Januar, in Groß
Lüssewitz, geboren wurde, nach Krottorf zu holen. Meine Frau hatte schon Holz für den Winter besorgt und vom Gut, auf
dem sie im Sommer gearbeitet hatte, Mehl und Kartoffeln bekommen. Wir haben das Mehl und andere Habseligkeiten in
Kisten verpackt. Das Holz haben wir einem Bauern gegeben, der uns und unser Gepäck, mit seinem Pferdewagen, zum 14
Kilometer entfernten Bahnhof, nach Ribnitz gebracht hat. Wir sind auch gut in Krottorf angekommen, aber als wir am
nächsten Tag, unsere Kisten vom Bahnhof abholen wollten, haben wir zwar die Kisten vorgefunden, doch der gesamte Inhalt
wurde während der Bahnfahrt entwendet. Die Bahnstation in Krottorf hat die Vorkommnisse zur Kenntnis genommen und
protokolliert, aber unsere Sachen haben wir nie wieder gesehen und mussten wieder bei Null anfangen.
Im Winter musste ich auf der Genossenschaft, unentgeltlich, für die Russen Weizen einsacken. Ich hatte versucht eine
Arbeit als Zimmermann zu bekommen, doch auf dem Arbeitsamt wurde mir gesagt, ich bin Ladwirt und muss auf der
Landwirtschaft arbeiten. Da in den ersten Nachkriegsjahren, auch in der sowjetisch besetzten Zone Arbeitsplätze knapp
waren, mussten auch solche, die einen anderen Beruf erlernt hatten, jede zumutbare Arbeit annehmen. Aus der Heimat
erhielt ich einen Brief, von meiner dort noch lebenden Mutter. Sie schrieb das sie mich noch einmal sehen wollte und
ich sollte doch wieder zurück kommen; Unser Hof wäre nicht von Polen besetzt und sie wäre ganz alleine, weil der Vater
nach dem Durchzug der Front von den Russen erschlagen wurde. Daraufhin habe ich dem polnischen Konsulat in Magdeburg
mitgeteilt, dass ich in Rohmanen eine Landwirtschaft besitze, und um eine Einreisegenehmigung gebeten.
Nach 2 Monaten erhielt ich eine Postkarte, mit der Mitteilung, ich sollte mich persönlich beim Konsulat vorstellen.
Nach Aufnahme meiner Personalien, wurde mir gesagt, das ich benachrichtigt werde wenn mein Antrag genehmigt wird. Ende
Juli 1947 erhielten wir die Einreisegenehmigung nach Ostpreußen, das jetzt unter polnischer Verwaltung stand. Wir
mussten zuerst zum polnischen Konsulat in Berlin-Lichterfelde, wo wir umgeben von einer Trümmerlandschaft, gewartet
haben, bis alle Untersuchungen und Formalitäten erledigt waren.
“ Wieder zurück in Ostpreußen.”
Der schwere Wiederaufbau nach dem Kriege
Dann fuhren wir über Frankfurt/Oder, Posen, Thorn, Allenstein, nach Ortelsburg, wo wir am 2. August 1947 ankamen. Mit
einem zweirädrigen Karren, den ich mir von einem noch in Ortelsburg lebenden Bekanten ausgeliehen hatte und meinem
Sohn Manfred im Kinderwagen fuhren wir nach Rohmanen. Meine Mutter war inzwischen verstorben und auf dem Hof war nur
meine, inzwischen aus Russischer Gefangenschaft wiedergekehrte Schwester, Frieda Pelkowski.

Es war alles ausgeplündert; kein Vieh, keine Maschinen und der ganze Hof mit kniehohem Graß überwachsen. Nur schmale
Trampelpfade, vom Haus zum Holzschuppen und zum Klo, durchkreuzten das satte Grün. Ich habe das Gras auf dem Hof mit
einer Sense, die ich noch gefunden habe, abgemäht, damit der Hof nicht so verwahrlost aussah. Am nächsten Tag habe ich
mich bei der Polizei in Ortelsburg angemeldet, wo ich auch ein Startgeld von 100 Zloty erhielt und Gepäckstücke, die
ich in Krottorf aufgegeben, am Bahnhof abgeholt. Es hat mich sehr gewundert das, das Gepäck überhaupt angekommen ist.
Da man von der Landwirtschaft nicht Leben konnte, habe ich mich in den nächsten Tagen, bei der jetzt polnischen Bahn,
um Arbeit beworben und wurde auch angenommen. Wenn wir unseren Monatslohn bekamen, saß immer einer am Tisch, der von
uns 100 Zloty für den Wiederaufbau von Warschau verlangte. Wenn ich dran war, riefen die Anderen, ich hätte Warschau
zerstört und müsste deshalb 200 Zloty abgeben. Nach 3 Jahren kam eine Verfügung, die besagte, dass wer länger als 1
Jahr bei der Bahn beschäftigt ist, angestellt werden muss. Um diese Bestimmung zu umgehen hat man mich entlassen und
eine Woche später wieder eingestellt.
Als ich vor Ablauf des nächsten Jahres, aus dem gleichen Grunde wieder entlassen wurde, habe ich mich bei der
Stadtverwaltung in Ortelsburg(jetzt Szczytno)beworben, wo ich zuerst im Gaswerk als Heizer und später auf Baustellen
als Zimmermann gearbeitet habe. Wir haben durch den Krieg beschädigte Häuser repariert, in den ehemals touristischen
Zentren einige Ausbesserungen an den Einrichtungen durchgeführt, eine Ziegelei wieder in Betrieb gesetzt und andere
anfallende Arbeiten verrichtet. Im Dach des Rathausturmes war während der Kämpfe eine Granate eingeschlagen, die, die
Dachlatten und die Verschalung zerstört hatte. Da wir, unter schwersten Bedingungen, den Schaden repariert haben,
wurde uns eine Höhenzulage versprochen, die wir aber nicht bekommen haben.
Aus Verärgerung darüber habe ich bei der Stadtverwaltung gekündigt und bei einer Wiederaufbaufirma unter der Leitung
von Bauingenieur Laskowski wieder angefangen, wo ich bis 1954, als Zimmermann beschäftigt war. Ab da habe ich mich
nur um meinen Hof gekümmert, der wegen meiner Arbeitsstellen, gezwungenermaßen, sehr vernachlässigt wurde. Als wir
1947 zurückkamen, brachten wir unseren Sohn Manfred noch im Kinderwagen. Den hat meine Frau zum Markt gebracht,
verkauft, und dafür eine Ziege erworben, die dank guter Pflege, uns täglich mit 4 Liter Milch versorgte. Das war der
erste Baustein zum Wiederaufbau, unserer durch den Krieg zerstörten, und danach ausgeplünderten Landwirtschaft.
Während meiner Arbeit bei der Bahn haben wir uns eine Kuh gekauft, die nach einem halben Jahr, wegen nicht bezahlter
Grundsteuer, vom Gerichtsvollzieher gepfändet wurde. Man hat uns die Kuh weggenommen und bei einem Arbeiter, der in
der Ernst-Mey-Straße in Ortelsburg wohnte und sie wegen nicht vorhandener Futtermittel, nur mit Kartoffelkraut
gefüttert hat, untergestellt. Als ich bei der Bahn meinen Monatslohn bekommen habe, bin ich zur Gmina gegangen, habe
eine Rate angezahlt und durfte dann die Kuh wieder mit nach Hause nehmen. Durch die schlechte Ernährung war die Kuh
stark abgemagert und lieferte nur die Hälfte der ursprünglichen Milchleistung.
Später habe ich ein Pferd auf Abzahlung bekommen, das 140.000 alte Zloty gekostet hat. Die Stute war schwach und unser
Feld sehr hügelig, so dass man nur bergab pflügen konnte, was sehr beschwerlich war, bergauf ging es immer im Leerlauf.
Später habe ich die schweren Böden mit dem Traktor umpflügen, und in den letzten Jahren auch mit dem Binder mähen
lassen. Von der Stute habe ich 2 schöne Fohlen gezogen; ein davon habe ich bei der Ausreise in die Bundesrepublik
mitgebracht und bei der Viehverwertungs-Genossenschaft in Göttingen verkauft. In den ersten Nachkriegsjahren als noch
wenig Land bestellt wurde, breiteten sich auf den nicht beackerten Flächen, Wildkräuter aus. Disteln und andere
Schnellwachsende, erreichten manchmal eine Höhe von 2 Meter, besonders auf den schweren Böden.
Es hat viel Schweiß gekostet ehe man den Acker soweit hatte, das er auch befriedigende Erträge abwarf. Die
Währungsreform von 1950, hat unser weiniges Geld das wir schon gespart hatten, wieder vernichtet. Ich hatte 2 Pferde,
1 Fohlen, 2 Kühe und Schweine, als ich wieder aufgefordert wurde nicht bezahlte Grundsteuern nachzuzahlen. Als ich
nicht bezahlen konnte, hat der Vollziehungsbeamte, ein Fohlen, eine Kuh und ein Schwein gepfändet. Es gelang mir jedoch
nach längeren Verhandlungen, ohne größere Verluste, alles zu regeln. Später kam eine Verfügung, die besagte; wenn
jemand auf seinem Hof nur eine Kuh und ein Pferd hatte, durften sie nicht gepfändet werden. Einige haben ihr Inventar
dieser Verfügung angepasst und dadurch die Zahlung von Grundsteuer umgangen.

Wer seine Steuern pünktlich bezahlt und sein Kontingent an landwirtschaftlichen Produkten fristgerecht abgeliefert hat,
der konnte seine, darüber hinaus erwirtschafteten Produkte zu marktgerechten Preisen verkaufen. Für eine hochtragende
Sterke, mindestens 400 kg schwer, die auf ein staatliches Gut verkauft wurde, konnte man bis zu 12000 Zloty bekommen.
Unsere Böden waren kalkarm, doch durch den Einsatz von Kalk und Kunstdünger konnte man den Ertrag erheblich steigern.
Kalk und Kunstdünger konnte man bei der Genossenschaft(GS) bestellen, der dann auch direkt auf den Hof geliefert wurde.
Kalk wurde geliefert und gleich auf dem Feld ausgestreut. In den 1960ger Jahren waren alle Ackerflächen der Rohmaner
Felder bestellt.
Die nach dem Krieg zurückgebliebenen deutschen Bauernfamilien, aber auch die Polen, die während des Krieges beim Bauern
in Deutschland gearbeitet haben, versuchten mit teils bescheidenen, oder auch zusammen gesuchten, landwirtschaftlichen
Geräten, die bäuerlichen Betriebe aufrecht zu erhalten. Nach den schweren Anfängen in den ersten Nachkriegsjahren
erzielten sie schließlich einen beachtlichen Erfolg, der sich in wogenden Kornfeldern, sowie in grünen Wiesen auf
denen gut genährtes Vieh weidete, widerspiegelte.
Wir kamen zuerst nach Saar Elbe, dann in die Nähe der Zonengrenze zu Thüringen. Hier mussten wir 2 Tage warten, weil
aus der sowjetischen Besatzungszone keine Eisenbahnwagen bereitgestellt wurden. Angesichts dessen, das der Russe beim
letzten Transport die aus Frankreich kommenden Wagen kassiert und nicht mehr herausgeben wollte, bestand der Franzose
jetzt darauf, seine Wagen sofort wieder mitzunehmen. Als der sehnsüchtig erwartete Zug endlich eintraf, durften wir
umsteigen und kamen, immer noch hinter Stacheldraht, nach Erfurt. Von dort weiter ins Quarantänelager nach Prätsch an
der Elbe.
Unter Androhung von Strafe war es verboten das Lager zu verlassen, doch der Hunger zwang uns dazu, in den umliegenden
Dörfern um Lebensmittel zu betteln. Man drohte uns damit, dass Zuwiderhandlungen, mit einer 14-tägigen Verlängerung der
Quarantäne geahndet werden. Der Roggen war schon reif und wir haben, auf den umliegenden Feldern, die Ähren abgerissen,
das Korn, zwischen 2 Steinen zu Mehl zerrieben, um daraus eine Suppe zu kochen, denn von dem was unsere Lagerküche uns
bieten konnte, war es nicht möglich zu überleben. Als der Eigentümer bemerkte wer seine Roggenähren entwendet hat, kam
er ins Lager, gerade zu dem Zeitpunkt als wir mit dem Mahlen beschäftigt waren. Der Lagerkommandant, bei dem er sich
beschwerte, drohte uns zu bestrafen, wenn wir unsere „Rauzüge” nicht unmittelbar einstellen würden. Wir sagten ihm er
solle uns heimfahren lassen, da wir doch lange genug hinter Stacheldraht gesessen hätten.
Endlich wieder in Freiheit
14 Tage nach unserer Ankunft wurden uns Entlassungspapiere ausgehändigt, sowie auch Fahrscheine
zum den, von uns angegeben Heimatorten. So kam ich nach Krottof, Kreis Oschersleben, zu meinem ehemaligen
Kriegskameraden, bei dem ich einen Tag geblieben bin. Er hatte mir schon eine Stelle bei einem Bauern besorgt, der 70
Jahre alt und kinderlos war. Zum Hof, den er mit seiner Ehefrau bewirtschaftet hat, gehörten 36 Morgen Land, 2 Ochsen
und 3 Kühe. Das Ackerland bestand aus 17 Parzellen und sicherte mir einen Arbeitsplatz.
Jetzt, da ich ein Dach überm Kopf und genug zu essen hatte, fing ich an nach dem Verbleib meiner Familie zu forschen.
Bei meinem letzten Heimaturlaub hatte ich mit meiner Frau verabredet; falls wir uns in den Kriegswirren verlieren
sollten, unsere Kontaktadresse, die meiner Quartiersleute in Burscheid, Kreis Opladen, sein sollte. Ich habe zuerst
nach Rohmanen geschrieben, aber leider keine Antwort erhalten. Dann habe ich nach Burscheid geschrieben, und siehe, -
bei denen lag schon eine Anfrage meiner Frau vor, die nach mir gefragt, und ihre jetzige Anschrift hinterlassen hatte.
Ich habe dem Bauern erzählt dass meine Frau sich zurzeit, auf einem Gut, in Alt Steinhorst, im Kreis Rostock, befindet.
Er war sofort bereit uns ein Zimmer zur Verfügung zu stellen, wenn ich meine Frau nach Krottorf rüberholen wollte. Das
habe ich Ihr mitgeteilt und sie war sofort bereit ihren Wohnsitz nach Krottorf zu verlegen, denn sie wohnte dort in
einem kleinen Stübchen unterm Dach.
Im Herbst, als die Feldarbeit so ziemlich erledigt war, bin ich nach Alt Steinhorst gefahren, um meine Frau und meinen
Sohn Kurt, sowie meinen Sohn Manfred, den ich noch nicht kannte, weil er erst nach der Flucht, am 31. Januar, in Groß
Lüssewitz, geboren wurde, nach Krottorf zu holen. Meine Frau hatte schon Holz für den Winter besorgt und vom Gut, auf
dem sie im Sommer gearbeitet hatte, Mehl und Kartoffeln bekommen. Wir haben das Mehl und andere Habseligkeiten in
Kisten verpackt. Das Holz haben wir einem Bauern gegeben, der uns und unser Gepäck, mit seinem Pferdewagen, zum 14
Kilometer entfernten Bahnhof, nach Ribnitz gebracht hat. Wir sind auch gut in Krottorf angekommen, aber als wir am
nächsten Tag, unsere Kisten vom Bahnhof abholen wollten, haben wir zwar die Kisten vorgefunden, doch der gesamte Inhalt
wurde während der Bahnfahrt entwendet. Die Bahnstation in Krottorf hat die Vorkommnisse zur Kenntnis genommen und
protokolliert, aber unsere Sachen haben wir nie wieder gesehen und mussten wieder bei Null anfangen.
Im Winter musste ich auf der Genossenschaft, unentgeltlich, für die Russen Weizen einsacken. Ich hatte versucht eine
Arbeit als Zimmermann zu bekommen, doch auf dem Arbeitsamt wurde mir gesagt, ich bin Ladwirt und muss auf der
Landwirtschaft arbeiten. Da in den ersten Nachkriegsjahren, auch in der sowjetisch besetzten Zone Arbeitsplätze knapp
waren, mussten auch solche, die einen anderen Beruf erlernt hatten, jede zumutbare Arbeit annehmen. Aus der Heimat
erhielt ich einen Brief, von meiner dort noch lebenden Mutter. Sie schrieb das sie mich noch einmal sehen wollte und
ich sollte doch wieder zurück kommen; Unser Hof wäre nicht von Polen besetzt und sie wäre ganz alleine, weil der Vater
nach dem Durchzug der Front von den Russen erschlagen wurde. Daraufhin habe ich dem polnischen Konsulat in Magdeburg
mitgeteilt, dass ich in Rohmanen eine Landwirtschaft besitze, und um eine Einreisegenehmigung gebeten.
Nach 2 Monaten erhielt ich eine Postkarte, mit der Mitteilung, ich sollte mich persönlich beim Konsulat vorstellen.
Nach Aufnahme meiner Personalien, wurde mir gesagt, das ich benachrichtigt werde wenn mein Antrag genehmigt wird. Ende
Juli 1947 erhielten wir die Einreisegenehmigung nach Ostpreußen, das jetzt unter polnischer Verwaltung stand. Wir
mussten zuerst zum polnischen Konsulat in Berlin-Lichterfelde, wo wir umgeben von einer Trümmerlandschaft, gewartet
haben, bis alle Untersuchungen und Formalitäten erledigt waren.
“ Wieder zurück in Ostpreußen.”
Der schwere Wiederaufbau nach dem Kriege
Dann fuhren wir über Frankfurt/Oder, Posen, Thorn, Allenstein, nach Ortelsburg, wo wir am 2. August 1947 ankamen. Mit
einem zweirädrigen Karren, den ich mir von einem noch in Ortelsburg lebenden Bekanten ausgeliehen hatte und meinem
Sohn Manfred im Kinderwagen fuhren wir nach Rohmanen. Meine Mutter war inzwischen verstorben und auf dem Hof war nur
meine, inzwischen aus Russischer Gefangenschaft wiedergekehrte Schwester, Frieda Pelkowski.

Es war alles ausgeplündert; kein Vieh, keine Maschinen und der ganze Hof mit kniehohem Graß überwachsen. Nur schmale
Trampelpfade, vom Haus zum Holzschuppen und zum Klo, durchkreuzten das satte Grün. Ich habe das Gras auf dem Hof mit
einer Sense, die ich noch gefunden habe, abgemäht, damit der Hof nicht so verwahrlost aussah. Am nächsten Tag habe ich
mich bei der Polizei in Ortelsburg angemeldet, wo ich auch ein Startgeld von 100 Zloty erhielt und Gepäckstücke, die
ich in Krottorf aufgegeben, am Bahnhof abgeholt. Es hat mich sehr gewundert das, das Gepäck überhaupt angekommen ist.
Da man von der Landwirtschaft nicht Leben konnte, habe ich mich in den nächsten Tagen, bei der jetzt polnischen Bahn,
um Arbeit beworben und wurde auch angenommen. Wenn wir unseren Monatslohn bekamen, saß immer einer am Tisch, der von
uns 100 Zloty für den Wiederaufbau von Warschau verlangte. Wenn ich dran war, riefen die Anderen, ich hätte Warschau
zerstört und müsste deshalb 200 Zloty abgeben. Nach 3 Jahren kam eine Verfügung, die besagte, dass wer länger als 1
Jahr bei der Bahn beschäftigt ist, angestellt werden muss. Um diese Bestimmung zu umgehen hat man mich entlassen und
eine Woche später wieder eingestellt.
Als ich vor Ablauf des nächsten Jahres, aus dem gleichen Grunde wieder entlassen wurde, habe ich mich bei der
Stadtverwaltung in Ortelsburg(jetzt Szczytno)beworben, wo ich zuerst im Gaswerk als Heizer und später auf Baustellen
als Zimmermann gearbeitet habe. Wir haben durch den Krieg beschädigte Häuser repariert, in den ehemals touristischen
Zentren einige Ausbesserungen an den Einrichtungen durchgeführt, eine Ziegelei wieder in Betrieb gesetzt und andere
anfallende Arbeiten verrichtet. Im Dach des Rathausturmes war während der Kämpfe eine Granate eingeschlagen, die, die
Dachlatten und die Verschalung zerstört hatte. Da wir, unter schwersten Bedingungen, den Schaden repariert haben,
wurde uns eine Höhenzulage versprochen, die wir aber nicht bekommen haben.
Aus Verärgerung darüber habe ich bei der Stadtverwaltung gekündigt und bei einer Wiederaufbaufirma unter der Leitung
von Bauingenieur Laskowski wieder angefangen, wo ich bis 1954, als Zimmermann beschäftigt war. Ab da habe ich mich
nur um meinen Hof gekümmert, der wegen meiner Arbeitsstellen, gezwungenermaßen, sehr vernachlässigt wurde. Als wir
1947 zurückkamen, brachten wir unseren Sohn Manfred noch im Kinderwagen. Den hat meine Frau zum Markt gebracht,
verkauft, und dafür eine Ziege erworben, die dank guter Pflege, uns täglich mit 4 Liter Milch versorgte. Das war der
erste Baustein zum Wiederaufbau, unserer durch den Krieg zerstörten, und danach ausgeplünderten Landwirtschaft.
Während meiner Arbeit bei der Bahn haben wir uns eine Kuh gekauft, die nach einem halben Jahr, wegen nicht bezahlter
Grundsteuer, vom Gerichtsvollzieher gepfändet wurde. Man hat uns die Kuh weggenommen und bei einem Arbeiter, der in
der Ernst-Mey-Straße in Ortelsburg wohnte und sie wegen nicht vorhandener Futtermittel, nur mit Kartoffelkraut
gefüttert hat, untergestellt. Als ich bei der Bahn meinen Monatslohn bekommen habe, bin ich zur Gmina gegangen, habe
eine Rate angezahlt und durfte dann die Kuh wieder mit nach Hause nehmen. Durch die schlechte Ernährung war die Kuh
stark abgemagert und lieferte nur die Hälfte der ursprünglichen Milchleistung.
Später habe ich ein Pferd auf Abzahlung bekommen, das 140.000 alte Zloty gekostet hat. Die Stute war schwach und unser
Feld sehr hügelig, so dass man nur bergab pflügen konnte, was sehr beschwerlich war, bergauf ging es immer im Leerlauf.
Später habe ich die schweren Böden mit dem Traktor umpflügen, und in den letzten Jahren auch mit dem Binder mähen
lassen. Von der Stute habe ich 2 schöne Fohlen gezogen; ein davon habe ich bei der Ausreise in die Bundesrepublik
mitgebracht und bei der Viehverwertungs-Genossenschaft in Göttingen verkauft. In den ersten Nachkriegsjahren als noch
wenig Land bestellt wurde, breiteten sich auf den nicht beackerten Flächen, Wildkräuter aus. Disteln und andere
Schnellwachsende, erreichten manchmal eine Höhe von 2 Meter, besonders auf den schweren Böden.
Es hat viel Schweiß gekostet ehe man den Acker soweit hatte, das er auch befriedigende Erträge abwarf. Die
Währungsreform von 1950, hat unser weiniges Geld das wir schon gespart hatten, wieder vernichtet. Ich hatte 2 Pferde,
1 Fohlen, 2 Kühe und Schweine, als ich wieder aufgefordert wurde nicht bezahlte Grundsteuern nachzuzahlen. Als ich
nicht bezahlen konnte, hat der Vollziehungsbeamte, ein Fohlen, eine Kuh und ein Schwein gepfändet. Es gelang mir jedoch
nach längeren Verhandlungen, ohne größere Verluste, alles zu regeln. Später kam eine Verfügung, die besagte; wenn
jemand auf seinem Hof nur eine Kuh und ein Pferd hatte, durften sie nicht gepfändet werden. Einige haben ihr Inventar
dieser Verfügung angepasst und dadurch die Zahlung von Grundsteuer umgangen.

Wer seine Steuern pünktlich bezahlt und sein Kontingent an landwirtschaftlichen Produkten fristgerecht abgeliefert hat,
der konnte seine, darüber hinaus erwirtschafteten Produkte zu marktgerechten Preisen verkaufen. Für eine hochtragende
Sterke, mindestens 400 kg schwer, die auf ein staatliches Gut verkauft wurde, konnte man bis zu 12000 Zloty bekommen.
Unsere Böden waren kalkarm, doch durch den Einsatz von Kalk und Kunstdünger konnte man den Ertrag erheblich steigern.
Kalk und Kunstdünger konnte man bei der Genossenschaft(GS) bestellen, der dann auch direkt auf den Hof geliefert wurde.
Kalk wurde geliefert und gleich auf dem Feld ausgestreut. In den 1960ger Jahren waren alle Ackerflächen der Rohmaner
Felder bestellt.
Die nach dem Krieg zurückgebliebenen deutschen Bauernfamilien, aber auch die Polen, die während des Krieges beim Bauern
in Deutschland gearbeitet haben, versuchten mit teils bescheidenen, oder auch zusammen gesuchten, landwirtschaftlichen
Geräten, die bäuerlichen Betriebe aufrecht zu erhalten. Nach den schweren Anfängen in den ersten Nachkriegsjahren
erzielten sie schließlich einen beachtlichen Erfolg, der sich in wogenden Kornfeldern, sowie in grünen Wiesen auf
denen gut genährtes Vieh weidete, widerspiegelte.
Endlich wieder in Freiheit
14 Tage nach unserer Ankunft wurden uns Entlassungspapiere ausgehändigt, sowie auch Fahrscheine
zum den, von uns angegeben Heimatorten. So kam ich nach Krottof, Kreis Oschersleben, zu meinem ehemaligen
Kriegskameraden, bei dem ich einen Tag geblieben bin. Er hatte mir schon eine Stelle bei einem Bauern besorgt, der 70
Jahre alt und kinderlos war. Zum Hof, den er mit seiner Ehefrau bewirtschaftet hat, gehörten 36 Morgen Land, 2 Ochsen
und 3 Kühe. Das Ackerland bestand aus 17 Parzellen und sicherte mir einen Arbeitsplatz.
Jetzt, da ich ein Dach überm Kopf und genug zu essen hatte, fing ich an nach dem Verbleib meiner Familie zu forschen.
Bei meinem letzten Heimaturlaub hatte ich mit meiner Frau verabredet; falls wir uns in den Kriegswirren verlieren
sollten, unsere Kontaktadresse, die meiner Quartiersleute in Burscheid, Kreis Opladen, sein sollte. Ich habe zuerst
nach Rohmanen geschrieben, aber leider keine Antwort erhalten. Dann habe ich nach Burscheid geschrieben, und siehe, -
bei denen lag schon eine Anfrage meiner Frau vor, die nach mir gefragt, und ihre jetzige Anschrift hinterlassen hatte.
Ich habe dem Bauern erzählt dass meine Frau sich zurzeit, auf einem Gut, in Alt Steinhorst, im Kreis Rostock, befindet.
Er war sofort bereit uns ein Zimmer zur Verfügung zu stellen, wenn ich meine Frau nach Krottorf rüberholen wollte. Das
habe ich Ihr mitgeteilt und sie war sofort bereit ihren Wohnsitz nach Krottorf zu verlegen, denn sie wohnte dort in
einem kleinen Stübchen unterm Dach.
Im Herbst, als die Feldarbeit so ziemlich erledigt war, bin ich nach Alt Steinhorst gefahren, um meine Frau und meinen
Sohn Kurt, sowie meinen Sohn Manfred, den ich noch nicht kannte, weil er erst nach der Flucht, am 31. Januar, in Groß
Lüssewitz, geboren wurde, nach Krottorf zu holen. Meine Frau hatte schon Holz für den Winter besorgt und vom Gut, auf
dem sie im Sommer gearbeitet hatte, Mehl und Kartoffeln bekommen. Wir haben das Mehl und andere Habseligkeiten in
Kisten verpackt. Das Holz haben wir einem Bauern gegeben, der uns und unser Gepäck, mit seinem Pferdewagen, zum 14
Kilometer entfernten Bahnhof, nach Ribnitz gebracht hat. Wir sind auch gut in Krottorf angekommen, aber als wir am
nächsten Tag, unsere Kisten vom Bahnhof abholen wollten, haben wir zwar die Kisten vorgefunden, doch der gesamte Inhalt
wurde während der Bahnfahrt entwendet. Die Bahnstation in Krottorf hat die Vorkommnisse zur Kenntnis genommen und
protokolliert, aber unsere Sachen haben wir nie wieder gesehen und mussten wieder bei Null anfangen.
Im Winter musste ich auf der Genossenschaft, unentgeltlich, für die Russen Weizen einsacken. Ich hatte versucht eine
Arbeit als Zimmermann zu bekommen, doch auf dem Arbeitsamt wurde mir gesagt, ich bin Ladwirt und muss auf der
Landwirtschaft arbeiten. Da in den ersten Nachkriegsjahren, auch in der sowjetisch besetzten Zone Arbeitsplätze knapp
waren, mussten auch solche, die einen anderen Beruf erlernt hatten, jede zumutbare Arbeit annehmen. Aus der Heimat
erhielt ich einen Brief, von meiner dort noch lebenden Mutter. Sie schrieb das sie mich noch einmal sehen wollte und
ich sollte doch wieder zurück kommen; Unser Hof wäre nicht von Polen besetzt und sie wäre ganz alleine, weil der Vater
nach dem Durchzug der Front von den Russen erschlagen wurde. Daraufhin habe ich dem polnischen Konsulat in Magdeburg
mitgeteilt, dass ich in Rohmanen eine Landwirtschaft besitze, und um eine Einreisegenehmigung gebeten.
Nach 2 Monaten erhielt ich eine Postkarte, mit der Mitteilung, ich sollte mich persönlich beim Konsulat vorstellen.
Nach Aufnahme meiner Personalien, wurde mir gesagt, das ich benachrichtigt werde wenn mein Antrag genehmigt wird. Ende
Juli 1947 erhielten wir die Einreisegenehmigung nach Ostpreußen, das jetzt unter polnischer Verwaltung stand. Wir
mussten zuerst zum polnischen Konsulat in Berlin-Lichterfelde, wo wir umgeben von einer Trümmerlandschaft, gewartet
haben, bis alle Untersuchungen und Formalitäten erledigt waren.
“ Wieder zurück in Ostpreußen.”
Der schwere Wiederaufbau nach dem Kriege
Dann fuhren wir über Frankfurt/Oder, Posen, Thorn, Allenstein, nach Ortelsburg, wo wir am 2. August 1947 ankamen. Mit
einem zweirädrigen Karren, den ich mir von einem noch in Ortelsburg lebenden Bekanten ausgeliehen hatte und meinem
Sohn Manfred im Kinderwagen fuhren wir nach Rohmanen. Meine Mutter war inzwischen verstorben und auf dem Hof war nur
meine, inzwischen aus Russischer Gefangenschaft wiedergekehrte Schwester, Frieda Pelkowski.

Es war alles ausgeplündert; kein Vieh, keine Maschinen und der ganze Hof mit kniehohem Graß überwachsen. Nur schmale
Trampelpfade, vom Haus zum Holzschuppen und zum Klo, durchkreuzten das satte Grün. Ich habe das Gras auf dem Hof mit
einer Sense, die ich noch gefunden habe, abgemäht, damit der Hof nicht so verwahrlost aussah. Am nächsten Tag habe ich
mich bei der Polizei in Ortelsburg angemeldet, wo ich auch ein Startgeld von 100 Zloty erhielt und Gepäckstücke, die
ich in Krottorf aufgegeben, am Bahnhof abgeholt. Es hat mich sehr gewundert das, das Gepäck überhaupt angekommen ist.
Da man von der Landwirtschaft nicht Leben konnte, habe ich mich in den nächsten Tagen, bei der jetzt polnischen Bahn,
um Arbeit beworben und wurde auch angenommen. Wenn wir unseren Monatslohn bekamen, saß immer einer am Tisch, der von
uns 100 Zloty für den Wiederaufbau von Warschau verlangte. Wenn ich dran war, riefen die Anderen, ich hätte Warschau
zerstört und müsste deshalb 200 Zloty abgeben. Nach 3 Jahren kam eine Verfügung, die besagte, dass wer länger als 1
Jahr bei der Bahn beschäftigt ist, angestellt werden muss. Um diese Bestimmung zu umgehen hat man mich entlassen und
eine Woche später wieder eingestellt.
Als ich vor Ablauf des nächsten Jahres, aus dem gleichen Grunde wieder entlassen wurde, habe ich mich bei der
Stadtverwaltung in Ortelsburg(jetzt Szczytno)beworben, wo ich zuerst im Gaswerk als Heizer und später auf Baustellen
als Zimmermann gearbeitet habe. Wir haben durch den Krieg beschädigte Häuser repariert, in den ehemals touristischen
Zentren einige Ausbesserungen an den Einrichtungen durchgeführt, eine Ziegelei wieder in Betrieb gesetzt und andere
anfallende Arbeiten verrichtet. Im Dach des Rathausturmes war während der Kämpfe eine Granate eingeschlagen, die, die
Dachlatten und die Verschalung zerstört hatte. Da wir, unter schwersten Bedingungen, den Schaden repariert haben,
wurde uns eine Höhenzulage versprochen, die wir aber nicht bekommen haben.
Aus Verärgerung darüber habe ich bei der Stadtverwaltung gekündigt und bei einer Wiederaufbaufirma unter der Leitung
von Bauingenieur Laskowski wieder angefangen, wo ich bis 1954, als Zimmermann beschäftigt war. Ab da habe ich mich
nur um meinen Hof gekümmert, der wegen meiner Arbeitsstellen, gezwungenermaßen, sehr vernachlässigt wurde. Als wir
1947 zurückkamen, brachten wir unseren Sohn Manfred noch im Kinderwagen. Den hat meine Frau zum Markt gebracht,
verkauft, und dafür eine Ziege erworben, die dank guter Pflege, uns täglich mit 4 Liter Milch versorgte. Das war der
erste Baustein zum Wiederaufbau, unserer durch den Krieg zerstörten, und danach ausgeplünderten Landwirtschaft.
Während meiner Arbeit bei der Bahn haben wir uns eine Kuh gekauft, die nach einem halben Jahr, wegen nicht bezahlter
Grundsteuer, vom Gerichtsvollzieher gepfändet wurde. Man hat uns die Kuh weggenommen und bei einem Arbeiter, der in
der Ernst-Mey-Straße in Ortelsburg wohnte und sie wegen nicht vorhandener Futtermittel, nur mit Kartoffelkraut
gefüttert hat, untergestellt. Als ich bei der Bahn meinen Monatslohn bekommen habe, bin ich zur Gmina gegangen, habe
eine Rate angezahlt und durfte dann die Kuh wieder mit nach Hause nehmen. Durch die schlechte Ernährung war die Kuh
stark abgemagert und lieferte nur die Hälfte der ursprünglichen Milchleistung.
Später habe ich ein Pferd auf Abzahlung bekommen, das 140.000 alte Zloty gekostet hat. Die Stute war schwach und unser
Feld sehr hügelig, so dass man nur bergab pflügen konnte, was sehr beschwerlich war, bergauf ging es immer im Leerlauf.
Später habe ich die schweren Böden mit dem Traktor umpflügen, und in den letzten Jahren auch mit dem Binder mähen
lassen. Von der Stute habe ich 2 schöne Fohlen gezogen; ein davon habe ich bei der Ausreise in die Bundesrepublik
mitgebracht und bei der Viehverwertungs-Genossenschaft in Göttingen verkauft. In den ersten Nachkriegsjahren als noch
wenig Land bestellt wurde, breiteten sich auf den nicht beackerten Flächen, Wildkräuter aus. Disteln und andere
Schnellwachsende, erreichten manchmal eine Höhe von 2 Meter, besonders auf den schweren Böden.
Es hat viel Schweiß gekostet ehe man den Acker soweit hatte, das er auch befriedigende Erträge abwarf. Die
Währungsreform von 1950, hat unser weiniges Geld das wir schon gespart hatten, wieder vernichtet. Ich hatte 2 Pferde,
1 Fohlen, 2 Kühe und Schweine, als ich wieder aufgefordert wurde nicht bezahlte Grundsteuern nachzuzahlen. Als ich
nicht bezahlen konnte, hat der Vollziehungsbeamte, ein Fohlen, eine Kuh und ein Schwein gepfändet. Es gelang mir jedoch
nach längeren Verhandlungen, ohne größere Verluste, alles zu regeln. Später kam eine Verfügung, die besagte; wenn
jemand auf seinem Hof nur eine Kuh und ein Pferd hatte, durften sie nicht gepfändet werden. Einige haben ihr Inventar
dieser Verfügung angepasst und dadurch die Zahlung von Grundsteuer umgangen.

Wer seine Steuern pünktlich bezahlt und sein Kontingent an landwirtschaftlichen Produkten fristgerecht abgeliefert hat,
der konnte seine, darüber hinaus erwirtschafteten Produkte zu marktgerechten Preisen verkaufen. Für eine hochtragende
Sterke, mindestens 400 kg schwer, die auf ein staatliches Gut verkauft wurde, konnte man bis zu 12000 Zloty bekommen.
Unsere Böden waren kalkarm, doch durch den Einsatz von Kalk und Kunstdünger konnte man den Ertrag erheblich steigern.
Kalk und Kunstdünger konnte man bei der Genossenschaft(GS) bestellen, der dann auch direkt auf den Hof geliefert wurde.
Kalk wurde geliefert und gleich auf dem Feld ausgestreut. In den 1960ger Jahren waren alle Ackerflächen der Rohmaner
Felder bestellt.
Die nach dem Krieg zurückgebliebenen deutschen Bauernfamilien, aber auch die Polen, die während des Krieges beim Bauern
in Deutschland gearbeitet haben, versuchten mit teils bescheidenen, oder auch zusammen gesuchten, landwirtschaftlichen
Geräten, die bäuerlichen Betriebe aufrecht zu erhalten. Nach den schweren Anfängen in den ersten Nachkriegsjahren
erzielten sie schließlich einen beachtlichen Erfolg, der sich in wogenden Kornfeldern, sowie in grünen Wiesen auf
denen gut genährtes Vieh weidete, widerspiegelte.
Jetzt, da ich ein Dach überm Kopf und genug zu essen hatte, fing ich an nach dem Verbleib meiner Familie zu forschen.
Bei meinem letzten Heimaturlaub hatte ich mit meiner Frau verabredet; falls wir uns in den Kriegswirren verlieren
sollten, unsere Kontaktadresse, die meiner Quartiersleute in Burscheid, Kreis Opladen, sein sollte. Ich habe zuerst
nach Rohmanen geschrieben, aber leider keine Antwort erhalten. Dann habe ich nach Burscheid geschrieben, und siehe, -
bei denen lag schon eine Anfrage meiner Frau vor, die nach mir gefragt, und ihre jetzige Anschrift hinterlassen hatte.
Ich habe dem Bauern erzählt dass meine Frau sich zurzeit, auf einem Gut, in Alt Steinhorst, im Kreis Rostock, befindet.
Er war sofort bereit uns ein Zimmer zur Verfügung zu stellen, wenn ich meine Frau nach Krottorf rüberholen wollte. Das
habe ich Ihr mitgeteilt und sie war sofort bereit ihren Wohnsitz nach Krottorf zu verlegen, denn sie wohnte dort in
einem kleinen Stübchen unterm Dach.
Im Herbst, als die Feldarbeit so ziemlich erledigt war, bin ich nach Alt Steinhorst gefahren, um meine Frau und meinen
Sohn Kurt, sowie meinen Sohn Manfred, den ich noch nicht kannte, weil er erst nach der Flucht, am 31. Januar, in Groß
Lüssewitz, geboren wurde, nach Krottorf zu holen. Meine Frau hatte schon Holz für den Winter besorgt und vom Gut, auf
dem sie im Sommer gearbeitet hatte, Mehl und Kartoffeln bekommen. Wir haben das Mehl und andere Habseligkeiten in
Kisten verpackt. Das Holz haben wir einem Bauern gegeben, der uns und unser Gepäck, mit seinem Pferdewagen, zum 14
Kilometer entfernten Bahnhof, nach Ribnitz gebracht hat. Wir sind auch gut in Krottorf angekommen, aber als wir am
nächsten Tag, unsere Kisten vom Bahnhof abholen wollten, haben wir zwar die Kisten vorgefunden, doch der gesamte Inhalt
wurde während der Bahnfahrt entwendet. Die Bahnstation in Krottorf hat die Vorkommnisse zur Kenntnis genommen und
protokolliert, aber unsere Sachen haben wir nie wieder gesehen und mussten wieder bei Null anfangen.
Im Winter musste ich auf der Genossenschaft, unentgeltlich, für die Russen Weizen einsacken. Ich hatte versucht eine
Arbeit als Zimmermann zu bekommen, doch auf dem Arbeitsamt wurde mir gesagt, ich bin Ladwirt und muss auf der
Landwirtschaft arbeiten. Da in den ersten Nachkriegsjahren, auch in der sowjetisch besetzten Zone Arbeitsplätze knapp
waren, mussten auch solche, die einen anderen Beruf erlernt hatten, jede zumutbare Arbeit annehmen. Aus der Heimat
erhielt ich einen Brief, von meiner dort noch lebenden Mutter. Sie schrieb das sie mich noch einmal sehen wollte und
ich sollte doch wieder zurück kommen; Unser Hof wäre nicht von Polen besetzt und sie wäre ganz alleine, weil der Vater
nach dem Durchzug der Front von den Russen erschlagen wurde. Daraufhin habe ich dem polnischen Konsulat in Magdeburg
mitgeteilt, dass ich in Rohmanen eine Landwirtschaft besitze, und um eine Einreisegenehmigung gebeten.
Nach 2 Monaten erhielt ich eine Postkarte, mit der Mitteilung, ich sollte mich persönlich beim Konsulat vorstellen.
Nach Aufnahme meiner Personalien, wurde mir gesagt, das ich benachrichtigt werde wenn mein Antrag genehmigt wird. Ende
Juli 1947 erhielten wir die Einreisegenehmigung nach Ostpreußen, das jetzt unter polnischer Verwaltung stand. Wir
mussten zuerst zum polnischen Konsulat in Berlin-Lichterfelde, wo wir umgeben von einer Trümmerlandschaft, gewartet
haben, bis alle Untersuchungen und Formalitäten erledigt waren.
Im Winter musste ich auf der Genossenschaft, unentgeltlich, für die Russen Weizen einsacken. Ich hatte versucht eine
Arbeit als Zimmermann zu bekommen, doch auf dem Arbeitsamt wurde mir gesagt, ich bin Ladwirt und muss auf der
Landwirtschaft arbeiten. Da in den ersten Nachkriegsjahren, auch in der sowjetisch besetzten Zone Arbeitsplätze knapp
waren, mussten auch solche, die einen anderen Beruf erlernt hatten, jede zumutbare Arbeit annehmen. Aus der Heimat
erhielt ich einen Brief, von meiner dort noch lebenden Mutter. Sie schrieb das sie mich noch einmal sehen wollte und
ich sollte doch wieder zurück kommen; Unser Hof wäre nicht von Polen besetzt und sie wäre ganz alleine, weil der Vater
nach dem Durchzug der Front von den Russen erschlagen wurde. Daraufhin habe ich dem polnischen Konsulat in Magdeburg
mitgeteilt, dass ich in Rohmanen eine Landwirtschaft besitze, und um eine Einreisegenehmigung gebeten.
Nach 2 Monaten erhielt ich eine Postkarte, mit der Mitteilung, ich sollte mich persönlich beim Konsulat vorstellen.
Nach Aufnahme meiner Personalien, wurde mir gesagt, das ich benachrichtigt werde wenn mein Antrag genehmigt wird. Ende
Juli 1947 erhielten wir die Einreisegenehmigung nach Ostpreußen, das jetzt unter polnischer Verwaltung stand. Wir
mussten zuerst zum polnischen Konsulat in Berlin-Lichterfelde, wo wir umgeben von einer Trümmerlandschaft, gewartet
haben, bis alle Untersuchungen und Formalitäten erledigt waren.
“ Wieder zurück in Ostpreußen.”
Der schwere Wiederaufbau nach dem Kriege
Dann fuhren wir über Frankfurt/Oder, Posen, Thorn, Allenstein, nach Ortelsburg, wo wir am 2. August 1947 ankamen. Mit
einem zweirädrigen Karren, den ich mir von einem noch in Ortelsburg lebenden Bekanten ausgeliehen hatte und meinem
Sohn Manfred im Kinderwagen fuhren wir nach Rohmanen. Meine Mutter war inzwischen verstorben und auf dem Hof war nur
meine, inzwischen aus Russischer Gefangenschaft wiedergekehrte Schwester, Frieda Pelkowski.

Es war alles ausgeplündert; kein Vieh, keine Maschinen und der ganze Hof mit kniehohem Graß überwachsen. Nur schmale
Trampelpfade, vom Haus zum Holzschuppen und zum Klo, durchkreuzten das satte Grün. Ich habe das Gras auf dem Hof mit
einer Sense, die ich noch gefunden habe, abgemäht, damit der Hof nicht so verwahrlost aussah. Am nächsten Tag habe ich
mich bei der Polizei in Ortelsburg angemeldet, wo ich auch ein Startgeld von 100 Zloty erhielt und Gepäckstücke, die
ich in Krottorf aufgegeben, am Bahnhof abgeholt. Es hat mich sehr gewundert das, das Gepäck überhaupt angekommen ist.
Da man von der Landwirtschaft nicht Leben konnte, habe ich mich in den nächsten Tagen, bei der jetzt polnischen Bahn,
um Arbeit beworben und wurde auch angenommen. Wenn wir unseren Monatslohn bekamen, saß immer einer am Tisch, der von
uns 100 Zloty für den Wiederaufbau von Warschau verlangte. Wenn ich dran war, riefen die Anderen, ich hätte Warschau
zerstört und müsste deshalb 200 Zloty abgeben. Nach 3 Jahren kam eine Verfügung, die besagte, dass wer länger als 1
Jahr bei der Bahn beschäftigt ist, angestellt werden muss. Um diese Bestimmung zu umgehen hat man mich entlassen und
eine Woche später wieder eingestellt.
Als ich vor Ablauf des nächsten Jahres, aus dem gleichen Grunde wieder entlassen wurde, habe ich mich bei der
Stadtverwaltung in Ortelsburg(jetzt Szczytno)beworben, wo ich zuerst im Gaswerk als Heizer und später auf Baustellen
als Zimmermann gearbeitet habe. Wir haben durch den Krieg beschädigte Häuser repariert, in den ehemals touristischen
Zentren einige Ausbesserungen an den Einrichtungen durchgeführt, eine Ziegelei wieder in Betrieb gesetzt und andere
anfallende Arbeiten verrichtet. Im Dach des Rathausturmes war während der Kämpfe eine Granate eingeschlagen, die, die
Dachlatten und die Verschalung zerstört hatte. Da wir, unter schwersten Bedingungen, den Schaden repariert haben,
wurde uns eine Höhenzulage versprochen, die wir aber nicht bekommen haben.
Aus Verärgerung darüber habe ich bei der Stadtverwaltung gekündigt und bei einer Wiederaufbaufirma unter der Leitung
von Bauingenieur Laskowski wieder angefangen, wo ich bis 1954, als Zimmermann beschäftigt war. Ab da habe ich mich
nur um meinen Hof gekümmert, der wegen meiner Arbeitsstellen, gezwungenermaßen, sehr vernachlässigt wurde. Als wir
1947 zurückkamen, brachten wir unseren Sohn Manfred noch im Kinderwagen. Den hat meine Frau zum Markt gebracht,
verkauft, und dafür eine Ziege erworben, die dank guter Pflege, uns täglich mit 4 Liter Milch versorgte. Das war der
erste Baustein zum Wiederaufbau, unserer durch den Krieg zerstörten, und danach ausgeplünderten Landwirtschaft.
Während meiner Arbeit bei der Bahn haben wir uns eine Kuh gekauft, die nach einem halben Jahr, wegen nicht bezahlter
Grundsteuer, vom Gerichtsvollzieher gepfändet wurde. Man hat uns die Kuh weggenommen und bei einem Arbeiter, der in
der Ernst-Mey-Straße in Ortelsburg wohnte und sie wegen nicht vorhandener Futtermittel, nur mit Kartoffelkraut
gefüttert hat, untergestellt. Als ich bei der Bahn meinen Monatslohn bekommen habe, bin ich zur Gmina gegangen, habe
eine Rate angezahlt und durfte dann die Kuh wieder mit nach Hause nehmen. Durch die schlechte Ernährung war die Kuh
stark abgemagert und lieferte nur die Hälfte der ursprünglichen Milchleistung.
Später habe ich ein Pferd auf Abzahlung bekommen, das 140.000 alte Zloty gekostet hat. Die Stute war schwach und unser
Feld sehr hügelig, so dass man nur bergab pflügen konnte, was sehr beschwerlich war, bergauf ging es immer im Leerlauf.
Später habe ich die schweren Böden mit dem Traktor umpflügen, und in den letzten Jahren auch mit dem Binder mähen
lassen. Von der Stute habe ich 2 schöne Fohlen gezogen; ein davon habe ich bei der Ausreise in die Bundesrepublik
mitgebracht und bei der Viehverwertungs-Genossenschaft in Göttingen verkauft. In den ersten Nachkriegsjahren als noch
wenig Land bestellt wurde, breiteten sich auf den nicht beackerten Flächen, Wildkräuter aus. Disteln und andere
Schnellwachsende, erreichten manchmal eine Höhe von 2 Meter, besonders auf den schweren Böden.
Es hat viel Schweiß gekostet ehe man den Acker soweit hatte, das er auch befriedigende Erträge abwarf. Die
Währungsreform von 1950, hat unser weiniges Geld das wir schon gespart hatten, wieder vernichtet. Ich hatte 2 Pferde,
1 Fohlen, 2 Kühe und Schweine, als ich wieder aufgefordert wurde nicht bezahlte Grundsteuern nachzuzahlen. Als ich
nicht bezahlen konnte, hat der Vollziehungsbeamte, ein Fohlen, eine Kuh und ein Schwein gepfändet. Es gelang mir jedoch
nach längeren Verhandlungen, ohne größere Verluste, alles zu regeln. Später kam eine Verfügung, die besagte; wenn
jemand auf seinem Hof nur eine Kuh und ein Pferd hatte, durften sie nicht gepfändet werden. Einige haben ihr Inventar
dieser Verfügung angepasst und dadurch die Zahlung von Grundsteuer umgangen.

Wer seine Steuern pünktlich bezahlt und sein Kontingent an landwirtschaftlichen Produkten fristgerecht abgeliefert hat,
der konnte seine, darüber hinaus erwirtschafteten Produkte zu marktgerechten Preisen verkaufen. Für eine hochtragende
Sterke, mindestens 400 kg schwer, die auf ein staatliches Gut verkauft wurde, konnte man bis zu 12000 Zloty bekommen.
Unsere Böden waren kalkarm, doch durch den Einsatz von Kalk und Kunstdünger konnte man den Ertrag erheblich steigern.
Kalk und Kunstdünger konnte man bei der Genossenschaft(GS) bestellen, der dann auch direkt auf den Hof geliefert wurde.
Kalk wurde geliefert und gleich auf dem Feld ausgestreut. In den 1960ger Jahren waren alle Ackerflächen der Rohmaner
Felder bestellt.
Die nach dem Krieg zurückgebliebenen deutschen Bauernfamilien, aber auch die Polen, die während des Krieges beim Bauern
in Deutschland gearbeitet haben, versuchten mit teils bescheidenen, oder auch zusammen gesuchten, landwirtschaftlichen
Geräten, die bäuerlichen Betriebe aufrecht zu erhalten. Nach den schweren Anfängen in den ersten Nachkriegsjahren
erzielten sie schließlich einen beachtlichen Erfolg, der sich in wogenden Kornfeldern, sowie in grünen Wiesen auf
denen gut genährtes Vieh weidete, widerspiegelte.
Dann fuhren wir über Frankfurt/Oder, Posen, Thorn, Allenstein, nach Ortelsburg, wo wir am 2. August 1947 ankamen. Mit
einem zweirädrigen Karren, den ich mir von einem noch in Ortelsburg lebenden Bekanten ausgeliehen hatte und meinem
Sohn Manfred im Kinderwagen fuhren wir nach Rohmanen. Meine Mutter war inzwischen verstorben und auf dem Hof war nur
meine, inzwischen aus Russischer Gefangenschaft wiedergekehrte Schwester, Frieda Pelkowski.

Es war alles ausgeplündert; kein Vieh, keine Maschinen und der ganze Hof mit kniehohem Graß überwachsen. Nur schmale
Trampelpfade, vom Haus zum Holzschuppen und zum Klo, durchkreuzten das satte Grün. Ich habe das Gras auf dem Hof mit
einer Sense, die ich noch gefunden habe, abgemäht, damit der Hof nicht so verwahrlost aussah. Am nächsten Tag habe ich
mich bei der Polizei in Ortelsburg angemeldet, wo ich auch ein Startgeld von 100 Zloty erhielt und Gepäckstücke, die
ich in Krottorf aufgegeben, am Bahnhof abgeholt. Es hat mich sehr gewundert das, das Gepäck überhaupt angekommen ist.
Da man von der Landwirtschaft nicht Leben konnte, habe ich mich in den nächsten Tagen, bei der jetzt polnischen Bahn,
um Arbeit beworben und wurde auch angenommen. Wenn wir unseren Monatslohn bekamen, saß immer einer am Tisch, der von
uns 100 Zloty für den Wiederaufbau von Warschau verlangte. Wenn ich dran war, riefen die Anderen, ich hätte Warschau
zerstört und müsste deshalb 200 Zloty abgeben. Nach 3 Jahren kam eine Verfügung, die besagte, dass wer länger als 1
Jahr bei der Bahn beschäftigt ist, angestellt werden muss. Um diese Bestimmung zu umgehen hat man mich entlassen und
eine Woche später wieder eingestellt.
Als ich vor Ablauf des nächsten Jahres, aus dem gleichen Grunde wieder entlassen wurde, habe ich mich bei der
Stadtverwaltung in Ortelsburg(jetzt Szczytno)beworben, wo ich zuerst im Gaswerk als Heizer und später auf Baustellen
als Zimmermann gearbeitet habe. Wir haben durch den Krieg beschädigte Häuser repariert, in den ehemals touristischen
Zentren einige Ausbesserungen an den Einrichtungen durchgeführt, eine Ziegelei wieder in Betrieb gesetzt und andere
anfallende Arbeiten verrichtet. Im Dach des Rathausturmes war während der Kämpfe eine Granate eingeschlagen, die, die
Dachlatten und die Verschalung zerstört hatte. Da wir, unter schwersten Bedingungen, den Schaden repariert haben,
wurde uns eine Höhenzulage versprochen, die wir aber nicht bekommen haben.
Aus Verärgerung darüber habe ich bei der Stadtverwaltung gekündigt und bei einer Wiederaufbaufirma unter der Leitung
von Bauingenieur Laskowski wieder angefangen, wo ich bis 1954, als Zimmermann beschäftigt war. Ab da habe ich mich
nur um meinen Hof gekümmert, der wegen meiner Arbeitsstellen, gezwungenermaßen, sehr vernachlässigt wurde. Als wir
1947 zurückkamen, brachten wir unseren Sohn Manfred noch im Kinderwagen. Den hat meine Frau zum Markt gebracht,
verkauft, und dafür eine Ziege erworben, die dank guter Pflege, uns täglich mit 4 Liter Milch versorgte. Das war der
erste Baustein zum Wiederaufbau, unserer durch den Krieg zerstörten, und danach ausgeplünderten Landwirtschaft.
Während meiner Arbeit bei der Bahn haben wir uns eine Kuh gekauft, die nach einem halben Jahr, wegen nicht bezahlter
Grundsteuer, vom Gerichtsvollzieher gepfändet wurde. Man hat uns die Kuh weggenommen und bei einem Arbeiter, der in
der Ernst-Mey-Straße in Ortelsburg wohnte und sie wegen nicht vorhandener Futtermittel, nur mit Kartoffelkraut
gefüttert hat, untergestellt. Als ich bei der Bahn meinen Monatslohn bekommen habe, bin ich zur Gmina gegangen, habe
eine Rate angezahlt und durfte dann die Kuh wieder mit nach Hause nehmen. Durch die schlechte Ernährung war die Kuh
stark abgemagert und lieferte nur die Hälfte der ursprünglichen Milchleistung.
Später habe ich ein Pferd auf Abzahlung bekommen, das 140.000 alte Zloty gekostet hat. Die Stute war schwach und unser
Feld sehr hügelig, so dass man nur bergab pflügen konnte, was sehr beschwerlich war, bergauf ging es immer im Leerlauf.
Später habe ich die schweren Böden mit dem Traktor umpflügen, und in den letzten Jahren auch mit dem Binder mähen
lassen. Von der Stute habe ich 2 schöne Fohlen gezogen; ein davon habe ich bei der Ausreise in die Bundesrepublik
mitgebracht und bei der Viehverwertungs-Genossenschaft in Göttingen verkauft. In den ersten Nachkriegsjahren als noch
wenig Land bestellt wurde, breiteten sich auf den nicht beackerten Flächen, Wildkräuter aus. Disteln und andere
Schnellwachsende, erreichten manchmal eine Höhe von 2 Meter, besonders auf den schweren Böden.
Es hat viel Schweiß gekostet ehe man den Acker soweit hatte, das er auch befriedigende Erträge abwarf. Die
Währungsreform von 1950, hat unser weiniges Geld das wir schon gespart hatten, wieder vernichtet. Ich hatte 2 Pferde,
1 Fohlen, 2 Kühe und Schweine, als ich wieder aufgefordert wurde nicht bezahlte Grundsteuern nachzuzahlen. Als ich
nicht bezahlen konnte, hat der Vollziehungsbeamte, ein Fohlen, eine Kuh und ein Schwein gepfändet. Es gelang mir jedoch
nach längeren Verhandlungen, ohne größere Verluste, alles zu regeln. Später kam eine Verfügung, die besagte; wenn
jemand auf seinem Hof nur eine Kuh und ein Pferd hatte, durften sie nicht gepfändet werden. Einige haben ihr Inventar
dieser Verfügung angepasst und dadurch die Zahlung von Grundsteuer umgangen.

Wer seine Steuern pünktlich bezahlt und sein Kontingent an landwirtschaftlichen Produkten fristgerecht abgeliefert hat,
der konnte seine, darüber hinaus erwirtschafteten Produkte zu marktgerechten Preisen verkaufen. Für eine hochtragende
Sterke, mindestens 400 kg schwer, die auf ein staatliches Gut verkauft wurde, konnte man bis zu 12000 Zloty bekommen.
Unsere Böden waren kalkarm, doch durch den Einsatz von Kalk und Kunstdünger konnte man den Ertrag erheblich steigern.
Kalk und Kunstdünger konnte man bei der Genossenschaft(GS) bestellen, der dann auch direkt auf den Hof geliefert wurde.
Kalk wurde geliefert und gleich auf dem Feld ausgestreut. In den 1960ger Jahren waren alle Ackerflächen der Rohmaner
Felder bestellt.
Die nach dem Krieg zurückgebliebenen deutschen Bauernfamilien, aber auch die Polen, die während des Krieges beim Bauern
in Deutschland gearbeitet haben, versuchten mit teils bescheidenen, oder auch zusammen gesuchten, landwirtschaftlichen
Geräten, die bäuerlichen Betriebe aufrecht zu erhalten. Nach den schweren Anfängen in den ersten Nachkriegsjahren
erzielten sie schließlich einen beachtlichen Erfolg, der sich in wogenden Kornfeldern, sowie in grünen Wiesen auf
denen gut genährtes Vieh weidete, widerspiegelte.
Da man von der Landwirtschaft nicht Leben konnte, habe ich mich in den nächsten Tagen, bei der jetzt polnischen Bahn,
um Arbeit beworben und wurde auch angenommen. Wenn wir unseren Monatslohn bekamen, saß immer einer am Tisch, der von
uns 100 Zloty für den Wiederaufbau von Warschau verlangte. Wenn ich dran war, riefen die Anderen, ich hätte Warschau
zerstört und müsste deshalb 200 Zloty abgeben. Nach 3 Jahren kam eine Verfügung, die besagte, dass wer länger als 1
Jahr bei der Bahn beschäftigt ist, angestellt werden muss. Um diese Bestimmung zu umgehen hat man mich entlassen und
eine Woche später wieder eingestellt.
Als ich vor Ablauf des nächsten Jahres, aus dem gleichen Grunde wieder entlassen wurde, habe ich mich bei der
Stadtverwaltung in Ortelsburg(jetzt Szczytno)beworben, wo ich zuerst im Gaswerk als Heizer und später auf Baustellen
als Zimmermann gearbeitet habe. Wir haben durch den Krieg beschädigte Häuser repariert, in den ehemals touristischen
Zentren einige Ausbesserungen an den Einrichtungen durchgeführt, eine Ziegelei wieder in Betrieb gesetzt und andere
anfallende Arbeiten verrichtet. Im Dach des Rathausturmes war während der Kämpfe eine Granate eingeschlagen, die, die
Dachlatten und die Verschalung zerstört hatte. Da wir, unter schwersten Bedingungen, den Schaden repariert haben,
wurde uns eine Höhenzulage versprochen, die wir aber nicht bekommen haben.
Aus Verärgerung darüber habe ich bei der Stadtverwaltung gekündigt und bei einer Wiederaufbaufirma unter der Leitung
von Bauingenieur Laskowski wieder angefangen, wo ich bis 1954, als Zimmermann beschäftigt war. Ab da habe ich mich
nur um meinen Hof gekümmert, der wegen meiner Arbeitsstellen, gezwungenermaßen, sehr vernachlässigt wurde. Als wir
1947 zurückkamen, brachten wir unseren Sohn Manfred noch im Kinderwagen. Den hat meine Frau zum Markt gebracht,
verkauft, und dafür eine Ziege erworben, die dank guter Pflege, uns täglich mit 4 Liter Milch versorgte. Das war der
erste Baustein zum Wiederaufbau, unserer durch den Krieg zerstörten, und danach ausgeplünderten Landwirtschaft.
Während meiner Arbeit bei der Bahn haben wir uns eine Kuh gekauft, die nach einem halben Jahr, wegen nicht bezahlter
Grundsteuer, vom Gerichtsvollzieher gepfändet wurde. Man hat uns die Kuh weggenommen und bei einem Arbeiter, der in
der Ernst-Mey-Straße in Ortelsburg wohnte und sie wegen nicht vorhandener Futtermittel, nur mit Kartoffelkraut
gefüttert hat, untergestellt. Als ich bei der Bahn meinen Monatslohn bekommen habe, bin ich zur Gmina gegangen, habe
eine Rate angezahlt und durfte dann die Kuh wieder mit nach Hause nehmen. Durch die schlechte Ernährung war die Kuh
stark abgemagert und lieferte nur die Hälfte der ursprünglichen Milchleistung.
Später habe ich ein Pferd auf Abzahlung bekommen, das 140.000 alte Zloty gekostet hat. Die Stute war schwach und unser
Feld sehr hügelig, so dass man nur bergab pflügen konnte, was sehr beschwerlich war, bergauf ging es immer im Leerlauf.
Später habe ich die schweren Böden mit dem Traktor umpflügen, und in den letzten Jahren auch mit dem Binder mähen
lassen. Von der Stute habe ich 2 schöne Fohlen gezogen; ein davon habe ich bei der Ausreise in die Bundesrepublik
mitgebracht und bei der Viehverwertungs-Genossenschaft in Göttingen verkauft. In den ersten Nachkriegsjahren als noch
wenig Land bestellt wurde, breiteten sich auf den nicht beackerten Flächen, Wildkräuter aus. Disteln und andere
Schnellwachsende, erreichten manchmal eine Höhe von 2 Meter, besonders auf den schweren Böden.
Es hat viel Schweiß gekostet ehe man den Acker soweit hatte, das er auch befriedigende Erträge abwarf. Die
Währungsreform von 1950, hat unser weiniges Geld das wir schon gespart hatten, wieder vernichtet. Ich hatte 2 Pferde,
1 Fohlen, 2 Kühe und Schweine, als ich wieder aufgefordert wurde nicht bezahlte Grundsteuern nachzuzahlen. Als ich
nicht bezahlen konnte, hat der Vollziehungsbeamte, ein Fohlen, eine Kuh und ein Schwein gepfändet. Es gelang mir jedoch
nach längeren Verhandlungen, ohne größere Verluste, alles zu regeln. Später kam eine Verfügung, die besagte; wenn
jemand auf seinem Hof nur eine Kuh und ein Pferd hatte, durften sie nicht gepfändet werden. Einige haben ihr Inventar
dieser Verfügung angepasst und dadurch die Zahlung von Grundsteuer umgangen.

Wer seine Steuern pünktlich bezahlt und sein Kontingent an landwirtschaftlichen Produkten fristgerecht abgeliefert hat,
der konnte seine, darüber hinaus erwirtschafteten Produkte zu marktgerechten Preisen verkaufen. Für eine hochtragende
Sterke, mindestens 400 kg schwer, die auf ein staatliches Gut verkauft wurde, konnte man bis zu 12000 Zloty bekommen.
Unsere Böden waren kalkarm, doch durch den Einsatz von Kalk und Kunstdünger konnte man den Ertrag erheblich steigern.
Kalk und Kunstdünger konnte man bei der Genossenschaft(GS) bestellen, der dann auch direkt auf den Hof geliefert wurde.
Kalk wurde geliefert und gleich auf dem Feld ausgestreut. In den 1960ger Jahren waren alle Ackerflächen der Rohmaner
Felder bestellt.
Die nach dem Krieg zurückgebliebenen deutschen Bauernfamilien, aber auch die Polen, die während des Krieges beim Bauern
in Deutschland gearbeitet haben, versuchten mit teils bescheidenen, oder auch zusammen gesuchten, landwirtschaftlichen
Geräten, die bäuerlichen Betriebe aufrecht zu erhalten. Nach den schweren Anfängen in den ersten Nachkriegsjahren
erzielten sie schließlich einen beachtlichen Erfolg, der sich in wogenden Kornfeldern, sowie in grünen Wiesen auf
denen gut genährtes Vieh weidete, widerspiegelte.
Aus Verärgerung darüber habe ich bei der Stadtverwaltung gekündigt und bei einer Wiederaufbaufirma unter der Leitung
von Bauingenieur Laskowski wieder angefangen, wo ich bis 1954, als Zimmermann beschäftigt war. Ab da habe ich mich
nur um meinen Hof gekümmert, der wegen meiner Arbeitsstellen, gezwungenermaßen, sehr vernachlässigt wurde. Als wir
1947 zurückkamen, brachten wir unseren Sohn Manfred noch im Kinderwagen. Den hat meine Frau zum Markt gebracht,
verkauft, und dafür eine Ziege erworben, die dank guter Pflege, uns täglich mit 4 Liter Milch versorgte. Das war der
erste Baustein zum Wiederaufbau, unserer durch den Krieg zerstörten, und danach ausgeplünderten Landwirtschaft.
Während meiner Arbeit bei der Bahn haben wir uns eine Kuh gekauft, die nach einem halben Jahr, wegen nicht bezahlter
Grundsteuer, vom Gerichtsvollzieher gepfändet wurde. Man hat uns die Kuh weggenommen und bei einem Arbeiter, der in
der Ernst-Mey-Straße in Ortelsburg wohnte und sie wegen nicht vorhandener Futtermittel, nur mit Kartoffelkraut
gefüttert hat, untergestellt. Als ich bei der Bahn meinen Monatslohn bekommen habe, bin ich zur Gmina gegangen, habe
eine Rate angezahlt und durfte dann die Kuh wieder mit nach Hause nehmen. Durch die schlechte Ernährung war die Kuh
stark abgemagert und lieferte nur die Hälfte der ursprünglichen Milchleistung.
Später habe ich ein Pferd auf Abzahlung bekommen, das 140.000 alte Zloty gekostet hat. Die Stute war schwach und unser
Feld sehr hügelig, so dass man nur bergab pflügen konnte, was sehr beschwerlich war, bergauf ging es immer im Leerlauf.
Später habe ich die schweren Böden mit dem Traktor umpflügen, und in den letzten Jahren auch mit dem Binder mähen
lassen. Von der Stute habe ich 2 schöne Fohlen gezogen; ein davon habe ich bei der Ausreise in die Bundesrepublik
mitgebracht und bei der Viehverwertungs-Genossenschaft in Göttingen verkauft. In den ersten Nachkriegsjahren als noch
wenig Land bestellt wurde, breiteten sich auf den nicht beackerten Flächen, Wildkräuter aus. Disteln und andere
Schnellwachsende, erreichten manchmal eine Höhe von 2 Meter, besonders auf den schweren Böden.
Es hat viel Schweiß gekostet ehe man den Acker soweit hatte, das er auch befriedigende Erträge abwarf. Die
Währungsreform von 1950, hat unser weiniges Geld das wir schon gespart hatten, wieder vernichtet. Ich hatte 2 Pferde,
1 Fohlen, 2 Kühe und Schweine, als ich wieder aufgefordert wurde nicht bezahlte Grundsteuern nachzuzahlen. Als ich
nicht bezahlen konnte, hat der Vollziehungsbeamte, ein Fohlen, eine Kuh und ein Schwein gepfändet. Es gelang mir jedoch
nach längeren Verhandlungen, ohne größere Verluste, alles zu regeln. Später kam eine Verfügung, die besagte; wenn
jemand auf seinem Hof nur eine Kuh und ein Pferd hatte, durften sie nicht gepfändet werden. Einige haben ihr Inventar
dieser Verfügung angepasst und dadurch die Zahlung von Grundsteuer umgangen.

Wer seine Steuern pünktlich bezahlt und sein Kontingent an landwirtschaftlichen Produkten fristgerecht abgeliefert hat,
der konnte seine, darüber hinaus erwirtschafteten Produkte zu marktgerechten Preisen verkaufen. Für eine hochtragende
Sterke, mindestens 400 kg schwer, die auf ein staatliches Gut verkauft wurde, konnte man bis zu 12000 Zloty bekommen.
Unsere Böden waren kalkarm, doch durch den Einsatz von Kalk und Kunstdünger konnte man den Ertrag erheblich steigern.
Kalk und Kunstdünger konnte man bei der Genossenschaft(GS) bestellen, der dann auch direkt auf den Hof geliefert wurde.
Kalk wurde geliefert und gleich auf dem Feld ausgestreut. In den 1960ger Jahren waren alle Ackerflächen der Rohmaner
Felder bestellt.
Die nach dem Krieg zurückgebliebenen deutschen Bauernfamilien, aber auch die Polen, die während des Krieges beim Bauern
in Deutschland gearbeitet haben, versuchten mit teils bescheidenen, oder auch zusammen gesuchten, landwirtschaftlichen
Geräten, die bäuerlichen Betriebe aufrecht zu erhalten. Nach den schweren Anfängen in den ersten Nachkriegsjahren
erzielten sie schließlich einen beachtlichen Erfolg, der sich in wogenden Kornfeldern, sowie in grünen Wiesen auf
denen gut genährtes Vieh weidete, widerspiegelte.
Später habe ich ein Pferd auf Abzahlung bekommen, das 140.000 alte Zloty gekostet hat. Die Stute war schwach und unser
Feld sehr hügelig, so dass man nur bergab pflügen konnte, was sehr beschwerlich war, bergauf ging es immer im Leerlauf.
Später habe ich die schweren Böden mit dem Traktor umpflügen, und in den letzten Jahren auch mit dem Binder mähen
lassen. Von der Stute habe ich 2 schöne Fohlen gezogen; ein davon habe ich bei der Ausreise in die Bundesrepublik
mitgebracht und bei der Viehverwertungs-Genossenschaft in Göttingen verkauft. In den ersten Nachkriegsjahren als noch
wenig Land bestellt wurde, breiteten sich auf den nicht beackerten Flächen, Wildkräuter aus. Disteln und andere
Schnellwachsende, erreichten manchmal eine Höhe von 2 Meter, besonders auf den schweren Böden.
Es hat viel Schweiß gekostet ehe man den Acker soweit hatte, das er auch befriedigende Erträge abwarf. Die
Währungsreform von 1950, hat unser weiniges Geld das wir schon gespart hatten, wieder vernichtet. Ich hatte 2 Pferde,
1 Fohlen, 2 Kühe und Schweine, als ich wieder aufgefordert wurde nicht bezahlte Grundsteuern nachzuzahlen. Als ich
nicht bezahlen konnte, hat der Vollziehungsbeamte, ein Fohlen, eine Kuh und ein Schwein gepfändet. Es gelang mir jedoch
nach längeren Verhandlungen, ohne größere Verluste, alles zu regeln. Später kam eine Verfügung, die besagte; wenn
jemand auf seinem Hof nur eine Kuh und ein Pferd hatte, durften sie nicht gepfändet werden. Einige haben ihr Inventar
dieser Verfügung angepasst und dadurch die Zahlung von Grundsteuer umgangen.

Wer seine Steuern pünktlich bezahlt und sein Kontingent an landwirtschaftlichen Produkten fristgerecht abgeliefert hat,
der konnte seine, darüber hinaus erwirtschafteten Produkte zu marktgerechten Preisen verkaufen. Für eine hochtragende
Sterke, mindestens 400 kg schwer, die auf ein staatliches Gut verkauft wurde, konnte man bis zu 12000 Zloty bekommen.
Unsere Böden waren kalkarm, doch durch den Einsatz von Kalk und Kunstdünger konnte man den Ertrag erheblich steigern.
Kalk und Kunstdünger konnte man bei der Genossenschaft(GS) bestellen, der dann auch direkt auf den Hof geliefert wurde.
Kalk wurde geliefert und gleich auf dem Feld ausgestreut. In den 1960ger Jahren waren alle Ackerflächen der Rohmaner
Felder bestellt.
Die nach dem Krieg zurückgebliebenen deutschen Bauernfamilien, aber auch die Polen, die während des Krieges beim Bauern
in Deutschland gearbeitet haben, versuchten mit teils bescheidenen, oder auch zusammen gesuchten, landwirtschaftlichen
Geräten, die bäuerlichen Betriebe aufrecht zu erhalten. Nach den schweren Anfängen in den ersten Nachkriegsjahren
erzielten sie schließlich einen beachtlichen Erfolg, der sich in wogenden Kornfeldern, sowie in grünen Wiesen auf
denen gut genährtes Vieh weidete, widerspiegelte.
